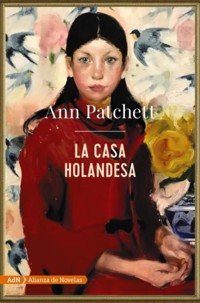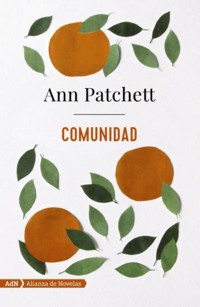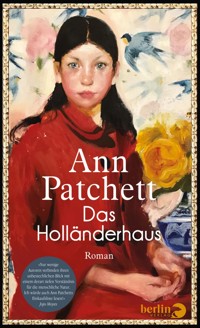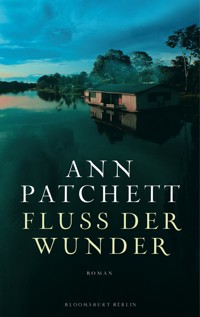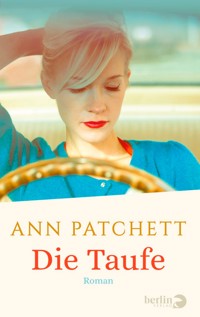12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein unvergessliches Buch über Liebe, Verlust, die Wunder der Freundschaft. Ann Patchett blickt zurück auf die letzten zehn Jahre ihres Lebens, auf ihre Beziehungen zu den Personen und Persönlichkeiten in dieser Zeit. Es geht um ihre Familie (zum Beispiel ihre diversen Väter), um ihren Mann, ihre Freundinnen und Freunde und um ihre Hunde. Es geht um Liebe und Glück, um Mut und Trauer und immer wieder um das Schreiben. Ihre freundliche Weltoffenheit und ihre klugen emotionalen und intellektuellen Einsichten machen aus dieser Sammlung eine kleine Offenbarung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für Maile Meloy
Übersetzung aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel These Precious Days bei HarperCollins, New York
© 2021 by Ann Patchett
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Sooki Raphael
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
VORWORT: Essays sterben nicht
Drei Väter
Das erste Thanksgiving
Das Tattoo von Paris
Mein Jahr ohne Shopping
Der unwürdige Diener
Wie man übt
In der Hundehütte
Eudora Welty, eine Einführung
Wie Stricken mir das Leben gerettet hat – zweimal
Maschen aufnehmen
Muster
Zopfmuster
Abketten
Tavia
Hier gibt es keine Kinder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ein Flugticket ist ein Jahr lang gültig
Der Augenblick, der nichts verändert hat
Das Museen-Museum
Der Nachttisch
Eine Rede vor der Association of Graduate School Deans in the Humanities, dem Verband der Hochschuldekane im Bereich Geisteswissenschaften
Bücher und Umschläge
Kate DiCamillo: eine Würdigung
Schwestern
Zwei Dinge, die ich noch über meinen Vater sagen wollte
Der Lektor
Oder auch nicht
Was mich die American Academy of Arts and Letters über den Tod gelehrt hat
Diese kostbaren Tage
Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
VORWORT: Essays sterben nicht
Ich war sechsundzwanzig und arbeitete an meinem ersten Roman The Patron Saint of Liars (Der Schutzheilige der Lügner), als ich zum ersten Mal ernsthaft über meinen eigenen Tod nachdachte. Immer und überall hatte ich zu jener Zeit das gesamte Figurenkabinett bei mir, es begleitete mich auf Schritt und Tritt – die Heldinnen und Helden, die Nebenfiguren ebenso wie die Städte, in denen sie lebten, ihre Häuser und Autos, all die Straßen und all die Bäume und die Farbe des Lichts. Jeden Tag wurde ein wenig mehr von ihrer Geschichte zu Papier gebracht, doch alles, was noch kommen sollte, existierte nur in meinem Kopf. Denn so arbeite ich: indem ich mir Dinge merke.
Ich hatte keinerlei Gliederung oder Notizen, und deswegen verfolgte mich der Gedanke, ich könnte im falschen Augenblick die Straße überqueren wollen oder im Ozean ertrinken (dieses zweite Szenario erschien realistischer, da ich damals in Provincetown, Massachusetts lebte, wo ich nicht selten Krämpfe bekam, wenn ich im eisigen Wasser schwimmen ging). Falls ich starb, würde die gesamte Welt meines Romans mit mir untergehen – gewiss, für die Literatur kein nennenswerter Verlust, aber die Vorstellung, all diese Seelen in mir zu verlieren, war unerträglich. Für diese Menschen war ich verantwortlich. Ich hatte sie mir ausgedacht, und ich wollte, dass sie ihre Chance bekamen. Das Gespenst meines Todes begleitete mich, bis ich den Roman fertig geschrieben hatte, und als er fertig war, nahm der Tod Urlaub.
Kein Glück währt ewig. Nach den ersten paar Kapiteln meines zweiten Romans war der Tod wieder zur Stelle, um das Gespräch genau dort fortzusetzen, wo wir es unterbrochen hatten. Ich lebte mittlerweile in Montana, einem Bundesstaat, in dem einen der Tod auf vielerlei Art und Weise ereilen konnte, über die ich mir bis dato nie hatte Sorgen machen müssen: Ich könnte auf einem Wanderweg ausrutschen und einen Berghang hinunterstürzen, ein außer Kontrolle geratener Langholzlaster könnte mich überfahren, ich könnte von einem Puma gefressen werden oder von einem Bären. Jeder Gang vor die Haustür war eine Meditation über die Sterblichkeit. Sobald ich aber auf der letzten Seite des Romans anlangte, packte der Tod wortlos seine Sachen. Nie kam mir bei der Überarbeitung des Texts, während des Lektorats, der Fahnenkorrektur, der Lesereise der Gedanke, dass ich im festen Eis des mittlerweile zugefrorenen Flusses einbrechen und davongeschwemmt werden könnte.
Als der Tod sich auf leisen Sohlen zum dritten Mal einstellte, war ich es schon gewohnt. Ich schrieb gerade an meinem dritten Roman und hatte inzwischen genug Erfahrung, um das Muster zu erkennen.
Mein Leben als Autorin ist bis heute von dieser durch Unterbrechungen gekennzeichneten Beziehung geprägt, und so seltsam es auch scheinen mag, war und bin ich nicht die Einzige mit diesem Problem. Eine Freundin schickt mir, ehe sie eine Flugreise antritt, eine Beschreibung, wo in ihrem Haus sie einen USB-Stick mit den Dateien ihres noch unvollendeten Romans versteckt hat, eine andere Freundin fragt an, ob ich wohl das Buch für sie zu Ende schreiben könnte, falls sie sterben würde. »Ich habe ein Post-it an meinem Computer hinterlassen«, erklärt sie mir, »auf dem steht, dass du das Ende schreibst.«
Autoren, die zu Beginn der Pandemie bereits mit einem Projekt beschäftigt waren, kamen in der Folgezeit gut damit voran, während jene von uns, die mit ihrer Arbeit noch ganz am Anfang waren oder noch gar nicht damit begonnen hatten, regelrecht ausgebremst wurden; so jedenfalls das Ergebnis meiner kleinen, ganz unwissenschaftlichen Studie. Diesmal hatte der Tod mich überrumpelt; ich hatte Angst vor ihm, ehe mir überhaupt eine ganz ausgeformte Idee für einen Roman gekommen war. Was für einen Sinn hatte es, mit etwas anzufangen, wenn ich nicht mehr lang genug lebte, um es abzuschließen? Was nicht unbedingt hieß, dass ich dachte, ich würde am Coronavirus sterben, ebenso wie ich nie ernsthaft damit gerechnet hatte, im Meer zu ertrinken oder von einem Bären gefressen zu werden, aber völlig auszuschließen waren diese Szenarien nicht. Das Jahr 2020 schien nicht gerade ideal dafür, eine Familie zu gründen, oder ein Unternehmen, oder mit einem Roman anzufangen.
Ich schrieb natürlich weiter Essays. Ich schreibe ständig Essays – 800 Worte darüber, wie es ist, Inhaberin eines Buchladens zu sein für eine Londoner Tageszeitung, meine zehn Lieblingsbücher des Jahres für eine Zeitschrift in Australien, ein neues Vorwort für einen neu aufgelegten Klassiker, vielleicht einen kleinen Text über Hunde. Essays füllten mich zwar nie ganz aus, doch dank ihrer wusste ich, dass ich noch immer eine Autorin war, auch ohne gerade an einem Roman zu arbeiten.
So stieß ich auf mein Schlupfloch: Für Essays interessierte sich der Tod nicht.
Warum fiel mir das jetzt erst auf? Bei der Arbeit an meinem ersten Essayband, This is the Story of a Happy Marriage (Dies ist die Geschichte einer glücklichen Ehe), hatte der Tod nicht einmal an den Fenstern gerüttelt. Das Buch fühlte sich so absurd persönlich an, dass mich einzig und allein die Sorge plagte, wen ich damit kränken könnte; an die Gefahr dagegen, auf eine Schlange zu treten, dachte ich keinen Moment lang. Mir wurde klar, dass ich bei all den Essays, die ich in meinem Leben schon verfasst hatte, noch nie das zart schabende Geräusch einer Sense vernommen hatte, die in der Nähe gewetzt wurde. Hatte der Tod sich getrollt, weil nicht die Aussicht bestand, einen größeren Haufen von Romanfiguren ausradieren zu können? Vielleicht lag es auch daran, dass die Gegenstände meiner Essays real waren, verifiziert werden konnten. Falls ich mitten in einem Essay abtrat, ließe sich irgendjemand finden, der ihn, mithilfe von ein wenig Recherche, beenden könnte. Er oder sie würde den Text womöglich nicht ganz so schreiben, wie ich es getan hätte, doch die verfügbaren Tatsachen wären dieselben. Vielleicht lag es auch an den Tatsachen – die Vorstellungskraft kann getötet werden, Tatsachen aber sind viel schwerer aus der Welt zu schaffen. Es mag nicht den Anschein haben, ich weiß. Die Geschichte arbeitet unermüdlich daran, Tatsachen zu tilgen, dieses Land arbeitet unermüdlich daran, doch Tatsachen haben so eine Art, immer wieder aufzutauchen, und mit der Zeit strahlt ihre Wahrheit umso heller. Was womöglich eine Erklärung für das Desinteresse des Todes an Essays sein könnte; Essays sterben nicht. Ich beschloss, alles auf diese Karte zu setzen.
Ich fing an, längere Essays zu schreiben, und ich schrieb sie für mich – woher der plötzliche Drang, sich von Dingen zu trennen? Was bedeutete es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, kinderlos zu sein? Andere Essays ergaben sich aus Gesprächen, die ich mit Freundinnen führte, insbesondere der Text, den ich über meine drei Väter schrieb. Nach dem Tod ihres Vaters erzählte mir meine Freundin Katie, dass sie über ihn schreiben wolle. Ich selbst dachte seit fünfzehn Jahren darüber nach, über meine drei Väter zu schreiben, und hatte irgendwie nie den Mut dazu aufgebracht. Ich fragte sie, ob ich mich anschließen dürfe. Schreiben ist eine so einsame Arbeit, doch in diesem Fall war es eine Ermutigung für mich, dass wir zu zweit waren.
Der Gedanke, dass ich einen ganzen Band zusammenstellen müsste, verfestigte sich erst während der Arbeit an »Diese kostbaren Tage«, dem Titelessay. Dieser umfangreiche Essay war mir persönlich so wichtig, dass ich ihm eine solide Unterkunft errichten wollte: ein sehr langer Essay mit vielen kürzeren Essays als Stütze ringsherum. Also besann ich mich und vertiefte mich in andere Texte, die ich in den letzten paar Jahren geschrieben hatte. Die meisten verwarf ich, die stärksten aber nahm ich auseinander und schrieb sie um. Sich einen Text, der einige Jahre alt ist, noch einmal ansehen zu können, aus der Distanz die Schwachstellen auszumachen und dann die Möglichkeit zu haben, Mängel auszubügeln, ein letztes Mal zu polieren oder manchmal den Text auch ganz zu verwerfen und eine bessere Version zu schreiben, das ist schon wirklich grandios. Bei Romanen geht das eindeutig nicht. Durch diese Essays konnte ich mir zusehen, wie ich mich beim Schreiben mit denselben Themen auseinandersetzte wie in meinem Leben: was ich brauchte, wen ich liebte, was ich loslassen konnte und wie viel Kraft dieses Loslassen kosten würde. Wieder und wieder stellte ich mir die Frage, worauf es in diesem gefährdeten und kostbaren Leben am meisten ankommt.
Was den Tod anbelangt, hielt meine Glückssträhne an. Sein Desinteresse ließ nicht nach, wenngleich er irgendwann fraglos wieder auf mich zurückkommen wird. Der Tod vergisst einen nicht. In der Zwischenzeit das Leben zu genießen und die Tage, die wir haben, gut zu nutzen – das ist die Kunst.
Drei Väter
Die Ehe ist für meine Familie seit jeher unwiderstehlich gewesen. Wir versuchen es und scheitern und versuchen es erneut und bewahren uns dabei irgendwie den Glauben an eine Institution, die uns alle genarrt hat. Ich habe zweimal geheiratet und meine Schwester auch. Unsere Mutter hat dreimal geheiratet. Geplant hatten wir das alle nicht, keine von uns. Eigentlich wollten wir gleich beim ersten Anlauf eine saubere Punktlandung hinlegen, doch wir haben es verpatzt. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich fünf war. Meine Mutter und mein Stiefvater Mike trennten sich, als ich vierundzwanzig war. Sie heiratete Darrell, als ich sechsundzwanzig war, und beide blieben bis zu seinem Tod im Jahr 2018 zusammen, da war ich vierundfünfzig.
Mangel war nie das Problem bei mir. Ich litt eher an einem Übermaß, zu viel und zu viele. Es gibt Schlimmeres.
Bei ihrer zweiten Heirat wollte meine Schwester Heather eine richtige Hochzeit. Sie und ihr Mann Bill richteten eine unglaubliche Feier in einer aufgemotzten Scheune aus, die als Eventlocation vermietet wurde. Für die Musik sorgte eine Swingband mit einem schmucken Leadsänger – Heather und ich waren beide heftig verknallt in ihn, und heute können wir uns nicht mehr an seinen Namen erinnern. Karl und ich hatten wenige Monate zuvor in aller Heimlichkeit geheiratet, und jene schönen Worte von Liebe und Treue waren noch frisch. Wir tranken den Champagner, tanzten Line Dance, pusteten Seifenblasen in den Nachthimmel über der Braut und dem Bräutigam. Nur mein Stiefvater Mike war nicht in Feierlaune. Seine dritte Ehe lag in den letzten Zügen, und er hatte sich wieder in meine Mutter verliebt. Meine Mutter aber war glücklich mit Darrell, und so tanzte Mike den Abend über meistens mit mir.
Mein Vater, der meinen Stiefvater immer gehasst hatte, hasste ihn etwas weniger, seitdem der meine Mutter ebenfalls verloren hatte. Bei der Hochzeit meiner Mutter begnügte mein Vater sich damit, meine Mutter zu hassen, obwohl sie ihn schon 1969 für meinen Stiefvater verlassen hatte. Wobei die Liebe meines Stiefvaters zu meiner Mutter und der Hass meines Vaters auf sie sich im Schein der kleinen weißen Lämpchen, die um die Dachbalken der Scheunendecke drapiert waren, bemerkenswert ähnlich sahen.
Darrell bekam von alldem nichts mit. Er war acht Wochen zuvor die Backsteintreppe an der Hintertür ihres Hauses heruntergefallen und hatte sich dabei mehrere Wirbel angebrochen. Unter seinem Anzug und dem Pastorentalar trug er ein Stützkorsett. Er war presbyterianischer Pfarrer im Ruhestand und hatte meine Schwester getraut, trotz der Schmerzen, die er beim Gehen und Stehen und Atmen hatte. Er hielt noch das Festessen durch und ließ sich dann nach Hause fahren.
Aber die Geschichte, die ich erzählen möchte, trägt sich unmittelbar nach der Trauzeremonie und vor dem Empfang zu, als die Fotos gemacht wurden. Eigentlich nahm sie schon Monate zuvor ihren Anfang, als mir erstmals klar wurde, dass alle drei Väter zu Heathers Hochzeit kämen – das familiäre Äquivalent zu einer totalen Sonnenfinsternis. Davon wollte ich ein Bild haben.
Meinen Vater rief ich als Ersten an, da ich von ihm am ehesten erwartete, dass er Nein sagte, aber er überraschte mich. Klar, sagte er, geht in Ordnung. Es machte ihm nichts aus. Dann fragte ich Mike, der mir, wenn ich ihn mir gewünscht hätte, sogar den Polarstern vom Himmel geholt hätte. Er zögerte kurz, sagte aber dann ebenfalls Ja. Die Idee gefiel ihm zwar nicht, aber das musste sie ja auch nicht. Die Sache würde zwei Minuten dauern. Darrell kannte meinen Vater noch nicht persönlich und war meinem Stiefvater erst einmal begegnet, mehr im Vorübergehen. Anders als mein Vater und mein Stiefvater war Darrell mir nichts schuldig, doch er sagte, einverstanden.
Die Hochzeit fand Ende September statt, an einem Tag, der klar und strahlend und obendrein noch recht warm war. Nachdem Heather und Bill ausgiebig mit Familie und Freunden abgelichtet worden waren, in allen nur denkbaren Kombinationen, reihte ich die Ehemänner meiner Mutter nebeneinander auf. Auf einem Foto sind nur die drei zu sehen, in ihren dunklen Anzügen, und auf dem anderen bin ich noch dabei, in meinem granatroten Brautjungfernkleid. Darrell hält meine eine Hand in die Höhe, Mike die andere, und mein Vater in der Mitte hat mir eine Hand um die Taille gelegt. Es wirkt ein bisschen so, als wollten sie mich stützen. Mein Vater ist der Gutaussehende, derjenige, dessen Gesicht echte Freude über den Tag ausstrahlt, Darrell lächelt tapfer, sehr aufrecht in seinem Korsett, und Mike sieht aus, als warte er nur darauf, dass ich seine Hand loslasse, um aus dem Bild zu hechten.
»Wir standen alle da und warteten auf den Fotografen«, erzählte mein Vater mir später am Telefon. »Und da sagte Mike: ›Euch ist schon klar, was sie vorhat, nicht wahr? Sie wird abwarten, bis wir drei tot sind, und dann schreibt sie über uns. Das hier ist das Bild, das neben dem Text stehen wird.‹« Auf die Idee sei er gar nicht gekommen, sagte mein Vater, und auch Darrell hatte so etwas nicht vermutet, doch sobald Mike es aussprach, wussten sie, dass er recht hatte.
Er hatte recht. Genau das hatte ich vor. Genau das setze ich jetzt in die Tat um.
Die drei Väter starben in der Reihenfolge, in der meine Mutter sie geheiratet hatte, und in umgekehrter Reihenfolge zu ihrem Gesundheitszustand. Mein Vater war als Erster dran, obwohl er aus Crosstrainer, Laufband und Nordic Walking seine Religion gemacht hatte. Er siechte vier Jahre langsam dahin, an progressiver supranukleärer Blickparese, einer neurodegenerativen Erkrankung, durch die er am Ende an den Rollstuhl gefesselt war. Meine Stiefmutter pflegte ihn zu Hause, eine wahre Herkulesaufgabe, und ermöglichte ihm so, im eigenen Bett zu sterben.
Da es keine vierte Ehefrau gab, wohnte Mike in seinen letzten beiden Jahren bei seiner älteren Tochter Tina, die ihm all die Liebe und Aufmerksamkeit schenkte, die er ihr als Kind schuldig geblieben war. Mike ließ den Tod beinahe leicht erscheinen. Er war etwas dement, und sechs Wochen nach einer Diagnose, die bei ihm Nierenversagen feststellte, starb er sanft im Schlaf.
Darrells Tod war schwer. Es ging ihm schon seit Jahrzehnten nicht gut. Auf seine angebrochenen Wirbel folgten eine Reihe splitternder Stürze, ein schrecklicher Autounfall, ein Shunt gegen Hydrozephalus und zwei Arten von Krebs. Aber er lebte weiter. Als ich in der Einrichtung für betreutes Wohnen, in der Darrell seine letzten, qualvollen Jahre verbrachte, an seinem Bett saß, kam mir das Foto wieder in den Sinn. Er war der Letzte und derjenige, der in meinem Leben die kleinste Rolle gespielt hatte. Ich hielt seine skelettartige Hand und überlegte, was ich schreiben würde, wenn er gestorben war.
Doch als der Tod dann schließlich kam, merkte ich, dass ich nicht mehr über Darrell nachdenken wollte. Ich wollte über sie alle nicht mehr nachdenken. Ich hatte – zusammen mit meiner Schwester und meinen Stiefschwestern, mit meiner Mutter und Stiefmutter – so viele Jahre damit verbracht, ihnen beizustehen und sie dann zu verabschieden. Als Darrell starb, fuhr ich zu der Einrichtung für betreutes Wohnen, um noch am selben Abend sein Zimmer auszuräumen, um die noch ungeöffneten Großpackungen Seniorenwindeln und Trinknahrung für jeden, der Bedarf hatte, in den Gemeinschaftsraum zu schleppen, und danach karrte ich seine Taschenbücher und unfassbar großen Schuhe ins Sozialkaufhaus. Als das erledigt war, hatte ich von alldem erst mal die Nase voll. Und so blieb es dann auch lange Zeit.
1974 abonnierte mein Vater die »100 Greatest Books of All Time« von der Franklin Library. Er entschied sich für die Schmuckausgaben im Ledereinband – Vorsatzblätter aus schillerndem Moiré-Papier, seidene Lesebändchen, die Kanten der Buchseiten veredelt durch 22-karätigen Goldschnitt. Als die Leute bei der Franklin Library sich dieses monatliche Klassiker-Abo ausdachten, war mein Vater genau die Sorte Kunde, die ihnen dabei vorschwebte. Er wollte die Bücher nicht nur kaufen, er hatte auch fest vor, sie zu lesen. Er hatte den Ehrgeiz, die Sorte Mensch zu sein, die zu Hause vor ihrer Bibliothek aus ledergebundenen Büchern mit goldgeprägten Rücken saß und The Return of the Native von Thomas Hardy las. Monat für Monat, Jahr für Jahr gab er viel Geld dafür aus, so ein Mensch zu sein.
Mein Vater war als drittes von sieben Kindern aufgewachsen. Er wurde 1931 geboren, der erste Patchett, der in Amerika zur Welt kam. Seine Eltern hatten England verlassen, um in Kalifornien Arbeit zu suchen, und nach einer langen Durststrecke – es war mitten in der Weltwirtschaftskrise – kam sein Vater als Maschinist bei Columbia Pictures unter. Als aber die Kulissenbauer in Streik traten, schloss er sich ihnen aus Solidarität an, und sie landeten alle auf einer schwarzen Liste, ohne Aussicht, bei den Studios je wieder Arbeit zu finden. Mein Großvater wurde Hausmeister bei der Los Angeles Times, ein schmutziger Job, wegen der allgegenwärtigen Druckerschwärze. Später gelang es ihm, meine Großmutter dort auf einer Stelle in der Cafeteria unterzubringen. Die neunköpfige Familie wohnte denkbar beengt in einem kleinen Haus mit gerade einmal drei Zimmern in der Council Street in Los Angeles, in der Umgebung von Echo Park. Mein Vater schlief in einem schmalen Bett auf der hinteren Veranda.
Nach seinem Dienst in der Navy zog mein Vater wieder in die Council Street und arbeitete einige Jahre in einem Spirituosenladen, während er sich beim Los Angeles Police Department bewarb. Er wurde immer wieder abgelehnt, weil ein Arzt behauptete, mit seinem Herzen stimme etwas nicht, bis schließlich ein anderer Arzt sagte, mit seinem Herzen sei alles in Ordnung. Er wurde Polizist. Er heiratete meine Mutter, eine schöne Krankenschwester. Sie bekamen zwei Töchter und kauften sich ein Haus in der Rossmoyne Avenue in Glendale. Dann verliebte meine Mutter sich in Mike, der Arzt in dem Krankenhaus war, in dem sie arbeitete, und als Mike nach Tennessee ging, folgte sie ihm mit meiner Schwester und mir dorthin.
Ohne uns vermietete mein Vater das Haus in der Rossmoyne und kehrte in die Council Street zurück, zu seinem Vater und seiner Schwester Cece, die bei der Telefongesellschaft arbeitete. Jeden Sommer, wenn Heather und ich per Flugzeug von Nashville aus für eine Woche zu Besuch kamen, überließ Cece uns ihr Bett und wich auf die Couch aus. Sie machte uns glauben, dass sie dort ohnehin viel lieber schlafe. Unser Vater hatte wieder sein Bett auf der Veranda. Nach dem jährlichen Kauf der zwei Flugtickets nutzte er den Rest seiner Ersparnisse, um mit uns Disneyland oder Knott’s Berry Farm zu besuchen, aber wo es uns allen am besten gefiel, war Forest Lawn. Forest Lawn kostete keinen Eintritt. Wir brachten uns immer ein Lunchpaket mit und spazierten die Wege inmitten der mustergültig gepflegten Rasenflächen entlang, um zu sehen, wo die Filmstars begraben lagen, und danach gingen wir und stellten uns in die frische, kalte Luft des Blumenladens, der aussah wie eine Sommerklause für Hobbits. Es roch dort durchdringend nach Nelken, ein Duft, den ich bis heute mit jenen fröhlichen Nachmittagen auf dem Friedhof assoziiere.
Anlässlich der Heirat mit unserer Stiefmutter zog unser Vater zurück in das Haus in der Rossmoyne. Sie machte daraus ein liebevolles Zuhause, in dem wir immer willkommen waren. Die Franklin Library erweiterte ihr Angebot über die ursprünglichen hundert Bände hinaus, und mein Vater erwarb auch noch diese Nachzügler. Danach abonnierte er die Präsidenten-Reihe.
Zu jedem Band gehörte eine schmale Broschüre mit einer Gesamtschau des Textes sowie einer Reihe Studienfragen, zur Vertiefung. Schon bald zeichnete sich ab, dass mein Vater nicht in einem Monat die Orestie und im Monat darauf das Dekameron bewältigen könnte, aber er las gewissenhaft die Broschüren durch und bewahrte sie in dem kleinen Kästchen auf, das eigens zu diesem Zweck übersandt worden war. Letzten Endes, da war er zuversichtlich, würde er den Rückstand schon aufholen, wenn nicht im Urlaub, dann im Ruhestand. Er wollte die Bücher lesen, und er wollte auch, dass die Bücher gelesen wurden. Entsprechend beglückt war er immer, wenn ich es mir bei unseren Besuchen im Sommer mit Die rote Tapferkeitsmedaille oder Stolz und Vorurteil zum Lesen bequem machte. Ich durfte sogar seine Ausgabe von Anna Karenina in die Eigentumswohnung mitnehmen, die er und meine Stiefmutter in Port Hueneme gekauft hatten, an der Küste ein Stück nördlich von Los Angeles. Tag für Tag saß ich lesend im Wohnzimmer und wollte nicht mit an den Strand.
So ein Vater, mag man vielleicht nun denken, ist der ideale Vater für eine Schriftstellerin. Was ich mit Ja und Nein beantworten würde.
Bei all seiner Liebe zu Büchern war mein Vater der Auffassung, dass die kindliche Entwicklung auf der Fähigkeit beruhte, Volleyball spielen zu können. Schon an den Stränden Südkaliforniens hatte ich daran so meine Zweifel, aber in der katholischen Mädchenschule, die meine Schwester und ich in Nashville besuchten, war ich mir sicher, dass er sich irrte. Mein Vater wollte uns noch von der anderen Seite des Landes aus formen. Bei meiner Schwester hatte er da mehr Glück. Heather war dreieinhalb Jahre älter. Sie hatte dreieinhalb Jahre länger mit ihm verbringen können. Wenn er ihr Anweisungen erteilte, welche Kurse sie belegen, welchen Vereinen sie beitreten und wie viele Klappmesser sie allabendlich machen sollte, hörte sie auf ihn. Ich hörte nicht auf ihn. Als ich neun war, schickte er Heather ein Volleyballnetz, einen Ball und zehn Dollar, ihren Lohn dafür, mich zum Spielen zu nötigen. Sie sollte seine Abgesandte sein und meine Trainerin, aber wir stritten uns damals wie die Kesselflicker. Sie spannte das Netz zwischen unserem Carport und dem Zaun und nahm es irgendwann wieder ab, denn man kann seine Schwester zwar vors Volleyballnetz stellen, sie aber nicht zum Schmetterschlag zwingen.
Mein Vater wollte mich sportlich. Ich sollte mich Mannschaften anschließen, in Vereine eintreten, selber Vereine gründen. Sollte mich zur Wahl stellen, wenn irgendwo ein Amt neu vergeben wurde. Ich sollte vorsprechen, mich engagieren, irgendwo dazugehören, mich unterordnen. Als ich behauptete, an einer Schülerinnenverbindung der Highschool kein Interesse zu haben, die er mir energisch ans Herz legte, sagte er, ich solle trotzdem eintreten, mich hocharbeiten und das System dann von innen her verändern. Ich sollte es unterwandern.
Vielseitig sein, sagte er, darauf komme es an, aber ich war alles andere als vielseitig. Ich entdeckte das nächste Buch und verkrümelte mich damit in eine Ecke. Ich würde Schriftstellerin werden, erklärte ich ihm. Mein Vater hatte nichts dagegen, dass ich las – er las selber gern –, aber eine Schriftstellerin, sagte er, das würde ich nie werden.
Sich von seinem Vater nicht wahrgenommen zu fühlen, dieses Problem ist sicher weitverbreitet. Bei mir allerdings war das ein Dauerzustand, da ich meinen Vater immer nur eine Woche im Jahr sah. Mein Vater und ich sahen uns tatsächlich nicht, und so verstanden wir uns auch nicht. Dass er mich überhaupt nicht kannte, lag auf der Hand, aber ich brauchte lange, um einzusehen, dass ich ihn genauso wenig kannte.
»Eines Tages wirst du geschieden«, unkte er, als ich auf der Highschool war. »Dann musst du deine Kinder allein durchbringen. Mit Schreiben schaffst du das nie und nimmer.« Ich dürfe nicht so egoistisch sein, sagte er. Ich müsse mir überlegen, was für diese Kinder am besten sei. Wo das herkam, war nicht weiter schwer zu erraten. Schon meine Mutter hatte nicht auf ihn gehört. Sie fand mein Vorhaben, Schriftstellerin zu werden, bewundernswert.
Wenn es nach meinem Vater ging, sollte ich den Beruf der Dentalhygienikerin ergreifen. Zugleich schwärmte er mir jedes Mal, wenn er aus dem Urlaub kam, davon vor, wie viel Spaß es mir machen könnte, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Vermutlich wären wir uns gegenseitig an die Gurgel gegangen, hätten wir unter einem Dach gewohnt, aber Ferngespräche waren seinerzeit noch teuer, und wir telefonierten nur einmal im Monat. Meine Schwester beherzigte seine Anweisungen – er wollte, dass sie Jura studierte. Sie war die Schlaue von uns beiden, meine Schwester, eine glänzende Schülerin. Ich dagegen hielt den Hörer von meinem Ohr weg, wenn er mir Ratschläge erteilte. Lass ihn reden, dachte ich. Das perlt alles an dir ab.
Ich bin heute älter, als mein Vater damals war. Diese Gespräche lassen im Nachhinein so viele unterschiedliche Deutungen zu. Vielleicht wollte er mir einfach Kummer ersparen. Vielleicht hatte er vor Augen, wie sein Vater sich auf der Suche nach Arbeit in Los Angeles von früh bis spät die Schuhsohlen ablief, mit einem Sandwich in der Tasche und mit einer Frau und sieben Kindern daheim in der Council Street. Und auch, wie er selbst nach der Navy wieder bei seinen Eltern wohnte, in einem Spirituosenladen arbeitete, erneut draußen auf der Veranda schlief. War es da nicht nachvollziehbar, wenn er mich davor bewahren wollte? Ich war als Kind keine sonderlich eifrige Schülerin und meine Berufsplanung prätentiös – ich träumte davon, mir mit Kunst einen sehr bescheidenen Lebensunterhalt zu verdienen. Vielleicht konnte er nur von der Welt ausgehen, die er kannte: dem Katholizismus, der Navy, dem Police Department. Kapitäne gaben Befehle, und Seeleute stachen in See. Was war ich denn mehr als ein kleiner Matrose? So wie er Befehle empfangen hatte, würde auch ich Befehle empfangen. Niemand kann einfach nur von Papier und Bleistift leben, allein in einem Zimmer, ohne dass jemand einem sagt, wann man aufzustehen hat, was man essen soll, wo man hinzugehen hat und wann wieder Schlafenszeit ist.
Aber ich war einfach Schriftstellerin, und wer das nicht begreifen wollte, lief Gefahr, mich völlig zu verkennen. Ich schrieb und las und las und schrieb. Ich setzte alles, was ich hatte, auf eine Karte. Dass einem das als Elternteil gewisse Sorgen bereiten könnte, leuchtet mir ohne Weiteres ein.
Habe ich schon erwähnt, dass mein Vater und ich uns gleichwohl liebten? Entgegen landläufiger Meinung kommt Liebe auch ohne Verständnis aus. Ich hätte meinen Vater oft am liebsten erwürgt, aber weit häufiger brachte er mich zum Lachen. Wir tauschten uns über Artikel aus, die wir im New Yorker gelesen hatten. Wir hörten Arien und versuchten, den Komponisten zu erraten. Es gab die Gelegenheiten, die mir als besonders beglückend in Erinnerung sind, wenn wir uns auf den beiden Leinensofas im Rossmoyne-Haus gegenübersaßen, Gin Tonic tranken und uns gegenseitig Gedichte von Yeats vorlasen, aus dem ledergebundenen Band, den wir uns hin und her reichten. Who will go drive with Fergus now,/And pierce the deep wood’s woven shade,/And dance upon the level shore? – Wer ist’s, der nun mit Fergus zieht,/Dringt tief ins schattige Geweb/Des Walds und tanzt am flachen Strand?
»Dieses hier«, pflegte er zu sagen, ehe er mir »The Lake of Innisfree« vorlas. Dann reichte er mir das Buch zurück, und ich sagte, »dieses hier«.
Aber er scheuchte uns auch in aller Frühe in die Gasse hinter dem Supermarkt, damit wir dort morgens um sechs Tennisbälle gegen die Rückwand von Ralph’s schlugen. Tennis lag mir ebenso wenig wie Volleyball, während meine Schwester den Ball ununterbrochen gegen die Mauer drosch. Jedes Mal, wenn er mich losschickte, um die in der Gasse verstreuten Bälle einzusammeln, dachte ich, dir werde ich’s zeigen. Ich werde weder beim Tennis noch in sonst einer Sportart glänzen, werde mich nicht in Klubs, Verbindungen oder sonst wo engagieren, aber schreiben werde ich, und dann wirst du schon sehen.
Wie sich herausstellt, prallen Tennisbällen besonders kräftig zurück, wenn man eine harte Mauer hat, gegen die man sie schlägt. Jemanden zu haben, der eher an mein Scheitern als an meinen Erfolg glaubte, machte mich wachsam. Und unempfindlich. Mein Vater brachte mir sehr früh bei, ganz unbeabsichtigt, mich nicht von der Zustimmung oder dem Beifall anderer abhängig zu machen. Ich wollte, ich könnte diese Freiheit irgendwie in Flaschen abfüllen und sie heute allen Nachwuchsautoren schenken, die ich kennenlerne, ganz besonders den Frauen. Damit würde ich ihnen die Fähigkeit schenken, zu lieben und gleichzeitig auf alles zu pfeifen.
»Natürlich darfst du ein Hobby haben«, sagte er gern. »Als Hobby ist Schreiben völlig in Ordnung. Aber bilde dir nicht ein, dass das ein Beruf wäre.« Über die Jahre und mit dem Puffer zweier Zeitzonen zwischen uns konnte ich seine Missbilligung mit Humor nehmen. Ich machte meinen geisteswissenschaftlichen Master an der Universität Iowa, bekam eine Handvoll Stipendien, erhielt diverse Auszeichnungen und Preise. Ich veröffentlichte Erzählungen, Artikel, drei Romane, und er schickte mir unbeirrt weiterhin Stellenanzeigen für Sommerjobs auf Kreuzfahrtschiffen. Ich hatte kein Geld und bat auch nie um Geld. Ich wohnte in einem winzigen Apartment und fuhr ein altes Auto. Ich hatte weder Kinder noch Schulden.
Mein Vater las meine Erzählungen und später meine Romane in Manuskriptform. Er half mir bei Recherchen. Er machte Anmerkungen. Er war stolz auf mich und gut zu mir, aber er hielt das, was ich da tat, nicht für einen richtigen Beruf.
Die Waage neigte sich schließlich durch etwas zu meinen Gunsten, das ich mir nie hätte träumen lassen: Ich wurde reich. Wobei »reich« ein unnützes Wort ist, weil jeder etwas anderes darunter versteht, aber versuchen wir es mal mit meiner Definition: Ich hatte so viel Geld, dass ich nicht mehr bis auf den letzten Dollar genau wusste, wie viel. Ich konnte Geld geben, ohne es zurückfordern zu müssen. Ich hatte ein Buch über Opern und Terrorismus in Südamerika geschrieben, das sehr erfolgreich war, und danach änderte auch mein Vater seine Einstellung. Er fand es nun vollkommen richtig, dass ich Schriftstellerin geworden war.
»Ich wollte ja immer, dass sie Dentalhygienikerin wird«, sagte er gern und legte mir stolz den Arm um die Schulter, wenn ich Lesungen in Los Angeles abhielt und alle Patchetts nebst Freunden und Familien sich dazu einfanden. »Nur gut, dass sie nie auf mich hört.«
Mein Stiefvater Mike hatte vier Kinder mit seiner ersten Frau. Er ließ sie in Los Angeles zurück und zog mit meiner Mutter, meiner Schwester und mir nach Nashville. »Sechs Kinder«, pflegte er zu sagen, wenn wir allein waren, »und du bist die Einzige, um die ich mir nie werde Sorgen machen müssen.« Ich dürfte ungefähr acht Jahre alt gewesen sein, als ich das zum ersten Mal von ihm zu hören bekam, und er sollte diese Botschaft, in der einen oder anderen Form, bis ans Ende seines Lebens noch oft wiederholen. Sah er tatsächlich schon etwas in mir strohhaarigem und spindeldürrem Wesen? Oder geht mein späterer Erfolg darauf zurück, dass er es so gebetsmühlenartig wiederholte, wie ein Orakel, das nicht irren kann: Du wirst es schaffen.
Womit ich es schaffen würde, stand für Mike auch bereits fest, nämlich als Schriftstellerin. »Irgendwann einmal werde ich eins deiner Bücher aufschlagen, und ganz vorne steht dann Für Mike Glasscock.«
Aber das kam nicht infrage. Es würde meinen Vater umbringen, wenn ich Mike ein Buch widmete. Das waren so die Probleme, mit denen ich mich in der Middle School herumschlug.
Hierin könnte man nun eine hübsche Art ausgleichender Gerechtigkeit erblicken – mein Vater und mein Stiefvater, beide gleichermaßen überzeugt von ihren gegensätzlichen Prognosen für meine Zukunft. Zur Entschädigung für den einen Vater, für den es feststand, dass ich scheitern würde, hatte ich einen weiteren Vater, der voll auf meinen künftigen Erfolg setzte. Keine schlechte Theorie, sie hat nur leider einen Haken – mein Stiefvater war völlig irre, während mein Vater die Vernunft in Person war.
»Irre« ist wieder so ein dehnbarer Begriff, ganz wie »reich«. Es kommt ganz auf die Definition an. Mein Stiefvater war in jeder Hinsicht ein erfolgreicher Mann, ein Facharzt, der Vorträge auf der ganzen Welt hielt, ein Spezialist der Neurootologie, den man zu den schwierigsten Fällen hinzuzog. Er flog einen Hubschrauber, fuhr Motorräder. Er kaufte eine Farm dreißig Meilen vor der Stadt, mit einem Tor und einer langen Kiesauffahrt. Dort ließ er ein Wasserversorgungssystem und einen unterirdischen Benzintank installieren, womit ich meine, dass wir eine eigene Zapfsäule neben dem Carport hatten, für den Fall, dass die normalen Tankstellen unerwartet ihren Betrieb einstellten. Er vergrub Goldmünzen unter den Ringelblumen und wuchtete Kartons mit Trockennahrung und Wasserkanister auf den Dachboden. Jedes Haus, in dem wir wohnten, war voller Schusswaffen: überall griffbereite Pistolen, in speziellen Halterungen unter Stühlen, in Nachtschränkchen, hinter Uhrzifferblättern, in den Luftschächten der Klimaanlage. Die Playboy-Hefte lagen offen auf dem Couchtisch im Wohnzimmer, während das harte Zeug im obersten Fach des Schlafzimmerschranks verborgen lag, wo es von allen Kindern prompt gefunden wurde. Mein Stiefvater schmiss Teller entzwei, hieb mit der nackten Faust Löcher in die Wabentüren und hielt mich für die Wiederkunft Christi.
An Wochenenden nahm Mike mich gern ins Krankenhaus mit. Er ließ mich in der Ärztelounge zurück, wo ich den Vormittag mit Lesen verbrachte, Donuts mit Puderzucker aß und dazu Orangenlimo trank, während er sich um seine Patienten kümmerte. Danach schaute er ein Stündchen bei seiner OP-Schwester vorbei und ließ mich solange vor ihrem Apartmenthaus im Wagen warten. Auf der Heimfahrt erzählte er mir dann die traurigen Geschichten aus seiner Kindheit, von seinen Teenagereltern, die ihn zu seinen Großeltern abschoben, von der Liebe, nach der er sich sehnte und die ihm nie zuteilwurde. Er verbrachte seine Tage damit, Patienten Hirntumore herauszuschneiden. Wenn er nach Hause kam, hatte er dunkle Blutergüsse unter den Augen, weil er sich zwölf oder vierzehn Stunden lang ununterbrochen über ein Mikroskop gebeugt hatte. Er musste zwei Ehefrauen und sechs Kinder versorgen. Er kaufte sich Rennpferde und bohrte nach Öl, ohne von beidem auch nur das Geringste zu verstehen. Er fing mit Bildhauerei und Fechten an. Er renovierte in seiner Auffahrt ein Hausboot. Er ging morgens fünfmal die Woche zur Analyse, viel länger, als es erlaubt sein sollte. Aber eigentlich wollte er Schriftsteller sein.
Einmal, als ich während des Studiums in den Ferien zu Hause war, schauten Mike und ich uns Laurence Oliviers König Lear an. Als der Abspann lief, erschienen im Bild groß die Worte: »Von William Shakespeare«.
»Das ist alles, was ich mir wünsche.« Mike zeigte auf den Fernseher. »Dass Leute in drei- oder vierhundert Jahren etwas im Fernsehen anschauen, bei dem eingeblendet wird: ›Von Michael Glasscock‹.«
Mike bezog die monatliche Buchreihe von Easton Press, und zwar mit Ledereinband, ganz wie mein Vater. Werkausgaben hatten es Mike besonders angetan. Werke von Shakespeare, von Dickens. Auf seinem Schreibtisch stand ostentativ eine kleine, gebundene Werkausgabe mit Tschechows Erzählungen, während er eigentlich Ian Fleming und James Clavell las. Während mein Vater jemand war, der den Ehrgeiz hatte, die 100 Großartigsten Bücher aller Zeiten zu lesen, aber leider nie dazu kam, war mein Stiefvater eher der Typ, der von sich sagte, die habe er schon gelesen. Er brachte mir Schachspielen bei, Autofahren, Messerwerfen, wie man Schwarz-Weiß-Fotos selbst entwickelte, erst in der Badewanne und dann in der Dunkelkammer, die er an den Hobbyraum anbauen ließ. Er brachte uns allen das Schießen bei – mit Gewehren, Schrotflinten, Handfeuerwaffen aller Art – und wie man diese Waffen sachgerecht auseinandernahm und reinigte. Er ließ uns für den Entführungsfall üben, blitzschnell nach der Pistole unter dem Wohnzimmersessel zu greifen.
Einmal erreichte mich ein Brief von einer Frau, in dem stand, sie und ihr Mann hätten eine geliebte Tochter, und das Mädchen zeige eine echte Begabung fürs Schreiben. »Wie können wir sie so aufwachsen lassen«, fragte die Frau, »dass sie so wird wie Sie?«
Um zu schreiben, muss man gut mit sich selbst auskommen. Bei uns zu Hause war es einfach, allein zu sein. Wir fanden uns nicht an zentralen Orten zusammen. Wir kamen zu den Mahlzeiten aus unseren Zimmern und kehrten dann in diese zurück. Meine Schwester hatte den ganzen Beifall unseres Vaters, aber das war in etwa so wie ein Koffer voller Francs, nachdem Frankreich den Euro eingeführt hatte. Ein wertloses Gut, höchstens ein Andenken daran, dass man einst reich gewesen war. Einige Jahre lang schlief sie im Sommer lieber wochenlang auf dem Boden des begehbaren Wäscheschranks, als sich ihr Zimmer mit den Kindern meines Stiefvaters teilen zu müssen, die in den Ferien zu uns kamen. Schließlich zog sie in den Keller um. Gemütlich war es da unten nicht, selbst mit dem Luftentfeuchter nicht, der rund um die Uhr lief. Es gab dort kein Badezimmer, keinen Zugang durchs Haus, kein einziges Fenster. Dafür gab es Silberfischchen und Tausendfüßler. Sie wollte eben ihre Ruhe vor uns haben. Ich blieb in meinem Zimmer. Ich las und schrieb. Ich kletterte im Wald herum, und als wir im Sommer vor meinem dreizehnten Geburtstag in die Stadt zogen, drehte ich auf meinem Fahrrad endlose Runden durch die Siedlung, bis es dunkel wurde. Es war schön, draußen zu sein.
»Leg dir bloß keine Kinder zu«, schärfte mein Stiefvater mir immer wieder ein. »Der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Versprich mir, dass du dir niemals Kinder zulegst.«
Ernstlich mit dem Schreiben fing Mike an, nachdem wir die Farm verlassen hatten, nur Kurzgeschichten zunächst, an denen er endlos arbeitete. Das heißt, dass er viele, viele Geschichten schrieb, die er aber so gut wie nie noch einmal überarbeitete. Er kritzelte sie auf gelbe Schreibblöcke, so hastig wie ein Gerichtsreporter, ließ sie von seiner Sekretärin abtippen und gab sie mir zu lesen. Auch mit dreizehn schon wusste ich, dass die Geschichten miserabel waren, aber wie sollte ich ihm das beibringen?
Das lernte ich dann. Er hatte einen solchen Ausstoß von Geschichten, dass meine guten Manieren dabei irgendwann auf der Strecke blieben. »Du kannst nicht acht Seiten lang beschreiben, wie jemand unter die Dusche geht«, sagte ich, ohne zu schreien. »Wie er sich auszieht, den Duschvorhang beiseiteschiebt, das Wasser aufdreht, darauf wartet, bis das Wasser warm ist. Das interessiert niemanden! Es bringt deine Geschichte kein Stück voran.« Woraufhin er die Duschszene komplett strich und die gekürzte Geschichte von seiner Sekretärin neu tippen ließ, um sie mir dann abermals zum Lesen zu geben.
Ich fing in der Unterstufe an, Mikes Geschichten zu lesen. Er reiste mit mir nach New York, als ich elf war. Als ich vierzehn war, reiste er mit mir nach England. Mit der Lektüre seiner Romane fing ich auf dem College an. Das Studium dort finanzierte er mir. Als ich ihm sagte, dass er nicht auch noch für mein Masterstudium aufkommen dürfe, kam es zu einem der seltenen ernsthaften Streits zwischen uns. Ich hatte mich um ein finanzielles Hilfspaket bemüht, das mir auch bewilligt worden war und für das ich als Gegenleistung Literaturkurse abhalten würde, aber das wollte er nicht. Ich sollte überhaupt nicht nebenher arbeiten müssen. Er wollte daran glauben, dass wir uns aufteilten, dass ich den Lernstoff vor Ort aufsaugte und die erworbene Weisheit dann mit nach Hause brächte, weil er zu stark eingespannt war, um selbst in Iowa zu studieren. Mike arbeitete so hart an allem, was er tat. Schreiben hielt er für etwas, das sich durch brachiale Gewalt meistern ließ. Er würde es sich gefügig machen, egal wie. Er fing an, Romane zu schreiben, immer am Wochenende. Romane von gewaltigem Umfang. Manchmal diktierte er sie, ließ sie tippen und schickte mir die Manuskripte dann zu, ohne sie vorher selbst auch nur einmal zu lesen.
Mike glaubte bedingungslos an mich, und im Gegenzug las ich seine Romane. Wie viele waren es insgesamt? Dreißig? Vierzig? Ich habe keine Ahnung. Manche waren bis zu fünfhundert Seiten lang, ausgedruckt auf cremefarbenem Bewerbungspapier und fachgerecht im Kopiercenter gebunden. Wie viel Lesezeit ich für diese Romane insgesamt geopfert habe, mag ich mir gar nicht ausrechnen. Es war eine Welt voller vollbusiger Blondinen und langhaariger Brünetten, voller Männer mit Knarren und Hubschraubern und Geld wie Heu. Wenn Körper verstümmelt wurden, verlangsamte sich sein Erzähltempo, um die Vorgänge medizinisch korrekt darzustellen. Es kam so viel Sex vor, so viele Autounfälle. Über die Jahre versuchte ich es mit jeder nur denkbaren Taktik: Ich redigierte den Text Zeile für Zeile. Ich redigierte ihn überhaupt nicht. Ich sagte Mike klipp und klar, dass er meine Zeit nicht derart verschwenden dürfe. Ich versuchte, ihn zu entmutigen. Ich stopfte ganze Manuskripte in Papierkörbe an Flughäfen und ließ nichts von mir hören. Jahrelang weigerte ich mich kategorisch, irgendwas von ihm zu lesen, und dann gab ich nach, weil er sich diesmal so sicher war, dass der Roman, den er gerade abgeschlossen hatte, anders war. Er war kein bisschen anders. Der Zustrom der Romane setzte wieder ein. Natürlich war ich nicht die Einzige. Manche dieser »Backsteine« landeten bei meiner Schwester und meinen Stiefschwestern, einer oder zwei auch bei meinen Stiefbrüdern, die erdrückende Mehrheit jedoch fand ihren Weg vor meine Türschwelle (per FedEx-Frühzustellung), weil ich nun mal die Autorin war. Über die Jahre besorgte ich ihm mehrere professionelle Lektoren, und das viele Geld, das er ihnen zahlte, war Dollar für Dollar sauer verdient. Am Ende, als sein Vermögen aufgebraucht war, bezahlte ich den Lektor.
»Das ist eigentlich Kindesmisshandlung«, sagte ich einmal abends zu meinem Mann, als ich mit einem Manuskript auf dem Schoß auf der Couch saß. »Bloß, dass ich schon zweiundfünfzig bin.«
Mike hörte nie auf mit dem Schreiben, und er bemühte sich auch bis zuletzt um einen richtigen Agenten und einen richtigen Vertrag. Er brachte vier Romane auf eigene Kosten heraus, die vier besten, aber sie waren trotzdem noch miserabel. Die Einbände ließ er von Grafikern gestalten. Äußerlich sahen die Bücher also gut aus. Er fragte an, ob er in der Buchhandlung in Nashville, deren Mitinhaberin ich bin, eine Lesung abhalten dürfe, und ich sagte Ja. All seine Freunde und früheren Patienten kamen, die Ärzte, die er ausgebildet hatte, aber zufrieden war er trotzdem nicht. Weil er sich wünschte, was ich hatte.
Ich war fünf, als ich Mike kennenlernte. Er und meine Mutter waren die meiste Zeit zusammen, wenn auch nicht durchgehend, bis ich vierundzwanzig war. Er und ich blieben einander nahe, bis er mit vierundachtzig starb. Mit der Zeit wurde er altersmilde; er wurde freundlicher, umgänglicher, ein besserer Zuhörer. »Wer ist dieser wundervolle Mensch?«, fragte meine Stiefschwester Tina mitunter. »Und was hast du mit meinem Vater gemacht?« Seine Schriftstellerei verbesserte sich nie.
Ich wuchs im Wetter seines Wahnsinns auf, und zugleich hat er mich überreich beschenkt. Er bestärkte mich nicht nur in dem Glauben, Schriftstellerin werden zu können, sondern nährte in mir obendrein das Gefühl, dass es nichts Erstrebenswerteres gab. Durch sein eigenes skurriles Beispiel lernte ich Arbeitsdisziplin. Wenn ein beruflich derart eingespannter Mann mit sechs Kindern, zig Hobbys und zig Affären zusätzlich noch die Zeit fand, so viele Bücher zu schreiben, so grausig sie auch sein mochten, sollte ich es wohl erst recht hinbekommen, mich so zu organisieren, dass ich produktiv sein konnte. Dank ihm weiß ich außerdem, dass ich mit der Bitte, einen Text von mir gegenzulesen, die Zeit eines anderen Menschen in Anspruch nehme, und deswegen achte ich besonders darauf, Manuskripte erst nach meiner allerletzten Überarbeitung an Dritte zu geben. Anhand von Eudora Welty kann man lernen, was Perfektion ist, 20 000 Seiten schlechter Prosa, über ein Leben verteilt gelesen, vermitteln einem nachhaltig, was das Gegenteil ist. Dialoge, Figurenentwicklung, Erzähltempo, Schauplätze, Handlung – ich hatte miterlebt, wie wirklich jedes einzelne Romanelement durch den Fleischwolf gedreht wurde. So kam die Lawine von Manuskripten, unter der Mike mich in all den Jahren begrub, letzten Endes meiner Sorgfalt zugute. Und dadurch habe ich viel Zeit gespart!
Ich war sechsundzwanzig, als meine Mutter zum dritten Mal heiratete. Allein die Vorstellung erschöpfte mich. Zu ihren ersten beiden Männern hatte sie keinen Kontakt mehr, dabei spielten beide in meinem Leben eine zentrale Rolle: mein Vater, der sich wünschte, dass ich mehr so würde wie er, und mein Stiefvater, der umgekehrt gern mehr so wie ich gewesen wäre. Ich hatte keine Lust, mir über meinen Platz in der neuen Familienlandschaft den Kopf zu zerbrechen. Immerhin war ich längst erwachsen, hatte inzwischen selbst eine geschiedene Ehe hinter mir. Ich wollte nur, dass meine Mutter glücklich war. Ich liebte sie und wünschte ihr das Beste. So schwierig ihre ersten Ehen für mich mitunter auch gewesen sein mochten, für sie waren sie katastrophal gewesen. Ich zog also mein bestes Kleid an und ging zur Hochzeit.
Darrell war pflegeleicht. Das war gleich von Anfang an klar. Er konnte kochen. Er gärtnerte gern. Er hatte ein gutes Verhältnis zu seinen drei erwachsenen Kindern. Er brachte sehr wenig in die Ehe mit ein: eine Uhr aus dem Besitz seines Großvaters mitsamt dem dazugehörigen Regal, ein paar gerahmte Bilder. Er packte diverse Kartons mit Büchern aus, hauptsächlich theologische Schriften, alle gelesen, viele mit Bleistiftanmerkungen versehen, kein einziges mit Ledereinband. Mit Klassikerausgaben von der Franklin Library und dergleichen hatte er nichts im Sinn, und für meine Arbeit als Autorin interessierte er sich nicht.
Oder vielleicht doch, aber nicht anders, als er sich auch für Heathers Arbeit als Strategieentwicklerin an einem kleinen geisteswissenschaftlichen College interessierte. Sein einer Sohn war Redakteur bei einer Zeitung, der andere Arzt, seine Tochter Immobilienmaklerin. Er schien von uns allen gleichermaßen beeindruckt zu sein. Wenn er eins meiner Bücher las oder zu einer Lesung kam, umarmte er mich hinterher und sagte, »Was bist du für ein Wunder«, was er allerdings auch bei anderen Gelegenheiten äußerte, etwa wenn ich abends Essen vom Italiener mitbrachte oder ihm beim Aufräumen der Garage half. Ich habe auch gehört, wie er es zu seinen Kindern und Enkeln und zu meiner Mutter sagte: »Was bist du für ein Wunder.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung, und sie klang nie abgedroschen, wie oft er sie auch von sich gab. Es war, als nähme er uns wahr, individuell, gleichwertig, und würde das Wunder in uns allen erkennen. Ich denke nicht, dass es Darrell je gekümmert hat, wie viel Geld ich verdiente, wo ich überall hinreiste oder wen ich alles kannte, und dennoch glaubte ich immer, dass ihm etwas an meinem Glück lag. Falls es in seinem Leben irgendwelche klaffenden Lücken gab, vermittelte er mir jedenfalls nie das Gefühl, dass ich diese Lücken zu füllen hätte. Ich kannte Darrell dreißig Jahre lang. Er verfügte über eine Fülle praktischer Kenntnisse, für die ich ihn zutiefst bewunderte. Er wusste, wie man Probleme löst, wie man Dinge in aller Ruhe bespricht. Und er kannte sich nicht nur in geistlichen Dingen aus. Ihn habe ich angerufen, als ich eines Morgens nach unten kam und feststellte, dass das Erdgeschoss meines Hauses fünf Zentimeter tief unter Wasser stand, das durch die Leuchtkörper in der Kellerdecke floss.
Darrell und ich gingen hin und wieder zusammen ins Kino, als er schon im Ruhestand war und meine Mutter noch arbeitete. Als er aufhörte, selbst Auto zu fahren, chauffierte ich ihn bei Bedarf. In all der Zeit, die ich ihn kannte, ist er mir gegenüber nur zweimal laut geworden, einmal, als wir vor einem Umzug den Inhalt des Kellers sichteten und ich zu ihm sagte, er solle sich von seinen Mother-Jones-Magazinen trennen, die er schon ein Leben lang sammelte und die eine Reihe riesiger, bleischwerer Vinylsammelordner füllten. Diese Zeitschriften gingen mich nichts an, belehrte er mich, und er hatte ja recht, sie gingen mich nichts an. Beim zweiten Mal hockten wir in ebenjenem Keller, um dort einen Tornado auszusitzen, und irgendwann reichte es mir schließlich, und ich sagte, ich würde jetzt nach Hause fahren. Tornadowarnungen sind bei uns in Tennessee keine Seltenheit. Man könnte leicht das ganze Frühjahr im Keller verbringen. Aber Darrell schrie los und untersagte mir, jetzt schon nach oben zu gehen. Und wieder hatte er recht. Das war alles, was es zwischen uns je an Konflikten gab.
Ich saß über die Jahre oft an Darrells Krankenhausbett, denn solange ich ihn kannte, war er entweder krank oder wieder einmal verunglückt, aber insgesamt habe ich nicht viel für ihn getan. Seine Söhne lebten in anderen Bundesstaaten, aber seine Tochter war immer für ihn da, wie es sich für eine gute Tochter gehört. Und er hatte meine Mutter. Ich wurde also kaum gebraucht.
Wie mein Leben verlaufen wäre, wenn Darrell mein Vater gewesen wäre, oder auch der Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin, weiß ich nicht. Erbitterten Widerstand gegen mein Schreiben kann ich mir bei ihm nur schwer vorstellen, ebenso wenig wie begeisterten Zuspruch dafür. Dadurch aber, dass er als dritter Vater zu einem Zeitpunkt in mein Leben trat, als mein Bedarf an Vätern eigentlich vollauf gedeckt war, machte er mir ein wunderbares Geschenk: Er setzte mich weder mit meiner Arbeit gleich, noch sah er in mir eine bloße Verlängerung meiner Mutter. Bei ihm durfte ich einfach nur eine weitere Person an einem vollbesetzten Tisch sein, ein geschätzter Neuzugang.
Darrell stürzte fortwährend. Dann musste sein Schwiegersohn kommen, um ihn vom Boden aufzuheben, oder die Feuerwehr rückte an. Er brach sich Rippen, zog sich Quetschfrakturen in der Wirbelsäule zu. Er aß nichts mehr, bis er nur noch Haut und Knochen war und wir uns fragten, wie er in dem Zustand weiterleben konnte. Das ging jahrelang so, und viel von seiner Liebenswürdigkeit wurde von den fürchterlichen Schmerzen aufgezehrt. Als meine Mutter ihn nicht länger allein versorgen konnte, brachte sie ihn im betreuten Wohnen unter. Sie besuchte ihn jeden Tag. Er war der Überzeugung, dass sein Nachbar nachts in sein Zimmer schlich und seine Kaffeemaschine mit Spinnen füllte. Er lebte und lebte und lebte, und dann starb er.
Nach so langem Leiden fällt es mitunter schwer, sich in Erinnerung zu rufen, was ein Mensch einem einmal bedeutet hat. Unser Vater starb, als meine Schwester und ich noch im Flugzeug nach Kalifornien saßen, um uns von ihm zu verabschieden. Wie oft hatten wir diese Reise schon unternommen, um Abschied zu nehmen? Bei unserer Ankunft lag er still dort im Bett, und wir küssten ihn.
Allen sechs Kindern war es vergönnt, Mike in seiner letzten Woche noch einmal zu sehen. Das ihm gewidmete Buch kam rechtzeitig aus der Druckerei, und ich konnte ihm die Seite zeigen, auf der sein Name stand, Für Mike Glasscock. Er wünschte sich eine grüne Bestattung, und als er starb, brachten wir seinen Leichnam in einen speziell dafür vorgesehenen Begräbniswald. Mein Stiefbruder hatte eigenhändig die Kiste aus Kiefernholz gezimmert, die wir auf einem Karren in den Wald rollten, und wir begruben ihn selbst, schaufelten stundenlang Erde und sangen in den Pausen, die wir zwischendurch einlegten, all die Lieder, die er am liebsten gemocht hatte. As I walked out in the streets of Laredo, as I walked out in Laredo one day.
Jetzt, wo sie alle tot sind, liegt für mich klar auf der Hand, was ich zu ihren Lebzeiten partout nicht sehen wollte, nämlich dass sie nur gelegentlich an mich dachten, genau wie auch ich nur gelegentlich an sie dachte. Von jedem meiner drei Väter nahm ich die Dinge, die ich benötigte, und dann verwandelte ich sie in Geschichten – mein Vater schenkte mir Kraft, von Mike erhielt ich grenzenlose Liebe und Bewunderung, von Darrell Akzeptanz. Diese Geschichten sind alle wahr, doch ebenso wahr sind Tausende weitere Geschichten, wie all die Abende in der Küche im Rossmoyne-Haus, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, mit seiner Dienstwaffe im Gürtelholster unter seinem Anzugsakko, und ich mich auf seine Schuhe stellte, damit wir tanzen konnten, und mein Vater sang, während er uns vor und zurück wiegte, Embrace me, my sweet embraceable you. Mein Gott, wie ich ihn liebte. Wie sehr er mich liebte! Wie stolz er auf das war, was ich tat, wie dankbar ich für seine Hilfe war.
Und da war Mike, der mit mir zu einer Farm in der Nähe fuhr, damit ich mir dort zu meinem neunten Geburtstag ein Schweinchen aussuchte. Ich hatte das Buch Wilbur und Charlotte Dutzende Male gelesen und wünschte mir seither nichts inniger als ein eigenes Schwein. Er setzte mich oben auf einen Zaun, dann wuselten alle Ferkel vorbei, und ich zeigte auf das kleinste, schwächste. Der Bauer ließ das Ferkel in einen Jutesack fallen, den er oben zuknotete, und diesen Sack mit dem quiekenden, zappelnden Inhalt verstaute Mike hinten auf dem Rücksitz, und wir fuhren nach Hause. Ich war so glücklich wie noch nie, weil ich nun ein Mädchen wie Fern war, und auch Mike war so glücklich wie noch nie, weil er noch nie in seinem Leben jemanden so glücklich gemacht hatte.
Dann denke ich an Darrell mit seiner Familie, mit seinen Kindern nebst Ehepartnern und Kindern, mit unseren Ehemännern, wir alle rund um den Esstisch in dem Haus versammelt, in dem er mit meiner Mutter wohnte, und alle vereint in herzlichem Gelächter. Es waren nie zuvor so viele Menschen in diesem Haus gewesen, und das Durcheinander und die Gespräche wurden zu einer Art Licht, und ich, die sonst in Gesellschaft immer nach einem Vorwand suchte, mich davonzustehlen, wollte gern bei ihnen bleiben.
Das erste Thanksgiving
In meinem ersten Jahr am College hatte ich solches Heimweh, dass meine Cousins mir ein Flugticket kauften, damit ich an Halloween zu Hause in Nashville sein konnte. An Halloween! Es war eine fantastische Extratour, allerdings mit der unbeabsichtigten Folge, dass ich kaum schon drei Wochen darauf an Thanksgiving wieder nach Hause kommen konnte, nur um dann zu Weihnachten abermals anzureisen. Ich würde also Thanksgiving am College verbringen müssen. Dort hatte ich zwar schon einige Freundschaften geknüpft, die aber in jenem ersten Semester alle noch nicht so weit gediehen waren, dass mich jemand über die Feiertage zu sich nach Hause eingeladen hätte. Ich studierte am Sarah Lawrence College, eine halbe Stunde nördlich von Manhattan. Das hübsche Wohnheim, in dem ich mir mit einer Kommilitonin ein Zimmer teilte, war ein ehemaliges Privathaus, mit einer Küche im Erdgeschoss. Für ein langes Wochenende, dachte ich mir, wäre es dort durchaus auszuhalten.
Wenn ich eine Heftzwecke in die Landkarte meines Lebens stecken und sagen sollte, hier, hier genau hat das Erwachsensein angefangen, würde ich mich für jenes Thanksgiving-Wochenende 1981 entscheiden. Ich war siebzehn Jahre alt. Während meine Mitbewohnerin am Mittwoch ihre Tasche packte, um mit dem Zug heim nach Boston zu fahren, machte ich mich mit einer Einkaufsliste auf zum A&P-Supermarkt in Bronxville. Als mir klarwurde, dass ich hierbleiben müsste, hatte ich in der Bücherei eine Ausgabe von The Joy of Cooking ausgeliehen. Ich machte eine Liste: Butter und Zucker, Zwiebeln und Sellerie, diverse Kartoffeln, ein Truthahn. Ich hatte Geld vom Babysitten und meiner wöchentlichen Schicht im Büro des Dekans. Ich war ein Mädchen, das immer etwas Geld in der Tasche hatte. Ich hatte fünf weitere Kids aufgetrieben, die in anderen Wohnheimen lebten und in derselben Lage waren wie ich, und sie zu mir zum Abendessen eingeladen. Beim Essen mittags in der Cafeteria nahm ich reichlich Besteck mit. In dem Haus, in dem ich wohnte, gab es Teller und Tassen, eine überschaubare Anzahl Töpfe, aber nur sehr wenig Besteck.
Irgendwen zu fragen, ob ich in meinem Zimmer bleiben konnte, das kam mir nicht in den Sinn. Es war ja schließlich mein Zimmer. Am Mittwochabend jedoch, als die Heizungen im Haus auf die Temperatur heruntergeregelt wurden, die eben noch ausreichte, damit das Wasser in den Leitungen nicht gefror, fragte ich mich, ob man vielleicht erwartet hatte, dass ich zusammen mit allen übrigen Mädchen das Wohnheim verlassen würde. Tja, zu spät. Die Liegenschaftsverwaltung des Colleges hatte bis Montag geschlossen. In jener seligen grauen Vorzeit, als es weder Handys noch Internet gab, ließen sich derlei missliche Lagen nicht einfach so abstellen. Stattdessen passte man sich entsprechend an. Ich zog einen weiteren Pulli an und darüber meinen Mantel.
Ehe ich ans College ging, war ich meiner Mutter an Thanksgiving nur eine sehr bescheidene Hilfe gewesen. Wenn sie mich bat, etwas zu schälen, schälte ich es und verzog mich dann, um mir im Fernsehen die Macy’s Parade in New York anzuschauen, bis sie mich zurückrief, um noch etwas zu schälen. Ich zeigte null Initiative und machte mir keine Mühe, bis zum Jahr 1981, als ich selber Thanksgiving-Dinner-Gäste hatte. Damals fing ich an, zu Eis gewordene Butter mit einem eisigen Messer in meinen eisigen Händen für einen Pie-Teig in erbsengroße Stückchen zu schneiden.
Ende der Leseprobe