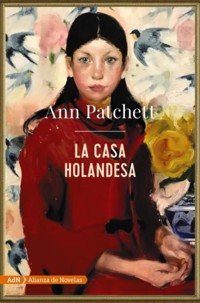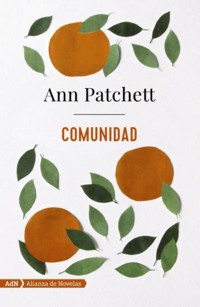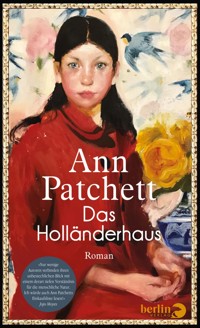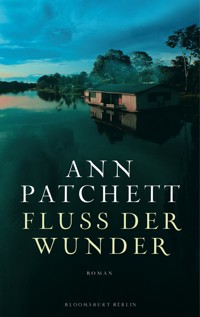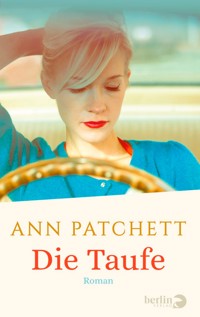12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Frühling 2020 kehren Laras drei Töchter beim ersten Lockdown in ihr Elternhaus zurück, eine Obstfarm im nördlichen Michigan. Bei der Kirschernte bitten sie ihre Mutter, ihnen die Geschichte von Peter Duke zu erzählen, dem weltberühmten Schauspieler, mit dem sie vor Jahren in einer Theatergruppe namens Tom Lake gemeinsam auftrat – und mit dem sie eine stürmische Liebesgeschichte erlebte. Durch Laras Erinnerungen an ihre Jugend sehen die drei Töchter sich herausgefordert, nicht nur die Beziehung zu ihrer Mutter, sondern auch ihr jeweils ihr eigenes Leben kritisch zu überprüfen und liebgewonnene Ansichten und Gewissheiten neu zu denken. Vom Reese Witherspoon Bookclub empfohlen. »Der Sommer zu Hause« ist eine Meditation über Jugendliebe, Eheliebe und das Leben der Eltern bevor sie Eltern wurden. Hoffnungsfroh und melancholisch zugleich stellt der Roman die Frage nach dem Glücklichsein in einer vor die Hunde gehenden Welt. Wie in all ihren Romanen kombiniert Ann Patchett erzählerische Brillanz mit nadelspitzen Einsichten in Familiendynamiken. Das Ergebnis ist eine üppige, leuchtende Geschichte, mit einer Intelligenz und und emotionalen Subtilität geschrieben, die wieder einmal beweisen, warum Patchett eines der verehrtesten und berühmtesten literarischen Talente unserer Zeit ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Für Kate DiCamillo, die die Laterne gehalten hat
Deutsch von Ulrike Thiesmeyer
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Tom Lake bei HarperCollins, US, New York.
© Ann Patchett 2023
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Redaktion: Stephan Pauly
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Gustave Caillebotte, Daisies (Bed of Daisies), c. 1892-1893. Musée des impressionnismes, Giverny © Fine Art Images/Heritage Images/Alamy Stock Photo und FinePic®
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Dass Veronica und ich Schlüssel erhielten, um an einem eisigen Samstagmorgen im April die Schule aufzuschließen, für das Vorsprechen für Unsere kleine Stadt, war ein Beleg für unsere langweilige Zuverlässigkeit. Der Regisseur des Stücks, Mr Martin, war mit meiner Großmutter befreundet und Versicherungsagent bei der State Farm Insurance. So wurde ich eingeschleust, über meine Großmutter, und Veronica war dabei, weil wir beide so ziemlich alles gemeinsam machten. In New Hampshire konnten die Leute von Unsere kleine Stadt nicht genug bekommen. Das Stück hatte für uns in etwa den Stellenwert, den die Verfassung oder das »Star Spangled Banner« für andere Amerikaner hatten. Es sprach für uns, gab uns das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, gesehen zu werden. Mr Martin rechnete mit einer hohen Beteiligung an dem Vorsprechen, was erklärte, warum er für diesen Tag die Turnhalle benötigte. Die Laientheaterproduktion hatte mit unserer High School nichts zu tun, aber da Mr Martin auch der Versicherungsagent des Schulleiters und höchstwahrscheinlich mit ihm befreundet war, wurde ihm die Bitte gewährt. So etwas war in unserer kleinen Stadt nicht ungewöhnlich.
Wir hatten unsere Thermobecher mit Kaffee und dicke Taschenbuchwälzer dabei, Veronica Feuerkind und ich Doktor Schiwago. Gegen die Schule an sich hatte ich nichts, aber ich hasste die Turnhalle und alles, wofür sie stand: Mannschaftssportarten, Cheerleading, brutale Kickball-Partien, im Kreis laufen, wenn es draußen zu kalt war, steife Tanzveranstaltungen, Abschlussfeiern. An jenem Samstagmorgen aber war die Halle menschenleer und seltsam schön. Durch die schmalen Fenster gleich unterhalb der Dachlinie strömte das Sonnenlicht herein. Ich glaube nicht, dass mir je zuvor aufgefallen war, dass es in der Turnhalle Fenster gab. Die Fußböden, die Wände und die Tribüne bestanden alle aus dem gleichen hellen Holz. Die Bühne befand sich an einem Ende hinter dem Basketballkorb, mit schweren roten Vorhängen, die nun aufgezogen waren und ein mattschwarzes Nichts offenbarten. Dort sollte sich alles abspielen. Vor der Bühne sollten wir einen Banketttisch und fünf Klappstühle aufstellen (»dicht, aber nicht zu dicht«, hatte uns Mr Martin instruiert) und dann, achtundzwanzig Meter davon entfernt, unter dem Basketballkorb gegenüber, einen weiteren Banketttisch gleich vor die Türen zum Empfangsbereich. An diesem Tisch sollten wir uns um die Anmeldungen kümmern. Wir bugsierten die beiden Klapptische aus dem Abstellraum. Wir holten Klappstühle heraus. Wir sollten den Morgen über erklären, wie das Formblatt auszufüllen war: Name, Künstlername, falls abweichend, Größe, Haarfarbe, Alter (in Sieben-Jahres-Kategorien – bitte eine auswählen), Telefonnummer. Die Bewerber waren gebeten worden, ein Porträtfoto und einen Lebenslauf mitzubringen, mit allen Rollen, die sie schon gespielt hatten. Wir hatten einen Becher mit Stiften. Für Leute, die keinen Lebenslauf dabeihatten, war Platz für entsprechende Angaben vorhanden, und Veronica war darauf vorbereitet, von Kandidaten ohne Foto ein Polaroid zu machen und mit einer Büroklammer an das Formblatt zu heften. Mr Martin wies uns darauf hin, Bewerber mit weniger Erfahrung nicht in Verlegenheit zu bringen, weil unter ihnen, wie er wörtlich sagte, »mitunter die Diamanten verborgen sind«.
Aber Veronica und ich waren keine Theatermädchen. Theatermädchen hatte man für diese Aufgabe nicht angefragt, für den Fall, dass sie sich für eine Rolle bewerben wollten. Wir waren normale Mädchen, die gar nicht gewusst hätten, wie man Erwachsene aufgrund ihrer fehlenden Bühnenerfahrung hätte verunsichern sollen. Nachdem der Papierkram erledigt war, sollten wir die Blätter aushändigen, von denen sie ablesen sollten, die »Seiten«, wie Mr Martin uns erklärte, zusammen mit einer Nummer auf einem Zettel, und dann würden wir sie zurück in den Empfangsbereich schicken, um dort zu warten.
Als sich die Türen um acht Uhr öffneten, strömten so viele Leute herein, dass Veronica und ich an unseren Tisch zurückeilen mussten, um vor der Menschenmenge dort anzukommen. Wir hatten umgehend alle Hände voll zu tun.
»Ja«, versicherte ich einer Frau und dann noch einer, »falls Sie für Mrs Gibbs lesen, werden Sie auch für Mrs Webb in Betracht gezogen.« Was ich nicht sagte, obwohl es rasch augenfällig wurde, war, dass man auch für Emilys Mutter infrage kam, wenn man als Emily vorsprach. Bei High-School-Aufführungen war es nicht unüblich, dass Fünfzehnjährige die Eltern von Siebzehnjährigen spielten, beim Laientheater jedoch gingen die Uhren anders. Die Bewerber an jenem Morgen gehörten allen Altersklassen an, es kamen nicht bloß ältere Männer, die es auf die Rolle des Spielleiters abgesehen hatten, sondern Leute im Collegealter, die Emily und George spielen wollten. (Die Emilys waren zu stark geschminkt und gekleidet wie die Amish-Mädchen, die auf dem Bauernmarkt Zimtschnecken verkauften. Die Georges beobachteten verstohlen die anderen Georges.) Sogar Kinder kamen an unseren Tisch und verkündeten, dass sie für Wally oder Rebecca lesen wollten. Vermutlich steckten ihre Eltern dahinter, die es auf Kinderbetreuung abgesehen hatten, denn welcher Zehnjährige verkündet schon von sich aus beim Frühstück, dass er Wally Webb spielen möchte?
»Wenn die alle wiederkommen und eine Eintrittskarte kaufen, wird das ein echter Renner«, sagte Veronica. »Die ganze Produktion kann an den Broadway weiterwandern, und wir werden reich.«
»Inwiefern werden wir deswegen reich?«, fragte ich.
Sie extrapoliere nur, sagte Veronica.
Mr Martin hatte an alles gedacht, außer an Klemmbretter, was sich als wirkliches Manko entpuppte. Leute nutzten unseren Tisch als Schreibunterlage, wodurch ein Engpass entstand und der Verkehrsfluss ins Stocken geriet. Ich versuchte zu entscheiden, was deprimierender war, Menschen zu sehen, die ich kannte, oder eher die Unbekannten. Cheryl, die im Major Market an der Kasse saß und im Alter meiner Mutter gewesen sein dürfte, hielt einen Lebenslauf mitsamt Foto in den Händen, an denen sie Fäustlinge trug. Falls Cheryl immer schon hatte Schauspielerin werden wollen, erschien es mir ausgeschlossen, jemals wieder in den Supermarkt zu gehen. Dann waren da die vielen Fremden, Männer und Frauen in dicken Mänteln mit Schals, die sich neugierig in der Turnhalle umsahen, weil sie offensichtlich zum ersten Mal hier waren. Mir vorzustellen, dass diese Leute an diesem eisigen Morgen wer weiß wie lange hergefahren waren, weil sie die weite Anreise für Proben und Aufführungen bis in den Sommer hinein auf sich nehmen wollten, fand ich ebenso traurig.
»›Die ganze Welt ist Bühne‹«, sagte Veronica, weil Veronica meine Gedanken lesen konnte, »›und alle Frau’n und Männer wollen bloß Spieler sein.‹«
Ich nahm einen Lebenslauf mit Foto vom Vater meiner Freundin Marcia entgegen, die ihren Namen als Mar-ssi-a aussprach. Ich hatte am Abendbrottisch dieses Mannes gesessen, auf dem Rücksitz seines Kombis, wenn er mit seiner Familie Eis essen fuhr, hatte im zweiten Bett im rosaroten Zimmer seiner Tochter geschlafen. Ich tat so, als würde ich ihn nicht kennen, das schien mir die freundlichste Lösung zu sein.
»Laura«, sagte er mit strahlendem Lächeln. »Guten Morgen! Was für ein Andrang.«
Ich nickte zustimmend, gab ihm dann seine Nummer und die Seiten und wies ihn an, draußen im Empfangsbereich zu warten.
»Wo ist denn die Toilette?«, fragte er.
Es war zu peinlich. Selbst die Männer wollten wissen, wo die Toilette war. Sie wollten ihre Haare in Ordnung bringen, die von Strickmützen platt gedrückt waren. Wollten ihre Rolle laut vor dem Spiegel lesen, um zu prüfen, wie sie dabei aussahen. Ich verriet ihm, dass die bei den Sprachlaboren weniger überlaufen sei.
»Ihr Mädchen habt ja offenbar gut zu tun«, sagte meine Großmutter. Sie tauchte unangekündigt auf, als Marcias Vater sich gerade entfernte.
»Möchten Sie eine Rolle?«, fragte Veronica. »Ich kenne Leute. Ich kann einen Star aus Ihnen machen.« Veronica liebte meine Großmutter. Sie wurde von allen geliebt.
»Nein, ich möchte nur zusehen.« Meine Großmutter warf einen Blick auf den Tisch vor der Bühne, zum Zeichen, dass sie dort neben Mr Martin und den Theaterleuten Platz nehmen würde. Meine Großmutter, die Inhaberin von Stitch-It war, der Änderungsschneiderei in der Innenstadt, hatte sich bereit erklärt, die Kostüme zu schneidern, was bedeutete, dass sie damit auch mich einspannte, weil ich nach der Schule bei ihr aushalf. Sie küsste mich auf die Stirn, ehe sie quer über das völlig menschenleere Basketballfeld ging und sich an den weit entfernten Tisch setzte.
Das Vorsprechen sollte um Punkt zehn Uhr beginnen, doch wegen der Klemmbrett-Situation verzögerte es sich auf nach halb elf. Als schließlich alle angemeldet waren, sagte Veronica, dass sie die Leute, nach Nummer und der Rolle, derentwegen sie gekommen waren, in kleine Grüppchen einteilen und zum Warten den Gang hinunterführen würde. »Ich spiele den Schäferhund«, sagte sie und erhob sich. Ich würde an unserem Tisch sitzen bleiben und lautlos die Nachzügler registrieren. Mr Martin und drei andere Leute nahmen neben meiner Großmutter ihre Plätze am anderen Ende des Basketballfelds ein, und in der Turnhalle, in der den ganzen Morgen dröhnender Lärm geherrscht hatte, kehrte mit einem Mal Stille ein. Veronica sollte die Bewerber, wenn sie namentlich aufgerufen wurden, den Gang entlang und die Treppe hinauf begleiten, durch den Bereich hinter den Kulissen und bis zum Bühnenrand, wo sie darauf warteten, bis sie an der Reihe waren. Das Vorsprechen ihrer Mitbewerber durften die Wartenden nicht mit ansehen, und nach ihrem Vorsprechen wurden die Leute verabschiedet, es sei denn, sie wurden ausdrücklich zum Bleiben aufgefordert. Die Spielleiter kämen als Erste dran (da der Spielleiter die größte und wichtigste Rolle des Stücks war), gefolgt von den Georges und Emilys, und dann die übrigen Webbs (Mister und Missus und Wally) und die übrigen Gibbs (Doktor und Missus und Rebecca). Die kleineren Rollen würden an die Zweitplatzierten vergeben. Niemand geht mit der Hoffnung aus dem Haus, die Rolle von Constable Warren zu ergattern, doch wenn man als Constable Warren besetzt wird, sagt man dazu nicht Nein.
»Mr Saxon«, rief Mr Martin. »Sie lesen den Anfang des zweiten Aktes.« Alle Spielleiter sollten den Anfang des zweiten Aktes lesen.
Dass ich das leise Schlurfen seiner Schritte auf der Bühne hören konnte, überraschte mich. »Ich bin der Erste?« Mr Saxon hatte nicht bedacht, dass sich das aus seinem frühen Eintreffen, eine halbe Stunde ehe die Turnhalle der High School ihre Pforten öffnete, zwangsläufig ergeben würde.
»Sie, Sir, sind der Erste«, bestätigte Mr Martin. »Bitte fangen Sie an, wenn Sie so weit sind.«
Und so räusperte Mr Saxon sich und fing, nachdem er eine volle Minute länger gewartet hatte, als eben noch vertretbar war, an. »Drei Jahre sind vorüber«, sagte er. »Ja, die Sonne ist mehr als tausendmal aufgegangen.«
Ich saß weiter mit dem Gesicht zum Empfangsbereich, wie schon den ganzen Morgen über, obwohl die beiden Doppeltüren nun verschlossen waren. Mr Martin und meine Großmutter und die anderen Leute saßen weit weg, mit dem Rücken zu mir, ich mit dem Rücken zu ihnen, und der arme Mr Saxon, der dort oben einen schrecklichen Tod starb, blickte ohne Zweifel den Regisseur an und nicht den Rücken eines High-School-Mädchens. Dennoch wandte ich mich nicht um, aus Höflichkeit. Er las weiter, bis ans Ende der Seite. »Ah! Da, es ist der Fünf-Uhr-fünfundvierzig-Zug nach Boston«, sagte er schließlich, hörbar erleichtert. Sein Vortrag ging über zwei Minuten, und ich fragte mich, wie man es für klug halten konnte, eine so lange Passage auszuwählen.
»Vielen Dank«, sagte Mr Martin in einem Tonfall ohne jede Ermutigung.
In mir stieg eine echte Traurigkeit auf. Wäre Veronica hier gewesen, hätten wir schweigend Galgenmännchen gespielt und bei jedem Wort, das Mr Saxon zu klagend betonte, ein Körperglied hinzugefügt. Wir hätten uns geweigert, einander anzusehen, aus Angst, sonst loszulachen. Aber Veronica war draußen im Flur, und anders, als wir beide erwartet hatten, war niemand zu spät noch eingetrudelt. Wie sich herausstellte, hatten alle Bewerber dieselbe Idee gehabt: pünktlich einzutreffen, sich anzumelden, wie angewiesen in einer Schlange zu warten und sich damit als brave Befehlsempfänger darzustellen. Mr Martin rief den zweiten Bewerber auf, Mr Parks.
»Soll ich oben auf der Seite anfangen, wo die Markierung ist?«, fragte Mr Parks.
»Das wäre wunderbar«, sagte Mr Martin.
»Drei Jahre sind vorüber«, sagte Mr Parks und wartete dann drei Jahre, um das Gesagte zu unterstreichen. »Ja.« Er machte eine weitere Pause. »Die Sonne ist mehr als tausendmal aufgegangen.«
Mr Parks spielte für Maine, nicht für New Hampshire. Hätte ich mich umgewendet, hätte ich sicherlich einen Mann in einer gelben Regenjacke gesehen, mit einem Hummer, den er unter den Arm geklemmt hatte. Ich griff lautlos in den Rucksack, der hinten an meinem Stuhl hing, und tastete nach meinem Schiwago. Das war immer der Plan gewesen: Sie würden vorsprechen, und ich würde lesen, und wenn es uns irgendwann zu langweilig würde, würden Veronica und ich unsere Posten tauschen, damit sie lesen konnte. Mr Parks war noch lange nicht am Seitenende angelangt. Das Gute an Doktor Schiwago war, dass er der verwickelten Handlung wegen meine volle Konzentration erforderte. So sehr gefiel mir der Roman nicht, aber ich wollte wissen, wie es mit Lara weiterging. Als jedoch ein Spielleiter zum sechsten Mal hoffnungsvoll verkündete, dass die Sonne aufgegangen war, merkte ich, dass Pasternak es mit meinen Umständen nicht aufnehmen konnte, und drehte meinen Stuhl also herum.
Ein Spielleiter nach dem anderen schritt auf die Vorbühne hinaus und fing an. Die unbeholfene Art, wie diese Männer dastanden, und wie heftig das Papier in ihren Händen zitterte, das war nichts, was ein High-School-Mädchen je zu sehen bekommen sollte. Einige von ihnen hatten annehmbare Stimmen, doch wenn man sie über eine Bootskante gestoßen hätte, wären sie im Wasser versunken wie ein Anker. Null Auftrieb. Andere fühlten sich in ihren Körpern sichtlich wohl, schlenderten mit der Hand in der Hosentasche auf der Bühne umher, sprachen aber dafür jedes Wort falsch aus. Es war ein Widerstreit zwischen Kopf und Körper: Manche hatten das eine, manche das andere, doch keiner brachte beides zusammen, und einige verfügten weder über das eine noch das andere. Alle Spielleiter zusammen waren ein Autounfall, eine Massenkarambolage, und ich konnte den Blick nicht abwenden.
Allem Augenschein zum Trotz war es fast Frühling in New Hampshire. In sieben Wochen hätte ich mein elftes Schuljahr hinter mir, doch mir ging ständig durch den Kopf, dass dies der erste Tag meiner wahren Erziehung war. Keins der Bücher, die ich gelesen hatte, war so wichtig wie das hier, keine der Matheklausuren, kein Geschichtsaufsatz hatte mir das richtige Agieren beigebracht, und mit »Agieren« meine ich nicht in einem Theaterstück, sondern im wirklichen Leben. Was ich hier sah, war nichts weniger als eine Lehrstunde darüber, mich in der Welt zu präsentieren. Schauspielern zuzusehen, die ihren Text auswendig gelernt hatten und über Monate angeleitet worden waren, war das eine, aber mitzuerleben, wie Erwachsene auf der Bühne stammelten und versagten, das war etwas völlig anderes. Zu entschlüsseln, was sie jeweils falsch machten, darauf kam es an. Mr Anderson, ein Kreditberater bei der Liberty Bank, hatte eine Tabakspfeife mitgebracht, ein ganz brauchbares Requisit womöglich, doch er hatte sie sich die ganze Zeit zwischen die Zähne geklemmt. Dass es beim Sprechen zweckdienlich war, die Zähne auseinanderzubekommen, sollte einem auch ohne Schauspielkenntnisse einleuchten, und doch war mir diese Tatsache klar und ihm nicht. Dann, in der Mitte des zweiminütigen Vortrags, faltete er das Textblatt zusammen, von dem er vorlas, steckte es in die Innentasche seines Jacketts, entnahm der Aufsatztasche dieses Jacketts eine Schachtel Streichhölzer und entzündete seine Pfeife. Das Paffen, das erforderlich war, um das Feuer in den Tabak zu ziehen, das Flämmchen, das aus dem Pfeifenkopf aufstieg, all das gehörte zu seinem Auftritt. Dann steckte er die Schachtel und das abgebrannte Hölzchen wieder ein, zog das Blatt heraus, entfaltete es und setzte seine Darbietung fort, während der süß duftende Pfeifenrauch zu den Dachsparren aufstieg und bis zu mir herüberwaberte.
Dass Mr Martin in diesem Augenblick nicht einfach aufstand und sagte, vergessen wir’s, ich habe kein Interesse mehr daran, Unsere kleine Stadt zu inszenieren, zeugte von seiner inneren Stärke. Stattdessen hüstelte er und dankte Mr Anderson für seine Zeit. Mr Anderson nickte ernst und ging von der Bühne ab.
Jeder Spielleiter hatte eine unfreiwillige Lektion für mich: Klarheit, Vorsatz, Schlichtheit. Sie erteilten mir Unterricht. Wie all meine Freundinnen beschäftigte mich die Frage, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. An vielen Tagen spielte ich mit dem Gedanken, Englischlehrerin zu werden, weil ich in Englisch am besten war und mir die Vorstellung gefiel, mein Leben mit Lesen zu verbringen und damit, andere Menschen zum Lesen zu ermuntern. Im hinteren Teil eines Spiralblocks hielt ich ständig Ideen für meinen Lehrplan fest, malte mir aus, wie wir mit David Copperfield anfangen würden, kaum jedoch hatte ich mich für den Lehrberuf entschieden, schrieb ich auch schon ans Friedenscorps, um Bewerbungsunterlagen anzufordern. Ich liebte Bücher, natürlich, aber wie konnte ich mein Leben in einem Klassenzimmer verbringen, in dem Bewusstsein, dass Brunnen gebohrt und Moskitonetze verteilt werden mussten? Das Friedenscorps wäre für mich der direkteste Weg, etwas wahrhaft Anständiges mit meinem Leben anzufangen. Anstand, ein Begriff, in dem für mich alles gebündelt war, was einen guten Menschen ausmachte, spielte bei meinen Überlegungen über die Zukunft eine gewichtige Rolle. Der Tierarztberuf war anständig – irgendwann sprachen wir alle mal davon, Tierärztin zu werden –, doch dafür musste man Chemie belegen, und Chemie machte mich nervös.
Warum aber haschte ich immer nach sechshundert Seiten starken Romanen britischer Autoren, nach exakten Wissenschaften und Tätigkeiten, für die eine Malariaimpfung erforderlich war? Warum nicht etwas in Betracht ziehen, was ich bereits gut beherrschte? Meine Freundinnen fanden alle, dass ich die Änderungsschneiderei meiner Großmutter übernehmen sollte, weil ich nähen konnte und meine Freundinnen nicht. Ebenso wenig wie ihre Mütter. Wenn ich einen Saum wendete oder einen Hosenbund enger machte, sahen sie mich an, als wäre ich Prometheus, der mit dem Feuer vom Olymp herabsteigt.
Falls Sie sich nun fragen, was denn an Änderungsarbeiten anständig sein soll, ich verrate es Ihnen: meine Großmutter. Sie war Schneiderin und dabei zugleich ein Quell menschlichen Anstands. Wenn Veronica über die Jeans sprach, die ich vor der Altkleidersammlung gerettet hatte, indem ich die Hosenbeine enger machte, sagte sie: »Du hast mir das Leben gerettet!« Menschen hatten es gern, wenn ihnen ihre Sachen gut passten, sie passend zu schneidern, war folglich hilfreich, anständig. Das hat mir meine Großmutter – der immer ein gelbes Bandmaß um den Hals baumelte und die stets ein Nadelkissen am Handgelenk trug, gehalten von einem Gummiband (ich nannte es die Nadelkissenkorsage) – beigebracht.
Der Anblick dieser Männer, die den immer gleichen Text so miserabel wiederholten und dabei ihre Brille mit riesigen weißen Taschentüchern putzten, brachte mich wirklich dazu, über mein Leben nachzudenken.
»Stopp mal, stopp mal, stopp mal, du wolltest Tierärztin werden?« Maisie schüttelt den Kopf. »Du wolltest niemals Tierärztin werden. Davon hast du nie etwas gesagt.« Für Maisie beginnt im Herbst ihr drittes Studienjahr in Tiermedizin, natürlich nur, wenn der Unibetrieb im Herbst wiederbeginnt.
»Eine Zeit lang wollte ich das. Du weißt doch, wie das in der High School ist.«
»Du wolltest in der High School Kinderärztin werden«, sagt Nell zu ihrer Schwester, wie zu meiner Verteidigung.
»Könnte mir irgendwer erklären, was das alles mit Peter Duke zu tun hat?«, fragt Emily. »Was hat Nähen mit Duke zu tun?«
Meine Mädchen haben mich aufgefordert, mit der Geschichte von Anfang an zu beginnen, obwohl sie der Anfang gar nicht interessiert. Sie möchten die Teile hören, die sie hören möchten, alles Übrige soll herausgeschnitten werden, um Zeit zu sparen. »Wenn du meinst, dass du es besser kannst, dann erzähl du die Geschichte«, sage ich und stehe auf, aber nicht strafend. Ich recke die Hände hoch über den Kopf. »Ihr könnt sie euch gegenseitig erzählen, ihr drei.« Hier ist wahrlich genug zu tun, weiß der Himmel.
»Scht«, sagt Nell zu ihren Schwestern. Sie klopft aufs Sofa. »Komm her«, sagt sie zu mir. »Komm zurück. Wir hören dir zu.« Nell versteht sich darauf, Menschen umzustimmen.
Emily, die Älteste, streicht sich ihre prächtigen, seidigen dunklen Haare über die Schulter. »Ich dachte bloß, es würde hier um Duke gehen. Mehr sage ich gar nicht.«
»Wirf doch nicht dauernd deine Haare zurück«, sagt Maisie gereizt. Maisie hat sich im Frühjahr von ihrem Vater die Haare kurz schneiden lassen, und sie fehlen ihr. Ihr Hündchen Hazel richtet sich auf, dreht sich dreimal umständlich um die eigene Achse und lässt sich dann in einem behaglichen Knäuel zurück auf die Couch fallen. Sie sagen mir, dass sie bereit sind.
Die drei Mädchen sind inzwischen alle in ihren Zwanzigern, und trotz ihrer persönlichen Entwicklung und zur Schau getragenen Emanzipation haben sie kein Interesse an einer Geschichte, in der es nicht um einen gut aussehenden, berühmten Mann geht. Gleichwohl, ich bin ihre Mutter, und sie wissen, dass sie mich erdulden müssen, um zu diesem Mann zu kommen. Ich setze mich wieder aufs Sofa und fange noch einmal an, obwohl ich genau weiß, dass die Teile, die sie gern hören würden, die Teile sind, die ich ihnen niemals erzählen werde.
»Duke«, sagt Emily. »Wir sind bereit.«
»Bis wir zu ihm kommen, dauert es noch eine Weile. Versprochen.«
»Waren das alle Spielleiter?«, sagte Mr Martin schließlich, mit müder Stimme.
Hinter dem Rand des Vorhangs tauchte Veronicas lieber Kopf auf. »Das waren alle«, rief sie, und dann fing sie meinen Blick auf. Sie warf für einen Sekundenbruchteil ihren Kopf zurück und brach dann in Gelächter aus.
Mr Martin bückte sich nach seiner Thermoskanne unten auf dem Boden und schraubte den Deckel auf, während seine Mitstreiter untereinander tuschelten. »Weiter«, sagte er.
Anders als der Spielleiter, der eine einsame Gestalt war, existierten George und Emily in Beziehung zueinander und zu ihren Familien, daher sprachen die Georges und Emilys paarweise vor. Wieder hatte Mr Martin Passagen aus dem zweiten Akt ausgewählt, was meiner Meinung nach (und das High-School-Mädchen im hinteren Teil der Turnhalle hatte neuerdings zu allem eine Meinung) am zweckmäßigsten war. Im ersten Dialog kam Emily mehr zur Geltung und im zweiten eher George, außer man achtete mehr auf die Fähigkeit einer Person, zuhören zu können, in diesem Fall verkehrte sich die Gewichtung.
Ich rätselte, ob die Paare eher zufällig zusammengestellt waren, je nachdem, welche zwei Personen in der Schlange nebeneinanderstanden, oder ob Veronica sich hinter den Kulissen Späßchen erlaubte, denn der erste George schien ungefähr sechzehn zu sein, und die erste Emily sah keinen schweren Tag jünger aus als fünfunddreißig, nicht, dass ich da Näheres gewusst hätte. Es wurde von Frauen gemunkelt, die Emily schon ewig spielen wollten. Sie tingelten in New Hampshire von Städtchen zu Städtchen, jahrein, jahraus, um die Rolle irgendwo zu ergattern. Diese hier hatte ihre Haare zu zwei Zöpfen gebunden.
Mr Martin fragte, ob sie so weit seien, und George legte sofort los.
»Emily, was hast du gegen mich?«, sagte er. Ich hatte die Seite aus dem Textbuch vor mir auf dem Schoß liegen.
Emily blinzelte. Sie hatte etwas gegen George, so viel war klar, schien aber unschlüssig, ob sie ihm den Grund dafür verraten sollte oder nicht. Dann wandte sie sich zur Seite und sah Mr Martin an. Sie beschirmte ihre Augen, wie man es immer im Film sieht, wenn Schauspieler sich an den Regisseur im Zuschauerraum wenden, aber da es keine Bühnenbeleuchtung gab, gegen die sie hätte anblinzeln müssen, wirkte die Geste einfach nur albern. »Ich war noch nicht so weit«, sagte sie.
»Halb so wild«, sagte Mr Martin. »Fangen Sie einfach noch mal an.«
Ich malte mir aus, wie er mit Leuten über Kfz-Versicherungen sprach, über Lebensversicherungen, wie er ihnen versicherte, dass State Farm für sie da wäre, falls ihr Haus abbrannte. Er machte es ihnen sicherlich leicht, jede Wette.
»Emily, was hast du gegen mich?«, fragte George wieder.
Sie sah George an, als hätte sie ihn am liebsten umgebracht, um sich gleich darauf erneut Mr Martin zuzuwenden. »Er kann nicht einfach so anfangen«, sagte Emily. »Ich muss erst so weit sein.«
Ich verstand nicht, was los war, aber dann begriff ich: Sie hatte verloren. Wie ein Rennpferd, das gleich am Start strauchelt und stürzt. Sie hatte noch nicht mal angefangen, und es war schon vorbei.
»Wir können es noch einmal wiederholen«, sagte Mr Martin. »Kein Problem.«
»Aber es ist eben ein Problem.« Würde sie weinen? Darauf warteten wir alle gespannt.
Der Junge war hoch aufgeschossen, mit einem verrückten Schopf aus hellbraunen Haaren, die ganz so aussahen, als hätte er sie sich selbst geschnitten, und zwar im Dunkeln. Der Ausdruck auf seinem Gesicht wirkte auf mich so, als hätte er im Kopf gerade irgendein Baseballproblem gewälzt und würde jetzt erst merken, dass er in Schwierigkeiten steckte. »Tut mir furchtbar leid«, sagte George, ganz so, wie George es auch sagen würde – kleinlaut und besorgt und ein wenig überrumpelt von alldem. Kurzum, der Junge setzte sein Vorsprechen fort, und das wusste Emily auch.
»Ich möchte mich noch mal anstellen«, sagte sie stockend. »Ich würde gern mit jemand anderem lesen.«
»Geht in Ordnung«, sagte Mr Martin, und ehe sie sich auch nur umgewandt hatte, rief er mit lauterer Stimme: »Wir brauchen eine andere Emily.«
An anderen Emilys herrschte kein Mangel. Es gab so viel mehr Emilys als Georges. Das wusste ich von der Anmeldung. Die abgehende Emily kam an der neuen Emily vorbei, locker fünfzehn Jahre jünger als sie, ein Mädchen mit glänzenden blonden Haaren, die es offen trug. Sie wiegte sich leicht in den Hüften, sodass ihr hübscher Rock beim Gehen hin- und herschwang. Es war grausig zu sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Ich wusste, dass sich die Erste nicht noch einmal anstellen würde.
Dieser George allerdings, er gefiel mir. Die Spielleiter hatten die Messlatte denkbar tief gelegt. Der George blieb drei weitere Durchgänge auf der Bühne und agierte jedes Mal ein wenig anders, immer als Reaktion auf das Mädchen, mit dem er zusammen las. Wenn die Emily schrill war, war er sachlich. War die Emily scheu und zaghaft, kehrte er den stillen Beschützer heraus. Die Dritte – wusste der Himmel, wie sie das so fix hinbekam – fing an zu weinen. Nur ein paar Tränen zunächst, wirklich beeindruckend, doch dann verlor sie die Fassung und heulte richtig. »George, jetzt tut es mir leid, dass ich all das über dich gesagt hab. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist –«
Und George zückte auch schon sein Taschentuch. Hatten sie alle eins dabei? Er tupfte an ihrem Gesicht herum, mit einem einzigen beschwichtigenden »Sch«, das sie tatsächlich beruhigte, wie durch ein Wunder. Es bescherte mir eine Gänsehaut.
Von den nachfolgenden Georges lasen viele ihre Zeilen, als sprächen sie für Peter Pan vor. Je älter sie waren, desto mehr sprangen sie in eine Szene hinein, die gar nicht nach dergleichen verlangte. Die Emilys waren zittrig, gefühlvoll, zwängten die gesamte Bandbreite menschlicher Erfahrungen in jede Zeile. Sie waren wütend und voller Bedauern und sehr bewegt. Langsam fragte ich mich, ob die Rolle vielleicht schwieriger war, als ich gedacht hatte.
Hör dir doch mal zu, hätte ich gern quer durch die Halle gerufen. Hör dem zu, was du von dir gibst.
Ein mittelmäßiger George konnte drei oder vier Emilys lang auf der Bühne bleiben, einfach nur, weil er gebraucht wurde, doch wenn er sehr schlecht war, blieb er nur für eine. Bei den Spielleitern war ich peinlich berührt gewesen, und die Georges, zumindest die nach dem ersten, langweilten mich, die Emilys aber ärgerten mich regelrecht. Sie spielten die klügste Schülerin ihrer High-School-Klasse, als wäre sie ein kleines Dummchen. Emily Webb stellte Fragen, sagte die Wahrheit und wusste, was sie wollte, während diese Emilys nervös die Hände in ihren Prärieröcken vergruben und maunzten wie kokette Kätzchen. Konnte sich von ihnen denn keine mehr erinnern, wie es war, das intelligente Mädchen zu sein? Es waren keine High-School-Mädchen gekommen, um für die Rolle vorzusprechen, keine Mädchen meiner High School zumindest, wahrscheinlich, weil zu viele Proben an Abenden stattfanden, an denen man lieber seine Hausaufgaben erledigte, sich mit Kellnern etwas dazuverdiente oder etwas mit Freundinnen unternahm. Es war niemand erschienen, um in unserem Namen zu sprechen.
Als nun wieder eine Emily und ein George die Bühne verließen, in dem Augenblick, ehe die nächste Emily und der nächste George sie ablösten, drehte ich meinen Stuhl herum. Eine Minute lang redete ich mir ein, dass ich mich wieder in Doktor Schiwago vertiefen würde, griff mir aber stattdessen ein Anmeldeformular. Nicht etwa, weil ich Schauspielerin werden wollte, sondern weil ich wusste, dass ich es besser machen könnte. Name, stand auf dem Formular. Künstlername, sofern abweichend. Ich trug meinen Namen ein, Laura Kenison. Bis auf meine Anschrift und Telefonnummer, mein Geburtsdatum hatte ich nichts zu bieten, ich konnte auch meinen nachschulischen Aushilfsjob bei Stitch-It nicht zu einer Bühnenerfahrung umdichten. Ich lauschte dem nächsten Vorsprechen hinter mir. »Nun, George, BIS vor einem JAHR, da HAB ich DICH noch GUT leiden mögen«, trällerte Emily. Ich faltete mein Anmeldeformular zusammen und schob es in meinen Pasternak, ehe ich mir ein neues Blatt nahm und noch einmal von vorn anfing. Diesmal gab ich meinen Namen als L-A-R-A an, unter Weglassung des »u«, das mir meine Eltern bei meiner Geburt gegeben hatten, weil mir diese neue Schreibweise zugleich russisch und weltläufig erschien. Ich entschied, dass Mr Martin recht hatte. Ich beschloss, der Diamant zu sein.
»Du hattest ein ›u‹ im Namen?« Emily beäugt mich skeptisch.
»Sechzehn Jahre lang.«
»Wusstet ihr, dass sie ein ›u‹ hatte?«, fragt sie ihre Schwestern, die beide den Kopf schütteln, verblüfft darüber, was ich ihnen vorenthalten habe.
»Ihr wisst vieles nicht«, sage ich.
Hazel sieht mich an.
»Ich wusste nicht, dass es lustig werden würde«, sagt Maisie.
»Keine Ahnung«, sagt Nell.
»Es ist auch nicht lustig«, sage ich. »Das wisst ihr. Es ist keine lustige Geschichte, bis auf die Teile, die lustig sind.«
»Wie das Leben«, sagt Nell und lässt den Kopf auf meine Schulter sinken, was ich rührend finde. »Erzähl weiter. Ich hab so das Gefühl, der heiße George wird uns weiter erhalten bleiben.«
Ich wartete, bis der George und die Emily auf der Bühne fertig waren, ehe ich mit der Anmeldung in der Hand und der Polaroidkamera um den Hals in den Empfangsbereich ging. Irgendwie hatte ich vergessen, dass noch so viele Leute darauf warten würden, für die anderen Rollen vorzusprechen: für die Gibbs und Webbs. Männer und Frauen und Kinder gingen auf und ab, lautlos die Worte auf den Textblättern in ihrer Hand sprechend. Ich war jetzt eine von ihnen. Ich würde George in Kürze sagen, dass ich von ihm enttäuscht war, weil er nur noch Baseball im Kopf hatte und nicht mehr der Junge war, den ich für meinen Freund hielt.
Eine kleine Handvoll Georges und Emilys saß noch in dem Gang, der nach hinten zur Bühne führte. Alle hatten einen Stuhl, bis auf Veronica und den ersten George, den guten. Sie hockten zusammen auf der Treppe, und er brachte sie zum Lachen, was allerdings, unter uns gesagt, nicht übermäßig schwer war. Ihre schwarzen Haare pendelten quer über eine gerötete Wange, und mir fiel auf, dass wir schon vor zwei Stunden unsere Posten hätten tauschen sollen, etwas, das mir wegen meiner Studien an der Schule des Vorsprechens ganz entfallen war, während sie mit George gequatscht und deswegen nicht daran gedacht hatte. Von dem Gang aus war von der Bühne wirklich nichts zu hören, weswegen sie dicht bei der Tür blieb, die einen Spaltbreit offen stand, mit ihrem Stephen-King-Wälzer als Türstopper. Das Geschehen auf der Bühne verlor Veronica nie aus den Augen, was auch immer sonst vor sich gehen mochte.
Als sie aufblickte und mich mit der Kamera vor sich stehen sah, zog sie eine prachtvolle Augenbraue in die Höhe. Veronica hatte dichte, schwarze Augenbrauen, die sie in zart geschwungene Form zupfte. Mit einer Braue konnte sie mehr Informationen übermitteln als andere Leute mit einem Mikrofon. Sie wusste, dass ich für Emily vorsprechen wollte und dass ich die Rolle bekommen würde. Veronica, habe ich immer gesagt, könnte nie Poker spielen, weil ihre Gedanken ihr förmlich von der Stirn abzulesen waren. In diesem Augenblick jedenfalls wurde ihr klar, dass sie für Emily hätte vorsprechen können, und dann wäre sie in den Genuss regelmäßiger Proben mit dem Typen hier gekommen. Sie hätten ihren Text zusammen in seinem Auto üben können, und nach jeder Vorstellung hätten sie händehaltend ihre Arme in die Höhe reißen und sich ein letztes Mal verbeugen können, ehe der Vorhang fiel. Aber Veronica konnte abends fast nie aus dem Haus, weil ihre Mutter als Krankenschwester in Spätschicht arbeitete und sie, da ihr Stiefvater schon lange auf und davon war, auf ihre Brüder aufpassen musste. Wir hatten beide zwei Brüder, eine weitere Gemeinsamkeit, die uns zusammenschweißte, wobei meine sehr viel älter waren, ihre dagegen, technisch gesehen Halbbrüder, noch kleine Jungs. Ohne diese Brüder hätte Veronica eine wahrhaft großartige Emily abgegeben.
»Wirklich?«, fragte sie mich.
Ich nickte und reichte ihr die Kamera. Sie stand auf, um mir die Spange aus den Haaren zu nehmen.
»Du bist dann die Letzte«, sagte sie. »Vordrängeln ist nicht. Falls Jimmy dann noch da ist, kann er mit dir lesen.«
Jimmy sah mir direkt in die Augen und hielt mir seine Hand hin. Wir wechselten einen Händedruck. »Gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre«, sagte er.
Ich machte kehrt und setzte mich auf einen Stuhl hinten im Gang. Niemand sollte denken, dass ich irgendwie bevorzugt wurde, obwohl das natürlich trotzdem der Fall war. Ich brauchte mich mit Veronica nicht aufs Klo zurückziehen, um zu verstehen, was sie machte. Mr Martin musste in einem Feld ohne ernstliche Kandidatinnen eine Emily finden. All seine Hoffnungen würden auf der letzten Bewerberin ruhen, wer es auch sein mochte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich an über vier Stunden Schauspielunterricht teilgenommen, was nicht hieß, dass ich nun schauspielern konnte, aber ich wusste auf jeden Fall, wie es nicht ging. Ich musste nur die Worte sagen und nicht im Weg stehen, mehr nicht.
Als das letzte Paar fort war und nur noch ich, Veronica und Jimmy-George im Flur übrig waren, bat ich Veronica, mir die Haare zu flechten.
Jimmy-George schüttelte den Kopf, und Veronica stimmte ihm zu. »Offen ist es hübscher«, sagte sie.
Ich trug Jeans und Duck Boots und das alte Sweatshirt meines Bruders Hardy von der University of New Hampshire. Wildcats voran!
»Du hättest es mir gesagt, ja?«, sagte sie. »Wenn das von Anfang an der Masterplan gewesen wäre?«
»Ich habe nie einen Plan, das weißt du doch.« Warum fühlte es sich so an, als würde ich sie verlassen?
Sie legte den Kopf schief, so, wie man es macht, wenn man irgendwo im Haus eine Tür aufgehen hört. Dann umarmte sie mich und drückte mich fest. »Zeig’s ihnen«, flüsterte sie.
Die Turnhalle war wieder die Turnhalle, Schauplatz aller Demütigungen: Laufen, Kickball, Tanzen, das Theaterstück. Ich wollte Englisch unterrichten, ins Friedenscorps eintreten, einem Hund das Leben retten, ein Kleid nähen. Schauspielern stand nirgendwo auf der Liste. Als ich meine Anmeldung einem der Männer reichte, der aufstand, um sie in Empfang zu nehmen, hätte ich vor Angst beinahe aufgeschrien. War es den Spielleitern auch so ergangen? Zündeten sie deswegen ihre Pfeifen an und nestelten an ihren Hüten herum? Die Georges sprangen, die Emilys wickelten sich Haarsträhnen um den Finger, als würden sie das Umherwirbeln des Tambourstabs üben, und das alles, weil sie wussten, dass sie dort oben sterben würden. Meine Großmutter sah mir zu, und ich wusste, sie musste voller Angst um mich sein. Ich schloss kurz die Augen und redete mir ein, dass alles so schnell gehen würde. Jimmy war George, und ich war Emily, und wir kannten unseren Text auswendig.
»Emily, was hast du gegen mich?«, fragte George.
»Ich habe nichts gegen dich«, sagte ich.
Es war ein einfaches Gespräch zwischen zwei Sandkastenfreunden, die im Begriff waren, sich ineinander zu verlieben. Ich sprach die Zeilen so, wie ich sie den ganzen Morgen im Kopf gehört hatte, und als wir fertig waren, standen Mr Martin, meine Großmutter und die drei anderen Männer auf und klatschten Beifall.
Ich schaue auf meine Uhr. Man vergisst leicht, wie spät es schon ist, weil die Sonne im Sommer so ewig lang am Himmel steht. »Wir wechseln jetzt über zur Montage«, erkläre ich den Mädchen. »Mehr High School werde ich euch nicht zumuten.«
»Aber was ist mit dem Theaterstück?«, fragt Emily, die ihre unmöglichen Beine über die Sofarückenlehne gehakt hat. Emily konnte noch nie auf Möbeln sitzen wie ein normaler Mensch. Den Kampf habe ich bereits verloren, als sie noch klein war. Wer auch immer ihren inneren Kompass eingebaut hat, hat den Magnet verkehrt herum platziert.
»Über das Stück weißt du doch Bescheid, und außerdem kommt es noch öfter vor. Wir müssen uns unsere Kräfte einteilen.«
»Was ist aus Veronica und Jimmy-George geworden?«, fragt Maisie. »Von keinem der beiden habe ich je ein Wort gehört.«
»Wir haben uns aus den Augen verloren.«
Maisie schnaubt abfällig. »Man kann sich nicht aus den Augen verlieren.« Sie zieht ihr Handy aus der Tasche ihrer Shorts und wedelt damit vor mir herum, als wäre es eine wundersame neue Erfindung. »Wie heißen sie mit Nachnamen?«
Ich sehe sie an und lächle.
»Du kannst uns wenigstens verraten, welche von euch am Ende bei ihm gelandet ist«, sagt Nell.
»Wir sind alle bei uns selbst gelandet.«
Die Mädchen stöhnen, alle drei, wie aus einem Munde. Diese Masche beherrschen sie perfekt.
Emily streckt die Hand aus und zupft an meinem Shirt. »Gib uns irgendwas.«
In wenigen Stunden werden wir wieder im Obstgarten sein. Wenn sie nicht bald schlafen gehen, werden sie morgen zu nichts zu gebrauchen sein, aber das konnte man ihnen unmöglich sagen. Ich arbeite daran, ihnen möglichst wenig vorzuschreiben. »Das Stück war ein großer Erfolg. Geplant waren sechs Aufführungen, und am Ende wurden es zehn. Ein Reporter kam aus Concord vorbei und hat uns im Monitor rezensiert.«
Die Wochenendsektion machte mit einem Bild von mir auf. Meine Großmutter kaufte gleich fünf Exemplare. Ich habe sie nach ihrem Tod gefunden, ganz unten in ihrer Deckentruhe.
Nell fragt, wer den Spielleiter gespielt hat. Nell ist Schauspielerin. Sie muss alles komplett vor sich sehen können.
Der Spielleiter. Es hatten so viele Spielleiter vorgesprochen. Ich muss kurz nachdenken. Die Schlechten stehen mir alle so klar vor Augen, aber wer hat noch mal die Rolle bekommen? Er war gut, so viel wusste ich. Ich versuche, mir vorzustellen, wie er mich zum Friedhof begleitet. »Marcias Vater!«, rufe ich, denn wenn mir auch sein Name entfallen ist, sehe ich doch sein Gesicht ganz deutlich vor mir. Das Gehirn ist ein bemerkenswertes Gebilde, was verloren ist, steht einem auf einmal glasklar vor Augen, ganz ohne eigenes Zutun. »Er hat eigentlich für Doc Gibbs vorgesprochen, aber er war besser als die anderen Männer, deshalb hat Mr Martin ihn als Spielleiter besetzt.« Ihm fehlte die Hybris, die Hauptrolle von vornherein für sich zu beanspruchen, genau deswegen war er gut. Marcia empfand den Gedanken als demütigend, dass ich Zeit mit ihrem Vater verbrachte. Sie ging mir während der gesamten Probenzeit und auch danach, solange das Stück aufgeführt wurde, aus dem Weg, wollte beim Mittagessen nicht mit mir zusammensitzen und wich stur meinem Blick aus, doch im Herbst, als für uns das zwölfte und letzte Schuljahr begann, war zwischen uns wieder alles in Ordnung.
»Und Jimmy war George?«, fragt Emily.
»Jimmy war ja wohl eindeutig George«, sagt Maisie.
»Jimmy war George«, sage ich.
»War er als George so gut wie Duke?«, fragt Emily. Oh, dieser Blick jedes Mal bei ihr, wenn sie Dukes Namen sagt. Wieder mal bereue ich es zutiefst, nicht von vornherein gelogen zu haben, durchgehend, über alles.
»Duke hat George nie gespielt.«
Maisie hebt eine Hand, um Einspruch einzulegen. »Wer war er denn dann?«
»Er war Mr Webb.«
»Nein«, widerspricht Nell. »Nein. In Tom Lake? Duke war George.«
»Ich war dort. Ihr wart alle noch nicht auf der Welt.«
»Aber wir drei können uns unmöglich alle irren«, sagt Emily, als würde ihre Mathematik schwerer wiegen als mein Leben.
»Ihr habt es so als Erinnerung gespeichert, weil es die Geschichte besser macht, wenn Duke George wäre und ich Emily. Was nicht heißt, dass es auch so war.«
Darüber denken sie ein Weilchen nach.
»Aber dann hat er ja deinen Vater gespielt«, sagt Maisie.
Wie auf Kommando kommt in diesem Moment ihr eigener Vater durch die Hintertür, die Hose ganz stachlig von Spreu. Hazel hebt den Kopf und bellt, bis Maisie sie zum Schweigen bringt. Hazel bellt bei jedem Mann, der hereinkommt.
»Arbeiterinnen«, sagt er zu uns und klatscht in die Hände. »Ab ins Bett mit euch.«
»Daddy, wir sind alt«, sagt Nell, die Jüngste. »Du kannst uns nicht einfach zu Bett schicken.«
Emily, unsere Farmerin, Emily, die all das hier übernehmen will, wenn wir alt sind, wirft einen Blick auf die Uhr. »Mom wollte gerade zur Montage übergehen.«
»Worum geht’s?«, fragt er, während er an der Tür seine Stiefel auszieht, ganz so, wie ich es ihm seit Jahren predige.
Die Mädchen wechseln einen Blick untereinander und sehen dann mich an.
»Die Vergangenheit«, sage ich.
»Ah.« Er nimmt seine Brille ab. »Ich gehe duschen. Aber morgen früh keine Ausreden, ja?«
»Versprochen«, sagen wir alle.
Und so versuche ich, uns so schnell wie möglich durch die langweiligen Teile zu manövrieren.
Im letzten Schuljahr trat ich der Theater-AG bei. Ich spielte Annie Sullivan in The Miracle Worker mit einer sehr klein gewachsenen Siebtklässlerin namens Sissy als Helen Keller, der man einschärfen musste, mir nicht die Haut zu verletzen, wenn sie mich biss. Wir schleuderten uns gegenseitig kreuz und quer über die Bühne. Bye Bye Birdie war das große Frühjahrsmusical, und ich spielte Rosie DeLeon. Niemand hätte mich als Sängerin bezeichnet, aber ich blamierte mich auch nicht. Ich wurde vom Dartmouth College und der Penn State University angenommen, ohne finanzielle Unterstützung. Ich ging an die University of New Hampshire, wo sich die jährliche Rechnung, inklusive Studiengebühren, Kost und Logis, Bücher und sonstiger Ausgaben, nach Abzug meines Leistungsstipendiums auf knapp über 2.500 Dollar belief. Was ich mit meinem Leben konkret anfangen sollte, wusste ich als Studentin ebenso wenig wie schon an der High School. Modedesign wurde an der University of New Hampshire nicht angeboten, und um das Fach Chemie machte ich weiter einen großen Bogen. Die Bewerbungsunterlagen fürs Friedenscorps lagen nach wie vor in meinem Schreibtisch. Zum Schulabschluss hatte meine Großmutter mir ihre geliebte alte schwarze Singer geschenkt, ein Schlachtross von einer Nähmaschine, und ich verdiente mir ein Taschengeld, indem ich die Cordröcke von Verbindungsstudentinnen kürzte. Die Tage waren ausgefüllt mit Britischer Literatur, Einführung in die Biologie und bergeweise Näharbeiten. Ich schlief in der Bibliothek ein, den Kopf seitwärts auf ein offenes Buch gebettet. Die Schauspielerei kam mir nie in den Sinn.
Jedenfalls nicht bis zu meinem dritten Studienjahr, als mir an einer Pinnwand im Studentenzentrum ein Aushang ins Auge fiel: Gesucht wurden Akteure für Unsere kleine Stadt. Ich war dort, um meinen eigenen Aushang anzupinnen: Stitch-It, Näharbeiten im Nu. Mein erster Gedanke war, dass es spaßig wäre, Leute für das Stück zu registrieren, und mein zweiter Gedanke war, dass ich für die Emily vorsprechen könnte. Es wäre ein solches Vergnügen, diese Worte noch einmal zu sprechen, und ich verstand die Dimensionen, um die das eigene soziale Umfeld durchs Theater erweitert wurde. Selbst im dritten Studienjahr waren die meisten Leute, die ich am College kannte, noch dieselben, mit denen ich damals auf der High School war.
An der University of New Hampshire studierten in jedem beliebigen Jahr mehr Mädchen als an jeder anderen Uni des Landes, die schon mal die Emily gespielt hatten, und wir waren alle überzeugt, die Rolle am besten zu verkörpern. Was hätte ich nicht darum gegeben, bei diesem Vorsprechen mit im Raum zu sein, aber diesmal fehlte mir ein triftiger Grund dafür. Ich wartete mit meiner Nummer draußen im Flur, im alten Wildcats-Sweater meines Bruders, der mir Glück bringen sollte.
Und ich hatte Glück.
Am Abend der dritten Aufführung saß Bill Ripley im Publikum. Er war ein groß gewachsener Mann mit immerzu rot leuchtenden Wangen, dunkelhaarig und mit vorzeitig ergrauten Schläfen, die ihm einen Anstrich von Würde verliehen. Er saß mit seiner Schwester in der fünften Reihe, mit seinem voluminösen Wollmantel vor sich auf dem Schoß, weil ihm die Warteschlange vor der Garderobe zu lang gewesen war.
Ich nannte ihn den Talentierten Mr Ripley, da ich in einer Buchhandlung mal das Taschenbuch gesehen hatte und mir der Titel gefiel. Diesen Beinamen meinte ich durchaus nicht negativ. In meiner Familie hieß er bei allen nur Ripley-Believe-It-or-Not, nach dem Comic über Kuriositäten, Naturwunder und dergleichen mehr. In beiden Spitznamen war ein Körnchen Wahrheit enthalten, was nicht heißen soll, dass Ripley ein Soziopath war, aber er hatte schon eine Fähigkeit, sich in das Leben anderer Menschen zu drängen und ihnen das Gefühl zu geben, dass er dort hingehörte. Der Glaub-es-oder-nicht-Teil wiederum erklärte sich von selbst.
Nach Durham, New Hampshire, verirren sich Talentscouts eher selten, und Ripley war auch kein Scout. Er weilte zu Besuch bei seiner Schwester, die in Boston lebte, anlässlich ihres Geburtstags. Was sie sich von ihm gewünscht hatte, anstelle eines Geschenks, war eine gemeinsame Fahrt hoch nach Durham, damit er seine Nichte, ihre Tochter Rae Ann, in der Rolle der Mrs Gibbs sehen konnte. Ripleys Schwester war der Ansicht, dass ihre Tochter Talent hatte, und sie fand, ihr Bruder sei es ihr schuldig, sie sich wenigstens einmal anzusehen, rein höflichkeitshalber.
Ich hatte Ripleys Nichte vor dem Stück nicht gekannt, und auch nach zahlreichen Proben und drei Aufführungen hätte ich nicht behaupten können, sie zu kennen. Sie spielte meine Schwiegermutter, und da sie es wie alle anderen Mädchen, die in der Produktion mitwirkten, ursprünglich auf die Rolle der Emily abgesehen hatte, neidete Rae Ann mir im Stillen meinen Erfolg. Immerhin war sie als Mrs Gibbs besetzt worden, das sprach für sie, und dass sie in der Rolle vollkommen flach war, konnte man ihr schwerlich zum Vorwurf machen. Für eine Neunzehnjährige ist es wirklich nicht leicht, als Mutter mittleren Alters zu glänzen, die auf der Bühne pantomimisch Hühner füttert. Ripley war Rae Ann gegenüber zu etlichen Zugeständnissen bereit, und dennoch wandte er ihr nie den Blick zu. Nach der Aufführung umarmte er sie und sagte, sie sei großartig gewesen, ehe er sie mitsamt ihrer Mutter zur Ensemblefeier schickte und sagte, er würde in Kürze nachkommen. Dann lungerte er mit seinem Mantel im Flur herum, bis ein Mädchen vorbeikam, bei dem er sich erkundigte, wo er die Emily finden könne.
1984 hatte keinerlei Ähnlichkeit mit Orwells Visionen und war dennoch eine Welt, die kaum zu erklären ist. Ein fremder Mann im Anzug klopfte an die Garderobentür, ehe ich dazu gekommen war, mich umzukleiden, ich trug noch mein Kostüm, und als ich die Tür einen Spalt weit öffnete, sagte er, er würde gern mit mir reden, ob wir wohl kurz irgendwo hingehen könnten, wo wir ungestört seien? Klar, sagte ich, wie ein Kind, das Anweisungen von einem Erwachsenen entgegennimmt, und so war es im Grunde auch. Es gab einen kleinen Übungsraum weiter hinten im Gang, mit einem Klavier darin, einer Couch und einigen Klappstühlen. So spät, das wusste ich, wäre dort niemand. Ich öffnete die Tür und tastete entlang der Wand aus kaltem Betonstein nach dem Lichtschalter. Was dachte ich mir bloß dabei? Das ist der Teil, den ich nicht zu rekonstruieren vermag.
Aber in dieser Geschichte geht es um Glück, zumindest in den frühen Jahren, und meine Glückssträhne hielt weiter an. Bill Ripley war nicht gekommen, um mich zu vergewaltigen oder zu zerstückeln. Er überließ mir die Couch und setzte sich auf einen der Klappstühle. Er sei Regisseur, erklärte er mir. Sie besetzten gerade einen neuen Film, und es gebe einen Part für ein Mädchen, einen sehr bedeutenden Part sogar, aber dafür hätten sie noch niemanden gefunden. Sie würden schon länger nach einer passenden Schauspielerin suchen, bisher allerdings ohne Erfolg.
Ich nickte und wünschte mir insgeheim, ich hätte die Tür offen gelassen.
»Sie könnten das Mädchen sein.« Er blickte mich durchdringend an, und da ich gerade erst von der Bühne gekommen war und mich nicht sonderlich schüchtern fühlte, starrte ich unerschrocken zurück. »Was ich damit sagen will, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie es sind. Sie müssten dazu nach Los Angeles kommen, für Probeaufnahmen. Können Sie das einrichten?«
»Ich war noch nie in Los Angeles«, sagte ich, doch was ich eigentlich sagen wollte, war, dass meine Familie einmal, ich war damals zehn, zur Spring Break nach Florida gereist und das meine bisher einzige Flugreise gewesen sei.
Er schrieb eine Nummer auf die Rückseite einer Visitenkarte und sagte, er sei zurzeit bei seiner Schwester in Boston zu Besuch und dass ich ihn morgen früh um neun anrufen solle.
»Um neun sitze ich im Seminar.« Ich merkte, wie ich in Emilys langem, weißem Kleid zu schwitzen anfing.
Er sah rasch auf die Uhr. »Die beiden werden sich schon fragen, wo ich bleibe.« Er stand auf und reichte mir die Hand, also schüttelte ich sie. »Das sollte vorerst besser unter uns bleiben«, sagte er.
»Klar.« Im Stillen fragte ich mich, wem ich wohl nichts davon erzählen sollte.
»Rae Ann ist meine Nichte.« Er beantwortete meine Frage, als hätte ich sie laut gestellt.
»Oh.« Rae Ann. Das empfand ich als irgendwie beruhigend.
»Morgen«, sagte er, und ich sagte: »Morgen«, wie ein Papagei.
Was mich in jener Nacht in meinem Wohnheimzimmer vom Schlafen abhielt, war nicht etwa die Frage, ob ich die Rolle wohl bekommen würde. Vielmehr dachte ich darüber nach, wie viele Vierteldollarmünzen ich für ein Telefonat nach Boston zur teuersten Tageszeit benötigen würde und wo ich genügend von diesen Münzen auftreiben könnte. Außerdem überlegte ich, wie viele Hosen ich säumen müsste, um das Geld für ein Flugticket nach Los Angeles aufzubringen, und dazu noch die Kosten für das Taxi vom Flughafen und das Hotel. Für all das wurde natürlich gesorgt, wenn auch nicht so schnell, wie man annehmen sollte. Bill Ripley kümmerte sich um alles, zumindest für eine Weile. Ich hatte mich so lange Zeit nicht entscheiden können, was ich mit meinem Leben anstellen sollte, dass er sich schließlich einschaltete und mir die Entscheidung abnahm. Ich würde Schauspielerin werden.
»Was hat das mit Anstand zu tun, zeig es mir!«, ruft Nell, und wir brechen alle in Gelächter aus.
Unsere drei Mädchen sind jetzt alle wieder zu Hause. Emily ist nach ihrem Collegeabschluss zu uns zurück auf die Farm gekommen, während Maisie und Nell, beide noch in der Ausbildung, seit März wieder hier sind. Es war ein banger Frühling für die Welt, obwohl er von unserem Küchenfenster aus nicht viel anders wirkte als jeder andere Frühling im Norden von Michigan: nass und regnerisch und kalt, gefolgt von einem schweren, späten Schneefall, einer plötzlichen Wärmeperiode, und dann das Schauspiel von blühenden Bäumen. Emily und Maisie und Nell beachteten die Bäume nicht und zogen es vor, sich stattdessen mit Nonstop-Nachrichtenkonsum verrückt zu machen. Ich habe schließlich durchgesetzt, dass die Glotze abends aus bleibt, denn nach dem Fernsehen können wir alle nicht schlafen. »Wenn man in die eine Richtung schaut, wirkt alles hoffnungslos und verzweifelt«, sagte ich zu ihnen. »Schaut man dagegen in die andere Richtung …« Ich deutete auf die Explosion weißer Blüten draußen vor dem Fenster.
»Du kannst doch nicht so tun, als wäre weiter nichts«, sagte Maisie.
Sie hatte recht, und das tat ich auch nicht. Doch ich werde auch nicht so tun, als würde es mich nicht mit Freude erfüllen, dass wir hier alle zusammen sind. Schon klar, Freude ist dieser Tage eher unangebracht, aber sei’s drum, man fühlt, was man eben fühlt.
Als der Sommer kam und die Blütenpracht von Früchten abgelöst wurde, verschoben sich unsere Umstände von hier sind unsere Töchter, und wir freuen uns so, sie bei uns zu Hause zu haben zu hier sind unsere Töchter, die ihre gesamte Kindheit über Kirschen gepflückt haben und sich mit dem Job auskennen, während uns dieses Jahr nur ein Bruchteil unserer regulären Saisonarbeitskräfte zur Verfügung steht. Es war ihr Vater, der die auf den Sitzmöbeln herumhängenden, mit ihren Handys beschäftigten Mädchen als die Pflückerkolonne identifizierte, die er dringend benötigte.
»Ich bin ans College gegangen, um keine Kirschen pflücken zu müssen«, sagte Nell.
»Das College ist geschlossen«, sagte Joe. »Das College kann dich jetzt nicht beschützen.«
»Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht«, singen sie, während sie sich auf der Treppe absichtlich anrempeln. Die drei sind jünger, wenn sie zusammen sind. Sie regredieren.
»Mama geht nach Kalifornien, um Filmstar zu werden«, sagt Nell zu ihren Schwestern. »Und wir bleiben weiter hier auf der Farm eingesperrt.«
»Wenigstens hat es eine geschafft, hier wegzukommen«, sagt Emily.
Ich verspreche, ihnen morgen alles darüber zu erzählen.
Maisie gähnt und reckt die Arme in die Höhe, um die Unterseite des Türrahmens zu berühren, mit Hazel gleich hinter sich. Hazel ist eine Art gelber Terrier mit einem krummen Vorderbein und feinem, unregelmäßigem Fell, das hier und da strubbelig absteht. Sie stammt aus dem Tierheim, in dem Maisie im zweiten Semester ihres Tiermedizinstudiums gearbeitet hat. Die Mitarbeiter versahen die Käfige mit drolligen Namen – Opie und Sparky und Goober und Bear –, unterschwelligen Versprechen, wie brav diese Hunde sein würden. Hazel war lange in einer Reihe mit riesigen Biestern eingesperrt gewesen, die sie zu gern in Stücke gerissen hätten und deswegen Tag und Nacht in die Gitterstäbe ihrer Käfige bissen. Hazel wiederum übernahm so viele ihrer schlechten Eigenarten, dass ein Wärter über ihren Namen mit dickem schwarzem Filzstift das Wort »HEXE« gekrakelt hatte. Wegen dieser schlechten Eigenarten, zusammen mit dem kaputten Bein und der Räude, unter der sie augenscheinlich litt, war sie praktisch nicht zu vermitteln, und nach einigen Wochen in dem Tierheim sah Maisie den Anhänger an Hexe Hazels Käfig, der anzeigte, dass ihre Zeit abgelaufen war. Es zog sie immer wieder dorthin zurück, um Hundekekse durch die Stäbe zu schieben. Letzte Leckerlis.
»Gib bloß auf deine Finger acht«, sagte ihre Vorgesetzte, als Maisie ihren Plan verkündete, Hazel übers Wochenende mit nach Hause zu nehmen. Als sie jedoch dann zum Käfig kam, fing die Hündin an zu heulen, als könnte sie kaum glauben, dass sie so spät in einem elenden Leben doch noch Glück haben könnte. Studierende wurden ausdrücklich vor den Gefahren der Sentimentalität gewarnt, aber diese Lektion klammerte Maisie an jenem Tag aus, und die räudige kleine Terrierdame wedelte dankbar mit dem Schwanz.
Emily kommt mit ihrem Buch wieder nach unten, einem Handbuch über Baumveredelung. Es haue sie um, sagt sie, womit gemeint ist, dass es eine gute Einschlafhilfe ist. Emily wohnt in dem kleinen Haus hinter dem Apfelgarten. Sie nimmt eine Taschenlampe aus dem Korb an der Hintertür, dem Korb voller Taschenlampen, Strickmützen, Handschuhen und Insektenspray.
»Ich bring dich noch ein Stückchen«, sage ich.
Sie lacht. Sie kommt zurück und küsst mich. Emily küsst mich. »Gute Nacht«, sagt sie.
Ich schaue aus dem Fenster über der Spüle, bis ihr ruhiger Lichtstrahl, der über den Feldweg schwenkt, nicht mehr zu sehen ist, dann mache ich alle Lichter aus und gehe nach oben.
Der Vater der drei schläft schon tief und fest. Weil er nicht auf mich warten kann, hat er die Lampe auf dem Nachttisch angelassen und die Decke auf meiner Seite des Betts zurückgeschlagen. Eine Hand liegt auf seinem Herzen, als hätte er als Letztes überprüfen wollen, ob es noch schlägt, die andere baumelt aus dem Bett, seine Finger berühren fast den Boden. Im Sommer kann ihn nichts wecken. Nach dem Abendessen geht er noch einmal raus zur Scheune, weil noch das eine oder andere abzuschließen sei, und legt dann einen zweiten Arbeitstag ein. Ich stelle mir die Farm als eine riesige Tanzfläche aus Parkett vor, die er auf seinem Kopf balanciert, mit den Bäumen, die aus den kleinen Vierecken wachsen. Da ist das Obst, das gepflückt werden muss, die Äste, die beschnitten werden müssen, der Dünger und das Insektengift (Kirschanbau ohne geht nicht, probieren Sie es ruhig aus), die Scheune voller kaputter Maschinen, zusammen mit dem neuen Traktor, den wir uns nicht leisten können, und den Ziegen, die eine so glänzende Idee zu sein schienen, als Benny vor fünf Jahren anregte, sie als Unkrautbekämpfer und zur Käseproduktion anzuschaffen. Da sind die Arbeiter, deren Kinder krank sind, und die Arbeiter, die Geld benötigen, um nach Hause zu fahren, zu ihren Kindern, und das kleine Haus, dessen Dach undicht ist, und die aufgetürmten Zwanzig-Pfund-Kisten aus Plastik mit der Aufschrift Drei Schwestern Kirschgarten auf der Seite, und ich und Emily und Maisie und Nell. Wir versuchen zu helfen, aber es bleibt sein Kopf, auf dem dieser Ort ruht. Bis in unser Bett schleppt er ihn mit sich, wenn er abends schlafen geht.
Ich ziehe mein Nachthemd an und krieche neben ihm ins Bett. Ich lege meine Hand auf die Hand, die auf seinem Herzen ruht. Lebe für immer, sage ich in Gedanken.
Veronica konnte nicht an der University of New Hampshire studieren. Sie musste zu Hause bleiben, weil es sonst niemanden gab, der sich um die Jungen kümmerte. Ihr Plan sah vor, zwei Jahre aufs Community College zu gehen und sich ihre Scheine dann anrechnen zu lassen. Alle haben Pläne, und als wir die High School abschlossen, erzählte sie mir ihre nicht mehr. Sie war diejenige, die mit Jimmy-George anfing, womit ich nicht die Stunden meine, als sie auf der Treppe am Ende des Gangs saßen und quatschten. Er war älter als wir, zweiundzwanzig, obwohl ihm das niemand abnahm. Veronica ließ sich seinen Führerschein zeigen, als er ihr sein Alter nannte, und dachte immer noch, dass er sie anlog, ganz wie die Typen in den Spirituosengeschäften, die seinen Ausweis für eine Fälschung hielten und ihm das Bier dann trotzdem verkauften. Er lebte zwei Städtchen entfernt und absolvierte gerade sein Unterrichtspraktikum. Die Kinder in seiner Klasse, erzählte er, hätten ihn ausgelacht, als er am ersten Schultag seinen Namen an die Tafel schrieb. Jimmy-George war angehender Mathematiklehrer an einer High School, und allein das machte ihn wertvoll, weil er für uns unsere Mathehausaufgaben machte. Er machte auch noch anderes. Sechs Jahre älter, das war später im Leben ein Klacks, damals aber war das ein unvorstellbarer Altersabstand. Wir konnten unser Glück kaum fassen, als er uns die Hände reichte, ein Erwachsener, der auf der Bühne einen Jugendlichen spielte.
Veronica erzählte mir, was sie für ihn empfand, und später erzählte sie auch, was sie machten. An zwei Abenden in der Woche kam er nach den Proben zu ihr nach Hause, und dann brachte sie die Jungen zu Bett. In Veronicas schmalem Einzelbett umfing er sie eng mit den Armen, damit sie wie ein Ehepaar einschlafen konnten, stand dann in aller Frühe auf, ehe es hell wurde, und fuhr zu dem Zimmer zurück, das er gemietet hatte, um sich für die Schule fertig zu machen, all das, noch ehe ihre Mutter von ihrer Spätschicht im Krankenhaus zurück war. Veronica erzählte, dass er ihr unentwegt in die Augen sah, ohne je den Blick abzuwenden. Sie sei ziemlich sicher, sagte sie, dass niemand sie je zuvor wirklich angesehen habe, ihr ganzes Leben lang noch nicht, und vielleicht stimmte das, aber es stimmte auch, dass das einfach Jimmy-Georges Art war, Leute anzusehen. Auf der Bühne sah er mich an, als hätte jemand ein riesiges Einmachglas über uns gestülpt und als wären wir ganz allein auf der Welt. Er war es, der mir beibrachte, wie man nicht den Blick abwandte.
»Wir sollten Zeit zusammen verbringen«, sagte er eines Abends nach der Probe. »Als George und Emily, weißt du, eine Erdbeerlimonade trinken gehen oder so.«
Aber wir waren George und Emily und Veronica. »Ich denke, eher nicht«, sagte ich.
»Ich dachte, du magst Schauspielern«, sagte er. »Es geht mir nur darum, dass wir noch überzeugender werden.«