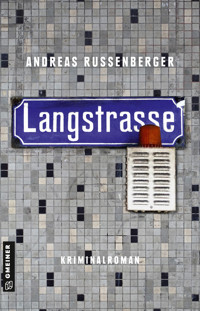Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kriminell schönes Arosa
- Sprache: Deutsch
Hinter der Postkartenidylle von Arosa lauert das wahre Leben. Humorvoll und feinfühlig erzählt Andreas Russenberger von großen und kleinen Katastrophen im winterlichen Alpenparadies. Von Geschichten, in denen scheinbar harmlose Gaunereien unerwartete Konsequenzen haben und ihre Spuren im Schnee hinterlassen. Mit Gespür für die Abgründe des Alltags lässt er Figuren lebendig werden, die sich selbst und andere ins Chaos stürzen. Ein literarischer Winterurlaub mit Tiefgang und Witz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Russenberger
Arosa – wo auch Gauner Urlaub machen
Krimis
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Ihor / stock.adobe.com
ISBN 978-3-7349-3358-5
Zitat
Gauner bereuen weniger ihre Tat als vielmehr das Missgeschick, dabei ertappt worden zu sein.
Die Geschichten
Spaghetti-Ski
Warnhinweis: Diese Geschichte beinhaltet Zigaretten, ein alkoholisches Getränk und nette Touristen.
Paul sass am Esstisch seiner Dreizimmerwohnung in Arosa, umgeben von der Art Möbel, die man »Alpenchic« nennt, die aber in Wirklichkeit lediglich eine Ansammlung von altem Holz und künstlichem Fell war. Er liess seinen Blick gedankenverloren über die schneebedeckten Gipfel des Schiesshorns, Furggahorns und der Tiejer Flue schweifen. Es war das passende Ambiente für einen Mann von Welt – oder zumindest für einen, der es sein wollte. Kurz vor Ostern hatte es kräftig geschneit, was nun an den Feiertagen für volle Pisten sorgen würde. Ideal für das lokale Gewerbe – und für Skidiebe.
Eigentlich hätte sich Paul das schmucke Feriendomizil nie leisten können. Doch er hatte beschlossen, dem Glück, das ihm sonst die kalte Schulter zeigte, auf die Sprünge zu helfen. Oft malte er sich seinen grossen Auftritt aus: Gäste, die den spektakulären Ausblick bestaunten: »Ach, wie schön du es hast!« Oder noch lieber Gästinnen: »Am liebsten würde man hier übernachten!«
Seine Wünsche hatten sich bislang jedoch nicht materialisiert. Das lag womöglich daran, dass Paul noch nie jemanden eingeladen hatte. Er fürchtete die entscheidende Frage wie der Schneemann den ersten Sonnenstrahl: »Wie kannst du dir das alles bloss leisten?« So war er einsamer als zuvor und lebte nicht das glamouröse Leben eines Hochstaplers. Nein, er stahl einfach nur Ski.
Das Stehlen an sich bereitete ihm keine Freude. Aber die Gaunerei war notwendig, so dachte er, um jemand zu sein. Eigentlich hatte Paul einen guten Charakter. »Pflichtbewusst, fleissig und trennt sogar den Müll«, wäre eine treffende Beschreibung gewesen. Doch gute Eigenschaften zahlten keine Miete.
Auf die Idee, seinen Luxus mit dem Diebstahl von exklusiven Ski zu finanzieren, hatte ihn sein bester Schulfreund Ernst gebracht. Die beiden waren in der sechsten Klasse sitzen geblieben, und aus dieser gemeinsamen Schmach war eine unzertrennliche Freundschaft entstanden. Ernst hatte sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht und war inzwischen ein erfolgreicher Verkäufer von »gebrauchten Waren«. Sein Kundenstamm konnte sich sehen lassen und reichte weit über die Schweizer Landesgrenze hinaus. »Ski zu reduzierten Preisen sind leicht zu verticken«, hatte Ernst versichert. Und wer sich teure Ski leisten kann, könne es sich auch leisten, diese zu ersetzen.
So hatte Paul mit äusserster Vorsicht begonnen, Ski zu stehlen. Ein Head hier, ein Rossignol dort – gerade genug, um die Miete seiner Ferienwohnung zu bezahlen. Ironischerweise war Paul ein miserabler Skifahrer. Er bevorzugte das Wandern. Aber das Stehlen von Wanderstöcken war nun mal kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Nein, es mussten Ski sein.
Eine lukrative Nische.
Und jetzt das! Schwarz auf weiss stand es in der aktuellen Ausgabe der Aroser Zeitung. Paul las den Bericht zum dritten Mal, als würde sich dadurch etwas ändern.
»Achtung, Skidiebe! In den letzten Wochen wurden vermehrt hochwertige Ski entwendet. Die Diebstähle ereigneten sich bei gut frequentierten Pistenrestaurants über die Mittagszeit. Gäste und Servicepersonal werden gebeten, achtsam zu sein und sich bei Auffälligkeiten umgehend an die Polizei zu wenden.«
Paul schleuderte die Zeitung auf den Boden. »Fantastisch!«, entfuhr es ihm. Er hatte Konkurrenz bekommen. Und die Deppen konnten den Hals nicht voll genug bekommen, wirbelten Staub auf. Nun musste er schnell handeln. Rechnungen mussten bezahlt werden, und sein Konto war leer wie die Aroser Hotels in der Zwischensaison. Unter den veränderten Umständen war heute jedoch besondere Vorsicht geboten. Paul entschied sich für die stark frequentierte Tschuggenhütte und schlüpfte in seine Wintersportbekleidung. Im Kellerabteil stand nur noch ein uraltes Paar Ski, das er sich im Sommer für kleines Geld auf dem Dorfmarkt erstanden hatte: zwei Meter lange Kneissl mit Parablacks. Parablacks waren im vergangenen Jahrhundert benutzt worden, damit sich die Skispitzen nicht überschneiden. Es handelte sich dabei um einen Aufsatz aus Kunststoff, den man oben am Ski befestigte. Die Klötze waren meist rechteckig und sahen aus wie das Brandenburger Tor in Miniatur. Sie hatten sich jedoch nicht durchgesetzt – aus gutem Grund. Überkreuzten sich die Spitzen nämlich trotz der Parablacks, war es fast unmöglich, die Ski wieder parallel in Falllinie zu bringen. Nun gut, lange würde er die Dinger ja nicht fahren müssen.
Dachte er.
Kurze Zeit später schwebte Paul im Sessellift Tschuggen Ost hoch ins Skigebiet. Er teilte sich die Dreierbank auf der 955 Meter langen Fahrt mit einem älteren Ehepaar, das sich erfreut über seine Bretter zeigte.
»Du meine Güte, in den 70ern bin ich auch Kneissl gefahren«, kommentierte der rüstige Senior.
»Ich wusste gar nicht, dass es heute noch Parablacks gibt«, ergänzte seine Gemahlin.
»Zum Saisonschluss bin ich immer klassisch unterwegs«, murmelte Paul und wandte sich demonstrativ ab, um keine weitere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das wohlüberlegt: Wenn du Ski stiehlst, dann bleibt am Abend nämlich genau ein Paar vor der Hütte übrig, nämlich deins! In diesem Fall ein Paar antiker Kneissl mit Parablacks. Danach braucht es nur die entsprechende Meldung in der Zeitung und ein ebenso aufmerksames wie redseliges Rentnerpaar: »Oh, die gehören doch dem netten jungen Mann, der uns von seiner Ferienwohnung an der Neubachstrasse erzählt hat.« Und eh man es sich versieht, steht die Polizei auf der Matte.
Oben angekommen, machte sich Paul mit kräftigen Schlittschuhschritten aus dem Staub. Die rostigen Kanten der Kneissl zeichneten eine braunorangene Spur in den Schnee. Er fuhr auf direktem Weg zu der grossen Skihütte unter der Bergstation des Sesselliftes. Zu seiner Zufriedenheit waren die Sitzbänke und Liegestühle gut belegt. Kurz vor Mittag herrschte ein reges Kommen und Gehen.
Perfekt.
Paul schnallte sich die unpraktischen alten Ski ab und stellte sie an einen der Holzständer. Beiläufig nahm er sein Smartphone zur Hand und tat, als ob er ein Gespräch führte. In Wahrheit begutachtete er das vorhandene Material. Ernst hatte ihm aufgetragen, diesmal einen extravaganten Ski mitzubringen.
»Wenn du einen Carradan oder Pinel / Lacroix findest, kannst du den Mietvertrag für die Wohnung gleich für ein ganzes Jahr verlängern.«
Sicherlich übertrieben, aber Paul hatte verstanden. Zunächst hielt er vergebens Ausschau nach dem Jackpot. Doch schliesslich zogen zwei weisse Helme auf Fellkragen seine Aufmerksamkeit auf sich. Unter den Helmen glaubte er, einen Mann und eine Frau zu erkennen. Braungebrannt, mittleren Alters. Der obere Teil der Bekleidung liess auf einen wertigen Unterbau schliessen. Paul schlenderte, in eine lebhafte, wenn auch fiktive Konversation vertieft, in Richtung seiner potenziellen Opfer. Er musste einen Jubelschrei unterdrücken, als er das helle, sanfte Holz der Zai-Ski sah. Das war nicht alles: Es handelte sich um das Zai-Supersport-Set, das die Firma zusammen mit dem Autohersteller Bentley entwickelt hatte. DerZai for Bentley, wie der Ski offiziell hiess, war eine limitierte Version und würde seine finanzielle Ebbe fluten.
Doch eines nach dem anderen.
Nachdem die beiden ihre Ski abgestellt hatten, gingen sie auf die Terrasse der Tschuggenhütte und setzten sich an das Kopfende eines der langen Tische. Paul beeilte sich, einen Platz neben dem Mann zu ergattern. Es roch nach Sonnencrème und Käseschnitten.
»Ist hier frei?«, fragte er.
»Ja, bitte schön«, kam die freundliche Antwort. Seine Zielpersonen mussten aus Deutschland stammen. Ein junger Kellner begrüsste das Paar wie beste Freunde – oder potenzielle Trinkgeldgeber – und erkundigte sich, ob sie denn bis Saisonende in Arosa blieben.
»Definitiv«, antwortete die Frau. »Und wir kommen die nächsten Tage immer zu dir in die Tschuggenhütte.«
Paul nahm die Speisekarte zur Hand und blätterte durch das Angebot. Während das Paar orderte – zwei Gerstensuppen und ein grosses Arosa-Wasser – schob Paul seinen Skischuh unauffällig neben den seines Sitznachbarn: die gleiche Grösse, plus/minus eine halbe Nummer.
Passt!
Er bestellte einen Kafi Lutz. Es war ein Muss, dass er das Restaurant vor seinen Sitznachbarn verlassen würde. Das Paar aus Deutschland plauderte entspannt über das schöne Wetter und die herrlichen Schneeverhältnisse. Die geschliffene Sprache der beiden klang nach Geld und teurem Internat. Leichte Klänge von Popmusik schwebten durch die Luft. Paul nippte an seinem alkoholhaltigen Heissgetränk und blinzelte in die Sonne. Als die Gerstensuppen serviert wurden, bezahlte er und verabschiedete sich. Er setzte noch im Gehen seinen Helm auf und zog die Skibrille über die Augen. Nun musste es schnell gehen, und er fokussierte sich auf seine Aufgabe: natürliche Bewegungen, kein Blickkontakt, auf direktem Weg zu den Objekten der Begierde, in die Bindung rein und runter ins Tal.
Das war der Plan.
Doch sie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie, das war eine junge Frau im blauen Einteiler, die, ohne mit der Wimper zu zucken, das kleinere der zwei Zai-Ski-Paare nahm und in Richtung Piste stapfte. Sie musste die dreiste Konkurrentin sein, die es auf das Titelblatt der Aroser Zeitung geschafft hatte. Paul überlegte, was zu tun sei. Sie zur Rede stellen? Einen Aufstand machen und die Täterin auf frischer Tat ertappen? Nichts tun und in einer Minute mit dem Herrenmodell ins Tal carven? Zwei Männer nahmen ihm die Entscheidung ab. Die beiden waren von einem Liegestuhl in der hintersten Reihe, von dem man den Grossteil der abgestellten Ski im Auge hatte, aufgestanden und stellten sich neben die junge Frau, die gerade dabei war, in die Ski zu steigen. Sie hielten ihr einen Ausweis vor das Gesicht, sprachen kurz auf sie ein und gingen mit der bleich gewordenen Gaunerin zum Hauptgebäude. Zweifellos handelte es sich bei ihnen um Polizisten in Zivil, die auf der Jagd nach dem Dieb waren. Nun, so dachte Paul schadenfreudig, hatten sie eine Diebin auf frischer Tat ertappt. Als die drei an ihm vorbeiliefen, konnte er sich ein mitleidiges Lächeln in Richtung seiner Konkurrentin nicht verkneifen. Diese quittierte mit leerem Blick.
Paul musste eine Entscheidung treffen: den Plan durchziehen oder abbrechen? Das ganze Osterwochenende stand noch bevor, und das deutsche Paar würde wieder hierherkommen. Angesichts der Polizeipräsenz entschloss er sich, sein Vorhaben zu vertagen. Nur eine Minute früher, und er selbst wäre den Tschuggern vor der Tschuggenhütte in die Hände gelaufen. Paul zündete sich eine Zigarette an, um seine Nerven zu beruhigen.
Das hätte ins Auge gehen können.
Nach einigen tiefen Zügen schnippte er die Kippe in den Schnee und kurvte kurz darauf über den mittlerweile schweren und sulzigen Schnee in Richtung Innerarosa.
Auf der Höhe des Restaurants Erzhorn überholte ihn ein Rettungsschlitten in horrendem Tempo. Der Pistenkontrolleur fuhr so schnell, dass sein Schlitten bei einer Kuppe abhob. Der darin festgezurrte Patient schrie sich die Lunge aus dem Leib. Fasziniert von dem Schauspiel und erwärmt vom Kafi Lutz beschleunigte Paul ebenfalls und drückte sich auf der Kuppe nach oben ab.
Als Paul das Malheur realisierte, war sein Schicksal bereits besiegelt. Die Skispitzen hatten sich über die Parablacks gekreuzt und bildeten aus seiner Sicht ein kleines V und die Skienden ein grosses, auf dem Kopf stehendes V. Das Verhältnis veränderte sich rasend schnell zu seinen Ungunsten – innerhalb des Bruchteils einer Sekunde vergrösserte sich der Abstand sowohl der Spitzen wie der Enden zueinander, bis seine Ski ein gleichmässiges X bildeten. Die viel zu fest eingestellten Bindungen hielten dem Druck länger stand als Pauls Knie, die, kurz bevor sich die Bindung doch noch löste, mit einem lauten Knacken nachgaben. Er stürzte nach vorne wie eine Bahnschranke, und es wurde dunkel.
»Können Sie mich hören?« Die Worte drangen undeutlich zu Paul, als wäre sein Kopf unter Wasser. Er versuchte, sich zu bewegen. Ein heftiges Stechen in seinen Knien liess ihn aufstöhnen.
»Schatz, ruf sofort den Rettungsdienst. Wir brauchen einen Rettungsschlitten.«
Paul öffnete die Augen und wischte sich den Schnee vom Gesicht. Langsam erinnerte er sich daran, was passiert war. Er lag mit dem Kopf talabwärts und sah den Weisshorngipfel, das Wahrzeichen von Arosa, in seiner ganzen Pracht. »Ich bin gestürzt …«, stammelte er.
»Da können Sie einen drauf lassen«, antwortete eine tiefe Stimme, die Paul bekannt vorkam. »Ich drehe Sie jetzt nach oben und lege Ihnen meine Jacke unter den Kopf.«
»Danke«, antwortete Paul. Er spürte, wie zwei starke Arme ihn sanft umfassten und ihm kurz darauf etwas unter den Kopf geschoben wurde. Weiche Daune und Fell? Paul beobachtete, wie ein Mann ohne Jacke und mit weissem Helm die Kneissl einsammelte und sie zur Absicherung der Unfallstelle weiter oben in den Schnee steckte. Seine Partnerin, die den Anruf getätigt hatte, steckte das Smartphone wieder zurück in ihre Umhängtasche.
»Der Rettungsdienst ist gleich hier und wird Sie gut versorgen.«
Paul nickte dankbar und schloss beschämt die Augen.
Er hörte, wie sich der hilfsbereite Tourist aus Deutschland neben ihn kniete und ihm ins Gewissen redete. »Ihre Beine werden bis zur nächsten Saison wieder gesund. Aber Sie sollten sich unbedingt neues Material kaufen. Wer fährt denn heute noch Spaghetti-Ski mit Parablacks!«
Drei Jahre später
Paul half der jungen Frau, Platz zu nehmen, und setzte sich ihr gegenüber auf die Holzbank. Claudia blickte frontal in die Sonne. Ihre zarten Sommersprossen hoben sich kaum von der hellen Haut ab. Das grelle Licht störte sie nicht. Claudia war blind. Paul zog die gelbe Weste, die mit »Guide« beschriftet war, aus und las die Speisekarte laut vor. Die AlpArosa war gut besucht und Paul hatte daher sicherheitshalber zwei Plätze reserviert. Nachdem sie die Bestellung aufgegeben hatten, wandte sich Claudia an Paul.
»Fährst du schon lange mit Sehbeeinträchtigten Ski?«, fragte sie.
Paul spürte, wie seine Wangen warm wurden. »Du bist die Erste.«
»Dann bin ich ja ein richtiges Glückskind«, meinte Claudia fröhlich. »Und warst du früher schon einmal in Arosa?«
Paul bewunderte den Lebensmut seiner Tagesschülerin. Er wusste nicht, wie er sein Leben an ihrer Stelle meistern würde. »Vor drei Jahren hatte ich hier oben eine Mietwohnung. Bei meiner letzten Talfahrt riss ich mir das Kreuzband.«
»Oh je«, sagte Claudia mitfühlend, als ob sie nie einen Schicksalsschlag hätte ertragen müssen.
»Es stellte sich im Nachhinein als eine glückliche Fügung heraus«, fuhr Paul fort. »Es war eine Endtäuschung, also das Ende einer Täuschung. Ich wollte mit der Wohnung etwas beweisen, vor mir selber fliehen, jemand sein, der ich nicht bin. Ich habe Sinn im Leben gesucht und mich verrannt, inklusive Schulden, die ich nun abbezahlt habe. Heimlich habe ich jedoch die Ski-Guides immer bewundert. Also habe ich meine Technik beim Skifahren verbessert und sitze nun hier mit dir.«
»Das freut mich für dich! Wenn du übrigens auch noch Sinn für den Sommer brauchst, könntest du mir mal Zürich zeigen.« Sie zwinkerte ihm mit Schalk im Gesicht zu.
Pauls Wangentemperatur wechselte von warm auf heiss. Er hatte sich ungewollt ein wenig in die Frau mit den lachenden Augen verliebt. »Es wäre mir eine Freude«, antwortete er.
Claudia legte den Kopf leicht schief. »Was hast du gearbeitet, als du die Wohnung in Arosa hattest?«, fragte sie.
Pauls Kopf glühte nun. Er war froh, dass Claudia ihn nicht sehen konnte. »Ich war im Skihandel tätig«, antwortete er wahrheitsgetreu. »Aber nicht sehr erfolgreich …«
Heute spielte er keine Rolle mehr. Heute versuchte er nicht mehr, der Mann von Welt zu sein. Heute war er einfach Paul.
Die Vermieterin
Warnhinweis: Vertraue nur Personen, die du respektvoll behandelst!
Das Chalet gehörte zu den schönsten in Arosa. Liebevoll renoviert, viel Holz, exklusive Möblierung, traumhafte Aussicht, ruhig gelegen. Ein wahres Schmuckstück – und ein sauberes dazu. Dafür sorgte Maria. Sie kannte jeden Winkel, jede Fliese, jeden Balken. Seit Jahren hielt sie alles in perfektem Zustand. Maria nahm ihren Beruf ernst, sehr ernst. Ihr Beruf war ihre Berufung. Eine Herzensangelegenheit, ja, Ehrensache. Sie war eine absolute Perfektionistin: Schreck der Staubkörner, Albtraum der Milben und Terminatorin von Flecken jeder Art. Maria nannte sich »faxineira«, portugiesisch für Putzfrau, ein Begriff, den man heute offiziell nicht mehr gebraucht. Er ist aus der Mode gefallen, nicht elegant genug für die achtsame Oberschicht, die bei sich zu Hause lieber reinigen lässt, und zwar von einer Kraft, nicht von einer Frau. So wurde aus der Putzfrau die Reinigungskraft – ein gewaltiges Upgrade, wenn auch nicht monetärer Natur – und die oberen Zehntausend konnten ihre Häuser weiterhin ohne schlechtes Gewissen von den meist ausländischen Frauen putzen lassen.
Maria kümmerte sich nicht um solche Feinheiten. Sie verdiente ihr eigenes Geld und blickte ihrem Ruhestand entgegen. Noch zwei Monate, dann würde sie nach Caldas da Rainha in Portugal ziehen. Nur den August und September überstehen – und Frau Baumann!
Frau Baumann, die Hausherrin, plante eine zweimonatige Auszeit von ihren Dauerferien. Eine Weltumrundung auf einem Luxusliner, zusammen mit ihrem Ehemann Hans. Die Baumanns hatten geerbt und gönnten ihren Mitmenschen den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Das geschenkte Geld hatte sie geiziger gemacht, als sie es schon waren.
Traurig, aber wahr.
Vor der Abreise erinnerte die Baumann Maria an ihre Pflichten. »Du putzen einmal pro Woche, lüften, abstauben, Decken ausschütteln. Woche, wo wir zurückkommen: Fensterputzen, einkaufen, Heizung hochdrehen.Capisce?« Nach all den Jahren wusste sie immer noch nicht, dass ihre Reinigungskraft Portugiesin war. Maria, in ihrer unerschütterlichen Geduld, widersprach nie. Warum auch? Es war nicht ihr Job, Frau Baumann zu belehren. Ihr Job war es, sauber zu machen. Für ihre Hausherrin war sie nicht mehr als ein praktisches Werkzeug, das man mit einem Klick bestellen und dann wieder vergessen konnte.
»Sie können sich auf mich verlassen, Frau Baumann. Wie immer«, sagte Maria höflich.
Die Hausherrin musterte sie misstrauisch. War da etwa ein ironischer Unterton zu hören? »Aber nicht nachlässig werden, Maria!«, sagte sie schnippisch. Ihre Lippen verzogen sich zu einem hinterhältigen Grinsen. »Genau genommen sind das nur kleine Arbeiten, nicht putzen wie sonst. Du verstehen, dass ich nicht gleichen Stundenlohn bezahlen kann. Weniger Arbeit, weniger Geld. Fünf Franken weg vom Stundenlohn.Va bene?« Sie beantwortete die Frage gleich selbst. »Sonst ich müssen nehmen andere Person.«
Maria, geduldig und müde von einem langen Arbeitsleben, wollte keinen Streit vom Zaun brechen. Sie war froh über jeden Zuschuss für ihre bevorstehende Rente.
»Wie Sie wollen.«
Baumann nickte zufrieden. »Braves Kind!« Sie händigte Maria den Zweitschlüssel aus und schob sie vor die Tür. Damit war die Sache erledigt und die Baumanns entschwanden in die weite Welt.
Wenig später, an einem heissen Augusttag, erlaubte sich Maria, eingedenk des reduzierten Stundenlohnes zum ersten Mal eine kleine Extravaganz im Chalet Baumann. Sie schaltete die teure Espressomaschine ein und gönnte sich einen Kaffee. Verschwitzt und müde entschied sie sich, ausgiebig zu duschen. Maria stand geschlagene zehn Minuten unter der Regendusche und verwendete reichlich Chanel Coco Mademoiselle, in dem sich eine frische Note der Orange, die Schönheit der Rose und die Grazie des Patschulis entfaltete.
Herrlich!
Dann öffnete sie den Kleiderschrank von Madame und zog sich ein knielanges Sommerkleid mit bunten Schmetterlingen darauf über. Sie schlüpfte hinein wie Aschenputtel ins Ballkleid. Erfrischt flatterte sie so zum Briefkasten, um die Post zu holen.
»Sie haben aber ein schönes Haus.« Die Stimme kam aus dem Nichts und liess Maria zusammenzucken. Sie befürchtete schon, es sei der seltsame Oberst a.D., der das Nachbarhaus bewohnte. Aber vor ihr stand ein Fremder, der das Chalet bewunderte.
»Äh, ja … Danke«, stotterte Maria und fühlte sich wie ein Schulkind, das beim Abschreiben erwischt worden war.
»Meine Frau feiert im September einen runden Geburtstag, und ich bin auf der Suche nach einem schönen Ort für einen Kurzurlaub, um sie zu überraschen. Sie vermieten Ihr wunderschönes Haus nicht zufällig? Es wäre nur für eine Woche.« Der Fremde blickte sie wirklich sehr freundlich an. Er schien nett zu sein.
Marias Gedanken kreisten in ihrem Kopf. Ein Karussell mit durchgebrannter Sicherung. Ehe sie sich versah, hörte sie sich sagen: »Sie haben Glück! Im September verreise ich. Wollen Sie das Haus gleich jetzt besichtigen?«
Der Deal war schnell in trockenen Tüchern. 3.000 Franken, sofort per TWINT bezahlt.
Maria, seit jeher Kleinunternehmerin, erkannte schnell das Geschäftsmodell, das ihre Rente nachhaltig absichern würde. Ein bisschen Gaunerei war vertretbar – solange man nicht erwischt wurde. Also schoss Maria schöne Fotos des Hauses: das sonnendurchflutete Wohnzimmer, die edle Küche mit Arbeitsplatte aus italienischem Marmor, das Badezimmer in Schiefer, den Wellnessbereich mit Sauna und riesigem TV. Sie stellte das Chalet auf einem Immobilienportal online und bot ein Weihnachtsspecial an: zwei Wochen für 5.500 Franken, mit 500 Franken Rabatt bei Sofortbuchung.
Marias Smartphone vibrierte in der darauffolgenden Woche beinahe ununterbrochen. Die Buchungen liefen via Mail. Sie hatte eigens eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet, abgerechnet wurde über TWINT.
Best practice.
Nach 15 Buchungen löschte sie das Inserat. Sie war zufrieden, kein Grund, gierig zu werden.
Am 24. Dezember sass Maria in Caldas da Rainha in einem der zahlreichen Cafés und trank einen Galão. Die Zahlungen waren alle pünktlich eingetroffen, und sie hatte das Bargeld abgehoben. Daraufhin hatte sie das Konto geschlossen. Bei Gelegenheit würde sie bei einer anderen Bank ein neues Konto unter ihrem Mädchennamen eröffnen. Kurz vor 12 Uhr begann ihr Handy zu vibrieren, unaufhörlich. Frau Baumann war hartnäckig. Ebenso die Schar Touristen, die vor dem Chalet stand und Einlass verlangte.
Maria ging nach Hause und legte ihr in die Jahre gekommenes Smartphone in die Mikrowelle. Ein Knistern, ein Knacken, und die Sache war erledigt.
Fortan lebte sie in Portugal unter dem Namen ihrer Mutter: Maria Nascimento. Maria Morgado war Geschichte. In Arosa kannten nur wenige Kolleginnen ihren neuen Aufenthaltsort. Die Baumanns würden ihn nie erfahren. Reinigungskräfte sind loyal – wenn man sie respektvoll behandelt.
Der Concierge
Warnhinweis: Dies ist eine Chronik der feinen Wahrnehmung.
Man sagt, wer lange genug beobachtet, lernt zu sehen. Schärfer als andere. Ich war 38 Jahre Concierge in einem der besten Viersternehotels von Arosa. Ich diente, ich lauschte, ich verschwand hinter der Rezeption wie ein Schatten. Bis ich selbst zum Störfaktor wurde. Die Besitzerfamilie wünschte meine Pensionierung. Zu viele Erinnerungen, sagten sie. Erinnerungen an das Drama, bei dem ich die Hauptrolle spielte – ohne es je gewollt zu haben.
Aber zurück zu meinem Beruf.
Ein guter Concierge urteilt nicht. Er löst Probleme. Er macht das Unmögliche möglich.
Wie für den Zürcher Banker, der drei Quadratmeter Wiese für sein Hündchen im Hotelzimmer verlangte. Also stachen wir im Garten ein Quadrat mit exakt 1,743 Metern Seitenlänge aus und legten ihm die grüne Oase ins Zimmer. Oder für die arabische Prinzessin, die sich einen Schneemann auf dem Balkon wünschte. Zwei junge Praktikantinnen schleppten Kisten voller Schnee hinauf und erschufen die gewünschte Figur. Solche Wünsche erfüllen wir. Ohne Kommentar. Ein Concierge ist der Gandalf des Hotels. Er löst Probleme auf magische Art und beschafft das Unmögliche in unter zehn Minuten.
Aber manche Probleme lassen sich halt nicht lösen. Manche sind grösser als die Möglichkeiten eines Concierge.
Das Ehepaar Gruber kam wie jedes Jahr kurz vor Mittag – Stammgäste seit 23 Jahren. Die Grubers stammten aus Österreich. Altes Wiener Geld. Ein Ehepaar aus einer anderen Zeit. Frau Gruber war die Personifizierung der Gelassenheit. »Passt scho« ihr Lebensmotto. Ihr Gemahl dagegen war ein geborener »Grantler«. Egal, wie perfekt alles war, er fand immer was zum Raunzen. Und dann die Titel! Frau Gruber war für alle »Frau Gruber«, obwohl sie promovierte Philosophin war. Als ich sie einmal mit »Frau Doktor« ansprach, winkte sie sofort ab. »Frau Gruber, des passt scho.« Herr Gruber, ein pensionierter Grundschullehrer, bestand dagegen auf der Anrede »Herr Magister«, darauf legte er grossen Wert. Manchmal warf ich ihm in Anwesenheit anderer Gäste ein »Herr Professor« zu, wofür er sich jeweils diskret mit einem Zehner bedankte.
Concierges sind auch nur Menschen.
Die Grubers wirkten zufrieden, wenn auch etwas müde nach der langen Anfahrt vom Flughafen Zürich. Während ich mit Frau Gruber die Formalitäten regelte, schwebte eine blondhaarige Schönheit durch die Hotellobby. Sie war zum ersten Mal bei uns zu Gast. Eine Schauspielerin, das wusste ich – ein guter Concierge kennt seine Gäste. Ihre Karriere steckte in kleinen Nebenrollen fest. Die Damen beäugten sie mit Misstrauen, die Herren mit Wohlwollen. Herr Gruber blieb höflich distanziert und legte den Arm um seine Frau – ein Gentleman alter Schule.
Wie ich das alles gleichzeitig registrierte? Ganz einfach: Mit den Jahren entwickelt der erstklassige Concierge Froschaugen, die es ihm ermöglichen, den gesamten Raum im Blick zu halten – 180 Grad. Manchmal gelang es mir sogar, den Winkel auf 220 Grad zu überdehnen. Du musst gar nicht erst versuchen, diese Fähigkeit zu erlernen, das benötigt Jahre.
Wenn nicht Jahrzehnte.
In der Nacht setzte starker Schneefall ein. Das dumpfe Grollen der Lawinensprengkanonen riss mich immer wieder aus dem Schlaf. Im Nachhinein vielleicht ein Zeichen, dass sich ein viel schlimmeres Drama anbahnte.
Das Wetter besserte sich auch im Laufe des nächsten Morgens nicht. Die Hotellobby, gleichzeitig Lounge und Bar, war gut gefüllt. Die Gäste verlängerten ihr Frühstück mit einem Kaffee am Kamin oder lasen Zeitung. Kinder rannten kreischend um die schweren Sessel, als wären es Slalomstangen. Ich nahm es mit professioneller Contenance zur Kenntnis.
Gegen 10 Uhr gingen die Grubers zum Skifahren. Beide dick eingepackt, Helme auf dem Kopf und die Jacken bis übers Kinn gezogen. Sie waren exzellente Skiläufer, vor allem Frau Gruber, Österreicherin halt. Ich sah ihnen nach, Frau Gruber schulterte die Ski verkehrt herum, Spitze nach hinten – eine Kleinigkeit, die mir sofort auffiel. Gute Skifahrer tun das eigentlich nicht. Die Spitze ist immer vorne.
Nie hinten.
Niemals.
Auf keinen Fall.
Eine Stunde später kehrte sie ins Hotel zurück. Allein. Mit behelmtem Kopf eilte sie an mir vorbei und verschwand im Aufzug. Grusslos! Das war neu. Ich wusste sofort: Etwas war passiert.
Am Nachmittag kam dann auch Herr Gruber, so gegen 15 Uhr. Der Magister winkte mich diskret heran. Ob denn seine Frau schon zurückgekehrt sei, wollte er wissen. Ich bejahte.
Gruber berichtete mir von einem Streit an der Mittelstation. »Eine Lappalie, aber meine Frau stürmte aus der Gondel. Ich bin trotzdem auf den Gipfel gefahren, wo ich ein üppiges Mittagessen zu mir genommen habe«, erzählte er leutselig, was ich so nicht von ihm kannte. Ich wünschte dem »Herrn Professor« einen schönen Abend und nahm den Geldschein mit der Würde eines Messdieners entgegen.
Der Anruf, der mein Leben verändern sollte, kam keine Minute später. Es war Gruber. Seine Stimme: panisch.
»Rufen Sie die Polizei. Meine Frau liegt regungslos im Zimmer!«
Ich war geschockt und mein geschultes Concierge-Hirn schaltete sofort auf Autopilot. »Soll ich nicht lieber den Notarzt rufen?«, fragte ich höflich.
»Du deppata Trottl, ich brauche Hilfe, keine Belehrung!« Schon war die Leitung tot.
So wie die Frau Gruber.
Die diensthabende Ärztin konnte nichts mehr ausrichten. Neben dem Leichnam lag die leere Packung eines starken Schlafmittels. Frau Gruber starb, so die Einschätzung, an einer akuten Atemdepression. Der Todeszeitpunkt: etwa vier Stunden zuvor.
»Mit einer solchen Dosis fährt das Gehirn so weit herunter, dass die Atmung stark verlangsamt oder ganz eingestellt wird, was zu Sauerstoffmangel und letztlich zum Tod führt«, erklärte die Ärztin dem stämmigen Mann neben ihr. Hauptmann Caduff, so hiess er, war Leiter der Kriminalpolizei Graubünden.
Ich stand im Zimmer der Grubers neben der Tür. Beobachtete. Niemand bemerkte mich. Ein Concierge wird oft übersehen oder macht sich unsichtbar. Herr Gruber war von einem Polizisten in die Lobby gebracht worden. Die Situation überforderte ihn offensichtlich.
Verständlich.
»Wer begeht denn an einem so schönen Ort Selbstmord?«, murmelte Caduff und rieb sich das Kinn. Er schien ein Mann der klaren Gedanken. Ich räusperte mich. Der Hauptmann blickte mich überrascht an.
»Wer sind Sie und vor allem: Was machen Sie hier?«, fragte er.
Ich verneigte mich leicht, stellte mich vor und erlaubte mir, meine bescheidenen Beobachtungen mit ihm zu teilen.
»Die Grubers haben sich gestritten?«, wiederholte Caduff. »Das ist doch kein Grund, sich das Leben zu nehmen.«
Ich mag Pragmatismus. Also formulierte ich mein Unbehagen in dieser Sache neu – natürlich so neutral, wie es sich für einen Concierge gehörte. Ein Concierge beschuldigt niemanden, er stellt lediglich fest.
»Frau Gruber trug ihre Ski heute Morgen verkehrt herum, was sie noch nie tat.«
Caduff musterte mich. Lange. Ich konnte nicht erkennen, ob er mich verstanden hatte – oder für verrückt hielt. Er rieb sich erneut das Kinn, die Stoppeln kratzten leise. »Ich will mit den Gästen auf diesem Stockwerk sprechen. Vielleicht hat ja jemand etwas gesehen oder gehört.« Er zeigte mit dem Finger auf mich. »Sie kommen mit und organisieren alles.« Dann wies er einen Beamten an, das Alibi von Herrn Gruber zu überprüfen, und schob mich vor sich aus dem Zimmer.
Die Befragungen fanden in der Lobby statt. Gemütliches Alpenambiente, viel Holz, tiefe Sessel, herrliches Panorama, tragischer Anlass. Grubers Alibi wurde bestätigt und er bestand darauf, an den Gesprächen teilzunehmen.
»Ich muss verstehen, was passiert ist«, so der bemitleidenswerte Witwer.
Es gab keine neuen Erkenntnisse. Als Letzte führte ich die blonde Schauspielerin namens Dorothea Schneider an den Tisch. Ihre Augen waren gerötet, sie sah dennoch bezaubernd aus. Caduff und Gruber erhoben sich. Gruber stellte sich vor und deutete eine Verbeugung an. Caduff streckte förmlich die Hand aus. Dorothea Schneider bestellte auf meine Frage hin Milchkaffee und einen Apfelstrudel.
Als ich servierte, war das Gespräch schon fast beendet. Herr Gruber war so freundlich, mir die Bestellung vom Tablett zu nehmen. Er bat, die Vanillesauce und den Schlagrahm wieder mitzunehmen, verlangte jedoch eine Extraportion Zucker für den Milchkaffee.
Erstaunlich.
Eine halbe Stunde später sass Caduff alleine am Tisch. Es dämmerte bereits, und die Sonne fiel wie immer um diese Jahreszeit wie ein Stein hinter den Horizont. Drinnen tauchte dezente Hintergrundbeleuchtung die Lobby in ein warmes Licht. Im angrenzenden Speisesaal wurde aufgetischt, sanftes Klimpern von Besteck vermischte sich mit erwartungsfrohem Murmeln. Der Polizist hockte wie ein verbeulter Wäschesack im tiefen Sessel und schien zu dösen. Auf mein Räuspern öffnete er die Augen zu einem Schlitz, als ob er aus der Luke einer Gefängniszelle lugen würde. Dann schloss er die Lider wieder und tippte die Fingerkuppen aneinander.
»Der Fall scheint klar. Selbstmord. Wasserdichtes Alibi für den Gatten. Wenn da nur Ihre Geschichte mit den Ski nicht wäre …« Er machte eine Pause, in der man locker ein Zimmer hätte reinigen können. »Ich sollte langsam zurück nach Chur«, sagte er halbherzig, blieb aber sitzen.
»Ich habe Ihnen eine kleine Stärkung gerichtet«, sagte ich und trug auf.
Der Hauptmann richtete sich auf, nippte am Milchkaffee und zog eine Grimasse. Danach nahm er ein Stück Strudel, kaute, sah auf die Tasse, kaute weiter, sah auf den Teller und schluckte schwer. Er blickte mich enttäuscht an. »Verzeihen Sie, ich kann keinen gezuckerten Milchkaffee trinken. Scheusslich! Und der Strudel ohne Rahm und Sauce ist trocken wie Saharastaub.«
Ich lächelte. »Nicht wahr? In meinen vielen Jahren als Concierge hat noch nie jemand diese Kombination verspeist. Niemand, bis auf Frau Schneider. Und Herr Gruber kannte ihre Vorlieben. Merkwürdig: Er muss ein Hellseher sein …«
Caduff schaute mich an, als hätte er gerade erfahren, Elvis lebe in einem Wohnmobil auf dem Campingplatz in Arosa. Eilig zog er einen zweiten Sessel heran. »Setzen Sie sich! Wir bringen die Sache jetzt zu Ende. Aber wir brauchen einen Plan. Ein gezuckerter Milchkaffee und Apfelstrudel ohne nichts wird der Staatsanwaltschaft nicht genügen …«
Eine Stunde später begleitete ich Gruber in den Salon. Caduff hockte nach wie vor am selben Platz, nun mit einem Kollegen in Uniform. Auf der anderen Seite des Raums sass Frau Schneider, in ein reges Gespräch mit zwei jungen Polizistinnen vertieft. Gruber stutzte kurz, setzte sich dann jedoch neben Caduff und überkreuzte die Beine.
Ich ging in die Mitte des Raumes und lauschte beiden Gesprächen gleichzeitig. Ein erfahrener Concierge hat nicht nur Froschaugen, sondern auch drehbare Katzenohren.
Am Tisch links von mir schwatzten die Polizistinnen mit Schneider über deren Filmrollen. Die Schauspielerin war entzückt, als sie um ein Autogramm gebeten wurde. Ohne zu zögern, unterschrieb sie mit feuchten Augen das unbedruckte Papier.
Am Tisch rechts von mir war der Tonfall rauer, Caduff war ein Mann der klaren Worte. »Herr Gruber, Sie haben Ihre Frau ermordet.«
Schweigen. Benetzen der Lippe mit der Zungenspitze.
»Die Schneider hat die Rolle Ihrer in Wahrheit bereits ermordeten Frau eingenommen. Sie haben einen Streit in der Gondel inszeniert und die Schauspielerin ist ins Hotel zurückgekehrt. Raffiniert, aber nicht raffiniert genug.«
Schweigen. Betupfen der Mundwinkel mit dem Einstecktuch.
»Verraten haben Sie kleine Details. Anfängerfehler. Es ist vorbei, Gruber.«
Spöttische Andeutung eines Applauses. »Herr Caduff, was für eine Schmierenkomödie …«, sagte Gruber mit überraschend ruhiger Stimme.
Caduff legte ihm mit ernster Miene eine Hand auf die Schulter und zeigte mit dem Daumen der anderen Hand durch den Raum. »In diesem Moment unterschreibt Frau Schneider das Geständnis.«
Gruber sah, wie seine Komplizin etwas auf ein Papier kritzelte, und verlor augenblicklich die Fassung. »Du Plemplem-Tschopperl, du Beidlmochn, du Trutschn, du Fusn! Damit kommst du nicht durch, es war alles deine Idee!«
Schneider gefror das Lächeln im Gesicht, dann explodierte auch sie. Auf ihre Wortwahl möchte ich aus Diskretionsgründen verzichten. Es war auf jeden Fall ein faszinierendes Schauspiel. Die beiden hinterlistigen Gauner, oder Gaundler eben, wurden abgeführt.
Ein Happy End? Für die Polizei war es jedenfalls ein voller Erfolg. Gruber hatte der jungen Schauspielerin den Aufstieg in dieUpper Society