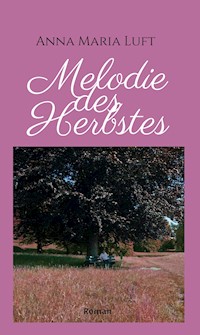3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die neunzehnjährige Sabine verlässt ihr Elternhaus, um auf eigenen Füßen zu stehen. Sie lernt in Nürnberg einen jungen Mann kennen, der in Kürze nach Berlin ziehen muss, um dort ein Studium aufzunehmen. Ein halbes Jahr später folgt sie ihm trotz der angespannten Lage in der geteilten Stadt, aus der nahezu täglich besorgniserregende Schlagzeilen der Zeitungen bestimmen. Ausgerechnet als Reinhard in den Semesterferien Berlin verlässt, um eine Radtour in der Schweiz zu unternehmen, wird die Mauer zwischen Ost und West errichtet. Sabine ist darum besorgt, ob sie jemals ihren Freund wiedersehen wird. Doch die Lage wird nicht so kritisch wie befürchtet. Reinhard kehrt nach Berlin zurück und das junge Paar verlebt eine verhältnismäßig schöne Zeit. Mittlerweile stellen sich Probleme in ihrer Beziehung ein, die einen äußerst brisanten Höhepunkt erreichen. Wie wird sich die Zukunft der beiden entwickeln? können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Anna Maria Luft
BerlinKolonnenstraße
Roman der Zeitgeschichte
© 2016 Anna Maria Luft
ISBN
Paperback:
978-3-7345-3814-8
E-Book:
978-3-7345-3815-5
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1
Der Januar 1960 gab sich ziemlich frostig. In Nürnberg zeigte das Thermometer 20 Grad minus. Sabine, die durch die Straßen der fränkischen Metropole schritt, bibberte vor Kälte in ihrem dunkelroten, weitschwingenden Mantel. Ihre Hände waren wie erstarrt. Sie blieb stehen, um ihre Reisetasche auf dem Gehsteig abzustellen.
Erschrocken blickte sie auf ihre rotgefrorenen Beine, die beinahe gefühllos waren. Trotz der niedrigen Temperatur hatte sie transparente Strümpfe angezogen, weil sie sich, wie viele Frauen, dem Modediktat unterwarf, Perlon- oder Nylonstrümpfe zu tragen, selbst wenn es Winter war. Es nützte nichts, wenn ihre Mutter oft predigte: „Kind, zieh dir endlich dicke Strümpfe an und unter deinem Mantel einen dicken Pullover. Warum hängt er sonst im Schrank? Du ruinierst dich bei dieser Kälte.“
Sabine in ihrem jugendlichen Leichtsinn nahm die Ratschläge der Mutter, aber auch des Vaters, nicht so ernst. Sie hatte mit ihren neunzehn Jahren eine eigene Vorstellung von dem, was Leben bedeutet. Sie war nicht nur voller Lebensfreude und Idealismus, sie konnte auch nachdenklich und in sich zurückgezogen sein, wenn es die Situation erforderte. Es hatte sie nun von daheim fortgezogen, um ihre Vorstellung, auf eigenen Füßen zu stehen, zu verwirklichen. Auch reizte es sie, andere Menschen kennenzulernen. Sie dachte dabei auch an das männliche Geschlecht, weil sie sich nach Liebe sehnte. Keineswegs fürchtete sie sich vor neuen Herausforderungen. Ihr Ziel war außerdem, beruflich vorwärts zu kommen. Bei ihrer Firma in Bayreuth hatte sie zu Ende des Jahres gekündigt. Sie hatte dort eine kaufmännische Lehre absolviert und war danach noch ein halbes Jahr geblieben. Als sie nun vorgestern den Stellenmarkt der Nürnberger Nachrichten studiert hatte, war ihr ein interessantes Inserat aufgefallen. Ungeduldig, wie sie war, wollte sie nicht erst eine schriftliche Bewerbung losschicken, sondern gleich persönlich vorstellig werden.
So hatte sie sich schon heute am frühen Morgen in den Zug gesetzt und war nach Nürnberg gefahren. Sie war voller Zuversicht, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Auf dem Arbeitsmarkt sah es gut aus, wie sie erfahren konnte.
Jetzt hob sie ihre Tasche wieder auf und lief mit etwas schnelleren Schritten als vorher ihrem Ziel entgegen. Hatte man ihr den Weg auch richtig beschrieben?
Ein Radfahrer kam ihr auf dem Gehsteig entgegen. Beinahe wäre sie von ihm umgefahren worden. Ärgerlich rief sie: „Wozu glauben Sie ist die Straße da?“
Seine Antwort überraschte sie: „Zum Marschieren.“
Sie schüttelte den Kopf, erinnerte sich gleich an die Erzählungen ihres Vaters, die von den mühsamen, qualvollen Märschen des Zweiten Weltkrieges handelten. Dabei lag dies etwa fünfzehn Jahre zurück. Aber seine Gedanken an diese schreckliche Zeit konnten bei ihm deshalb nicht zur Ruhe kommen, weil er damals bei einem Angriff seinen besten Freund verloren hatte.
Nachdem Sabine noch einen halben Kilometer weitergegangen und nach rechts abgebogen war, entdeckte sie das Fabrikgebäude auf der linken Straßenseite. Gleich stellte sich bei ihr ein mulmiges Gefühl ein, das sich noch verstärkte, als sie das Personalbüro betrat.
Sie stand einem Herrn mit grauen Schläfen gegenüber, der keine Miene beim Vortragen ihres Anliegens verzog. Nach dem Betrachten ihrer Zeugnisse lobte er beinahe tonlos: „Es sind gute Zeugnisse, aber ohne Test gibt es bei uns keine Chance. Eine Frage habe ich noch vorweg: Wann könnten Sie anfangen?“
„Sofort. Ich habe zum 31.12. bei meiner Lehrfirma in Bayreuth gekündigt und wollte mich auf was Neues einlassen.“
Er nickte und sie war bereit, die geforderte Prüfung über sich ergehen zu lassen. Ihr brach dabei der Schweiß aus den Poren, da ihr einige der Aufgaben so kompliziert erschienen, dass sie glaubte, sie nicht lösen zu können. Sie dachte: reinstes Gehirntraining. Es war ein Feld aufgezeichnet, auf dem die Symbole durch Zahlen ersetzt werden sollten. Außerdem war eine Zahlenreihe angegeben, in der man die nächste Zahl erraten und einsetzen musste. Dazu gab es noch eine Textaufgabe. Den Abschluss bildete ein Brieftext, von dem eine Kurzfassung zu erarbeiten war. Sabine atmete auf, nachdem sie den Test hinter sich gebracht hatte. Sie war zuversichtlich und beinahe davon überzeugt, den größten Teil der gestellten Aufgaben korrekt gelöst zu haben.
Innerhalb von zwei Tagen sollte sie Bescheid erhalten, ob daran gedacht wurde, sie einzustellen. Herr Billar gab ihr ein Kärtchen mit seiner Telefonnummer mit.
Gleich darauf trippelte sie wieder den Weg Richtung Stadt zurück.
Sabine freute sich schon auf die Freiheit in der Großstadt. Was sie sich genau davon versprach, schien sie selbst noch nicht zu wissen. Jedenfalls dachte sie nicht mehr daran, die Bevormundung ihres strengen Vaters zu akzeptieren. Immer noch beanstandete er, dass sie ihre Schule nicht mit dem Abitur abgeschlossen, sondern bereits nach der sechsten Klasse das Gymnasium verlassen hatte. Er hatte dies als Bequemlichkeit bewertet. Ihr jedoch hatten andere Ziele vorgeschwebt. In dieser Hinsicht zeigte Ihre Mutter mehr Verständnis für sie. Sie hatte damals zu ihrem Mann gesagt: „Gregor, warum soll sie nicht gleich einen Beruf erlernen, sondern erst studieren? Ich weiß, als Redakteur setzt du andere Maßstäbe. Aber bedenke, dass nicht alle Menschen gleiche Anlagen ins Leben mitbringen. Unsere beiden Töchter könnten nicht verschiedener sein. Bitte, nimm Rücksicht auf Sabine. Sie ist nicht wie ihre Schwester und will jetzt nicht mehr auf der Schulbank sitzen.“
Sabine hatte sich damals ohne den Segen ihres Vaters zu einer kaufmännischen Lehre entschlossen. Das hielt er ihr heute noch vor. Zu jenem Zeitpunkt hatte sie noch nicht erkannt, dass ihr genau die gleiche Liebe und Fürsorge galt wie ihrer großen Schwester, die sich für das Berufsleben höhere Ziele gesteckt hatte. Während sie jetzt durch die Straßen ging, drängten sich ihr Gedanken an daheim auf. Künftig würde es bei Vater und Mutter keine so lebhaften Diskussionen mehr wie früher geben, da beide Kinder das Elternhaus verlassen hatten. Marianne, die ältere Tochter, besaß in Bayreuth eine eigene kleine Wohnung. Sie hatte erst kürzlich ihr Studium abgeschlossen und war zur Freude ihres Vaters Gymnasiallehrerin geworden. Und sie als jüngere Tochter war soeben dabei, hier in Nürnberg nach einer Bleibe für längere Zeit zu suchen.
In diesem Moment bog Sabine in die Jakobstraße ein. Hier befand sich das Wohnheim Sankt Monika, bei dem sie sich eine Unterkunft versprach. Es war ihr von der Freundin ihrer Schwester empfohlen worden, die bei einem Seminarbesuch kurzzeitig hier gewohnt hatte.
Rasch strich sie mit den Fingern ihre Haare glatt. Dann seufzte sie so tief, als gäbe es eine schwere Entscheidung zu treffen. Als sie läutete, öffnete sich blitzschnell die Tür. Drinnen entdeckte sie das Schild: Anmeldung erster Stock. Sie stieg in die nächste Etage hinauf. Hier in der Diele stand bereits eine Ordensschwester, von der sie lächelnd begrüßt wurde. Sofort fielen Sabine deren große braune Augen auf, die sie fragend anblickten.
„Bitte, was kann ich für Sie tun?“, hörte sie die melodische, sympathische Stimme.
Sabine trug ihr Anliegen vor, aber die freundliche Frau in der dunklen Kleidung schüttelte heftig mit dem Kopf. „Ich kann Sie nicht aufnehmen, weil Sie keinen Arbeitsplatz haben.“
„Aber ich finde doch leicht eine Stelle, selbst wenn ich den Test bei den Ebertswerken nicht bestehen würde.“
Schwester Mathilde, auf ihrer Oberlippe kauend, stand etwas unschlüssig da. Sogleich bemerkte sie: „Nehmen Sie hier einen Augenblick Platz. Ich spreche mit der Schwester Oberin.“
Sabine murmelte „danke“. Sie setzte sich auf die Bank, auf das weiche, karierte Polster, während die Nonne die Treppe hinabstieg. Sie fasste sich an die Magengegend, wo sie einen leichten Schmerz fühlte. Am Vormittag, ehe sie von Frankenbronn weggefahren war, hatte ihr die Mutter ein Wurstbrötchen eingepackt, das sie im Zug verzehrt hatte, aber jetzt war es bereits Nachmittag, und sie hatte nichts weiter zu sich genommen.
Kurz darauf kehrte Schwester Mathilde wieder zurück. „Kommen Sie bitte mit“, bat sie, und Sabine stieg mit ihr ins Parterre hinab in den Aufenthaltsraum, wo sie von der Heimleiterin freundlich begrüßt wurde. Nachdem sie noch einmal ihr Anliegen vorgetragen hatte, genehmigte ihr bereits jetzt die Schwester Oberin den Aufenthalt in diesem Heim.
Wie befreit hauchte Sabine: „Danke. Vielleicht habe ich sogar den Test bestanden.“
Die Heimleiterin lächelte. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und lassen Sie sich jetzt von Schwester Mathilde in ein Zimmer einweisen.“
Die Nonne stand daneben und führte Sabine wieder die Treppe hinauf in einen Raum, den sie mit drei anderen Mädchen zu teilen hatte. „Hier ist Ihr Bett, das ich gleich beziehen werde, und das hier ist Ihr Schrank. Sie können einräumen, wenn Sie wollen. Benötigen Sie Handtücher und dergleichen?“
„Nein, danke. Ich habe alles dabei: Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Waschhandschuh und zwei Handtücher.“
Die Ordensfrau nickte, worauf sich Sabine erst einmal umsah. Ein Tisch mit vier Stühlen stand in der Mitte des Raumes. Darauf lag ein buntes Strickzeug, vielleicht wurde daraus ein Pullover. Über den Betten waren Regale angebracht, die mit Büchern vollgeladen waren. Auf einer Buchreihe saß eine kleine Puppe. Das Wandbrett, das jetzt zu ihrer Schlafstätte gehörte, war noch leer. Augenblicklich fiel ihr ein, das Lexikon daheim gelassen zu haben. Sogar auf Reisen schleppte sie es mit. Ihr Vater verstand dies, aber ihre Mutter schüttelte darüber den Kopf. Einmal hatte sie gemeint: „Warum nimmst du dieses dicke Buch mit? Nachblättern kannst du doch daheim.“ „Nein, Mama, inzwischen habe ich vergessen, was ich suchen will und schon ist wieder eine Bildungslücke entstanden. Papa legt ja großen Wert darauf, dass ich mich weiterbilde.“ „Aha, dein Papa hat dir das eingeimpft. Bildungslücken hat doch jeder. Na ja, er wahrscheinlich nicht. Jedenfalls glaubt er das felsenfest.“
So zu reden, fand Sabine nicht nett von ihrer Mutter. Sie hörte jetzt die Ordensschwester erklären: „Das Waschbecken ist für die Morgen- und Abendtoilette. Sie können den Vorhang vorziehen. Das WC ist draußen im Flur.“
Sabine dachte: Wie umständlich. Für vier Personen ein Waschbecken. Wie soll das gehen? Muss man dann ungewaschen zur Arbeit gehen?
„Zum Baden müssen Sie sich anmelden. In jeder Etage gibt es ein Bad.“
Sabine nickte.
„Und Abendessen gibt es von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Wer nicht anwesend ist, bekommt sein Essen, das heißt sein belegtes Brot, ins Zimmer gestellt. So ist das bei uns“, erklärte Schwester Mathilde. Sie erkundigte sich, ob sich Sabine zurecht finde.
„Ja, schon“, erwiderte sie leicht nachdenklich und setzte sich auf das Bett, das jetzt ihr gehörte. Sie warf einen Blick auf die anderen Schlafstätten, bei denen die Zudecken und Kopfkissen zusammengerollt nach hinten an die Wand geschoben waren, sodass die Liegestatt auch als Sitzplatz benutzt werden konnte.
Als der Abend nahte, erschienen Sabines zukünftige Zimmerkolleginnen. Nachdem sie alle drei anwesend waren, begrüßte die älteste der drei den Neuankömmling, der sich vorgestellt hatte. „Herzlich willkommen. Ich bin die Hildegard.“ Das nächste Mädchen, es war sehr groß und schlank, schloss sich ihr gleich an. „Ich bin Elke aus Düsseldorf.“ „Und ich bin die Manuela, die Jüngste“, hörte Sabine das dritte Mädchen sagen und bemerkte sofort den bitteren Zug um deren Lippen. Manuela fügte auch gleich hinzu: „Ich laufe hier als schwarzes Schaf herum. Und wenn dir mal was fehlen sollte, komm zu mir. Vielleicht habe ich es unter der Matratze versteckt.“
Sabine schwieg dazu. Sie blickte diesem Mädchen über die Schulter, um zu erfahren, wie die beiden anderen auf diese Worte reagierten, entdeckte aber nur Teilnahmslosigkeit.
Drei Tage später erhielt Sabine von den Ebertswerken den Bescheid, ihren Test bestanden zu haben. Überglücklich teilte sie dies der Heimleitung und ihren Eltern mit.
Der Personalchef bat sie, gleich mit in die Abteilung zu kommen, in der sie künftig arbeiten sollte, nämlich in der Rechnungsprüfstelle. An der Stirnseite des Großraumbüros saß ein Herr mit ziemlich kurzen Haaren, einem vollen Gesicht und Augen, die alles aufzunehmen schienen. Er war der Abteilungsleiter. Sabine sah sich einen kurzen Augenblick um. Sie überschlug momentan, dass in diesem Raum mindestens zehn bis zwölf Personen saßen.
„Herr Mittler, das ist Ihre neue Angestellte, Fräulein Gartner“, wurde sie vorgestellt.
Der künftige Vorgesetzte reichte Sabine die Hand. „Freut mich, endlich die Lücke auffüllen zu können“, äußerte er, worauf sich Sabine verängstigt duckte. Der durchdringende Blick und die energische Stimme waren es, die sie etwas einschüchterten. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte sich herausstellen, dass dieser Herr nicht so streng war wie sie anfangs vermutet hatte, aber auf gewissenhafte Arbeit größten Wert legte.
Jetzt blickte sie sich genauer um. Alle Augen, das waren sechzehn Mal zwei, waren auf sie gerichtet. Sie gewann den Eindruck, dass dies durchweg freundliche Gesichter waren. Von Großraumbüros hatte sie bereits Negatives gehört, aber sie wollte unbedingt vorurteilsfrei bleiben.
Schneller als Sabine vermutet hatte, gewöhnte sie sich an ihren neuen Arbeitsplatz. Die Angestellten waren altersmäßig gemischt, auch mehr Männer als Frauen. Bis auf die Geräusche, die die Rechenmaschinen verursachten, herrschte hier Ruhe. Sobald jedoch Herr Mittler den Raum verließ, standen die Maschinen still. Jetzt entspannten sich die Angestellten und unterhielten sich leise miteinander. Aber jedes Mal wenn der Chef wieder im Türrahmen erschien, wurde das Gemurmel und Getuschel schlagartig beendet. Ein süffisantes Lächeln erschien dann auf den Lippen des Abteilungsleiters, der soeben noch ein paar Wortfetzen aufgenommen hatte, wusste er doch, dass seine Abwesenheit als Erholungspause genutzt wurde.
Ab und zu gab es eine Verzögerung beim Nachschub der zu überprüfenden Rechnungen. Was konnte man gegen diese Langweile tun, fragten sich einige Angestellte, so auch Sabine. Nichts, wurde ihr bald klar, denn der Chef behielt jeden seiner Mitarbeiter im Auge.
Im Mädchenwohnheim konnte Sabine nach dem Auszug von Elke mit Hildegard und Manuela in ein Dreibettzimmer überwechseln. Sie verstand sich jetzt besonders gut mit Hildegard, aber Manuela war ihr ein Dorn im Auge. Als sie einmal später heimkam, hatte ihr dieses Mädchen das Marmeladenbrot, ihr Abendessen, weggegessen. Ein andermal war es das Wurstbrot, und sie musste hungrig schlafen gehen. Außerdem legte Manuela ihre schmutzige Wäsche oder alte Zeitschriften auf das Bett ihrer Nachbarin. Als Hildegard Sabine Das Tagebuch der Anne Frank zum Lesen gab, äußerte Manuela grinsend:
„Glaubst du dieses Märchen? Es hat doch nie eine Judenverfolgung gegeben. Mein Vater hat gesagt, dass die Juden einander selbst verfolgt haben.“
Daraufhin rief Sabine ärgerlich: „Wie kannst du das behaupten? Und die Gaskammern hat es deiner Meinung nach wohl auch nicht gegeben, wie?“
„Hat es auch nicht. Du glaubst wie alle hier jeden Unsinn.“
„Unsinn, sagst du? Weißt du was, Manuela. Jede Minute, in der ich mich mit dir unterhalte, empfinde ich als verlorene Zeit.“
Oh, das war hart!
Dass Manuela auf diese Worte hin grinste, begriff Sabine nicht. Sie hörte ihre Zimmerkollegin sagen: „Habe ich dich nicht gleich darauf hingewiesen, dass ich das schwarze Schaf bin und kein weißes Lämmchen wie du? Dabei wird es immer bleiben.“
„Wundert dich das, wenn du solche Sachen von dir gibst und mir laufend das Brot wegisst?“
Manuela kaute auf ihren Lippen herum, ehe sie mit Bitterkeit äußerte: „Du bist immer satt geworden, nehme ich an. Hättest du in deinem Leben einmal richtig gehungert, würdest du anders reagieren. Du kannst dich nicht über Gefühle erheben, die du nicht selbst empfunden hast.“
Sabine stutzte über diese bemerkenswerte Aussage. Sie fragte sich in diesem Augenblick, was sich in Manuelas Leben Schlimmes ereignet haben musste. Sie verfiel in kurze Nachdenklichkeit. Aber gleich darauf stieg von neuem Wut in ihr auf, die sie nicht zu unterdrücken vermochte.
Im Fasching besuchte Sabine mit Hildegard den Blunaball. Heute spielte der bekannte Hasy Osterwald mit seinem Quartett. Sabine hatte ein Hawai-Röckchen aus Schilf angezogen, wozu sie eine rote Bluse und schwarze Netzstrümpfe trug. Auf dem Kopf thronte eine Perücke mit langen schwarzen Haaren. Dies alles hatte sie von ihrer älteren Schwester erhalten, als sie zwischenzeitlich daheim gewesen war. Sie wusste bislang noch nicht, ob diese Faschingssachen geschenkt oder ausgeliehen waren.
Eine Woche später besuchte Sabine allein einen Ball. Den jungen Mann, der sie zum Tanz bat und mit ihr Foxtrott tanzte, fand sie sehr sympathisch. Er wollte wissen, ob sie eine Nürnbergerin sei.
„Nein, ich komme aus Frankenbronn, das liegt nur ein paar Kilometer von Bayreuth entfernt. Und von woher kommen Sie?“
„Gebürtig aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die jetzt zu Polen gehören. Aufgewachsen bin ich in der Nähe vom Chiemsee in einem kleinen Ort. Wir sind später nach München gezogen, wo meine Eltern jetzt leben.“
„München, wie schön!“
„Hier in Nürnberg wohne ich in der Kaiserstallung auf der Burg.“
Sabine lächelte ihn an. „Sie sind also ein Burgherr?“
Er lachte laut. „Ja, leider ein armer. Wir wohnen zu viert in einem Zimmer. Zwei davon, dazu gehöre ich, schlafen in einem Stockbett. Ich mache bis zum Herbst ein Praktikum. Danach werde ich studieren.“
Sabine wurde neugierig. „Was werden Sie studieren?“ „Ingenieur der Fernmeldetechnik. Leider gibt es nur eine einzige Ingenieurschule der Deutschen Bundespost und die ist ausgerechnet in Berlin, wo es so kriselt.“
„Oh, das ist ja bitter für Sie.“
„Kann man wohl sagen. Ich hoffe doch sehr, dass sich dort die politische Lage etwas ändern wird.“
Von nun an wurde Sabine oft von diesem jungen Mann zum Tanz aufgefordert. Er begleitete sie auch später zu ihrem Heim. Sie besprachen, sich beim nächsten Ball in der Messehalle zu treffen. Aber Sabine konnte ihn dort nirgends entdecken. Als dann Damenwahl angekündigt wurde, sah sie sich nach einem Partner um. Ihre Wahl fiel auf einen jungen Mann, der sich als Mafioso verkleidet hatte. Schwarzes Schnurrbärtchen, dunkles Hemd, weiße Krawatte, Sonnenbrille, beinahe Respekt einflößend. Als sie mit ihm die Tanzfläche betrat, bemerkte er zu ihrer großen Überraschung: „Ich staune, dass Sie mich trotz meiner Verkleidung gleich erkannt haben.“
Sabine fiel es wie Schuppen von den Augen. Doch sie dachte nicht daran zuzugeben, dass es Zufall gewesen war, ihn erwählt zu haben und nicht, weil sie ihn als ihren Tänzer vom Blunaball erkannt hatte.
Es wurde ein wundervoller Abend. Sie drehten sich im Dreivierteltakt, tanzten Rumba und Tango, aber auch Rock’n Roll, wobei so mancher Jugendliche außer Rand und Band geriet. Sabines Tanzpartner besaß auch viel Temperament. Sie stoppte ihn kurz. „Bitte, nicht so wild tanzen. Ich komme sonst nicht mit. Außerdem wackeln schon die Wände“, kicherte sie.
Er lachte über ihre witzige Bemerkung. Sie redeten jetzt von Elvis Presley. Das amerikanische Rock‘n Roll-Idol war im hessischen Friedberg im Rang eines Sergeanten stationiert gewesen und erst kürzlich nach zweijähriger Dienstzeit entlassen worden.
Eine Solo-Sängerin beeindruckte mit der Interpretation des Schlagers „Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück. In deinen Armen zu träumen…“
Sabine fand es „himmlisch“, mit diesem jungen Mann einen Langsamen Walzer zu tanzen. Der Text des Schlagers passte zu ihrer verliebten Stimmung. Bei dem anschließenden Slowfox schmiegten sie sich beide eng aneinander. Etwas später gingen sie bei einem Glas Wein auf das „Du“ über. Gerne hätte Reinhard seiner Bekannten einen Kuss auf die Lippen gedrückt, aber er wagte es nicht. Stattdessen streichelte er ihre Hände.
Auf dem Heimweg blieb er einmal stehen, um Sabine in die Arme zu nehmen. Er drückte seine Lippen fest auf ihren geschminkten Mund. Für Sabine war es der erste Kuss und somit einzigartig. Sie fühlte bereits, dass es nicht der letzte sein würde. Doch gerne hätte sie erfahren, ob er schon einmal ein Mädchen geküsst hatte.
Von der Heimleiterin hatte Sabine ausnahmsweise den Hausschlüssel erhalten. So konnte sie länger ausbleiben als üblicherweise gestattet war. Leise schlich sie in ihr Zimmer, um ihre beiden Mitbewohnerinnen nicht zu wecken. Plötzlich rührte sich etwas im Nebenbett.
„Meine Güte, du bist ja unter die Nachtschwärmer gegangen“, flüsterte Hildegard. Doch ehe Sabine etwas erwidern konnte, rief Manuela:
„Diese Hure hat wieder Sonderrechte erhalten. Immer ist sie eine Ausnahme.“
Sabine war nahe daran, Manuela zu schlagen, so wütend war sie. Zu ihrer Überraschung knipste Hildegard das große Licht an, zog Manuela die Zudecke vom Leib und zerrte sie aus dem Bett. „Jetzt will ich dir mal was sagen. Die Hure bist du. Zweimal bist du nachts nicht heimgekommen und hast wahrscheinlich bei einem Mann geschlafen. Und einige Male habe ich dich mit verschiedenen Männern am Frauentorgraben gesehen. Und noch etwas: Ständig klaust du uns das Abendessen, sodass wir hungrig ins Bett gehen müssen. Ich mache Meldung.“
Diese Beschwerde hatte zur Folge, dass Hildegard und Sabine in ein erst gestern freigewordenes Zweibettzimmer umziehen durften.
Sabine genoss diese fröhliche Faschingszeit mit Reinhard sehr. Noch mehr erfreute sie sich jedoch an den herrlichen Frühlingstagen, an denen allmählich die Natur zu erwachen begann. So unternahmen sie zum Wochenende stundenlange Spaziergänge durch Wald und Wiese und erzählten einander von ihren Familien. Einmal sprach Reinhard von seinem Vater, einem Konstrukteur in der Autobranche. „Er hat die besten Ideen. Mir hat er ein kleines Radio gebaut, meiner Mutter eine Küchenmaschine, die so ähnlich wie ein Mixer funktioniert.“
„Und wie ist deine Mutter?“
„Sie ist strenger als mein Vater. Die beiden ergänzen sich gut. Sie leiden darunter, dass ich nicht mehr daheim sein kann. Ich habe keine Geschwister.“
„Mein Vater hätte mich auch gern daheim. Er wollte, dass ich wieder in Bayreuth eine Stelle annehme, aber ich möchte frei sein. Ich habe noch eine ältere Schwester, die bereits eine eigene Wohnung hat. Sie ist Gymnasiallehrerin in Bayreuth. In den Augen meines Vaters ist sie etwas Besonderes.“
Reinhard zog die Augenbrauen hoch. „Bist du deshalb eifersüchtig? Es klingt jedenfalls so.“
Sabine fühlte sich ertappt und erwiderte ungehalten: „Und wenn schon.“
Sofort entschuldigte sich Reinhard. „Hätte ich nicht sagen sollen. Tut mir leid.“
Sie erwiderte mit einem gezwungenen Lächeln: „Muss dir nicht leid tun. Ich habe auf deine Frage zu heftig reagiert. Ja, ich bin eifersüchtig, weil sie bei meinem Papa mehr gilt als ich. Immer stellt er ihre gute Bildung heraus, die ich in seinen Augen verpasst oder verpatzt hab.“
„Du meine Güte“, kam es ihm über die Lippen. „Jeder sollte das machen können, was er selbst möchte.“
Sabine nickte, und sofort wurde das Thema gewechselt.
Der Wind wurde heftiger, allmählich artete er in Sturm aus. Die Bäume schüttelten ihre Zweige, als wollten sie sie von sich stoßen. Sie bogen sich hinüber und herüber. Plötzlich brach ein dicker Ast ab und wäre beinahe Sabine auf den Kopf gefallen. Sie hatte sich gerade noch retten können. Erschrocken flüchtete sie in Reinhards Arme. „Das ist gerade noch einmal gutgegangen“, stöhnte sie. Er hielt sie fest und nützte die Gelegenheit zu einem raschen Kuss. Danach rief er: „Schnell weg, schnell raus aus dem Wald.“
Sie spazierten den Weg zurück zur Wiese. Das Wetter war so unangenehm, dass sie sich zum Besuch eines Cafés entschlossen. Hier begann Sabine aus ihrer Kindheit zu erzählen. „Vorhin bei dem starken Wind hab ich an ein Erlebnis denken müssen. Mit sechs Jahren hab ich zusammen mit meiner Mutter einen Sturm erlebt. Ich hab geglaubt, der Wind reißt mich gleich um und nimmt mich mit sich fort. Ich hab nach meiner Mutter geschrien, aber sie war schon weitergegangen. Schnell hab ich mich am Zaun angehalten, aber, o weh, die morsche Latte brach ab, und meine Mutter fand mich mit diesem Stück Holz weinend am Boden liegen.“
Reinhards Erlebnisse waren viel dramatischer. „Als wir Ende des Krieges flüchten mussten, ist meine Mutter im Flüchtlingslager schwer erkrankt, und ich habe gedacht, sie muss jetzt sterben. Aber sie ist bald wieder gesund geworden. Mein Vater hat uns nach dem Krieg vom Roten Kreuz suchen lassen. In Oberbayern hat es dann ein glückliches Wiedersehen gegeben. Ich erinnere mich noch daran, dass bei meinem etwas rührseligen Vater die Tränen gekullert sind. Es war unglaublich schön gewesen, wieder eine vollständige Familie zu sein. Leider mussten wir in dem kleinen Ort zeitweise sogar hungern.“
„Wir hatten Glück und konnten uns einigermaßen über Wasser halten“, erzählte Sabine. „Als Bayreuth in Schutt und Asche fiel, haben wir die Detonation bis nach Frankenbronn gehört, ließ ich mir sagen. Ich war ja erst drei Jahre alt und habe fast nichts mitgekriegt. Viele Ausgebombte haben nach einer neuen Unterkunft gesucht. Wir haben auch eine dreiköpfige Familie aufgenommen, die fünf Jahre lang in unserem Häuschen gelebt hat. Später sind die meisten Bayreuther wieder in ihren Heimatort zurückgegangen. Es war in dieser Stadt sehr viel aufzubauen gewesen.“
Auf dem Weg zu Sabines Heim waren sie sich beide einig, dass es ein angenehmer, unterhaltsamer Nachmittag gewesen war. Reinhard drückte ihr wie so oft einen Kuss auf den Mund. Hinterher stellte er ihr überraschend die Frage, ob sie ihn heiraten wolle. Ihre Augen nahmen daraufhin einen traurigen Ausdruck an. Sie klagte: „Aber Reinhard, das ist doch utopisch, ich meine, aussichtslos. Du wirst in Berlin sein und ich hier in Nürnberg bleiben. Wie soll das gehen?“
Verlegen biss er sich auf die Lippen, ehe er erwiderte: „Aussichtslos ist es sicher nicht. Ich könnte öfter zu dir nach Nürnberg kommen, vielleicht alle vier Wochen. Und nach meiner Ausbildung heiraten wir. Dann sind wir für immer zusammen.“
Sabine schwieg, aber hinter ihrer Stirn arbeitete es ununterbrochen. Gab es wirklich keine andere Möglichkeit, als in der Ferne auf ihn zu warten? Über diesen Punkt dachte sie lange nach, weil sie Reinhard nicht mehr verlieren wollte.
„Liebling, du willst also nicht auf mich warten?“, erkundigte er sich enttäuscht, worauf sie entgegnete: „Doch, das will ich. Ich möchte auch für immer bei dir bleiben.“
Er zeigte ihr sein schönstes Lächeln, als er meinte: „Wir werden einen Weg finden, um unsere Liebe zu erhalten.“
Sie nickte und flüsterte: „Das hoffe ich auch.“
Trotz ihrer Hoffnung, zusammenbleiben zu können, gingen sie an diesem Nachmittag traurig auseinander.
Doch am nächsten Tag strahlten Sabines Augen bereits wieder. Sie teilte Reinhard ihre Absicht mit, im Frühjahr zu ihm nach Berlin übersiedeln zu wollen. Dass sich seine Begeisterung über ihre Idee in Grenzen hielt, darüber war sie verblüfft. Er äußerte seine Bedenken: „Liebling, Berlin ist für dich zu gefährlich. Viele Menschen verlassen die geteilte Stadt. Der Russe hätte jederzeit die Möglichkeit, die Zufahrtswege dicht zu machen. Was dann?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Glaubst du wirklich, dass er das tun wird? Und wenn das zutreffen sollte, bin ich doch bei dir.“
„Was glaubst du, was Chruschtschow noch alles bewirken könnte.“
„Du musst doch dieses Risiko auch eingehen. Warum nicht ich, wo ich zu dir gehöre?“
Er blickte ihr tief in die graugrünen Augen. „Liebling, für mich gibt es doch keine andere Wahl. Ich muss. Du könntest auch in Nürnberg auf mich warten. Für deine große Bereitschaft, dein großes Vertrauen, danke ich dir. Ich möchte dich aber in keine missliche Lage bringen, verstehst du das nicht? Was würden deine Eltern dazu sagen?“
Sabine verschränkte die Arme und blickte Reinhard fragend an. „Du denkst an meine Eltern? Nicht an mich? Warum müssen die etwas dazu sagen? Es ist meine Entscheidung. Oder findest du es aufdringlich, wenn ich zu dir nach Berlin komme?“
Über seinen ernsten Blick erschrak sie. „Aufdringlich? Niemals, Sabine. Im Gegenteil: Ich finde es sehr mutig von dir. Unter anderen Voraussetzungen wäre ich glücklich darüber, dass du in meine Nähe kommen möchtest. Aber ich versichere dir, dass ich dir auch in der Ferne treu bleibe.“ Er blieb stehen und legte zärtlich seinen Arm um sie. „Ich möchte dich für immer festhalten, mein geliebtes Mädchen, und zwar für ein ganzes Leben lang“, flüsterte er.
„Das möchte ich doch auch. Deshalb komme ich zu dir nach Berlin. Ich habe Angst, dass wir sonst einander verlieren.“
Reinhard spürte, wie ernst ihr dieses Vorhaben war. Er riet ihr, sich noch etwas Zeit für eine Entscheidung zu nehmen.
Inzwischen unternahmen die beiden lange Spaziergänge. Sie suchten an einem Samstagnachmittag das Märzfeld auf. Reinhard war die damit verbundene Geschichte bekannt. Auf diesem Gelände, das größer war als achtzig Fußballfelder, wollte einst Hitler ein bombastisches Aufmarschgelände errichten. 24 Türme hätten entstehen sollen, aber 12 waren nur gebaut worden. Einen von diesen bestiegen jetzt die beiden jungen Leute. Es war beinahe dunkel darin. Schritt für Schritt kamen sie nur vorwärts. Auf einmal blieb Sabine stehen und klammerte sich an ihren Freund. Sie stöhnte: „Ich fürchte mich. Gehen wir schnell wieder hinaus. Man fühlt sich hier wie eingesperrt, beinahe wie in einem Konzentrationslager.“
Reinhard hielt Sabine einige Augenblicke fest. „Liebling, hab doch keine Angst. Hier passiert uns doch nichts. Ja, die Konzentrationslager waren eines der traurigsten Kapitel der deutschen Geschichte. Was du vielleicht nicht weißt: Es gibt immer noch Menschen, die diese Tatsache leugnen. Mein Zimmerkollege behauptet, dies hätte es nie gegeben. Es sei die Erfindung einfallsreicher Leute.“
„Ein Mädchen aus meinem Heim denkt genauso. Warum machen sich diese Menschen etwas vor?“
„Was mein Zimmerkollege denkt, ist katastrophal. Beinahe hätte ich dieses arrogante Miststück verhauen. Ausziehen aus diesem Zimmer kann ich nicht. Ich muss noch mein Praktikum zu Ende führen.“
Sie verließen den Turm wieder und warfen einen Blick über das ganze Gelände, das einmal den Eindruck einer Festung erwecken sollte.
Reinhard hatte über die Geschichte Nürnbergs schon einiges gelesen. Diese mittelalterliche Stadt war einst Ort der NSDAP-Reichstage, und 1945-1946 Schauplatz der Nürnberger Prozesse gewesen. Sie hatten mit 12 Todesurteilen gegen Nazigrößen geendet. 1946-1949 hatten auch noch zwölf Nachfolgeprozesse vor amerikanischen Militärgerichten stattgefunden.
Nürnberg war im Zweiten Weltkrieg erheblich zerstört worden. Auch jetzt gab es hier noch Ruinen. An einer kamen die beiden öfter vorbei. Reinhard hatte das letzte Mal, als sie vorübergegangen waren, gemeint: „Man sieht, dass es einmal ein herrschaftliches Haus gewesen war. Sieh dir doch mal das halb zerstörte Türmchen an.“
Sabine meinte, dass es sich lohnen könne, dieses Gebäude wieder aufzubauen und warum das nicht längst geschehen war.
„Vielleicht sind die ehemaligen Besitzer im Krieg umgekommen oder das Geld ist ihnen ausgegangen.“
„Nun steht es als Ruine da. Ich finde das furchtbar traurig?“
„Ich auch. Ach ja, der Krieg. Was hat der nicht alles angerichtet. Er hat Tod, Not, Elend und Einsamkeit bei manchen Menschen zurückgelassen. Manche Spuren verwehen nie.“
Sabine lächelte. „Heute erscheinst du mir als Philosoph, mein Liebling“
Inzwischen war es September geworden. Ein Sommer mit Spaziergängen, Besuchen von Tanzveranstaltungen und Theateraufführungen war zu Ende gegangen. Sie hatten Die Meistersinger von Nürnberg erlebt und waren auch im Germanischen Nationalmuseum gewesen. Über die von Peter Henlein erfundene Taschenuhr, es nennt sich Das Nürnberger Ei, schüttelte Sabine den Kopf. „Ich begreife nicht, warum die Uhr nur einen Zeiger hat. Ist die kaputt gegangen?“
„Nein. In der Uhrenmechanik war der Mensch damals noch nicht so weit.“
Dies leuchtete Sabine ein.
An einem noch verhältnismäßig warmen Abend unterlagen sie dem Zauber Nürnbergs bei Nacht. Sie suchten den Schönen Brunnen, die Frauenkirche und den Kettensteg auf. Diese Sehenswürdigkeiten waren mithilfe von Scheinwerfern in ein sanftes Licht getaucht. Reinhard fand interessante Motive zum Fotografieren. Nachdem er seinen Apparat wieder eingesteckt hatte, legte er seinen Arm um Sabine und flüsterte: „Ich trenne mich so schwer von dir, Liebling, und von dieser interessanten Stadt.“
Ebenso traurig dachte auch sie an den bevorstehenden Abschied. „Wie soll ich es so lang ohne dich aushalten? Deshalb habe ich mich endgültig dazu entschlossen, im Mai zu dir nach Berlin zu kommen.“
Ein tiefer Seufzer war zu vernehmen. „Sabine, dort sieht es zurzeit sehr schlecht aus. Das Innenministerium der DDR hat für die Bundesbürger ein fünftägiges Verbot der Einreise nach Berlin-Ost verhängt. Die DDR nennt den Tag der Heimat, der jetzt im September stattfinden soll, ein Revanchistentreffen. Jetzt hat unsere Regierung das Interzonenhandelsabkommen gekündigt. Wo soll das alles noch hinführen? Die Lage ist sehr bedenklich.“
Sie verdrehte die Augen und murmelte enttäuscht: „Du willst also nicht, dass ich zu dir komme.“
Er fasste sich an die Stirn und überlegte, was er sagen sollte. „Du verstehst das falsch, aber da du meinetwegen nach Berlin kommen willst, bin ich in gewisser Weise auch verantwortlich dafür.“
„Verantwortlich für meine Entscheidung?“
„Ja, so fühle ich mich. Deshalb breche ich nicht in Jubel aus, weil du kommen willst.“
Als sie weitergingen, stolperte er über ihre flachen, spitzen Schuhe. „Entschuldige bitte.“
„Nichts passiert“, murmelte sie. „Es war meine Schuld. - Und wenn ich bei dir in Berlin sein sollte und es würde etwas geschehen, bin ich doch selbst dafür verantwortlich. Du hast mich oft genug gewarnt.“
Er schwieg, bis sie vor dem Heim standen. „Danke für die schönen Stunden mit dir“, erklärte er, als sie sich voneinander verabschiedeten. „Und überlege dir noch einmal ernsthaft, ob du wirklich nach Berlin kommen willst.“
Ärgerlich entgegnete sie: „Ja, hör mal, ich denke schon wochenlang darüber nach. Aber wenn du nicht willst, dass ich komme, bleibe ich hier.“
Er spürte ihre Enttäuschung und wusste nicht, was er ihr antworten sollte. Deshalb umarmte er sie schweigend.
Am nächsten Tag waren sie sich darüber einig, dass Sabine im Mai nachkommen würde. Dennoch schmerzte Ende September der vorläufige Abschied sehr. Tagelang ließ Sabine den Kopf hängen. Nicht einmal Hildegard gelang es, sie zu trösten.
Zum Wochenende fuhr sie heim und eröffnete ihren Eltern, im Frühjahr nach Berlin zu ziehen. Die Mutter nickte nur dazu, aber der Vater tobte. „Sag mal, bist du lebensmüde?“
„Nein, aber verliebt. Ach, so schlimm steht es um Berlin doch wieder nicht.“
„Das sagst du, weil du keine Ahnung von der politischen Lage hast.“
Sie hockte mit verschränkten Beinen auf der Couch, und der Vater saß neben ihr, als sie darüber sprachen. „Ich hab schon Ahnung davon, wie es um Berlin steht“, erklärte sie ihm mit gedämpfter Stimme. „Reinhard hat mich bereits aufgeklärt. Trotzdem will ich ihm in diese Stadt folgen.“
„So, will er das auch? Er hat dich wohl dazu verleitet.“
„Nein, das Gegenteil ist der Fall. Er hat gemeint, dass es für mich da oben zu gefährlich sei und ich in Nürnberg bleiben soll.“
„Damit hat er recht. Sehr vernünftig von ihm. Du drängst dich ihm auf.“
„Nein, so darfst du das nicht sehen.“
„Ich muss dir mal sagen, was in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand, nämlich, dass in einer Bonner Pressekonferenz Dokumente vorgelegt wurden, die auf einen geplanten Angriffskrieg der DDR gegen die Bundesrepublik hindeuten. Lieferant ist ein geflüchteter Hauptmann der DDR-Volksarmee. Verstehst du jetzt, dass ich große Angst um dich haben werde, falls du in Berlin leben würdest. Bitte, bleib in Nürnberg, bitte, bitte, mein Mädchen.“
Düster blickte die Tochter auf ihren Schoß hinab. „Papa, verschone mich künftig mit solchen Nachrichten. Sie sind erfunden. Ich liebe Reinhard und möchte ihn nicht verlieren.“
„Wenn er dir in der Ferne nicht treu sein kann, ist er deiner nicht wert. Du bist noch nicht mal einundzwanzig. Deshalb verbiete ich dir, nach Berlin zu ziehen.“
Sabine fuhr sich stöhnend über die Augen. „Und wenn ich trotzdem gehe. Wirst du mich polizeilich zurückholen lassen?“
Seine Antwort blieb aus. Er begriff, dass seine Tochter alles daran setzen würde, ihr Vorhaben auszuführen. Sie war der Typ, der sich immer durchsetzte, auch wenn sie andere damit verletzte. Schon als Kleinkind wollte sie immer, bildlich gesprochen, mit dem Kopf durch die Wand gehen.
Die Mutter hatte bis jetzt noch geschwiegen. Jetzt riet sie: „Gregor, lass Sabine ihren Weg gehen. Sie ist bereits erwachsen und will selbst über ihre Zukunft entscheiden. Wir müssen darauf vertrauen, dass sie ihre Sache gut macht.“
„Erika, ich habe mich wohl verhört“, erwiderte Gregor verärgert. „Mit ihren neunzehn Jahren ist sie noch kein erwachsener Mensch. Sie ist ohne jede Erfahrung.“
Sabine lächelte. „Das bin ich wirklich schon, ein erwachsener Mensch. Mama hat vollkommen recht. Ich möchte in Zukunft mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und Erfahrungen muss ich natürlich erst sammeln. Aber dabei kann mir keiner helfen. Ich bin zwar noch minderjährig, aber doch schon so weit, dass ich selbst entscheiden kann.“
Mit energischer Stimme erwiderte der Vater: „Ich bin immer noch für dich verantwortlich. In Wirklichkeit bist du noch ein Küken, das erst einmal aus dem Nest schlüpfen muss. Viele Gefahren werden in Berlin auf dich lauern, die dich umbringen können.“
„Mich umbringen können, Papa? So viel Angst vor diesem neuen Leben hab nicht einmal ich selber.“
„Weil du noch so ahnungslos, so unerfahren bist.“
„Und wenn schon.“
Das Streitgespräch wollte kein Ende nehmen. Erika schüttelte immerzu den Kopf über die Unterredung, die Vater und Tochter führten. Sie hatte gedacht, sich für Sabines Freiheit einsetzen zu können, aber ihr Mann sprach ständig dagegen.
Sie nahm jetzt ihr Strickzeug wieder in die Hand. Es sollte ein Pullover für ihren Mann werden. Mit Wolle und Textilien konnte sie besonders gut umgehen, weil sie Handarbeitslehrerin gewesen war. Nachdem Marianne, das erste Kind, auf die Welt gekommen war, hatte sie ihren Beruf aufgegeben. Und dann war der Zweite Weltkrieg gekommen. 1941, mitten im Krieg, war Sabine auf die Welt gekommen. 1945 war ihr Mann aus dem Krieg zurückgekehrt. Neben seinem Beruf als Redakteur bei dem Nürnberger Blatt Mittelfränkische Nachrichten verfasste er daheim auch noch ab und zu Kurzgeschichten. Erika bedauerte, jetzt nur noch Hausfrau zu sein. Andererseits verbrachte sie viel Zeit mit Stricken, Häkeln und Sticken. Sie bedauerte, dass Sabine kein Interesse daran zeigte, dafür Marianne, die sich ein Deckchen nach dem andern häkelte.
Die freien Tage um Weihnachten herum verbrachte Sabine bei ihren Eltern. Ihre Großmutter kam wieder zu Besuch. Sie war die Mutter Gregors und Christians, der sie gestern nach Frankenbronn gebracht hatte. Elise Gartner lebte bei ihrem jüngeren Sohn und bei ihrer Schwiegertochter in Bamberg. Sie kam immer gern ein paar Tage zu ihrem älteren Sohn Gregor und zu ihrer Schwiegertochter Erika, vor allem, wenn Sabine daheim war. Großmutter und Enkelin verband eine herzliche Beziehung.
Während Erika und ihre Tochter den evangelischen Gottesdienst in der Bayreuther Stadtkirche besuchten, saß Gregor mit seiner Mutter auf der Couch und trank mit ihr ein Gläschen Glühwein. Als die beiden zurückkehrten, lag Elise bereits im Bett.
Zur späten Stunde gab es noch einen Punsch. Auf dem Tisch stand ein Teller mit Plätzchen. Während sie naschten und vom Punsch nippten, redeten sie von früheren Weihnachtsfesten.
Die Mutter erzählte, dass es in den ersten Jahren nach dem Krieg mit Geschenken nicht gut ausgesehen habe. Enttäuscht hatten die beiden Töchter die von ihr aus alten Kleidungsstücken genähten Röcke entgegen genommen. „Aber das Christkind war noch nicht da und hat mir keine Puppe gebracht“, hatte die kleine Sabine festgestellt, worauf Marianne gesagt hatte: „Du bekommst meine. Wir brauchen keine neue.“ „Aber ich will deine alte Puppe nicht, die ist schon kaputt“, war Sabines Antwort gewesen. Die Mutter hatte versprochen: „Nächstes Jahr gibt es eine neue. Und jetzt nimmst du Mariannes Puppe an. Hast du mich verstanden?“ Daraufhin war Sabine in Tränen ausgebrochen, hatte dabei zornig mit den Füßen gestampft und gemurmelt: „Mariannes Puppe hat einen dummen Strohkopf.“
Auch Gregor hatte damals geweint, weil er an seinen Hollfelder Freund denken musste, der im Krieg ums Leben gekommen war. Und jetzt, nach sechzehn Jahren, erinnerte er sich auch noch an einige andere Kameraden, von denen zwei schwer verletzt in ein Lazarett gekommen waren. Nie hatte er erfahren können, ob sie wieder gesund geworden waren.
Jetzt konnte Sabines Stimmung nichts trüben, obwohl sie sich gewünscht hätte, Reinhard würde sie und ihre Familie besuchen. Er war von Berlin aus zu seinen Eltern nach München gefahren und feierte mit ihnen das Weihnachtsfest. Am Telefon hatte er wissen lassen, dass ihn seine Mutter gebeten habe, bei ihnen daheim zu bleiben. Sie habe zu ihm gesagt: „Diese wenigen Tage sollen uns gehören, dir, Vati und mir. Deine Freundin kannst du doch ein andermal besuchen.“
Marianne kam am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihrem Freund Siegfried, einem freundlichen, aber etwas schüchternen jungen Mann. Als sie alle am Tisch saßen, stellte Gregor seinem künftigen Schwiegersohn eine peinliche Frage: „Nun, wann wird geheiratet?“
Geschickt wich Siegfried dieser Problemstellung aus, und Marianne hatte einige Augenblicke die Luft angehalten. Jetzt glühte ihr Gesicht vor Aufregung. Wie konnte sich der Vater so vergessen? Er war doch sonst so beherrscht, dass die Mutter von ihm gesagt hatte: „Er ist ein kühler Mann und weiß, was sich gehört. Nie vergisst er, höflich zu bleiben.“
Dass er kühl sein sollte, zweifelten seine beiden Töchter an.
Sabine war es bei Papas Verhalten auch unbehaglich geworden. Sie blickte zu ihrer Mutter hinüber, die sich auf die Lippen biss und die Augen verdrehte. Großmutters Gesicht zeigte keine Regung. Sie starrte schweigend auf ihren Schoß hinab. Sabine überlegte, warum ihre Oma heute so zurückhaltend blieb. Vielleicht, weil ihr Mariannes Freund noch nicht vertraut war?
In dieser prekären Situation fühlte Sabine Mitleid mit ihrer Schwester. Siegfried Meilitsch war Mariannes erster Freund, und Marianne hätte womöglich befürchten können, dass ihr Vater diesen netten jungen Mann verärgerte.
Es gab ein opulentes Mahl mit Leberknödelsuppe, Gänsebraten, Kartoffelklößen, Bohnen und Wirsingkohl. Als Dessert hatte die Hausfrau eine Creme aus eingeweckten Sauerkirschen und Sahne zubereitet.
Von der Kochkunst seiner künftigen Schwiegermutter war Siegfried so begeistert, dass er sich dreimal für das Essen bedankte. Er war ein sehr höflicher Mann. Träumerisch sah er Marianne in die Augen. Sabine hätte am liebsten gesagt: Na, küsst euch doch schon, ihr zwei Verliebten.
Später stießen sie mit Sekt an. Auch die Großmutter nippte davon. Sie war immer noch schweigsam und lächelte nur still vor sich hin, sodass es Sabine nicht einmal gelingen konnte, etwas ausführlicher mit ihr zu reden.
Sabine warf einen Blick auf die Tanne draußen auf der Terrasse. Ihr Vater hatte sie mit elektrischen Lichtern behängt, die jetzt voll erstrahlten. Mit Wehmut dachte sie an Reinhard und wünschte sich, er wäre jetzt auch hier. Es fing an zu schneien, und der Schnee rieselte auf den Lichterbaum, der herrlich zu glitzern begann. Momentan erschien Sabine ihr Zuhause wieder wie ein trautes Heim, das sie in letzter Zeit nicht mehr zu schätzen gewusst hatte. Ein paar Augenblicke wünschte sie sich hierzubleiben und in Bayreuth eine Stelle anzunehmen, doch was würde dann aus ihrer Liebe zu Reinhard werden? Rasch verflog diese sentimentale Stimmung wieder, und sie hatte die Erfüllung ihres Wunsches wieder klar vor Augen.
Während sie noch am Fenster stand, trat Marianne leise an sie heran und erkundigte sich flüsternd: „Sabine, willst du wirklich nach Berlin ziehen? Ist das nicht zu gefährlich?“
Ärger stieg in der jüngeren Schwester hoch, weil ausgerechnet Marianne, die ihren Freund immer neben sich haben konnte, diese Frage stellte. Entsprechend empfindlich stieß sie hervor: „Soll ich etwa auf mein Glück verzichten, während du deines in vollen Zügen genießen kannst?“
Schweigend senkte Marianne das Kinn, und Siegfried, der alles mit angehört hatte, lächelte verhalten.
Ehe Sabine nach Nürnberg zurückkehrte, suchte sie in ihrem Zimmer einige Sachen für Berlin zusammen, obwohl sie annahm, vorher noch einmal heim zu kommen. Sie bedauerte, den Plattenspieler zurücklassen zu müssen.
Die Großmutter kam hereingeschlichen und nahm auf dem Bett Platz. „Bitte, setz dich doch ein bisschen zu mir“, bat sie ihre Enkelin. „Mein liebes Sabinchen“, flüsterte sie, „es könnte sein, dass wir uns heute zum letzten Mal sehen. Deshalb will ich dir etwas auf deinen Weg mitgeben: Folge immer deinem Gewissen und tu nie etwas Unrechtes. Achte auch auf deine Gesundheit. Das sind zwei Punkte, die du beherzigen solltest.“
„Danke für deinen Rat, Omi. Du meinst es ja so gut mit mir. Wir hoffen doch beide, dass du noch lange leben wirst und wir uns noch oft sehen können.“
Elise zuckte mit den Schultern: „Ich weiß, die Hoffnung ist sehr wertvoll. Aber in meinem Fall bin ich nicht davon überzeugt. Weißt du, was Nietzsche darüber gesagt hat: Hoffnung ist das Schlimmste aller Übel, weil sie die Qualen des Menschen nur verlängert.“
Sabine hob die Lider und rief entsetzt: „Das hat dieser Philosoph wirklich gesagt?“
„Vielleicht hat er eine Enttäuschung erlebt?“, überlegte Elise und drückte ihre Wange noch fester an die ihrer Enkelin. Sie flüsterte: „Geh deinen Weg, mein Kind. Und werde so glücklich wie du nur kannst. Denn du bist zu großer Liebe fähig.“
Die Worte ‚du bist zu großer Liebe fähig‘ bewahrte Sabine in ihrem Herzen. Noch nie hatte jemand solch bedeutende Worte zu ihr gesagt.
Bei Sabines Rückkehr ins Heim war Hildegard noch nicht angekommen. Manuela hatte in Umlauf gebracht, die Mitbewohnerin habe sich bei einem Skiunfall in den Österreicher Alpen das Bein gebrochen. Für Sabine klang das echt. Warum erfand dieses Mädchen immer wieder neue Storys? Manuela freute sich darüber, wenn andere ihre Geschichten glaubten. In Wirklichkeit lag Hildegard mit einer Grippe im Bett. Als sie zurückkam, bat sie Sabine, mit ihr eine Bewohnerin des Altenheims aufzusuchen. Sie trafen sich mit einer Neunzigjährigen, deren Verstand noch sehr klar war, die jedoch ihre Körperpflege schwer vernachlässigt hatte. Sie ließ weder eine Altenpflegerin noch eine Krankenschwester an sich heran. So war sie von eigenartigen Gerüchen umgeben. Da Sabine sehr geruchsempfindlich war, lief sie manchmal rasch aus dem Zimmer, um sich in der Toilette zu übergeben. Hildegard klagte in diesem Fall nach dem Besuch: „Nimm dich bitte zusammen“, worauf Sabine ärgerlich entgegnete: „Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe diese Empfindlichkeit von meinem Papa geerbt. Wir in der Familie haben Hundenasen und können den Braten schon von weitem riechen, bis auf meine Mutter. Meine Schwester ist ähnlich wie ich. Du hast keine Ahnung davon, was man alles erben kann.“
Hildegard lachte. „Blödsinn. Einen Sack voll Geld kann man erben, aber doch nicht diese Eigenschaft. Magst du deinen Papa?“
„Wie kommst du darauf? Natürlich mag ich ihn, sogar sehr. Nur eines mag ich nicht an ihm: Dass er mich ummodeln, umformen möchte. Ich sollte so sein wie meine Schwester: brav, temperamentlos und gebildet. Ich jedoch habe andere Eigenschaften. Meine Mutter nimmt mich so wie ich bin. Trotzdem mag ich meinen Papa lieber, obwohl ich öfter mit ihm Streit hab. Er will mich nicht nach Berlin lassen, weil er so besorgt ist um mich. Aber ich geh trotzdem.“
Hildegard zuckte nur mit den Schultern. Sie erklärte, ein prächtiges Elternhaus zu haben. Ihr fünf Jahre älterer Bruder sei ihr großes Vorbild, dem sie nacheifern wolle.
Als Sabine wieder einmal aus dem Zimmer der Heiminsassin flitzte, kam ihr im Flur eine Altenpflegerin entgegen und das Erbrochene landete auf dem weißen Kittel dieser Frau. Entsetzt über ihr Missgeschick, rief Sabine: „Oh, tut mir das leid. Wie kann ich es wieder gutmachen?“, worauf die Antwort kam: „Nichts müssen Sie gutmachen. Wenn Sie von Frau Mangau kommen, ist das nicht verwunderlich. Sie hat einen penetranten Geruch an sich, weil sie sich nicht waschen lässt. Sie findet sich in dieser Welt nicht mehr zurecht, obwohl sie sehr intelligent ist. Ich glaube, der Tod wäre ihre Erlösung. Leider muss ich das sagen.“
Eine Woche später verstarb die alte Dame. Sie hinterließ viele antiquarische Bücher, die in die Bücherei des Heimes eingereiht wurden. Eines dieser Bände im Regal hatte sie selbst verfasst. Der Titel des Romans lautete: Glückliche Reise in die Vergangenheit.
Hildegard und Sabine durften es durchblättern. Am liebsten hätten sie es sich ausgeliehen, aber die Heimleiterin ließ es nicht zu.
Die beiden Mädchen besuchten danach einmal in der Woche eine demente, aber sehr gepflegte Heiminsassin. Sabine wunderte sich stets über Hildegards großes Verständnis für diese alten Menschen. Jedes Mal wiederholte Frau Weber permanent den Satz: „Die Blumen im Garten sind schön.“ Hildegard schlug deshalb vor, ihr einmal Blumen mitzubringen. Bei der Übergabe meinte die Heiminsassin lächelnd: „Die Blumen im Garten sind schön. Hast du sie dort gepflückt?“
Nein, nein, wir haben sie gekauft.“
„Gekauft? Die Blumen im Garten sind schön. Hast du sie dort gepflückt?“
„Nein, habe ich nicht. Ich habe sie wirklich gekauft. Das dürfen Sie mir glauben.“
„Die Blumen im Garten sind schön.“
Sabine glaubte, in solchen Momenten aus der Haut fahren oder davonlaufen zu müssen. Ihr fehlte es an dieser Engelsgeduld, die Hildegard, ohne sich groß anstrengen zu müssen, aufbringen konnte. Wenn sie mit diesen hinfälligen Heimbewohnern zusammenkam, musste sie unwillkürlich an ihre Großmutter denken, die mit ihren achtundachtzig Jahren immer noch einen gesunden Menschenverstand besaß und die Gabe hatte, aufgeschlossen und freundlich ihren Mitmenschen gegenüber zu stehen. In Sabines Augen war sie etwas Besonderes.
2
Zwölf Wochen lebte Reinhard bereits in der geteilten Stadt. Das Studium fand er anstrengend, aber er war der Meinung, dass es zu schaffen war. Er und seine Kommilitonen nannten es „büffeln“, wenn sie auf bevorstehende Klausuren lernten. Blieb etwas Zeit, saßen sie nach dem Essen noch diskutierend in der Mensa. Dem Berlin-Politikum gegenüber gaben sich die meisten jungen Leute aufgeschlossen. Sie redeten darüber, dass so viele Menschen die DDR verließen und man dort seine Meinung nicht frei äußern durfte.
In der Berliner Morgenpost stand, dass Kurt Thomas, der Leiter des berühmten Thomaner Knabenchors, wieder in die Bundesrepublik zurückgekehrt war. Er gab an, man habe ihn in der DDR in seiner künstlerischen Tätigkeit behindert. Später setzte sich sogar Fritz Freitag, der Chefkonstrukteur der DDR-Luftfahrtindustrie in den Westen ab. Vermutet wurden einengende Arbeitsbedingungen.
Alle vierzehn Tage schrieb Reinhard Sabine einen Brief. Er verzehre sich vor Sehnsucht nach ihr und freue sich schon auf den Frühling mit ihr. Allerdings, betonte er, mache er sich bereits Sorgen darüber, dass sie in Berlin das Gefühl haben könne, eingesperrt zu sein, weil man nicht über die Stadtgrenzen hinaus das Umland aufsuchen könne. Ansonsten empfinde er diese Stadt mit ihren aufgeschlossenen Menschen als etwas Besonderes.
Sabine schrieb zurück, sie könne es kaum erwarten, bei ihm in Berlin zu sein. Sie würde sich bestimmt nicht eingesperrt fühlen. Er solle sich nicht zu sehr den Kopf über die Politik zerbrechen und gelassen bleiben.
Darauf kam die Antwort, dass er sich zwar mit dem Berlin-Problem befasse, es ihm aber keine schlaflosen Nächte bereite. Die meisten seiner Kommilitonen seien politischer als er. Aber er wisse, dass Walter Ulbricht von den Warschauer Pakt-Staaten und besonders von Russland gestützt werde, was bei der Bevölkerung die Befürchtung nähre, dass Westberlin zu einer freien, entmilitarisierten Stadt werden könne, und dass dies viele Menschen als schlechte Aussicht für die Zukunft ansähen.
Anfang Februar legte Sabine ihrem Chef die Kündigung vor. Herr Mittler zeigte sich so überrascht, dass er sie mit offenem Mund anstarrte. „Wie? Sie wollen schon wieder kündigen und sind gerade einmal über ein Jahr hier. Warum, frage ich Sie?“
Als ihm Sabine den Grund dafür nannte, zog er seine Stirn in Falten und äußerte konsterniert: „Das glaube ich jetzt nicht. Sie wollen nach Berlin? Bei dieser kritischen Lage? Keiner weiß, was sich in nächster Zeit dort abspielen wird. In den Zeitungen steht Schlimmes. Also, wenn ich Ihr Vater wäre, würde ich Ihnen erst einmal den Hintern versohlen.“
Wie in Trance ging Sabine auf ihren Platz zurück. Eine Kollegin flüsterte, sie solle in Nürnberg bleiben und sich hier einen Freund suchen. Der Kollege neben ihr wisperte:
„Wenn Sie wüssten, was in Berlin los ist, würden Sie hierbleiben.“
In der Mittagspause kam eine ältere Kollegin lächelnd auf sie zu und flüsterte: „Ich weiß, die Liebe überbrückt auch die schwierigsten Hürden.“
Sabine nickte. „Endlich jemand, der mich verstehen kann.“
Mochten sich viele darüber aufregen, für Sabine stand fest, nach Berlin zu ziehen.
Reinhard hatte ihr geschrieben, dass jetzt immer mehr DDR-Bürger und Ostberliner in den Westteil der Stadt kämen, weil sie sich hier freie Meinungsäußerung und besseres wirtschaftliches Fortkommen erhofften. Aber wie lange noch würden die DDR und die Sowjetunion dabei zusehen?
Erst Anfang Mai fand Reinhard für Sabine eine Unterkunft. Weil bislang nichts geklappt hatte, war er schon unruhig geworden, da seine Freundin daran dachte, schon im Laufe dieses Monats kommen zu wollen. Er las in der Berliner Morgenpost die Anzeige, dass eine Gertrud Meroux in Schöneberg in der Kolonnenstraße ein Zimmer zu vermieten habe. Dorthin begab er sich am Samstagnachmittag.
Nach der Besichtigung des Zimmers meinte Frau Meroux, sie müsse dieses Mädchen erst einmal kennenlernen, ehe sie sie hier einziehen lasse. Daraufhin schüttelte Reinhard den Kopf. „Geht nicht. Sie kann doch nicht vorher kommen und sich vorstellen.“
„Sie könnte doch erst in ein Hotel gehen oder erst bei Ihnen unterkommen“, schlug die Dame vor. Reinhard presste ärgerlich die Lippen zusammen, dann erwiderte er: „Entweder bekommt sie das Zimmer oder nicht. Sie können mir glauben, dass meine Freundin das netteste Mädchen auf der ganzen Welt ist. Ich garantiere Ihnen, dass Sie mit ihr gut auskommen werden.“
„Gewiss, Sie kommen bestimmt gut mit ihr aus, aber ich weiß doch nicht, ob das auch für mich zutrifft.“
Ein schweres Gewitter kam. Es fing plötzlich an zu donnern und zu blitzen. Ständig zuckte Frau Meroux erschrocken zusammen. Reinhard erhob sich bereits, um zu gehen. Er meinte: „Dann lassen wir es lieber, wenn Sie Bedenken haben. Schade.“
Ein neuer Donner folgte, worauf Frau Meroux ängstlich rief: „Bitte, bleiben Sie noch. Ich habe furchtbare Angst. Bitte, nehmen Sie doch noch einmal Platz.“
„Gern, wenn Sie das beruhigt.“ So setzte sich Reinhard wieder auf den Stuhl, um das Ende des Unwetters abzuwarten. Plötzlich gab es einen ungeheuer lauten Kracher, und darauf folgte sofort ein so heller Blitz, dass sich Frau Meroux die Hand vor die Augen schlug und schockiert schrie: „Jetzt hat es hier eingeschlagen.“
Reinhard erhob sich und blickte aus dem Fenster. Als er nichts Ungewöhnliches entdeckte, rief er: „Nichts ist passiert. Die Kolonnenstraße steht noch.“
„Machen Sie Witze? Ich meine doch das Haus hier, in dem ich wohne.“
„Auch das steht noch. Es ist garantiert nichts passiert, wirklich nichts. Sie brauchen sich nicht zu sorgen.“
Die ängstliche Frau nickte. „Bitte, setzen Sie sich noch einmal. Ich habe Ihnen etwas zu sagen, nämlich, dass Ihre Freundin hier einziehen kann. Zufrieden?“
Reinhard strahlte. „Oh ja, ich bin sehr zufrieden damit. Danke, Frau Meroux. Sie werden es nicht bereuen.“ Beinahe hätte er ihr noch die Hand geküsst, so glücklich war er über diese Mitteilung. Er selbst wohnte auch im Stadtteil Schöneberg. Bei Frau Morhardt durfte er Küche und Bad benutzen. Er kochte sich nie etwas, sondern bereitete sich nur morgens und abends Tee zu. Nun würde er bald den Vorteil genießen können, dass er seine Freundin in der Nähe hatte. Wie sehr er sich darauf freute.
Ein paar Tage vor ihrer Abreise fuhr Sabine noch einmal zu ihren Eltern. Es ging dabei etwas dramatisch zu. Der Vater fand sich nicht damit ab, dass sie nach Berlin ziehen wollte. „Mädchen, dann hängst du da oben fest, wenn es einen Krieg gibt.“
„Jage mir doch keine Angst ein. Ich liebe Reinhard. Deshalb möchte ich bei ihm sein.“
Die Großmutter, die heute auch wieder zu Besuch gekommen war, erklärte: „Wenn euer Sabinchen was will, dann will sie es. Habt ihr das noch nicht verstanden?“
Die Enkelin kicherte. „Omi hat es erfasst. Wenn ich was will, will ich es.“
Darüber schüttelte der Vater verständnislos den Kopf, und die Mutter zupfte nachdenklich an ihren Haarspitzen. In ihren braunen Locken konnte man schon einige graue Strähnen entdecken. Jetzt zog sie es vor zu schweigen, doch sie war davon überzeugt, dass auch sie an Sabines Stelle dem Mann ihres Herzens folgen würde. Sie selbst war, als sie Gregor kennengelernt hatte, auch einige Risiken eingegangen. Wenn sie einmal davon sprach, erhob sich ihr Mann und verließ das Zimmer.
Sie saßen schon beinahe eine Stunde beim Frühstück, das in dieser Familie meistens sehr gemütlich eingenommen wurde, besonders, wenn Elise zu Besuch weilte, die ihr Brot in winzige Stücke schnitt und sie bedächtig aß. Zum Abschluss der Mahlzeit tunkte sie ein Bamberger Hörnchen in ihren Kaffee ein, das meistens so weich wurde, dass es sich bereits in der Flüssigkeit auflöste.
Sabine schmeckte heute das Essen nicht, weil sie heftigen Abschiedsschmerz fühlte. Wahrscheinlich würde viel Zeit vergehen, bis sich wieder einmal die Gelegenheit zu einem Besuch bot. Ohne Appetit kaute sie auf einer halben Scheibe Butterbrot mit Marmelade herum.
Nach der Mahlzeit verabschiedete sie sich von ihrer Großmutter, die nicht mit zum Bahnhof kommen wollte. „Sabinchen, ob wir uns wiedersehen werden?“, zweifelte Elise. Dabei fuhr sie ihrer Enkelin zärtlich über die Wange. Plötzlich begann sie zur Überraschung aller zu singen: „Nun adé, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland adé…“
Gerührt lauschte Sabine dieser schon etwas zittrigen Altstimme, die viel Gefühlstiefe besaß. Sie biss sich auf die Lippen, um nicht in Tränen auszubrechen.
Hinterher bemerkte Elise: „Die Liebe geht oft schwierige oder seltsame Wege. Aber sie wird ihr Ziel erreichen, wenn sie echt ist.“
„Ach, Mutter, lass doch diesen Zinnober“, brummte Gregor ärgerlich. „Du kennst genauso wenig wie wir die Träume der Jugend.“
„Mann, so darfst du nicht reden“, klagte Erika. „Sabine träumt nicht. Sie meint es ernst.“
„Und ob es ihr Reinhard auch ernst meint, wird sich noch herausstellen. Vielleicht hat er da oben schon eine neue Freundin“, gab Gregor zurück.
Verärgert bemerkte Sabine: „Papa, wie kannst du nur so reden. Reinhard ist treu wie Gold. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.“
„Dann sieh zu, dass sie dir nicht verbrennt.“
Sabine nahm nun im Fond des Wagens Platz und ließ sich von ihren Eltern zum Bahnhof bringen. Ehe sie in den Zug stieg, wurde sie noch einmal von Vater und Mutter in die Arme genommen. Der Vater stöhnte. „Mädchen, gib auf dich acht. Ich sorge mich sehr um dich.“
Sabine rollte die Augen. „Papa, das musst du nicht. Es wird schon alles gutgehen.“
„Steig ein, sonst heule ich noch wie ein Schlosshund.“
Ungläubig starrte Sabine ihren Vater an. „Du, Papa, du heulst? Das glaube ich jetzt nicht. Ich hab dich noch nie weinen sehen.“
„Ach, du mein Küken, du hast doch keine Ahnung, was ich fühle. Die Angst um dich quält mich.“
„Aber bitte sag nicht mehr Küken zu mir. Ich bin eine erwachsene Frau.“
„Ein Küken könnte auch nicht allein in die Fremde reisen. Es braucht immer eine Glucke dazu. Und die Glucke bleibt hier.“
Die Mutter lachte. „Dazu werde ich jetzt nichts sagen, nur: Pass auf dich auf, Sabine. Überall können Gefahren lauern. Geh mit Gott.“
So dramatisch hatte sich Sabine den Abschied von ihren Eltern und von ihrer Großmutter nicht vorgestellt. Über die feuchten Augen ihres Vaters und über seine Bemerkung hatte sie sich sehr gewundert. Ihrer Mutter fiel das Loslassen leichter als ihm. War das meistens nicht umgekehrt?
Mit Marianne hatte sie noch einmal telefoniert. Die große Schwester hatte ihr viel Glück in der Liebe gewünscht und: „Sabine sei nicht leichtsinnig in der Großstadt.“
„Ach was, musst du mich auch noch vor den Gefahren warnen? Ich kann doch selbst auf mich achtgeben. Außerdem passt schon Reinhard auf mich auf.“
„Dann ist es ja gut.“
In Kürze nahm Sabine auch von Nürnberg Abschied, vor allem von Hildegard, die ihre Freundin geworden war.
Mit zwei Koffern beladen und mit gemischten Gefühlen in ihrer Brust fuhr sie mit dem Bayernexpress nach Berlin. Reinhard empfing sie herzlich an der Bushaltestelle. Er nahm ihr sofort das Gepäck ab. „Liebling, du wohnst jetzt im Stadtteil Schöneberg, genau wie ich. Ich habe nachgelesen, dass Schöneberg bereits im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts als Straßendorf durch deutsche Siedler gegründet worden ist. Urkundlich wurde es erstmals im Jahr 1264 erwähnt, als Markgraf Otto III. dem Nonnenkloster zu Spandau fünf Hufen Land im Dorf Schöneberg schenkte. Also, das war’s geschichtlich, damit du eine Ahnung davon hast, wo du künftig wohnen wirst.“
Sabine lächelte gezwungen. „Danke für die Aufklärung. Mir geht was anderes durch den Kopf. Ich bin so aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie diese Frau Meroux sein wird.“
„Nett. Sie reißt dir nicht den Kopf ab. Außerdem wohnst du allein in einem Zimmer. Sie war erst misstrauisch, weil sie dich vorher nicht kennengelernt hat. Ich glaube, wenn sie jetzt erlebt wie du bist, wird sie sofort von dir begeistert sein.“
„Ach, Liebling, du siehst das wahrscheinlich mit anderen Augen als sie.“
Er lächelte sie an. „Ja, natürlich. Ich sehe dich mit den Augen der Liebe.“
Sie schmiegte sich an ihn. „Wie schön, dass du mich so siehst“, hauchte sie.
Sabine wurde auf so nette Weise von ihrer zukünftigen Vermieterin begrüßt, dass sie freudig überrascht war. Das Zimmer, in dem sie nun wohnen würde, ließ allerdings zu wünschen übrig. Kein Waschbecken gab es hier, nur eine Waschkommode, auf der eine große Schüssel und ein Krug für Wasser standen, so wie man es von früher her kannte. Der Raum war sehr schmal. Rechts von der Tür befand sich ein weißer Kachelofen, der bis zur Decke hinaufreichte. Auf dieser Seite stand auch das Bett. Links, nahe am Fenster, gab es eine Kommode für Wäsche. Dem Bett gegenüber befand sich ein Tisch mit zwei Stühlen. Gleich links von der Tür gab es einen Kleiderschrank. Ein Bad gab es in dieser Wohnung nicht, auch keinen Kühlschrank. Die Küche war nur mit einem zweiflammigen Herd und einem Büfett ausgestattet. Dahinter befand sich ein Toilettenhäuschen. Etwas ungewöhnlich, fand Sabine. Frau Meroux selbst besaß auch nur ein Wohn-Schlafzimmer, das größer war als Sabines Raum. Die Wohnung verfügte über zwei durch eine Tür getrennte Dielen.
Reinhard verabschiedete sich bald wieder von Sabine, die nun die erste Nacht in ihren zukünftigen vier Wänden verbrachte. Am nächsten Morgen, es war bereits neun Uhr, bereitete sie sich umständlich ein Frühstück zu. Reinhard hatte für sie Brot, Aufstrich und Teebeutel besorgt. Frau Meroux war längst zur Arbeit gegangen.