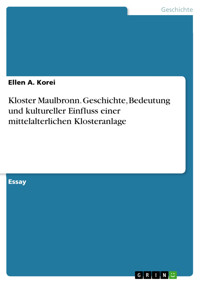Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Reise durch einen zersplitterten Geist, ein Labyrinth dunkler Erinnerungen, einzig geleitet von einem goldenen Funken Hoffnung. Jamie, eine junge Frau mit ungewöhnlicher Wahrnehmung muss sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen. Zerrissen zwischen Träumen und verzerrter Realität begibt sie sich auf die Suche, stets mit der Frage, in welcher dieser Welten sie leben möchte. Einzig ein Licht aus Bernstein, sowie ein vertrauter Duft führen sie auf ihrem Weg, während Albträume und verborgene Erinnerungen mit Krallen und Zähnen nach ihr greifen. Und je weiter sie in die Tiefen der Albtraumwelten vordringt, umso weniger kann sie unterscheiden, was ist noch Wirklichkeit und was nur ein Traum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ellen A. Korei
Bernsteinspur
Über das Buch:
Eine Reise durch einen zersplitterten Geist, ein Labyrinth dunkler Erinnerungen, einzig geleitet von einem goldenen Funken Hoffnung.
Jamie, eine junge Frau mit ungewöhnlicher Wahrnehmung muss sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen. Zerrissen zwischen Träumen und verzerrter Realität begibt sie sich auf die Suche, stets mit der Frage, in welcher dieser Welten sie leben möchte. Einzig ein Licht aus Bernstein, sowie ein vertrauter Duft führen sie auf ihrem Weg, während Albträume und verborgene Erinnerungen mit Krallen und Zähnen nach ihr greifen. Und je weiter sie in die Tiefen der Albtraumwelten vordringt, umso weniger kann sie unterscheiden, was ist noch Wirklichkeit und was nur ein Traum.
Über den Autor:
1982, weit im Süden Deutschlands wurde Ellen A. Korei quasi mit dem Stift in der Hand geboren – oder vielleicht zumindest mit der Ahnung, dass Worte Türen zu Welten öffnen können.
Während des Studiums der Germanistik und Geschichtswissenschaften an der Uni Tübingen lernte sie, dass jede Geschichte ein Echo hat. Selbst was wir Erinnerungen nennen, ist oftmals nur eine der vielen Formen des Erzählens. Seitdem folgte sie den Spuren von Legenden und Mythen, sowie den flüchtigen Momenten, in denen das Unheimliche sich zeigt, ohne gesehen werden zu wollen.
Auf diesem Weg erkundete sie vor allem auch Japan. Ob stille Schreine, Yokai oder andere geisterhafte Gestalten der Folklore – die feine Linie zwischen dem Abgründigen, aber Anziehenden, sowie der Eleganz asiatischer Erzählkunst wurde bald zu einer weiteren erzählerischen Heimat.
Ihr heutiges Schaffen befasst sich daher häufig mit den Schwellenwelten. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wie auch zwischen der Sehnsucht nach dem Unbekannten und der Schönheit des Bekannten. Ihre Texte suchen die Risse der Wirklichkeit und jene Stellen, an denen das Unsichtbare hindurch schimmert.
Deutsche Ausgabe 2025
Copyright © Ellen A. Korei 2025
Publikation erfolgt im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
Anita Goltzsch
c/o IP-Management #7386
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
Covergestaltung und Illustrationen: Megumi M. Loy
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Werkes oder Teilen daraus, sind nur mit Zustimmung des Autors zulässig. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Einspeicherung, Einsprechen oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Ausführliche Informationen über den Autor:
https://www.patreon.com/c/bernsteinfuchs
https://www.instagram.com/bernsteinfuchs_elli/
Vorwort
Wir leben alle in unserer eigenen, kleinen Welt, schultern unsere Probleme und suchen eine Lösung diese Welt oder uns selbst darin zu schützen.
Wir laufen, wir rennen, wir fliehen, wir kämpfen … wir sehen uns ständig konfrontiert und heimgesucht von verschütteten Erinnerungen und Trugbildern. Wir tanzen zwischen Schatten und Licht und manchmal wissen wir nicht, was ist Traum und was Wirklichkeit … oder auch: was ist Angst und was Liebe.
Dieses Buch setzt sich mit stigmatisierten und sensiblen Themen auseinander und kann auf manche Leser verstörend wirken.
Hierbei handelt es sich vor allem um: seelische Problematiken (Depressionen, Wahnvorstellungen, selbstverletzendes Verhalten, PTBS), Szenen traumatisierender Ereignisse, Angststörungen und andersartige Wahrnehmungen sowie Albträume.
Kapitel 0.1 – Da war … ein Weg
Da war ein Weg. Versteckt lag er zwischen unzähligen Stämmen, deren Wurzeln sich tief in den Boden gruben und wie Adern durchzogen. Selbst bei Tag fiel Licht nur in einzelnen Tropfen herab durch die wenigen Löcher des Blätterdaches. Er schlängelte sich die Steigung hoch – immer weiter, ungesehen, unberührt. Abgelegen wie er war, verkörperte er ein Geheimnis des Forstes, oder vielleicht … führte er zu einem? Doch unbeschritten blieb der Pfad still und einsam.
Einst soll er andere geführt haben. Tiefer in den Wald, tiefer zu etwas Unbekanntem, was man sonst nicht fand. Wie lange lag er schon hier? Vergessen und unentdeckt.
Da war ein Weg … ein Weg, der führte und sich scheinbar endlos zog.
Da war ein Weg … im Zwielicht unter dem schützenden Dach der Bäume.
Da war ein Weg … ein Weg im Wald, der Verlorenes zu sich rief.
Doch ward der Ruf nur selten aufgefangen – aufgefangen und verstanden – von einer kleinen Seele, die sich dann aufmachte, den Weg zu beschreiten. Und wo ihre Spuren still im Dickicht sich verliefen, tanzte manchmal ein Irrlicht zwischen den Stämmen – fragil und flackernd. Dieses flog umher, unstet und zweifelnd, verharrte hin und wieder und verschwand schließlich hinter Bäumen, scheuchte Motten von der Rinde auf. Flatternd erfüllten deren Flügelschläge die Luft mit Summen, dort auf dem Weg, dem einsamen Weg, der so oft übersehen wurde.
Da kam ein Kind. Ein Kind im weißen Kleidchen. In den Händen hielt es etwas, wie einen Schatz – golden wie ein Strahl der Sonne zwischen seinen Fingern glimmend. Als es den Weg erblickte, blieb es stehen, sah ins Zwielicht aus großen Augen … und der Weg, er seufzte tief.
Ob Worte hier gewechselt wurden, war nicht auszumachen. Kein anderer zumindest hätte hier etwas gehört, das Kind jedoch lauschte und der Wald schien zu erwachen. Leise, ganz leise raschelten die Blätter im Wind und die Lippen des Mädchens bewegten sich, ohne dass ein Laut sie floh.
Da war ein Weg. Ein Weg, der sprach. Und auf seinem weichen Boden setzte das Mädchen die ersten Schritte. Schritte auf dem Weg. Es folgte den verschlungenen Windungen, tiefer in den Wald – stetig, ohne anzuhalten.
Die Wurzeln formten Stufen, die den Berg nach oben führten. Stämme schmiegten sich aneinander und lehnten sich zugleich wie gequält voneinander weg. Ein seltsames Schauspiel aus Schatten und noch mehr Schatten tanzte und räkelte sich, wogte und spielte mit der Wahrnehmung, die versuchte klare Bewegungen auszumachen.
Da war ein Wald …
Da war ein Weg …
Da war ein Licht …
Da war ein Kind.
Und als das Kind dem Pfad bis zum Ende folgte, entdeckte es, was verborgen lag im verlassenen Dunkel.
Da war … ein Haus …
… ein Haus im Wald.
Und vor den Türen … stand das Kind …
Kapitel 1
Wege
Ungefähr zehn Meter vor meiner Nase wuchs das Torii empor, hinter dem der geschlängelte Pfad mit halb ins Erdreich eingesunkenen Treppenstufen in den Wald führte. Zwei Pfeiler aus lackiertem Holz senkrecht in der Erde, am oberen Ende durch zwei Querbalken miteinander verbunden, ragten wie selbstverständlich mitten zwischen den Bäumen auf. Einst von roter Farbe war diese längst verblasst. Im Grunde wäre an dem Bild nichts Seltsames gewesen … sofern ich mich in Japan befunden hätte. Doch momentan streunte ich durch deutsche Wälder, in denen mit Sicherheit niemand, vor allem nicht derart abgelegen, eine shintoistische Grenzmarkierung aufgestellt hätte.
Im Land der aufgehenden Sonne markierten diese Tore die Schwellen zu heiligen Gebieten. Nun, heilig sah der Pfad dahinter wirklich nicht aus, eher überwuchert und vergessen, als hätte seit Jahrhunderten niemand diesen Weg betreten.
Schön war es trotzdem, irgendwie. Zumindest wenn man ein Faible für unberührte Natur hatte und einen Hang zum Unheimlichen, denn die Schatten schienen tiefer zu sein als auf dem Pfad davor. Auch der Baumbestand verdichtete sich zu beiden Seiten.
Ich hätte hindurchgehen können. Im Grunde wollte ich das, aber die sich immer weiter sättigenden Braun- und Grüntöne stritten im Licht der untergehenden Sonne, das durch das Blätterdach gefiltert wurde, um die Vorherrschaft. Bedauerlicherweise würde es nicht mehr lange dauern, bis alles mit Nachtschwarz überpinselt werden würde.
Matt schloss ich einen Moment die Augen. Es war manchmal gefährlich, dies zu tun, denn ohne etwas zu sehen, hörte und fühlte sich die Welt plötzlich anders an. Anfangs rollte Dunkelheit über alles hinweg, ehe sich diese in ein schwammiges Sammelsurium von Farben verwandelte, die in der Masse ihren Charakter verloren.
Die übrigen Sinne barsten in einer gewaltigen Informationsfülle. Selbst mein Atmen hatte sich verändert. Ich spürte, wie die Luft meine Lungen weitete, sich der Sauerstoff im ganzen Körper ausbreitete und die Muskeln mit elektrischen Impulsen auflud – bereit jeden Moment zu explodieren.
Bewegungen! Links hinter mir. Etwas war da! Atmete es? Vielleicht nur der Wind. Was wenn es mehr war? Ein Wesen?
Ein Duft wehte mit heran. Fast nichts Besonderes, doch irgendwie anders. Kaum wahrnehmbar tanzte er zwischen dem Waldgeruch, der hier über allem wie eine dicke Decke hing. Trotzdem konnte ich diese Note wahrnehmen … etwas wie …
Sandelholz!
Ich war mir sicher, hier noch keinen Sandelholzbaum gesehen zu haben. Und irgendwie erschien er mir auch … anders.
Ein Klingeln! Der Klang eines Windspieles – zart wie das feine Seidengespinst einer Raupe und doch präsent genug, dass es mich die Lider aufreißen ließ. Sofort sprudelten die Farben zurück in die Formen der waldigen Umgebung. Das Torii war verschwunden. Wo die Pfeiler gestanden hatten, flirrten lediglich Überreste weiß-goldenen Nebels. Vermutlich nicht mehr als ein zurückgebliebenes Abbild, das sich auf der Netzhaut festgesetzt hatte. Trotzdem kam ich nicht umhin den Fleck eine Weile nostalgisch anzustarren. Ich glaubte, die Umrisse einer tierischen Gestalt auszumachen, so wie man in Wolken alles Mögliche erkennen konnte. Ein schlanker Rumpf und dünne Beine, ein buschiger Schwanz und ein Kopf mit schmaler Schnauze, der sich in meine Richtung gewandt hatte.
Leider war es zu schnell verschwunden, als dass ich wirklich hätte sicher sein können. Ein seltsames Ziepen in der Brust machte ich einen Schritt zurück, wollte mich umdrehen, als ich den versteckten Stein zu meinen Füßen bemerkte, der zwischen den Wurzeln herausblitzte.
Ein Bernstein.
Fix hob ich ihn auf und ließ ihn durch meine Finger tanzen. Manchmal hatte ich dieses Glück und fand diese kleinen Kostbarkeiten an den unmöglichsten Orten. Er war warm, so sehr, dass ich spürte, wie kalt es an einer verborgenen Stelle tief in mir drin war. Wie von selbst schloss ich die Hand zur Faust und verbarg das Kleinod.
Was war diese vehemente Kälte bloß, die sich festgesetzt hatte und in manchen Momenten aus meinem Inneren bis zur Oberfläche fraß? Mir fiel keine Antwort ein, also wandte ich mich um.
Ich ging den Weg zum Waldrand zurück, gerade rechtzeitig, ehe der Abend schlagartig seinen dunklen Mantel über die Landschaft warf. Vermutlich hätte ich froh sein sollen, den Wald hinter mir zu lassen. Die Nacht verwandelte jede Umgebung in etwas Neues, Fremdartiges, und entblößte eine sonst unsichtbare Seite der Realität – und nicht immer war diese einem freundlich gesonnen. Meine Neugier zwang mich trotzdem, einen Blick zurückzuwerfen.
Da thronte der dichte Wald, in dem jeder Baum seine Äste mit denen seiner Nachbarn verflocht. Aus dem Inneren drang ein Potpourri an Lauten – tierisch, pflanzlich, vielleicht auch menschlich oder etwas ganz anderes. Es war unmöglich, einzeln zu erfassen, woraus es sich zusammensetzte.
Es gab Tage, da konnte ich diesem Sammelsurium ewig lauschen. An anderen jagte es mir eine Höllenangst ein, als hätte sich etwas darunter gemischt, was nicht hätte dort sein sollen. Heute erklang zum Glück die beruhigende Variante und ich sog noch einmal die von Naturdüften geschwängerte Luft in die Lungen, vermied jedoch, die Augen ein weiteres Mal zu schließen. Zwar verlor so mancher Zauber mit offenen Lidern seine Magie, doch es hätte sich nicht um meine Welt gehandelt, wenn alles daraus verschwunden wäre.
Gerade drehte ich mich um und wollte dem Waldstück den Rücken kehren, als ich seitlich auf dem Fluss Lichter schimmern sah – klein und von warm gelblichem Schein.
Definitiv keine Glühwürmchen. In dieser Entfernung hätte man sie nicht mehr in dieser ovalen Form erkennen können. Außerdem trieben sie scheinbar auf dem Wasser. Die Augen zusammengekniffen ging ich zwei Schritte darauf zu.
Schwimmende Lichter? Ja, ganz sicher. Es handelte sich um rechteckige, japanische Laternenschiffchen aus Holz und Papier und mit einer Kerze im Inneren. In Japan ließ man sie übers Meer oder Flüsse treiben, um sie ins Reich der Toten zu schicken und den Verblichenen ein Licht zur Orientierung zu senden.
Ich wiederhole noch mal: ich befand mich in Deutschland. In Japan wäre ein solcher Anblick zu bestimmten Festen oder Zeiten wohl nichts Ungewöhnliches gewesen, hier allerdings schon.
Ich zählte vier, ehe mein Blick an einer der Laternen festklebte wie eine Fliege am Honig. Auf einem glaubte ich, etwas Geschriebenes zu erkennen. Doch ich war zu weit entfernt, um es ausmachen zu können. Natürlich hätte ich hingehen können. Flüsterte es? Es war schwer auszumachen, ob es sich um Stimmen oder das Rauschen von Wald und Fluss handelte. Hin und her gerissen und unschlüssig worauf ich mich genauer konzentrieren sollte setzte mein Körper jedoch den halbfertigen Entschluss mit einem Schritt nach vorne direkt um.
»Bleib.«
Bleib? Ich glaubte meinen Namen noch als leisen Zusatz zu hören und beim Klang der Worte stoppte ich sofort.
Bleib, Jelena. Aber ich war so unsicher, ob ich mir das eingebildet hatte. Eigentlich wollte ich herumwirbeln, doch ich brachte nicht mehr zustande als eine sachte Drehung des Oberkörpers.
Niemand zu sehen.
Natürlich nicht. Wie zuvor erhob sich hinter mir nur der Waldrand – still und einsam. Den Blick zurück Richtung Fluss sparte ich mir, denn es war mir irgendwie klar, dass sich die Lichter dort wieder aufgelöst hatten.
Manchmal war es schwer zu unterscheiden, was wirklich existierte und was nicht. An Tagen wie heute jedoch waren die Dinge, die um einen herum erschienen, so fehl am Platz, dass sie eindeutig in die Kategorie der Nichtexistenz fielen.
Vielleicht war Nichtexistenz falsch ausgedrückt. Aber sie befanden sich zumindest nicht in der Realität, die die meisten Menschen wahrnehmen konnten.
Sie waren … nun ja, nur in meiner. Oft hatte ich mir Gedanken gemacht, ob andere existierten, die sahen, was ich sah. Sicher gab es auch welche. Die Welt war so groß, da musste es unmöglich sein die Einzige in irgendwas zu bleiben. Außerdem war es beruhigender anzunehmen, dass noch mehr wirre Wahrnehmungslegastheniker da draußen herumliefen. Begegnet war ich diesen Leuten bisher allerdings nicht. Aber wie sagte man so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich verbrachte die Tage lieber damit zu hoffen, so jemanden zu finden, als mir einzugestehen, dass ich die einzige Verrückte auf diesem Planeten war, die solche Erscheinungen hatte.
Mit diesen Gedanken machte ich mich auf den Rückweg. Wurde auch Zeit, denn mit der heranrollenden Nacht nahm die Kälte zu. Ehrlich gesagt merkte ich es selten, wenn es zu kühl wurde. Mein Körper schien der Ansicht, dass ein offensichtliches Zeichen dafür nicht notwendig war. Daher hatte ich mir im Laufe der Jahre so meine Tricks angeeignet, und einer davon bestand darin im Spätherbst lieber nach Hause zu gehen, wenn die Sonne die himmlischen Gefilde verlassen hatte.
Nicht mehr lange und hier draußen, mitten auf dem Land, wo kein Mensch in der Nähe war und somit auch keine Straßenlaterne, würde die Umgebung ohnehin in absoluter Finsternis versinken.
Sinnvollerweise sollte ich mir wohl wieder angewöhnen eine Taschenlampe dabei zu haben. Nur für den Notfall, versteht sich. Die Vergangenheit bewies, dass diese »Notfälle« häufig genug eintraten und man ohne ein Ass im Ärmel schnell zum hilflosen Klops wurde.
Ich setzte den Kauf geistig auf meine To-do-Liste und hoffte, beim nächsten Baumarktbesuch würde sie sich von allein aktivieren. Wie schon mal erwähnt: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dieses Mal ging es ohne Leuchte gut. Ich erreichte mein Auto und ließ mich erleichtert hinters Lenkrad sinken.
Da es sich heute eindeutig wieder um einen dieser »speziellen« Tage handelte, war mir klar, dass auf der Fahrt noch irgendetwas passieren musste. Und genau so kam es auch.
Um das Ganze einmal richtig zu erklären: Von Kindesbeinen an sah ich Dinge, die anderen verborgen blieben. Das konnte völlig Verschiedenes sein und für den ein oder anderen wäre klar, dass manches einfach nicht real sein konnte.
Für mich war es nie klar. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass das, was vor meiner Nase geschah, nicht für jedermann den Alltag darstellte. Mit der Zeit lernte ich das zwar, so hundertprozentig sicher konnte ich mir jedoch bei einigem bis heute nicht sein. Wie viel Arbeit es mich gekostet hatte, überhaupt darauf zu kommen! Als Kind sagte einem ja niemand, was wirklich existierte und was nicht. Jeder ging davon aus, dass andere genau die Realität sahen, die sie selbst wahrnahmen. Dazu kann ich nur sagen: So läuft das nicht!
Für mich waren Menschen mit drei Augen, plötzlich wachsende Leute und sich verzerrende Gebäude, sprechende Gesichter auf Holzpaneelen oder die vorlaute Wieselmaus mit Punkfrisur völlig normal. Manchen Dingen gab ich Namen, anderen nicht, und ab und an benutzte ich nur einen Begriff. Wieselmaus hieß übrigens Punky. Davor hatte ich ihn – ich ging davon aus, er war ein Männchen – schlicht Wieselmaus gerufen. Simple Logik: Er war eine Maus und wieselte herum. Dann glaubte ich einmal, einen bösen Blick von ihm aufgefangen zu haben – einen wirklich bösen Blick, triefend vor Vorwurf. Daraufhin entschied ich mich, ihm einen Namen zu geben, der mehr aussagte als die Beschreibung des Offensichtlichen. Mein kindliches Gehirn wählte »Punky« und scheinbar fühlte sich das Kerlchen mit dieser Betitelung glücklicher.
Des Weiteren fand ich es absolut normal, Stimmen oder Musik zu hören, ohne eine passende Quelle dazu ausmachen zu können. Die Stimmen waren mal freundlich, mal frech, selten jedoch wirklich bösartig. Ein bisschen nervig manchmal, weil man sich vorkommt, wie in einer Dokumentation, wenn man ständig kommentiert wird. Zu Anfang hatte ich meinen Eltern noch erzählt, was ich so alles sah, hörte, fühlte, roch. Allerdings hatten diese es der regen Fantasie eines Kindes zugeordnet – nichts Beunruhigendes also. Meine Brüder hatten sich auch nicht daran gestört und so traten Schwierigkeiten erst auf, als ich häufiger mit Gleichaltrigen außerhalb der Familie umgehen musste.
Es hatte zu unterschiedlichen Situationen geführt und zugegeben, an viele erinnere ich mich nicht einmal mehr. Was ich aus ihnen jedoch lernte, war, dass nicht alle Menschen das Gleiche sahen. Und weiter wurde mir klar, dass es manchmal schlauer war, einfach den Mund zu halten. Daher versuchte ich zu Anfang vieles, was sich um mich herum aufhielt, zu ignorieren. Eine mäßig gute Strategie, denn zum einen war nicht jeder damit einverstanden unbeachtet zu bleiben, zum anderen war es oftmals schwer auszumachen, was für alle anderen auch als anwesend galt oder eben nicht.
Trotzdem arbeitete ich weiter daran. Nun, eigentlich arbeite ich bis heute daran. Und ich denke, ich werde von Tag zu Tag besser, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir wie gesagt bei einigen Dingen immer noch nicht.
Jedenfalls war das mein Leben und meine Welt. Bisher hatte sich auch niemand genauer mit meiner Wahrnehmungsstörung auseinandergesetzt. Ob es also wirklich ein verrückter Verstand war, Geister, Dämonen oder Aliens oder vielleicht irgendwelche Schwingungen aus einem Paralleluniversum weiß keiner – am wenigsten ich. Aber ich habe gelernt damit zu leben, und im Grunde kam ich ganz gut klar.
Darum und weil heute, wie bereits erwähnt, wieder einer dieser »besonderen Tage« war, überraschte mich der Fuchs nicht, der auf zwei Beinen am Rand der Fahrbahn stand. Aus der Ferne hätte es auch ein übergroßer Hase sein können, der auf den Hinterläufen Männchen machte. Je näher ich kam, umso klarer wurde jedoch die Kanidengestalt, die sich irrigerweise auf die Hinterbeine erhoben hatte. Sie verschwamm ein wenig, schien zu leuchten, was an dem extrem hellen Fell liegen konnte, das eher einem leuchtenden Blond, das in Weiß überging, ähnelte, als dem typischen Orangerot eines Fuchses. Damit nicht genug, tanzte das Tier auch noch. Zumindest vermutete ich, dass es sich um so etwas wie einen Tanz handeln sollte. Das Wesen sprang von einem Bein aufs andere und vollführte ab und an wilde Pirouetten. Dabei zeichnete der buschige Schweif leuchtende Spuren in die Luft.
Ich fuhr langsamer, wollte aber vermeiden anzuhalten. Man konnte nie wissen, was diese Erscheinungen im Schilde führten, und momentan war mein Bedarf an Begegnungen jeglicher Art gedeckt. Schließlich war ich in die Natur gefahren, um Abstand zu bekommen. Heute hatte mich genug erschüttert, beispielsweise ein wieder einmal fehlgeschlagenes Date, von denen ich leider zu viele in meinem knapp dreißig Jahre andauernden Dasein gehabt hatte.
Viele Dates – wenig Festes. Ich machte mir nichts vor, denn es könnte durchaus an mir liegen. Zu hohe Ansprüche bei zu hoher Unsicherheit oder sowas. Wer konnte das schon mit Sicherheit sagen? Meine Beziehung davor, die erste Richtige in meinem Leben, war lang und die absolute Hölle gewesen. Trotzdem hatte mich das Ende schmerzhaft getroffen und meinen Selbstwert zerschmettert. Manch einem hätte es dann vielleicht gut getan positive Rückmeldung zu bekommen. Ich hatte eigentlich Ruhe nötig. So hatte ich im Grunde gewusst, dass Dates nicht das waren, was ich brauchte. Hatte ich auf mein Bauchgefühl gehört? Natürlich nicht.
»Jelly-Belly«, hatten einige Bekannte immer wieder genervt. Ich hasste diesen Spitznamen, denn er erinnerte mich an Teenagerzeiten, als ich etwas mehr auf den Rippen gehabt hatte und darum viel zu oft damit betitelt wurde.
»Jelly-Belly, du brauchst einfach einen Mann. Selbst du solltest doch in der Lage sein einen zu finden. So ganz allein wirst du noch verquerer als ohnehin schon.« Dann lachten sie und den Rest des Treffens ging es nur darum, welche sonderbaren Eigenarten ich an mir hatte, und sie zerrissen sich regelrecht die Mäuler darüber.
Ich hätte gehen können, klar, aber manchmal blieb man eben doch aus einem seltsamen Verpflichtungsgefühl oder weil einem partout keine Ausrede einfallen wollte, um halbwegs elegant aus einem Raum zu flüchten.
Als mir der Druck zu viel wurde, war ich auf Anraten dieser Personen eben ins Internet gegangen und hatte mich in einem Anfall, den ich nur als puren Wahnsinn bezeichnen kann, bei ein paar der unzähligen Singlebörsen angemeldet. Immerhin war ich so schlau gewesen, mich nach dem heutigen Desaster wieder abzumelden. Überall!
Die Uhr hatte mir versucht einzureden, dass das Treffen nur eine Stunde gedauert hätte, aber für meine Wenigkeit fühlte es sich an, als hätte es mich zehn oder mehr Stunden meiner Lebenszeit gekostet. Die Begegnung hatte mit einer intensiven Wolke aufdringlichen Aftershaves angefangen, gemischt mit dem Odeur von Pumakäfig. Das Ganze war von einem Individuum ausgegangen das in einem, schätzungsweise drei Wochen nicht gewaschenen, Shirt und einer Hose gesteckt hatte, die sicher von allein hätte stehen können, hätte er sie ausgezogen. Zum Glück hatte er auf Entblätterungsversuche jeglicher Art verzichtet. Der Typ, der direkt in jedem Zombiefilm eine Statistenrolle bekommen hätte, ohne Make-up zu benötigen, hatte wohl meinen Blick bemerkt. Grinsend hatte er die Ausrede angebracht, er wäre gerade von der Arbeit gekommen. Welcher genau? Schweinchen im Dreck? Ich hatte lieber nicht nachgefragt. Jedenfalls, garniert wurde dieses erste Aufeinandertreffen mit einer schraubstockartigen Umklammerung und schlabberigen Küsschen. An dem Punkt war ich emotional und geistig endgültig ausgestiegen. Vor allem bei Berührung von fremden Lippen auf meiner Haut war ich doch, sagen wir, eigen. Wenn mir zudem, wie in diesem Fall, die Ausdünstungen meines Gegenübers dabei die Schleimhäute wegätzten, waren Hopfen und Malz verloren. Leider bin ich zu höflich, um direkt wegzurennen, wie schon mal erwähnt – zumindest inzwischen. Es hatte jahrelanges, hartes Training gekostet, trotz erster Gefühle von Abneigung nicht augenblicklich das Weite zu suchen. Warum ich mir das abgewöhnt hatte, weiß ich nach dem heutigen Tag ehrlich gesagt nicht mehr. Es hätte mir und meiner Nase in diesem Moment einiges an Leid erspart.
»Hey, ich bin Jamie«, war so ziemlich das einzige gewesen, was ich herausgebracht hatte. Das hatte mein Gegenüber aber nicht gestört, denn er hatte viel zu erzählen – sehr viel. Nichts davon war wirklich interessant. Dieses Mal hatte ich im Übrigen extra »Jamie« gewählt – eigentlich nicht mein echter Name, sondern eine Verschmelzung aus Erst- und Zweitnamen: Jelena Aimée, kurz Jamie. Eine Brieffreundin, mit der ich nach zehn Jahren immer noch wenn auch sporadisch in Kontakt war, hatte diese Namensfusion herbeigeführt und zum ersten Mal gefiel mir ein Spitzname. Daher hatte ich ihn beibehalten, wo es ging. Vor allem nachdem beim ersten Date, wo ich doch »Jelena« benutzte, die Antwort kam: »Jelena? Wie die aus Troja?«
Den ganzen Abend über hatte mein Auge gezuckt, weil ich nicht begreifen konnte wie man Jelena mit Helena verwechseln konnte. Wie gesagt, das war das Date davor. Dieses hier äußerte sich in einer Art Nasenkrampf. Zumindest gefühlt, denn das Zucken war dieses Mal zurecht in die Nasenregion gerutscht.
Aber ich hatte durchgehalten – die vollen dreiundsechzig Minuten und vierundzwanzig Sekunden. Anschließend war ich in mein Auto gestiegen, nach Hause gefahren, hatte meine Profile und die eigens dafür angelegte E-Mail gelöscht und war fluchtartig für einige Stunden ins ländliche Nirgendwo geflohen, um zu atmen.
Allmählich kam ich zu der Ansicht, dass Alleinsein nicht immer die schlechtere Alternative war.
Doch zurück zum Fuchs, der am Straßenrand seinem seltsamen Reigen frönte, und es dabei immer noch schaffte, mich zu fixieren, die ich langsam näher heranfuhr. Zugegeben sah er recht hübsch aus, wenn auch irgendwie falsch, wie er so auf zwei Beinen balancierte.
Es handelte sich definitiv nicht um einen Menschen im Kostüm. Dafür waren die Bewegungen zu skurril und ein Sprung in die Luft verzögerte sich sogar leicht, als würde er einen Augenblick der Schwerkraft trotzen.
Zum Glück war sonst niemand unterwegs. So konnte ich in gedrosseltem Tempo weiter heranfahren. Die Türen hatte ich vorsorglich verriegelt – man konnte ja nie wissen.
Ehrlich gesagt, ich habe mich nie gefragt, woher all diese Wesen kamen. Irgendwann hatte ich es schlicht akzeptiert, so wie andere akzeptierten, dass wir auf einer gewaltigen Kugel im Weltall umherrotieren. Genauso fand ich mich auch jetzt damit ab, dass der rätselhaft tanzende Fuchs am Straßenrand urplötzlich die Fahrbahn überquerte, als ein wilder schwarzer Hund, so groß wie ein Bär, aus den Schatten sprang und ihn jagte.
Zum Glück war das Ganze noch einige Meter entfernt, so dass ich mir die Vollbremsung hätte sparen können. Es gelang mir nur nicht. Ich trat mit aller Kraft aufs Pedal und hätte fast das Lenkrad geküsst, wenn mir der Gurt nicht hilfsbereit die Luft abgeschnürt und mich zurückgehalten hätte. Vielen Dank, lieber Gurt.
Okay, dieser schwarze, gewaltige Hund war ein anderes Kaliber. Es dauerte einige Sekunden, vielleicht auch Minuten, ehe ich es schaffte, aus der gekrümmten Haltung wieder nach vorne zu schauen.
Der Fuchs und sein Verfolger waren bereits weit weggelaufen, doch ich glaubte auf dem Feld zu meiner Linken einen undeutlichen, hellen Schemen zu erkennen. Nicht für lange, denn der schwarze Schatten stürzte sich auf ihn und verschlang Leuchtklecksi in wenigen Augenblicken. Ich blinzelte einmal und alles war verschwunden.
Den Mund noch offen merkte ich, dass ich die Luft angehalten hatte. Einmal tief durchatmen. Es gab Schlimmeres als tanzende Füchse, die einem nachts vors Auto sprangen. Viel Schlimmeres. Der Hundeschatten hätte dazugehören können. Aber da er es nicht auf mich abgesehen hatte, bestand heute keine weitere Gefahr. Ich schaute wieder zum Fenster hinaus. Den Fuchs hatte er nicht verschont und ich spürte, wie in mir Sorge wuchs. Egal wie sehr ich meine Augen anstrengte, keine Spur mehr vom weiß-blonden Filou zu sehen, stattdessen ballte sich ein dunkler Fleck an der Stelle zusammen. Es konnte aber auch nur die übliche Nacht sein.
Nach kurzem Zögern legte ich den Gang ein. Dem Biest wollte ich nicht begegnen. Nicht auf offener Fläche, schon gar nicht allein. Obwohl mir Tanzpfötchen leidtat, fuhr ich weiter. Heute hatte ich keine suizidalen Tendenzen und wollte mich nicht in einen ungewissen Kampf stürzen. Ja, das kam ab und an tatsächlich vor, dass der Überlebensinstinkt stärker als die Neugier oder das Mitleid war. Auch wenn die Neugier häufiger gewann, Wissensdurst wollte nun mal befriedigt werden.
Die Finsternis verschluckte vor mir die Fahrbahn, so dass die Scheinwerfer ihre Mühe hatten, viel davon zu erhellen. Die Fahrt auf der unbeleuchteten Landstraße kribbelte mir bis in die Finger, so groß war meine Konzentration. Erst als ich den Stadtrand erreichte und Straßenlampen auftauchten, schien ein wenig Sicherheit zurückzukehren. Trotzdem vermied ich den Blick in den Rückspiegel. Vermutlich raste ich etwas, aber glücklicherweise erwischte mich niemand. Ich wollte eben so schnell wie möglich zum Parkplatz, kam dort auch an. Der Weg zur Wohnungstür schien mir jedoch länger als normal. Erst mit Überschreiten der Schwelle zur Wohnung fiel die Anspannung wie Steine von mir ab. Erschöpft sackte ich auf die Knie und lehnte mit dem Rücken gegen die Tür.
Es dauerte, bis ich mich wieder erheben konnte. Meine Beine hatten sich scheinbar entschlossen, eine Weile die Konsistenz von Pudding nachzuahmen. Wenigstens war ich zu Hause.
Zu … Hause …
Ein schaler Beigeschmack mischte sich in den Gedanken. Vorhin im Wald hatte es sich für einen Moment mehr nach »zu Hause« angefühlt. Nicht, dass ich meine Wohnung nicht mochte, aber irgendwie fehlte etwas, um sie wirklich zu einem »echten« Heim zu machen. Vielleicht lag es momentan auch daran, dass es dunkel und kalt war. Ich hatte die Heizung noch nicht angestellt und das Licht war ebenfalls aus. Wurde doch mal Zeit, sich wieder aufzurichten und wenigstens einige Schalter umzulegen. So weit kam es allerdings erstmal nicht.
Beim Betreten des Wohnzimmers entdeckte ich einen fiepsenden, hellen Fleck, der davonhuschte. Leise schlicht ich weiter ins Zimmer und sah in die Richtung, in die das Etwas verschwunden war. Kurz darauf lugte eine Maus hinter einem Regal hervor.
Da war er also wieder. Der niedliche Kleine mit dem punkigen Schopf und den großen Knopfaugen hatte sich scheinbar herein verirrt. Normalerweise war Punkys bevorzugtes Territorium der Balkon. Da ich ihn nicht erschrecken wollte, schlich ich mich vorsichtig zur Tür und öffnete diese. Kühle Luft strömte ins Zimmer, aber das hinderte das Mäuschen nicht daran, wie ein geölter Blitz hinaus zu flitzen.
Ich folgte ihm mit Blicken. Der Boden des Minibalkons war voller Blatthaufen. Ja, ich hatte es bisher nicht für nötig befunden das Laub wegzukehren. Warum auch? Ich verbrachte dort keine Minute – zu viele Spinnen und anderes krabbeliges Getier.
Punky störte es nicht, er schien sich sogar darüber zu freuen, dass hier so viel Raschelkram herumflog. Mit einem Satz tauchte er in das Blättergewölle ein, nur um kurz darauf wieder daraus hervorzurollen und in wildem Kampf mit einem besonders großen Blatt über den Balkon zu wrestlen. Absolut nicht auszumachen, wer die Führung übernahm, bis das Mäuschen mit einer Drehung herumsprang, auf allen vieren landete und den laubigen Feind in geduckter Haltung entschlossen anstarrte.
Ring frei für die letzte Runde!
Punky baute sich auf, fiepte in wildem Kampfruf auf und stürmte erneut auf den Gegner zu. Er gewann … irgendwie.
Blättchen segelte theatralisch zu Boden und rührte sich nicht weiter, während sich die Maus triumphierend darauf postierte. Fehlte nur noch, dass sich Punky stolz die Vorderpfoten in die Hüfte stemmte. Doch entweder war er zu beschäftigt mit seinem Sieg, oder schaffte es nicht schnell genug die Ärmchen zu erheben. Die Zeit für die dramatische Siegespose verstrich jedenfalls ungenutzt.
Ich musste schmunzeln. Kurz zumindest. Ehe mir der tanzende, hellfellige Fuchs wieder in den Sinn kam. Scheinbar hatten diese geisterhaften Tiere den Tanz- und Spielwahn gemeinsam. An den Türrahmen gelehnt schlang ich die Arme um mich. Ein weiteres Leuchten fing meine Aufmerksamkeit ein. Diesmal ging es von den Bäumen aus, die hier an der Rückseite des Gebäudes wuchsen. An der Wand neben mir zeichnete warmes Licht die kunstvollen Blattformen, durchzogen von filigranen, schattenhaften Adern. Das umgekehrte Schattenspiel entstand durch das Glühen der Blätter, das plötzlich wie dickflüssiges Gold an den Ästen klebte. An meiner Wange spürte ich einen Hauch wie einen geisterhaften Kuss.
Wie schön alles war und es wurde immer beeindruckender. Wurde es wärmer? Ein bisschen vielleicht, wie in einer milden Spätsommernacht. Und von irgendwoher …
Sandelholz!
Doch ehe ich ausmachen konnte, woher der Duft kam, begann der Schein von den Blättern zu schmelzen und träge hinab zu perlen. Er benetzte das Gras unten mit seinem Glanz, der langsam zu flimmern anfing. Der Geruch von bevorstehendem Regen gesellte sich hinzu und als die ersten Tropfen fielen, verblassten die Lichtflecken und sickerten ins Erdreich.
Ich zog mich zurück ins Zimmer und schaltete die Lampen an. Punky hatte sich bereits verkrümelt, wo auch immer er sich üblicherweise versteckt hielt.
Der Tag war lang genug gewesen. Daher steuerte ich das Bett an und sumpfte fix und fertig in die weichen Kissen. Als sich meine Augen schlossen, hörte ich entfernt das melodische Klingeln eines Windspieles.
Wie im Wald, dachte ich noch bei mir, ehe Morpheus’ Wogen mich in sein Reich schwemmten.
Traum
Ich träumte. Einerseits wusste ich, dass ich mich in einem Traum befand, andererseits fühlte sich das Hiersein deutlich realer an als mein üblicher Wachzustand. Trotz der Häufigkeit, in der das Empfinden aufkam, stolperte ich jedes Mal erneut darüber. Irgendwie blieb es seltsam, wenn man in der Realität nicht so viel Wirklichkeit empfand wie in der Traumwelt.
Aber so war es nun einmal.
Tatsächlich fühlte es sich an, als wäre ich nach einer langen Reise wieder nach Hause gekommen. Das Bild, das sich mir bot, war ein ländliches Dorf mit asiatischem Einschlag. Die Pfahlbauten in verschiedenen Größen waren gedeckt mit Stroh und umringt von dem charakteristischen, überdachten Außenflur japanischer Bauweisen, die inneren Räume teilweise geschützt vor neugierigen Blicken durch hölzerne Schiebetüren. Auf einer Art Dorfplatz saß eine Gruppe von Frauen zusammen und wusch Bohnen in Körben. Manchmal schleuderten sie eine Handvoll mit Schwung in die Gegend, lachten dabei und scherzten, ließen ihre Arbeit jedoch nicht schleifen.
Ich kam nicht aus Asien, trotzdem weckten asiatische Stile in Gebäuden und Gewändern eine unerklärliche Vertrautheit in mir. Allerdings irritierte mich die Handlung, in der die Bohnen sonst wohin flogen. Aber manchmal stellte man in einem Traum besser keine Fragen nach Sinnhaftigkeit.
Kinder tollten barfuß über den festgetrampelten Erdboden und riefen so durcheinander, dass keine einzelnen Sätze auszumachen waren. Eine der Frauen kam heran und hielt mir eine große, flache Schale hin.
Sie sagte nichts, lächelte einladend und nickte mehrmals, bis ich das Gefäß annahm und daraus trank. Der Alkohol brannte in meiner Kehle und ich verkniff mir ein Husten. Ihr Kopf wiederholte weiterhin die auffordernde Nickbewegung, bis ich einen zweiten und schließlich einen dritten Schluck intus hatte. Erst dann stieß sie zufrieden die Luft aus. Ihre Finger umfingen die Schale wieder und ich war froh, dem Ritual genügt zu haben, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was damit bezweckt worden war.
Gastfreundschaft lehnte man allerdings nicht ab. Schon gar nicht an einem Ort wie diesem, wo sich alles so wohlig und heimisch anfühlte.
Es schien früher Abend zu sein. Im Licht der untergehenden Sonne wurde die Welt zu einem lebendigen Sepiafoto und erinnerte mich an die uralten Bilder aus Familienalben. Etwas entfernt lag ein Fluss und dahinter leuchteten die Felder, von denen die Männer mit ihren Werkzeugen beladen gerade zurückkehrten.
Ich schlenderte ein wenig umher. Wohin ich sah, lachten die Menschen und ich schaute den Frauen immer wieder über die Schultern. Vor meinen Füßen rollte einer der schlichten Bälle der Kinder vorbei, den die Knirpse unter Jubelrufen verfolgten. Als ich weiter kam, hörte ich ein paar Männern zu, die nach getaner Arbeit zusammensaßen und aus kleinen Schälchen tranken. Es wurden keine ausgefallenen Themen angesprochen und lange blieb ich auch nicht an einem Punkt stehen. Aber ich genoss die Atmosphäre und sog sie tief ein, während ich alles erkundete. Den Kopf im Nacken schaute ich in den Himmel, der sich in sattes Dunkelorange gekleidet hatte und an dem zaghaft die ersten Sterne versuchten, ihren Platz zu erobern.
Jemand wartet hier auf mich.