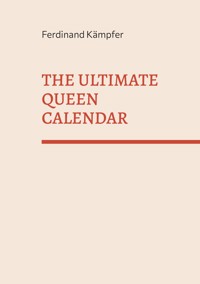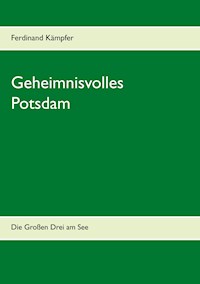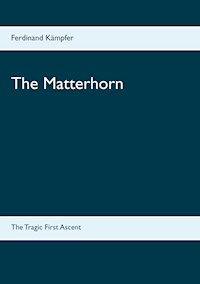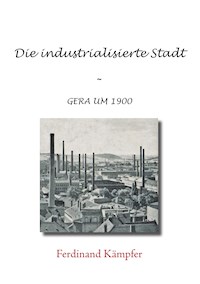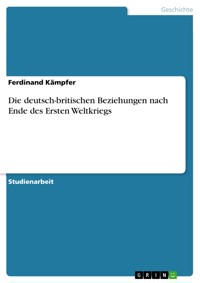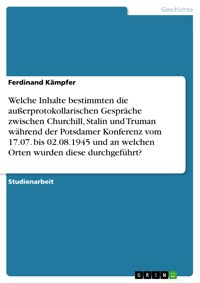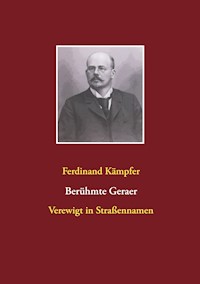
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Otto Dix kennen viele Menschen als einflussreichen Künstler des 20. Jahrhunderts. Wer aber kennt seinen Künstlerkollegen Professor Paul Neidhardt oder Dix' Schwager, den Künstler Alexander Wolfgang? Diese prägten die Stadt Gera genauso wie politische Persönlichkeiten, etwa Wilhelm Weber oder Curt Böhme, oder Naturforscher, wie Moritz Rudolph Ferber. Die Stadt Gera benannte etliche Straßen nach Berühmtheiten, die in Gera lebten und wirkten. Diese zahlreichen Prominenten werden in diesem Buch entsprechend der Stadtteile vorgestellt. Damit soll der historische Gedanke an die einst reiche Stadt mit ihren bereichernden Prominenten aufrecht erhalten werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Autor: Ferdinand Kämpfer ist Student des Masterstudienganges Geschichte transkulturell an der Universität Erfurt. Seit 2016 gibt er Stadtführungen und hält Vorträge über die Geschichte Thüringens in Gera.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Langenberg/Stublach
Bieblach/-Ost/Tinz
Gewerbegebiet Tinzer Straße
Untermhaus
Siedlung Schafwiesen
Geraer Nordstadt
Zentrum ohne Altstadt
Südostviertel
Ostviertel/Leumnitz
Heinrichsgrün
Debschwitz
Krankenhaus
Dürrenebersdorf
Lusan
Zwötzen/Liebschwitz
Schlussbemerkungen
Literaturverweise
Einleitung
Straßen bilden seit jeher eine wichtige Grundlage für Handel, Transport, Verkauf und Wohnen. Straßennamen verleihen diesen Straßen Identifikationen, die insbesondere für das wachsende Postwesen eine wesentliche Rolle spielten.
Im Mittelalter war es üblich, die Berufsgruppen, die in den jeweiligen Straßen lebten, in den Straßenbezeichnungen zu nennen. Noch heute lässt sich in vielen Städten erkennen, an welchen Stellen die Menschen der verschiedenen Arbeitsbereiche ihr Zuhause hatten. So gibt es beispielsweise in Gera nach wie vor die Böttchergase in der Nähe des Marktes.
In der Gründerzeit wurden bedingt durch das rasante Bevölkerungswachstum in Gera, wie in den meisten Städten, mehr Straßen angelegt, um sowohl Quartiere für die Arbeiter als auch repräsentative Villenvororte zu schaffen.
Als sich ab dem Jahr 1933 das politische System in Deutschland durch die NSDAP änderte, wurden Straßennamen oft zu Propagandazwecken verändert. Diese wurden nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum entfernt, und es entstanden entweder neue Namen oder es wurde auf ehemalige Namen, die die jeweiligen Straßen einmal trugen, zurückgegriffen.
In der DDR war es in der Bezirksstadt Gera zudem üblich, in den entstandenen Plattenwohnungsvierteln Namen zu finden, die im Zusammenhang mit der russischen bzw. sowjetischen Kultur, aber auch mit der Wirtschaft der DDR, wie etwa der Wismut, standen. Namen wie Anton S. Makarenko oder Nicolai Ostrowski – beides sowjetische Schriftsteller – sind nach wie vor in verschiedenen Straßennamen zu finden, genauso wie zum Beispiel der Erzhammer oder Worte wie Glück Auf, die Symbole für die Wismut waren.
Die Stadt Gera verfügt weiterhin über verschiedene Viertel, die nach Berufen bedeutender Persönlichkeiten geordnet sind. Dazu gehört beispielsweise das Musikerviertel Heinrichsgrün, in dem sehr viele Komponisten aus Deutschland und der Region als Straßennamen dienen (Ausnahme: Richard-Wagner-Straße im Ostviertel und Franz-Schubert-Weg in Lusan).
In Bieblach-Ost wurden das dortige Neubaugebiet und die anschließende Eigenheimsiedlung nach Physikern wie Carl Zeiss oder Otto von Guericke benannt. Ärzte wie Ignatz Semmelweis, Ferdinand Sauerbruch oder Rudolf Virchow finden sich wiederum im Wohngebiet Scheibe/Klinikum mit Ausnahme von Robert Koch. Das Philosophenviertel befindet sich mit der Schellingstraße, der Feuerbachstraße und der Kantstraße im Stadtteil Untermhaus.
Dichter und Schriftsteller finden sich im gesamten Stadtgebiet: Schillerstraße (Ostviertel bis Ferberturm), Uhlandstraße (zwischen Zschochernstraße und Laasener Straße), Stormstraße (fernab des Zentrums in Liebschwitz), Heinrich-Heine-Straße (Debschwitz) oder Lessingstraße (zwischen Laasener Straße und Clara-Zetkin-Straße).
Das vorliegende Büchlein handelt jedoch von berühmten Geraern, die in den heutigen Straßennamen der Stadt Gera verewigt wurden. „Goethestraße“, „Turmstraße“ oder „Bahnhofsstraße“, um einmal die klassische Monopoly-Edition zu zitieren, kommen deutschlandweit wohl fast unzählbar häufig vor. Dagegen ist eine „Ferdinand-Hahn-Straße“, oder ein „Wilhelm-Weber-Hof“ bis heute nur in Gera zu finden.
Im Folgenden werden jedoch nur die Personen in Betracht gezogen, die die Stadt sowie das politische, wirtschaftliche und soziale Leben nachhaltig prägten, und nicht nur für eine kurze Weile in der Stadt waren.
Johann Wolfgang von Goethe, Theodor Körner oder Hans Otto besuchten zwar Gera, prägten es aber nicht so intensiv wie andere Persönlichkeiten. Trotzdem weist die Stadt eine beachtliche Anzahl an Geraer Prominenten auf, sodass das Buch bereits jetzt gut gefüllt ist.
Alle Straßen werden im Folgenden nach Stadtteilen bzw. Gebieten geordnet und mit dem jeweiligen Straßenschild fotografisch festgehalten. Sollte bei der nun folgenden Vielzahl dennoch eine Straße fehlen, bittet der Autor um Kontakt unter: [email protected]
Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ferdinand Kämpfer.
Langenberg/Stublach
Gladitschstraße
August Wilhelm Gladitsch (1826–1895) war einer der bedeutendsten Geraer Kaufleute. Er engagierte sich zudem für die Armen und nach seinem Tod wurde von seinem Vermögen das Armenhaus in Langenberg unterstützt.
Gerade deshalb wurde nach ihm die von der Zeitzer Straße bis zur Schulstraße in Langenberg verlaufende Straße benannt. Der Geraer Verschönerungsverein errichtete außerdem im Jahr 1897 im Stadtwald auf dem Hainberg den Gladitschturm, der heute aber zusehends verfällt.
Unter der Charlottenburg/Charlottenburgweg
Vom Charlottenburgweg abzweigend verläuft die Straße „Unter der Charlottenburg“. Der Geraer Harmonikafabrikant Heinrich Wagner (1808–1872) ließ die „Charlottenburg“ für seine Gemahlin errichten. Ihr Name hat demnach einen anderen Ursprung als das Berliner Schloss, das nach der ersten preußischen Königin Sophie Charlotte benannt wurde.
Wagnerstraße
Die nach Heinrich Wagner benannte Wagnerstraße verläuft von Unter der Charlottenburg bis zur Schulstraße. Wagner handelte ab 1836 mit Harmonikas, die er von seinem Schwager aus Wien erhielt. Gleichzeitig holte er erfahrene Harmonikamacher, Stimmer und Plattenmacher nach Gera, sodass ab 1842 die Harmonikaproduktion beginnen konnte. Damit gehörte er zu einem der frühesten Fabrikanten, der Gera industriell prägte.
Der Berliner Kaufmann A. Hofmann komplettierte das Team um Wagner und es entstand die Firma Wagner & Co. Ab 1850 produzierte das Unternehmen ca. 100 000 Harmonikas und 720 000 Mundharmonikas. Wagner kaufte anschließend das Tivoli auf dem Puschkinplatz und richtete dort eine weitere Produktionsstätte ein. Nach dem Tod von Heinrich Wagner übernahm sein Sohn die Leitung des Unternehmens und zog in Räumlichkeiten in der Neuen Straße. Bis 1899 produzierte die Firma noch Musikinstrumente, bevor der Betrieb eingestellt wurde.
Heinrich Wagner war außerdem für sein soziales Engagement bekannt. Im Jahr 1862 gründete er einen Verein, der die Arbeiter bei Krankheiten und Unfällen unterstützte.
Steinbeckstraße
Die Steinbeckstraße verläuft mit mehreren Abzweigungen von der Langenberger Straße bis zur Auenstraße. Benannt wurde sie nach dem Geraer Herausgeber der Zeitung „Aufrichtig-deutsche Volkszeitung“ Christoph Gottlieb Steinbeck (1766–1818). Er wurde von der Universität Jena mit der Ehrendoktorwürde für seine bildungsreichen Schriften ausgezeichnet. Kurz vor seinem Tod wurde Steinbeck Advokat in der Herrschaft Gera.
Adolf-Rolle-Platz
Inmitten Stublachs nördlich von Langenberg befindet sich der Adolf-Rolle-Platz. Der Namenspatron Adolf Rolle (1845–1928) war nicht nur Klempnermeister, sondern auch Bürgermeister von Langenberg. Im Jahr 1886 begründete Rolle die freiwillige Feuerwehr und sorgte für die Ansiedlung neuer Fabriken, zum Beispiel die Mechanische Weberei Gey. Zudem wurde in seiner Amtszeit die Langenberger Schule errichtet. Bei seinem Tod hinterließ er eine Stiftung für die ortsansässigen Bürger Stublachs und Langenbergs.
Bieblach/-Ost/Tinz
Otto-Lummer-Straße
Otto Lummer (1860–1925) wurde als Sohn eines Bäckers geboren und studierte nach dem Besuch des Geraer Realgymnasiums Physik an der Berliner Universität. Lummer promovierte über die Spektroskopie und entdeckte die sogenannten „Lummerschen Ringe“. Seinem Doktorvater Hermann von Helmholtz folgte er im Jahr 1887 an die Physikalisch-Technische-Reichsanstalt und im Jahr 1905 wurde Lummer Professor an der Universität Breslau.
Kurz vor Ende der DDR wurde im Jahr 1988 die damals neuentstandene Straße als „Otto-Cummer-Straße“ verzeichnet. Der Fehler wurde nach der Wende berichtigt.
Alexander-Wolfgang-Straße
Entlang des Bieblacher Kaufparks verläuft die Alexander-Wolfgang-Straße. Sie wurde nach dem Schwager von Otto Dix, Alexander Wolfgang (1894–1970), benannt, kam 1908 nach Gera und wurde zunächst Buchhalter. Im Ersten Weltkrieg übte er sich am Malen und Zeichnen. Ab 1919 widmete er sich in Gera erneut dem Malen und orientierte sich stark an expressionistischen und impressionistischen Malereien.
In den Zwanzigern stellte er gemeinsam mit den Geraer Künstlern Kurt Günther, Paul Neidhardt und Hermann Paschold aus. Das Hauptwerk Wolfgangs bilden Landschaften und Stillleben. Wolfgang heiratete in den Dreißigerjahren die Schwester des Malers Otto Dix, Hedwig.
Fritz-Gießner-Straße
Von der Wachsenburgstraße zweigt die Fritz-Gießner-Straße ab. Der in Gera geborene Kommunist (1898–1976) war in der Geraer Fabrik Weißker als Eisendreher tätig. Schon früh organisierte er sich gewerkschaftlich und gehörte der Arbeiterjugend an. Nach dem Ersten Weltkrieg war er in Gera Mitbegründer der KPD-Ortsgruppe Gera und von 1925 bis 1932 Mitglied des Geraer Gemeinderates.
Während der NS-Zeit wurde Gießner mehrmals festgenommen und dabei zweimal im KZ Buchenwald inhaftiert. Von Mai 1945 bis 1949 wirkte Gießner als Bürgermeister von Gera und wurde anschließend zum Landrat des Landkreises Nordhausen gewählt. Später war er auch dort Bürgermeister und wurde von der Stadt Nordhausen anlässlich seines 75. Geburtstages zum Ehrenbürger ernannt.