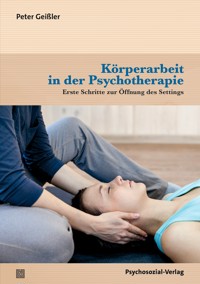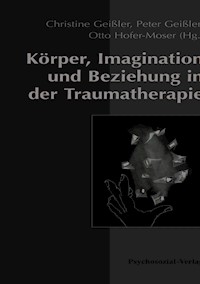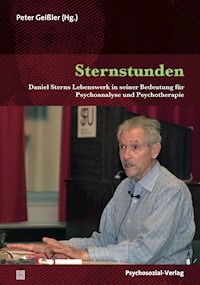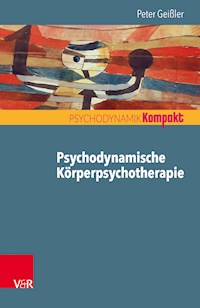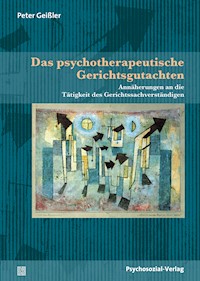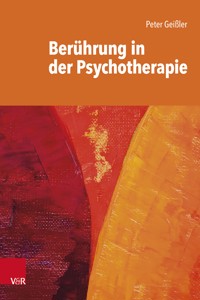
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie wirkt Berührung in der Psychotherapie? Kann körperliche Berührung Heilung fördern oder birgt sie Risiken? Dieses Buch geht einer der umstrittensten Fragen nach. Es beleuchtet verschiedene therapeutische Ansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und ethische Überlegungen. Fundiert und praxisnah zeigt Peter Geißler, wie körperliche Berührung emotionale Prozesse vertieft und die therapeutische Beziehung stärkt. Mit Einblicken aus Psychoanalyse, Körperpsychotherapie und Grundlagenwissenschaften bieten er sowie einige beitragende Kollegen wertvolle Impulse für Fachleute und Interessierte. Sie laden dazu ein, Berührung in der Therapie neu zu verstehen und bewusster einzusetzen. Ein Buch, das berührt – und zum Nachdenken anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Geißler
Berührung in derPsychotherapie
Mit Beiträgen von Markus Angermayr, Markus Böckle,Peter Cubasch und Jochen Willerscheidt
VANDENHOECK & RUPRECHT
Für Jörg, meinen geschätzten Freund und Lehrer im präzisen Denken, mit aufrichtigem Dank und tiefempfundener Wertschätzung
Copyright
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Anna_Fevraleva/Shutterstock
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-525-40878-0 (print)
ISBN 978-3-647-99251-8 (EPUB)
Inhalt
Geleitwort
Vorwort
Teil 1: Grundlagen und Perspektiven
Kapitel 1: Einführung
1.1Allgemeines
1.2Definitionen
1.3Zusammenfassung
1.4Die Ambivalenz körperlicher Nähe: Herausforderungen und Chancen der Berührung in der Psychotherapie
1.5Fazit
Kapitel 2: Existential Touch – philosophische Implikationen körperleiblicher Berührung
Markus Angermayr
2.1Vorbemerkungen
2.1.1Sich als Mensch in der Welt fühlen
2.1.2Zum Kontext von Berührung – Berührung als Wert
2.1.3Eigentümlichkeit von Berührung als anthropologische Konstante
2.1.4Soziale Ambivalenzen – Berührung als Problem
2.1.5Begriffliche Unschärfen: Körper und Leib
2.2Anmerkungen zur Phänomenologie der Berührung
2.2.1Berührung als Resonanzverstärker
2.2.2Berührung als körperleiblicher Dialog
2.2.3Berührung als Erkenntnisweg
2.2.3.1Bezogenheit – Selbsterfahrung
2.2.3.2Entzogenheit – Welterfahrung
2.2.3.3Exponiertheit – offener Kontext
2.3Aspekte einer Ethik der körperleiblichen Berührung
2.4Berührung als Weg in existenzielle Themenfelder
2.4.1Berührung als Erdung im Sein – Kann ich da sein?
2.4.2Berührung als Verbindung zum Lebendigen – Mag ich leben?
2.4.3Berührung als Selbstentdeckung und Selbstfindung – Darf ich so sein?
2.4.4Berührung als Spüren des Bedeutsamen für mein Leben – Was soll daraus werden?
Kapitel 3: »Die Welt ist im Wandel«: Körperliche Berührung im Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen
3.1Das viktorianische Zeitalter in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
3.2Aufbruch in der Nachkriegszeit
3.3Der Einfluss von Wilhelm Reich
3.4Reichs Erbe
3.5Veränderungen seit dem Inkrafttreten des Psychotherapiegesetzes
3.6Zwischen Nähe und Distanz: Die Rolle der Berührung im Spannungsfeld des gesellschaftlichen Wandels
3.7Ethikrichtlinien
Kapitel 4: Die evolutionsbiologische Perspektive
4.1Anpassung, Überleben und soziale Bindung
4.2Tasten und bewegen
4.3Tastsinn und Interaktion
4.4Berührung im Spannungsfeld egoistischer und kooperativer Motive
4.5Berührung im Spannungsfeld der Geschlechter
4.6Eine evolutionsbiologische Leseart des Unbewussten
4.7Zusammenfassung und abschließende Betrachtung
Kapitel 5: Die Bedeutung der Haptikforschung für die Psychotherapiewissenschaft
Jochen Willerscheidt
5.1Vorbemerkung
5.2Begriffserläuterungen
5.3Physiologische und neurobiologische Grundlagen
5.3.1Der Tastsinn – das erste Sinnessystem
5.3.2Bedeutung und Wirkungsweise der Lanugobehaarung
5.3.3Bedeutung der C-taktilen Nervenfasern
5.3.4Körperschema – Körperbild
5.4Entwicklungspsychologische Aspekte
5.4.1Stimulierende Bedeutung der Berührung – jenseits des Eros
5.4.2Selbst- und fremdregulative Funktionen innerhalb des haptischen Systems
5.4.3Kommunikative Aspekte von Berührungen
5.5Welche Rolle spielt das Haptiksystem bei der Integration der basalen Bedürfnis- und Affektsysteme?
5.5.1CARE-System
5.5.2SEEKING-System (Neugier)
5.5.3PLAY-System
5.5.4PANIC-System
5.5.5LUST-System
5.5.6RAGE-System
5.5.7FEAR-System
5.6Fazit
Kapitel 6: Selbstberührung in der Psychotherapie – Idiopraxie
Markus Böckle und Peter Cubasch
6.1Einleitung
6.1.1Allgemeine Grundlagen
6.1.2Psychologische und neurobiologische Grundlagen
6.2Berührungen als therapeutische Interventionen
6.3Vergleich von Selbst- und Fremdberührung
6.4Selbstberührung als therapeutische Intervention
6.5Integration der Selbstberührung in verschiedene Therapieansätze
6.6Die Rolle des Leibs in der Psychotherapie: Integration durch Selbstberührung
Kapitel 7: Ergänzende Grundlagenforschung
7.1Erste Studie: »streichelnde« Berührungen
7.1.1Affektive Berührung als emotionales Regulierungsmittel
7.1.2Förderung von Selbstwahrnehmung und Körperbewusstsein
7.1.3Soziale Bindung und Vertrauensbildung
7.1.4Affektive Berührung und Selbstwahrnehmung in sozialen Kontexten
7.2Zweite Studie: Soziale Berührung – warum, wer und wie?
7.2.1Das »Warum«
7.2.2Das »Wer«
7.2.3Das »Wie«
7.2.4Kulturelle und individuelle Unterschiede
7.2.5Psychologische und soziale Bedeutung
7.2.6Verstärkung und Klarstellung der Absicht
7.2.7Die Rolle der verbalen Begleitung in der zwischenmenschlichen Dynamik
7.2.8Sprachliche Hinweise als Regulierung von Berührungsintensität und -kontext
7.2.9Bedeutung der sprachlichen Begleitung bei konfliktreichen oder unangenehmen Berührungen
7.2.10Erotisch-sexuelle Berührungen: Eine trennscharfe Unterscheidung zu nicht-erotischen?
7.2.11Sexualisierung durch Berührung: Ein kontroverses Thema in der Psychotherapie
7.2.12Körperliche Empfindung versus körperliche Fantasie
7.3Dritte Studie: frühkindliche Berührungsmuster
7.3.1Synchrone Berührungsmuster in ihrer Kontextabhängigkeit
7.3.2Körperliche Berührungen im Zeitverlauf
7.3.3Synchronizität als Prädiktor für eine sichere Bindung
7.3.4Bedeutung der Berührung im sozialen und emotionalen Austausch
7.3.5Langfristige Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
7.3.6Fazit der Studie
7.3.7Bedeutung der Studie in einem psychotherapeutischen Kontext
7.4Nachbemerkung
Kapitel 8: Regression und Berührung
8.1Überblick
8.2Regression genauer betrachtet
8.2.1Regressionsförderung durch eine Haltung von Empathie und Sensitivität
8.2.2Regressionsförderung durch Deutungen
8.2.3Regressionsförderung durch therapeutische Zurückhaltung
8.2.4Regressionsförderung durch taktvolles Ansprechen latenter Emotionen
8.2.5Regressionsförderung durch taktvolles Ansprechen manifester Emotionen
8.2.6Regressionsförderung durch körperliche Berührung
8.2.6.1Unmittelbarkeit und Tiefenwirkung
8.2.6.2Aktivierung früher Beziehungserfahrungen
8.2.6.3Doppelte Wirkung von Präsenz und Halt
8.2.6.4Somatische Resonanz
8.2.7Fazit
Kapitel 9: Die Theorie der ursprünglichen Verführung nach Laplanche – heute noch haltbar?
Teil 2: Körperliche Berührung in der Selbsterfahrung und der Psychotherapie Erwachsener
Kapitel 10: Phänomenologie der Berührung
10.1Taktile Berührung
10.2Haptische Berührung
10.3Selbst erfahren werden durch Berührung
10.4Unbewusste Reaktionen erspüren durch Berührung
10.5Empathische, vertrauensfördernde und Halt gebende Berührungen
10.6Regressionsfördernde Berührung
10.7Existenzielle Gemeinsamkeit erleben (»being with«)
10.8Kraft, Grenzen und Selbstwirksamkeit erleben
10.9Die eigene Wut entdecken
10.10Grenzerfahrungen
10.11Geburtserfahrungen
10.12Berührungen an unterschiedlichen Körperteilen
10.12.1Berührung am Kopf
10.12.2Berührung auf der Stirn
10.12.3Berührung am Brustbein
10.12.4Berührung der Füße
Kapitel 11: Detailaspekte
11.1Zur Wirkung körperlicher Berührung
11.1.1Verstärkung der Körperwahrnehmung
11.1.2Körperberührung im Dienste der Ermutigung
11.1.3Berührung als Initialerfahrung
11.1.4Körperberührungen als Schlüsselszenen oder »magic moments«
11.1.5Körperliche Assoziationen und Erinnerungen wecken
11.1.6Erschütterung in der Selbstwahrnehmung und im Selbstausdruck
11.2Das Erleben von Berührungserfahrungen im Vergleich zu anderen therapeutischen Interventionen im Nacherleben
11.3Erinnern und nachträgliche Bearbeitung (Reframing)
11.4Berührung als unabweisbare seelisch-körperliche Realität
11.5Nachhaltigkeit
11.6Technische Gesichtspunkte
11.6.1Erklärung des Vorgehens
11.6.2Kleinschrittiges Vorgehen
11.6.3Szenische Arbeit mit Berührung
11.6.4Druck- und Stresstechniken
11.6.5Begleitende Verbalisierung
11.6.6Stellenwert der Intuition
11.7Vergleich zwischen Einzel- und Gruppensetting
11.8Berührung in Kenntnis der Strukturniveaus der Patient:innen
11.9Berührung bei Traumafolgestörungen
11.10Berührung in Coronazeiten
11.11Tipps für Einsteiger
11.12Mögliche Kritikpunkte
11.12.1Unstimmige und negative Berührungserfahrungen
11.12.2Expressive Egozentrik
11.12.3Fixierung auf die regressive Erfahrung
11.12.4Forciertes Vorgehen
11.12.5Mangel an verbaler Bearbeitung
11.12.6Berührung im Dienste des Widerstandes
11.12.7Unangemessener Umgang mit sexuell-erotischen Themen
11.12.8Retraumatisierung
11.12.9Guruverhalten
11.12.10Verstrickungsmöglichkeiten
11.12.11Widerstände der Therapeut:innen (oder: Die Angst vor dem Unkontrollierbaren)
Kapitel 12: Berührung im Gruppensetting – Sandra: Körperliche Berührung auf dem Weg zur Autonomie
12.1Vorbemerkungen
12.2Vor der Szene
12.3Vorbereitende Fantasieübung
12.4Vorbereitung der Gruppenszene
12.5Körperliche Berührung im Kontext der Gruppenszene, Teil 1
12.6Körperliche Berührung, Teil 2, und Entfesselung
12.7Nachreflexion
12.8Fazit: Stellenwert der körperlichen Berührung im Gesamtgeschehen
Kapitel 13: Grundzüge der einzeltherapeutischen Arbeit im offenen Setting
Kapitel 14: Körperliche Berührung als letzte Kontaktbrücke
14.1Die Entwicklung einer besonderen Beziehung
14.2Körperliche Berührung von Hand zu Hand – das Fingeralphabet
14.3Die Durchbruchserfahrung
14.4Fazit: Stellenwert der körperlichen Berührung
Kapitel 15: Berührungserfahrungen als Übergangsraum
15.1Die Patientin
15.2Die Arbeit im offenen Setting
15.3Erfahrungsmöglichkeiten
15.3.1Höhle
15.3.2Kuhle
15.3.3Schoßlage
15.3.4Rücken-an-Bauch-Lage
15.3.5Bauch-an-Bauch-Lage
15.4Analytische Phase
15.5Fazit: Stellenwert der körperlichen Berührung
Kapitel 16: »Ich kann es nicht fassen«: Die Trennung vom Therapeuten in einer vorweggenommenen szenischen Berührungsinteraktion
16.1Zur Persönlichkeit der Patientin
16.2Die rekonstruktive Fantasie
16.3Erste Berührungsproben
16.4Die Abschlussszene
16.5Fazit: Stellenwert der körperlichen Berührung
Kapitel 17: »Ich habe einen Platz bei Ihnen!«
17.1Die Patientin
17.2Herkunft der Patientin
17.3Erste Therapiephase
17.4Erste Berührungsprobe
17.5Feste Berührung am Bauch
17.6Die therapeutische Regression
17.7Erster Zugang zum Hass der Patientin
17.8Die Manifestation negativer Gefühle im Körperlichen
17.9Die Entfesselung
17.10Neubeginn
17.11Fazit: Stellenwert der körperlichen Berührung
Kapitel 18: Körperliche Berührung als Trigger für ein altes Trauma
18.1Der Patient
18.2Settingöffnung
18.3Körperliche Berührung
18.4Rückkehr zum verbalisierenden Vorgehen
18.5Stellenwert der körperlichen Berührung
Kapitel 19: Körperliche Berührung als »Enactment« und die nachfolgende Krise als Wendepunkt in der Behandlung
19.1Die Patientin
19.2Die erste Therapiephase
19.3Die Körperintervention: Ein ungewolltes Enactment
19.4Die therapeutische Bearbeitung der Szene
19.5Die unbewusste Botschaft des Enactments
19.6Weitere Öffnungsschritte
19.7Eine entscheidende Spielszene
19.8Die Rekonstruktion der Vergangenheit
19.9Die Fortgang der analytischen Arbeit
19.10Schlussfolgerungen
19.11Fazit: Stellenwert der körperlichen Berührung
Kapitel 20: Eine gescheiterte Therapie – körperliche Berührung als Eröffnungsmoment auf dem Weg in eine maligne Regression
20.1Die Patientin
20.2Der Therapeut
20.3Die erste körperliche Berührung
20.4Vorstufen der Verwicklung
20.5Die erotische Aufladung der therapeutischen Beziehung
20.6Das Fortschreiten der malignen Regression
20.7Der Kipppunkt
20.8Die Unlösbarkeit der Verstrickung
20.9Nachbetrachtung und Analyse des Geschehens
20.10Stellenwert der körperlichen Berührungen
20.11Reflexion der erotisierenden Dynamik
20.12Erste Schlussfolgerungen für eine Berührungsleitlinie
Kapitel 21: Berührungsleitlinie für die Psychotherapie erwachsener Patient:innen
21.1Vorbemerkungen
21.2Entwurf einer Berührungsleitlinie für die Psychotherapie Erwachsener
21.2.1Professionalität und Ausbildung
21.2.2Die Verortung von Berührung im jeweiligen Settingangebot
21.2.3Transparenz
21.2.4Dokumentation
21.2.5Grundlegende ethische Prinzipien
21.2.6Kooperatives Vorgehen
21.2.7Grenzen körperlicher Berührung und Kontraindikationen
Teil 3: Körperliche Berührung in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen
Kapitel 22: Klinischer Beitrag mit Fallepisoden aus körpernahen psychodynamischen Kindertherapien
Jochen Willerscheidt
22.1Fallepisode »Ein zärtlicher Ringkampf«
22.2Fallepisode über Berührungsdialoge: Begegnungsmomente trotz Fehlabstimmung
22.3Fallepisode über eine Berührungsprobe: »Stierkampf beim Fußballspiel«
22.4Subsymbolische Arbeit in der Kindertherapie
22.5Fazit
Kapitel 23: Orientierungslinien für den Einsatz von Berührung in der psychodynamischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Jochen Willerscheidt
23.1Professionalität und Qualifikation
23.2Die psychotherapeutische Haltung
23.3Theoretischer Hintergrund
23.4Transparenz
23.5Dokumentation
23.6Grundlegende ethische Prinzipien
23.7Grenzen körperlicher Berührung und Kontraindikationen
Literatur
Personenregister
Stichwortregister
Die Mitautoren
Geleitwort
Ich fühle mich geehrt, für dieses Buch ein paar Worte zum Geleit zu verfassen, da das Anliegen ein sehr würdiges und wiederholt aktuelles ist.
Peter Geißler kenne ich schon seit vielen Jahren von unterschiedlichen Veranstaltungen her: von den Wiener Symposien »Psychoanalyse und Körper«, wo ich selbst einmal als Referent einen Beitrag leisten durfte, und von den vielen Begegnungen als Lehrende an der Sigmund-Freud-Universität in Wien, wo Peter die adlerianische fachspezifische Ausbildung mitbetreut und ich selbst für die Psychoanalyse freudianischer Provenienz verantwortlich bin.
Aber hier geht es um das Anliegen, die Psychoanalyse von der Einschränkung aufs Sprachliche, auf die reine »Redekur« (Sigmund Freud) zu befreien. Und dies nicht ohne Grund, sondern aus dem Motiv, Patienten und Patientinnen eine tiefgreifende Heilungsmöglichkeit zu bieten, um in den Körper eingeschriebene, eingebrannte und abgeschottete Konflikte und Traumata dem therapeutischen Veränderungsprozess zugänglich zu machen. Auch innerhalb der Psychoanalyse gibt es hier schon eine Reihe bedeutender Vorgänger – angefangen bei Wilhelm Reich, Alexander Lowen und jüngst Tilmann Moser, um nur einige zu erwähnen. Die Jahrestagung des Psychoanalytischen Seminars Innsbruck im April 2024 war der unmittelbare aktuelle Anlass, Peter Geißlers körperpsychotherapeutische Arbeitsweise in einem Vortrag von ihm vorgeführt zu bekommen. Sehr beeindruckend war dabei der Audiomitschnitt einer körpertherapeutischen Sitzung mit einer traumatisierten Patientin, die Probleme schilderte, und die heftige Resonanz dazu im Auditorium.
In der nachfolgenden Diskussion, auch nach einem weiteren Vortrag des Kollegen Sebastian Leikert, fand ich es verstörend und diskussionswürdig, dass – im Gegensatz zu Geißler – der wohl eher konservative Kollege auch schwer traumatisierte Patientinnen und Patienten für fähig hielt, dass sie auf der Couch, also im traditionellen psychoanalytischen Setting, behandelt werden könnten.
In diesem Buch hingegen anders präferiert: Das behutsame Herantasten auch an körperberührende Interventionen, das Sich-Hineintrauen in Angebote an Patient:innen für ebensolche Interventionen, das ist wohl das Ansinnen und die erkenntnisleitende Motivation dieser körperorientierten Psychoanalyse. Wichtig dabei natürlich, dass der Therapeut dem »inneren Analytiker« (Ralf Zwiebel) folgt und die Resonanzen des Patienten weiterhin kontinuierlich reflektiert. Dies zu ermöglichen ist wohl Peter Geißlers Motivation, um nicht zu sagen Mission, seit vielen Jahren.
Nun zum Inhalt des Buches. Man könnte von einem Handbuch mit fast schon lexikalischer Breite zum Thema sprechen. In seiner Einleitung gibt der Autor sein Ziel an, nämlich für das Thema »Berührung in der Psychotherapie« zu sensibilisieren.
Schon in der Einleitung wird die Kulturgeschichte körperlicher Berührungen in verschiedenen Kontexten aufgezeigt. So wird etwa Markus Angermayr erwähnt, der das Beispiel von Jesus anführt, der durch Berührung u. a. Aussätzige im Tempel heilte. Folgerichtig wird in Kapitel 3 erläutert, wie körperliche Berührung im Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen unterschiedliche Freizügigkeit oder Hemmungen erfahren hat. Es werden viele Beispiele von früheren therapeutisch-psychoanalytischen Seminaren aufgeführt, die – insbesondere infolge der 68er-Bewegung – sehr freizügige und teils grenzüberschreitende Ausformungen fanden. Konkrete Beispiele damaliger körperorientierter Gruppensitzungen werden aufgezeigt, zum Teil berührend, zum Teil erheiternd.
Im jüngeren geschichtlichen Kontext wird die klassische psychoanalytische Haltung erwähnt, wonach Patientinnen und Patienten durch Versagung zur Reifung gelangen sollten. Die Befriedigung von Bedürfnissen und Wünschen durch den Therapeuten/die Analytikerin war lange ein No-Go. Im Gegensatz dazu gehört die therapeutische Möglichkeit korrigierender bzw. kompensierender emotionaler Erfahrungen heute durchaus zum Handwerkszeug von Analytikerinnen und Analytikern.
Sehr interessant ist Kapitel 4, in dem die evolutionsbiologische Perspektive der Bedeutung des Tastsinns erläutert wird. Dieser entwickelte sich evolutionär als Schlüsselmechanismus zur Erfassung sensorischer Informationen und zur sozialen Interaktion. Körperliche Berührungen verstärkten soziale Bindungen und Kooperationen, dienten der Stressregulation und förderten das Überleben in komplexen sozialen Strukturen.
In Kapitel 5 zum Thema »Haptikforschung« hinterfragt der Beitrag von Jochen Willerscheidt kritisch, dass psychoanalytische Konzepte die Haut, die Berührung ausschließlich erotisch konnotiert betrachten. Dies würde der tatsächlichen Bedeutung und den vielfältigen, überlebenswichtigen Funktionen von Berührung in der frühen Kindheit nicht gerecht. Hier wird der Gegensatz aufgezeigt zwischen den lebenswichtigen Aspekten von Berührung und der psychoanalytischen Sicht, nach der Berührung aufgrund der Lustempfindungen beim Kleinkind an Körperregionen gebunden sei – mit dem Endziel des immerwährenden Begehrens des freudschen Menschen. In diesem sehr interessanten Kapitel wird auch auf der Basis zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen auf die selbstregulatorischen Fähigkeiten des Säuglings hingewiesen, erste Berührungserfahrungen als Form der Selbsterfahrung scheinen bereits im Mutterleib stattzufinden – mit einer stressregulierenden Zielsetzung. Es werden Konzepte wie das Care-System, das Seeking System, das Play-System und das spätere Lustsystem besprochen und reflektiert.
Im folgenden Kapitel 6 wird das Thema »Selbstberührungen« behandelt – als unterstützende Technik zur Stabilisierung emotionaler Zustände, zur Förderung des Selbstbewusstseins und zur Beeinflussung tief verwurzelter psychischer Prozesse. Hierzu werden theoretische, biologische und praktische Anwendungen vorgestellt.
Im Kapitel 7 zur Grundlagenforschung wird nochmals die gerade für Therapeuten zentrale Frage aufgeworfen, ob eine klare Trennung zwischen erotischsexuellen und nicht-erotischen Berührungen überhaupt möglich ist. Natürlich kommt es dabei auf den Kontext an, aber schwierig wird es immer bleiben, da die subjektive Wahrnehmung und die damit verbundenen Kontexte eine zentrale Rolle spielen. Das heißt z. B., dass die Intention des Berührenden nicht immer mit der Wahrnehmung des Berührten übereinstimmt. Die daraus entstehenden Probleme sind vielfältig und leicht vorstellbar. Deshalb, so meint der Autor, wird eine Berührung im therapeutischen Kontext oft vermieden. Deutlich wird dann die Klärung, dass eine klare Kommunikation über die Absichten hinter der Berührung deshalb zentral wichtig ist und auch ein offener Kommunikationsraum nach einer körpertherapeutischen Intervention gewährleistet sein muss.
In Kapitel 8 geht es um Regression und Berührung, was aus dem therapeutischen bzw. behandlungstechnisch-therapeutischen Blickwinkel vielleicht das spannendste Kapitel ist. Die Überlegung im körpertherapeutischen Arbeiten ist hier, tiefer liegende Muster und verdrängte oder abgespaltene Emotionen bewusster zu machen, ja sogar »entfesseln« zu können. Auch ist bekannt, dass der Körper hier als der Träger eines impliziten Wissens im Sinne des nichtdeklarativen Gedächtnisses (= Körpergedächtnis) bzw. der präödipalen Lebenszeit angesehen wird. Auch hier die Überlegung, dass frühkindliche Erfahrungen, die von starken Emotionen geprägt waren und die oft nicht ausreichend von Eltern oder Bezugspersonen aufgegriffen wurden, vom Kind nicht integriert bzw. nicht symbolisch verarbeitet werden konnten. Körpertherapeutische Interventionen haben dann das Ziel, diese abgespaltenen oder traumatisierenden Erfahrungen der Therapie zugänglich zu machen. Somit versteht sich die psychodynamische Körperpsychotherapie auch als ein aufdeckendes therapeutisches Verfahren.
Diese Art der körpertherapeutischen Arbeit wird somit als sehr mächtiges und gleichsam sehr heikles Instrument verstanden, die besondere Weise der körperlichen Berührung besteht in der direkten präverbalen und basalen Wirkung auf den Patienten oder die Patientin, die nicht symbolisch oder kognitiv vermittelt wird.
Bei Kapitel 9 handelt es sich um ein sehr originelles und dem Zeitgeist entsprechendes Interview. Peter Geißler stellt hier einen Dialog in Form eines Chats mit der KI von ChatGPT vor. Er diskutiert dabei über Laplanches Theorie der ursprünglichen Verführung bzw. Laplanches »Allgemeine Verführungstheorie«. Mein persönlicher Eindruck davon ist: Es ist schon bemerkenswert, wie die KI sehr fundierte und theorierelevante Erklärungen zum Thema generieren kann.
Im Teil 2 des Buches macht der Autor ernst mit seinem eingangs schon erwähnten Vorhaben, dass dieses Buch vor allem anregen soll zum Austausch unter und zur Information von Interessierten und Kolleg:innen. Die 16 Experteninterviews, die der Autor als Materialsammlung auch im Internet zur Verfügung stellt, enthalten zahlreiche Details zur körperpsychotherapeutischen Arbeit. Es werden sowohl sehr gelungene als auch misslungene Beispiele aufgezeigt.
Am Ende dieses umfassenden und mit interessanten Beispielen angereicherten Abschnitts finden sich erste Gedanken zu einer Leitlinie – ein zukunftsweisendes Gerüst für die Anwendung körperlicher Berührungen in der psychotherapeutischen Praxis.
In Kapitel 10, das sich mit der Phänomenologie der Berührung befasst, wird detailliert dargestellt, welche körperpsychotherapeutischen Interventionen möglich sind. Gleichzeitig werden die Lesenden selbst gefordert zu entscheiden, ob sie diese Ansätze als Anregung oder eher als etwas betrachtet, das für sie persönlich nicht infrage kommt.
Kapitel 11 (Detailaspekte) zeigt erneut, wie intensiv sich der Autor mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Es wird sowohl auf mögliche Effekte – etwa eine Erschütterung in der Selbstwahrnehmung (Kapitel 11.1) – als auch auf verschiedene Druck- und Stresstechniken aus der bioenergetischen Analyse eingegangen. Ebenso wird der Aspekt der Berührung unter Berücksichtigung des Strukturniveaus der Patienten und Patientinnen mithilfe des OPD-2-Modells betrachtet.
Beispiele aus der gruppentherapeutischen Arbeit im Gruppensetting (Kapitel 12) sowie zahlreiche Fallbeispiele körpertherapeutischer Einzelarbeit (Kapitel 13) geben einen nachhaltigen Eindruck davon, wie diese Methoden praktisch angewandt werden.
Im letzten, sehr kurz gefassten Teil 3 des Buches geht es um körperliche Berührung in der Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Auch hier wird der Versuch unternommen, Leitlinien zu formulieren, die zeigen, worauf bei dieser Klientel besonders zu achten ist.
Zusammenfassend möchte ich festhalten: Dieses beeindruckende Werk mit seiner reichhaltigen Materialsammlung sowie den vielen geschichtlichen und aktuellen behandlungstechnischen Aspekten verdient großen Respekt. Es ist der Versuch, der psychoanalytisch-körperpsychotherapeutischen Arbeit ein breites Fundament zu geben.
Wie eingangs erwähnt, bleibt es jedem selbst überlassen, ob er daraus Anregungen für seine eigene Arbeitsweise mitnimmt. Wer dies tut, erhält zahlreiche Anleitungen und weiterführende Impulse. Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander gelesen werden; sie bauen nicht zwingend aufeinander auf. Das Stichwortverzeichnis ist daher hilfreich – sowohl für die gezielte Nutzung als auch für den weiteren Austausch mit Kolleg:innen, insbesondere Psychoanalytiker:innen, die sich von diesem Ansatz angesprochen fühlen.
Die vielen negativen Analyseerfahrungen, von denen Patienten und Patientinnen aus ihren Therapien mit hochgradig abstinenten Analytikerinnen und Analytikern (vor allem in früheren Jahren) berichten, sollten Anlass genug sein, die Körperpsychotherapie auch in heutige psychoanalytische Ausbildungscurricula zu integrieren – idealerweise mit einer verpflichtenden Selbsterfahrung. Danach könnten die jungen AnalytikerInnen selbst entscheiden, inwieweit sie körperorientierte Interventionen in ihrer Praxis anwenden. Aber das immer noch subtil vorhandene Berührungsverbot bei Analysen wäre einer neuen Erfahrung gewichen.
Der nicht antwortende, abstinent und interaktionsverweigernde Analytiker sollte in unserer Zeit der Vergangenheit angehören. Dieses Buch leistet einen wichtigen Beitrag, um Vorurteile abzubauen und anachronistische Analysevorstellungen zu relativieren. Peter Geißler ist hoch anzurechnen, dass er mit diesem Werk einen wertvollen Impuls gegen eine oft toxische Orthodoxie in der Psychoanalyse setzt.
Dr. Christoph Fischer
Psychoanalytiker, Lehranalytiker am PSI Innsbruck und Leiter des Wahlpflichtfachs Psychoanalyse an der SFU Wien
Vorwort
Welche Rolle spielt Berührung in den unterschiedlichen Ansätzen der Psychotherapie, und warum ist sie so umstritten? Können körperliche Berührungen heilsam sein? Warum tun sich viele Psychoanalytiker so schwer damit, körperliche Berührung in ihre therapeutische Arbeit zu integrieren? Und warum legen andererseits zahlreiche Körperpsychotherapeuten so großen Wert auf die Bedeutung und Wirksamkeit von Berührung in der Therapie? Können nicht physische Formen von Berührung, wie etwa die Stimme oder ein resonantes Spüren, nicht eine ähnliche Wirkung auf Patienten entfalten wie physische Berührungen, also direkter Körperkontakt?
Das Thema »Berührung« ist wohl eines der strittigsten im Methodenspektrum der verschiedenen Psychotherapien. In der als »Redekur« konzipierten psychoanalytischen Behandlung sowie in anderen verbal geführten Therapien ereignet sich körperliche Berührung in der Regel nur im konventionellen Kontext von Begrüßung und Verabschiedung. Berührung figuriert hier in einer allgemeineren Bedeutung, etwa im Sinne der emotionalen oder körperlichen Einwirkung aufeinander. Im Gegensatz dazu teilen viele Körperpsychotherapeuten die Meinung, konkrete körperliche Berührung sei ein wesentlicher Bestandteil der therapeutischen Zugangsweise, die das körperliche Geschehen innerhalb der Psychotherapie wirklich ernst nimmt. Sie sprechen sogar von »heilsamen Berührungen« (Heisterkamp, 1993). Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven hat eine lange Tradition und besteht seit Freud. Sie hat jedoch an Aktualität nichts eingebüßt.1
Seit über vierzig Jahren bewege ich mich an der Schnittstelle von Körperpsychotherapie und Psychoanalyse und bin mit den Spannungsfeldern dieses Gebiets vertraut. Über viele Jahre hinweg habe ich die enorme Wirkkraft des körperpsychotherapeutischen Ansatzes, einschließlich der Arbeit mit körperlicher Berührung, sowohl aus der Perspektive eines Patienten als auch als Teilnehmer zahlreicher Selbsterfahrungsgruppen intensiv erlebt. Im einzeltherapeutischen Setting als Therapeut hingegen habe ich diese Ansätze deutlich zurückhaltender eingesetzt. Dabei fiel mir immer wieder die merkwürdige Diskrepanz auf, die sich aus den unterschiedlichen Rollen ergab: Während ich als Patient von der körperlichen Berührung stark profitierte, griff ich in der Rolle als Therapeut darauf vergleichsweise wenig zurück. Diese Differenz begleitete mich über die Jahre hinweg, und ich hatte sie schließlich als eine Art Kompromiss zwischen den Prinzipien der Psychoanalyse und der Körperpsychotherapie akzeptiert – zwei Ansätze, denen ich persönlich viel verdanke. Ein selbstkritischer, aber pragmatischer Zugang schien mir hierbei angemessen. Dennoch muss ich zugeben, dass ich diese Haltung nie bis ins Letzte durchdacht habe.
Dann kam die Zeit der Coronapandemie. Psychotherapeutische Themen waren während dieser Zeit weitgehend in den Hintergrund getreten, weil ich mit anderen Aufgaben beschäftigt war und ganz darin aufging. Dann erhielt ich im Februar 2022 eine überraschende E-Mail von meinem Freund und Kollegen Jörg Scharff: »Nun ist ja gerade das Buch herausgekommen, das Sebastian veröffentlicht hat, auf das Du Dich neulich schon kurz bezogen hattest. Ich nehme an, nach allem, was ich von Dir höre, dass Du sehr stark in anderen Dingen beschäftigt bist, will aber doch fragen, ob Du eine Rezension in Deiner Zeitschrift initiieren kannst?«
Die Rezensionsanfrage bezog sich auf das Buch »Das körperliche Unbewusste in der psychoanalytischen Behandlungstechnik«, herausgegeben von Sebastian Leikert (2022), der mehrfach zum Wiener Symposium »Psychoanalyse und Körper« als Referent eingeladen war. Ich hatte es bereits zu Hause und war beim ersten flüchtigen Querlesen an folgender Aussage des Herausgebers hängen geblieben (S. 13 f.): »Beginnend bei Wilhelm Reich gab und gibt es Überlegungen und Erfahrungen, das psychoanalytische Setting zu erweitern und durch übende Verfahren, Rollenspiele, konkrete Körperberührungen und Ähnliches zu ergänzen. Meine Überzeugung ist es, dass diese Versuche problematisch und unnötig sind […] Die faktische taktile Berührung ist verzichtbar, denn die Stimme der Analytikerin oder des Analytikers berührt das Körperselbst, die gemeinsame Aufmerksamkeit berührt das Leibliche, das resonante Spüren der leiblichen Gegenübertragung hat eine Wirkung auf das Körperselbst der Analysandin oder des Analysanden. Abstinenz ist in der Arbeit mit leiblichen Konstellationen zentral, weil hier Verletzlichkeit und Gefahr der Retraumatisierung besonders groß sind« (Hervorh. P. G.).
Diese Äußerung berührte genau dieses Spannungsfeld. Als Therapeut selbst im Einzelsetting zurückhaltend, schien mir die hier getroffene Abgrenzung in ihrer Verallgemeinerung aber zu radikal zu sein.2 Nun gab mir diese Rezensionsanfrage einen Grund, über all dies nochmals genauer nachzudenken. Ich war mit der Rezension beschäftigt und suchte nach einer angemessenen Entgegnung auf Leikerts Aussage – weder überzogen noch zu zurückhaltend. Da ich keine zufriedenstellende Lösung fand, entschied ich mich, das Problem in einem Telefonat mit Jörg Scharff anzugehen. Im Zuge dieses Gesprächs entwickelte sich die Idee, nach Ende der Pandemie doch wieder einmal eine Tagung in Wien zu machen, und zwar explizit zum Thema »körperliche Berührung in der Psychotherapie«.
Während der inhaltlichen Vorbereitung auf die Tagung, der intensiven Auseinandersetzung mit den beeindruckenden Fallbeispielen vor Ort und den Gesprächen im Nachgang wuchs meine Faszination für das Thema stetig. Besonders prägend war dabei der Hinweis von zwei Kollegen aus dem Steißlinger Kreis3 auf das bereits 2017 erschienene Buch »Homo hapticus« von Martin Grunwald, das ich nun erstmals las. Ich empfand diese Lektüre als wahren Augenöffner! Nun schien der Zeitpunkt gekommen zu sein, das Themenfeld der »Berührung in der Psychotherapie« definitiv gründlich zu erforschen – und die Idee für das vorlegende Buchprojekt war geboren.
Das Buch versteht sich als Standortbestimmung anhand ausgewählter Beiträge und erhebt in keiner Weise den Anspruch einer systematischen Darstellung des gesamten Themenfelds.4 Beispielsweise habe ich in meinen eigenen Kapiteln bewusst auf eine systematische Untersuchung und Kategorisierung der verschiedenen Formen der Berührung verzichtet. Während der Niederschrift des Buches tauchte eine Reihe von Fragen erst auf und manche mussten unbeantwortet bleiben, wie z. B. der Stellenwert genitaler Selbstberührungen im Verlauf der frühkindlichen Entwicklung.
Das Buch will für konkrete körperliche Berührung in unterschiedlichen psychotherapeutischen Feldern und Methoden sensibilisieren, ohne die Botschaft vermitteln zu wollen, man sollte oder man müsste sogar mit körperlicher Berührung arbeiten. Der Einsatz körperlicher Berührung – verstanden weniger als Technik, sondern mehr als Beziehungsangebot – ist und bleibt ein Zugang, der herausfordernd sein kann und daher wohlüberlegt sein will.
Und ich spreche in meinen eigenen Beiträgen von Patient:innen und nicht von Klient:innen, weil sich Menschen an uns wenden, die leiden, was sich im lateinischen Wort patiens wiederfindet: leidend, erduldend.
Ich spreche außerdem von Patient:innen, Therapeut:innen etc., wenn die geschlechtliche Zuordnung unerheblich ist, also Patienten und Patientinnen, Therapeuten und Therapeutinnen etc. gemeint sind – und weitere Geschlechtsidentitäten sind durch die Pluralformen mit dem Doppelpunkt zumindest nicht ausgeschlossen. In diesem Buch wird der Einfachheit halber nur zwischen den beiden sexuellen Identitäten männlich/weiblich unterschieden. Ich bin mir bewusst, dass Geschlechtsidentitäten vielfältiger sind und über diese binäre Einteilung hinausgehen. Meine Perspektive spiegelt meinen aktuellen beruflichen Erfahrungshorizont wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ich spreche in meinen eigenen Beiträgen von Körper und nicht, wie manche das tun, von Leib oder »Körperleib«, weil Körper und Körperpsychotherapie die (zumindest derzeit) international meistverwendeten Begriffe sind. Zur Klarstellung: Auch wenn der Körper ein »Objekt« sein kann und wir daher auch einen Körper »haben« können, befassen wir uns in der (Körper-)Psychotherapie mit dem Körper primär aus der Perspektive des Körpererlebens und der Körpererfahrung.
Für dieses Buchprojekt nutze ich erstmals die Unterstützung künstlicher Intelligenz. Seit der Niederschrift dieses Textes arbeite ich mit der freien Version von ChatGPT. Alle von der KI erstellten Inhalte wurden von mir überprüft, und Passagen, die mithilfe von ChatGPT verfasst wurden, sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Kapitel 9 enthält den vollständigen Dialog mit ChatGPT und veranschaulicht, wie KI heute effizient und sachgerecht eingesetzt werden kann.
Teil 1 befasst sich mit den »Grundlagen und Perspektiven« des Themas und insbesondere auch mit der grundsätzlichen Ambivalenz des Einsatzes körperlicher Berührung in der Psychotherapie.
Teil 2 »Körperliche Berührung in der Psychotherapie Erwachsener« bietet praxisnahe Einblicke in das therapeutische Geschehen. Die Kapitel verbinden anschauliche Fallvignetten mit theoretischen Reflexionen. Spezielles Augenmerk liegt auf der Analyse eines misslungenen Prozesses, aus der heraus Überlegungen für eine mögliche Berührungsleitlinie entwickelt werden.
Teil 3 widmet sich den spezifischen Aspekten der Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen.
Das Buch wäre ohne die Mitwirkung einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Methodenfeldern nicht zustande gekommen. Herzstück des Buches sind Gespräche mit einer Reihe von Kolleg:innen. Viele einzelne Fragestellungen entwickelten sich erst im Zuge des gemeinsamen Nachdenkens. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Patka Gödeke-Krebs (Osteopathie, Körperpsychotherapie), Ulfried Geuter (Körperpsychotherapie), Christine Geißler (Psychoanalyse), Otto Hofer-Moser (Integrative Therapie), Bernd Kuck (leibfundierte Daseinsanalyse), Gerhard Lang (analytisch körperbezogene Psychotherapie), Imke McMurtrie (Dozentin für Atem- und Stimmbildung), Dagmar Motzkau (psychoanalytisch fundierte Körperpsychotherapie), Susanne Rabenstein (Individualpsychologie), Thomas Reinert (psychodynamische Körperpsychotherapie), Jörg Scharff (Psychoanalyse), Alexander Schwetz (Psychoanalyse), Gerhard Stumm (Personzentrierte Psychotherapie) und Marek Szczepański (Verhaltenstherapie) für ihre Bereitschaft, mir im Rahmen von Experteninterviews Antworten auf meine Fragen zu geben. Ausgewählte Textteile aus den Interviews wurden in das Buch integriert. Die Gesamtinterviews sind sämtlich unter folgender Adresse abrufbar und nachlesbar: www.psychoanalyseundkoerper.at/laufende-projekte/.
Mit Jochen Willerscheidt und Daniel Geißler habe ich monatelang um die Möglichkeiten, körperliche Berührungen in einen neuropsychoanalytischen Kontext zu integrieren, diskutiert. Dafür sei ihnen herzlich gedankt, ebenso Markus Angermayr, Vanesa Brahaj, Julia Deimel, George Downing, Christina Sogl und Hannes Winge für ihre Rückmeldungen zu ausgewählten Textabschnitten.
Mein Dank gilt Bernd Kuck, Jochen Willerscheidt und Jörg Scharff für ihre Bereitschaft, mit mir wiederholt bestimmte Fragestellungen rund um die gegenständliche Thematik zu diskutieren. Ich danke meinen Söhnen Andres und Daniel sowie Thomas Siegmund dafür, dass sie mir als Modelle für die Erstellung fotografischer Abbildungen zur Verfügung standen, und meiner Tochter Angelika für die nachfolgende Bildbearbeitung. Nicht zuletzt möchte ich mich bei Frau Englisch und Frau Rastin vom Verlag Vandenhoeck & Ruprecht bedanken, die mich während des gesamten Projekts sachkundig und einfühlsam begleitet haben.
Peter Geißler
1Der vorstehende Text, den ich gemeinsam mit Jörg Scharff entwickelt habe, ist im Wesentlichen die Wiedergabe des ersten Teils der Einführung in das 13. Wiener Symposium »Psychoanalyse und Körper« vom 23. bis 25. Juni 2023, www.psychoanalyseundkoerper.at/symposium-2023-23-25-6-zum-thema-beruehrung/ (4.11.2024).
2Eine solche radikale Sicht wird immer wieder von Psychoanalytiker:innen geäußert. Dazu Westland (2023, S. 542): »Diese Sicht ist insofern kaum überraschend, als nur wenige Psychoanalytiker eine Ausbildung in körperpsychotherapeutischer Arbeit haben.«
3Der Steißlinger Kreis ist eine Arbeitsgruppe überwiegend deutscher Psychoanalytiker, die körperpsychotherapeutisch arbeiten und ihren Zugang theoretisch und praktisch miteinander reflektieren.
4Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf zwei bereits vorhandene detaillierte Ausarbeitungen zu diesem Thema (Downing, 1996; Geuter, 2019).
Teil 1: Grundlagen und Perspektiven
Im ersten Teil soll es um eine umfassende Darstellung der vielfältigen Facetten von körperlicher Berührung gehen, indem ihre philosophischen und gesellschaftlich-kulturellen Dimensionen in den Mittelpunkt gestellt werden. Gleichzeitig betrachten wir körperliche Berührung aus der Perspektive der Evolutionsbiologie sowie der wissenschaftlichen Grundlagenforschung, insbesondere der Haptikforschung. Am Ende dieses Buchteils wird versucht, verschiedene Ausformungen körperlicher Berührung in die Brückenwissenschaft der Neuropsychoanalyse zu integrieren. In einem weiteren Kapitel kommt das bislang wenig diskutierte Themenfeld der Selbstberührung zur Sprache. Es folgen Überlegungen zur therapeutisch relevanten Erfahrung der Regression und zur immer wieder diskutierten Frage, ob körperliche Berührung in der Psychotherapie ungewollt erotisch-sexuelle Bedeutungen vermittelt.
Kapitel 1: Einführung
1.1Allgemeines
Körperliche Berührung findet in vielerlei Kontexten statt: im privaten Bereich beim Aufziehen der Kinder, in der sexuellen Intimität, in kumpelhaften Freundschaften, im Zuge des Handschlags bei Begrüßung und Abschied oder beim Küsschen auf die Wange, im Gedränge in der U-Bahn, bei Massenversammlungen, bei Sportveranstaltungen (etwa nach einem Tor); im professionellen Bereich in der Pflege, bei Massageanwendungen, beim Arzt, beim Schneider, bei der Polizei im Zuge von eingrenzender Gewaltanwendung; im rituell-religiösen Bereich im Zuge von Segnungen.
In kultureller Hinsicht variiert, was an Berührung erlaubt ist und was nicht (Hall, 1976; Hallam u. Hockey, 2002; Montagu, 1971/dt. 2004). In asiatischen Kulturen wie in China oder Japan hat körperliche Berührung, sogar in der Kindererziehung, einen geringeren Stellenwert als beispielsweise in Europa. Man legt Kindern die Hand nicht auf den Kopf, denn dort wohnt Buddha – dies gilt für südostasiatische Kulturen wie Thailand, Laos, Kambodscha und Sri Lanka, also in Ländern, in denen der Buddhismus stark verbreitet ist. In diesen Kulturen gilt der Kopf als der heiligste Teil des Körpers, da er als Sitz der Seele und des Bewusstseins angesehen wird. Der Glaube, dass Buddha oder eine spirituelle Kraft im Kopf wohnt, spielt eine wichtige Rolle. Daher wird es als respektlos empfunden, jemandem – insbesondere einem Kind – auf den Kopf zu fassen. Diese Geste könnte als Herabsetzung oder Entweihung interpretiert werden.
In den USA wird ein kräftiger Handschlag erwartet, denn er drückt Entschlossenheit aus; in Europa hingegen gilt ein fester Handschlag eher als übertrieben. Bei den Inuit in Kanada und Grönland findet ein großes Ausmaß an Berührung statt, und zwar in einem ganz anderen Zusammenhang. Es sind die extremen klimatischen Bedingungen in den kalten arktischen Regionen, in denen Körperkontakt nicht nur als Ausdruck von Nähe und Zuneigung verstanden wird, sondern auch, um Wärme zu übertragen. In der harschen Kälte ist Wärme überlebenswichtig, und der Austausch von Körperwärme durch Berührung ist eine praktische Notwendigkeit. Diese körperliche Nähe spiegelt sich in sozialen Ritualen wider, wie dem traditionellen »Kunik« – einem Nasenkuss, bei dem die Nasen und manchmal Oberlippen aneinander gerieben werden. Diese Geste wird oft zwischen engen Familienmitgliedern oder Liebenden ausgetauscht und drückt tiefe Zuneigung und Fürsorge aus. Hier zeigt sich der Kontrast zu Kulturen wie der buddhistisch geprägten in Südostasien, wo Berührung, besonders des Kopfes, als respektlos empfunden wird.
Körperliche Berührung kann in verschiedenen Kontexten als angemessen oder unangemessen empfunden werden. Während angemessene Berührungen in bestimmten sozialen oder beruflichen Situationen als Ausdruck von Nähe, Respekt oder Trost wahrgenommen werden, können unangemessene Berührungen das persönliche Wohlbefinden verletzen und Grenzen überschreiten. Die #MeToo-Bewegung, die ab 2017 weltweit an Bedeutung gewann, hat in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle gespielt. Ursprünglich über Twitter und andere soziale Medien verbreitet, hat die Bewegung weltweit das Bewusstsein für sexuelle Belästigung und Missbrauch gestärkt. Viele Menschen teilten öffentlich ihre Erfahrungen, was eine breite gesellschaftliche Debatte auslöste. Als direkte Folge dieser Debatte haben zahlreiche Länder ihre gesetzlichen Regelungen zum Schutz vor sexueller Belästigung und Missbrauch überarbeitet und verschärft, um Betroffene besser zu schützen und klare rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Auf der klinisch-psychodynamischen Ebene kommt die Vielfalt unserer Patienten hinzu, mit unterschiedlichsten Pathologien im Wechselspiel mit einer Vielfalt an Therapeutenpersönlichkeiten, das heißt die Frage des Matchings bzw. des Zusammenpassens. Ebenso kommt hinzu die jeweilige Primärerfahrung: Ist sie eventuell gekennzeichnet durch einen Mangel an Berührung oder durch unempathische Intrusion? Hinzu kommt die ästhetische Konfiguration des jeweiligen Behandlungssettings, im Sinne eines soundso regelhaft gestalteten Raumes, z. B. der Nahraum in der Körpertherapie versus die Wahrung des konventionellen Abstandes in der Psychoanalyse. Welcher therapeutische Raum führt zu welcher Regression, zu welchen »states of mind«, zu welchen emotionalen Aggregatzuständen? Wie unterschiedlich sind die Tempi der Regression, welche Kindheitserinnerung werden angetriggert mit körperlicher oder ohne körperliche Berührung? Aus all diesen Aspekten lassen sich Ideen hinsichtlich Indikationen und Kontraindikationen betreffend Berührung ableiten, abhängig vom jeweiligen Behandlungssetting.
Die theoretische Grundreferenz spielt ebenso eine Rolle. Beziehe ich mich auf das Freud’sche Unbewusste? Auf Lacan, das heißt das Unbewusste in der Sprache? Auf Laplanche und seine rätselhaften Botschaften der Eltern an ihr Kind? Auf die Bindungs- und Säuglingsforschung? Auf die Affektforschung? Liegt das Heilungsverständnis eher auf der korrigierenden Neuerfahrung (einschließlich körperlicher Berührungen) oder auf der schmerzlichen Akzeptanz des So-geworden-Seins? Ist die Intervention darauf fokussiert, die aktuelle Situation zu beschreiben und zu interpretieren (deskriptiv-deutend), mögliche Handlungsalternativen zu entwickeln und deren Wirkung zu erkunden (proskriptiv-handlungsorientiert) oder alternative Szenarien modellhaft zu erproben (modellszenenhaft)? Worin besteht die jeweilige Abwehrebene – im Abspeisen mit Worten, im Sprechen als Abwehr oder im Berühren als Abwehr? Oder gar in fehlender Distanz?
Körperliche Berührung kann bei Menschen, insbesondere in einem regressiven oder pathologischen Zustand, Verwirrung stiften. Sie kann einerseits den Bezug zur Realität verstärken – sei es durch den realen Kontakt oder durch die erlebte Trennung von einem anderen Menschen. Auf diese Weise wird die Person auf den »Boden der Realität« zurückgeholt, indem die Berührung eine klare Verbindung zur Realität herstellt. Ein Beispiel dafür wäre eine Patientin, die gerade eine schwierige Trennung durchlebt. Sie wird von überwältigenden Gefühlen gequält, die sie schwer zu kontrollieren vermag. Die Therapeutin legt nun in einem passenden Moment eine unterstützende Hand auf ihre Schulter. Durch diese Berührung spürt die Person, dass sie nicht allein ist und dass jemand real an ihrer Seite steht. Sie wird dadurch gleichsam in die gegenwärtige, reale Situation geholt und spürt durch die Berührung, dass sie mit einer anderen Person, der Therapeut:in, verbunden bleiben kann. Diese Art der Berührung wirkt »erdend« und stärkt das Bewusstsein für die Realität und den aktuellen Moment.
Andererseits kann die Berührung auch bestehende pathologische oder konfliktbehaftete Fantasien verstärken. Ein Beispiel wäre eine paranoide Patientin, die dazu neigt, harmlose Gesten anderer Menschen als Bedrohung zu erleben. Wenn diese Person körperlich berührt wird, z. B. durch einen zufälligen Kontakt im Alltag oder durch eine unerwartete Berührung durch die Therapeutin, kann diese Berührung die bestehenden pathologischen Fantasien verstärken, etwa in dem Sinne, dass jemand Kontrolle über ihren Körper übernehmen will oder ihr Schaden zufügen möchte.
Beides ist also möglich: Berührung kann entweder die Verbindung zur Realität klären oder die Fantasie stärker in die Realität hineintragen. Die Frage ist, wie dieser Prozess verstanden und interpretiert wird, das heißt, ob körperliche Berührung dabei hilft, die Realität klarer zu sehen oder ob sie die Grenzen zwischen Fantasie und Realität weiter verwischt.
Welche neurobiologischen Mechanismen werden durch Berührungen aktiviert? Wie beeinflusst die Art der Berührung (z. B. sanft, druckvoll, rhythmisch) die physiologische Reaktion? Werden verschiedene Rezeptoren angesprochen? Und wie wirken sich diese Unterschiede auf Wohlbefinden oder Schmerzempfinden aus? Welche Unterschiede gibt es in der sensorischen Wahrnehmung von Berührungen zwischen Individuen? Spielen genetische oder entwicklungsbedingte Faktoren eine Rolle?
Mittlerweile dürfte klar geworden sein, wie komplex sich die Frage nach den Chancen und den Risiken von körperlicher Berührung in einem psychotherapeutischen Setting darstellt. Einfache Antworten wird in diesem Buch nicht geben, vielmehr werden immer weitere Fragen aufgeworfen: Was hat die körperliche Berührung überhaupt an sich, dass sie manches Mal Segen und in anderen Fällen Fluch sein kann? Welche Einflussfaktoren spielen dabei eine Rolle, was ist zu beachten? Wie kann körperliche Berührung therapeutische Prozesse fördern oder behindern? Welche Rolle spielt die verbale und nonverbale Kommunikation bei der Einführung körperlicher Berührung in die Therapie? Welche Risiken und Chancen ergeben sich aus solchen intensiven körperlichen Erfahrungen in der Gruppentherapie und in der Einzeltherapie? Wie kann die Therapeutin die individuellen Bedürfnisse und Grenzen der Patientin in Bezug auf körperliche Berührung verstehen und respektieren? Welche Kompetenzen benötigen die Therapeut:innen, um die Reaktionen der Patient:innen auf körperliche Berührung richtig zu interpretieren und zu steuern? In welchen Situationen ist körperliche Berührung in der Therapie angemessen und wann sollte sie vermieden werden? Wie kann ein Therapeut angemessen auf unangemessene Forderungen von Patienten oder Patientinnen reagieren, die durch körperliche Berührung ausgelöst werden? Welche ethischen Richtlinien sollten bei körperlicher Berührung in der Psychotherapie beachtet werden? Wie können Therapeut:innen sicherstellen, dass die Berührung im Einklang mit den professionellen Standards und ethischen Richtlinien steht?5
In diesem Buch wird so weit wie möglich auf verallgemeinernde Schlussfolgerungen verzichtet. Auch wenn aktuelle Erkenntnisse der Grundlagenforschung – insbesondere der Haptikforschung – die besondere Bedeutung körperlicher Berührung in einem psychotherapeutischen Kontext nahelegen könnten, gilt – in Anbetracht der bereits angedeuteten Komplexitätsebenen – die Prämisse, keine voreiligen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die vergleichende Psychotherapieforschung (z. B. Wampold, Imel u. Flückiger, 2018) zeigt bislang, dass unterschiedliche therapeutische Ansätze ähnlich wirksam sind, auch wenn es Hinweise gibt, dass psychodynamische Therapien tendenziell besser wirken könnten – insbesondere bei längeren Verläufen (Shedler, 2011). Diese Überlegenheit ist jedoch nicht zweifelsfrei belegt. Für Befürworter körperpsychotherapeutischer Ansätze mag das Potenzial körperlicher Berührung überzeugend erscheinen und sie könnten sich angesichts der in diesem Buch dargelegten Grundlagenforschung diesbezüglich bestätigt fühlen. Dennoch scheint mir eine Haltung der Vorsicht angemessen zu sein. Ob sich psychotherapeutische Ansätze mit körperlicher und ohne eine solche Berührung überhaupt voneinander unterscheiden lassen und ob sich daraus eine Überlegenheit irgendwelcher Art ableiten lässt, muss meiner Ansicht nach aus gegenwärtiger Sicht vollkommen offenbleiben. Der objektive Nachweis einer solcher Überlegenheit könnte, wenn überhaupt, nur durch unabhängige Forschung erbracht werden, und eine solche Evidenz liegt meines Wissens bislang nicht vor.
1.2Definitionen
Unstrittig ist, dass auch Worte berühren können. Worte können wie sanfte Hände sein, die die Seele umschließen, sie heben und tragen, ohne dass dabei der Körper angefasst würde. Auch verbale Deutungen können sehr wirkmächtig sein und die Überzeugung auslösen, man habe nun etwas gesehen wie nie zuvor im Leben. Eine solche Einsicht kann mit einer tiefen Bewegtheit einhergehen, kann im Innersten berühren. Auch Musik und andere Kunstwerke können einen unglaublich ergreifen.
In diesem Buch beschränke ich mich ausdrücklich und ausschließlich auf den konkreten Körperkontakt. Körperliche Berührung im hier gemeinten Sinn bezeichnet die absichtsvoll herbeigeführte, nicht ritualisierte physische Kontaktaufnahme zwischen zwei, manches Mal auch (in Gruppensettings) zwischen mehreren Personen und den damit verbundenen Wahrnehmungsqualitäten, sei es in der aktiven oder in der passiven Form.6 Aktive Berührung ist die gezielte Bewegung, durch die eine Person eine andere Person physisch kontaktiert. Passive Berührung beschreibt den Zustand, in dem eine Person von einer anderen berührt wird, ohne selbst die Berührung zu initiieren. Die Person, die berührt wird, ist hierbei die passive Partei und nimmt die Berührung als Ergebnis der Bewegung der anderen Person wahr. Weil es aus neurophysiologischer Sicht einen Unterschied macht, ob wir uns im Zuge von Berührungen unseres Körpers aktiv bewegen oder passiv bewegt werden, spreche ich in Anlehnung an Grunwald (2017, S. 26) im aktiven Modus von haptischer und im passiven Modus von taktiler Wahrnehmung: »Taktile Wahrnehmung entsteht, wenn unser Körper durch physikalische Reize verformt oder berührt wird, zum Beispiel, wenn wir von einem Masseur durchgeknetet werden. Sind wir hingegen selbst der Masseur, generiert unser neuronales System haptische Wahrnehmungen. Da wir den größten Teil unseres Alltags als aktiv Handelnde gestalten, ist ein Großteil unserer Tastsinneswahrnehmungen haptisch und nur ein geringer Teil taktil.«
Die Begriffe taktil und haptisch beziehen sich ursprünglich auf unterschiedliche Modi der Berührungswahrnehmung, die aus neurophysiologischer Sicht klar voneinander zu unterscheiden sind: Die taktile Wahrnehmung beschreibt den passiven Prozess, bei dem eine Person durch Berührung Reize aufnimmt. Im Gegensatz dazu steht die haptische Wahrnehmung, die den aktiven Vorgang bezeichnet, bei dem eine Person bewusst etwas oder jemanden berührt, um Berührungsinformationen gezielt zu verarbeiten.
In der Psychotherapie gebrauchen wir diese Begrifflichkeiten in einer etwas anderen Weise. Hier liegt der Fokus weniger auf der neuronalen Verarbeitungsweise als vielmehr auf der Art und Weise der Berührung selbst und der dabei empfundenen subjektiven Erfahrung.
Taktile Berührung in der Psychotherapie beschreibt eine Berührung, die passiv empfangen wird, also wenn der oder die Patient:in berührt wird und die Berührung als »empfangende« Wahrnehmung erlebt. Diese Form der Berührung ermöglicht es den Patient:innen, sich auf das Empfangen und Spüren zu konzentrieren, ohne dabei selbst aktiv in die Berührungsbewegung involviert zu sein.
Haptische Berührung hingegen bezieht sich auf eine Berührung, die aktiv durch die Patientin (bzw. den Patienten) ausgeführt wird. In diesem Fall ist sie diejenige, die durch eine aktive Bewegung mit etwas oder jemandem in Kontakt tritt. Die Person gestaltet ihre Erfahrung eigenständig und fühlt sich durch die aktive Rolle (meistens) autonomer und selbstbestimmter.
1.3Zusammenfassung
Körperliche Berührung hat oftmals eine starke Wirkung auf unsere Wahrnehmung und unser Erleben. Dabei unterscheidet sich die aktive (haptische) Berührung, die durch eigenes Handeln erfolgt, von der passiven (taktilen) Berührung, die empfangen wird. In der Psychotherapie liegt der Fokus auf der subjektiven Erfahrung von Berührung, ob passiv taktil oder aktiv haptisch.
1.4Die Ambivalenz körperlicher Nähe: Herausforderungen und Chancen der Berührung in der Psychotherapie
Für die psychoanalytische Buchreihe »Psychodynamik kompakt« habe ich den Band »Psychodynamische Körperpsychotherapie« (Geißler, 2017) verfasst, in welchem ich mein Vorgehen anhand von Beispielen erklärt habe. Ich erhielt von einer Reviewerin die Rückmeldung, mein Text habe bei ihr den Eindruck einer gewissen »Schmuddeligkeit« hinterlassen. Wie kann man diese Rückmeldung verstehen? Die folgenden Ausführungen (bis 1.5) wurden mithilfe von ChatGPT3.5 ausgearbeitet (30.11.2024).
Die Rückmeldung der Psychoanalytikerin, der Text habe bei ihr den Eindruck einer gewissen »Schmuddeligkeit« hinterlassen, eröffnet ein komplexes Feld, das psychodynamische, kulturelle und methodologische Aspekte berührt. Es lässt sich nicht nur als persönliche Reaktion deuten, sondern auch als Ausdruck tiefer liegender Spannungen zwischen verschiedenen therapeutischen Paradigmen und deren Umgang mit Nähe, Körperlichkeit und Grenzsetzungen.
Das Wort »schmuddelig« trägt in sich einen abwertenden Ton, der oft Unreinheit, Grenzüberschreitung oder mangelnde Klarheit impliziert. Auf der inhaltlichen Ebene könnte es bedeuten, dass die Analytikerin eine Unbehaglichkeit empfand, die mit dem Umgang mit körperlicher Nähe und Berührung in der psychotherapeutischen Arbeit zusammenhängt. Psychoanalytiker:innen, die traditionell auf verbal-symbolische Prozesse fokussiert sind, könnten auf Körperpsychotherapie reagieren, indem sie diese Dimension als potenziell »unordentlich« wahrnehmen – möglicherweise weil sie sich außerhalb des gewohnten Bezugsrahmens bewegt. Körperliche Berührung und Nähe werfen Fragen nach Grenzen, Macht, Intimität und Übertragung auf, die im psychoanalytischen Kontext oft implizit vermieden werden, indem der Körper als neutraler Hintergrund fungiert. Eine explizite Thematisierung des Körpers und seiner Interaktionen in der Therapie könnte somit als Herausforderung oder sogar als Bedrohung empfunden werden.
Aus der Perspektive der Psychoanalyse könnte diese Reaktion auch mit der historischen Tendenz zusammenhängen, das Körperliche zugunsten des Symbolischen zu marginalisieren. Der Körper wird in der klassischen Psychoanalyse zwar als Träger von Symptomen oder als Schauplatz der Triebenergie verstanden, doch seine direkte Einbindung in den therapeutischen Prozess bleibt oft außen vor. Körperpsychotherapeutische Ansätze hingegen stellen den Körper ins Zentrum, was die Wahrnehmung von Nähe und Berührung intensiviert. Diese Fokussierung könnte als eine Art Grenzüberschreitung wahrgenommen werden, besonders wenn die Rezipient:innen selbst keine methodische Erfahrung oder Reflexion über solche Dynamiken besitzt. Der Eindruck des »Schmuddeligen« könnte somit eine Projektion von Unbehagen sein, das aus einem nicht verarbeiteten Spannungsfeld zwischen Nähe, Körperlichkeit und professioneller Distanz resultiert.
In einem breiteren kulturellen Kontext spielt möglicherweise auch die gesellschaftliche Ambivalenz gegenüber dem Körper und der Berührung eine Rolle. Während Berührung als menschliches Grundbedürfnis anerkannt ist, wird sie in professionellen Kontexten häufig mit Skepsis betrachtet, da sie schnell mit Machtmissbrauch oder sexuellen Grenzverletzungen assoziiert werden kann. Dieses Spannungsfeld könnte das Unbehagen der Reviewerin verstärkt haben, insbesondere wenn in der Falldarstellung die Grenzen zwischen therapeutischer Berührung und persönlicher Intimität als fließend wahrgenommen wurden.
Aus dieser Rückmeldung können mehrere wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Erstens verdeutlicht sie, wie zentral die professionelle Reflexion über Körperlichkeit und Nähe für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen therapeutischen Schulen ist. Die Empfindung von »Schmuddeligkeit« könnte ein Signal sein, dass die Bedeutung von körperlicher Nähe und Berührung in der Therapie für manche Rezipient:innen zu wenig explizit oder ausreichend kontextualisiert wurde. Eine differenziertere theoretische Einbettung der körperpsychotherapeutischen Arbeit könnte helfen, solche Missverständnisse zu minimieren. Zweitens zeigt diese Rückmeldung die Notwendigkeit eines Dialogs über unterschiedliche therapeutische Ansätze und deren jeweilige Grundannahmen. Gerade die Konfrontation mit Unbehagen kann als Einladung verstanden werden, die eigenen blinden Flecken zu hinterfragen und die Grenzen des eigenen therapeutischen Ansatzes zu reflektieren.
Letztlich kann die Rückmeldung als Ausdruck einer kulturell und methodisch tief verwurzelten Ambivalenz gegenüber dem Körper gelesen werden. Sie bietet die Chance, diese Ambivalenz nicht nur zu benennen, sondern auch produktiv zu nutzen, um die jeweiligen Stärken und Schwächen verschiedener Ansätze miteinander zu verknüpfen. Dies erfordert jedoch Mut, sich den eigenen Vorurteilen und Ängsten zu stellen – eine Herausforderung, die für Therapeut:innen jeder Disziplin von grundlegender Bedeutung ist.
1.5Fazit
Berührung in der Psychotherapie ist somit ein Thema von tiefgreifender Bedeutung, das die Grenze zwischen menschlicher Nähe und professioneller Distanz auf einzigartige Weise beleuchtet. Die Rückmeldung der Psychoanalytikerin, die Arbeit wirke »schmuddelig«, zeigt, wie stark kulturelle und persönliche Assoziationen unsere Wahrnehmung von Berührung prägen. Sie verdeutlicht, dass Berührung nicht nur eine physische Handlung ist, sondern ein vielschichtiges Kommunikationsmittel, das sowohl Transformation als auch Unbehagen auslösen kann.
Gerade deshalb ist es essenziell, Berührung in der Therapie nicht nur praxisbezogen, sondern auch theoretisch und ethisch fundiert zu reflektieren. Die bewusste, methodisch begründete Einbindung von Berührung erfordert Klarheit über Intention, therapeutische Ziele und die Dynamik der Beziehung. Sie ist kein technisches Werkzeug, sondern ein zutiefst relationaler Akt, der eine Präsenz und Achtsamkeit erfordert, die weit über das Körperliche hinausgeht. Berührung, richtig eingesetzt, kann ein Schlüssel zu Wandlung und Integration sein – doch ihre transformative Kraft entfaltet sich nur, wenn sie aus einem fundierten Verständnis der psychodynamischen Prozesse heraus geschieht.
Die Herausforderung und die Chance bestehen darin, Berührung in der Psychotherapie von Vorurteilen und kulturellen Stigmatisierungen zu befreien und sie zugleich mit höchster Sensibilität einzusetzen. So kann körperliche Berührung ein Weg sein, um nicht nur den Körper, sondern auch die Seele zu berühren.
5Einige dieser Fragen wurden im Rahmen zweier Masterarbeiten thematisiert (Zelzer-Lenz, 2023; Zobel, 2023).
6Diese Einschränkung bezieht sich auf die von mir verfassten Beiträge und ggf. nicht auf die anderen Autoren in diesem Buch.
Kapitel 2: Existential Touch – philosophische Implikationen körperleiblicher Berührung
Markus Angermayr
Vor vielen Jahren leitete ich eine Gruppe junger Menschen bei einem Selbsterfahrungsseminar in den Bergen Korsikas. Wir experimentierten auch mit kleinen Körperarbeitssequenzen. Ich zeigte jeweils eine Übungsform vor und wer wollte, konnte das dann ausprobieren. Die abschließende Sequenz war ein Halten des Kopfes und dann ein sanftes und bestimmtes Bedecken der Augen mit den Händen für circa drei Atemzüge, dann öffnen sich die Hände, streifen über den Kopf und gehen wieder aus dem Kontakt. Ich arbeitete mit einer jungen Frau, deren Gesicht durch eine Krebserkrankung vor langer Zeit entstellt war. Sie war gut integriert, in einer guten Beziehung, lebensfreudig und wach, aber auch etwas Schweres war spürbar. Ich kam hinter ihrem Kopf zum Sitzen und hielt ihren Kopf in meinen Händen, wie in einer Schale. Dann legte ich den Kopf ab und bedeckte mit meinen warmen Handflächen ihre Augen und Teile des Gesichts, der Wangen. Ohne Absicht. Es entstand ein Zittern in ihrem Gesicht und Tränen bahnten sich den Weg. Ich atmete ruhig weiter. Sie begann still zu weinen. Dann löste ich die Hände und die Tränen flossen frei heraus und sie schluchzte. Dann beruhigte sie sich wieder und setzte sich auf, und wir tauschten unsere Erfahrung aus. Ich war ein bisschen unsicher wegen des Weinens und wie das für sie war. Sie aber sagte strahlend, dass sie das so sehr vermisst hatte, dass niemand sie – außer den funktionalen ärztlichen Berührungen – an dieser entstellten Stelle berührt hatte. Selbst ihr Freund hatte sie nicht an dieser Stelle berührt. Sie hatte den Eindruck, das kam ihr während der Sequenz in den Sinn, wie wenn sie an dieser vom Krebs entstellten Stelle im Gesicht kein Mensch mehr wäre und irgendwie unantastbar. Und wie gut es täte, da eine wohlwollende, warme, absichtslose Berührung zu erleben. Sie habe das Gefühl, wieder ein Mensch zu sein.
Dass Berührung dabei unterstützt, sich wieder als Mensch in der Welt zu fühlen, habe ich nie mehr vergessen.
2.1Vorbemerkungen
2.1.1Sich als Mensch in der Welt fühlen
Der Zugang zur Welt ist gewissermaßen ein berührender. Welt geht mir nah. Wir sind darin und indem wir uns in unserer Welt befinden, geht sie uns nah, sie wird zu unserer Lebenswelt. Es scheint, als könnte man überhaupt von einem berührenden Selbst- und Weltverhältnis menschlicher Lebewesen sprechen. Die erste Berührung: eingebettet schon vor der Geburt durch den schützenden Körper der Mutter, und dann mit der Geburt, dem »in den Händen halten« des kleinen lebendigen Körpers des zur Welt gekommenen Lebewesens. Zur letzten Berührung: Im Sterben, den noch warmen Körper des geliebten Menschen berühren, oder die unter die Haut gehende Erfahrung des schon erkalteten Leibes eines Menschen.
Welt berührt uns leiblich spürbar sowohl aus der Ferne, mit körperlichem Abstand, als auch in der Nähe als körperleibliche Berührung. Denn man kann sich körperlich fern sein und sich doch leiblich spürbar berühren. Eine Erfahrung, die durch die modernen sozialen Medien und Maschinen enorme Erweiterung erlebt. Welt geht uns nahe durch das Berührtwerden oder Berühren von Menschen, von anderen Lebewesen, Dingen (z. B. so selbstverständliche Dinge wie Kleider, die Luft, technische Geräte), aber auch Gedanken und Theorien, ja sogar Atmosphären, Melodien, Tönen, Geschmack – alles, was vor den klaren, bewussten Gefühlen und Impulsen liegt und sprachlich nicht so leicht zu fassen ist. Das alles erreicht uns durch die Stimmung, atmosphärische Berührung. Martin Heidegger hat das im Begriff der Befindlichkeit, die uns durch die Stimmung zugänglich wird, gefasst.
Darum ist es irritierend, warum das Thema »körperliche Berührung« in den Jahren meines Philosophiestudiums kaum vorkam. Dabei zeigt das Phänomen Berührung ja an, dass uns etwas ergreift, nahegeht und angerührt hat. Das kann überraschend sein: z. B. eine Szene in einem Film, ein nebenbei gefallenes Wort, ein Blick, eine spontane Geste oder Berührung des Gesprächspartners. »Etwas rührt mein Herz an«, sagt man poetisch, oder aber jemand ist leicht angerührt, heißt es dann mit pejorativer Note: Jemand sei ein Sensibelchen oder sentimental, ein Weichei. Dabei ist Berührung ziemlich »robust«, eben »handfest«, ein basaler unverzichtbarer Zugang zur Welt und zu sich selbst, der uns über die gesamte Spanne des Lebens begleitet.
Die philosophische Relevanz von Berührung wird vor allem in der Phänomenologie und in der Lebenskunstphilosophie aufgegriffen:
1.Die Impulse aus der Phänomenologie – beginnend mit Edmund Husserl, Edith Stein, Merleau Ponty, Bernhard Waldenfels bis hin zu Thomas Fuchs und Herman Schmitz und den neophänomenologischen Konzepten – haben eine große Bedeutung. Nicht zuletzt werden diese Befunde zunehmend auch von den naturwissenschaftlichen, neurobiologischen und Embodimentforschungen herangezogen und dienen hier als kritischer Dialogpartner.
2.Aus der Lebenskunstphilosophie im Gefolge der Entwürfe von Wilhelm Schmid stammen viele anregende Impulse und die Hinwendung zur konkreten Lebenswelt.
Beide Quellen sind für die Psychotherapie äußerst hilfreich und erhellend.
Im Folgenden beschreibe ich Aspekte einer Phänomenologie der Berührung aus philosophischer Sicht. Dem Anliegen des Buches folgend, werde ich die Berührung aus der Nähe in den Blick nehmen, also körperleiblicher Art im Unterschied zur Berührung aus der Ferne, aus körperlichem, zeitlichem und kulturellem Abstand. Diese Unterscheidung ist keine strenge oder gar trennende. Im Grunde ist sie theoretisch beinahe zu vernachlässigen, aber von praktischer Bedeutung. Es geht um Berührung, wie sie sich im psychotherapeutischen Prozess ereignet, und ihre philosophischen Implikationen. Die vielen sich häufenden, faszinierenden einzelwissenschaftlichen Erkenntnisse werde ich nur nebenbei streifen, da sie in diesem Buch von den Autoren detailliert angeführt werden.
Welt, die uns nahekommt, rührt uns an. Diese ständige körperleibliche Resonanz ist in der Regel unbewusst, ein impliziter Prozess mit der Welt. Mit der Berührung – im Besonderen der konkreten körperlichen Berührung, auf die in diesem Werk fokussiert wird – bewegen wir uns in der Intimsphäre von Lebewesen. Berührung ist eine exzellente Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, mich sozusagen vom Leben überraschen zu lassen. Denn die Erfahrung, so Hans-Georg Gadamer, die »diesen Namen verdient«, kann nicht auf Wissen oder Belehrung reduziert werden. Vielmehr meint sie jene Erfahrung, die, selbst erworben, eine Erwartung durchkreuzt (Gadamer, 1990, S. 362).
2.1.2Zum Kontext von Berührung – Berührung als Wert
Dass Berührungen heilsame Wirkung haben, ist historisch überliefert. Wir kennen Beispiele aus der antiken Heilkunst und aus der Bibel: Zum Beispiel Jesus, der den Aussätzigen durch Berührung heilt, oder der zweifelnde Apostel Thomas, der, um die Realität des Geschehens zu erfassen, eingeladen wird, die Wunden Jesu zu berühren. Mit der christlichen Vorstellung der Menschwerdung Gottes – das Wort wurde Fleisch (Johannes-Evangelium 1,14) – ist regelrecht ein »Berührungsparadigma« gegeben.
Alle Menschen kennen die beglückende und erfüllende Wirkung streichelnder, warmer Hände oder die Halt und Geborgenheit vermittelnde Umarmung. Berührung – feinfühlige – ist für das Kind überlebensnotwendig und bleibt es für den Menschen ein Leben lang. Abgesehen vom Berührtwerden durch andere, berühren wir uns oft selbst. Zwischen 400- bis 800-mal am Tag berühren wir unser Gesicht und in der Regel nehmen wir von dieser Bewegung, die circa 1,3 Sekunden dauert, keine Notiz. Um möglichst keine Aufmerksamkeitsressourcen aus der aktuellen Situation abzuziehen, laufen diese Prozesse unbewusst ab. Selbstberührungen sind also eine sehr häufige Alltagshandlung – von allen Menschen, weltweit (Grunwald, 2020, S. 2). Ebenso schmerzhaft wird ihr Fehlen erlebt. Wer einsam ist und ohne Partner lebt, hat Studien zufolge eine kürzere Lebenserwartung und ein höheres Krankheitsrisiko. Das scheint auch mit dem Mangel an Körperkontakt zusammenzuhängen, unter dem diese Menschen oft leiden, denn lange Umarmungen und intensiven Körperkontakt gibt es in der westlichen Kultur hauptsächlich in romantischen Beziehungen. Aber auch das Streicheln von Hunden und anderen Tieren führt zu Endorphinausschüttungen und baut Stress ab – weil wir uns selbst als Natur, die wir sind, spüren.
Auch in der Psychotherapie war der Körper von Anfang an ein Thema. Sigmund Freud massierte anfangs seine Patienten und Patientinnen. Erst mit dem Auftauchen der Schwierigkeiten im Übertragungsgeschehen bei hysterischen Patientenpersonen hat er sich davon abgewandt. Später postulierte er, dass in der analytischen Behandlung nichts anderes als ein Austausch von Worten zwischen dem Arzt und dem Analysanden vorgeht (Geißler, 2017, S. 14). Das führte dazu, dass einige Psychotherapieschulen Berührung marginalisierten, tabuisierten, in einigen Fällen sogar kriminalisierten (Zur u. Nordmarken, 2020): Körperliche Berührung wurde als unzulässige Sexualisierung und als Missbrauch des Patienten für eigene Bedürfnisse eingestuft. Und doch war der Körper immer dabei als »absent presence«, als anwesend und zugleich im Hintergrund. Auch hier wird deutlich, dass der Körper ein Ding merkwürdiger Art ist. Heute können wir von einem sanften »Bodyturn« in der Psychotherapie sprechen (Angermayr, 2022, S. 7).
Auch gesellschaftlich ist Berührung und berührt werden ein heißes Thema. Gerade infolge von »MeToo« ist das verständlich. Darf ich den anderen berühren? Wo und wie darf ich ihn berühren? Ist es anstößig? Wird es missverstanden als sexuelle Anmache? Niemand hat das Recht, einen Menschen gegen seinen Willen anzufassen. Das hat etwas mit Würde, die ja »unantastbar« ist, und mit körperlicher Integrität zu tun (Flaßpöhler, 2021, S. 188).
Wir merken, wie relevant das Thema ist, und dass es einer Ethik der Berührung bedarf, einer bestimmten qualitativen Atmosphäre und vor allem einer inneren Zustimmung des Berührenden wie des Sichberührenlassenden. Denn sowohl das Heilsame als auch das unter Umständen Traumatisierende findet sich im Leibgedächtnis gespeichert und zeigt sich körperlich. Dieses implizite Körperwissen kann sich durch Berührung öffnen.
2.1.3Eigentümlichkeit von Berührung als anthropologische Konstante
Maurice Merleau-Ponty unterscheidet die Wahrnehmung von Gegenständen und der des eigenen Leibes anhand der Selbstberührung (Merleau-Ponty, 1945/2004, S. 118): »Berühre ich meine rechte Hand mit der linken, so hat der Gegenstand rechte Hand die Eigentümlichkeit, auch seinerseits die Berührung zu empfinden.« Dabei ist es nicht möglich, die Berührung zugleich als berührende und berührte Person wahrzunehmen. Darum spricht Bernhard Waldenfels von einer »Differenz im Leib« (Waldenfels, 2000, S. 37). Diese Fähigkeit zur Doppelempfindung und zur Selbstreflexion gehört zur Grundcharakteristik leiblichen Existierens. Die Selbstberührung ist ungleich komplexer als die Berührung eines Gegenstandes. Nur die Berührung eines anderen lebendigen Körpers, zum Bespiel in der Geste des Händedrucks, ist noch komplexer, denn die fremde Hand ist nicht Teil des eigenen Leibes, sie ist aber auch nicht einfach ein Ding oder Gegenstand (Stoller, 2010). Diese komplexe Ambiguität schwingt in jeder Berührung eines Lebewesens mit.
Zudem sind Menschen von Geburt an mit einer anthropologisch-körpersprachlichen Grundausstattung versehen, über die sie nicht nachdenken, die Teil des spontanen, verlässlichen Ausdrucksreservoirs ist (Sollmann, 2016, S. 25). Berührung ist unabdingbar. So betont der bekannte Körperpsychotherapeut Thomas Harms, dass der Aufbau einer Beziehung zwischen Eltern und ihren neugeborenen Kindern ohne Körperberührung nicht denkbar ist. Dabei legen die Ergebnisse der modernen Säuglings- und Bindungsforschung aber nah, dass nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität der Berührung entscheidet, ob sie ihren Zauber entfaltet und die Bindung nachhaltig gestärkt wird (Harms, 2016). Berührung ist damit so etwas wie eine erste Sprache, lange vor dem Sehen, dem Sprechen und vor bewusster Reflexion (Atwood, 2000). So ist das In-der-Welt-Sein immer schon In-Berührung-Sein mit etwas oder jemand. Gerade darum ist ein »Nähe- oder Berührungsverbot«, wie wir es in den Zeiten der Covidpandemie erlebt haben, so einschneidend.
2.1.4Soziale Ambivalenzen – Berührung als Problem
Betrachten wir kurz die Zeit, die wir in der Covidpandemie durchlebt haben: Berührung in Zeiten von Covid. Die Philosophin Svenja Flaßpöhler wies auf die soziale Ambivalenz hin: Sie meint, dass nicht wenigen Menschen die Maßnahmen recht waren, sie diese als Erleichterung empfanden, denn es gebe eine – so Elias Canetti – anthropologisch begründete Berührungsangst (Flaßpöhler, 2021, S. 26). Im Wort des An-Greifens ist diese Doppeldeutigkeit schon enthalten. Wir hungern nach Berührung und fürchten uns zugleich vor ihr.
In den Zeiten von Corona wurde jegliche Berührung und körperliche Nähe hochproblematisch und das Grundthema »Berührung und Nähe als Gefahr und Zumutung« gesetzlich verankert. Berührungs- und Näheverzicht wurde mathematisiert und gesetzlich geregelt: zwei Meter Abstand, Babyelefant, möglichst keine sozialen Kontakte, Lockdown und Quarantäne. In Zuspitzung: Menschen sterben lassen ohne Kontakt zu ihren Liebsten. Der Gewinn von »hygienical correctness«-Regelungen (Böhme, 2019, S. 19) dieser Art ist klar: Sie dienen der Entlastung von Unsicherheit sowie inneren Ambivalenzen und der Herstellung von Sicherheit. Dabei vergaß man allerdings die fehlende Sicherheit auf einer darunterliegenden Ebene, die im Körperleiblichen abgespeichert ist: nämlich die Bindungssicherheit, die auf angemessenen Näheerfahrungen und Berührungen beruht.
Diese Bindungssicherheit drückt sich durch viele kleine, unscheinbare Näheerlebnisse und Mikroberührungen aus. Wir wissen heute, wenn keine Bindungssicherheit gegeben ist, dann ist das Explorationsbedürfnis gehemmt und damit das Bedürfnis nach Wachstum, Lebendigkeit, Entwicklung, Heilung. Eine Hemmung dieser Bedürfnisse macht Angst. Wir bekommen keine hundertprozentige Sicherheit.
Inzwischen merken wir auch einige Folgen dieser Zeit des Abstandsgebots: vom Anstieg der depressiven Erkrankungen über die großen Problemen für die Jugendliche und Kinder sowie der schlechteren Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen bis hin zu den Unsicherheiten in den Begrüßungsritualen.