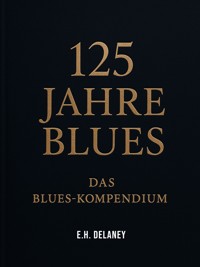Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte von Bessie Smith, der ungezähmten "Kaiserin des Blues" – einer Frau, die ihre Stimme als Waffe im Kampf gegen Armut und Rassismus einsetzte. Hinweis des Verlags: Dieser Roman basiert auf den biografischen Stationen der historischen Bessie Smith , jedoch sind die Figuren, Dialoge und viele der beschriebenen Ereignisse frei erfunden oder literarisch verändert. Er ist ein fiktionales Porträt, das ihre Welt und ihre Haltung erzählerisch erfahrbar machen soll. Von den staubigen Gleisen Chattanoogas und den harten Vaudeville-Bühnen des Jim-Crow-Südens bahnt sich Bessie ihren Weg nach New York. Sie kämpft sich durch die Speakeasies der Prohibitionszeit, erobert Columbia Records mit einem Millionen-Hit und wird zur bekanntesten Schwarzen Künstlerin Amerikas. Doch Ruhm ist ein doppelter Käfig: Er fesselt sie an den eifersüchtigen Manager Jack Gee und verleitet sie zu einem exzessiven Leben voller Whiskey und freier Liebe. Als die Große Depression das Land lähmt und die Börse krachend fällt, singt Bessie den prophetischen Song Nobody Knows You When You're Down and Out. Der Aufstieg ist vorbei. Der harte Kampf ums Überleben beginnt. Ein Epos über Wut, Freiheit und die unsterbliche Macht des Blues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bessie – Stimme des Blues
Von den Gleisen Chattanoogas zu den Bühnen Harlems
Eleanor Helena Delaney
1. Auflage – © 2025
Vorwort
Die folgende Geschichte basiert auf dem Leben der Blues-Sängerin Bessie Smith, deren Stimme und Auftreten zu Beginn des 20. Jahrhunderts Musikgeschichte geschrieben haben. Viele ihrer biografischen Stationen – ihre Herkunft aus dem Süden der USA, ihre frühen Jahre mit Wandertruppen, ihr Aufstieg zu einer der bekanntesten Künstlerinnen ihrer Zeit – bilden den historischen Hintergrund dieses Romans.
Trotzdem handelt es sich nicht um eine biografische Nacherzählung. Die Figuren, Dialoge und viele der beschriebenen Ereignisse sind teilweise frei erfunden oder literarisch verändert. Sie sollen kein genaues Bild der historischen Person zeichnen, sondern ermöglichen, sich ihrer Welt, ihren Konflikten und ihrer Haltung erzählerisch zu nähern.
„Bessie – Stimme des Blues“ ist damit eine Mischung aus Fakt und Fiktion – ein Roman, der sich an historischen Linien orientiert, aber eigene Wege geht, wenn es um innere Erfahrungen, Beziehungen und Motive geht. Die Geschichte erhebt keinen Anspruch auf historische Vollständigkeit, sondern versucht, das Leben und die Zeit dieser außergewöhnlichen Frau in einer erzählerischen Form erfahrbar zu machen.
Prolog – Nobody Knows You
Chattanooga, 1930Der Regen fiel schräg, als wolle er etwas verbergen. Vor der Bar hing ein Schild, das nur noch halb leuchtete – ein „O“ brannte, das „P“ nicht mehr. Drinnen roch es nach Rauch, kaltem Fett, billigem Parfum und dem, was Menschen Hoffnung nennen, wenn sie sie nicht mehr erkennen. Der Pianist rieb sich die Hände, klopfte einmal auf die Tasten, als wollte er sich selbst vergewissern, dass Musik noch möglich war. Bessie Smith saß hinten, den Hut tief im Gesicht, die Lippen um ein Glas, das längst leer war. Niemand sah sie an. Kaum jemand wusste, wer sie war.
Vor nicht einmal fünf Jahren hatte sie Säle gefüllt, die so hell waren, dass die Lichter bis in die Zeitungsspalten reichten. Jetzt war sie hier, in einem Keller in Tennessee, und sang wieder für Münzen, wie damals auf der Ninth Street, nur dass der Glanz der Vergangenheit das Licht verschluckte. „Noch ein Lied, Miss Smith?“ fragte der Pianist. Sie nickte, stand langsam auf, zog die Handschuhe aus, als würde sie eine Haut abstreifen.
„Nobody Knows You When You’re Down and Out,“ sagte sie, mehr zu sich selbst als zu den anderen. „Langsam, Baby. Und ehrlich.“ Der Pianist nickte, die Finger suchten den Anfang.
Die ersten Töne waren wie Schritte auf nassem Asphalt. Dann kam ihre Stimme – tiefer als früher, rauer, aber voll, satt, wie der Klang einer alten Flasche, die im Dunkeln gegen die Wand rollt. Sie sang, und der Raum hielt den Atem an. Ihre Stimme war nicht nur Schmerz, sie war Erinnerung. Erinnerung an Zeiten, in denen Musik die einzige Währung war, die Schwarze Menschen im Süden besaßen. Chattanooga hatte sie geformt – der Lärm der Gleise, die Predigten vom Sonntag, das Pfeifen der Dampfloks, die Menschen fortbrachten, weg von der Baumwolle, hin zu den Fabriken, zu den Städten im Norden, wo angeblich Gerechtigkeit wartete.
Sie sang über Reichtum, der verschwand, über Freunde, die mit dem Geld gingen, über Lachen, das nachhallte, bis es sich selbst vergaß. Aber zwischen den Zeilen war mehr: die ganze Bewegung eines Volkes, das aus dem Staub aufbrach. The Great Migration nannten die weißen Journalisten es. Für sie war es nur ein Strom von Arbeitern. Für Bessie war es Familie, war Flucht, war Rhythmus.
Als sie die Zeile „Nobody knows you…“ wiederholte, sah sie in die Gesichter. Ein alter Mann am Tresen nickte. Eine Frau mit einem Schal vor dem Gesicht wischte sich über die Wange. Ein Junge klopfte mit der Schuhspitze den Takt. Es war nicht Ruhm. Es war Verbindung. Und das war mehr, als Ruhm je gewesen war.
Nach dem letzten Ton blieb es still. Dann Applaus, unkoordiniert, aber echt. Der Pianist grinste. „Du hast sie wieder,“ sagte er leise. – „Ich hatte sie nie,“ sagte sie. – „Dann hattest du sie alle.“
Sie nahm das Glas, das ihr gereicht wurde, roch daran, trank. Whiskey, stark und schwarz, wie die Nächte, in denen Musik das einzige Gesetz war. Prohibition nannten sie das neue Jahrzehnt. Verbot auf Papier, Geschäft auf der Straße. In den Speakeasies spielte der Blues lauter, als das Gesetz ihn fassen konnte. Und Bessie hatte in jedem von ihnen gestanden – in New Orleans, Memphis, Chicago, Harlem.
Damals, vor zehn Jahren, war der Norden noch ein Versprechen gewesen. „Komm rauf, Baby,“ hatte Ma Rainey gesagt, „im Norden zahlen sie, was sie fühlen.“ Also war sie gekommen, mit einem Koffer, einer Stimme und einem Bruder, der ihre Welt trug. In Philadelphia roch der Asphalt nach Kohle und Hoffnung. Harlem war heller, härter, voller Gedichte und Gesichter, die glaubten, dass das Singen eine Form von Protest war.
Jetzt, 1930, war all das wieder weit weg. Die „Roaring Twenties“ waren verklungen, die Börse gefallen, und die Radiostationen spielten Swing statt Blues. Der Norden war nicht mehr liberal, der Süden nicht weniger rassistisch – nur anders organisiert.
„Schöner Song,“ sagte Jack, als sie die Bühne verließ. Er lehnte an der Wand, den Hut schief, den Blick trüb. – „Ich sing nicht schön,“ sagte sie. – „Dann echt.“ – „Ich sing, weil ich muss.“ – „Dann musst du weiter müssen.“
Draußen hatte der Regen aufgehört, aber die Straßen glänzten, als wären sie noch nass. Sie blieb stehen, sah auf das Pflaster, das die Lichter spiegelte. Irgendwo hörte man einen Zug. Der Klang war altvertraut, fast tröstlich. Sie dachte an Andrew. An die Blechdose, in die sie als Kinder Münzen gesungen hatten. „Dieser Takt…“ flüsterte sie. „Der lag nur in Andrews Dose.“
Sie drehte sich um, sah die Bar noch einmal an – ein Ort, der keine Erinnerung wollte, aber eine bekam. „Morgen,“ sagte sie zu Jack, „singe ich’s ihnen wieder vor.“ – „Dass dich keiner kennt?“ – „Nein. Dass ich’s trotzdem bin.“
Sie gingen die Straße hinunter, vorbei an Schildern, auf denen stand „Colored Entrance“ und „No Spirits Sold Here“, und sie lachte. „Sie lügen sogar auf Holz,“ sagte sie. Jack nickte, ohne hinzusehen. Sie blieb kurz stehen, sah nach Westen. In der Ferne glomm der Himmel über den Schienen.
Das Licht dort… das ist nicht der Abend, das ist der Anfang.
Der Zug würde bald kommen. Sie hörte ihn schon. Und während der Klang lauter wurde, dachte sie an den Süden, an Ma, an die Bühne, an die Flasche, an Andrew. Und an den Ton, der noch immer in der Dose schlief.
Dann ging sie los. Der Regen kam zurück, aber diesmal machte er keinen Lärm. Nur ein gleichmäßiges Trommeln – wie ein Herz, das noch schlägt.
Kapitel 1 – Dreck und Feuer
Chattanooga, 1907. Der Morgen roch nach Kohle und abgestandenem Kaffee. Die Züge heulten, als wollten sie den Schlaf aus den Hütten treiben. Die Sonne hatte es eilig, aber das Licht kam selten bis in die Ninth Street. Da, wo Bessie Smith aufwuchs, war alles laut und schief – das Pflaster, die Stimmen, die Hoffnung. Die Häuser standen dicht an dicht, als stützten sie sich gegenseitig, um nicht einzustürzen. Die Straße gehörte denen, die nichts hatten, und die Musik denen, die das nichts sagen mussten.
Bessie war acht, vielleicht neun. Sie wusste es nicht genau. Alter war ein Luxus, den sich Arme nicht merken konnten. Der Vater war früh gestorben, der Prediger mit der lauten Stimme, der den Himmel in jedes Haus tragen wollte. Danach kam kein Himmel mehr, nur Regen. Die Mutter folgte bald. Krankheit, sagten die Nachbarn. Hunger, sagte Andrew, der älteste Bruder. Seitdem waren sie allein. Sechs Kinder, ein Zimmer, ein geborgter Herd.
Andrew war sechzehn, mager, klug, aber ohne Zukunft. Er trug Hemden, die anderen gehörten, und sprach, als wolle er vergessen, dass er selbst Kind war. Er war der, der entschied, wann sie aßen, wann sie sangen, wann sie losmussten. „Aufstehen“, sagte er an jenem Morgen. „Es gibt Züge.“ – „Ich mag Züge nicht“, murmelte Bessie. – „Dann sing lauter, dass sie dich übertönen.“
Sie gingen zur Ninth Street, wo Händler ihre Waren ausschütteten und Prediger ihre Stimmen verloren. Chattanooga war ein Knotenpunkt. Jeder zweite Zug brachte jemanden fort, jeder dritte brachte jemanden zurück, der wünschte, er wäre weggeblieben. Die Afroamerikaner zogen nach Norden – Chicago, Philadelphia, New York –, dem Gerücht nach Orte mit Arbeit, Geld, Würde. The Great Migration nannte es später die Geschichte. Für Bessie war es einfach: Bewegung.
Andrew stellte die alte Blechdose hin, die sie vom Schrottplatz hatten, beulte sie ein wenig aus. „Klingt besser, wenn’s nicht ganz rund ist,“ sagte er. Dann nickte er ihr zu. „Sing.“ – „Was?“ – „Was du fühlst.“ – „Ich fühl Hunger.“ – „Dann sing Hunger.“
Und sie sang. Erst leise, dann lauter. Die Stimme kam rau, ungeschliffen, aber echt. Kinder blieben stehen, Frauen nickten, Männer warfen Münzen. Der Blues war noch kein Begriff, aber er war schon da – zwischen Staub, Schweiß und dem Zittern der Dampfpfeifen. „Du bist laut,“ sagte Andrew. – „Du sagtest, ich soll.“ – „Ich meinte laut wie die Welt, nicht laut wie Ärger.“ – „Ist da ein Unterschied?“ – „Später.“
Am Abend zählten sie die Münzen. Zweiundvierzig Cent. Genug für Brot und ein Stück Fleisch. Bessie grinste. „Ich kann Geld machen.“ – „Du kannst Stimmen machen,“ sagte Andrew. – „Ist das besser?“ – „Bleibt länger.“
Nachts lag sie wach. Durch die dünne Wand hörte sie den Wind, das Rattern der Züge, das Summen der Stadt. Sie stellte sich vor, in einem dieser Waggons zu sitzen, weit weg von hier, irgendwo, wo niemand sie kennt. „Wenn ich groß bin,“ flüsterte sie, „kauf ich mir einen Zug.“ – „Zum Fahren?“ – „Zum Singen.“
Am nächsten Tag kam Maud, eine Nachbarin, mit einer Gitarre vorbei. Sie spielte auf den Stufen, sang von Männern, die gingen, und Frauen, die blieben. Bessie hörte zu, bewegte den Fuß im Takt. „Das ist schön,“ sagte sie. – „Schön ist nicht das Wort,“ meinte Maud. – „Was dann?“ – „Wahr.“. Sie begriff damals, dass Musik mehr war als Klang. Es war Sprache, Gebet, Waffe. Und jeder, der nichts hatte, hatte wenigstens ein Lied.
Ein paar Wochen später kam ein Prediger durch die Straße, ein weißer Mann, der Bibeln verkaufte. „Ihr solltet beten, nicht singen,“ sagte er. Bessie lachte. „Ich tu beides, Sir. Nur lauter.“
Der Mann schnaubte, Andrew zog sie weg. „Manchmal ist Schweigen besser,“ sagte er. – „Dann hört keiner.“ – „Vielleicht muss man nicht immer gehört werden.“ – „Doch,“ sagte sie. „Sonst denkt Gott, du bist still.“
Der Sommer wurde heiß. Die Hitze lag über den Gleisen wie ein Versprechen. Immer mehr Züge fuhren nach Norden. Familien gingen. Freunde verschwanden. „Wohin?“ fragte Bessie. – „Weg,“ sagte Andrew. – „Kommt man da an?“ – „Manchmal.“
Er wollte selbst gehen, hatte davon geträumt, in einer Fabrik in Pittsburgh zu arbeiten. Doch Bessie war zu klein, zu eigensinnig, um allein zu bleiben. Also blieb er auch. Und wenn er abends auf der Treppe saß, die Gitarre auf dem Knie, sah er sie an und dachte: Wenn einer von uns hier rauskommt, dann sie.
Eines Nachts, als der Sturm die Dächer scheppern ließ, saßen sie am Fenster. „Du hast Feuer,“ sagte Andrew. – „Brennen tut weh.“ – „Wenn du’s lernst, tut’s gut.“ Sie sah hinaus, wo die Blitze die Gleise streiften, und nickte. „Dann lern ich’s.“
Am nächsten Morgen sang sie wieder auf der Ninth Street. Diesmal ohne Schüchternheit. Die Stimme trug über den Lärm der Händler, über das Rattern der Züge, über das Gebrüll der Welt. Ein Mann blieb stehen, warf eine Münze, blieb dann wieder stehen. „Du hast was,“ sagte er. – „Was?“ – „Etwas, das Geld macht, ohne zu stehlen.“
Später fragte sie Andrew, was das bedeute. Er sagte: „Dass du gehen wirst.“ Sie lachte. „Ich geh, wenn ich’s kann.“ – „Du kannst schon.“ – „Dann wart ich auf den richtigen Zug.“
Und irgendwo, in einem Büro in New Orleans, saß zur gleichen Zeit Ma Rainey, blätterte durch ein Notizbuch, las einen Namen, den sie bald hören würde.
Der Tag endete wie er begonnen hatte – mit Lärm, Rauch und dem Geruch von Kohle. Bessie lag im Bett, die Hände unter dem Kopf, und summte. Der Rhythmus kam aus der Dose, aus der Straße, aus dem Hunger. Dreck und Feuer, dachte sie. Mehr braucht man nicht, um anzufangen.
Kapitel 2 – Die Gabelung