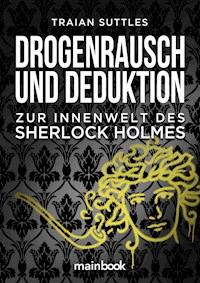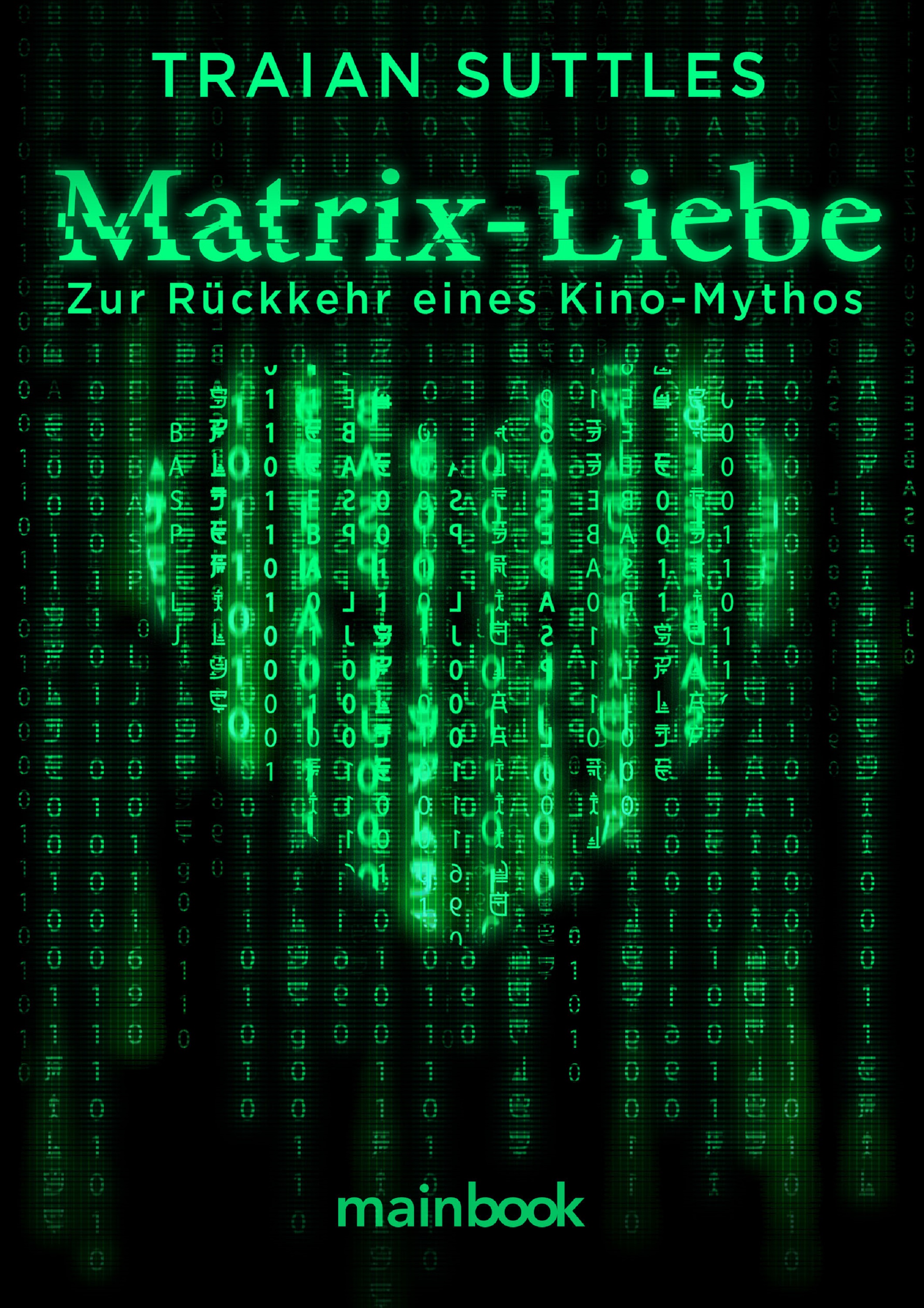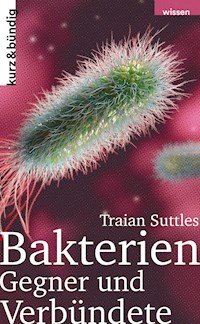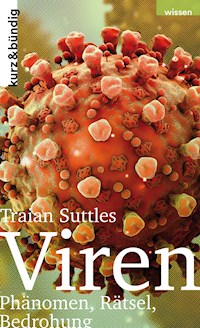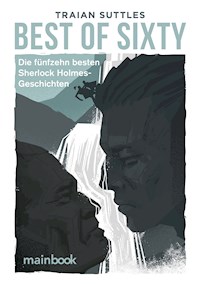
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Seit vor 135 Jahren die erste Sherlock Holmes-Geschichte erschien, fasziniert diese archetypische Detektivgestalt eine riesige Leser- und Fangemeinde auf der ganzen Welt. Anhand fünfzehn ausgewählter Fälle zeigt Holmes-Exeget Traian Suttles, dass auch in einigen der bekanntesten kanonischen Erzählungen noch überraschende Entdeckungen möglich sind. Die von ihm präsentierten, erheblich verfeinerten und z.T. gänzlich revidierten Lesarten dürften von der internationalen Sherlockianer-Community als Durchbruch zu einem bisher unerreichten Textverständnis wahrgenommen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Traian Suttles
BEST OF SIXTY
Die fünfzehn besten Sherlock Holmes-Geschichten
eISBN 978-3-948987-27-5
Copyright © 2022 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung und -motiv: Lukas Hüttner
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere Bücher:
www.mainbook.de
Der Autor
Traian Suttles ist promovierter Biologe und verfasste zuletzt die Bücher Viren – Phänomen, Rätsel, Bedrohung sowie Bakterien – Gegner und Verbündete für die Wissensreihe des kurz & bündig-Verlages (Basel). Im Frankfurter mainbook-Verlag hat er neben Best of Sixty bereits die Sherlock Holmes-Studie Drogenrausch und Deduktion (2017) vorgelegt. Dort erschien auch seine detaillierte Analyse der »Matrix«-Filmtrilogie (Matrix-Liebe. Zur Rückkehr eines Kino-Mythos, 2020).
Inhalt:
Vorwort
Zur Einführung
1 – Divenkrieg: A Scandal in Bohemia (Juli 1891)
2 – Stolz und Fehlurteil: The Beryl Coronet (März 1892)
3 – Abgehängtes Meisterwerk: Silver Blaze (Dezember 1892)
4 – Der Annie Morrison-Faktor: The Reigate Squires (Juni 1893)
5 – Geheime Offenbarungen: The Naval Treaty (Oktober/November 1893)
6 – Holmes’ »awful abyss«: The Final Problem (Dezember 1893)
7 – Auferstanden aus Fiktionen: The Empty House (September 1903)
8 – Das Böse außer Kontrolle: The Norwood Builder (Oktober 1903)
9 – Unbekannte Größen: The Three Students (Juni 1904)
10 – Letzte Schritte: The Golden Pince-Nez (Juli 1904)
11 – Erzähler versus Detektiv: Abbey Grange (September 1904)
12 – Lady Hildas Gegenangriff: The Second Stain (Dezember 1904)
13 – Der Tod der kleinen Leute: The Bruce Partington Plans (Dezember 1908)
14 – Erst die Pflicht: The Problem of Thor Bridge (Februar/März 1922)
15 – Das Pfeilgift der Liebe: The Sussex Vampire (Januar 1924)
Deutschsprachige Übersetzungen der fünfzehn Originalgeschichten
Literaturverzeichnis
The whole Sherlock Holmes saga is triumphant illustration ofart’s supremacy over life.
(Christopher Morley: »In memoriam Sherlock Holmes«,The Saturday Review of Literature 2.8.1930)
Vorwort
Die zwischen 1887 und 1927 erschienenen Sherlock Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle sind bis heute ein popkulturelles Phänomen. Üblicherweise als Trivialliteratur klassifiziert, hat der aus sechzig Texten bestehende Holmes-Kanon deutlich mehr zu bieten, als man bei erster Lektüre vermuten könnte: Sogar ein anerkannter „Hochliterat“ wie T. S. Eliot behauptete von sich, die Holmes-Storys alle fünf Jahre durchzugehen (er wurde sechsundsiebzig Jahre alt, dürfte in seinem Leben also mehr als zehn solcher „Zyklen“ gefahren haben). Woran es liegen könnte, merkt man u.a., wenn man über eines der vielen Holmes’schen Paradoxa stolpert, wie etwa »Die Welt ist voll von offensichtlichen Dingen, die zufällig niemand je bemerkt«. Mit solchen, oft beiläufig geäußerten Sätzen kommt der Meisterdetektiv manch späteren, real existierenden Geistesgrößen nahe, oder ihnen schlicht zuvor (in diesem Fall Wittgensteins Behauptung aus den »Philosophischen Untersuchungen«, dass die wichtigsten Dinge durch ihre Alltäglichkeit verborgen seien).
Das vorliegende Buch ist für Leser gedacht, die sich im T. S. Eliot-Modus befinden: also solche, die „ihren“ Sherlock Holmes bereits kennen, aber davon ausgehen, bei wiederholter Lektüre noch manch Verborgenes ans Licht bringen zu können. Was davon akademisch verwertbar sein könnte oder den Paralleluniversen des Sherlockian Game vorbehalten bleibt, mögen die jeweiligen Nutzergruppen unter sich ausmachen. Der Autor hat, wie schon beim Vorgänger »Drogenrausch und Deduktion« (2017), die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheiten der Sherlockologie gleichermaßen in Anspruch genommen. Großer Dank gebührt Sherlock Holmes-Experte Ralph Ilmer für das sorgfältige Gegenlesen der einzelnen Kapitel; jedes von ihnen hat davon profitiert, einige in erheblichem Maße.
Traian Suttles, Juni 2021
Zur Einführung: Vote Sherlock!
Im Juni 1927 kam The Case-Book of Sherlock Holmes in den Buchhandel, ein letzter, zwölf Geschichten umfassender Sammelband, mit dem die seit 1887 bestehende Reihe um die gemeinsamen Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson ihren Abschluss fand. Kurz vor dem Erscheinen, im März und Juni 1927, veröffentlichte Arthur Conan Doyle im englischen Strand Magazine zwei Artikel, in denen er seiner Leserschaft die Idee einer persönlichen Holmes-Bestenliste auseinandersetzte. Zunächst waren die Leser aufgefordert, Doyles zwölf Lieblingserzählungen aus der Sherlock Holmes-Reihe zu erraten (ein Einsender kam auf zehn Treffer; er durfte sich über einen Geldpreis von £100 freuen). Mit Aufdeckung seiner Favoritenliste erläuterte Doyle dann das Zustandekommen seiner Auswahl (Doyle 1927; vgl. auch Bigelow 1976).
Seitdem sind in unregelmäßigen Abständen Best of Sherlock Holmes-Abstimmungen durchgeführt worden, wenn auch nicht unter gleichlautenden Bedingungen. Bereits beim ersten, von Conan Doyle initiierten Ranking waren die Geschichten aus dem aktuellen, neu angekündigten Holmes-Sammelband nicht zur Wahl zugelassen, und außerdem wurden die vier Holmes-Romane ausgeschlossen, sodass von den insgesamt sechzig kanonischen Fällen des Londoner Meisterdetektivs nur vierundvierzig bewertet werden durften. Die unter diesen Vorgaben zusammengestellte Bestenliste Conan Doyles sah wie folgt aus:
Arthur Conan Doyle 1927
1 – The Speckled Band
2 – The Red-Headed League
3 – The Dancing Men
4 – The Final Problem
5 – A Scandal in Bohemia
6 – The Empty House
7 – The Five Orange Pips
8 – The Second Stain
9 – The Devil’s Foot
10 – The Priory School
11 – The Musgrave Ritual
12 – The Reigate Squires
Doyle sah sich später veranlasst, seine Liste zu ergänzen (vgl. Bigelow 1976, S.47), mit folgenden Geschichten auf den Plätzen dreizehn bis fünfzehn:
13 – Silver Blaze
14 – The Bruce Partington Plans
15 – The Crooked Man
In einer ersten Nachfolge dieses initialen Sherlock-Holmes-Rankings entschieden sich die Veranstalter – keine geringeren als die elitären Baker Street Irregulars (BSI) – bei den Vorgaben der Doyle-Wahl zu bleiben, d.h. die zwölf Geschichten aus dem Case-Book sowie die vier Romane erneut außen vor zu lassen. Ermöglicht, wenn nicht sogar angestrebt wurde ein direkter Vergleich mit Conan Doyle,1 und wie sich zeigte, war das Ergebnis dieser 1944 durchgeführten Abstimmung sehr ähnlich. Nur zwei der von Doyle gelisteten Geschichten schafften es bei den BSI-Mitgliedern nicht in die Top Fünfzehn (The Priory School und The Reigate Squires). Die ersten dreizehn Plätze der BSI-Wahl lauteten:
Baker Street Irregulars 1944
1 – The Speckled Band
2 – A Scandal in Bohemia
3 – The Red-Headed League
4 – Silver Blaze
5 – The Dancing Men
6 – The Musgrave Ritual
7 – The Five Orange Pips
8 – The Final Problem
9 – The Empty House
10 – The Bruce Partington Plans
11 – The Second Stain
12 – The Devil’s Foot
13 – The Engineer’s Thumb
Platz vierzehn teilten sich stimmengleich drei Geschichten, nämlich Charles Augustus Milverton, The Golden Pince-Nez und The Six Napoleons. Zusammen mit The Engineer’s Thumb auf dem dreizehnten Rang waren dies gegenüber Doyles Liste die einzigen Neuzugänge.
Bereits bei dieser zweiten Wahl kristallisierte sich ein Muster heraus, das bis in die Gegenwart Bestand hat. Insbesondere wurde Conan Doyles Favorit The Speckled Band in allen nachfolgenden Abstimmungen auf den ersten Platz gehievt, d.h. auch nachdem die Geschichten aus dem Case-Book zur Wahl zugelassen wurden (was in sämtlichen Wahlen seit 1954, wie sie bei Stock 1999a/b dokumentiert sind, der Fall gewesen ist2). Ebenso belegte Doyles Nummer zwei The Red-Headed League durchgehend den zweiten Platz, lediglich mit Ausnahme oben angeführter 1944er BSI-Abstimmung. Gemessen an Doyles 1927er-Ranking und der 1944er-Nachfolgewahl konnten sich später nur noch wenige Geschichten neu unter den Top Fünfzehn platzieren: 1954 drang The Blue Carbuncle auf Platz sechs ein, stieg 1959 auf einen geteilten dritten Platz auf und war auch in den Abstimmungen der Jahre 1989 und 1999 weit oben platziert, nämlich an vierter beziehungsweise fünfter Stelle.3 Ebenfalls 1954 kam The Naval Treaty auf Platz fünfzehn, erreichte 1959 Platz elf, 1989 Platz vierzehn und 1999 wieder den elften Rang. Einziger Neuling der 1959er-Abstimmung war The Man with the Twisted Lip auf einem geteilten zwölften Platz, eine Position, die 1989 mit Rang dreizehn und 1999 mit einem neuerlichen zwölften Platz gehalten wurde. 1989 sah man, verglichen mit den vier vorangegangenen Rankings, keine Neulinge in den Top Fünfzehn, während 1999 erstmals eine Geschichte aus dem 1927 und 1944 nicht berücksichtigten Case-Book hoch genug aufstieg: The Problem of Thor Bridge belegte den dreizehnten Platz.
Mit den fünf Wahlresultaten, welche 1944, 1954, 1959, 1989 und 1999 zum Vergleich mit der von Doyle 1927 vorgelegten Liste ermittelt wurden, folgten die Sherlock Holmes-Anhänger aus aller Welt dem Erfinder des Detektivs also so weit, dass bislang nur dreiundzwanzig Geschichten eine Top Fünfzehn-Platzierung erreichten (entweder aus einem Pool von vierundvierzig oder sechsundfünfzig wählbaren Storys – im letztgenannten Fall erreichten deutlich weniger als 50% aller Geschichten einen Top Fünfzehn-Stellenwert). Stock (1999a) erstellte aus allen bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnissen ein Durchschnittsranking und kam für die ersten zwölf Plätze zu folgendem Resultat:
Historische Durchschnittswertung Stock 1999
1 – The Speckled Band
2 – The Red-Headed League
3 – A Scandal in Bohemia
4 – Silver Blaze
5 – The Musgrave Ritual
6 – The Blue Carbuncle
7 – The Dancing Men
8 – The Bruce Partington Plans
9 – The Final Problem
10 – The Empty House
11 – The Six Napoleons
12 – The Five Orange Pips
Es folgte ein geteilter dreizehnter Platz mit The Devil’s Foot und The Priory School, sowie ein geteilter vierzehnter mit The Second Stain und The Naval Treaty.
Ferner erläutert Stock (ebd.), dass die Wahl von 1999 nach Stimmenanzahl die weitaus größte war, die jemals durchgeführt wurde (und dass sich die Bildung eines Durchschnittsrankings aus diesen und anderen Gründen als problematisch erweist, etwa unterschiedlicher Auswertungsmodi). Aufgrund der vielen Einsendungen, die aus der ganzen Welt zur 1999er-Abstimmung eingingen, waren dem Ausrichter einige vertiefende Betrachtungen zum Beliebtheitsgrad der Geschichten in verschiedenen Ländern möglich, aber auch zu den unterschiedlichen Vorlieben der männlichen und weiblichen Leserschaft. In der Gesamtwertung lauteten die ersten dreizehn Plätze wie folgt:
Baker Street Journal 1999
1 – The Speckled Band
2 – The Red-Headed League
3 – A Scandal in Bohemia
4 – Silver Blaze
5 – The Blue Carbuncle
6 – The Musgrave Ritual
7 – The Final Problem
8 – The Empty House
9 – The Dancing Men
10 – The Six Napoleons
11 – The Bruce Partington Plans
12 – The Man with the Twisted Lip
13 – The Problem of Thor Bridge
Den vierzehnten Rang teilten sich The Devil’s Foot und The Naval Treaty. Stock (1999b) stellte gesonderte Ergebnisse innerhalb der weiblichen und der männlichen Lesergruppe gegenüber und konnte auf diese Weise einige deutliche Abweichungen aufzeigen:
Beliebteste Geschichten bei Frauen
Platzierung bei Männern
1 – A Scandal in Bohemia
3
2 – The Blue Carbuncle
5
3 – The Speckled Band
1 (geteilt)
4 – Silver Blaze
4
5/6 (geteilt) – The Red-Headed League
1 (geteilt)
5/6 (geteilt) – The Dancing Men
11
7 – The Musgrave Ritual
6
8 – The Empty House
8
9 – The Final Problem
7
10/11 (geteilt) – Charles Augustus Milverton
18
10/11 (geteilt) – The Copper Beeches
19
12 – The Solitary Cyclist
23
13 – The Devil’s Foot
15
14 – The Second StainThe Priory School)
16 (geteilt mit
15/16 (geteilt) – The Naval Treaty
14
15/16 (geteilt) – The Six Napoleons
9
In dieser Gegenüberstellung fallen besonders die Abweichungen zwischen dem zehnten und zwölften Platz auf, also die von der weiblichen Leserschaft ungewöhnlich hoch bewerteten Geschichten Charles Augustus Milverton, The Copper Beeches und – am auffälligsten – The Solitary Cyclist. Auch wenn die von Stock untersuchte Stimmenverteilung unter den verschiedenen Wählergruppen einige interessante Einzelheiten zutage fördert, so gewinnt man insgesamt doch den Eindruck, dass künftige Abstimmungen das seit 1927 vorliegende Bild nicht besonders verändern werden: Es gibt eine Art „Grundstock“ essenzieller Holmes-Geschichten, die sich aus etwa einem Drittel oder einem Viertel der sechsundfünfzig kurzen Erzählungen zusammensetzen – etwa so, wie man unter den vier Holmes-Romanen stets nur einen als lesenswert hervorhebt, The Hound of the Baskervilles.
Während an der genannten Beurteilung der vier Romane kein Zweifel besteht, ist es im Falle der Kurzgeschichten bedauerlich, dass einige von ihnen bei Best of-Zusammenstellungen regelmäßig außerhalb der vorderen Plätze verbleiben. Zwar wird von Holmes-Liebhabern zuweilen ein gewisser Qualitätsabfall in den letzten beiden Sammelbänden His Last Bow und The Case-Book of Sherlock Holmes registriert,4 doch auch diese enthalten Geschichten, bei denen man das aus den ersten Sammlungen etablierte Niveau schwerlich in Abrede stellen kann. Doyle selbst (1988, S.97f.) betonte denn auch in seinen Memoiren, dass er gerade beim Verfassen der späteren Holmes-Erzählungen nicht mehr unter finanziellem Druck stand und dies der qualitativen Einheitlichkeit des Kanons zugute kam:
»I was determined, now that I had no longer the excuse of absolute pecuniary pressure, never again to write anything which was not as good as I could possibly make it, and therefore I would not write a Holmes story without a worthy plot and without a problem which interested my own mind, for that is the first requisite before you can interest anyone else. If I have been able to sustain this character for a long time and if the public find, as they will find, that the last story is as good as the first, it is entirely due to the fact that I never, or hardly ever, forced a story. (…) I think (…) that if the reader began the series backwards, so that he brought a fresh mind to the last stories, he would agree with me that, though the general average may not be conspicuously high, still the last one is as good as the first.«
Doyles Worte sollten Ermunterung genug sein, einen neuen Blick auf den Holmes-Kanon zu werfen. Von den fünfzehn Geschichten, die im vorliegenden Buch betrachtet werden, findet sich etwa die Hälfte in den oben aufgeführten Abstimmungsresultaten wieder, während die anderen es – aus welchen Gründen auch immer – bei der Leserschaft schwieriger hatten. Ein Ranking jedoch ist nicht beabsichtigt, die Kapitelfolge gibt stattdessen die zeitliche Abfolge der Erstabdrucke wieder. Eine vergleichende Bewertung ließe sich höchstens anstellen, wenn man nachzählt, wie viele Geschichten den fünf Sammelbänden von Holmes-Erzählungen zuzuordnen sind: Die meisten, nämlich sechs, sind aus The Return of Sherlock Holmes, gefolgt von vier aus The Memoirs of Sherlock Holmes, während die restlichen drei Anthologien mit jeweils zwei (The Adventures of Sherlock Holmes, The Case-Book of Sherlock Holmes) oder nur einer Geschichte (His Last Bow) vertreten sind. Wenn man will, ließe sich auf diese Weise also The Return of Sherlock Holmes (1903) als Hochplateau der Holmes-Reihe auszeichnen, aber die Frage nach einer „besten“ Einzelstory wird hiermit nicht beantwortet. Die Aufgabe, der das vorliegende Buch nachgeht, ist eine andere: Es soll dem Leser zeigen, wie sehr die aufmerksame Lektüre bestimmter Holmes-Meisterzerzählungen bis heute lohnt, und ihm vielleicht dabei helfen, mehr über seine persönlichen Lieblingsgeschichten zu erfahren.
1Vgl. Bigelow 1976, S.47: »On January 14, 1944, despite the regard in which they held Dr Doyle’s judgment, the Baker Street Irregulars decided to poll their own membership with a view to establishing an official aggregate expression of opinion regarding the respective merits of the tales which might stand for all time or at least another seventeen years.«
2In diesen bei Stock (1999a/b) zitierten Abstimmungen wurden die vier Holmes-Romane von den Kurzgeschichten separiert. Hingegen erwähnt Bigelow (1976, S.49f.) die 1959 veranstaltete Wahl einer bedeutenden Sherlock Holmes-Gesellschaft aus Philadelphia, The Sons of the Copper Beeches, bei der auch für die Romane gestimmt werden durfte: Interessanterweise landete dort The Hound of the Baskervilles auf dem ersten Platz, vor The Red-Headed League und The Speckled Band auf den Plätzen zwei und drei. Ebenso konnten sich die Romane The Sign of Four und A Study in Scarlet in den Top Fünfzehn platzieren; ersterer auf einem geteilten sechsten, letzterer auf einem geteilten neunten Rang. Gegenüber Doyles Bestenliste sowie den BSI-Wahlen der Jahre 1944, 1954 und 1959 gab es in diesem Ranking (mit Ausnahme der drei Romane) keine Neulinge auf den ersten fünfzehn Plätzen.
3Ein Grund dafür mag sein, dass sich The Blue Carbuncle im Laufe der Zeit als „Holmes-Weihnachtsgeschichte“ etablierte und in dieser Eigenschaft bei den Lesern an Beliebtheit gewann.
4Umgekehrt legen Sherlockianer aus aller Welt Wert darauf, dass der Kanon keine schlechten Geschichten enthält (etwa Bigelow 1976, S.52: »Let us admit, first of all, that there is no bad Sherlock Holmes story«). In der von Redmond (2016) herausgegebenen Sammlung von Kurzessays wird noch ein Schritt weiter gegangen: About Sixty: Why every Sherlock Holmes Story is the Best.
1. Divenkrieg: A Scandal in Bohemia (Juli 1891)
A Scandal in Bohemia war Arthur Conan Doyles dritter Versuch, seiner Schöpfung Sherlock Holmes breite Aufmerksamkeit zu verschaffen, und bald wurde klar, dass er mit der Veröffentlichung dieser Kurzgeschichte im neu herausgebrachten, abonnentenstarken Strand Magazine sein Ziel erreicht hatte. Gemessen an der Erfolglosigkeit der ersten beiden Holmes-Romane erwiesen sich abgeschlossene kurze Erzählungen in einer Monatsschrift als das optimale Medium für die gemeinsamen Abenteuer des eher ungleichen, aber umso besser harmonierenden Duos aus der Baker Street. Nicht zuletzt nutzte Doyle hier auch die Freiheit, auf zeitliche Kontinuität verzichten zu können: Von einer Strand-Ausgabe zur nächsten präsentierte er den Lesern „beliebig hervorgeholte“ Erinnerungen Watsons, wobei der Doktor entweder Mitbewohner von Holmes oder aber verheiratet und (zwischenzeitlich, wie sich später zeigt) aus der gemeinsamen Junggesellenwohnung ausgezogen ist.5
A Scandal in Bohemia beginnt nach diesem Schema, indem der mittlerweile verheiratete Watson schildert, wie er abends an der ehemaligen gemeinsamen Behausung in 221B vorbeikommt und seinem Freund Holmes einen Besuch abstattet. Den neuen Lesern, wie sie Doyle mit den Abonnenten und Käufern des Strand Magazine gewann, wird hierdurch ein lockerer Anschluss an die beiden Holmes-Romane A Study in Scarlet und The Sign of Four angeboten. Verglichen mit den beiden Vorgängern (und auch den vielen nachfolgenden Geschichten) setzte Doyle aber inhaltlich andere Prioritäten, was A Scandal in Bohemia zu einem aberranten Bestandteil des Kanons macht: Im Verlauf der Handlung werden Holmes’ überragende detektivische Fähigkeiten in vergleichsweise reduzierter Form geschildert, und als Krönung des Ganzen erleben wir einen Meisterdetektiv, der von seinem Observationsobjekt ausgetrickst wird – von einer Frau, Irene Adler.
Es drängt sich auf, in Irene Adler die heimliche Heldin von A Scandal in Bohemia zu sehen. Wie Doyle zu dieser Konzeption kam, ist eher unklar, aber es lassen sich eine Reihe plausibler Gründe anführen. Zum einen darf man vermuten, dass Doyle seine ganz eigenen Überlegungen zu gesellschaftlichen Skandalen, wie sie damals der Presse zu entnehmen waren, in seiner Handlung verarbeitete. Zum anderen dürfte er einkalkuliert haben, dass ein erheblicher Teil der Leserschaft des Strand Magazine weiblich sein und auf die Beschreibung einer Frauenfigur, die dem männlichen Protagonisten erfolgreich trotzt, positiv reagieren würde (zu einer Zeit übrigens, in der England von einer Königin regiert wurde, aber Frauen noch kein Wahlrecht hatten, wie Misri 2016 anmerkt). Im Einführungskapitel haben wir bereits die Auswertung von Stock (1999b) erwähnt, derzufolge A Scandal in Bohemia unter weiblichen Holmes-Fans als beliebteste Erzählung rangiert. Wenn man aber auf Stocks Resultate verweist, dann ist der Vollständigkeit halber zu ergänzen, dass A Scandal in Bohemia auch unter den männlichen Lesern einen erstaunlich starken dritten Platz in der Beliebtheitsskala einnimmt, und ferner, dass bereits Doyle die Geschichte mit einem fünften Platz sehr hoch einstufte.
Diese allgemeine Wertschätzung ist nicht einfach zu erklären, denn im Vergleich zu fast allen anderen Holmes-Erzählungen vermisst man gewisse typische Elemente. Zwar kommt das anfängliche Gespräch zwischen Holmes und Watson, in dem Letzterer die üblichen kleinen Deduktionsspielchen seines Freundes über sich ergehen lassen muss, recht unterhaltsam daher und ist im Hinblick auf die vielen Leser, die den Londoner Meisterdetektiv beim erstmaligen Abdruck der Geschichte noch nicht kannten, genau richtig platziert. Doch beim anstehenden Besuch jenes anonymen adligen Klienten, der sein Erscheinen in der Baker Street brieflich angekündigt und dabei um strengste Diskretion gebeten hatte, wird sich dies ändern. Zwar haben Holmes und Watson noch Zeit, gemeinsam über dessen Brief zu sprechen und zu dem Schluss zu kommen, es mit einem deutschsprachigen Verfasser aus dem Königreich Böhmen zu tun zu haben. Aufgrund welcher Deduktionen es Holmes jedoch schafft, sofort beim Eintreten des maskierten Mannes mit Sicherheit zu schlussfolgern, dass es sich um den König höchstselbst handeln muss, wird nicht aufgedeckt. In anderen Holmes-Geschichten zählt die Erläuterung solch „klientenbezogener“ Deduktionen zu den typischen Grundbausteinen, während diesmal nur das Ergebnis in den Raum gestellt wird, ohne die später sprichwörtlich gewordenen „elementaren“ Überlegungen im Detail anzusprechen.
Noch weniger musterhaft erscheint dann der weitere Verlauf der Handlung. In der Erzählung geht es, anders als in fast allen sonstigen Holmes-Geschichten, nicht um die schrittweise Aufklärung eines geheimnisvollen Verbrechens oder sonstiger unerklärlicher Begebenheiten. Stattdessen soll Holmes dem König von Böhmen eine kompromittierende Fotografie besorgen, die sich in Irene Adlers Besitz befindet und beide als Liebespaar zeigt. Irene Adler ist eine erfolgreiche Opernsängerin – als solche findet sie sich auch in Holmes’ Index, seinen gesammelten Notizen über allerlei Prominente und Straftäter. Mindestens ebenso erfolgreich scheint sie aber als Mätresse zu sein, die sich im vorliegenden Fall vom König hintergangen fühlt und dessen in drei Tagen anstehende „standesgemäße“ Verlobung mit der Veröffentlichung des Fotos zu sabotieren droht. Alle vorangegangenen Versuche des Monarchen, die belastende Aufnahme durch den Einsatz von Agenten zurückzuerhalten, sind gescheitert, sodass als letztes Mittel der consulting detective aus der Baker Street engagiert wird. Holmes nimmt den Auftrag an, und wie die weiteren Geschehnisse zeigen, geht er bei der Suche nach der Fotografie von gerade einmal zwei Prämissen aus. Die erste lautet »Frauen sind von Natur aus Geheimniskrämer, und sie möchten ihre Geheimnisse für sich behalten« („Ein Skandal in Böhmen“, S.27), die zweite »Wenn eine Frau glaubt, ihr Haus stehe in Flammen, dann lässt ihr Instinkt sie zuerst zu dem Objekt laufen, das sie am höchsten schätzt« (ebd., S.31). Als originell kann man diese Überlegungen nicht gerade bezeichnen; sie scheinen weit entfernt von all jenen verblüffenden Detailbeobachtungen und Schlussfolgerungen, mit denen die Leser in anderen Holmes-Abenteuern so reichlich verwöhnt werden.
Es ist daher anzunehmen, dass es sich bei A Scandal in Bohemia um eine Holmes-Geschichte handelt, in der weniger das Hauptnarrativ, sondern gewisse unter der Oberfläche ablaufende Vorgänge die eigentliche Strahlkraft erzeugen. Holmes’ allgemeine Persönlichkeitsentwicklung stellt einen dieser verborgenen Vorgänge dar, insbesondere der durch Watsons Bericht erzeugte Widerspruch zwischen jener zölibatären, »vollkommensten Denk- und Beobachtungsmaschine, die die Welt je gesehen hat« (ebd. S.7) und dem irrational anmutenden Wunsch, eine Fotografie von Irene Adler zu behalten, da Holmes in ihr »die Frau« erkannt hat: Beginn und Ende der Erzählung stehen in deutlichem Kontrast. Besagte Kontrastwirkung (und die Aktionen der Opponenten Sherlock Holmes und Irene Adler, aus denen sie letztendlich hervorgeht) macht A Scandal in Bohemia zu einem Sonderfall des Kanons. Um dies genauer zu verstehen, sollte man zunächst rekapitulieren, wie Holmes auf den Auftrag des Königs reagiert. Es lassen sich hier zwei Ebenen unterscheiden: einmal Holmes’ spezielle Reaktion auf den ungewöhnlichen Klienten sowie seine Reaktion auf das ihm gestellte Problem.
Den Schilderungen Watsons können wir entnehmen, dass Holmes auf beiden Ebenen außerordentlich professionell agiert – er hat bereits den Status eines hoch versierten Detektivs und weiß seinen Erfahrungsschatz zu nutzen. Als die Droschke des Königs vor dem Haus vorfährt, kündigt Holmes seinem Mitbewohner an, dass der anstehende Auftrag viel Geld einbringen wird. Dem unbedarften Leser vermitteln diese Zeilen, wie geschickt Holmes auch auf der rein geschäftlichen Ebene agiert, und ein gewisser Zynismus dem König gegenüber lässt sich in den folgenden Dialogen nicht überhören. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Holmes für das Thema „Gesellschaftsskandal“ – und ganz allgemein wohl für alle ähnlich gearteten Probleme aus der Welt der Reichen und Mächtigen – nur Verachtung empfindet. Aus dieser Haltung heraus behandelt er den Monarchen von Anfang an als einen Narren, der für seine Dummheit (sprich, das unbedacht aufgenommene Foto) einen hohen materiellen Preis zu zahlen hat. Man erinnere sich abermals an den Beginn der Erzählung, an die Feststellung des seit einiger Zeit verheirateten Watson, dass Holmes nicht dazu geschaffen sei, jemals eine Frau lieben zu können. So betrachtet, ist Holmes das genaue Gegenteil des Königs – ihm erscheint dieser angeblich mächtige Mensch, dem all seine Macht in der von ihm selbst zu verantwortenden Affäre nichts nützt, reichlich lächerlich. Wenn aber alles, was er sich vom König anzuhören hat, im Grunde banal und lächerlich ist, dann geht es Holmes scheinbar nur um eines: um leicht verdientes Geld.
Entsprechend „abgezockt“ wirkt Holmes, nachdem er sich – nicht ohne zwischendurch demonstrativ zu gähnen – alle relevanten Details hat darstellen lassen und nun nach seiner Vorauskasse fragt. Der Regent, der ihm vorher schon eine beliebig hohe Belohnung in Aussicht gestellt hatte, legt ohne zu zögern tausend Pfund auf den Tisch, welche Holmes kommentarlos entgegennimmt. Was die zuvor artikulierte Verzweiflung des königlichen Auftraggebers betrifft, so rührt sie im wesentlichen von zwei Dingen her: einmal, dass seine eigenen besten Leute an Irene Adler gescheitert sind und das Versteck der Fotografie nicht zu ermitteln vermochten, zum anderen, dass die Zeit bis zur Proklamation seiner Verlobung praktisch abgelaufen ist – es bleiben nur noch drei Tage, um den Skandal zu verhindern. Gemessen an dieser „hoffnungslosen“ Situation jedoch, gibt sich Holmes auffallend selbstsicher. Er wünscht seiner Majestät eine gute Nacht und sagt ihm, dass er »sicher« (!) sei, »bald gute Nachrichten« für ihn zu haben. In späteren Sherlock Holmes-Geschichten wird man dies als wiederkehrendes Muster erleben: Es gibt Fälle, in denen der Meisterdetektiv von Anfang an genau weiß, was er zu tun hat, und bei denen er auch seine Erfolgschancen entsprechend präzise einzuschätzen vermag. A Scandal in Bohemia gehört ganz offensichtlich zu dieser Kategorie, doch es ist alles andere als einsichtig, warum.
Die Erklärung hierfür liegt in der Tat ein wenig verborgen. Bereits erwähnt wurden die beiden etwas oberflächlich wirkenden Prämissen, mit deren Hilfe Holmes eine Strategie zur geforderten, raschen Auftragserfüllung entwickelt. Aus der ersten Prämisse, dass Frauen »von Natur aus Geheimniskrämer« seien, leitet Holmes ab, dass sich das Foto sehr wahrscheinlich in Irene Adlers Wohnung befindet und nicht bei einer dritten Person hinterlegt ist. Er schätzt die Diva nach allen vorliegenden Schilderungen so ein, dass sie sich nicht auf dritte Personen verlassen und außerdem das Foto sofort zur Hand haben möchte, wenn am kommenden Montag die Verlobung des Königs proklamiert wird. Um diese Hypothese über den Verwahrungsort der Fotografie testen zu können, bringt Holmes seine zweite Prämisse zur Anwendung, derzufolge Frauen bei einem Hausbrand bestimmte geschlechtsspezifische Instinkte zeigen. Hier nun ist ein wichtiges Detail hervorzuheben: Holmes zitiert keine Buchweisheit und auch sonst keine „graue“ Theorie, sondern er bezieht sich auf konkrete Erfahrungen, die er selbst mehrfach (!) gemacht hat (Misri 2016, S.34). Kurz nachdem sein Plan geglückt ist und Irene Adler bei einem von Holmes initiierten falschen Feueralarm ihr Geheimversteck verriet, indem sie in dessen Richtung blickte, erhält Watson von Holmes folgende aufschlußreiche Erklärung zu seinem Vorgehen („Ein Skandal in Böhmen“, S.31):
»Dieser Impuls ist unwiderstehlich, und ich habe mehr als nur einmal meinen Nutzen daraus gezogen. Im Fall des Skandals um die Darlington-Unterschiebung hat er mir genutzt, und ebenso in der Sache Answorth Castle. Eine verheiratete Frau greift nach ihrem Baby – eine unverheiratete nach ihrer Schmuckschatulle.«
Nun können wir besser verstehen, warum Holmes bereits an dem Abend, an dem der ratlose Monarch ihn aufsuchte, so ausgesprochen selbstsicher wirkte. Diese erste Konsultation reichte aus, um ihn vermuten zu lassen, dass sich die Fotografie in einem schwer aufzufindenden Geheimversteck in Irene Adlers Haus befinden dürfte. Basierend auf seiner Arbeitshypothese stand auch Holmes’ Plan mit dem falschen Feueralarm frühzeitig fest – er hatte, wie im Nachhinein von ihm erläutert, schon Erfahrungen mit diesem Trick gesammelt und hielt ihn für erfolgversprechend.
Natürlich bleibt trotz allem eine Restwahrscheinlichkeit, dass das geplante „Feueralarm-Experiment“ anders verlaufen wird als erhofft. Aber Holmes wäre nicht Holmes, wenn er nicht bereits am ersten Abend Alternativhypothesen entworfen sowie Möglichkeiten ihrer Prüfung ausgearbeitet hätte. Welche das sind, erfahren wir leider nicht, da seine Leithypothese sich als richtig herausstellt. Jedoch weist die Schnelligkeit seines Handelns darauf hin, dass er genügend Zeit für einen „zweiten Versuch“ haben wollte: Bereits am ersten Tag nach der Beauftragung durch den König inszeniert er den Fehlalarm mit der von Watson durchs Fenster geworfenen Rauchpatrone. Hätte die Getäuschte nicht wie erwartet reagiert und Holmes schlussfolgern müssen, dass sich die Fotografie doch woanders befindet – etwa bei ihrem neuen Geliebten Godfrey Norton –, dann hätte der Detektiv noch zwei weitere Tage Zeit gehabt, seine für diesen Fall entwickelten Alternativpläne in Gang zu setzen.
Dies aber ist nicht nötig; Holmes ist dank seiner Vorab-Überlegungen erfolgreich – und gleichzeitig erfolglos. Seine erfahrungsbasierten Prämissen erweisen sich als hochgradig zielführend; er findet heraus, wo Irene Adler die Fotografie verbirgt. Die Gesamtsituation jedoch vermag er nicht zu kontrollieren, da es bestimmte Faktoren gibt, die er sträflich unterschätzt. Eigentlich hätte Holmes gewarnt sein müssen, nachdem der König gleich zu Beginn den außerordentlichen Charakter der Operndiva schilderte. Das Pathos dieser Darstellung spiegelt zunächst einmal männliche Ideal- und Wunschvorstellungen; darüber hinaus lässt sich aber ein verborgener Zusammenhang mit einem (in späteren Geschichten mehrfach geäußerten) Lieblingstheorem des Detektivs herstellen. Das „wahre Leben“, so Holmes, sei weitaus komplexer als alle Produkte der Fantasie. Diese Annahme ist nichts weniger als eine von Holmes in dogmenhafter Manier vertretene Zentralprämisse6 – in gewisser Weise ein unbeweisbarer Glaubenssatz, der literaturtheoretischen Debatten entnommen ist. Holmes verteidigt diesen Satz bei mehreren Gelegenheiten gegen Watsons Kritik, man könnte meinen, aus Starrsinn und Schrullenhaftigkeit. In Wirklichkeit aber ist es so, dass Holmes’ Komplexitätsdogma ihm höchste Gewissenhaftigkeit bei der Erledigung seiner Arbeit abverlangt: Die Annahme einer im Grunde kaum ausrechenbaren Realität zwingt ihn, übermäßig einfachen Erklärungen zu misstrauen, Alternativerklärungen prinzipiell zuzulassen und, falls sich unter diesen Alternativen bestimmte Favoriten herauskristallisieren, auch gegenüber den eigenen Lieblingshypothesen so lange kritikfähig zu bleiben, bis sie durch genügend Beweismaterial hinreichend abgesichert sind.
Kurz gesagt, Holmes scheitert, weil er die Komplexität der vorliegenden Situation unterschätzt. Er war sich sicher, die dem König von Böhmen so uneinnehmbar scheinende „Festung“ Irene Adler im Sturm nehmen zu können, einfach aufgrund seines Beobachtungsvermögens, seines persönlichen Erfahrungsschatzes sowie seines ganz exzellenten Vorbereitetseins auf das ihm gestellte Problem. Diesen Aspekt der Vorbereitung kann man in zwei Richtungen unterteilen: einmal Holmes’ nötig werdende Verkleidungs- und Schauspielkünste, um Miss Adler ausspionieren zu können, des Weiteren die große „Schauspieltruppe“, die er für seine Rauchbombenidee braucht – all jene Vagabunden, Scherenschleifer, Gardisten, Kindermädchen und Zigarre rauchenden Flaneure, die „zufällig“ in der sonst eher ruhigen Straße vor Irene Adlers Haus unterwegs sind, waren zuvor von Holmes engagiert worden. Es mussten gute und verlässliche Schauspieler sein, und gewiss verwendete Holmes einen ansehnlichen Teil seines hohen Auslagenhonorars, um diese eilig rekrutierte Truppe mittels großzügiger Bezahlung zur Höchstleistung zu motivieren.7
Auch diesen Teil seines Planes hatte Holmes schon am Abend seines ersten Gespräches mit dem König festgelegt. Irene Adler ist auf der Hut, da die Helfer des Monarchen seit geraumer Zeit versuchen, ihr die Fotografie zu stehlen. Von daher weiß der Detektiv, dass er die „gehobene“ Handwerkskunst der Illusionistenzunft anwenden muss, wenn er erfolgreich sein will: Es bedarf nicht nur hoher Verstellungskunst, sondern einer verwirrenden Gesamtsituation mit vielen Ablenkungsfaktoren – in diesem Fall die Schlägerei vor Irene Adlers Kutsche, als sie Abends um sieben nach Hause kommt, sowie den am Kopf verletzten Geistlichen, den Holmes bei dieser Inszenierung mimen will. Aus all diesen Vorab-Konzeptionen ergibt sich tatsächlich der optimale Verlauf: der „Patient“ gelangt in Miss Adlers Räumlichkeiten und kann von dort aus beobachten, in welcher Weise sie auf den Feueralarm reagiert.
Hinsichtlich seiner berühmt-berüchtigten Methodik zeigt sich der Meisterdetektiv also voll auf der Höhe: Er hat wie so oft schon beim ersten Konsultationsgespräch mit seinem Klienten die Lage präzise erfasst und aus den vorliegenden Fakten eine ebenso ungewöhnliche wie brillante Strategie entwickelt. Wenn wir nun diese strategische Ebene genauer betrachten, dann lernen wir, dass hier eine ganz besondere Motivation für Holmes verborgen liegt, welche ihn persönlich viel stärker reizen dürfte als der in Aussicht stehende, außerordentlich hohe finanzielle Gewinn. Es ist nämlich keineswegs so, dass er die königlichen Warnungen vor Irene Adlers Besonderheiten als unwichtig abtut – Holmes registriert sehr wohl, dass er es mit einer erfahrenen Bühnenakteurin zu tun hat, und dass genau dieser Punkt seine Gesamtstrategie gefährdet. Wie einleitend erwähnt, ist Holmes im Jahr 1888, in dem die Handlung spielt,8 bereits ein sehr erfahrener Ermittler, und in besonderer Weise versiert darin, bei seiner „auswärtigen“ Arbeit mit Hilfe von Verkleidungen zu operieren. Eigentlich ist daran nichts besonderes, da die Täuschung durchschnittlicher Mitbürger einem Sherlock Holmes sehr leicht fällt und er somit auch nicht ständig gezwungen ist, verkleidungstechnische und schauspielerische Glanzleistungen zu vollbringen. Er ist sich aber vollkommen der Tatsache bewusst, dass er in Gegenwart einer Frau, die selbst als berufsmäßige Schauspielerin lebt, eine exzellente und absolut makellose Vorstellung abliefern muss. Genau auf dieser Ebene liegt der eigentliche Kampf, der sich in Scandal in Bohemia abspielt: Der (hochbegabte) Amateurschauspieler Holmes brennt darauf, die professionelle Schauspielerin Irene Adler auszutricksen. Er ist sich sicher, dass er das kann – und muss am Ende feststellen, dass irgendetwas schiefgegangen ist, obwohl er an der Leistungsgrenze performte.
Holmes’ unübersehbare Affinität für Verkleidungen und seine äußerst wirkungsvollen Tarnungen in allen möglichen Rollen weckten zuweilen die Vermutung, er habe in seiner Jugend intensive Theater-Erfahrungen gesammelt oder sei gar mit schauspielerischen Ambitionen in London unterwegs gewesen (vgl. z.B. die bei Baring-Gould 1978 S.393 imaginierten Szenarien). Watson lässt uns genügend über Holmes’ außerordentliche Verstellungskunst wissen – er selbst fällt mehr als einmal auf ihn herein, am spektakulärsten in The Empty House –, trotzdem spricht einiges dagegen, dass Holmes diese Fähigkeiten über das Bühnenschauspiel erlernte. Zum einen erwähnt er durch den gesamten Kanon hindurch keine Besuche von Theateraufführungen; die umjubelten Schauspieler der damaligen Zeit scheint er zu ignorieren: Sein Interesse gilt eindeutig der Musik (einschließlich der Oper), nicht jedoch dem Drama. Zum anderen lohnt es, sich an die ablehnenden Bemerkungen zu erinnern, mit denen Holmes in A Case of Identity die Produktionen der Literaten kritisiert: Bekanntlich lautet sein (am o.g. Zentralen Dogma ausgerichtetes) Argument, dass all die angeblich bedeutenden Erzählungen uns nur in den seltensten Fällen Mysterien des alltäglichen Lebens offenbaren. Somit besaßen damals aufgeführte Theaterstücke wohl nur unter kulturhistorischem Aspekt einen Wert für Holmes (etwa, wenn das antike Repertoire oder Meisterwerke aus dem Shakespeare-Kanon gegeben wurden), aber sicherlich nicht vor dem Hintergrund seines ganz speziellen Blickes auf die Alltagsrealität. Ein Roman- oder Dramenautor, der Holmes’ Ansprüchen hier auch nur ansatzweise hätte gerecht werden können, musste erst noch geboren werden.9 All das schauspielerische Talent, das die meistgerühmten Bühnenakteure des Spätviktorianismus zu bieten hatten, war aus Holmes’ besonderer Sicht an Rollen verschwendet, welche insgesamt zu sehr durch allgemeine dramaturgische Konventionen sowie Angst vor Skandalen eingeschränkt waren. Vor allem aber hatten diese Darbietungen rein gar nichts mit dem zu tun, was Holmes zu leisten hatte, wenn er seinerseits zum Kostüm griff: das Eintauchen und Verschwinden im Strom des Londoner Lebens, die unauffällige Annäherung an Zielpersonen und -orte seiner Nachforschungen oder auch die Flucht vor gefährlichen Feinden. Sämtliche hierfür erforderliche Fähigkeiten dürfte Holmes sich selbst beigebracht haben, und zwar ebenso auf Grundlage seiner überscharfen Beobachtungsgabe wie auch seiner Imaginationskraft. Wenn er z.B. in A Scandal in Bohemia als Stallbursche auftritt, so ist er dazu befähigt, weil er typische Eigenheiten dieses Standes ebenso genau kennt wie die zahlloser anderer Berufsgruppen. In der Wahl der erforderlichen Kleidungsstücke (und ihrer charakteristischen Gebrauchsspuren), den Veränderungen seiner Körperbewegungen und seiner Sprache imitiert er all jene Details,10 die er sich sonst zunutze macht, wenn er aus dem bloßen Erscheinungsbild eines Fremden dessen Beruf deduziert. Bei solchen, höchst durchdacht vorgenommenen Verwandlungen dürfte er den Fähigkeiten professioneller Bühnenschauspieler um einiges voraus sein: Seine Bühne ist das wirkliche Leben, und dort sind andere Feinheiten gefragt als vor einem Theaterpublikum.
Dass Holmes seine Verstellungskunst planvoll perfektionierte, ist vor dem Hintergrund seiner beruflichen Herausforderungen zwanglos nachvollziehbar, und der Erfolg gibt ihm Recht (im neunten Kapitel von The Sign of Four z.B. sagt Inspektor Athelney Jones über Holmes: »You would have made an actor, and a rare one.«). Er wird Observationstechniken aller Art zeitig durchdacht haben, und seine Bemerkungen über die Rolle des Stallburschen in A Scandal in Bohemia belegen, wie zielgerichtet er seine Verwandlungen einsetzte. Man kann davon ausgehen, dass der Detektiv gleich zu Karrierebeginn ein taktisches Repertoire bestimmter Rollen anlegte und zwecks Perfektionierung der geforderten Imitationskünste genauestens jene Vorbilder studierte, wie sie ihm das reale Leben Tag für Tag bot. Holmes vermochte solche Überlegungen in einer Weise zu vertiefen, wie sie sonst nur von außerordentlich vorbereitungsbesessenen Schauspielern denkbar wären: So wird er z.B. Stallburschen und ihre „beruflichen Deformationen“ nicht nur am lebenden Exemplar, sondern auch in Form ihrer Leichname genauestens inspiziert haben – und zwar in der Pathologie des Barts College. Spätestens dank dieser schauerlichen Studien „am Objekt“ dürfte er nicht nur allen damaligen, sondern auch allen heutigen Schauspielern meilenweit voraus gewesen sein – und genau hieraus erklärt sich das riesige Selbstvertrauen, mit dem der „Amateur“ Holmes gegen den „Profi“ Irene Adler antritt.
Holmes’ riskantes Vorgehen, gleich zweimal in unmittelbarer Nähe seines Zielobjektes Irene Adler zu operieren und sich dabei auf seine Verkleidungen als Stallbursche und als Geistlicher zu verlassen, ist ihm später meist als Überheblichkeit ausgelegt worden. Zwar war es in seiner ersten Rolle nicht vorgesehen, dass es zu einem direkten Gespräch mit Miss Adler kommen würde (also die gänzlich unerwartete Trauzeugenszene in der Kirche, über die Holmes später in schallendes Gelächter ausbricht). Aber der Detektiv scheint den Bogen zu überspannen, als er kurz darauf einen zweiten direkten Kontakt riskiert, denn diesmal wird er von seiner Gegnerin durchschaut. Genau das war natürlich unter allen Umständen zu vermeiden; und daher muss man davon ausgehen, dass Holmes absolut sicher war, Irene Adler auch ein zweites Mal täuschen zu können. Die ganze Begebenheit zeigt einerseits, wie intensiv sich Holmes mit dem Annehmen neuer Identitäten und ihrer überzeugenden schauspielerischen Darbietung beschäftigt hatte, scheinbar aber auch, wie ihn sein im Laufe der Jahre erworbenes Selbstvertrauen auf diesem Gebiet ins Fiasko führt. Zwar endet A Scandal in Bohemia dahingehend gut, dass Holmes’ Auftraggeber sich zum Schluss zufrieden zeigt und in der verheirateten Irene Adler keine Gefahr mehr zu fürchten braucht, aber für Holmes zählt dieser Aspekt natürlich nicht: Seine Selbsteinschätzung hat einen schweren Schlag erlitten. Zuzuschreiben hat er es sich, worauf auch Watson hinweist, durch seine generell frauenverachtende Attitüde. Alle Vorabinformationen, die er über Irene Adler besaß und die ihm durchaus die Schwierigkeit seiner Aufgabe hätten ankündigen können, führten doch nicht dazu, sich bestimmter versteckter Gefahren bewusst zu werden. Bekanntlich ist Holmes am Ende der Erzählung so getroffen von seiner Fehleinschätzung, dass er einen wertvollen Smaragdring, den der König ihm als Belohnung darbietet, ablehnt. Ihm ist es wichtiger, sich als „gefühlter Verlierer“ vom Feld zurückziehen und über sein Scheitern in Ruhe nachgrübeln zu können. Als Unterstützung für diese Grübeleien erbittet er vom König die Fotografie – wohlgemerkt eine andere, als die eigentlich gesuchte –, welche Irene Adler ihrem Abschiedsbrief beigelegt hatte.
Besagter Brief nun verdient einen genaueren Blick, nicht nur, weil er an Holmes gerichtet ist – statt an den König –, sondern weil man ihm auch entnehmen kann, wie haarscharf die Entscheidung im vorangegangenen „Divenkrieg“ zugunsten von Irene Adler ausfiel. Wenn allgemein angenommen wird, dass Irene Adler in der Lage war, Holmes’ Verwandlungskünste zu durchschauen, so ist dies eine recht ungenaue Wiedergabe ihrer Zeilen. Nirgendwo in ihrem Brief steht zum Beispiel, dass sie Holmes erste Verkleidung als Stallbursche erkannte. Demzufolge ahnt sie nichts davon, dass der eilig herbeigerufene, spontan gewählte Trauzeuge, mit dem ihre Heirat Godfrey Nortons rechtskräftig wurde, in Wirklichkeit Sherlock Holmes war. Diese erste Runde also hat Holmes klar gewonnen; die Sorgfalt, mit der er seine Rolle spielte, zahlte sich aus, auch und gerade als er völlig unerwartet von Godfrey Norton herbeigerufen wurde und sich beträchtliche Zeit in unmittelbarer Nähe von Irene Adler – kurz danach dann Irene Norton – aufhalten musste.
War er demzufolge bei seiner zweiten Rolle als Geistlicher schlechter, beging er hier seinen entscheidenden Fehler? Die Antwort ist nein, denn Irene Norton schreibt gleich zu Beginn, dass Holmes »sehr gut« gewesen sei, sie gar bis kurz nach dem Feueralarm vollständig getäuscht hätte. Es gab aber eine Sache, die Holmes nicht bewusst war und die entscheidend dazu beitrug, dass das Blatt sich wendete: Sein Observationsobjekt war »bereits vor Monaten« vor ihm gewarnt worden. Die Diva ist nicht einfach eine isolierte Person, eine von ihrem Liebhaber im Stich gelassene und mutterseelenallein durch die Gegend reisende Frau: Sie hat Kontakte in einflussreiche Kreise, und irgendeiner dieser gut informierten Bekannten11 muss ihr, nachdem sie sich temporär in London niedergelassen hatte, ganz richtig angekündigt haben, dass der ihr nachstellende König auf die Idee kommen könnte, Sherlock Holmes zu engagieren.12 Aus einer so zu denkenden Ausgangssituation ergeben sich unerwartete Parallelen zwischen Holmes und Adler. Beide sind nicht nur Musikliebhaber und aus professionellen Gründen an Schauspielkunst interessiert, sie sind auch übereinander informiert: Adler ist in Holmes’ Index verzeichnet, während sie wiederum nicht nur seinen Namen, sondern – wie sie schreibt, dank ihres Informanten – auch seine Adresse kennt. Beide sind gesellschaftlich auf spezielle Weise vernetzt und nutzen ihre Vernetzung zur Erlangung wertvoller Informationen. Während Holmes dies liest, muss ihm erstmals klar geworden sein, dass seine Widersacherin ihm auf viel mehr Gebieten ebenbürtig war als nur auf dem ihrer schauspielerischen Sonderkenntnisse. Zwar hat sie Holmes’ Verkleidung nicht als solche erkannt, und auch in seiner „Sprechrolle“ ist Holmes kein entscheidender Fehler unterlaufen. Aber in der Getäuschten ist der warnende Gedanke aufgeblitzt, dass sie durch ihre Bewegung hin zu dem Geheimversteck den Verwahrungsort der Fotografie verraten haben könnte – und zwar an jene andere Person im Raum, die sie bis dahin für einen liebenswürdigen und sehr harmlosen Geistlichen hielt. Verglichen mit den grobschlächtigen Versuchen des Königs, die Fotografie zu stehlen, erscheint ihr diese Methode außerordentlich subtil und in der schauspielerischen Durchführung schlichtweg brillant. Wenn es tatsächlich einen solchen Plan gibt, die Fotografie zu beschaffen, so kann er eigentlich nur von jenem ungewöhnlichen Mr. Holmes ausgehen, vor dem man sie bereits gewarnt hatte.
All dies ergibt sich aus dem ersten Teil des Briefes, und auch aus dem zweiten muss Holmes (sicherlich zu seiner außerordentlichen Betroffenheit, mit der sich denn auch seine Übellaunigkeit zum Ende der Erzählung erklärt) einige erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen sich und der Verfasserin herauslesen. Irene Norton gibt offen zu, dass ihr plötzlicher Verdacht, der verletzte Geistliche könnte in Wahrheit Sherlock Holmes gewesen sein, nicht mehr darstellte als eine Hypothese. Diese jedoch wollte sie sogleich testen – nicht weniger gewissenhaft, als auch Holmes seine Hypothesen zu testen pflegt. Sie sorgte dafür, dass ihr Kutscher John das Versteck der Fotografie im Auge behielt und zog sich rasch um – sie verkleidete sich als junger Mann. In dieser Aufmachung konnte sie Holmes durch die abendlichen Straßen problemlos vor die Wohnungstür von Baker Street 221 verfolgen und den handfesten Beweis dafür erlangen, dass ihr Besucher tatsächlich der vom König beauftragte Detektiv gewesen war.
Irene Nortons Vorgehen wirkt bei all dem nicht minder kühn als Holmes vorausgegangene Nachstellungen, sie zahlt ihm sozusagen mit gleicher Münze heim. Man könnte es ihr sogar als Übermut auslegen, dass sie sich zu solch einer Aktion hinreißen ließ, statt sofort ihre Sachen zu packen und abzureisen. Der bloße Verdacht, soeben von Sherlock Holmes ausgetrickst worden zu sein, wäre ja schon Anlass genug für schnelle Flucht gewesen – warum noch Zeit verschwenden für die Gewissheit, dass dieser tatsächlich der Verfolger ist? Ein Faktor dafür ist schlicht „professionelle Neugier“; die Diva empfindet so etwas wie uneingeschränkte, ganz natürliche Begeisterung für die Schauspielkünste des verletzten Geistlichen – wenn es denn wirklich ein verkleideter Detektiv war, was sie liebend gerne erfahren will. Abgesehen von solch berufsbedingter Neugier ist sie aber kaltblütig und klug genug, um sich direkt in die Gedanken von Sherlock Holmes hineinversetzen zu können. Ganz beiläufig schreibt sie in ihrem Brief »Sie werden also das Nest leer vorfinden, wenn Sie morgen vorbeikommen«. Mit diesem Satz beweist sie ihrem Adressaten eine ganze Menge – sie gibt ihm zu verstehen, dass sie seine Handlungsweise und Planung, möglicherweise aber auch die darin mitschwingende Arroganz, hundertprozentig durchschaut hat. Holmes kennt das Versteck und glaubt, Irene Norton ahne nichts – also legt er sich (selbst)zufrieden ins Bett, um die Fotografie am nächsten Morgen, mit dem König im Gefolge, abholen zu können. All dies hätte auch genau wie vorgesehen funktioniert, wenn sein „Opfer“ nicht 1) konkret vorgewarnt und 2) klug genug gewesen wäre, sich der Vorwarnung zu entsinnen und richtig zu reagieren, als es Zeit hierfür war. Sie kehrt von der Baker Street aus nach Hause zurück, packt zusammen mit ihrer Dienerschaft und ihrem Mann ihre Sachen und schreibt gegen Mitternacht in aller Ruhe den Abschiedsbrief, bevor sie auf Nimmerwiedersehen verschwindet.
Holmes muss es als schmerzliche Ironie empfunden haben, dass Irene Norton mutig genug war, die Rolle von Verfolger und Verfolgtem umzudrehen und sich dabei einer Verkleidung als Mann zu bedienen. Zur damaligen Zeit kam es nicht selten vor, dass Frauen sich auf Reisen oder bei anderen Gelegenheiten als Männer verkleideten, um den üblichen gesellschaftlichen Nachteilen, denen sie ausgesetzt waren, auszuweichen. Irene selbst spricht im Brief von ihren »Wanderkleidern«, womit genau diese Form des Inkognito-Reisens umschrieben ist. Der Witz ist nun, dass ihr im Augenblick des Triumphs ein schwerer Fehler unterläuft – sie kann es nicht unterlassen, ein »Gute Nacht, Mr. Sherlock Holmes« von sich zu geben, als sie Holmes und Watson am Hauseingang von Nr. 221 passiert. Holmes merkt sogar, dass ihm die Stimme bekannt vorkommt, aber bei all seinen Bekanntschaften – man denke nur an die Schauspieltruppe, die er für diesen Abend im Einsatz hatte – kommt er nicht auf die Idee, dass der junge Mann im Ulster eine Frau sein könnte. Hätte er dies bemerkt, wäre der Divenkrieg der Schauspieler wohl doch noch zu seinen Gunsten ausgegangen: Er selbst hätte zwei „makellose“ Auftritte verbuchen können, während sich die Professionelle trotz all ihrer Erfahrung und Stimmkontrolle einen einzigen, aber entscheidenden Fehler geleistet hätte. Doch das Glück der Mutigen ist mit Irene, und somit gelingt ihr, was nur den wenigsten gelang – ein Sieg über den großen Sherlock Holmes.
Die bis heute erstaunliche Breiten- und Langzeitwirkung von A Scandal in Bohemia lässt sich so sicherlich am überzeugendsten erklären: In der einfachsten Zusammenfassung der Geschichte ergibt sie sich aus Holmes’ unerwartetem Scheitern an einer Frau, bei analytischer Betrachtung jedoch aus den unter der Oberfläche verborgenen, mannigfaltigen Übereinstimmungen zwischen den Künstlernaturen Holmes und Adler/Norton. Ihr unkonventioneller Lebensstil, ihr leidenschaftliches Ausleben natürlicher Talente unter Inkaufnahme gesellschaftlichen Außenseitertums, ihr kluges Networking, ihre Intelligenz, Geistesgegenwart und Improvisationskunst – in all dem rücken Sherlock und Irene zum Ende der Geschichte so eng zusammen, dass sie von Gegnern zu einem potenziellen Traumpaar werden. Leider steht dem aber mächtig viel entgegen: zunächst einmal Sherlocks notorische Misogynie und Irenes Heirat nebst Flucht aus London, und vor allem natürlich die traurigen Zeilen, die Watson gleich zu Beginn der Geschichte einflicht – Irene Norton lebt nicht mehr, sie ist „vor der Zeit“ verstorben.
Dass Irene Norton geb. Adler ein frühes Ende fand, vollendet gleichsam ihren Status als Unruhe stiftendes und unverständliches Phänomen (abgesehen davon, dass damit auch ihre nachträgliche Idolisierung durch Holmes auf eine neue, „abschließende“ Ebene gehoben werden kann). Als der königliche Klient die Bedrohungslage erläuterte, betonte er, dass die Folgen »die europäische Geschichte beeinflussen« könnten („Ein Skandal in Böhmen“, S.14). Kurz gesagt, Irene Adler setzt das aus vergangenen Jahrhunderten bekannte Mätressentum fort und bedroht damit den „geordneten“ Lauf der Geschichte. Als gleichzeitig faszinierendste und potenziell destruktivste Mätressengestalten wurden stets jene wahrgenommen, die einfachsten Verhältnissen entstammen und trotzdem den Aufstieg nach ganz oben schaffen: Sie sind Figuren mit dämonischen Kräften, und das Einzige, was sie aufhalten kann, ist der zeitige Verfall ihrer Schönheit, ihrer erotischen Macht über Männer. Eben weil dies so ist, beschwor Félicien Rops das plötzliche Verlöschen anstelle längeren Verfalls – jener belgische Skandalkünstler also, dessen (Frauen?)Bilder Holmes in einer Ermittlungspause des Baskerville-Falles stundenlang bewunderte:
»Ich hasse die Lauheit. Die heißen Menschen müssen mit einem Schlag erkalten, wie von einer Kugel getroffen. So muss das Alter sie durchbohren, und Alter und Tod müssen ein und dasselbe sein. Man muss sich seine schönen Verrücktheiten bewahren.«13
5Hinzu kommen die wenigen späten Fälle, in denen Holmes nicht mehr in London lebt.
6»Zentrales Dogma«, vgl. Suttles (2017, S.50ff.). Boltanski (2015, S.109) verfehlt diese spezifisch Holmes’sche Sicht der Dinge, wenn er behauptet, dass der Detektiv mittels Annahme einer »Robustheit und Einfachheit der Realität« operiere, die den offiziellen Polizeiermittlern abginge! »Robustheit« ließe sich verteidigen (siehe Nikolaus 2013), aber für den Punkt »Einfachheit« verhält es sich genau umgekehrt.
7Bereits aus A Study in Scarlet erfährt man, dass Holmes schnell in der Lage ist, kleine „Armeen“ für seine Aufträge zu rekrutieren – in diesem Fall die von ihm als Beobachter ausgeschickten Londoner Straßenkinder. In späteren Geschichten lernt man weitere Helferfiguren kennen, von Klatschreportern und geläuterten Ex-Verbrechern bis hin zu seinem Bruder Mycroft, der Kontakte in höchste Regierungskreise hat. Die in Scandal in Bohemia so hilfreichen Schauspieler treten in anderen Fällen nicht mehr auf (vgl. aber auch unser 7.Kapitel), sodass man nicht erfährt, woher Holmes sie kannte – der Kontakt und das offensichtlich gute Vertrauensverhältnis könnte z.B. auf ehemalige Schul- oder Universitätskameraden zurückgehen, aber auch auf ehemalige Klienten.
8Die Datierung ist unter Sherlockianern allerdings umstritten; einige favorisieren 1887, andere 1889.
9Man vergleiche, wie der junge James Joyce im Jahr 1900 das umstrittene „Neue Drama“ Ibsens verteidigte (Ellmann 1999, S.123): »Die Tradition des Romantischen wird nur noch in der Boheme hochgehalten. Dennoch glaube ich, dass selbst aus der öden Einförmigkeit der Existenz ein bestimmtes Maß an dramatischem Leben gezogen werden kann. Auch die durchschnittlichsten, auch die abgestorbensten unter den Lebenden können eine Rolle in einem großen Drama spielen.«
10Holmes’ Schauspiel- und Verwandlungskünste aus A Scandal in Bohemia wurden in der gleichnamigen Granada-Produktion mit Jeremy Brett (1984) ansprechend in Szene gesetzt.
11Wer das war, wird sich nie klären lassen. Denkbar ist, dass es ein erklärter Feind von Holmes gewesen sein könnte – wobei man unausweichlich an die Verbrecherorganisation Professor Moriartys beziehungsweise an Moriarty höchstpersönlich denken muss, sogar wenn es noch gar keine direkten Konflikte zwischen dem Detektiv und dem Syndikat gegeben hat (eine Vermutung, die Steven Moffat und Mark Gatiss für die BBC-Serie Sherlock aufgriffen).
12Genau hier also schlägt Holmes’ »Zentrales Dogma« ins Kontor, die Überkomplexität (und damit Unausrechenbarkeit) des realen Lebens.
13Brief an den Literaten und Rops-Sammler Octave Uzanne (Hassauer & Roos 1984, S.128).
2. Stolz und Fehlurteil: The Beryl Coronet(März 1892)
Bei The Beryl Coronet handelt es sich um die elfte Geschichte des Holmes-Kanons. Gemessen an den bisherigen Umfragewerten ist ihr – ohnehin nicht hoher – Beliebtheitsgrad im Laufe der Zeit stetig gesunken, von Platz 28 im Jahr 1944 bis Platz 48 im Jahr 1999 (was in Stocks Durchschnittswertung Platz 32 ergibt). Es lassen sich aber gute Gründe benennen, dass die Komplexität des präsentierten Falles allgemein unterschätzt wird. Dies betrifft weniger den Tatablauf – einen nächtlichen Diebstahl, für dessen Ausführung es zunächst nur drei Verdächtige gibt –, sondern die rund herum am Geschehen beteiligten Charaktere. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass schon die mit großer Feinheit ineinander greifenden Willensbeziehungen der vier eigentlichen Hauptakteure ausgereicht hätten, um aus The Beryl Coronet einen kleinen Roman zu machen (für eine Kurzgeschichte ist der Plot freilich ebenso gut verwendbar, da Holmes die präsentierten Verwicklungen innerhalb von vierundzwanzig Stunden aufzulösen vermag). Als zusätzliche Besonderheit ist eine fast vollständig anonymisierte Person am Ablauf der Ereigniskette beteiligt, über die man auch bei der Auflösung des Falles so gut wie nichts erfährt. Die Identität dieser „maskierten“ Figur, genauer gesagt ihre Charaktereigenschaften, könnte aber die Motive und die Entschlossenheit der anderen Beteiligten in hohem Maße beeinflusst haben – ein Aspekt, der in der bisherigen Rezeptionsgeschichte nicht genügend beachtet wurde.