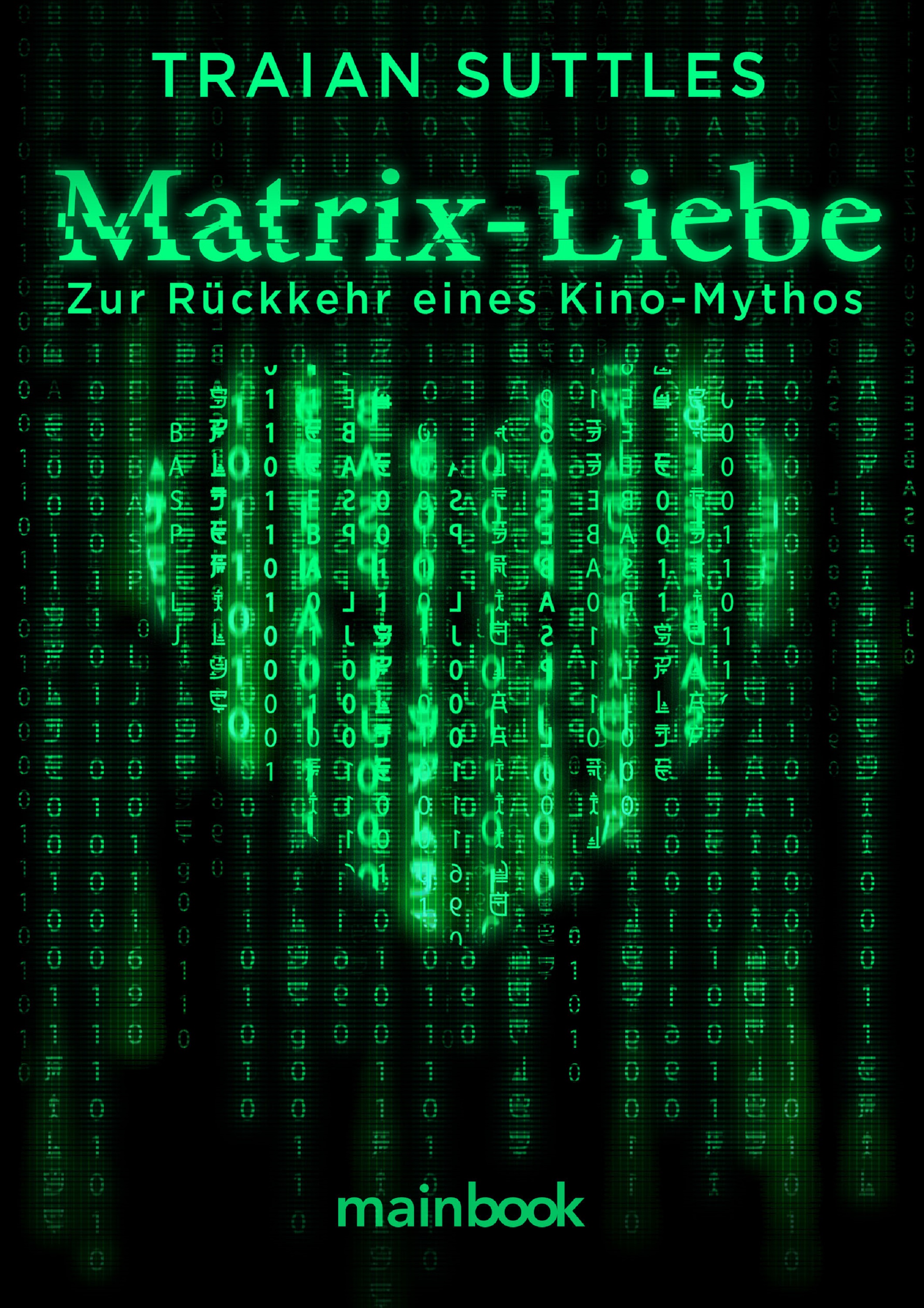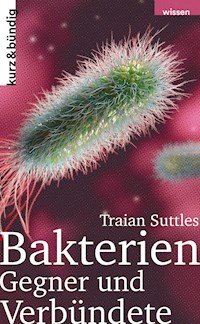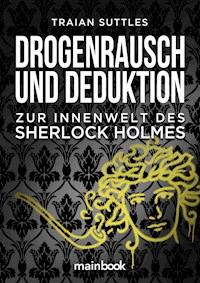
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
SHERLOCK HOLMES – eine der wenigen Figuren der neueren Literaturgeschichte, denen ein mythischer Status zukommt, und zugleich eine der rätselhaftesten. Warum konsumiert Holmes, entgegen des ärztlichen Rates seines Vertrauten Dr. Watson, regelmäßig Kokain- und Morphium? Was hat es mit der seltsamen Ikonisierung seiner ehemaligen Opponentin Irene Adler auf sich? Wie sind seine höchst eigenwilligen Improvisationen an der Geige zu verstehen? Worüber ist Watson so nachhaltig befremdet, als er zusammen mit Holmes eine Bildergalerie verlässt, in der Werke "moderner belgischer Meister" zu sehen waren? Wie ist Holmes' irritierender metaphysischer Exkurs über die Schönheit der Blumen – beim Anblick eines Portulak-Röschens – zu verstehen? Und warum empfiehlt er Watson ein provokatives Skandalwerk des viktorianischen Freigeistes Winwood Reade? Das vorliegende Buch stellt erstmals einen Zusammenhang zwischen diesen und anderen seit über hundert Jahren ungeklärten Fragen her und liefert ein ebenso durchdachtes wie ungewöhnliches Charakterporträt des legendären Londoner Meisterdetektivs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Traian Suttles
Drogenrausch und Deduktion
Zur Innenwelt des Sherlock Holmes
Der Autor
Traian Suttles wurde als britischer Staatsbürger in Hamburg geboren und erhielt später die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach Studium der Biologie nebst Promotion in Frankfurt am Main widmete er sich zunächst speziellen zoologischen und evolutionstheoretischen Fragestellungen, ausgehend hiervon aber auch der allgemeinen Biologiegeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Entsprechend fundiert lesen sich die wissenschaftshistorischen Exkurse in DROGENRAUSCH UND DEDUKTION, seinem ersten populären Sachbuch.
ISBN 978-3-946413-36-3
Copyright © 2017 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung und -motiv: Lukas Hüttner
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere Bücher:
www.mainbook.de
Inhalt:
Vorwort des Verlegers
Einleitung
1. Kapitel:_____»The game is afoot!«: Zur Fiktionalisierung Arthur Conan Doyles
2. Kapitel:_____Die Frau und das Leben: Scandal in Bohemia
3. Kapitel:_____Gottesauge und Dämon: Holmes’ „Zentrales Dogma“
4. Kapitel:_____Gott versus Kain: machtvolle Rekonstruktionen
5. Kapitel:_____Halluzinogene und Psychedelika: Holmes’ Griff zur Droge
6. Kapitel:_____»Mein besonderes Thema«: Überkomplexität und Scheitern
7. Kapitel:_____Jenseits des Materialismus
Anhang 1:——Die sechzig kanonischen Holmes-Erzählungen
Anhang 2:——Aufbau der Figur Sherlock Holmes in den ersten sieben Fällen des Kanons
Anhang 3:——Grafische Synopsis zur Entwicklung von Holmes’ Drogenkonsum
Quellenverzeichnis
I have been sluggish in mind and wanting in that mixture of imagination and reality which is the basis of my art.
(Sherlock Holmes in „The Problem of Thor Bridge“)
Whoever improves his own nature, improves the universe of which he is a part.
(Winwood Reade, „The Martyrdom of Man“)
Vorwort des Verlegers
»Drogenrausch und Deduktion« von Traian Suttles ist nicht nur inhaltlich, sondern auch formal eines der ungewöhnlichsten Manuskripte, die mir jemals vorgelegt wurden. Ich habe im Laufe der Jahre Bücher aus unterschiedlichen Genres auf den Weg gebracht, aber dieser Text erwies sich von Anfang an als eine ganz neue Herausforderung.
Die zentrale Fragestellung des Buches ist spannend genug: Gibt es eine nachvollziehbare Erklärung dafür, dass der für seine extreme Rationalität berühmte Detektiv Sherlock Holmes Kokain und Morphium konsumierte? Hierauf sind bisher eher kurze Antworten formuliert worden – Traian Suttles hingegen wählt den langen und mühseligen Weg, indem er aus Zitaten der Originalgeschichten biografische Rückschlüsse über Holmes’ Leben und dessen individueller Gedankenwelt ableitet. Der Lohn dieser Mühen besteht in einer ebenso facettenreichen wie überzeugenden Erklärung des Holmes’schen Drogenkonsums, die ich hier natürlich nicht vorwegnehmen will.
Stattdessen sei einiges zu den formalen Eigenheiten des Textes gesagt, denn jedem, der ein wenig darin blättert, wird hierzu als erstes der umfangreiche Fußnotenapparat auffallen, mit dem Suttles aufwartet. Die aus meiner Sicht hervorragendste Besonderheit des Buches besteht darin, dass der Leser es auf zwei ganz verschiedene Weisen lesen kann. Wer an einem schwungvoll entwickelten Charakterporträt von Sherlock Holmes interessiert ist und dessen ungewöhnliche Persönlichkeitsentwicklung anhand mehrerer, vom Autor sorgfältig rekonstruierter Stufen nachvollziehen will, kann die Fußnoten ausblenden und sich ganz dem Haupttext widmen. Besonders die Holmes-Nostalgiker werden hierbei auf ihre Kosten kommen, denn einerseits werden sie mit zahlreichen Szenen aus den Originalgeschichten verwöhnt, andererseits lernen sie diese aber aus einem ganz neuen, zutiefst faszinierenden Blickwinkel kennen. Traian Suttles versteht es sachkundig, den Geist des viktorianischen Zeitalters heraufzubeschwören; in seinen zahlreichen Exkursen besonders zur Geschichte der Naturwissenschaften zeigt er, wie schon der junge Holmes vom Erkenntnisstreben seiner Zeit geprägt wurde, dadurch aber auch früh an Grenzen und Tabuzonen stieß, mit denen er in der Folge ganz anders umging als es die damalige bürgerliche Moral erlaubte. Wir lernen Holmes als kritikfähigen Geist, als wissenschaftlichen Selbstdenker, aber auch als wahrhaft künstlerischen Menschen kennen – als einen hochbegabten Bohemien, der für alle Rätsel des Lebens offen ist und sich mit einer unnachahmlichen Mischung aus strenger Logik und lebhafter Fantasie immer wieder den Grenzbereichen menschlicher Erkenntnisfähigkeit annähert. Der große Bogen, der hier vom jungen Sherlock Holmes bis hin zu seinem „Verschwinden“ in den Sussex Downs gespannt wird und dabei die Aspekte Wissenschaft, Kunst und Metaphysik auf originelle Weise zusammenführt, ist in der Sekundärliteratur zu dem legendären Meisterdetektiv wohl ohne Beispiel.
Diesem „rauschhaften“ Leseerlebnis steht, passend zum Titel des Werkes, noch eine andere Lesemöglichkeit zur Seite. Die Argumentation des Textes ist vom Autor gewissenhaft reflektiert worden; er sichert sie mit zahlreichen Verweisen auf die umfangreiche Sekundärliteratur zu Holmes ab und versäumt es auch nicht, auf argumentative Grauzonen und die Gedanken anderer begeisterter Holmes-Forscher („Sherlockianer“) hinzuweisen. In dieser akribischen Herangehensweise nimmt der Text einen stellenweise literaturwissenschaftlichen Charakter an. Dem Leser, der sich hierauf einlassen will, geht es sozusagen wie Sherlock Holmes am Mikroskop: Er muss geduldig von einer Vergrößerungsstufe zur nächsten vor- und zurückschalten, wird dafür aber – ebenso wie im Haupttext – mit einer Fülle anregender Einsichten belohnt. Auf dieser Ebene erweist sich das Buch vor allem als literarische Fundgrube, die zu zahlreichen lesenswerten Vorarbeiten und Forschungsresultaten zum Thema Holmes zurückführt und gerade auch denjenigen Lesern, die von dieser Dimension nichts wissen, Wege in die verborgene Welt „sherlockianischer“ Gedankenarbeit aufzeigt.
Um es aus meiner persönlichen Sicht zusammenzufassen: »Drogenrausch und Deduktion« ist genau das Buch, das ich mir als Holmes-Leser immer gewünscht habe. Und ich bin mir sicher, dass es sehr vielen bereits umfassend belesenen Holmes-Liebhabern, aber auch solchen, die erst seit der hohe Wellen schlagenden BBC-Serie »Sherlock« dabei sind, sich die literarische Vorlage zu erschließen, enorm viel Anregung bieten wird. Schon deshalb ist es ein Buch, das man gerne zweimal (oder noch viel häufiger) liest: mal rauschhaft inspiriert, mal kühl fokussiert auf kleinste Details und tief verborgene logische Zusammenhänge. Die dunkle, von zahllosen Sternen erleuchtete »Innenwelt des Sherlock Holmes« zu betreten, bereitet nicht weniger Vergnügen als die Originalschilderungen seiner uns alle bis heute begleitenden detektivischen Meisterleistungen.
Gerd Fischer, Frankfurt, im Oktober 2016
Einleitung
In den Jahren 2010, 2012 und 2014 strahlte die BBC die ersten drei Staffeln der Serie Sherlock aus und erzielte eine nicht unbedingt erwartbare Wirkung: Die Abenteuer des Londoner Meisterdetektivs Sherlock Holmes wurden bekannter als jemals zuvor. Mit der Übertragung der klassischen Erzählungen in das London des 21. Jahrhunderts gelang es, ein vielseitiges Interesse an Holmes und seinem loyalen Mitstreiter Dr. Watson hervorzurufen, denn außer der bereits bestehenden wurde auch eine ganz neue, bisher nicht mit den Geschichten vertraute Fangemeinde dazu angeregt, die vom Produzentenduo Steven Moffat und Mark Gatiss liebevoll inszenierten filmischen Details mit den Originalschilderungen von Arthur Conan Doyle zusammenzubringen.
Die hier vorgelegte Studie zur Innenwelt des Sherlock Holmes ist von der kenntnisreichen Machart der Moffat/Gatiss-Produktion maßgeblich inspiriert; inhaltlich basiert sie ganz auf den Originalerzählungen Doyles. Zwar ist das Aufsehen, das Sherlock weltweit auslöste, in erster Linie auf die zeitgemäße visuelle Inszenierung und die beeindruckenden Leistungen der Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch und Martin Freeman zurückzuführen, doch der Erfolg des Gesamtkonzeptes beweist vor allem eines: Die Unausschöpflichkeit der zum Teil über hundert Jahre alten Originaltexte. Dieser Aspekt ist üblicherweise nur jenem inneren Kreis von Holmes-Fans bewusst, die sich als sogenannte Holmesianer oder Sherlockianer akribisch mit dem Inhalt der sechzig klassischen, „kanonischen“ Holmes-Fälle auseinandersetzen (und in extra hierfür begründeten Periodika über ihre Resultate berichten, etwa dem seit 1946 herausgegebenen Baker Street Journal). Das von ihnen betriebene Sherlockian Reading der Originaltexte grenzt sich vom etablierten literaturwissenschaftlichen Procedere ab, indem es in gleichsam spielerischem Ernst – Sherlockian Game – darauf besteht, Holmes und Watson als historisch reale Figuren aufzufassen (bei gleichzeitiger Degradierung Arthur Conan Doyles zum bloßen Herausgeber der in Wirklichkeit von Watson verfassten Texte). Gelungene Beispiele eines Sherlockian Reading spiegeln nicht selten das Vorgehen, das auch Holmes bei der Lösung seiner Fälle zeigt: Noch winzigste Details werden genauestens unter die Lupe genommen, um bislang verborgene Zusammenhänge aufzuspüren. Offensichtlich entspricht dieser Ansatz den Worten, mit denen sich Holmes gegenüber Watson in The Boscombe Valley Mystery erklärt („Das Rätsel von Boscombe Valley“, S.115):
»Sie kennen doch meine Methode. Sie beruht auf der Beobachtung von scheinbaren Nebensächlichkeiten.«
In genau diesem Sinne will das vorliegende Buch dazu beitragen, Licht in einen bislang ungeklärten Sachverhalt zu bringen: Systematisch vorgehend und die alten Geschichten neu lesend wird die Frage untersucht, warum ausgerechnet der zu kausalanalytischen Höchstleistungen befähigte Sherlock Holmes über einen langen Zeitraum seiner Karriere Kokain und Morphium konsumierte. Dass er seine Leistungsfähigkeit dadurch gefährde, gestand er Dr. Watson, der ihn vor den langfristigen Folgen des Lasters warnte, zwar zu – trotzdem dauerte es nach ihrer ersten Begegnung noch gut fünfzehn Jahre, bis Watson in The Missing Three-Quarter das Ende der Drogeneskapaden vermelden konnte. Gewöhnlich begnügt man sich mit der von Holmes selbst getätigten Aussage, dass er Phasen geistiger Untätigkeit nicht ertrug und daher, zermürbt von Langeweile, zu harten Drogen griff. Dass er sich hierzu aber auch anders äußerte und in The Sign of Four die Wirkung des Kokains als »über alle Maßen anregend und erhellend« schilderte, wird meist ausgeblendet: Denkt man die Konsequenzen dieser Aussage zu Ende, muss der scheinbare Missbrauch i np o s i t i v e rW e i s em i tH o l m e s ’p r a k t i s c h e rA r b e i tv e r k n ü p f tgewesen sein. Die vorgelegte Untersuchung wird diese Annahme in mehreren Schritten prüfen und dabei, ganz im Sinne der Holmes’schen Methode, einige kritische Details wiederholt und unter jeweils leicht verändertem Blickwinkel aufgreifen, bis sich am Ende eine – hoffentlich – überzeugende Lösung des Problems ergibt.
In Würdigung der außerordentlich inspirierenden Vorarbeiten der weltweiten Sherlockianer-Gemeinde hat sich der Autor dafür entschieden, deren charakteristische Zugangsweise aufzunehmen bzw. über weite Strecken dieser Arbeit Holmes und Watson so zu beschreiben, als hätten sie einst wirklich von der Londoner Baker Street 221B aus ihren Beitrag zu einer besseren Welt geleistet. In diesen Passagen wird Watson, den Vorgaben des Sherlockian Reading entsprechend, als realer Chronist der überlieferten Fälle dargestellt. Trotzdem soll auch Arthur Conan Doyle gebührende Erwähnung finden, und zwar als der produktive Schriftsteller, dem wir die Erfindung der literarischen Figur Sherlock Holmes verdanken. Die vorgelegte Studie erhält somit einen leicht paradoxalen, aber beabsichtigten Anstrich, ist doch diese „eingebaute Anomalie“ unserem Untersuchungsobjekt höchst angemessen: einem hochrationalen Beobachter und Denker, der sich in unerklärlicher Selbstgefährdung dem Irrationalen geöffnet hat. Wir werden sehen, dass diese zentrale Widersprüchlichkeit nur eine von mehreren Paradoxien ist, auf die man stößt, wenn man sich gründlich mit dem Leben und der Gedankenwelt von Sherlock Holmes auseinandersetzt. Am Ende wird das Bild eines „unsterblichen“ Charakters stehen, der im Paradoxon förmlich aufging und dessen enormer Bekanntheitsgrad nur dazu beitrug, ihn nachhaltig unbekannt zu machen.
T. S., Juli 2016
1. Kapitel:
»The game is afoot!«: Zur Fiktionalisierung Arthur Conan Doyles
»Das ganze Durcheinander begann sich vor meinem geistigen Auge zu entwirren, und ich fragte mich, wie jedesmal, warum mir dies alles nicht längst schon klar gewesen war.«
(„Wisteria Lodge“)
Im Herbst des Jahres 1886 erhielt der siebenundzwanzigjährige britische Arzt und Gelegenheitsliterat Arthur Conan Doyle ein kurzes Schreiben, das ihm keine Freude bereitete (vgl. Doyle 1988, S.75):
Dear Sir,
We have read your story and are pleased with it. We could not publish it this year as the market is flooded at present with cheap fiction, but if you do not object to its being held over till next year, we will give you £25 for the copyright.
Yours faithfully, WARD, LOCK & CO.
Oct. 30, 1886
Ein Honorar von einmalig fünfundzwanzig Pfund war nicht gerade das, was Doyle – zu diesem Zeitpunkt ein »penniless doctor« (ebd. S.71) – sich erhofft hatte, und trotz seiner Armut zögerte er, das Angebot anzunehmen. Letztendlich blieb ihm jedoch kaum eine Wahl, denn das Manuskript war bereits seit einem halben Jahr durchgehend abgelehnt worden. Er erklärte sich einverstanden; 1887 erschien sein Kurzroman als Bestandteil von Beeton’s Christmas Annual, und bis zum Ende seines Lebens verdiente Doyle an dem Text nichts mehr. Materiell war die Angelegenheit also reichlich enttäuschend, aber dafür kamen auf der literarischen Ebene Dinge in Bewegung, deren Auswirkungen auf die Populärkultur fantastische Ausmaße annehmen sollten. Eher bescheiden mutet in diesem Licht der Satz an, den die Hauptfigur von Doyles Geschichte im zweiten Kapitel des Romans äußert:
»Ich weiß, dass ich das Zeug habe, mir einen großen Namen zu machen.«
Selten dürfte eine literarische Figur ihre Zukunft präziser vorausgesagt haben, denn ihr Name lautete SHERLOCK HOLMES. Mag der so gering honorierte Roman-Erstling A Study in Scarlet – zu Deutsch „Eine Studie in Scharlachrot“ – auch alles andere als Hochliteratur darstellen, in seiner Gegenwartsversion A Study in Pink, dem Pilotfilm der BBC-Serie von Steven Moffat und Mark Gatiss, erreicht er heute ganz neue Bekanntheitsgrade. Für den Protagonisten Holmes gilt dasselbe, demonstriert die aktuelle Fernsehserie doch überzeugend, wie einer vielschichtig konzipierten Figur aus dem spätviktorianischen London der Sprung in unser Jahrtausend gelingen kann, ohne dass sie im geringsten von ihrer Faszination einbüßt. Die enorm erfolgreiche TV-Adaption mit ihrer multimedial vernetzten Holmesfigur vor Augen kann man sich ein Lächeln nicht verkneifen, wenn man in Conan Doyles Autobiografie aus dem Jahr 1924 folgende Bemerkung zu den allerersten Verfilmungen liest (Doyle 1988, S.106):
»My only criticism of the films is that they introduce telephones, motor cars and other luxuries of which the Victorian Holmes never dreamed.«
Wie wir spätestens seit 2010 – also seit besagter Study in Pink – feststellen können, vermag auch der gesammelte technische Luxus des frühen 21. Jahrhunderts die Gestalt des Sherlock Holmes nicht wesentlich zu verzerren. Egal ob mit Lupe oder Elektronenmikroskop, mit Shag-Pfeife oder Nikotinpflastern, mit Telegrammen oder SMS, die Persönlichkeit des consulting detective aus der Baker Street scheint Zeiten und Räume mühelos zu überstrahlen. Genau dies führt uns zur zentralen Frage: Wer ist Sherlock Holmes, welche Zugänge haben wir zu seinem Innenleben – und vor allem, wie steht es um bestimmte Widersprüchlichkeiten, die er mit anderen großen Gestalten der Literaturgeschichte teilen mag, aber doch in ganz unvergleichlicher Form?
Antworten hierauf sind immer wieder versucht worden, viel mehr als man überblicken kann, denn die Holmes-Sekundärliteratur ist all zu umfangreich. Und doch wird man beim Wiederlesen der alten Geschichten – ebenso wie bei den Moffat/Gatiss-Verfilmungen – das Gefühl nicht los, mit einem „offenen Enigma“ konfrontiert zu sein: einer unverwechselbar scharf konturierten Figur, die mit schöner Regelmäßigkeit über sich respektive über die von ihr angewandten Ermittlungsmethoden zu dozieren pflegt, nur um letztlich in Undurchschaubarkeit zu verharren.
Der Anreiz, Licht in dieses Dunkel zu bringen, ist von je her groß gewesen. Als Startschuss gilt ein Studentenulk der gehobenen Sorte, nämlich die vom Theologen und späteren Monsignore Ronald Knox in seinen Universitätsjahren abgefasste Satire Studies in the Literature of Sherlock Holmes (1911). Knox hatte sich den bis dahin erschienen Holmes-Romanen und Erzählungen mit der Gewissenhaftigkeit eines historischkritischen Bibelforschers angenommen; er sammelte Fehler und wies auf Inkonsistenzen hin, welche ihm jede Menge Steilvorlagen boten: etwa für die These, dass nur die ersten beiden Holmes-Romane sowie die ersten dreiundzwanzig Kurzgeschichten der Feder des echten Dr. Watson entstammen, während man die danach erschienenen Werke einem „Pseudo-Watson“ zuschreiben müsse (zur Reihenfolge der Geschichten vgl. Anhang 1). Damit war der Beginn eines Interpretationsspieles eingeläutet, dessen endgültige Grundlage mit Erscheinen der letzten Sherlock Holmes-Geschichten im Jahr 1927 gegeben war: Doyles vier Romane und sechsundfünfzig kurze Erzählungen bilden zusammen die sechzig kanonischen Holmes-Fälle.1 Da Doyle sich in den späteren Werken des Kanons einige wenige „Experimente“ gestattete, werden nicht alle Geschichten von Holmes’ treuem Mitstreiter Watson erzählt (entweder löst Holmes Watson als Ich-Erzähler ab, oder es wird auf eine auktoriale Ebene gewechselt). Das Sherlockian Game, die gleichermaßen spielerische wie detailverliebt-ernsthafte Erforschung des Kanons, kann trotzdem weitgehend nach dem Knox’schen Vorbild ablaufen: Watson wird als reale Person aufgefasst, die der staunenden Welt die wahrhaftigen Erlebnisse eines realen Sherlock Holmes hinterlassen hat. Wo immer diese „Realität“ brüchig zu werden droht, müssen Erklärungen gefunden werden, und die einfachste lautet bis heute, dass Watson ein teilweise unzuverlässiger, weil überforderter Chronist gewesen sei: ob unhaltbare Jahreszahlen oder der geradezu ikonische2 Widerspruch, dass Watson seine Kriegsverletzung mal als Schuss in die Schulter („Eine Studie in Scharlachrot“, S.9), mal als Schuss ins Bein („Das Zeichen der Vier“, S.10) beschreibt – sobald Fehler auftauchen (auch und gerade in Aussagen von Holmes), werden diese routinemäßig auf den »Boswell«3 abgewälzt. Denkbar freilich sind hier auch Konstruktionen, die sowohl Watson als auch den angeblichen Herausgeber Doyle in Schutz nehmen: etwa die elegante Ausrede, dass Watson seinen Mittelsmännern in den Redaktionen und Verlagshäusern mit einer schwer leserlichen Handschrift zu schaffen machte.
Man könnte diese Art der Neuschöpfung, in der praktisch alle inhaltlichen Fehler nachträglich entschuldigt werden, als Geste des Respekts vor Arthur Conan Doyle auffassen, doch das Verhältnis der Holmes-Liebhaber zum Holmes-Schöpfer gestaltet sich bisweilen problematisch. Erstens wird Doyle im Sherlockian Game unweigerlich abgewertet; er geht als bloße Randfigur einer revidierten Realität all seiner Remiten verlustig, wenn der reale Verfasser des Kanons »John H. Watson, M. D.« sein soll (vgl. etwa Doyles Rolle bei Baring-Gould 1978, S.270f.). Die akribische Auseinandersetzung mit den Figuren Holmes und Watson tendiert zum Total-Ausschluss der Person Doyles, dessen Name hinter denen seiner Protagonisten ohnehin merklich verblasst ist. Dass mancher Sherlockianer dies gern in Kauf nimmt, hängt nun zweitens vor allem damit zusammen, dass Doyles Gedankenwelt während den letzten ca. fünfzehn Jahren seines Lebens in spiritistische Sphären abdriftete und nichts mehr von dem repräsentierte, was er zeitgleich in seinen Wissenschaftlichkeit und Logik zelebrierenden Holmes-Geschichten zu Papier brachte. Ein The Irrelevance of Conan Doyle betitelter Aufsatz des durch seine langjährigen Beiträge im Scientific American („Spektrum der Wissenschaft“) auch in Deutschland bekannten Autors Martin Gardner spricht für sich. Poststrukturalistische Literaturtheoreme à la Barthes und Foucault, in deren Fahrwasser einst (und z.T. bis heute) die „Abschaffung des Autors“ verkündet wurde, sind im Falle des Holmes-Kanons nicht erforderlich – der Autor Doyle hat durch die befremdliche Hinwendung zum Okkulten selbst für seine Auflösung gesorgt (Gardner 1974, S.128):
»There is scarcely a page in any of Doyle’s books on the occult that does not reveal him to be the antithesis of Holmes. His gullibility was boundless. His comprehension of what constitutes scientific evidence was on a level with that of members of London’s flat-earth society.«
Immerhin wäre dem so übel Gescholtenen aber positiv anzurechnen, dass er in der Lage war, seine »antithesis« bis zum Ende der Holmes-Reihe ganz unverfälscht zu erhalten (und damit seinem Publikum eine durchgehende, im großen und ganzen ungetrübte Lesefreude – was ihm in der Gegenwelt des Sherlockian Game wahrhaftig nicht zugutekommt). Dieser Punkt wäre auch insofern hervorzuheben, als Doyle (1988, S.84ff.) in seiner Autobiografie berichtet, dass er bereits 1886 von den telepathischen Fähigkeiten eines ihm vorgestellten „Mediums“ überzeugt war und seitdem der spiritistischen Bewegung mit Offenheit begegnete (zu ihrem aktiven Propagator wurde er erst etwa dreißig Jahre später). Grenzbereiche dieser Art werden in den Holmes-Geschichten nur selten berührt; wenn überhaupt geht es nicht um Geister und Gedankenübertragung, sondern um jene „letzten Fragen“, die der sinnsuchende Mensch in religiöser Hinsicht stellt. Hier aber versteht Doyle es geschickt, dem Leser Rätsel aufzugeben, denn Holmes tätigt immer wieder Äußerungen, die ganz denen eines gläubigen Menschen entsprechen – wo es doch ansonsten kaum vorstellbar ist, dass ein sperriger Bohème-Typ wie er im bürgerlichen Sinne religiös sein könnte. Wenn Watson an anderer Stelle erwähnt, dass Holmes zu Fragen der Kunst »äußerst krude Ansichten« vertrat – wir werden hierauf später ausführlich zurückkommen – dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich auch auf metaphysischem Gebiet so verhielt. Ausgeprägt-eigenwilliger Kunstsinn und ein undurchdringliches Verhältnis zur Religion sind jedenfalls zwei der Kontrastmittel, derer sich Doyle bediente, um das Schema der reinen „Denkmaschine“ zu durchbrechen. Ein drittes, und bei weitem das eindrücklichste, kommt hinzu: der Drogenkonsum von Holmes, seine Einnahme von Kokain und Morphium in Phasen der Untätigkeit. Die Figur des Sherlock Holmes kann nur ausschnittsweise (oftmals leider klischeehaft) beschrieben werden, solange all diese Aspekte nicht stimmig ineinander greifen.
Arthur Conan Doyle hat spätestens mit dem Vorwort zu His Last Bow (dem vierten, 1917 erschienenen Sammelband von Holmes-Geschichten) dazu eingeladen, sein modernes Dioskurenpaar als reale Personen zu behandeln: Die kurze Vorrede ist angeblich von Dr. Watson verfasst und unterrichtet den Leser darüber, dass der vormalige Großstadtmensch Holmes sich nunmehr in den Sussex Downs in Südengland zur Ruhe gesetzt habe.4 Doyle, der übrigens vom jungen Ur-Sherlockianer Knox persönlich angeschrieben wurde und sich von dessen akribischer Holmes-Exegese nicht wenig überrascht zeigte, ermunterte hier also seinerseits zum Sherlockian Game bzw. zur Einbettung fiktiver Figuren in die Realhistorie. Was dabei schlussendlich herauskam, kann in verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens bestaunt werden: Sherlock Holmes ist die einzige fiktive Gestalt, an die in England – sprich, London sowie seinem angeblichen Rückzugsort in Sussex – mit jenen blue plaque-Gedenktafeln erinnert wird, die ansonsten realen Personen vorbehalten sind. Auch mit Ehrenmitgliedschaften in seriösen wissenschaftlichen Gesellschaften wird zum Ausdruck gebracht, dass Holmes larger than fiction sein soll.5
Wenn für den ungeheuren Erfolg der Holmes-Geschichten eine Erklärung gesucht wird, so wäre der erste zu benennende Punkt tatsächlich ein gekonnt inszenierter Realismus.6 Dem bescheidenen, bodenständigen Kriegsveteranen Watson folgt man gerne, wenn er versucht, uns so nahe wie möglich an das Faszinosum Holmes heranzuführen. In dieser Annäherungsbewegung geschehen meist zwei Dinge. Zum einen wird die heimelige Baker Street-Atmosphäre mit den Schilderungen der Fälle kontrastiert; Holmes blüht erfahrungsgemäß nur dann richtig auf, wenn diese seinen Geist durch besonders ungewöhnliche, ja bizarre7 Einzelheiten herausfordern. Zum anderen wird Watson hier regelmäßig zum scheiternden Erzähler, denn gerade wenn er das Glück hat, dass Holmes angesichts eines besonders reizvollen Falles aus seiner üblichen Reserviertheit herauskommt und ins Dozieren gerät, geben ihm die Abläufe insgesamt Rätsel auf. Am Ende jeder Erzählung mag Holmes’ Ermittlungsverfahren in all seiner Genialität offengelegt sein, doch als denkende und handelnde Person bleibt Holmes das immer gleiche Enigma. Mit einem unserer hochtechnisierten Gegenwart angepassten Bild könnte man sagen, dass Watson wie eine partiell untaugliche Weltraumsonde ist, die zwar viele Aufnahmen vom Zielplaneten macht, aber nicht wie geplant auf diesem landet, sondern immer wieder nur vorbeifliegt. Es ist Watsons Glück, im Bannkreis von Holmes zu stehen, er kann für sich beanspruchen, sein engster Begleiter zu sein, aber er ist naturgesetzlich dazu verdammt, auf Distanz zu bleiben. Die sehr wenigen Ausnahmen, in denen Holmes – meist angesichts lebensgefährlicher Situationen – tiefere freundschaftliche Regungen zeigt, bestätigen nur diese Regel.
Watsons Scheitern am Phänomen Holmes spiegelt das Scheitern der neugierigen Leserschaft. Immer wenn Watson meint, die teilweise aufgedeckten Gedankengänge seines zutiefst bewunderten Freundes selbstständig weiterdenken zu können, fällt er bald aus allen Zusammenhängen wieder heraus und muss darauf hoffen, dass Holmes ihm das tatsächliche Konstrukt offenbart. Diese Offenbarungen werden dann, auf subtile Weise, zur Wiederholung des ersten Scheiterns, denn Watson glaubt in seinen regelmäßigen „jetzt, wo Sie es erklären, ist alles so einfach!“-Ausrufen nur, Holmes verstanden zu haben – genau betrachtet ist dies niemals der Fall; er weiß nicht, was im Kopf seines Gefährten vor sich gegangen ist; die letzten Feinheiten8 der Holmes’schen Methode bleiben verborgen. Es ist nicht nur Watsons übergroßer Abstand in Sachen Beobachtungsfähigkeit, der ihn dazu nötigt, die finale Auflösung des Rätsels durch Holmes’ typische (Selbst-)Inszenierungen abzuwarten. Vielmehr ist es sein absolutes Unverständnis der Holmes’schen Gedankenwelt, das besonders durch den Irrglauben erzeugt wird, der Bohème-Detektiv sei eine hochspezialisierte Beobachtungs- und Denkmaschine. Oft genug relativiert Holmes selbst dieses Bild und hebt die Rolle der Fantasie hervor, doch eben diese fehlt Watson: Er kann sie in Holmes’ System nicht sicher verorten; sie bleibt eine Art flüchtiger Zusatzstoff, während das wirklich Greifbare nur auf Empirie und Logik zu beruhen scheint. Einen Primat des Irrationalen, der Intuition, der Fantasie, ihre Bedeutung vor aller Logik kann Watson höchstens dann und wann erahnen, aber stimmig in Holmes’ Innenleben einzuordnen vermag er diesen Teil des Wahrheitsfindungsprozesses nie.
Dass die Innenwelt des Sherlock Holmes nicht weniger labyrinthisch sein dürfte als das von ihm so geliebte, von menschlicher Aktivität und menschlichen Abgründen wimmelnde London9, liegt nahe, und ebenso, dass dieses Labyrinth nur wenige kurze Durchstiege bietet, sondern hauptsächlich Umwege. Das Sherlockian Game ist so gesehen ein Lustwandeln in den Irrgärten des Kanons; auch randständigste Themen werden liebevoll abgehandelt, um versteckte Verbindungen aufzuspüren. Im Laufe der Jahre haben sich einige Ergebnisse verfestigt, die als Basisresultate angesehen werden und mit denen man üblicherweise weiterarbeitet, auch wenn Gegenargumente im Raum stehen mögen. Auf der biografischen Ebene etwa wird davon ausgegangen, dass Holmes 1854 geboren wurde (vgl. z.B. Ellison 1978, S.41) und dass das legendäre erste Aufeinandertreffen von Holmes und Watson im Labor des Bart’s College zu Beginn des Jahres 1881 geschah, Holmes zu diesem Zeitpunkt also vor Vollendung seines 27. Lebensjahres stand. Besagte Jahreszahl 1881 ist in London sogar auf Gedenktafeln verewigt, aber es gibt triftige Gründe, sie in Frage zu stellen: Zuletzt hat Ilmer (2015) gezeigt, dass das Jahr 1882 stimmiger der ersten Begegnung von Holmes und Watson – bzw. den bei dieser Gelegenheit fallenden legendären Worten »you have been in Afghanistan, I perceive« – zugeordnet werden kann. Zuvor dürfte Holmes in Oxford oder Cambridge studiert haben, wobei Oxford – wenngleich nur nach sehr allgemeinen Erwägungen – als wahrscheinlicher gilt (siehe Cooper 1976).
Wie bereits erwähnt, werden Probleme mit Jahreszahlen gerne dem notorisch unzuverlässigen Watson zur Last gelegt, doch gleichzeitig bietet das Sherlockian Game eine naheliegende Möglichkeit zu dessen Ehrenrettung: Demnach sah Watson sich zuweilen gezwungen, falsche Angaben zu machen, um die realen Vorfälle zwecks Schutz von Persönlichkeitsrechten10 zu verschleiern. Zwischen diesen beiden Extremen, also ungenauen Notizen einerseits und gewissenhaft vorgenommenen – zudem wohl auch von Holmes gewünschten – Unkenntlichmachungen andererseits schwanken die angebotenen Erklärungen. Tatsächlich kann man finden, dass Watson solche Änderungen (wenn schon nicht der Jahreszahl, dann zumindest von Orten und Namen, wie in The Three Students) selbst ankündigt und dem Leser von vornherein klar macht, dass auf Grundlage seines Berichtes die wahren Beteiligten nicht zu ermitteln sein werden (der Beginn von The Veiled Lodger ist besonders amüsant, da Watson sich dort gezwungen sieht, einer namentlich nicht genannten Politikerperson zu drohen, weil diese seine Diskretion nicht zu schätzen weiß). Trotzdem muss man sich fragen, ob es z.B. wirklich nötig ist, dass Holmes nach seinem tödlichen Zweikampf mit dem Verbrecherfürsten Moriarty für drei Jahre von der Bildfläche verschwindet – von 1891 bis 1894, dem sogenannten great hiatus – und Watson dessen ungeachet zwei Fälle innerhalb dieses Zeitraumes datiert: Hier kommt man nicht umhin, wieder an die aus Afghanistan mitgebrachte Gewehrkugel zu denken, die im ersten Holmes-Roman in Watsons Schulter, im zweiten aber im Bein steckt (und in der späteren Erzählung The Noble Bachelor dann wieder im Arm).
Besagter Verbrecherfürst Moriarty lieferte auch den Stoff für die wohl bekannteste Kontroverse unter den Sherlockianern. Behauptet wurde, dass Holmes die Figur des „unsichtbar“ aus dem Hintergrund agierenden Erzschurken Professor Moriarty selbst erfunden habe, oder gar an einer paranoia moriartii leide (vgl. Sheperd 1986, S.22): Moriartys Erwähnung am Beginn von The Valley of Fear sowie die in The Final Problem geschilderte, mit dem Kampf am Reichenbachfall endende Verfolgungsjagd durch Europa sollen nur den traurigen Höhepunkt des Holmes’schen Drogenproblems darstellen.11 Die Fürsprecher dieser Theorie verweisen darauf, dass Holmes die Existenz von Moriarty zwar ständig behauptet, aber beide nie zusammen von „neutralen“ Dritten beobachtet werden, erst recht nicht bei ihrem finalen Aufeinandertreffen bzw. dem angeblichen, seltsamen Ringkampf am Wasserfall (tatsächlich muss man fragen, warum Moriarty, nachdem er Holmes so geschickt in die Sackgasse gelockt und Watson kilometerweit von ihm weggelotst hat, nunmehr ohne irgendeine Waffe zum Kampf auf Leben und Tod antritt). Die konservativ eingestellten Gegner dieser Argumentation können jedoch anführen, dass Holmes während der Flucht vor Moriarty – aus dem Fenster eines Zugabteiles zeigend – Watson auf einen Verfolger aufmerksam macht, der der zuvor gegebenen Beschreibung seines Todfeindes recht genau entspricht, und ferner, dass Moriartys Spießgeselle Colonel Sebastian Moran alles andere als eine Drogenhalluzination ist, wird er doch in The Empty House von Holmes und Watson gemeinsam mit der Londoner Polizei zur Strecke gebracht. In diesem Szenario werden Holmes’ möglicherweise ausufernde Probleme mit psychoaktiven Drogen nicht abgestritten, aber die These, dass Moriarty Produkt einer drogeninduzierten Paranoia oder einer in größenwahnsinniger Manier von Holmes selbst inszenierten Täuschung gewesen sei, gilt als unhaltbar (vgl. z.B. Hall 1978).
Für unsere Untersuchung, wie sie in den folgenden Kapiteln durchgeführt werden soll, ist das Problem des Holmes’schen Drogenkonsums gleichermaßen ein Ziel- und Ansatzpunkt. Es ist Holmes’ Narkotika- und Stimulantienmissbrauch, den Watson als dessen einzigen echten Persönlichkeitsdefekt bezeichnet12 (einige andere charakterliche Abnormitäten kann er demgegenüber leicht verschmerzen) und der dem Doktor lange Zeit Kummer bereitet, bis er in The Missing Three-Quarter die erfolgreiche Überwindung der »Drogensucht« verkünden kann. Ob es sich wirklich um ein Suchtphänomen handelte (vgl. etwa Spanier 2011) ist dabei ebenso schwer zu beantworten wie die Frage, was Holmes überhaupt – und zu welchem Zeitpunkt seines Lebens – zur Einnahme harter Drogen veranlasste. Jedenfalls markiert dieses sein Verhalten ein irrationales Extrem, das sich innerhalb des sonst von ihm überlieferten, äußerst rational ausgerichteten und stets nach Kontrolle strebenden Charakters kaum stimmig einordnen lässt. Grundsätzlicher Leitfaden der folgenden Untersuchung soll daher das Verhältnis von „irrational“ versus „rational“ bei Sherlock Holmes sein. Es wird davon ausgegangen, dass eine möglichst genaue Darstellung dieses Verhältnisses zu einem vollständigeren und ganzheitlicheren Verständnis der Holmes-Figur führen sollte, und damit zur Überwindung des ausschließlich auf strenge Logik fixierten „Denkmaschinen“-Bildes.
Keineswegs soll dabei in Abrede stehen, dass Holmes als überragender Beobachter und Meister der Deduktionskunst konzipiert war. Aus diesem Grund wird hier und im Folgenden auch die Person des Erfinders Doyle nicht so ausgeblendet, wie es im Sherlockian Game üblicherweise der Fall ist. Beabsichtigt ist, der schöpferischen Leistung Doyles gerecht zu werden, indem die Figur Sherlock Holmes ganz im Stile des Sherlockian Game als reale, aber eben auch als lebendige Persönlichkeit betrachtet wird (denn es ist nichts weniger als „das Leben“ – alle Totalität des Begriffes ausschöpfend – in dem Holmes sich in unvergleichlicher Weise verortet). Demnach lief Holmes’ Karriere als consulting detective zwischen 1874 und 1881 eher langsam an, steigerte sich nach dem ersten Zusammentreffen mit Watson 188213 zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte und endete mit dem Jahr 1903 bzw. Holmes’ Rückzug in die Sussex Downs, wo der Ruheständler z.T. noch Fälle zu lösen hatte, wie beispielsweise in The Lion’s Mane. Die bevorzugten Schätzungen seines Alters, basierend auf dem Geburtsjahr 1854, werden mit dieser Rahmenchronologie übernommen, zumal leichtere Korrekturen nach oben oder unten die Argumentation nicht wesentlich stören.
„Drogenrausch und Deduktion“ steht für das Spannungsfeld von irrational und rational, welches Holmes’ Innenleben ausmacht und entlang dieser Polarität einem bisher nicht gegebenen Verständnis zugeführt werden kann. Anstelle der Begriffe „Innenwelt“ oder „Innenleben“ könnte auch eingrenzender vom Denksystem des Sherlock Holmes gesprochen werden, da sich textlich belegen lässt, dass er früh ein eigenes System der Beobachtung und Deduktion entwickelte und sich dann, in einem biografisch gesonderten Schritt, zur kriminalistischen Anwendung seiner speziellen Fähigkeiten entschloss. Diese schrittweise „Selbsterziehung“ zum herausragenden Ermittler verführt zusammen mit Holmes’ naturwissenschaftlicher Kompetenz zu der Annahme, dass besagtes Denksystem nicht anders als rein rational und wissenschaftlich vorstellbar ist. In unserer Untersuchung wollen wir jedoch besonders beachten, an welchen Stellen, und vor allem zu welchen Zwecken (!) sich Holmes den Bereich des Irrationalen offenhielt. Die einfachste Begründung hierfür lautet, dass ein Denksystem nicht per se rational sein muss: Es kann irrationale Elemente enthalten, oder zumindest nicht weiter beweisbare Bestandteile, welche man je nach Kontext Dogmen oder Axiome nennen mag. Überhaupt drängt sich die Frage auf, was genau Holmes eigentlich meint, wenn er bei verschiedenen Gelegenheiten die Bedeutung der Fantasie betont (von „Intuition“, einem von ihm seltener gebrauchten Begriff, ganz zu schweigen). „Denken“ soll im Folgenden also, der Problemstellung durchaus angemessen, auch höchst fantasievolle Gedanken umfassen (wir werden bald sehen, dass Holmes hier einer ganz besonderen Idee anhängt, nämlich einer anthropologisch ausgerichteten Fusion von Realität und Fantasie). Was den Begriff des „Systems“ anbelangt, so ist vorläufig festzustellen, dass wir uns Holmes als hochbegabten, überragenden Systemarchitekten vorzustellen haben, bei dem wir uns wenig Hoffnung machen dürfen, sämtliche Feinheiten jemals nachvollziehen zu können. Es kann jedoch begründet angenommen werden, dass er ein Gespür dafür hatte, dass die Teile eines Systems ihre Ordnung zuweilen „von selbst“14 hervorbringen: Nicht umsonst ist Holmes ein großer Liebhaber der Chemie, und wie wir später ausführen werden, dürfte die Entdeckungsgeschichte des Periodensystems der Elemente einen nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht haben. Ohne den exakt-naturwissenschaftlichen Einfluss und ein daran erzogenes Talent zur Systematisierung von Wissen (ebenso wie zur Hypothesenbildung) ist Holmes nicht vorstellbar; gleichzeitig ist er jemand, der die Wissenschaftlichkeit seiner Verfahren zur Kunst erhoben hat und im Stile eines Künstlers betreibt. Es soll gezeigt werden, dass sein System bei aller theoretischen und architektonischen Brillanz zunächst auf erfolgreiche Praxis ausgerichtet war, und dass er es gründlich genug durchdacht hatte, um sich der „unscharfen“, teilweise ins Paradoxe umschlagenden Randbereiche stets bewusst zu sein (alle auf diesem Gebiet offen bleibenden bzw. nicht direkt praxisrelevanten Fragen reservierte er für die Zeit seines Ruhestandes in den Sussex Downs). Einen solchermaßen „lebendigen“ Holmes vor Augen, sind die Voraussetzungen gegeben, um anhand der Überlieferungen des Kanons ins Detail zu gehen. Gern erinnern Sherlockianer zu Beginn derartiger Untersuchungen daran, wie Holmes im Angesicht neuer Herausforderungen mit einem »the game is afoot!« Shakespeare’s Henry V. paraphrasiert – wir wollen vorausblickend hinzufügen, dass dieses Zitat nicht, wie oft angenommen, für reine Jagdlust steht,15 sondern für den Beginn eines Krieges (siehe editorische Notiz in Doyle 2005e, S.266): Es ist der Krieg gegen das Böse, dem Sherlock Holmes sich mit allen (= von ihm außerordentlich tief durchdachten) Konsequenzen verschrieben hat.
„The death of Sherlock Holmes“, Illustration von Sidney Paget zu The Final Problem (1893).
Professor James Moriarty, der sich am 4. Mai 1891 am südlich von Meiringen gelegenen Reichenbachfall den tödlichen Zweikampf mit Sherlock Holmes lieferte. Illustration von Sidney Paget zu The Final Problem (1893).
2. Kapitel:
Die Frau und das Leben: Scandal in Bohemia
»Die ganze Sache ist sehr eigenartig und komplex, Watson.«
»Was treibt Sie denn dazu, sie weiterzuverfolgen? Was haben Sie davon?«
»Allerdings, was habe ich eigentlich davon? Es ist Kunst um der Kunst willen, Watson.«
(„Der Rote Kreis“)
Als die Figur des Sherlock Holmes in zwei 1887 und 1890 erschienenen kurzen Romanen (A Study in Scarlet und The Sign of Four) erstmals das Licht der Welt erblickte, erregte sie zunächst kein besonderes Aufsehen. Erst mit der in der Juli-Ausgabe des Strand Magazine abgedruckten Kurzgeschichte A Scandal in Bohemia von 1891 setzte die beispiellose Erfolgsgeschichte der Holmes-Reihe ein, und bekanntlich fühlte sich Arthur Conan Doyle von seiner Schöpfung bald derartig in seinen sonstigen literarischen Ambitionen eingeengt, dass er mit der dreiundzwanzigsten, im Dezember 1893 erschienenen Erzählung The Final Problem die Serie beendete und sein Millionenpublikum mit dem angeblich tödlich endenden Zweikampf am Reichenbachfall entsetzte.
Doyle hielt zehn Jahre lang durch, bis die – mittlerweile ins Astronomische gestiegenen – finanziellen Anreize übermächtig wurden und er die Produktion von Holmes-Kurzgeschichten wieder aufnahm16. An seiner Hauptfigur musste er rein gar nichts ändern, vielmehr lässt sich feststellen, dass schon die ersten beiden Romane und die erste Erzählung A Scandal in Bohemia ausgereicht hatten, um einen Charakter zu installieren, der das Potenzial zum literarischen Selbstläufer und Dauerbrenner besaß. Doyles geschicktes Changieren zwischen gemütlichem Baker Street-Realismus und den unvermittelt einbrechenden Szenarien des Schreckens und des Absurden wurde im obigen Kapitel bereits angesprochen, so dass nun der Protagonist selbst, welcher souverän zwischen beiden Welten agiert und mit kaltem Verstand noch den verworrensten und erschreckendsten Herausforderungen die Stirn bietet, ins Zentrum der Untersuchung rücken soll.
Es besteht kein Zweifel, dass vor allem Holmes’ siegreiche Rationalität immer wieder fasziniert, und dass die wenigen Merkmale, die vom Bild einer hocheffizienten Denkmaschine ablenken – sprich die Hinweise auf seinen Kunstsinn, auf seine (gemessen an seiner hageren Erscheinung) überraschenden Körperkräfte, vor allem aber auf seinen unverständlichen Drogenkonsum – eher als schmückendes Beiwerk erscheinen, die das Enigma einer einzigartigen, ebenso bewunderungswürdigen wie irritierenden Persönlichkeit literarisch abrunden. Holmes ist ein polarer Charakter; die auffälligste Polarität besteht entlang der „vertikalen“ Achse von Rationalität und Irrationalität, sprich seiner wissenschaftlich geschulten Beobachtungs- und Kombinationsgabe einerseits und seiner Flucht in drogeninduzierte Dämmerzustände andererseits. Aus Sicht des Erzählers Watson beinhaltet diese Polarität eine moralische Ambivalenz, Holmes scheint eine rationale Heldenfigur zu sein, die von unerklärlichen Dämonen immer wieder in den Sumpf irrationaler Selbstzerstörung17 gelockt wird (und die, eigentlich ebenso unerklärlich, stets mit enormer Tatkraft aus ihren Drogen-Träumereien zurückzukehren vermag, sobald die reale Welt neue Herausforderungen liefert). Überspitzt könnte man sagen, dass Holmes’ innere Spaltung den krassen Gegensatz zwischen erobernd-fortschrittlicher Ratio des Spätviktorianismus und antisozialen Niederungen der Londoner Gauner- und Verbrecherwelt spiegelt (letztere uferten mit den Ripper-Lustmorden von 1888 in geradezu antikulturelle Dimensionen aus, also den höchstmöglichen Gegensatz zum viktorianischen Selbstverständnis).
Betrachten wir zunächst die Installation der wissenschaftlichen Seite. In seiner 1924 erschienenen Autobiografie schildert Doyle (1988, S.26), wie die effektvoll dargebotenen diagnostischen Fähigkeiten seines Universitätslehrers Dr. Joseph Bell (1837-1911)18 zur Inspiration wurden:
»It is no wonder that after the study of such a character I used and amplified his methods when in later life I tried to build up a scientific detective who solved cases on his own merits and not through the folly of the criminal.«
Auf die Ähnlichkeit zwischen methodisch durchgeführter medizinischer Diagnose und den Deduktionstechniken von Holmes ist später oft genug hingewiesen worden (etwa Seboek & Seboek 1982, Miller 1985). Beobachtungsgabe und wissenschaftliche Denkweise stehen klar im Zentrum der Holmes-Konzeption, als Doyle 1886 mit A Study in Scarlet zur Tat schreitet (Doyle 1988, S.74):
»I thought of my old teacher Joseph Bell, of his eagle face, of his curious ways, of his eerie trick of spotting details. If he were a detective he would surely reduce this fascinating but unorganized business to something nearer to an exact science. I would try if I could get this effect. It was surely possible in real life, so why should I not make it plausible in fiction? It is all very well to say that a man is clever, but the reader wants to see examples of it – such examples as Bell gave us every day in the wards.«
Über die „dunkle“ Seite von Holmes erfahren wir direkt von Doyle jedoch nichts, so dass hier nur das Sprachrohr der Holmes-Geschichten, sprich Holmes’ Kompagnon Dr.Watson, als Informationsquelle genutzt werden kann. Wie bereits angedeutet, reichen die ersten beiden Holmes-Romane und die erste Holmes-Erzählung vollkommen aus, um das gängige Bild der Situation nachzuzeichnen. In A Study in Scarlet kann sich Watson unmittelbar nach dem Einzug in die Baker Street noch keine übermäßigen Unvernünftigkeiten seines Mitbewohners vorstellen („Eine Studie in Scharlachrot“, S.19f.):
»Mit Holmes war keineswegs schwierig auszukommen. Er war von ruhiger Art und hatte geregelte Gewohnheiten. Selten war er nach zehn Uhr abends noch auf den Beinen, und immer hatte er bereits gefrühstückt und das Haus verlassen, bevor ich morgens aufstand. Bisweilen verbrachte er den Tag im Chemie-Laboratorium, manchmal in den Sezier-Räumen, und gelegentlich auf langen Spaziergängen, die ihn in die niedersten Teile der Stadt zu führen schienen. War er arbeitswütig, so vermochte nichts seine Energie zu übertreffen; hin und wieder setzte jedoch eine Reaktion ein, und dann pflegte er tagelang auf dem Sofa im Wohnraum zu liegen, wobei er vom Morgen bis zum Abend kaum ein Wort sagte oder einen Muskel bewegte. Bei derlei Gelegenheiten habe ich in seinen Augen einen solch verträumten, leeren Ausdruck bemerkt, dass ich ihn hätte verdächtigen mögen, irgendeinem Narkotikum19 zu frönen, hätte nicht die Mäßigung und Reinlichkeit seiner ganzen Lebensführung eine derartige Annahme verboten.«
Das Thema Drogenkonsum wird im weiteren Verlauf der Handlung nicht mehr angesprochen; Watson bleibt in dieser Hinsicht zunächst uninformiert. Der Folgeroman The Sign of Four hingegen schildert bereits im ersten Satz, wie Holmes zum Kokainfläschchen greift, um sich eine Spritze zu setzen, sowie Watsons Verbitterung über diese charakterliche Anomalie seines Freundes. Im folgenden Streitgespräch gesteht Holmes zu, dass er sich möglicherweise durch den Konsum von Kokain und Morphium gesundheitlich gefährde, dass er anders aber nicht in der Lage sei, längere Phasen geistiger Untätigkeit zu ertragen. Watson versucht, ihn wieder auf das Gleis komplexer intellektueller Herausforderungen zurück zu führen: Es kommt zu der berühmten Episode, in der er Holmes bittet, seine Taschenuhr auf Hinweise auf den Vorbesitzer zu untersuchen. Mit einer Kette zutreffender Deduktionen20 verblüfft Holmes ihn daraufhin so sehr, dass der aus der Fassung gebrachte Watson zunächst nichts als dreiste Scharlatanerie vermutet. Holmes bleibt gelassen und erläutert seinen Gedankengang, Watson bedauert seine Anschuldigungen, dann kündigt die Hauswirtin Miss Hudson unerwarteterweise eine Klientin an, und Holmes darf sich über einen neuen Fall freuen. Erst am Ende des Romans greift er wieder zum Kokain – dem sicher nicht glücklichen Watson andeutend, dass er sich dies als Belohnung nach seinem vorangegangenen Ermittlungserfolg verdient habe.
Holmes ist damit als detektivisches Genie eingeführt, auf dem der Schatten des Drogenkonsums liegt – wenn auch nicht der Drogensucht, denn bei der Bearbeitung seiner Fälle kann Holmes auf Kokain problemlos verzichten (in diesen Phasen sind Kaffee und der berüchtigte, starke Shag-Tabak die Mittel der Wahl). Die erste Holmes-Kurzgeschichte A Scandal in Bohemia jedenfalls bekräftigt dieses durch die Romane vorgezeichnete Bild. Eingeleitet wird sie damit, dass Watson, der mittlerweile Mary Morstan – die Klientin aus The Sign of Four – geheiratet hat und aus der Baker Street ausgezogen ist, seinem alten Freund Sherlock Holmes einen abendlichen Besuch abstattet. Holmes’ Drogenkonsum kommt dabei zweimal zur Sprache, zunächst in Form eines allgemeinen Rückblickes („Ein Skandal in Böhmen“, S.8):
»(…) Holmes dagegen, der jede Form von Gesellschaft mit seiner ganzen Bohème-Seele verabscheute, blieb in unserer Behausung in der Baker Street, vergrub sich zwischen seinen alten Büchern und verbrachte die Wochen abwechselnd mit Kokain und Ehrgeiz, der Schläfrigkeit der Droge und der unbezähmbaren Tatkraft seines lebhaften Wesens.«
Sodann auf die Gegenwart bezogen, als Watson von der Straße aus Holmes durch das Fenster hindurch erkennen kann (ebd. S.8f.):
»Seine Räume waren strahlend hell erleuchtet, und noch als ich emporschaute, sah ich seine große hagere Gestalt zweimal als dunkle Silhouette an der Gardine vorbeigehen. Er schritt schnell und versunken im Raum auf und ab, das Kinn auf der Brust, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Mir, der ich alle seine Stimmungen und Angewohnheiten kannte, erzählte seine Haltung und sein Verhalten ihre Geschichte. Er war wieder bei der Arbeit. Er hatte sich aus den von der Droge erschaffenen Träumen erhoben und war einem neuen Problem eng auf der Fährte.«
Der Anfang von A Scandal in Bohemia ist vor allem aber deshalb interessant, weil hier unbemerkt der Widerspruch zwischen der „Denkmaschine“ Holmes und seinem Drogenkonsum auf die Spitze getrieben wird, und zwar in einer Form, die bisher nie eine zufriedenstellende Auflösung erfuhr. In den ersten drei Sätzen geht es gleichermaßen um Frauen wie auch um die eine ganz besondere Frau, welche im weiteren Verlauf der Handlung zu Holmes’ Widersacherin wird (ebd. S.7):
»Für Sherlock Holmes bleibt sie immer die Frau. Selten habe ich ihn sie mit einem anderen Namen erwähnen hören. In seinen Augen überstrahlt und beherrscht sie ihr gesamtes Geschlecht.«
Direkt danach geht es um die Gefühle, die diese eine, idealtypische Frau bei Holmes auslösen könnte, bzw. niemals auslöste (ebd.):
»Keineswegs war es so, dass er für Irene Adler eine mit Liebe verwandte Empfindung gehegt hätte. Alle Gefühle, und dieses eine ganz besonders, waren seinem kalten, genauen, aber wundervoll ausgewogenen Geist zuwider. Für mich war er die vollkommenste Denk- und Beobachtungsmaschine, die die Welt je gesehen hat; als Liebhaber hätte er sich jedoch in eine falsche Position begeben. Über die sanfteren Leidenschaften sprach er niemals anders denn mit einer höhnischen oder spöttischen Bemerkung. Als Beobachter kamen ihm diese Regungen prächtig zupass – sie eigneten sich vorzüglich dazu, den Schleier über den Beweggründen und Handlungen der Menschen zu lüften. Dem geübten Denker hingegen wäre das Zulassen solcher Einflüsse in sein kompliziertes und feinstens austariertes Seelenleben gleichbedeutend gewesen mit der Einführung eines Ablenkungsfaktors, der all seine geistigen Erträge zweifelhaft machen musste.«