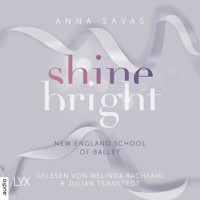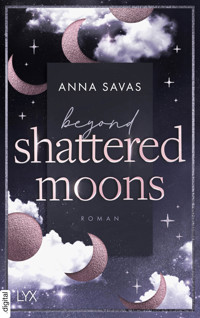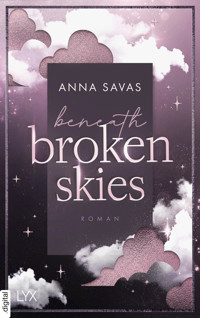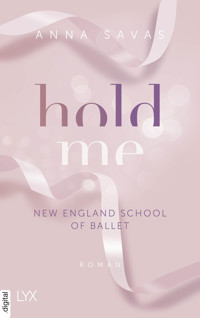11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: London is Lonely
- Sprache: Deutsch
DAMALS habe ich ihn verlassen, um mich selbst zu retten
JETZT muss ich ehrlich sein, um uns zu retten.
DAMALS habe ich sie nicht aufgehalten, als sie gegangen ist.
JETZT muss ich sie festhalten, wenn ich sie nicht wieder verlieren will.
JETZT können wir wieder wir sein, wenn wir mutig genug sind.
Band 3 der LONDON IS LONELY-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Anna Savas
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Motto
Playlist
Glossar
Prolog
Nachricht #17
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Fragen aus dem Publikum
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Fragen aus dem Publikum
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Fragen aus dem Publikum
Fragen aus dem Publikum
Fragen aus dem Publikum
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Fragen aus dem Publikum
Fragen aus dem Publikum
Fragen aus dem Publikum
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Impressum
ANNA SAVAS
Between Fading Stars
Roman
ZU DIESEM BUCH
Wes Knight ist zurück in London. Doch nach dem tragischen Unfall, bei dem er zeitweise sein Gedächtnis verlor, ist nichts mehr, wie es war. Und auch wenn ihm sein Job in der Presseabteilung von Prince Publishing Halt gibt und die Erinnerungen langsam zurückkehren, bleibt das Gefühl, fehl am Platz zu sein. In seiner Familie, im Verlag, in seinem eigenen Leben. Als wären das nicht genug Probleme, findet Wes bei seinem ersten großen Verlagsevent auch noch heraus, dass sich hinter dem Pseudonym der gefeierten Debütautorin niemand anders verbirgt als Hailey Clarke – seine erste große Liebe. Die Frau, die ihn verließ, als er sie am allermeisten gebraucht hätte. Mit ihr auf Lesereise gehen zu müssen kommt einer Katastrophe gleich, und auch Hailey macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich Schöneres vorstellen kann, als jeden Tag mit Wes zusammen zu sein. Doch zwischen all dem Schmerz und den unausgesprochenen Worten, ist da auch diese alte Vertrautheit, ein Hauch von Zuhause und das Gefühl, gleichzeitig zu fallen und gehalten zu werden, das sich einfach nicht leugnen lässt. Wenn das Davor nicht mehr existiert, und ein Danach völlig ausgeschlossen scheint, ist vielleicht jetzt genau der richtige Moment, den Menschen zurück in sein Leben zu lassen, den man nie loslassen konnte …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Anna und euer LYX-Verlag
Für alle, die schon mal feststellen mussten, dass auch die schönsten Träume manchmal wehtun können.
Und für alle, die ihren Platz im Leben noch suchen.
»There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.« – Ernest Hemingway
PLAYLIST
red (taylor’s version) – taylor swift
call your mom – noah kahan, lizzy mcalpine
love you from a distance – ashley kutcher
sad beautiful tragic (taylor’s version) – taylor swift
i hate that it’s true – dean lewis
amnesia – 5 seconds of summer
i told you things – gracie abrams
to love someone – benson boone
… what are we? – lizzy mcalpine
fortnight – taylor swift, post malone
all too well (10-minute-version) (taylor’s version) – taylor swift
the only thing left – vincent lima
the smallest man who ever lived – taylor swift
family line – conan gray
favorite crime – olivia rodrigo
because i liked a boy – sabrina carpenter
blue – billie eilish
die in your arms – ashley kutcher
best day of my life – tom odell
in the kitchen – reneé rapp
cool – gracie abrams
hate to be lame – lizzy mcalpine, finneas
down bad – taylor swift
the manuscript – taylor swift
GLOSSAR
PSEUDONYM
Ein Pseudonym ist der ausgedachte Name einer Person, unter der sie z. B. als Autor:in veröffentlicht. Es wird anstelle des realen Namens verwendet, manchmal um die Identität zu verschleiern, manchmal aber auch, weil der ausgedachte Name schöner klingt oder einfach besser zu dem jeweiligen Genre passt, in dem man veröffentlicht. So schreiben z. B. einige deutschsprachige Autor:innen unter einem englischen Namen. Man unterscheidet außerdem zwischen einem offenen und einem geschlossenen Pseudonym.
OFFEN
Bei einem offenen Pseudonym ist die wahre Identität der Autor:in bekannt, es wird oft dazu genutzt, wenn man einen Genrewechsel vornimmt.
GESCHLOSSEN
Bei einem geschlossenen Pseudonym ist die wahre Identität der Autor:in dagegen nicht bekannt.
LEKTOR:IN
Ein:e Lektor:in ist die Schnittstelle zwischen Autor:in und Verlag. Ihre Aufgaben sind sehr vielfältig, es geht nicht nur darum, Texte daraufhin zu prüfen, ob sie in das Verlagsprogramm passen und diese nach der Prüfung einzukaufen und mit den Autor:innen an den Texten zu arbeiten. Eigentlich kann ein:e Lektor:in vielmehr als Projektmanager:in gesehen werden, denn Kalkulationserstellung, das Schreiben von Klappentexten und die Zusammenarbeit mit Marketing, Vertrieb, Herstellung etc. gehören genauso zu ihrem Aufgabenbereich.
(Und an manchen Tagen macht sie auch solche Dinge, wie einen Knoten im Kopf einer Autor:in zu lösen und ihr zu versichern, dass alles gut wird und das Buch keineswegs so schlecht ist, wie diese:r glaubt.)
LEKTORAT
Im Lektorat wird der Text von Autor:in und Lektor:in überarbeitet, man unterscheidet dabei zwischen inhaltlichem und sprachlichem Lektorat.
INHALTLICH
Das inhaltliche Lektorat ist meistens die erste Runde, in der das Manuskript inhaltlich überarbeitet wird. Es wird unter anderem darauf geachtet, ob ein Text logisch schlüssig aufgebaut wurde, ob es Plot Holes gibt und ob die Charaktere eine authentische Entwicklung durchlaufen. Es kann unter Umständen vorkommen, dass währenddessen ganze Kapitel gestrichen und neu geschrieben werden, um die Handlung weiter auszubauen oder den Figuren mehr (emotionale) Tiefe zu verleihen.
SPRACHLICH
Im sprachlichen Lektorat wird vor allem auf die Sprache (ach was!) und die Stilistik geschaut. Die Lektor:in geht den Text durch, sucht nach (Wort-)Wiederholungen und streicht z. B. Füllwörter heraus. Der Text wird in dieser Phase des Lektorats aufpoliert, allerdings ist es auch die Aufgabe der Lektor:in, dem Stil der Autor:in treu zu bleiben, sodass manchmal z. B. Wiederholungen stehen bleiben, anstatt gestrichen zu werden, weil sie zum Stil der Autor:in gehören.
KORREKTORAT
Nach dem Lektorat geht das Manuskript ins Korrektorat. Die Korrektor:innen prüfen alles noch mal auf Herz und Nieren, damit sich auch nirgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Ist nirgendwo ein Leerzeichen zu viel? Fehlt noch ein Komma? Gibt es einen Buchstabendreher? Manchmal wundert man sich, was da noch alles gefunden wird, und darum ist auch dieser Schritt unersetzlich.
DRUCKFAHNE
Die Druckfahne ist das Dokument, das am Ende des ganzen Prozesses gedruckt wird (yay!). Der Text ist lektoriert, korrigiert und gesetzt und kann nach einer letzten Prüfung gedruckt werden. Meist liest die Autor:in die Druckfahne vor der Druckfreigabe noch mal, um allerletzte Unstimmigkeiten zu finden und zu korrigieren, denn es kann sein, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und doch noch Kleinigkeiten im Lektorat und Korrektorat durchrutschen.
LESEREISE
Bei einer Lesereise reist die Autor:in zu mehreren Buchhandlungen in verschiedenen Städten, um ihr Buch vorzustellen und gegebenenfalls daraus zu lesen. Dabei trifft sie viele liebe Menschen und freut sich darüber, ihnen von ihrem Buch zu erzählen.
BELEGEXEMPLAR
Wenn ein Buch veröffentlicht wird, bekommt die Autor:in eine vertraglich festgelegte Anzahl an Exemplaren zur eigenen Verwendung, um Gewinnspiele zu machen oder sie zu verschenken – oder um sie ins eigene Bücherregal zu stellen und die ganze Zeit ansehen zu können.
REZENSIONSEXEMPLAR
Rezensionsexemplare werden als Freiexemplare bei Neuveröffentlichungen an die Presse und an Blogger:innen verschickt. Als Gegenleistung schreiben die Blogger:innen Rezensionen auf verschiedenen Portalen oder bei Social Media. Man kann Rezensionsexemplare aktiv beim Verlag anfragen, oft werden sie aber auch als Überraschung so verschickt.
PROLOG
Wes
Vergangenheit
18 Jahre alt
Man ist nicht vorbereitet auf die schlimmen Dinge im Leben. Egal, wie sehr man im Vorfeld jedes Szenario zerdenkt. Es spielt keine Rolle. Man kann sich nicht darauf vorbereiten, wann und wie das eigene Leben auseinanderbricht. Noch weniger kann man sich darauf vorbereiten, dass auf die erste Katastrophe möglicherweise noch eine zweite folgt.
Vielleicht kann auch einfach nur ich das nicht. Vielleicht habe ich mich zu sehr darauf konzentriert, dass meine Familie kaputtgeht, um zu bemerken, dass mit meiner Beziehung das Gleiche passiert.
Denn auf ein »Wir müssen reden« kann nichts Gutes folgen.
Nur die nächste Katastrophe.
»Was ist los?«, frage ich, vollkommen ahnungslos, weil ich nun mal ahnungslos bin. Hailey ist meine erste Freundin, ich habe keine Erfahrungen im Schlussmachen. Ich weiß nicht, wie so was läuft. Ich weiß nicht, dass es manchmal genauso klischeehaft ist, wie es in Filmen dargestellt wird.
Hailey weicht einen Schritt zurück und meinem Blick aus. Sie entzieht mir ihre Hand und schlingt beide Arme um ihre Taille. Ihre Brust hebt sich, als sie tief durchatmet und mich dann doch wieder anschaut. Aus Augen, deren Farbe mich immer an einen klaren Sommerhimmel denken lässt. Absolut kitschig, aber so ist das nun mal, wenn man verliebt ist. Doch als Hailey endlich antwortet, begreife ich, dass ich offensichtlich der Einzige bin, der noch verliebt ist.
»Das mit uns funktioniert nicht mehr.« Ihre Stimme wankt, meine Welt bei ihren Worten auch.
»Was soll das heißen?« Irritiert runzle ich die Stirn. Ich bin mir sicher, mich verhört zu haben. Sie kann das nicht tatsächlich gesagt haben.
Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. Oder sind es schon zehn Tage? Möglicherweise auch zwei Wochen? Scheiße, keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren, bei all dem Chaos hier zu Hause.
Welcher Tag ist heute überhaupt? Vermutlich sind es wirklich schon zwei Wochen. Wie konnte das passieren? Wir haben telefoniert und jeden Tag geschrieben. Und sie hat immer beteuert, es wäre okay, dass wir uns gerade nicht treffen. Dass ich mir keinen Kopf darüber machen soll, meine Familie würde vorgehen. Jetzt weiß ich, warum sie nicht sauer war, dass ich keine Zeit für sie hatte.
»Wes … bitte.« Ihr Blick fleht mich an.
Bitte zwing mich nicht dazu, das noch mal auszusprechen.
Aber sie muss. Weil ich es nicht verstehe.
Ich schüttle den Kopf, unfähig, irgendwas zu erwidern.
»Wir funktionieren nicht mehr«, wiederholt sie.
Funktionieren. Als wäre unsere Beziehung … was? Irgendwas Technisches? Das funktionieren muss?
Der Gedanke ist so absurd, ein ungläubiges Lachen steigt in mir auf. Aber es findet keinen Weg hinaus, denn meine Kehle ist wie zugeschnürt. Weil es scheißegal ist, welches Wort Hailey benutzt. Der Sinn dahinter ist dann irgendwie doch nicht nicht zu verstehen.
»Du machst Schluss.« Es ist Frage und Feststellung in einem.
»Ja.« Zwei Buchstaben, so leise und erstickt, dass ich sie kaum höre.
Hailey streicht sich eine blonde Haarsträhne hinters Ohr, ihre Augen glänzen, sie presst die Lippen zusammen, und ich weiß, dass sie gleich zu weinen anfängt. Und dass sie sich mit aller Macht davon abhalten will, weil sie es hasst, zu weinen. Sie hasst es, und deswegen tut sie es nicht. Niemals. Nicht mal bei den Disney-Filmen, bei denen sogar ich heulen muss.
Aber irgendwas ist anders heute. Irgendwas ist anders an ihr, ich kann nur nicht … Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich weiß, dass etwas anders ist. Sie ist anders. Fremd irgendwie. Als würde gerade nicht das Mädchen vor mir stehen, mit dem ich in den letzten zwei Jahren so viel Zeit verbracht habe wie möglich.
Mir schwirrt der Kopf, alles dreht sich.
»Warum? Ist es wegen …« Ich stocke, meine Augen zucken zur Tür. Sie ist geschlossen, deswegen sehe ich ihr Gegenstück auf der anderen Seite des Flurs nicht. Adams Tür.
Adam, der rausgefunden hat, dass Mum und Dad und ich ihn belogen haben. Dass wir Geheimnisse hatten. Obwohl man es kaum rausfinden nennen kann, wenn er einfach ein Gespräch mitbekommen hat, das er nie hätte hören dürfen. Es ist meine Schuld, was vor meiner Zimmertür passiert. Es ist meine Schuld, dass unsere Familie auseinanderbricht, weil ich den Mund nicht halten konnte. Weil ich das Geheimnis nicht länger runterschlucken und in mir verschließen konnte, so wie in den letzten Jahren.
»Das ist es nicht, Wes. Wirklich nicht.«
»Was ist es denn dann? Ich meine … Es war doch alles gut?« Ich bin mir schon in der Sekunde nicht mehr sicher, in der mir die Frage über die Lippen kommt. Man neigt doch irgendwie immer dazu, zu denken, dass alles gut ist, bis es das eben nicht mehr ist. Aber Verdrängung funktioniert leider nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich habe diesen Punkt offensichtlich erreicht.
»War es auch.« Hailey blinzelt, legt den Kopf in den Nacken und starrt an die Decke, als würde das dabei helfen, die Tränen zurückzudrängen. Als sie mich wieder anguckt, sind ihre Augen rot, aber sie weint nicht. »Es war alles gut, und es war schön. Aber du gehst in ein paar Wochen nach Oxford und ich –«
»Du kommst doch mit«, unterbreche ich sie, weil das der Plan war. Das ist der Plan. Seit über einem Jahr. Seit wir auf dem Internat zum ersten Mal darauf vorbereitet wurden, uns für Unis zu bewerben. Ich muss nach Oxford, das steht nicht zur Debatte. Meine ganze Familie hat dort studiert, ich kann mit der Tradition nicht brechen. Nicht jetzt. Nicht wenn meine Eltern wegen der Situation mit Adam schon genug leiden. Aber wir haben so oft darüber geredet, dass Hailey und ich zusammen dorthin gehen, dass ich nicht einen einzigen Gedanken daran verschwendet habe, dass es noch eine andere Option gibt. Sie wollte das ja auch.
»Nein«, sagt Hailey, ihr Blick flackert, ihre Stimme ist allerdings fest. »Ich komme nicht mit. Ich wurde nicht angenommen.«
»Das ergibt gar keinen Sinn!«, platzt es aus mir heraus. Tut es wirklich nicht. Hailey hat ihren Schulabschluss als Beste unseres Jahrgangs gemacht. Jede Uni sollte sich um sie reißen. Wie kann es sein, dass ich einen Platz bekommen habe und sie nicht? »Du hattest doch die Zusage?«
»Ja, na ja, sie haben sich geirrt. Ich habe keinen Platz, und ich kann’s nicht ändern.« Sie zuckt mit den Schultern, doch nichts daran wirkt so gleichgültig, wie sie es gerne hätte.
»Ich spreche mit Dad«, sage ich, ohne eine Sekunde zu zögern, ohne auch nur eine Sekunde lang nachzudenken. »Bestimmt kennt er jemanden, der –«
»Nein!« Hailey fällt mir so scharf ins Wort, dass ich zurückzucke. Da ist etwas Gehetztes, Panisches in ihren Augen. Etwas, das ich noch nie bei ihr gesehen habe. Etwas, das mir Angst macht. »Ich will nicht, dass du mit deinem Dad redest. Ich will nicht, dass du irgendwas für mich drehst. Ich will das nicht. Ich will das alles nicht. Und ich will … Ich will dich nicht.« Vier Wörter, die sie nur erstickt hervorbringt, und doch ist dieser kleine Satz das wahre Problem, richtig?
Es geht nicht um die Uni.
Es geht um mich.
Um sie.
Um uns.
Und sie will das nicht mehr.
Sie will mich nicht mehr.
Ich blinzle, hinter meiner Stirn pocht es, meine Augen brennen, als mein Herz bricht. Es zerbricht einfach. Als wäre nichts dabei. Ein Satz – und alles, was war, zählt nicht mehr.
»Du willst mich nicht mehr«, wiederhole ich, es fühlt sich an, als würde ich Scherben schlucken.
Hailey verzieht das Gesicht, als hätte sie Schmerzen. Aber das kann nicht sein, weil sie doch diejenige ist, die mir wehtut. »Nein.«
»Du liebst mich nicht mehr?«
Halt die Klappe, fleht eine Stimme in meinem Kopf. Halt einfach deine verfluchte Klappe und mach es nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Sie hat doch schon gesagt, dass sie dich nicht mehr will. Warum musst du es noch schlimmer machen?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht weil ich irgendwie hoffe, dass es einen Unterschied macht, ob sie mich nicht mehr will oder ob sie mich nicht mehr liebt. Es ist eine dumme Illusion. Es macht keinen Unterschied. Das Ergebnis ist dasselbe. Es ist vorbei, weil sie eine Entscheidung getroffen hat.
Hailey zögert für den Bruchteil einer Sekunde, doch dann reckt sie das Kinn, und ihr »Nein« lässt keinen Raum für Zweifel.
Ich höre sie, klar und deutlich, und trotzdem sperrt sich etwas in mir gegen ihre Worte. Es fühlt sich falsch an. Alles fühlt sich einfach nur verdammt falsch an.
Sie fühlt sich falsch an.
Etwas an ihr ist anders, und ich kriege nicht zu fassen, was.
Was, was, was zur Hölle übersehe ich?
»Hailey, was ist passiert? Das ist doch … Das bist doch nicht du.«
»Doch, Wes. Genau das bin ich.«
Ich schüttle den Kopf. »Irgendwas stimmt nicht. Ich kenne dich!«
»Nein.« Sie stößt ein verzweifeltes Lachen aus. »Du kennst mich nicht. Du hast keine Ahnung, wer ich bin, Wes.«
Das ist nicht wahr, will ich widersprechen. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist Hailey. Du bist meine Freundin. Du liebst mich.
Aber sie liebt mich nicht. Sie will mich nicht. Sie hat es ja gesagt, gerade eben erst.
Sie wendet sich ab, ich bewege mich ganz von selbst, zwei Schritte, dann schließen sich meine Finger um ihr Handgelenk. »Warte. Lass uns reden. Lass uns das klären und –«
»Da gibt es nichts zu klären!« Mit einem Ruck befreit sie sich aus meinem Griff. »Ich liebe dich nicht mehr, verstanden? Ich will dich nicht mehr. Ich will uns nicht mehr. Es ist vorbei!«
Jedes Wort ist wie ein Pfeil, der sich in meine Brust bohrt. Scharf und potenziell tödlich. Meine Sicht verschwimmt, ich höre ihr leises »Es tut mir leid«, bevor sie geht und erst aus meinem Zimmer und dann aus meinem Leben verschwindet.
NACHRICHT #17
»Hey, hier ist Wes. Ich kann gerade nicht drangehen. Hinterlasst eine Nachricht, dann rufe ich zurück.«
»Hey, Wes, ich bin’s. Ich bin mir nicht sicher, ob du das wissen willst, aber ich dachte, ich erzähl’s dir lieber, bevor du es später von jemand anderem erfährst … Es gibt da eine Autorin bei Prince, Liz Brown. Sie hat einen Fantasyroman geschrieben, der im November erscheint. FadingDarkness. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Madelyn meinte, ihr hättet bei einem Termin mal darüber gesprochen. Wir waren vorhin mit Meredith mittagessen, und sie hat über das Buch gesprochen und darüber, dass die Autorin ein Pseudonym benutzt. Und … ach, fuck, ich weiß echt nicht, wie ich dir das sagen soll, vielleicht interessiert es dich auch nicht, aber diese Liz Brown … Das ist Hailey. Sie lebt wohl wieder in London, und ja, keine Ahnung, ich dachte einfach, du solltest das wissen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr euch im Verlag mal über den Weg laufen solltet oder so. Vielleicht ist es dir auch wirklich egal, aber ich an deiner Stelle würde das wissen wollen. Also ja, melde dich, wenn du drüber reden willst. Wenn nicht, auch okay. Bis dann.«
1. KAPITEL
Hailey
Gegenwart
Hailey, 25 – Wes, 25
Bücher zu schreiben, wird auf gemeinste Weise romantisiert. Die Vorstellung ist aber auch einfach zu schön. Man sitzt mit seinem Laptop und wahlweise einer Tasse Kaffee, Tee oder Chai Latte an einem Tisch, am besten in einem niedlichen Café, und schreibt sich alles von der Seele, was in einem steckt. Schreiben ist wie Atmen, ohne geht es nicht. Man verbringt freiwillig Stunden, Tage, Wochen, ganze Jahre am Laptop, ohne besonders viele soziale Kontakte, weil man so von seiner Geschichte gefangen genommen wird. Die Worte fließen. Keine Zweifel, keine Angst, keine Blockaden, nur die Geschichte zählt.
Und bis zu einem gewissen Punkt ist das auch so.
Schreiben ist wie Atmen, ja. Da ist so viel, was geschrieben werden muss. Nur ist nichts davon einfach. Es gibt Tage, an denen es gut läuft, und Tage, an denen gar nichts geht. Es gibt Kapitel, die nicht funktionieren, Figuren, die nicht so reagieren, wie sie reagieren sollten, Tausende geschriebene und wieder gelöschte Wörter. Und am Ende ein Manuskript, auf das man stolz ist und vor dem man trotzdem Angst hat. Angst davor, dass man sich irrt, dass es nur Einbildung ist, wenn man zufrieden ist, reines Wunschdenken, denn das, was man geschrieben hat, kann doch irgendwie gar nicht so gut sein, oder?
Wenn man schreibt, ist der eigene Verstand dein größter Feind und gleichzeitig dein bester Freund. Denn er schenkt dir Ideen, die wirklich gut sind, nur um dich ein paar Minuten, Stunden, Tage später zu verhöhnen und dir einzureden, dass du das irgendwie doch nicht so gut gemacht hast, wie du dachtest. Dass du versagst. Dass du der Idee nicht gerecht werden kannst. Es niemals können wirst.
Es ist anstrengend und frustrierend, aufhören kann man aber trotzdem nicht. Nicht, wenn man sein Herz an das Schreiben verloren hat.
Und das habe ich. So sehr, dass ich mir nicht vorstellen kann, jemals damit aufzuhören, auch wenn es manchmal wehtut. Denn es gibt nichts Besseres, als die Bilder in meinem Kopf in Worte zu verwandeln und ganze Seiten mit ihnen zu füllen. Es gibt nichts Besseres, als die Figuren aus meinem Herzen zum Leben zu erwecken. Ihnen Gefühle zu verleihen und mir Geschichten für sie auszudenken, ihre Gedanken, Hoffnungen und Träume auf Papier zu bringen. Es gibt nichts Besseres, als der Realität zu entfliehen und Leben zu leben, die nicht mein eigenes sind und trotzdem mir gehören.
Kompliziert wird das Ganze erst dann, wenn man die Geschichte veröffentlichen möchte, wenn man sich wünscht, dass sie gelesen wird, nicht nur von einem selbst und engen Freundinnen, sondern von allen.
Man jagt einem Traum nach, der alles für einen ist und trotzdem wehtut, weil er einem so viel abverlangt.
Es ist paradox, wie sehr man an sich selbst glauben und gleichzeitig verzweifeln kann. Wie sehr man sich wünscht, dass die eigene Geschichte gelesen, geliebt und verstanden wird, und für wie unfähig man sich gleichzeitig hält.
Weil es eben nicht mehr nur um die Geschichte geht, in die man Jahre seines Lebens und unendlich viel Herzblut gesteckt hat.
Der Druck steigt, sobald man das Manuskript an Agenturen und Verlage rausgeschickt hat. Der Plot und die Figuren werden seziert, es ist nicht nur wichtig, ob das, was man geschrieben hat, gut ist, sondern ob es auch einen Platz auf dem Markt verdient hat.
Und wenn dann der erlösende Moment kommt, in dem man feststellt, dass tatsächlich noch andere Menschen – Menschen, die Ahnung davon haben – an die eigene Geschichte glauben, fühlt man nichts als Erleichterung. Vorfreude. Aufregung. Und die Hoffnung, dass alles gut wird, weil man es geschafft hat. Der Traum ist zum Greifen nah.
Bis die Zweifel zurückkommen, ohrenbetäubend laut und nicht zu ignorieren.
Denn es kann immer noch sein, dass sich all diese Menschen, die von diesem Buch überzeugt sind, geirrt haben. Dass man sich selbst geirrt hat.
So geht es mir an diesem Morgen, und nichts daran ist schön.
»Es wird alles furchtbar«, jammere ich und vergrabe mit einem frustrierten Stöhnen das Gesicht in den Händen. »Alle werden mein Buch hassen. Und dann wird der Verlag zu dem Entschluss kommen, dass es ein riesengroßer Fehler war, sich für mich zu entscheiden. Dass sie niemals so viel Geld in mich hätten investieren sollen und dass sie das Buch niemals hätten veröffentlichen dürfen.«
»Ja, du wirst auf jeden Fall alle enttäuschen«, erwidert Ella so trocken, dass ich den Blick hebe. Sie schaut mir vom Bildschirm meines Laptops entgegen, einen Ausdruck auf dem Gesicht, den man nur als genervte Verzweiflung beschreiben kann.
Ich fürchte, das liegt nicht nur daran, dass sie langsam, aber sicher mal schlafen möchte, weil es bei ihr in den Staaten weit nach Mitternacht ist. Ich hingegen habe mich an diesem Freitagmorgen zu einer gottlosen Uhrzeit aus dem Bett gequält, da meine kreisenden Gedanken mir keine Ruhe mehr ließen.
»Ich weiß.« Wieder stöhne ich auf, und in Ellas Augen tritt etwas beinahe Mörderisches, das im krassen Gegensatz zu ihren weichen Gesichtszügen und den kupferfarbenen Locken steht, die ihr in die Stirn fallen. Wahrscheinlich sollte ich froh sein, dass uns fast viertausend Meilen und sechs Stunden Zeitverschiebung trennen, ich glaube, sie würde mir gerade gerne wehtun. Auf eine liebevolle Weise, aber ja, ich glaube, sie möchte mich wirklich dringend zum Schweigen bringen.
Ich habe Ella im ersten Semester an der Faerfax University kennengelernt. Sie hat damals den Workshop in Kreativem Schreiben geleitet, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Weil der Kurs nicht benotet wurde und sowieso freiwillig war, stand unserer Freundschaft auch nichts im Wege. Inzwischen ist sie eine meiner engsten Freundinnen und eine der wenigen, die das Chaos in meinem Kopf verstehen. Kein Wunder, sie ist schließlich selbst Autorin. Sie kennt all die Gedanken und Zweifel, die mich gerade plagen.
»Du weißt, dass ich das kein bisschen ernst gemeint habe.«
»Und du weißt, dass ich das trotzdem glaube.« Ich sage es mit aller Theatralik, die ich aufbringen kann, und meine es leider vollkommen ernst.
Sie seufzt, ihr Blick wird weicher. »Ja. Das weiß ich tatsächlich. Aber das wird nicht passieren. Du wirst niemanden enttäuschen, das kannst du gar nicht.«
»Kann ich wohl.«
»Nein«, sagt sie so entschieden, dass ich das Gesicht verziehe. »Meredith und Susanna haben sich für dich entschieden. Für dich und dein Manuskript. Sie haben dein Potenzial gesehen. Sie wissen, wie gut du bist. Du kannst sie nicht enttäuschen!«
»Ich hätte dieses Buch nie schreiben sollen.«
»Du musstest es schreiben. Es wollte raus.«
»Ich hätte mich nie bei Agenturen bewerben sollen.«
»Doch, hättest du. Das Buch ist toll geworden, es muss gelesen werden.«
»Ich hätte –«
»Hailey!«, unterbricht Ella mich scharf, ich kann praktisch hören, wie ihr Geduldsfaden reißt. Ihr Blick bohrt sich in meinen. »Ich hab dich lieb, aber halt endlich die Klappe! Wenn du jetzt noch behauptest, dass du Prince Publishing nie hättest zusagen dürfen, steig ich in den Flieger, komme zu dir nach England und trete dir höchstpersönlich in den Hintern.«
»Also wenn das so ist, dann –«
»Nein«, fällt sie mir erneut ins Wort. »Wenn du willst, dass ich komme, komme ich. Aber ich würde dich lieber besuchen, um mit dir zu feiern, dass dein absolut großartiges Buch am Montag erscheint, und nicht, um dich so lange zu schütteln, bis du wieder klar denken kannst und begreifst, was für einen Unsinn du da von dir gibst!«
»Du kannst nicht kommen, du wirst irgendwann in den nächsten zwei Wochen Patentante«, erinnere ich sie, dabei will ein Teil von mir sie dringend anbetteln, herzukommen und mir beizustehen. Aber Cassidy hat Vorrang. Sie ist Ellas älteste Freundin und erwartet ein Baby.
Ich kriege nur einen mittelschweren Nervenzusammenbruch, weil mein Buch in drei Tagen erscheint und ich nicht damit umgehen kann, dass es tatsächlich Menschen kaufen und lesen werden.
Gott, hoffentlich werden es überhaupt Menschen kaufen und lesen.
Was ist, wenn es niemand kauft? Was, wenn Tausende Exemplare unberührt in den Regalen der Buchhandlungen verstauben, weil einfach niemanden interessiert, was ich geschrieben habe?
Ich fürchte, darüber darf ich nicht nachdenken, weil ich sonst wirklich den Verstand verliere.
Zu meinem Glück habe ich Ella, und Ella rettet mich vor mir selbst, so wie sie es immer tut.
»Dann fliege ich eben wieder zurück«, gibt sie so ungerührt zurück, als würde sie nicht bei jeder neu eingehenden Nachricht wie ein aufgescheuchtes Huhn nach ihrem Handy greifen, weil sie erwartet, dass bei Cassidy die Wehen einsetzen.
»Wirst du nicht. Herkommen, meine ich. Ich kriege das schon hin. Mir geht’s gut.« Ich zwinge ein Lächeln auf mein Gesicht, das sie mit einem spöttischen Schnauben quittiert.
»Klar. Dir geht’s ganz fantastisch. Davon merke ich nichts.«
»Nur ein kleiner Ausrutscher«, beteuere ich hastig. »Geht gleich wieder.«
»Hailey.« Dieses Mal kommt ihr mein Name als schweres Seufzen über die Lippen. »Ich verstehe dich. Glaub mir, als mein erstes Buch erschienen ist, war ich genauso ein Nervenbündel wie du gerade. Und beim zweiten auch. Bei allen Büchern. Ich verstehe dich also wirklich. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Du musst keine Angst haben. Es wird großartig werden. Das Marketing von PrincePublishing ist fantastisch, das Buch ist wunderschön, und die Geschichte ist toll geworden. Alle freuen sich auf dein Buch. Social Media ist jetzt schon voll davon, und das Buch ist noch nicht mal auf dem Markt. Die Leute wollen dein Buch lesen! Hab ein bisschen Vertrauen in dich selbst.«
»Okay.« Ich gebe nach, es nützt schließlich auch nichts. Irgendwo im rationalen Teil meines Verstands weiß ich, dass sie recht hat. Dass es da draußen einige Menschen gibt, die Fading Darkness lesen wollen. Im Moment funktioniert der rationale Teil nur nicht so gut, wie er sollte.
»Danke!« Ella wirkt so erleichtert, dass ich lächeln muss. »Genieß die Zeit, genieß deine Releaseparty morgen. Dein erstes Buch erscheint nur ein einziges Mal. Hab keine Angst davor!«
Mein Herz macht einen Satz. Gott ja, die Releaseparty. Morgen. Hilfe. Ich bin kein bisschen bereit. Es werden Dutzende Bloggerinnen und Blogger kommen, nur wegen mir und meinem Buch.
In den letzten Tagen habe ich jeden Gedanken an die Party so weit von mir geschoben wie möglich, weil ich bei der Vorstellung, so ganz und gar im Mittelpunkt zu stehen, jedes Mal innerlich gestorben bin. Seit ich von der Party weiß, schwanke ich zwischen Euphorie und Panik. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich heute fühle.
»Ich versuch’s. Versprochen! Und du solltest jetzt schlafen. Es ist echt ziemlich spät bei dir.«
»Ich kann auch noch ein bisschen wach bleiben, wenn du mich brauchst«, protestiert Ella, doch das Gähnen, das sie hinter einer Hand zu verstecken versucht, straft ihre Worte Lügen.
»Ich brauche dich immer. Aber fürs Erste komme ich klar. Sonst melde ich mich. Geh schlafen. Und danke, dass ich dich wieder volljammern durfte.«
»Jederzeit«, verspricht sie.
Wir verabschieden uns, und einen Moment später flutet Stille den Raum, als Ellas Gesicht vom Bildschirm verschwindet.
Ich hasse Stille. Ich kann damit nicht umgehen. Wenn die Welt zu leise ist, wird es in meinem Inneren zu laut. Dann befreien sich meine Gedanken aus dem Käfig, in den ich sie immer wieder sperren muss, wandern zurück zu Tagen und Menschen, an die ich nicht denken will, weil jeder Gedanke wehtut.
Deshalb öffne ich Spotify, wähle eine Playlist aus – meine Daylist schlägt mir friday morning scream pop vor, was erschreckend passend ist – und stehe auf. Wenn ich schon so früh wach bin, kann ich auch ein bisschen aufräumen, richtig? Richtig.
Das dürfte mich zumindest eine Weile davon abhalten, alle zwei Sekunden nach meinem Handy zu greifen und die Verkaufsränge in sämtlichen Online-Shops zu checken oder Instagram zu öffnen, um nachzuschauen, ob es irgendwas Neues gibt.
Diese Woche wurden die ersten Rezensionsexemplare rausgeschickt, Bloggerboxen mit Goodies passend zu meinem Buch, Charakterkarten, Sticker und eine Karte der Welt, in der die Geschichte spielt. Das heißt, die Ersten können Fading Darkness schon lesen, was gleichermaßen aufregend und beängstigend ist. In den letzten Tagen gab es schon etliche Stories und Beiträge, in denen die Bloggenden das Buch in die Kamera gehalten haben.
Ich greife nach dem Exemplar, das seit letzter Woche auf unserem runden Küchentisch liegt und fahre ehrfürchtig mit den Fingerspitzen über das schwarze Cover. Die Sterne darauf sind geprägt und mit der gleichen goldenen Folie veredelt, die auch den Buchschnitt ziert. Es ist schlicht, aber atemberaubend schön, und es passt einfach perfekt zu meiner Geschichte, zu der Prinzessin, die der Dunkelheit in ihrem Leben zu entkommen versucht.
Als meine Belegexemplare letzte Woche gekommen sind, haben Poppy und ich alle in unserer Wohnung verteilt.
Einige Bücher stehen jetzt mit dem Cover nach vorne in unserem Bücherregal im Wohnzimmer, eins liegt auf dem Couchtisch, eins auf der Fensterbank, damit sich das fahle Licht der Novembersonne in den goldenen Sternen verfangen und sie zum Leuchten bringen kann, eins in der Küche, eins auf der Kommode im Flur.
Eigentlich passt es gar nicht richtig in unsere Wohnung, in der sonst alles eher hell ist. Helle Wände, helle Möbel, heller Parkettboden, heller Teppich. Alles ist in warmen Cremetönen gehalten, mit ein paar rosafarbenen und violetten Farbtupfern. Unser Bücherregal ist nach Farben sortiert, viele Pastellcover, und jetzt mittendrin schwarze Bücher mit goldenen Sternen.
Sie passen wirklich nicht hinein, und doch gehören sie genau dorthin. Meine Bücher sind der Mittelpunkt unseres Regals, und ich liebe Poppy dafür, dass sie ihre eigenen Regeln dafür außer Kraft gesetzt hat, denn eigentlich darf nichts und niemand ihre heilige Ordnung durcheinanderbringen.
Ich lebe mein Chaos in meinem Zimmer aus. Lavendelfarbene Wände, unzählige Polaroidfotos von Poppy und mir, von Ella und unseren Freundinnen und Freunden in Faerfax. Fotos von dem Tag, an dem ich die Zusage von Prince Publishing bekommen habe, und von dem Moment, als ich das erste Mal mein eigenes Buch in den Händen gehalten habe.
Jedes schöne Erlebnis der letzten Jahre hängt verewigt an meinen vier Wänden. Und bald kommen hoffentlich ein paar neue dazu.
Ich drehe den Kopf, als ich aus dem Flur ein leises Klimpern höre. Ein Schlüssel, der im Schloss gedreht wird, und dann ein fröhliches Summen, als Poppy unsere Wohnung betritt.
»Guten Morgen«, flötet sie und schwebt geradezu in unsere kleine Küche. »Na, wie geht’s meiner zukünftigen Bestsellerautorin?« Sie schlingt die Arme um mich.
»Fantastisch«, gebe ich ironisch zurück, lege das Buch wieder auf den Tisch und stoppe die Playlist.
»Warum glaube ich dir nicht?«
»Weil du mich kennst?«, schlage ich vor.
»Ja, wahrscheinlich.«
»Und wie geht’s dir?« Ich werfe ihr einen fragenden Blick zu. Ich habe gestern irgendwann um kurz vor elf nur eine knappe Nachricht mit dem Standort der Wohnung des Typen bekommen, mit dem sie die Nacht verbracht hat.
»Fantastisch«, stößt sie hervor, sehr viel ehrlicher als ich gerade eben. Ein seliges Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, ihre braunen Augen leuchten übermütig. »Ich wurde gevögelt. Oft. Wirklich sehr oft. Und sehr gut. Ganz vielleicht würde dir das auch mal wieder guttun. Möglicherweise wärst du dann nicht mehr so gestresst.« Neckend zupft sie an einer meiner Haarsträhnen.
»Ich bin nicht gestresst.«
»Klar.« Sie schnaubt, drückt mir einen Kuss auf die Wange und lässt sich auf den Stuhl gegenüber von dem fallen, auf dem ich eben gesessen habe. »Du bist absolut entspannt. Deswegen tigerst du auch morgens um halb sieben in der Küche rum, obwohl du freiwillig niemals vor neun aufstehen würdest. Ich kenne niemanden, der weniger gestresst ist.« Die Ironie in ihrer Stimme ist unüberhörbar, und ja, vielleicht hat sie ein ganz kleines bisschen recht.
Ich bin gestresst. Ich bin so gestresst, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, entspannt zu sein. Trotzdem …
»Sex würde da aber ganz sicher auch nicht helfen.«
»Das kannst du gar nicht wissen, bis du es nicht ausprobiert hast.«
Ich gebe mir keine Mühe, das Seufzen zu unterdrücken, das in mir aufsteigt. »Ich will keinen Freund.«
»Du sollst dir doch keinen Freund suchen. Nur jemanden zum Vögeln.«
»Ich will mir aber auch niemanden zum Vögeln suchen«, sage ich entschieden.
Dating ist anstrengend. Ich hab’s versucht. Wirklich. Wenn man in einer Universitätsstadt auf dem Campus wohnt, kommt man irgendwie auch nicht so richtig darum herum. Viele Menschen, viele Partys, viele Dates. Ein paar gute, viele weniger gute. Genug, um zu wissen, dass mir das keinen Spaß macht. Dass es nicht das ist, was ich will. Nicht dass ich wüsste, was ich will. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Mit dem ich mich heute nicht befassen werde. Oder überhaupt irgendwann. Ich habe keine Zeit dafür. Und noch weniger die Nerven.
»Nein, eigentlich sehnst du dich nach Romantik.« In einer dramatischen Geste breitet sie beide Arme aus. »Du sehnst dich nach all den Dingen, über die du schreibst und über die wir tausend Bücher lesen können, ohne dass uns jemals langweilig wird. Aber ganz eigentlich willst du –«
»Sag es nicht«, falle ich ihr ins Wort, stürze reflexartig nach vorn und drücke ihr eine Hand auf den Mund, während mein Puls in die Höhe schießt.
Sag es nicht, sag nicht seinen Namen, bitte nicht.
»Es muss gesagt werden«, nuschelt sie an meiner Hand vorbei, weicht dann ein Stück zurück, um mir zu entkommen, und schenkt mir ein liebenswürdiges Lächeln.
Ich rolle mit den Augen und setze mich mit angezogenen Beinen wieder auf meinen Platz. »Muss es nicht. Du beschäftigst dich wirklich ein bisschen zu intensiv mit meinem Liebesleben.«
»Ich mache mir nur Sorgen um dich, das ist ein Unterschied.« Sie greift nach der Tasse, die neben meinem Laptop steht, trinkt einen Schluck und verzieht angewidert das Gesicht, als sie feststellt, dass der Kaffee längst kalt geworden ist. »Ekelhaft. Wie kannst du das trinken?«
Ich übergehe ihre Frage einfach und komme zum Wesentlichen zurück. »Du musst dir keine Sorgen machen. Mir geht’s gut. Ich hab keine Zeit dafür, mir jemanden zu suchen, mit dem ich mich wohl genug fühle, um mit ihm zu schlafen. Das ist mir alles zu anstrengend. Erst das Texten, dann das Treffen, um zu gucken, ob es irgendwie passt. Ich will das nicht. So wichtig ist Sex nicht.«
Poppy seufzt schwer. »Ich weiß echt nicht, was ich mit dir machen soll.«
»Du musst ja auch gar nichts machen.«
»Ich würde aber gerne. Ich möchte nur, dass es dir gut geht, Hailey.«
»Mir geht’s gut, wirklich.« Zumindest, was mein nicht vorhandenes Liebesleben angeht.
»Na schön. Ich muss jetzt eh gleich los. Wenn ich zu spät bin, kriegt Carl einen Anfall.« Poppy macht gerade ein Volontariat bei der Times – etwas, das weder ihrem Politiker-Vater noch ihrer Schauspiel-Mutter sonderlich gefällt –, und ihr Boss Carl legt entschieden zu viel Wert darauf, dass sich die Volontäre jeden Morgen noch vor allen anderen im Büro blicken lassen. Und er ändert gefühlt jede Woche seine Meinung darüber, wann genau das sein muss.
»Bestellen wir später Sushi und gehen noch mal den Plan für deine Releaseparty durch?« Sie steht auf und tänzelt Richtung Flur zu ihrem Schlafzimmer.
»Klingt gut«, rufe ich ihr hinterher.
»Wundervoll«, ruft sie zurück, bevor sie erst in ihrem Schlafzimmer und dann im Bad verschwindet. Zwanzig Minuten später macht sie sich auf den Weg ins Büro, und ich bin allein.
Ich bin allein, und die Stille, die sich jetzt wieder in der Wohnung ausbreitet, drückt unangenehm gegen meine Schläfen. Ich muss etwas dagegen tun, also starte ich erneut die Playlist, die ich vorhin schon rausgesucht habe.
Musik füllt unsere kleine Küche. Laut genug, um jedes Geräusch zu übertönen. Nur nicht meine eigenen Gedanken.
Die werden sofort wieder lauter. Vor allem die, die ich nicht denken will. Die, die immer wieder hochkommen, wenn Poppy anfängt, darüber zu reden, dass ich mich vielleicht doch noch mal auf Dates einlassen sollte.
Ich wünschte wirklich, ich könnte. Ich wünschte, irgendjemand könnte all die Berührungen fortwischen, die sich wie Tinte unter meiner Haut festgesetzt haben. Ich hasse es, dass ich sie immer noch spüren kann, es ist so lächerlich.
Ich habe mehr Zeit ohne ihn als mit ihm verbracht.
Ich sollte nichts davon mehr spüren können. Ich sollte mich nicht immer noch daran erinnern.
Meine Schultern verkrampfen sich, ich stelle die Musik auf die höchste Lautstärke, und endlich übertönt der Song das Chaos in meinem Kopf.
Es ist nur eine Illusion, die Gedanken lassen sich nie so richtig vertreiben, aber diese Illusion ist alles, was ich habe, und genau das, was ich jetzt brauche.
2. KAPITEL
Wes
Der schlimmste Moment des Tages ist das Aufwachen.
Dieser Moment zwischen Schlafen und Wachsein, in dem ich nicht weiß, was real ist und wo ich bin. Nicht nur, ob ich in meinem Schlafzimmer in London bin oder doch noch in Nics Gästezimmer in Paris. Ich weiß dann manchmal nicht, in welcher Zeit ich stecke.
Es sind diese Sekunden, in denen mein Kopf vollkommen leer ist. Nicht auf gute Weise, sondern auf allerschlimmste. Dann fühlt es sich ein paar Sekunden lang an, als wäre alles wieder weg. Die letzten Tage, Wochen, Monate. Dann liege ich wieder im Krankenhaus mit diesen mörderischen Kopfschmerzen, und Maddie sitzt neben meinem Bett, blasse Wangen, ängstliche Augen, zitternde Unterlippe. Sie starrt mich an, Panik in ihrem Blick, Panik überall in meinem Körper. Schrilles Fiepen in den Ohren und das Gefühl, als würde mein Herz jeden Moment einfach platzen.
Die Erkenntnis, dass ich mich nicht erinnern kann. Dass ganze Wochen und Monate weg sind, dass alles irgendwie weg ist.
In diesen Augenblicken zwischen Schlafen und Wachsein fühlt es sich manchmal immer noch so an. Als wäre alles weg. Als könnte ich mich nicht erinnern.
In diesen Augenblicken kann ich mich nicht erinnern. Mein Kopf ist leer, dunkle Flecken überall.
Und dann wieder Panik und Herzrasen, nicht atmen können, immer nur ein paar Sekunden, bis ich mich doch wieder erinnere.
Was passiert ist.
Wo ich bin.
In meiner Wohnung in London. Es ist ein Freitag Ende November, ich bin seit ein paar Wochen zurück.
Ich liege in meinem eigenen Bett, es ist kurz vor sechs, das weiß ich, ohne auf mein Handy schauen zu müssen. In zehn Minuten klingelt mein Wecker, es ist jeden Tag das Gleiche.
Und jeden Tag bleibe ich liegen, höre und spüre, wie mein donnernder Puls sich mit jeder Minute, die vergeht, langsam, aber sicher beruhigt. Wie die dunklen Flecken in meinem Kopf verschwinden, sich in Bilder verwandeln. Ein Puzzleteil nach dem anderen findet zurück an seinen Platz, und es ist alles wieder da.
Trotzdem fühlt sich jeder Morgen wie ein Albtraum an. Weil ich immer Angst habe, dass es wieder passiert. Das Vergessen.
Es ergibt keinen Sinn, natürlich nicht. Nichts an dieser Angst ist logisch, wirklich gar nichts. Ich habe mein Gedächtnis durch den Unfall verloren, oder durch die Operation danach, wer weiß das schon, und welche Rolle spielt es, was letztendlich der Grund für die Amnesie war. Wichtig ist nur, dass es passiert ist. Und dass es nicht wieder passieren kann. Auf jeden Fall nicht ohne einen rationalen, medizinischen Grund.
Ich weiß das, aber das macht es nicht besser. Nicht das Aufwachen, nicht die Momente danach.
Mein Körper fühlt sich schwerfällig und steif an, als ich aus dem Bett klettere und meine Laufsachen anziehe, weil Laufen das Einzige ist, was mich daran erinnert, dass ich wirklich und wahrhaftig am Leben bin. Dass mein Körper mir gehört. Dass ich irgendwie immer noch ich bin. Auch wenn ich nach wie vor keine Ahnung habe, wer das eigentlich ist.
Ich wärme mich kurz auf, bevor ich meine Wohnung verlasse, draußen ist es dunkel, nass und eiskalt. Langsam laufe ich los, viel langsamer als früher, ich versuche, nicht darüber nachzudenken und mich davon nicht frustrieren zu lassen, schließlich ist es normal, weniger Leistung zu bringen, nachdem man wochenlang überhaupt keinen Sport machen durfte und dann erst mal in der Reha wieder mit dem Muskelaufbau anfangen musste.
Das war eine Scheißzeit.
Mein Körper hat nicht gehorcht, er konnte einfach nicht das tun, was er sollte, ich war zu schwach, und ich konnte nichts dagegen tun. Nur geduldig sein. Früher dachte ich immer, ich wäre es. Einigermaßen geduldig. Ich habe mich nie schnell aus der Ruhe bringen lassen, aber diese Wochen, in denen ich mit einem Physiotherapeuten wieder angefangen habe, meine Muskeln zu trainieren, nachdem ich im Koma gelegen habe, waren die reinste Geduldsprobe. An so etwas denkt man gar nicht. Oder vielmehr war das zunächst ja auch gar nicht so relevant.
Erst mal ging es darum, überhaupt zu leben, aufzuwachen. Alles andere würde sich dann schon finden.
Es hat sich gefunden.
Es hat mich gefunden.
Die Amnesie, die ganze Scheiße danach. Mehr Tage, mehr Wochen im Krankenhaus, Maddies enttäuschtes Gesicht, wenn sie mir wieder etwas erzählt hat, an das ich mich nicht erinnern konnte. Dads Frustration, weil ich nicht mal mehr ansatzweise der war, der ich hätte sein sollen. Maddies gebrochenes Herz, der Hass auf mich selbst, weil ich ihr so wehgetan habe.
Das Weglaufen danach war einfach. Einfacher als angenommen.
Und irgendwie laufe ich immer noch weg. Jetzt nur wieder in der Stadt, in der alles angefangen hat.
Eiskalte Regentropfen laufen mir übers Gesicht, während ich durch die dunklen Straßen jogge. Ein Schritt nach dem anderen. Einatmen, ausatmen, weiterlaufen. Schneller werden, nicht nachdenken.
Nur laufen, nicht denken.
Mein Körper gehorcht, er tut, was er soll, endlich, auch wenn es noch dauert, bis es wieder sein wird wie früher. Aber das spielt keine Rolle, jedenfalls rede ich mir das mit jedem Schritt weiter ein, denn wichtig ist nur, dass ich wieder laufen kann.
Ich weiche einer riesigen Pfütze aus und steigere das Tempo. Nur bis es in meinen Lungen unangenehm zieht, bis mein Körper mich praktisch anfleht, stehen zu bleiben, bis jeder klare Gedanke sich nur noch um den nächsten Schritt und den nächsten Atemzug dreht.
An diesem Morgen treibe ich es zu weit, das weiß ich, noch bevor ich das erste Zittern in meinen Beinen spüre. Dieses Zittern, das Aufgeben bedeutet. Mein Körper, der auf die Barrikaden geht und mich jetzt nicht mehr anfleht, anzuhalten, sondern sich aktiv dagegen wehrt, weiterzulaufen.
Keuchend verlangsame ich meine Schritte, bleibe aber nicht stehen. Wenn ich stehen bleibe, kann ich mich keinen Meter mehr weiterbewegen.
Es ist nicht mehr weit bis zu meiner Wohnung, fünf Minuten vielleicht. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich den Rückweg eingeschlagen habe, ich habe irgendwo eine Abzweigung genommen, und jetzt bin ich fast wieder zu Hause.
Schwindel lässt mich blinzeln, vielleicht ist es auch der Regen. Ich traue mich nicht, auf meinem Handy nachzuschauen, wie lang die Strecke war, die ich gerade zurückgelegt habe. Schon klar, ich darf nicht zu viel von mir fordern. Ich mache schließlich Fortschritte. Ich halte mehr und länger durch als vor drei Wochen. Oder drei Tagen.
Mit dem Handrücken fahre ich mir über die Stirn, meine Haut ist heiß und fühlt sich gleichzeitig eiskalt an. Schweiß mischt sich mit dem Regen, wieder blinzle ich, meine Sicht klart auf.
Langsam gehe ich zurück nach Hause, mache die Dehnübungen, die mein Physiotherapeut mir gezeigt hat, und steige unter die Dusche. Heißes Wasser, meine Muskeln entspannen sich ein bisschen, ich werde wieder müde, obwohl ich eigentlich eh immer müde bin. Wenn man Angst vor dem Aufwachen hat, ist das Einschlafen auch keine ganz unkomplizierte Angelegenheit.
Während ich mich anziehe, vibriert mein Handy. Ich schlüpfe in meinen Pulli, greife nach dem Smartphone und wische über das Display. Nate hat geschrieben, ungewöhnlich um die Uhrzeit. Bei ihm ist es kurz nach eins, mitten in der Nacht. Eigentlich sollte er schlafen.
Nate:
Können wir noch mal über unsere Silvesterpläne sprechen? Wir haben immer noch nicht entschieden, wo wir uns treffen
Auf meinem Weg in die Küche tippe ich eine Antwort.
Wes:
Mir ist das egal
Ich stelle eine Tasse auf das Abtropfsieb des Kaffeeautomaten und drücke auf den Knopf. Das knirschende Geräusch der mahlenden Bohnen ertönt eine Sekunde später. Wahrscheinlich sollte ich auch etwas essen, aber das mit dem Appetit ist morgens auch so eine Sache. Dann füge ich meiner letzten Nachricht noch etwas hinzu.
Wes:
Ihr wart in den letzten Monaten so oft in London, ich komme überallhin
Nate:
Naaaw
Nate:
Dann also Paris oder New York
Wes:
Was spricht gegen Silvester in Boston?
Nate:
Dass es Boston ist
Wes:
Also mir ist es wirklich egal
Nate:
Unhilfreich, Wes, absolut unhilfreich
Wes:
Stets zu Diensten
Nate schickt ein augenrollendes Emoji, ich kontere mit einem roten Herz, bevor ich Jeffs Nachricht sehe, dass er unten an der Straße steht, um mich in den Verlag zu fahren. Ich stürze meinen Kaffee hinunter und verlasse zum zweiten Mal an diesem Morgen meine Wohnung.
So wie jeden Tag, seit ich wieder in London bin.
***
»Guten Morgen«, begrüße ich Martha, als ich auf dem Weg zu meinem Büro an ihrem vorbeigehe. Ihre Tür steht offen, das tut sie fast immer, wenn sie nicht gerade einen Termin hat. Sogar beim Telefonieren schließt sie nur selten die Tür, manchmal hört man ihre ungeduldige Stimme den ganzen Flur hinunter.
Martha und ich haben in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht, die ersten zehn Tage saßen wir zusammen an einem Schreibtisch, ich habe sie zu jedem Meeting begleitet. Martha arbeitet seit drei Jahren im Veranstaltungsmanagement von Prince Publishing und hat mir seit meinem ersten Tag alles beigebracht, was ich wissen muss. Sie ist zwei Jahre älter als ich und Andys rechte Hand. Eigentlich wollte Andy meine Einarbeitung selbst übernehmen, aber ich bin zur falschen Zeit in den Verlag zurückgekehrt, sie hatte zu viel zu tun, um mich einzuweisen. Allerdings ist Martha auch deutlich geduldiger als Andy, von daher ist das wohl nicht das Schlechteste.
»Morgen.« Sie schenkt mir ein halbherziges Lächeln und drückt Luna an sich.
Luna ist eine überdimensionale, pastellbunte Raupe. Ein Emotional-Support-Kuscheltier, das Andy auf einer ihrer Lesereisen einsam und verloren im Shop einer Raststätte gefunden hat und mitnehmen musste. Ja, musste. Sie hatte praktisch keine andere Wahl, als dieses Kuscheltier mit den großen, dicht bewimperten Augen mitzunehmen. Ich habe das nicht weiter hinterfragt. Martha und Andy scheinen wirklich an Luna zu hängen, und auch wenn ich es nie zugeben würde, einfach nur, weil ich den beiden die Genugtuung nicht gönne, hat es schon was sehr Beruhigendes, wenn man nach dem dritten anstrengenden Meeting gestresst oder frustriert ist und die bunte Raupe ein paar Momente lang fest an sich drücken kann. Also ja, vielleicht sind meine beiden Kolleginnen nicht mehr die Einzigen, die an Luna hängen.
»Kein guter Morgen?« Ich lehne mich mit der Schulter an den Türrahmen und hebe fragend eine Augenbraue.
Martha schüttelt den Kopf. »Menschen nerven. Nicht dass das was Neues wäre, aber na ja, das macht es nicht besser.«
»Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Nein.« Sie seufzt. »Aber danke für das Angebot.«
»Wenn doch, sag Bescheid, okay?«
»Mach ich.« Sie lächelt. »Aber du hast doch bestimmt genug zu tun.«
Ich zucke mit den Schultern. Ich habe immer viel zu tun. In unserem kleinen Team geht es ständig drunter und drüber, wir organisieren mehrere Veranstaltungsreihen für verschiedene Autorinnen gleichzeitig. Aber irgendwie bin ich froh über den Stress. Er hält mich davon ab, zu viel über andere Dinge nachzudenken.
»Melde dich bitte, wenn ich was tun kann.«
»Mach ich.« Martha drückt Luna noch ein bisschen fester an sich.
Ich verabschiede mich mit einem Nicken, stoße mich vom Türrahmen ab und gehe den Flur hinunter zu meinem eigenen Büro. Es ist winzig, aber ich brauche auch nicht viel Platz. Der Raum ist groß genug für meinen Schreibtisch, ein Regal und den zweiten Stuhl, auf dem Martha immer sitzt, wenn sie mir einen neuen Prozess erklärt.
Dann fahre ich meinen Laptop hoch und mache mich an die Arbeit.
3. KAPITEL
Wes
Mein Handy klingelt zum dritten Mal an diesem Tag.
Und zum dritten Mal an diesem Tag ist es meine Mum. Sie hat mich diese Woche fast jeden Tag angerufen, ich bin kein einziges Mal drangegangen. Auch jetzt drücke ich ihren Anruf weg. Nicht weil ich zu viel zu tun habe, um mit ihr zu reden. Es ist früher Nachmittag, und ich habe fast alle Mails aus meinem Postfach abgearbeitet.
Ich kann nur nicht.
Fuck, ich will nicht.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also sage ich gar nichts, lasse ihre Anrufe unbeantwortet auf die Mailbox laufen und bete, dass sie irgendwann nachgibt und es gut sein lässt. Dabei ist mir eigentlich vollkommen klar, dass das nicht passieren wird. Je mehr Zeit vergeht, bis ich sie zurückrufe, desto öfter wird sie sich melden. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange und sie steht vor meiner Tür. Ich könnte das vermeiden, indem ich einen ihrer Anrufe mal entgegennehme, drei Minuten mit ihr telefoniere und das Gespräch dann wieder beende. Das Problem ist, dass Gespräche mit Mum nie nur drei Minuten dauern. Nicht, seit ich wieder da bin.
Hinter meiner Stirn beginnt es schmerzhaft zu pochen. Ich kneife die Augen zu, als würde es dadurch aufhören. Reines Wunschdenken, denn wenn das Pochen erst mal begonnen hat, verschwindet es so schnell nicht wieder. Im Frühling waren die Kopfschmerzen noch Folgen des Unfalls, der Operation, der Amnesie.
Jetzt sind meistens meine Eltern dafür verantwortlich.
Mum und ihre Überfürsorge, Dad und seine Erwartungshaltung.
Beides war erträglicher, als ich in Paris war. Die Distanz hat dafür gesorgt, dass der Druck nachlässt, dass sie sich weniger um mich sorgen, weniger von mir erwarten.
Es ist paradox, man sollte meinen, gerade in der Zeit nach dem Unfall, nachdem ich entschieden hatte, London zu verlassen, hätten sie sich mehr Sorgen um mich gemacht, mehr angerufen und mehr meine Nähe gesucht als jetzt nach meiner Rückkehr. Doch obwohl weder Mum noch Dad glücklich mit meiner Entscheidung waren, das Land zu verlassen, haben sie mir meinen Freiraum gegeben.
Und ich konnte endlich wieder atmen.
Vier Wochen in London, und es fühlt sich so an, als würde ich ersticken. Als würde eine Schlinge um meinem Hals liegen, die sich mit jedem Tag, jedem Anruf und jeder Nachricht ein paar Millimeter weiter zuzieht, bis ich keine Luft mehr bekomme.
Mein Handy leuchtet auf, eine neue Nachricht von Mum, wenig überraschend, sie schreibt mir lieber noch mal, als eine Nachricht auf meine Mailbox zu sprechen, wahrscheinlich weil sie ahnt, dass ihre Mailboxnachrichten leichter zu ignorieren sind.
Die Schlinge zieht sich noch ein bisschen weiter zu, das Pochen hinter meiner Stirn wird stärker.
Ich tippe aufs Display, die Nachrichtenvorschau reicht, um alles lesen zu können. Mum ist kein Nachrichtenmensch, unser Chat besteht lediglich aus knappen Fragen und einsilbigen Antworten.
Mum:
Kannst du mich bitte zurückrufen?
Mein schlechtes Gewissen verknotet mir den Magen, als ich die Benachrichtigung wegwische, ohne zu reagieren oder zurückzuschreiben. Ich weiß wirklich, dass ich das tun sollte. Aber ich habe keine Antworten auf Mums Fragen.
Isst du genug? Schläfst du ausreichend? Hast du wieder Kopfschmerzen? Du musst besser auf dich aufpassen. Möchtest du nicht doch mal mit der Tochter meiner Freundin ausgehen? Du musst mehr unter Leute. Warum kommst du nicht mal wieder zu uns zum Dinner? Warum ziehst du dich so zurück? Warum redest du nicht mit uns?
Warum, warum, warum.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht weil ihr mir die Luft zum Atmen nehmt und ich nicht in der Lage bin, euch das zu sagen, um eure Scheißgefühle nicht zu verletzen. Stattdessen lasse ich mich von euch wie ein Kind behandeln und frage mich jeden Tag, warum ich eigentlich zurückgekommen bin. Wie ich denken konnte, alles würde sich vielleicht endlich in die richtige Richtung entwickeln. Tut es nicht. In den letzten Monaten hat sich alles geändert und gleichzeitig gar nichts.
Es gibt so viel, was ich sagen könnte, aber nichts davon werde ich je über die Lippen bringen. Nicht, ohne wieder alles kaputtzumachen. Und das kann ich nicht. Nicht schon wieder.
Ein Klopfen an der Tür bewahrt mich davor, in das Loch zu stürzen, aus dem ich in den letzten Monaten wieder und wieder herausgeklettert bin. Keine Ahnung, wie oft mir das noch gelingt. Oder ob ich irgendwann einfach unten gefangen bleibe.
»Ja?«, rufe ich.
Die Tür geht auf, mein Bruder steht auf dem Flur, ein schiefes Lächeln im Gesicht, einen fragenden Ausdruck in den dunklen Augen.
»Hey. Störe ich?«
»Nein.« Ich schüttle den Kopf, alles ist besser, als über Mum und Dad nachzudenken. »Komm rein.«
Adam schließt die Tür und fläzt sich auf den Stuhl neben meinem Schreibtisch.
»Willst du was Bestimmtes?« Ich lehne mich zurück und mustere ihn argwöhnisch. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft Adam in den Wochen, seitdem ich wieder bei Prince Publishing bin, in mein Büro gekommen ist. Sein Kalender ist immer so voll, dass ich mich frage, wie er irgendwas abarbeiten kann, wenn er ständig von einem Meeting zum nächsten hetzen muss. Aber er schafft es. Weil er immer alles schafft.
»Nein, ich hatte nur gerade ein bisschen Zeit und dachte, ich schaue mal, wie es bei dir so läuft. Wir haben ganz schön lange nicht geredet.«
»Kein Ding«, winke ich ab.
»Doch, schon. Es ist nur gerade ziemlich … viel.« Er reibt sich über die Stirn, ein Anflug von Erschöpfung huscht über sein Gesicht. Er hatte wirklich viel zu tun die letzten Wochen und Monate, seit er die Geschäftsführung von Prince Publishing übernommen hat, ein Job, der für eine kurze Zeit meiner war, bevor ich abgehauen bin. Aber es war ohnehin Adams Platz, von Anfang an. Ich habe nur zwischenzeitlich seine Rolle übernommen, ohne sie je wirklich ausfüllen zu können. Er ist für diesen Job geboren, ich … nicht.
»Bist du in Ordnung?«, frage ich besorgt, denn nur weil er gut in seinem Job ist, muss er sich noch lange nicht überarbeiten.
»Ja, alles okay. Wenn nächste Woche das neue Programm vorgestellt wird, wird es hoffentlich auch ein bisschen ruhiger werden. Wenigstens für ein paar Wochen. Aber egal, ich wollte wissen, wie es bei dir läuft.«
»Ich komme klar.« Ich ringe mir ein Lächeln ab.
Es läuft wirklich gut. Überraschend gut sogar, aber Andy und Martha haben es mir nun mal auch denkbar leicht gemacht, mich im Veranstaltungsmanagement wohlzufühlen. Die beiden leben für ihren Job, sie leben für ihre Autorinnen und ihre Veranstaltungen. Alles andere spielt keine Rolle. Ihnen ist egal, dass ich für ein paar wenige Monate ihr Boss war. Es interessiert sie nicht, wo ich die letzten Monate gewesen bin, warum ich mich überhaupt aus dem Staub gemacht habe, und auch nicht, warum ich wieder da bin. Sie haben kein einziges Mal gefragt, warum ich mich jetzt doch für einen Job bei Prince Publishing entschieden habe. Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob ich ihnen eine zufriedenstellende Antwort darauf geben könnte.
Ich bin seinetwegen hier. Wegen Adam. Weil ich meinen Bruder vermisst habe. Und die Buchwelt sogar auch irgendwie.
Aber vor allem bin ich hier, weil ich endlich herausfinden muss, was ich mit meinem Leben anfangen will. Tja, und da ich keine Ahnung habe, wo genau ich damit anfangen soll, warum nicht gleich hier?
Meistens glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war, doch es gibt diese Tage, an denen die Welt ein bisschen dunkler wird und ich mich frage, ob ich nicht nur den einfachsten Weg gewählt habe, als Adam mir diesen Job angeboten hat, nachdem die Stelle freigeworden war.
Ich habe zugesagt, in der absurden Hoffnung, ich würde mich und mein Leben dadurch wieder in den Griff kriegen. Ich habe zugesagt, weil ich das wollte.
Dachte ich.
Denke ich.
Ich bin mir nur manchmal nicht so sicher.
»Wirklich?« Adam zieht eine Augenbraue hoch, sein Blick bohrt sich in meinen, und ich muss mich zwingen, ihm nicht auszuweichen. Nicht zuzugeben, dass ich zu oft das Gefühl habe, zu versagen, obwohl es doch echt richtig gut läuft.
Es ergibt keinen Sinn, aber so ist das nun mal mit Gefühlen, sie richten sich nicht nach Logik, man kann sie nicht immer verstehen.
Ich wünschte, ich könnte. Ich wünschte, ich würde mich selbst verstehen. Doch ich weiß nur, dass sich mein Inneres vollkommen verdreht anfühlt, und ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern soll.
»Ja, wirklich.«
»Mit Andy und Martha ist auch alles okay?« Adam verschränkt die Arme vor der Brust, und auch wenn er ein Jahr jünger ist als ich, kommt es mir in Momenten wie diesen so vor, als wäre er der ältere Bruder. Noch eine Rolle, die wir getauscht haben. Noch eine Rolle, die zu groß für mich geworden ist. Früher war es meine Aufgabe, auf ihn aufzupassen, mich zu vergewissern, dass es ihm gut geht. Ihn zu beschützen.
Jetzt passt er auf mich auf. Nicht dass er müsste. Aber er macht sich Sorgen um mich, so wie sich alle Sorgen machen, weil ich immer noch haltlos durch mein Leben taumle und nicht in der Lage bin, mein Gleichgewicht wiederzufinden.
Adam hat seins gefunden, Stück für Stück, seit er zurückgekehrt ist.
Und jetzt erwarten alle von mir das Gleiche.
Ich erwarte das von mir.
Doch je mehr ich es versuche, desto mehr habe ich das Gefühl, nicht nur das Gleichgewicht zu verlieren, sondern zu fallen.
»Wes?«, hakt Adam nach, und ich brauche einen Moment, bis ich mich daran erinnere, was er mich gefragt hat. Martha, Andy, richtig.
»Es ist echt alles in Ordnung«, erwidere ich.
»Dann macht dir die Arbeit Spaß?« Hoffnung leuchtet in seinen braungrünen Augen, und mein Herz krampft sich zusammen.
»Ja.« Mehr bringe ich nicht heraus, keine Ahnung, ob es eine Lüge oder die Wahrheit ist. Ich habe in den letzten Wochen vor allem Orga-Kram geregelt, mit Hotels und Buchhandlungen telefoniert und mehr Mails geschrieben als vorher in meinem ganzen Leben. Es ging um Budget- und Zeitpläne, darum, Konzepte für die Dekoration verschiedener Veranstaltungsräume zu erstellen und die entsprechende Deko dann zu bestellen. Ob ich das als Spaß bezeichnen würde, sei mal dahingestellt, aber ich bin nicht ungern hier. Es fühlt sich nur manchmal so … keine Ahnung, ich finde nicht mal das richtige Wort dafür. Aber Adam lebt für seinen Job, so wie Andy und Martha, Maddie und gefühlt alle anderen, die bei Prince Publishing arbeiten. Ob es mir irgendwann genauso gehen wird, wenn ich mich an alles gewöhnt habe?