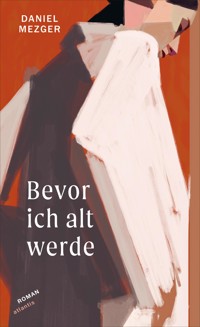
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Frage war nicht, ob, die Frage war, wann man diese Stadt verlässt. Hanover, Ontario.« Charlotte, genannt Charlie, ist das Mädchen an der Gitarre. Mit den Jungs ihrer Band hofft sie auf den Durchbruch. Zu Hause hat sich ihre Mutter schon lange einer Diagnose ergeben, eine heimtückische Erbkrankheit, die mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit auch in Charlotte schlummert. Doch das Versprechen der Jugend ist riesig, und Charlotte will ein freies Leben. Sie nimmt ihre erste Platte auf, es warten Toronto, Detroit, Berlin. Hanover hat sie längst hinter sich gelassen – aber die mögliche Krankheit rückt näher. Spätestens als sie Jason trifft und irgendwann ein Kinderwunsch im Raum steht, muss sie sich der Frage stellen, ob sie sich testen lassen soll. Ob sie wissen will, was ihr Leben für immer bestimmen könnte. Altwerden könnte bei ihr früh beginnen. Mitreißend erzählt Daniel Mezger von einer Auflehnung gegen ein perfides Schicksal, das eine junge Frau mit ihrer Mutter bereits vor Augen hat. Ihre Freiheitssuche beschert ihr immerhin eine launische Musikkarriere, und mit treibendem Groove wird die womöglich fatale Diagnose überholt, überspielt und mit lapidaren Dialogen vom Sockel der Betroffenheit geholt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniel Mezger
Bevor ich alt werde
Roman
Atlantis
»Things they do look awful c-c-cold«
The Who, My Generation
Erster Teil
I.Hanover 1
1.
Die Frage war nicht, ob, die Frage war, wann man diese Stadt verlässt. Hanover, Ontario.
Im Netz findet sich Toronto als Geburtsort, was falsch ist, der Bruder schrieb ihr eine gehässige SMS, als er es entdeckt hatte: Ist es dir peinlich, woher du kommst, oder was? Als hätte sie den Eintrag selbst verfasst. (Hat sie zu großen Teilen, aber niemals, niemals würde sie das zugeben.) Doch nicht mal Hanover war ihr Geburtsort, erst mit zwölf dahin gezogen, gezogen worden, aus einem Kaff namens Creemore, ein Dorf, nein, eine Ansammlung von Häusern plus einem Nachbarort mit Highschool, an der ihr Vater unterrichtete. Eine Kindheit in Allzweckjacken, Fleece und Goretex, alle immer irgendwo draußen. Im Schnee, auf den Feldern, Trecking, Hiking, Kunsteisbahn.
Dann Hanover.
Endlich eine Stadt, wie man mit zwölf denkt, und wenige Jahre später merkt man, man hat sich geirrt, das hier, das ist keine Stadt, nichts gibt es hier, nichts. Auch wenn sich ein paar Menschen finden, mit denen man sich gern ein paar Jahre umgibt. Mit fünfzehn kam sie mit Peter zusammen, mit sechzehn begann sie, in seiner Band zu spielen. Menschen, mit denen man sich, als der Erste endlich alt genug ist, gern in ein Auto quetscht. Nolan ist ein kleines bisschen älter, Nolan hat den Kombi der Eltern, da passt man hinten auch zu viert rein.
Fahren wir runter nach Toronto?
Spinnt ihr, ich muss um eins zurück sein, dann sind wir ja nur im Auto!
Fahren wir trotzdem?
Also gut.
Charlotte setzt sich auf Peters Schoß, unterwegs werden sie tauschen müssen, Peter wird es lustig finden, er wird eine halbe Stunde nur darüber reden: Ich, der Mann, auf dem Schoß meiner Freundin!
Noch sagt er: Du bist schwer, Charlie!
Sie sagt: Bin ich zu schwer, bist du zu schwach!
Soll ich mal übernehmen?, fragt Andy; Nolan sagt: Hört auf, so rumzuzappeln dahinten, ich muss mich konzentrieren, macht mal lieber Musik an.
Jeanette hat eine Kassette gemacht. Jeanette genannt Jeannie, wie aus der Wunderlampe. Jeanette mit den schönen Haaren. Jeanettes schönes Haar, das über den Sitz hängt. Man möchte darin rumzausen, man möchte ihr ein paar Zöpfe flechten, möchte sagen: Was für schönes Haar du hast, Jeannie! Aber man möchte lieber kein solches Mädchen sein, so eins, das noch in Haaren zaust, man ist ja schließlich kein Mädchen mehr. Man sagt lieber: Gleich müssen wir tauschen, Peter, dann sitzt du mal auf meinem Schoß!
Nein, man möchte nicht so eine sein, die einfach schöne Haare hat und gute Laune und die alles mag, auch Madonna, auch Phil Collins, und Nirvana doch bloß, weil der Sänger so süß aussieht. Und außerdem die Preppy Sins, weil da ein Freund ihres Bruders dabei ist. Die ziehen Schuluniformen an beim Auftritt und spielen – und das ist jetzt wirklich das Letzte – Coverversionen! Kein Problem für Jeannie, und weil Nolan ihr Freund ist, mag sie auch The Middle Child, trotz all dem Lärm und der ganzen schlechten Laune. Nolan ist der Schlagzeuger. Und Charlotte mag Jeannie, denn sie schert sich nicht. Sie, Charlotte, schert sich viel zu viel, denkt sie. Sie findet ausnahmslos alles schlecht. Nein, nicht ausnahmslos, das Fahren hier, das ist schön, Jeannies schönes Haar vor ihr, ja, das auch. Andy sagt: Dann zeig endlich mal her, die Kassette, was hast du da drauf? Und Jeanette legt sie ein, und sie freut sich auf jedes Lied, und erst darf man spotten, und später singt man dann doch mit: Oh, think twice, it’s just another day for you and me in paradise. Und Andy sagt, ah, das ist so scheiße, das Lied, das ist geil. Und Nolan sagt: Hat noch wer Zigaretten? Und Peter sagt: Halt mal bei der nächsten Raststätte, dann rufe ich meinen Cousin an, vielleicht können wir bei ihm übernachten.
Und Ethan sagt jetzt auch mal was, Ethan sagt: Nein, nicht anhalten, jetzt sind wir doch endlich unterwegs!
Ja, heute sind wir unterwegs, heute haben wir ein Auto, heute fahren wir raus, raus aus der Stadt, die keine ist, rein in die richtige Stadt, wo wir uns den Abend um die Ohren schlagen werden, zumindest einen Teil davon, den kleineren Teil, denn den größeren sitzt man im Auto, ist man auf dem Highway oder im Stau des Stadtverkehrs oder auf der Suche nach einer Location. Und wenn man eine gefunden hat, sucht man ewig einen Parkplatz, und dann endlich stehen sie vor einem Club, von dem sie gehört haben. Mein Cousin hat mal von dem erzählt, wenn ich mich recht erinnere, sagt Peter. Und die anderen streiten sich, ob der Ort es wert ist, so viel Eintritt zu bezahlen.
Darf man bloß mal reinschauen?
Darf man. Aber einzeln und nur die Mädchen.
Nicht so voll da drin.
Noch nicht!
Dürfen wir umsonst rein, wir bleiben auch nicht lange?! Sagt man.
Man darf nicht, aber man bekommt einen Tipp. Für diesen Ort ohne Eintritt, der Zugang zum Hinterhof muss erst lange gesucht werden, dann ist es leicht: an den vollgesprayten Wänden entlang und dort die Treppe runter. Also gut, stellt man sich eben zu den Punks, hört man sich eben Punkmusik an, hier gibt es Bier und keine Fragen.
Der Schlagzeuger ist der Einzige, der was hergibt, sagt Nolan, der Schlagzeuger ist.
Ich mag die Energie, sagt Peter.
Und den Welthass!, sagt Jeannie. Sie sagt es so fröhlich. Erntet Fragen. Aber ja doch, sagt sie, ich meine das ernst! Und dann führt sie aus, wie schön es sei, dass die da oben die Welt hassen würden für sie, und sie müsse sie deswegen nicht selbst hassen.
Der Krach, kaum wer hat was verstanden, außer Charlotte, die neben ihr steht, die sich den Satz merkt. Und die sagt: Gut ist es hier, aber die Band könnte schon mal den Akkord wechseln, finde ich.
Und Nolan: Wenn ich nicht um eins wieder zu Hause bin, dann können wir das mit dem Kombi nächstes Mal vergessen.
Wir sind doch gerade erst angekommen, sagt Jeanette.
Ja, sei doch nicht so, sagt Peter, vielleicht fragen wir später noch, ob wir mal hier spielen können, sag doch auch mal was, Ethan!
Endlich erwacht Ethan aus seinem Weggetretensein, er sagt: Habt ihr gehört, dass die jetzt so einen provisorischen Fahrausweis einrichten wollen, wo man erst mal keine anderen Unterachtzehnjährigen im Auto haben darf und nach Mitternacht nicht fahren und so, kommt der nicht dieses Jahr schon, oder habe ich da was verpasst?
Hast du, Ethan, hast du wie immer! Als Erstes: Du verpasst das Konzert, die Stimmung, die interessanteren Themen. Zweitens: Unter achtzehn oder nicht, sechs Leute in diesem Auto, das ist auch jetzt schon verboten! Andy sagt das. Ach so, ja, eh, sagt Ethan, und dann sagt er wieder nichts. Und schaut so vor sich hin, so ohne recht aus den Augen zu sehen, und Andy sagt: Jetzt schaut euch mal Ethan an, ich glaube, den können wir gleich im Kofferraum transportieren, wehe, wenn der ins Auto kotzt!
Und alle lachen und erzählen sich Geschichten von Leuten, die mal hierhin kotzen mussten oder dahin und mal mitten im Unterricht und so weiter. Und dann quetscht man sich zurück ins Auto, und dann fragt Jeanette, ob sie die Kassette wieder auf Anfang spulen soll, und Andy sagt: Wenn ich die noch ein drittes Mal hören muss, bin ich derjenige, der kotzt.
Und wenn Charlotte zurückdenkt, dann ist das ihre Jugend. Diese Fahrten. Zusammen in die Großstadt.
Auf Peters Schoß, oder Peter auf ihrem.
Das Rumstehen bei den Punks, wo sie sich nicht zugehörig fühlt, aber irgendwie dennoch wohl.
Zusammen war man mutig, war man betrunken, war man unterwegs, das alles, das war nur für sie da. Diese Fahrten. Und den zugesprayten Punk-Hinterhof, den hatte man nur hingestellt, damit sie Kleinstädter etwas hatten, wovon sie anderen erzählen konnten.
Die Rückbank, der Highway, Peter, das Reden über die Punks, die sie nicht waren, aber etwas war schon dran an der Sache: Lärm machen und dagegen sein und keine Zukunft.
So war ihre Jugend.
Eigentlich fuhren sie vielleicht drei Mal, vier höchstens. Und dieses eine Mal noch, als sie zwei Autos hatten, weil Ethan nun auch fahren durfte. Mehr Platz für mehr Leute, also eine zu große Runde, Klassenfahrtsgröße, und alles bereits zu etabliert, all die Stationen: Lasst es uns erst im Club probieren, nein, zu den Punks, nö, da will ich nicht hin. Zu viele Meinungen. Es ist viel zu laut hier, das mag ich nicht, ich auch nicht. Und Ethan musste fahren, also trank er nicht, also keine Witze über Ethan.
Nolan ging ein Jahr später bereits aufs College. In London. London, Ontario. Kommt auch dahin, da ist es viel netter als in der Großstadt. Er meinte Toronto. Er kam am Wochenende zurück, damit man proben konnte und um zu merken, dass er und Jeannie dabei waren, sich auseinanderzuleben.
Aber da im Auto, da auf der Rückbank, da war die Jugend schön.
2.
Rückbank war auch das, was sich von der Kindheit eingeprägt hatte. – Neben ein paar Anekdoten über Hockey, so oft erzählt, rund geschliffen, kaum mehr glaubwürdig, ja, sie hatte wirklich Hockey gespielt, aber auch Cheerleaderin war sie einmal gewesen, hatte ihrem Hockeyspielerinnenkörper versucht Grazie beizubringen in zu kurzem Rock, hatte durchgehalten bis zum nächsten Wachstumsschub. Und Prinzessin hatte sie mal werden wollen.
Aber eben, Kindheit: Man war draußen gewesen, in der Kälte, langsam war man hungrig geworden, müde, alle ein wenig gereizt, man hatte eine Schicht Funktionskleidung ausgezogen, saß im Wollpullover (kratzig, weil selbst gestrickt) wieder im Auto, kurzer Streit, wer in der Mitte sitzen musste, die Heizung pumpte erst bloß Kaltluft in den Wagen, dann hatten die Eltern endlich alle Schlitten, Hockeyschläger, Skier eingeladen, die Mutter auf dem Beifahrersitz drehte sich nach hinten, hatte Essbares im Angebot. Der Vater legte noch seine Jacke in den Kofferraum, ein sattes »Wumms«, zu! Es dauerte, bis er bei seiner Tür war, er ließ sich Zeit. Wenn er einstieg, war bereits etwas Wärme im Luftstrom, wenig später würde der Erste sagen: Dad, kannst du mal die Heizung runterdrehen?
Die Wärme und alle zu müde, um zu reden, und möglicherweise Landschaft da draußen, sie fuhr vorbei, keiner nahm sie wahr, außer der Mutter, sie sagte etwas mit »schön«, vielleicht auch als Tageszusammenfassung, aber Außenwelt war etwas, das sich hinter beschlagenen Scheiben abspielte und also nicht existierte, und der Vater stellte das Radio an, drehte am Rädchen, Sendersuche, die Mutter sagte, pass auf die Straße auf, das kann doch ich machen; der Vater nahm es als Herausforderung, ich kann ja wohl beides! Dann war ein Sender da, leise, weil die Fahrgeräusche laut waren, Musik- oder Sprachfetzen, die man sich selbst weiter und zu Ende denken musste, dazu das Brummen, dazu die Wärme, dazu vielleicht vorne ein Satz, der vom einen Elternteil zum anderen ging, dazu diese Schläfrigkeit, wohlig, aber ganz wollte man nicht eindösen, wollte von dieser Stimmung, von der Wärme, von Gemütlichkeit und Gemeinsamkeit und Familienkokon nichts verpassen, und vielleicht döste man doch irgendwann ein, und wenn man es schaffte, bei der Ankunft Tiefschlaf zu simulieren, wurde man vielleicht sogar ins Haus getragen.
Dann Hanover.
Ein altes Haus nahe der Hauptachse der Stadt, klein, aber zwei Geschosse plus Keller, hintenraus ein weitläufiger Garten. Den Dachboden ließen sie ausbauen, geplant war ein Büro für den Vater, aber dieser arbeitete dann doch meist oben in Own Sound, kam später und später nach Hause, warum war man nicht dorthin gezogen?
Es lag am Haus. Sie habe schon immer von so etwas geträumt, sagte die Mutter. Charlie hatte davor nie was von solcherlei Träumen erfahren, aber sie wusste, ihre Mutter liebte nicht nur ihren Geschichtslehrer, sie liebte vor allem Dinge mit Historie. Man sah das Leuchten in den Augen, als sie das Baujahr in Erfahrung gebracht hatte. Sie wollte gehört haben, dass sich im Erdgeschoss einmal eine Apotheke befunden hatte. Gästen wurde dies wiederholt erzählt, als sei die Apotheke selbst ein Ereignis, dabei ging es der Mutter nur darum, dass das Haus bereits ein Leben geführt hatte, bevor sie einzogen waren.
Ein Steinhaus aus der Gründerzeit der Stadt, hundertjährig und bald so eingerichtet, als ob sie selbst schon seit hundert Jahren hier lebten.
Allgemein wurde die Mutter dafür verantwortlich gemacht, wie vollgestopft es war. Sie störte sich am wenigsten an dem, was andere Chaos nannten, man war zu fünft, da war so ein Haus schnell gefüllt, aber jedes Objekt über das Nötige hinaus hatte ebenfalls seine Berechtigung. Zumindest in den Augen der Mutter.
Zum Beispiel dieses, sagen wir, Ding. Die Familie besuchte einen Garagenflohmarkt irgendwo im Umland, die Kinder liebäugelten mit einem koffergroßen roten Fernseher, oben ein Griff, die Eltern winkten ab, Fernsehen war zu dem Zeitpunkt noch ausgeschlossen. Jeremy spielte mit einem Auto, das durch eine lange Nabelschnur mit einer Steuerung verbunden war, er schaffte es, damit ein paar Steinguttöpfe zu umwickeln und gefährlich ins Wanken zu bringen, Colton kam mit einem Drahtteil an, in dem circa fünfzig Vinyl-Singles steckten, er zog eine nach der anderen heraus, las die Titel mit Begeisterung vor, Countrykram, Schlagertrash, die Rede eines Predigers, aber es waren Singles, und Colton besaß seit Neuestem einen eigenen Plattenspieler. Platten, nicht CDs, weil das besser sei, Charlie verstand nicht ganz, warum.
Und dann kam die Mutter an. Sie erzählte, dass sie etwas entdeckt habe. Berichtete von der Großartigkeit des Objekts. Eine echte Antiquität. Aus der Beschreibung wurde keines der Kinder schlau, mit dem Vater besprach sie den Preis, der beachtlich schien, wenn auch für ein so historisches Artefakt keinesfalls überhöht. Die Sache wurde erst einmal nicht weiterverfolgt, sie kauften Grundschülern Sirup und Muffins ab, Jeremy fand eine He-Man-Figur, die er sich leisten konnte, der Ausflug neigte sich dem Ende zu, dann sagte der Vater, er habe da noch eine Überraschung, er wolle ihr, der Mutter, eine Freude machen.
Er habe es beiseitelegen lassen.
Und dann gingen sie und kamen wieder, und die Mutter strahlte, und in den Händen hielt sie: einen Holzreif, pizzagroßer Durchmesser, stumpf und braun, drin ein Drahtgitter, und bei näherer Betrachtung war es ein Sieb und zu nichts zu gebrauchen.
Die Blicke der Kinder.
Die begeisterte Erklärung: Damit hat man früher Käse abgeschöpft!
Die Mutter betonte das Wort »früher«, als sei das Sieb höchstpersönlich mit der Mayflower auf den Kontinent gereist. Sie wollte den Preis wissen, den der Vater erhandelt hatte, und schon platzte es aus dem Jüngsten heraus: Du hast zweihundert Dollar bezahlt für ein rostiges Sieb?!
Die Antiquität fand ihren Platz auf einer der Treppenstufen. Auf anderen standen: ein Waschkrug, ebenfalls aus grauer Vorzeit; etwas, das ein Bündel Trockenblumen hielt und einmal ein Nachttopf war. Unter der Treppe: Charlottes Cellokasten, der zwischen den Stunden Staub ansetzte, und Jeremys Hockeyschlägersammlung. Von Colton kaum was, er war bald hochgezogen ins Dachbodenbüro, später Jeremys Behausung, nur Charlotte blieb in dem, was für immer Kinderzimmer hieß.
Auf dem Weg dahin, Treppe hoch, wie gesagt, all der Dekokram, und oben stieß man sich die Knie an einer Holztruhe, von der Mutter selbst erst mit Lauge behandelt, dann von Farbschicht um Farbschicht befreit, abgeschliffen, eingeölt, aber dennoch: Die Truhe stand im Weg. Daneben ein Sekretär, nicht schön, die Mutter hatte ihn zum sechzehnten Geburtstag bekommen, von ihren Eltern, so gut wie das einzige Erinnerungsstück an diesen Teil der Familie. Fotos gab es, dort im Sekretär, wenn auch wenige, auf denen ihre Mutter zu sehen war. Fünf Kinder, vier mit frechem Blick und die Mutter schüchtern verschämt, man wäre nicht auf die Idee gekommen, dass sie die Älteste war.
Die Geschichten von ihrem Teil der Familie klangen nach Errettung der Burgprinzessin aus den Klauen eines Despoten. Vom Vater mit Heldenstolz erzählt, von der Mutter bestätigt.
Sie hatten sich bei der evangelikalen Jugendkirche Ottawa kennengelernt, Charlottes zukünftiger Vater war ein neunzehn Jahre junger Frischling, verloren auf dem großen Campus der Ottawa University und verloren auch in der neuen Stadt, die ihm riesig vorkam, bis er in der Kirche endlich seinesgleichen fand.
Und sie, die später Charlottes Mutter werden sollte.
Fromm war er, jung und Sinn suchend. Sie die Tochter des Pastors. Ebenfalls jung.
Was Charlotte wusste: dass auch die Eltern der Mutter fremd waren dort. Erst wenige Jahre davor zugezogen aus Fall River Massachusetts, wo sie sich als Französischsprechende mehr und mehr diskriminiert gefühlt hätten, wie Charlottes Großvater wiederholt ausgeführt habe. »L’Américain« nannte er sich selbst, vor vielen Jahren vielleicht einmal ein Scherz, zu oft wiederholt. Charlotte wusste wenig über die Französischmuttersprachler in Neu England, wusste überhaupt kaum etwas von diesem Zweig der Familie. Die entsprechenden Fotos lagen jedenfalls nicht bei den Familienalben, sondern hier neben Briefen, Rechnungsunterlagen und Zeug, das sie Kinder nur deswegen durchforsteten, weil sie von der Geheimschublade fasziniert waren. Die Geheimschublade, die kein bisschen geheim aussah. Viel zu dick war der Boden. Viel zu offensichtlich, dass es ein doppelter war.
Auch im unteren Stock so einiges an Zeug. Vor allem der Mutter. Zum Beispiel in der Küche, aber was sollte man da sagen, die Eltern waren auf ihre Fortschrittlichkeit stolz, ein Nachhall der Siebziger, vor allem der Vater betonte es damals und später, wie wichtig das war: Emanzipation, geteilte Familien- und Erwerbsarbeit und so weiter.
Was nicht hieß, dass er kochen lernte.
Oder putzen.
Oder wusste, wie die Waschmaschine zu bedienen war.
Obwohl die Mutter auch einen Teil des Geldes verdiente, im Krankenhaus zusätzliche Nachtschichten einlegte, damit man sich das Haus leisten konnte, war sie es, die das Haus in Ordnung hielt. Allerdings ohne Ansprüche auf eine Sauberkeitsmedaille.
Die Küche war das Revier der Mutter, also durfte es darin aussehen, wie sie es wollte. Aber auch im Wohnzimmer gingen die Stile durcheinander, braun-grün-grau, hier Holz, dort Jute, und auf einer der Heizungen trocknete immer irgendeine neonfarbene Allwetterjacke. Bei den Buchrücken ebenfalls viel Neon, neben ebenso viel Pastell, sie zeigten: Die Geschichte der Errettung der Mutter aus den Fängen des amerikanischen Pastors blendet aus, dass die Eltern der Religion keineswegs abschworen. Doch aus dem evangelikal wurde etwas milder ein evangelisch. Die Glaubensgemeinschaft, der sie sich in Creemore angeschlossen hatten, schrammte nur knapp am New Age vorbei (Neon), später begannen sie sich politisch zu engagieren, für saubere Flüsse und die Rechte der First Nations, versuchten kurzzeitig ein Projekt namens offene Liebe, auch dazu Bücher, dazu auch einige Streits, bei denen die Eltern sich vorrechneten, wer wann wie viel und vor allem wie intensiv. Das Projekt wurde abgebrochen, möglicherweise ein Auslöser dafür, dass das Berufsleben des Vaters in den Fokus rückte, seine Unzufriedenheit damit, er bewarb sich auf die Schulleiterstelle, bekam sie nicht, man zog nach Hanover, der Vater war nun Geschäftsführer eines Vereins, dem es darum ging, heilpädagogische Schulen im Grey County aufzubauen, darum neu auch einige Bücher in Pastell.
Des Weiteren: Zimmerpflanzen; ein Spinnrad, das die Mutter seit Jahren nicht mehr benutzt hatte, aber das sie durchaus wieder einmal zu benutzen versprach, weil man sich vorgenommen hatte, so viel wie möglich selbst zu machen; ein großer Korb neben dem Sessel, darin das Strickzeug und ein einziger Riesenwollknäuel, in dem sich jeder Faden jeglicher Dicke und Farbe um jeden der anderen gewickelt hatte, der gemütlichste Ort für die Katzen, denn ja, die gab es auch noch.
Als die Mutter Jahre nach der Trennung beschloss, das Haus zu verlassen, als Letzte der Familie, als das Haus also, wie man sagt, leer stand, mussten sie es für den Verkauf erst noch wirklich leer räumen.
Eine Arbeit von mehreren Tagen.
Die Mutter hatte in die neue Wohnung nur das mitgenommen, was auch wirklich ihr gehörte. Charlotte wurde bewusst, wie viel von dem Gerümpel eigentlich der Gesamtfamilie zuzuordnen war. Kinderschätze, gesammelt über Jahre, Hockeymedallien, Schulbücher, Plüschtiere. Und die Tales from the Krypt-Hefte, bei denen die einzelnen Seiten nicht mehr klar zuordenbar waren.
Sie räumten auf und schmissen weg, nahmen Teenagerposter von den Wänden, versuchten Kritzeleien dahinter zu entfernen. Und auf einem Tisch in dem Raum, der einmal Elternschlafzimmer hieß, hatte die Mutter fein säuberlich den Schmuck, den sie einmal vom Vater bekommen hatte, aufgereiht. Und daneben, ebenfalls nachträglich zurückgewiesen: das Käsesieb.
3.
Garagenverkäufe und Flohmärkte gehörten zu den wenigen Attraktionen in dieser Stadt. Samstägliche Entdeckungsreisen. Das Sieb war ihr Dauerscherz. Hoffentlich finden wir wieder so was Nützliches!, sagte Jeremy. Und Charlotte entdeckte tatsächlich etwas: eine abgeranzte Ramschgitarre, Fender-Verschnitt, so gut wie geschenkt, aber auch wirklich nicht mehr wert als das.
Sie besaß bereits ein richtiges Instrument, hatte brav Barré-Griffe geübt, den Wechsel von Dur auf Moll, sie war die Einzige in der Band, die eine vernünftige musikalische Grundausbildung mitbrachte, die Bildungsbürgeransprüche der Eltern und eine Cellolehrerin, die gleichermaßen nett wie streng war, hatten ganze Arbeit geleistet.
Dass ihr Fund bloß noch vier Saiten aufwies und einer der Bünde lose war, brachte Charlie auf eine Idee. Sie murkste nachmittagelang an Vaters Werkbank daran herum, kratzte sich die Finger auf, als sie mit Schraubenzieher und Hammer jedes einzelne störende Metallteil vom Griffbrett entfernte. Die Ritzen versuchte sie erst wegzufeilen, aber sie erwiesen sich als zu tief, also füllte sie sie mit Spachtelmasse und Leim, schliff danach Überstehendes ab, der ganze Korpus hatte bei der Aktion gelitten, nein, schön sah das nicht aus.
Frankensteins Gitarre.
Sie zog wieder bloß vier Saiten auf, stimmte sie wie beim Cello in Quinten; während Peters Finger sich zum Powercord verkrampften, würde sie die Riffs mit einem Finger spielen können. Doppelstopp. Bildung, wie gesagt.
Sie versuchte, ob sich das Ding mit dem Bogen spielen ließ, was so halb klappte. So halb war genau, was sie suchte.
Als sie das erste Mal mit dem Unding auftauchte, gab es ein großes Hallo. Ethans Verdikt: Hässlich, aber noch nicht mal im schönen Sinne. Die Gitarre wurde Freddy getauft und zur Geheimwaffe der Band. Wenn es nicht lief oder zu kommerziell wurde oder zu wenig laut, hieß es bald: Vielleicht sollten wir mal Freddy dazuholen. Oder: Vielleicht hat ja Freddy eine Idee.
Charlie versuchte sich so wenig wie möglich um Harmonielehre und eindeutig definierbare Töne zu kümmern. Seit sie das Cello gegen Rückkopplungen eingetauscht hatte, hieß das, was sie machte, zum ersten Mal nicht mehr Noten-in-Töne-Übertragen, sondern Musikmachen.
Eine Band mit Mädchen gab es selten. Eine Band mit einem Mädchen, das sich mit dem Cellobogen an einer im Auflösen begriffenen Schrottgitarre abarbeitete, gab es noch seltener. Sie war die Zirkusattraktion, sie war der Freak mit dem zusammengeleimten Instrument und mit dem Bogen und mit dem Lärm und mit den Haaren im Gesicht – und: Sie war ein Mädchen.
4.
Der Lachanfall, als sie in einem Schaufenster zum ersten Mal eine Fretless-Gitarre sahen.
5.
Wenn man sechzehn war, siebzehn, achtzehn, dann konnte man in einer Band spielen, man konnte die Gitarre mit einem Cellobogen bearbeiten, die Haare im Gesicht, man konnte ohne Mikro mitschreien, während der Sänger schrie; und weil die Locations, in denen sie auftraten, klein waren, konnte das Publikum hören, dass die da oben, dort vor dem Verstärker, dort im Rückkoppelungsrausch mitschrie; und man selbst konnte es schön finden, dass man gehört wurde; auch ohne Mikro war verständlich, dass es Momente gab, in denen man schreien musste, weil das so guttat, diese inszenierte Rage, die auch ein bisschen echt war. Die Ekstase war es auf jeden Fall, logisch, dass man schreien musste in Refrains und in B-Teilen.
Und man konnte große grundsätzliche Ansichten haben, mit sechzehn, siebzehn, achtzehn, zum Thema Musik. Und zum Leben. Man konnte also wild sein und vehement und die mit den Haaren im Gesicht und mit dem Rücken zum Publikum, und gleichzeitig war man sechzehn, war siebzehn, war achtzehn und wohnte noch zu Hause, und man kam am Nachmittag von der Highschool, man steckte den Schlüssel in die Haustür und hoffte, dass er eine ganze Umdrehung brauchte, denn dann hatte man Glück: Man war die Erste.
Man konnte sein Zeug zum Zeug unter der Treppe werfen, in die Küche gehen, eine Schüssel mit Cornflakes füllen, Milch bis zum Rand, die überzuschwappen drohte, wenn man diese Teenagernachmittagszwischenmahlzeit die Treppe hochbalancierte und mal wieder das Knie an der Truhe anstieß.
Oben im Flur stand seit Neuestem doch ein Fernseher. Die Kinder, die keine Kinder mehr waren, hatten sich durchgesetzt, ihn selbst bezahlt. Dafür durften die Eltern den Ort bestimmen. Es war absichtlich der ungemütlichste. Immer latschte wer durch, musste kommentieren oder, schlimmer, mitschauen.
Wir sind keine Fernsehfamilie, sagte der Vater; die Mutter bestätigte, dass sie sowieso nicht interessiert war an dem, was da so lief, und war abends dann doch meistens da anzutreffen. Vor irgendeiner Schmonzette, bei der sie, wie sie sagte, zufällig gelandet sei.
Kein Kabelanschluss, darum wenig Programme. Charlie schaltete das Gerät ein, setzte sich, im Schoß Fernbedienung und Cornflakesschüssel. Star Treck begann bereits um kurz nach vier, den Anfang verpasste sie meist, schaute der Crew beim Finden der Lösung zu, ohne das dazugehörige Problem zu kennen.
Mit sechzehn, siebzehn, achtzehn war Zuhause dieser Ort, allein hier im Flur. Star Treck und im Anschluss DieSimpsons. Die prickelnde Freude, dass ihr etwas geboten wurde, dass ihr etwas gehörte, ihr ganz allein. Teenagerglückseligkeit. Eine Glückseligkeit, genährt von Angst Nummer eins: dass ausgerechnet jetzt unten jemand zur Tür reinkommen und sie stören könnte; und Angst Nummer zwei: Sportübertragungen. Was hieße: sie mit ihrer Cornflakesschüssel, wohlige Vorfreude und dann – eine Radrundfahrt, ein Tennismatch, der Lauftext, der verkündete, dass das normale Programm erst im Anschluss weitergehen würde. Was Jahre dauern konnte. Jahrzehnte.
Die allumfassende Langeweile, die vom Schweigen auf dem Court vor dem Aufschlag ausging.
Oder noch schlimmer, darum Angst Nummer drei: Man hatte Glück gehabt, Piccard und Co. hatten soeben Friede über das Weltall und die Stimmung an Bord gebracht, gerade gaben die Schäfchenwolken den ersehnten Schriftzug frei. Und bei den ersten Bildern die Enttäuschung: Diese Folge kenne ich bereits.
Szene für Szene auswendig.
Die alles lähmende Ödnis, die in ihre Glieder fuhr. Die gänzlich verlorene Hoffnung, dass es heute, an diesem ihr allein gehörenden Ort, etwas geben könnte, das sie auch nur im Ansatz interessierte. Das Glück, das mit jedem nun lahmen, weil bekannten Witz mit Füßen getreten wurde. Nie enden wollende zwanzig Minuten lang.
Und das war dann auch in etwa das Schlimmste, was einem in einer solchen Jugend zustoßen konnte.
… Tour, April – Kohlblätter
Ihre Mutter starb bei einem Autounfall. Ein Unfall. Zum Lachen eigentlich. Charlotte unterbrach ihre Tour, flog zur Beerdigung. Ihre Brüder nahmen es ihr übel, dass sie in der Kirche nichts darbieten wollte, und statt nun heftig auf Gitarrensaiten einzuhauen oder eines ihrer verletzlicheren Lieder, die allesamt nichts mit ihrer Mutter zu tun hatten, anzustimmen, saß sie in der ersten Reihe auf der Holzbank, hörte der Pastorin zu, die unvorbereitet wirkte, fahrig, die sich bei der Predigt mehrfach verlas. Als sie zum Lebenslauf der Verstorbenen kam, wirkte es, als habe sie den falschen Zettel dabei.
Die Mutter hatte auf dem Beifahrersitz gesessen, als das Auto in der Kurve durch die Leitplanke schoss, ungebremst, wie es schien. Was im Detail geschehen war, ließ sich offenbar nicht genau rekonstruieren, möglich, dass ihr Freund, der deutlich älter war, seine Fahrkünste überschätzt hatte. Oder ein plötzlich entgegenkommendes Fahrzeug hatte ihn überrascht, und er verwechselte Bremse und Gaspedal? Das Auto war den Abhang hinuntergestürzt, hatte sich mehrfach überschlagen, die Äste eines Baums durchstießen die Frontscheibe, Charlotte wollte keine weiteren Einzelheiten hören.
Sie wäre für eine gemeinsame Beerdigung gewesen, hätte den beiden ein Zusammensein über den Tod hinaus gegönnt, immerhin hatte die Mutter die letzten fünfzehn Jahre mit diesem Mann verbracht. Aber plötzlich zählten wieder Religionszugehörigkeit und Bestattungsarten, die Brüder hatten sich durchgesetzt, sie waren es schließlich auch, die alles organisieren mussten. Und Charlotte solle doch bitte wenigstens für ein, zwei Wochen in Kanada bleiben und helfen, die Sachen durchzusehen.
Sie fragte sich, wem sie es eigentlich gerade recht machen wollte, als sie durch den Kalender scrollte, überlegte, ab welchem Konzert sie wieder in Europa sein konnte und wie viel sie die ganzen Ausfälle und der Flug kosten würden. Eigentlich war der Plan, sich ein kleines Polster anzulegen, sie war Mitte vierzig und fragte sich ernsthaft, ob sie sich bald um einen Brotjob kümmern musste. Sie versuchte es auf die zwei Jahre abgesagter Konzerte zu schieben, aber wenn sie ehrlich war, hatte es sich bereits davor abgezeichnet.
Nach der Kirche schüttelte sie Hände von lauter ihr Unbekannten, ihr Vater trat auf sie zu, freute sich sehr, sie zu sehen, aber nein, er würde besser nicht mitkommen zum Essen, das sei vielleicht nicht angebracht. Sie überredete ihn nicht, versprach, ihn zu besuchen, falls sie es schaffe, länger zu bleiben, dann folgte sie den Brüdern zum Restaurant, das diese ausgesucht hatten.
Alle gaben sich redlich Mühe, traurig zu wirken und überrascht vom plötzlichen Tod. Ende sechzig, das ist doch viel zu früh.
In den letzten Jahren hatten sich bei der Mutter die unausweichlichen Anzeichen der Jacksonschen Krankheit gezeigt, erst das leise Dauerschwanken, das sich in den Bewegungsablauf einschlich, dazu Rückzugstendenzen, die man als Beginn einer Depression lesen konnte. Später unvermittelt vergrößerte Bewegungen, verwirrte Momente, sie kümmerte sich nicht mehr um sich, fiel unangenehm auf, ob sie sich noch regelmäßig wusch? Schließlich der volle Ausbruch. Dass der Mutter, und vor allem, dass der Familie der finale Verlauf der Krankheit erspart geblieben war, mischte sich als Erleichterung in den Gefühlsbrei des Abschieds.
Beim Essen der feixende Bruder: Na, Charlie, wenigstens musstest du dich nicht umziehen für den Anlass, was? Als ob sie immer Schwarz trüge. Jeremy kramte weitere Musikerinnenklischees hervor und alte Geschichten, die er sich gemerkt hatte, um sich nicht unterlegen zu fühlen mit seinem Versicherungsvertreterdasein. Im selben Atemzug bot er an, sie könne gern bei ihnen übernachten – dann siehst du wenigstens mal unser Haus!
Sie ärgerte sich, dass sie sich von den Normen und Wertvorstellungen ihres Bruders in die Ecke gedrängt fühlte und dass sie ihn, statt seine Sprüche zu parieren, nach der Arbeit fragte, ihn erzählen ließ.
Sein Akzent, die trägen Vokale, die in ihrer Aussprache schon lange nicht mehr vorkamen, schien stärker als früher. Legte er Wert darauf?
Im Hotel suchte sie nach Flügen, schrieb ihrer Managerin eine Mail und nahm zwei Tage später ihre Tour wieder auf.
Paderborn.
Charlotte, eingeklemmt auf dem Flugzeugsitz. Der Vordermann, der den seinen ohne jede Rücksicht nach hinten geklappt hatte. Sie, die sich nicht entscheiden konnte, ob sie zu schlafen versuchen oder sich durchs Filmangebot scrollen sollte. Und so unvermittelt wie zusammenhanglos diese eine Erinnerung: die Schamlippen der Mutter.
Echt jetzt?
Wobei nein, nicht die Schamlippen selbst, bloß das Denkenmüssen an ein Daran-denken-Müssen. Dass sie über diese Schamlippen gesprochen hatte. Dass sie sie als Kohlblätter bezeichnet hatte. Daran dachte sie.
Kohlblätter.
Sie war nackt im Hotelzimmer herumgegangen. Unter Blicken von einem, der sich »Groupie« nannte, weil er sie am Abend zuvor nach dem Konzert angesprochen hatte, weil er ihre Platten besaß, weil er Freude fand an dieser Selbstbezeichnung, bis sie sagte: Jetzt ist auch mal gut!
Sie hatten die Nacht zusammen verbracht, am Morgen erneut miteinander geschlafen; was der Tag bringen würde, war noch unklar gewesen. Charlotte hatte Kleidungsstücke aus dem Koffer gewühlt, sich um die eigene Achse gedreht, hatte erzählt, dass ihre Mutter oft so durchs Haus gegangen sei. So, ohne sich zu schämen. Manchmal gar wenn Schulfreundinnen zu Besuch gewesen seien. Vom Körper der Mutter hatte Charlotte erzählt, dort im Hotelzimmer, wie ausladend er sei, alles daran üppig, die Brüste, der Hintern. Und die Schamlippen groß und offen wie, und nun eben das Wort: Kohlblätter.
Er hatte nicht verstanden, sein Englisch, sie hatte ausgeführt, umschrieben, blieb länger bei der Sache als beabsichtigt. Kohlblätter. Sie pantomimte, er grinste.
Viel habe ich nicht von ihr geerbt, hatte Charlotte hinzugefügt. Er bot an, die Sache nochmals einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, sie sagte: Es reicht, ich will duschen, ich will frühstücken!
Seltsamer Anfang fürs Trauern, dachte Charlotte, suchte eine neue Position im Flugzeugsitz, bohrte ihre Knie in die Rückenlehne, den Idioten vor ihr schien es nicht zu stören. Also tippte sie auf dem Bildschirm herum, die Auswahl an Ablenkung: romantische Komödien oder lieber einen sogenannt wertvollen Film? Sie wartete, dass der nächste Gedanke kam, Kindheit, das Haus, die Mutter früher, wobei alles, was die Mutter anbelangte, nun so heißen würde: früher.
Aber nein, kein weiterer Bilderreigen, bloß dieses Hotelzimmer, der »Groupie« und wie er sie nach dem Duschen zu einer Stadtrundfahrt überreden wollte, weil sie gesagt hatte, dass sie nie wisse, was sie an all diesen Orten mit sich anfangen solle, wenn sie einmal einen Tag freihatte. Wie sie abgewinkt hatte. Wie er sagte: Notfalls würde ich dich auch begleiten.
Paderborn war schrecklich. Die Anlage so eingestellt, dass die Stimme einerseits zu laut dröhnte und Charlotte sich an anderen Stellen wiederum gar nicht hören konnte. Mick, ihren Schlagzeuger, der sie die ganze Zeit mit diesem Ist-alles-gut-bei-dir?-Hundeblick anschaute, musste sie nach den ersten paar Stücken von der Bühne schicken. Sie versuchte es allein, das Licht blendete blöd, es war heiß, die Gitarre verstimmte sich andauernd, einen Song brach sie ab.
Das Schlimmste dann so einer aus dem Publikum. Der Applaus für Wasted Fortunes war gerade verebbt, sie ging die Setliste durch, überlegte, was sich unter diesen Bedingungen überhaupt spielen ließe, und wie immer fordert jemand Call Me by Another Name. Das werde ich wie immer auf gar keinen Fall spielen, sagt sie, und dann eben dieser Typ laut und als spräche er für alle: »Don’t worry, everything is fine, we love you, Charlotte!«
Ein paar Leute klatschten.
Das reichte.
Sie schrie, dass das wohl das Letzte sei, es gebe nichts Schlimmeres als Leute wie ihn, die behaupten würden, alles sei gut, wenn sie doch genau sehen würden, dass gar nichts gut sei.
Sie packte die Gitarre in den Koffer, stopfte das Kabel dazu, verließ die Bühne.
Gut, also doch nicht so glatt über alles weg. Zugegeben.
Draußen Mick, er bot eine Zigarette an, sie griff zu, obwohl sie aufgehört hatte. Richtiges Backstage gab es mal wieder nicht, sie paffte, der Puls noch immer oben, die Leute kamen die Kellertreppe hoch, starrten sie beim Vorbeigehen an. – Dann lasst euch halt das Ticket erstatten, habt euch nicht so! Dachte sie.
Mick mit seinen schmalen Schülterchen versuchte, sie etwas abzuschirmen, das sah nun wieder lustig aus. Als sie lachte, schauten die Leute erst recht.
Schon wieder der Gedanke an diesen Morgen damals, wie lange war das her? Vier Jahre? Die Tour zu All Those Tiny Houses, also ja, vier Jahre bereits.
Mick, ich gehe jetzt schlafen, wir sehen uns morgen.
Sie war froh, dass er noch sein Zeug zusammenpacken musste und sie nicht zu einem Schnaps an der Bar nötigen konnte oder was er als Tröstungsmaßnahme sonst so im Sinn gehabt hatte.
Die Schamlippen ihrer Mutter.
Ihr Groupie.
Was für eine blöde Bezeichnung, dachte sie. Als wäre er ein Teenagermädchen. Charlotte hatte keine Groupies. Klar, auch sie wurde zwischenzeitlich umschwärmt, aber während sie mitbekam, wie ihre Kollegen im entscheidenden Augenblick ihren ansonsten wohlversteckten Chauvinismus auspackten, sich eine der Schwärmerinnen auswählten, sie mitnahmen, schien die Unterordnungsrolle ihren Anhimmlern weniger zu liegen: all die Holzfällerhemden, die am Schluss an den Bühnenrand traten, die von anderen Bands berichteten, die niemand außer ihnen kannte, Fachsimpeleien über Akkordfolgen, dabei sollten doch sie von ihr beeindruckt sein!
Manchmal ließ sie sich einladen in WGs, die Küchentische sahen alle gleich aus, Rotwein war ihr Getränk. Wenn Mitbewohner da waren, wurde sie präsentiert wie eine Trophäe, ein weiterer Fachsimpelei-Diskurs, dass man sie kennen müsse, wenn man sich auskenne, was vor allem hieß: dass man sie nicht kannte.
Wie deutlich sie ihn vor sich hat. Warum? Er, wie er zögert, sie anzusprechen, sich rumdrückt, Blick auf sie, während sie ihr Zeug einpackt, endlich kommt er an, wird sein Es-war-toll-vielen-Dank-ich-bin-ein-großer-Fan-Sätzchen los. Er ist zwei, drei Jahre jünger als sie.
Vielleicht ist es der spontane Gedanke an die Kollegen, an die Chauvinistennummer, der sie die Abkürzung nehmen lässt: Kommst du von hier, kann man noch irgendwohin?
Er nennt eine Kneipe, fragt, ob er ihr die Gitarre tragen solle.
Ist es weit?
In dieser Stadt ist nichts weit.
Sie gehen, sie fragt ihn über die Stadt aus, sein Leben, um nicht selbst ausgefragt zu werden. Er sagt ihr ein paar schweizerdeutsche Wörter vor, das Gespräch beginnt sich zu verheddern, sie entscheidet sich für Abkürzung Nummer zwei: Hier links ist mein Hotel, komm mit hoch, wir trinken dort was.
Er steht im Zimmer rum, als gäbe es etwas zu besichtigen, braucht lange, bis er sich endlich traut, sie zu küssen.
Kohlblätter.
Ihre Mutter war zu Hause tatsächlich manchmal nackt durch die Wohnung gegangen. Vor dem Duschen, nach dem Duschen. Aber wahrscheinlich bloß einmal, als Besuch da war. Aus Versehen. Wenn überhaupt.
Ob man sie früher »Scharlott« genannt habe, fragt er sie, ihr Groupie. Er versucht sie zu beeindrucken, spricht ein, zwei windschiefe Sätzchen Französisch. Nur meine Mutter kommt aus Quebec, und nein, in meiner Familie hieß ich Charlie. Sagt sie. Er freut sich, nennt sie wenig später ebenfalls so, sie verbietet ihm den Kindernamen.
Ihre Mutter hatte seit fünfundzwanzig Jahren gewusst, dass »die Krankheit« sie einmal heimsuchen würde. Die Krankheit. So die offizielle Familienbezeichnung, die den wahren Namen gleichermaßen schonend aussparte und dadurch erst bedrohlich raunend betonte. Wahrscheinlicher Ausbruchszeitpunkt circa Mitte sechzig. Auch das hatte sie gewusst. Ein Gentest zeigte: die gleiche Ausprägung wie bei ihrer Mutter, sprich Charlottes Oma, eine eher späte Variante. Erst im Alter auftretend. Aber unaufhaltsam. Und das Endstadium sah in allen Fällen gleich aus.
Klar war auch, dass die Mutter sie mit einer Wahrscheinlichkeit von fünfzig zu fünfzig an ihre Kinder weitergegeben hatte, unwissend, weil Jahre bevor der Test auf den Markt kam. Also hatte sie zumindest diesbezüglich Glück gehabt. Die Kinder-oder-nicht-Frage hatte sich für sie nicht gestellt.
Dass ihr Leben etwas Zwangsläufiges hatte. Dass es genau auf diesen Schlusspunkt zulief und nur auf diesen zulaufen konnte. So schien es.
Dann: Autounfall.
Die Krankheit war längst ausgebrochen. All die Gesten, die je länger, desto überzeichneter und verdoppelt daherkamen, aber immer noch ihre Gesten waren. Ihre Ausflüchte, ihre Verschleierungsmaßnahmen, wenn sie etwas nicht verstanden hatte oder etwas nicht mehr richtig sagen konnte. Die Floskeln, die sie dafür benutzte, hatte sie auch früher benutzt.
Dass sie auch die Jahre davor nicht zum Arzt gehen wollte mit ihrem Bein, das doch rein gar nichts mit der Jacksonschen Krankheit zu tun hatte, diese Sturheit, die hatte mit dem Krankwerden zu tun, aber stur war sie immer schon gewesen.
Die Krankheit hatte sich in langsamstem Crescendo eingefadet, erst eine leiseste Beimischung, noch nicht zu sagen, ob man schon etwas hörte oder ob man sich bei der Erinnerung an den Ursprungssound schon immer getäuscht hatte. Bis die Störgeräusche nach Jahren so stark waren, dass man sich nicht mehr daran erinnern konnte, dass sie je weg waren.
Charlotte hat einmal dieses Video gesehen, eines, das man weitergeleitet bekommt, nicht anklicken will und dann doch anklickt. Eine monochrome Fläche, blau, nichts passiert, man schaut zwei Minuten lang darauf, und hinterher wird man gefragt, ob einem etwas aufgefallen sei. Nein. Alles ist gleich geblieben. Immer diese monochrome Fläche. Immer bloß diese eine Farbe: Rot.
Die nächste Station eine Stadt namens Wiesbaden, der Veranstalter hatte selbst gekocht, saß beim Essen mit am Tisch. Er zählte die lange Liste von Bands auf, die bei ihm schon gespielt hatten, berichtete ausführlich von dem Schlachtbetrieb, der das hier einmal gewesen sei. Charlottes Aufgabe war es, beeindruckt zu schauen und das Essen zu loben. Sie hatte beschlossen, heute umgänglicher zu sein.
Der Journalist einer überregionalen Zeitschrift war da, ein kurzes Porträt, Besprechung des Konzerts, der neuen Songs; Charlotte willigte ein, ein paar Fragen zu beantworten. Als könne sie mit Wiesbadener Nettigkeit ihren Paderborner Aussetzer wiedergutmachen.
Und es gab ihr die Möglichkeit, den Raum zu verlassen.
Sie setzten sich nach draußen.
Er war kaum zwanzig, hielt einen kleinen Schreibblock in der Hand, notierte kein einziges Wort, die Fragen las er von seinem Smartphone ab, er nannte den Namen der Zeitschrift, Charlotte kannte sie nicht.
Klassischer Start: Kindheit? – Kanada.
Hockey? – Abstruserweise ja.
Band? – Je kleiner, desto praktischer.
Die abgesagten Konzerte? – Gesundheitliche Gründe.
Geht es besser? – Danke der Nachfrage.
Dann:
Du kommst regelmäßig nach Deutschland.
Ich stamme aus Hanover.
Sagtest du nicht …?
Hanover, Ontario. Aber ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt.
Und?
Wie kann sich eine so hässliche Stadt so wichtig nehmen …
Sprichst du Deutsch?
Schreibst du dir nichts auf?
Bis jetzt kann ich es mir noch merken.
Kannst du den Satz über Berlin bitte wieder vergessen, ich will heute nett sein.
Schade.
Wo waren wir?
Ob du Deutsch sprichst.
Niemand in Berlin spricht Deutsch.
Der Junge scrollte durch sein Telefon, lief eine Aufnahme-App? Dann hatte er etwas gefunden: Du hast ja bei deiner vorletzten Platte, oder wie soll man sagen? EP? Erscheinung …?
All Those Tiny Houses?
Ja.
Sollen wir es einfach zeitgemäß Playlist nennen?
Okay, also, du hast da ja komplett die Pandemie vorweggenommen, diesen Zustand des Zuhausesitzens in zu engen Räumen, die Langeweile der Serien-Cliffhanger, so heißt es doch in dem Lied? Fühlst du dich nun als Prophetin?
Ach was, so funktioniert Musik. Man schreibt etwas, hängt ein paar Sätze aneinander, und später wird das hineingedeutet, was um uns rum so vorgeht. Diesen Zustand kannten wir doch alle eigentlich auch schon vorher, nicht?
Sein leeres Nicken. Sie hatte ihn ausgebremst. Er scrollte wieder herum. Es dauerte, bis er etwas gefunden hatte. Er machte ein akademisches Gesicht:
Diese wütenden Frauenstimmen, bei Patty Smith angefangen, wie sehr ist das ein feministischer Akt?
Bei Patty Smith angefangen? Sollen wir uns erst kurz über Popgeschichte unterhalten?
Charlotte lachte, der Junge versuchte es erneut:
Verstehst du dich als Vorbild? Für junge Frauen. Du weißt schon: Selbstermächtigung und so.
Der Groupie, das Hotelzimmer, ihr Rumtänzeln, ihr Runterschauen am eigenen Körper.
Charlotte versuchte, sich wieder zu konzentrieren, sagte: Mein Publikum besteht zu zwei Dritteln aus Männern.
Weil du eine Frau bist?
Weil ich Nische bin. Und weil Männer sich gerne auskennen.
Auch diesmal fand der Junge sie nicht witzig.
Also gut, nett sein: Eine letzte Frage hast du noch, aber streng dich an.
Gut.
Was ist das eigentlich für eine Zeitschrift, für die du schreibst?
Er wiederholte den Namen, den sie sich auch diesmal nicht merken konnte, er scrollte wieder, schien unzufrieden mit dem, was er vorbereitet hatte, schaute sie an: Die Plattenindustrie ist ja in einer Krise und –
Ich glaube eher, die Industrie war in den Achtzigern und Neunzigern in einem unverdienten Hoch. Man nennt das wohl Blase. Ich bin zur Party gestoßen, als gerade noch niemand wahrhaben wollte, dass diese bereits geplatzt war.
Aber du hast bei einem Majorlabel begonnen.
Ich hätte wohl auch zu den Blütezeiten keinen Nummer-eins-Hit gehabt.
Der Junge streckte den Rücken durch, er schien nun eher in seinem Element zu sein, bestimmt liebte er es, abendelang über den Kapitalismus zu diskutieren und dabei dauernd einer Meinung zu sein. Diese aufrichtige Jugend. Unironisch. Gute Noten und ebensolches Benehmen. Wobei sie die Vorgängergenerationen und deren Hände auf ihren Knien auch nicht vermisste.
Also gut, sagte er, Blase oder nicht, die Industrie geht den Bach runter. Ebenso die Musik?
Wieso sollte sie? Ich kann mir den Beruf eventuell bloß nicht mehr lange leisten.
Wieder ihr Lachen, wieder ohne dass er darauf reagierte, langsam wurde es anstrengend: Hatten wir nicht gesagt, noch eine Frage?
Nur noch eine allerletzte, darf ich?
Also gut.
Er müsse etwas ausholen. Sie habe ihre Karriere ja bei einem Großlabel gestartet, ob es da nicht seltsam sei, dass, ähm … also, dass jeder weitere Schritt eine Verkleinerung bedeutet habe. Kleinere Plattenfirma, noch kleiner, noch mehr Indie, und nun biete sie Song für Song einzeln im Netz an. Er müsse an seine ehemalige Schulband denken, da habe man das auch so gemacht, aber eben bloß als Promo für Auftritte.
Vergisst du in der Aufzählung meiner Karriereschritte nicht diese winzige Fernsehsache, die so ein ganz kleines bisschen Einfluss darauf hatte, dass ich jetzt immer noch zum Beispiel gerade hier spiele?
Ja, klar, das. Aber auf Bekanntheit will ich nicht hinaus.
Und was genau ist dann die Frage?
Ist das die Art, wie heutzutage das Produkt Musik verkauft wird? Alles selber machen? Fühlt sich das frei an?
Charlotte musste lange überlegen.
Er: Entschuldige, das war vielleicht eine blöde Frage.
Sie: Nein, ich habe bloß noch nie darüber nachgedacht.
Sie schwieg wieder, kam auf keine Antwort.
Sagte: Es fällt mir immer noch schwer, mich selbst als Produkt zu sehen.
Er wartete, ob sie noch etwas hinzufügen würde.
Dann: Und du kommst wirklich aus Hannover?
Das Konzert wurde überraschend schön, außer dass Mick danach mit ihr darüber reden wollte, wie überraschend schön es gewesen war.
Er hatte halb so laut gespielt wie sonst. Er redete neuerdings auch halb so laut.
Der Veranstalter kam an, Textschwall zum Thema Publikumsdichte, die Leute hätten sich irgendwie noch nicht daran gewöhnt, dass es wieder Konzerte gab, und so weiter. Kein Wort zur Musik. Charlotte verzog sich.
Sie schlief früh, war um neun bereits wach.
Sie würde frühstücken müssen, bevor sie weiterfuhren. Sie malte sich noch im Bett die nächsten Schritte aus: Telefon nehmen, sich etwas aufs Zimmer bestellen. Sie wiederholte die Vorstellung, um sie nicht in Realität umsetzen zu müssen. Wie ein Traum, in dem man aufstehen muss, all die kleinteiligen Einzelheiten der Morgenverrichtungen vollzieht, Klo, Duschen, Anziehen. Dann erwacht man.
Sie hatte keine Lust auf Interaktion, wollte keine Wünsche durchgeben müssen, kein Danke an der Tür.
Bescheuerte Kurzschlusslösung: der Frühstücksraum.
Natürlich saß Mick bereits da. Am Fenster. Er winkte. Eine andere Option, als sich dazuzusetzen, gab es nicht.
Mick, sehr zuvorkommend, nach kurzer Na-alles-klar-gut-geschlafen-mhm-ja-doch-Konversation signalisierte er mit offensivem Aufs-Smartphone-Schauen, dass er sie in Ruhe zu lassen gedenke. Erst als sie sich mit Kaffee und diversen Brötchensorten gesetzt, die Minibutter ausgepackt und den Deckel des Marmeladenpäckchens abgezogen hatte, konnte er die Frage nicht zurückhalten: Geht es etwas besser?
Es wurde also impliziert, dass es ihr schlecht ging.
Der Versuch ihres Ausweichens: Etwas müde noch, danke.
Er wieder scrollend. So sieht heutzutage Zeitunglesen aus, dachte sie, hätte sich gewünscht, er hätte Großflächigeres vor dem Gesicht. Das Stück, das Mick aufführte, hieß: Ich bin ganz bei mir und lasse dir allen Raum, den du brauchst. Ihr war es schneller unangenehm als ihm.
Komm schon, lass es.
Was?
Das hier, dieses, ach, ich weiß auch nicht …
Sie bestrich ihr Brötchen, trank Kaffee, er behielt sie im Blick, sagte: Weißt du, Charlotte, ich bin hier.
Sie: Nicht zu übersehen.
Er: Ich merke, dass du dich zurückziehst, dass das alles nicht so leicht ist …
Mit »das alles« meinst du, dass meine Mutter gestorben ist?
Ja. Aber du bist nicht allein. Ich bin da.
Wie gesagt: Unübersehbar.
Für dich, meine ich, sagte er.
Ich weiß, Mick. Ich weiß.
Vermisst du sie?
Meine Mutter?
Ja.
Nein.
Micks Blick. Die Stille. Das Wort war aus ihr herausgefallen. Einfach so.
Trotz? Vielleicht. Aber nun hatte sie es gesagt, und nun musste sie darüber nachdenken, ob es stimmte. Und sie musste mit Micks Fragezeichengesicht umgehen, seiner Fürsorgegrimasse.
Wir haben uns nicht oft gesehen in den letzten, sagen wir, Jahren.
Ich weiß.
Viel vom Abschied hatte bereits stattgefunden.
Ein Nicken von ihm. Schau nicht so, dachte sie. Ein Hund, der auf ein zweites Leckerli wartet.
Dieses Jahr war das erste, in dem ich mich noch nicht mal zum Geburtstag gemeldet habe. Es gab einfach keinen sinnvollen Weg. Telefonieren funktionierte nicht mehr. Sie ging nicht mehr ran, das Klingeln sei ihr zu laut, es irritiere sie immer so.
Ich wusste nicht, dass sie so alt war.
Siebenundsechzig.
Das …
Sie war krank. Letztes Jahr ging das noch. Mit dem Telefonieren. Aber jetzt musste man ihr gegenübersitzen und damit umgehen können, dass man nicht spricht.
Es gibt Postkarten.
Ja. Vielleicht hätte ihr Freund ihr die vorgelesen. Aber das habe ich wohl verpasst. Wie lange braucht so eine Postkarte aus Europa?





























