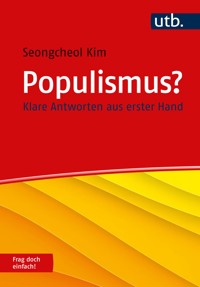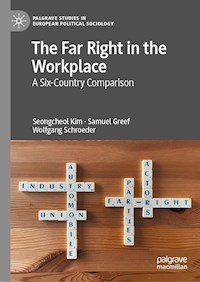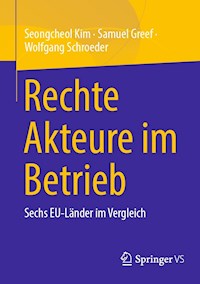54,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit 2010 sind neue Formen der Parteiorganisation zu sichtbaren Bestandteilen des Parteienwettbewerbs in vielen europäischen Ländern geworden. Dieses Buch greift das in aktivistischen und demokratietheoretischen Debatten zunehmend verbreitete Vokabular von Horizontalität und Vertikalität auf und entwickelt einen diskursiv-organisatorischen Forschungsansatz zur Einordnung horizontaler und vertikaler Spielarten parteiförmiger Organisationspraxis. Im Mittelpunkt stehen dabei Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs als paradigmatische Formen horizontaler bzw. vertikaler Parteiorganisation. Unter Berücksichtigung zahlreicher aktueller Fallbeispiele aus ganz Europa untersucht Seongcheol Kim die Funktionsweise dieser Parteitypen im dynamischen Spannungsfeld zwischen horizontal verflachter Koordination und vertikal zugespitzter Führung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Seongcheol Kim
Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs
Neue Formen politischer Organisation in Europa
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Seit 2010 sind neue Formen der Parteiorganisation zu sichtbaren Bestandteilen des Parteienwettbewerbs in vielen europäischen Ländern geworden. Dieses Buch greift das in aktivistischen und demokratietheoretischen Debatten zunehmend verbreitete Vokabular von Horizontalität und Vertikalität auf und entwickelt einen diskursiv-organisatorischen Forschungsansatz zur Einordnung horizontaler und vertikaler Spielarten parteiförmiger Organisationspraxis. Im Mittelpunkt stehen dabei Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs als paradigmatische Formen horizontaler bzw. vertikaler Parteiorganisation. Unter Berücksichtigung zahlreicher aktueller Fallbeispiele aus ganz Europa untersucht Seongcheol Kim die Funktionsweise dieser Parteitypen im dynamischen Spannungsfeld zwischen horizontal verflachter Koordination und vertikal zugespitzter Führung.
Vita
PD Dr. Seongcheol Kim ist Privatdozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Interkulturelle und Internationale Studien der Universität Bremen. https://orcid.org/0000-0001-8920-9369
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Dank
1.
Einleitung
1.1
Horizontalität, Vertikalität und politische Organisation: erste Überlegungen
1.2
Parteiorganisation im Wandel: eine Bestandsaufnahme
1.3
Horizontale und vertikale Parteitypen: ein diskursiv-organisatorischer Forschungsansatz
1.4
Analytisches Vorgehen und Quellengrundlage
1.5
Struktur des Bandes
2.
Horizontalität und Vertikalität in der Protestkonjunktur: Radikale Demokratie trifft auf Populismus
2.1
Einleitung und Problemlage
2.2
Radikale Demokratietheorie nach den Plätzen: zum Verhältnis von Horizontalität und Vertikalität
2.3
Radikale Demokratie und Populismus: Grundzüge eines Spannungsverhältnisses
2.4
Horizontalität, Vertikalität und politische Organisation: erste Überlegungen
2.5
Fazit
3.
Horizontalität und Vertikalität im Spiegel der Parteienforschung
3.1
Michels: Die funktionale Notwendigkeit oligarchischer Führung
3.2
Duverger: Mittelbare und unmittelbare Struktur, horizontale und vertikale Bindungen
3.3
Kirchheimer und Panebianco: Vertikalisierungstendenzen im Formwandel der Massenparteien
3.4
Katz und Mair: Vertikalisierungstendenzen im Spiegel der Kartellisierungsthese
3.5
Horizontalität, Vertikalität und Parteiorganisation: weiterführende Überlegungen
3.6
Fazit
4.
Horizontalität, Vertikalität und Parteiorganisation: Ein diskursiv-organisatorischer Forschungsansatz
4.1
Horizontalität und Vertikalität aus diskursiv-organisatorischer Perspektive
4.2
Das Standardmodell der modernen Mitgliederpartei
4.3
Horizontale Parteitypen
4.3.1
Bewegungsparteien
4.3.2
Klientelistisch-korporative Parteimaschinen als horizontale Organisationsform?
4.4
Vertikale Parteitypen
4.4.1
Volksparteien neuen Typs
4.4.2
Business-Firm-Parteien
4.4.3
Autoritär-patrimoniale Staatsparteien
4.5
Fazit
5.
Bewegungsparteien
5.1
Zum Begriff der Bewegungspartei
5.2
Zur Funktionslogik von Bewegungsparteien: dezentrale Bewegungsräume, horizontale Koordination, kollektive Führungsspitze
5.3
Bewegungsparteien von links
5.3.1
Fallbeispiel: CUP in Katalonien
5.4
Bewegungsparteien der Mitte
5.4.1
Fallbeispiel: Együtt in Ungarn
5.5
Bewegungsparteien von rechts
5.5.1
Fallbeispiel: Konfederacja in Polen
5.5.2
Exkurs: Ist die AfD eine Bewegungspartei?
5.6
Diskussion und Fazit
6.
Volksparteien neuen Typs
6.1
Zum Begriff der Volkspartei (neuen Typs)
6.2
Zur Funktionslogik von Volksparteien neuen Typs: undifferenzierte Basis, plebiszitäre Akklamation, einheitliche Hyperführung
6.3
Volksparteien neuen Typs von links
6.3.1
Fallbeispiel: Podemos in Spanien
6.4
Volksparteien neuen Typs der Mitte
6.4.1
Fallbeispiel: Fünf-Sterne-Bewegung in Italien
6.5
Volksparteien neuen Typs von rechts
6.5.1
Fallbeispiel: Front National/Rassemblement Bleu Marine in Frankreich
6.6
Exkurs: Ist das Bündnis Sahra Wagenknecht eine Volkspartei neuen Typs?
6.7
Diskussion und Fazit
7.
Mischformen, Übergänge und Diffusion
7.1
Mischformen zwischen Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs
7.1.1
Von Spanien nach Kroatien, Serbien und Rumänien: Munizipalistische Formationen als Parteiakteure
7.1.2
Más País und Sumar in Spanien
7.2
Adaptations- und Diffusionsprozesse um Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs
7.2.1
Von Bewegungspartei zu Volkspartei neuen Typs: Die Transformation von Syriza in Griechenland
7.2.2
Transnationale Diffusion der »Podemos-Hypothese«? Ein Blick auf Ostmittel- und Südosteuropa
7.3
Bewegungsnahe Parteien: AfD in Deutschland, Corbyn-Labour in Großbritannien
7.4
Die moderne Klassenavantgardepartei
7.4.1
Fallbeispiel: Partei der Arbeit Belgiens
7.5
Exkurs: Zur Einordnung der Digitalpartei
7.6
Fazit
8.
Fazit
8.1
Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs: ein Resümee
8.2
Erscheinungs- und Verteilungsmuster von Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs
8.3
Weiterführende Forschungsperspektiven
8.4
Schlussbemerkungen
Abkürzungen
Abbildungen
Bibliografie
Register
Dank
Der vorliegende Band basiert auf einer kumulativen Habilitationsschrift, für die das Habilitationsverfahren im Juli 2023 mit der Verleihung der Venia Legendi an der Universität Bremen abgeschlossen wurde. Er baut aber auch auf einer länger etablierten Forschungsagenda zu den Themenkomplexen radikale Demokratie und Populismus, Horizontalität und Vertikalität sowie Organisationsformen an der Schnittstelle von Parteien und Bewegungen, die über viele Jahre sowie verschiedene Karrierestationen in Berlin, Kassel und Bremen verfolgt wurde. Seit Juni 2022 wird meine Stelle in Bremen durch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt POPRADEM finanziert (Fördernummer 469527186). Ich möchte mich bei allen Kollegen bedanken, die Teile des Manuskripts in der einen oder anderen früheren Fassung gelesen und kommentiert haben: Endre Borbáth, Arthur Borriello, Lluis de Nadal, Lazaros Karavasilis, Oliver Marchart, Kolja Möller, Martin Nonhoff, Heiko Pleines und Jakob Schultz. Bei Gerrit Pantel bedanke ich mich herzlich für sein hilfreiches Sprachlektorat des Gesamtmanuskripts. Auf persönlicher Ebene bin ich meinen Eltern für ihre unendliche Liebe und Unterstützung zutiefst dankbar.
Etwa die Hälfte der Kapitel basieren zum Teil auf Aufsatzpublikationen (in alleiniger Autorschaft), die auszugsweise und in erheblich erweiterter bzw. überarbeiteter Form ins Manuskript einflossen. Dies gilt im Einzelnen für Kapitel 2: »Von Lefort zu Mouffe. Populismus als Moment und Grenze radikaler Demokratie«, Zeitschrift für Politikwissenschaft 32 (4): 767–86 (2022), und »Between Autonomy and Representation: Toward a Post-Foundational Discourse Analytic Framework for the Study of Horizontality and Verticality«, Critical Discourse Studies 20 (4): 345–60 (2023); Kapitel 5: »Movement Parties of the Left, Right, and Center: A Discursive-Organizational Approach«, Constellations (2023, Online First) und »Far-Right Movement Parties in Europe: Two Perspectives«, Nations and Nationalism (2024, Online First); sowie Kapitel 6: »Das Ende eines Zyklus? Podemos und France Insoumise als Volksparteien neuen Typs«, Forschungsjournal Soziale Bewegungen 35 (3): 441–51 (2022). Die Aufsätze »Von Lefort zu Mouffe«, »Between Autonomy and Representation« und »Movement Parties of the Left, Right, and Center« gehörten außerdem zur kumulativen Habilitationsschrift.
1.Einleitung
In diesem Band geht es um neue Formen von Parteiorganisation, die insbesondere seit 2010 in Europa in den Vordergrund gerückt sind. Das Jahr 2010 markierte mit dem ersten Troika-Memorandum zu Griechenland den Beginn der sog. Eurokrise, aber mit den Antiregierungsprotesten in Tunesien auch den Beginn einer globalen Protestwelle um die sog. Platzbewegungen (engl. movements of the squares), die dezentral und ohne Federführung von Parteien und Verbänden mit öffentlichen Platzversammlungen und -besetzungen im Namen des gesamten ›Volkes‹ oder auch der ›Bürgerschaft‹ auftraten. Mit den Indignados- und Aganaktismenoi-Protesten in Spanien bzw. Griechenland 2011 für »echte Demokratie« und gegen Austeritätsmaßnahmen sowie den Platzbewegungen gegen autoritäre Machthaber im MENA-Raum sowie in Russland (2011/12), der Türkei (2013) und der Ukraine (2013/14) waren viele Hoffnungen verbunden, dass die 2010er Jahre ein neues Zeitalter der Demokratisierung markieren würden. Zu dieser erhofften und auf vielen öffentlichen Plätzen bereits im Entstehen begriffenen Demokratisierungswelle gehörten für viele Beobachter:innen neue Formen politischer Organisation: Insbesondere in zeitgenössischen Debatten innerhalb der radikalen Demokratietheorie war von ›horizontalen‹, führungslosen, netzwerkartigen Organisationsformen als präfigurativer Praxis der selbstverwalteten Demokratie in den Protestlagern und -versammlungen die Rede. Nach dem Abebben dieser Proteste wiederum richteten sich viele gespannte Blicke auf Parteiphänomene wie Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien oder auch die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die anscheinend versuchten, die die Impulse solcher Protestbewegungen mit massenhaften Platzversammlungen und innerparteilichen Partizipationsmechanismen in die eigene organisatorische Funktionsweise aufzunehmen – und gleichzeitig, so die naheliegende Kritik, in ›vertikale‹ führungszentrierte Parteiorganisationen zu überführen.
Der Ausgangspunkt des vorliegenden Bandes besteht in dieser Begegnung zwischen Bewegungen und Parteien, zwischen (scheinbarer) Horizontalität und Vertikalität, zwischen dem radikaldemokratischen Moment der Platzproteste und dem vieldiskutierten ›populistischen Moment‹, mit dem zahlreiche Parteien, die an die Platzbewegungen anzuknüpfen versuchten, in Verbindung gebracht wurden. Vor diesem Hintergrund haben Begriffe wie Horizontalität und Vertikalität, die insbesondere an der Schnittstelle von aktivistischen Diskursen und radikalen Demokratietheorien weitverbreitete Verwendung gefunden hatten, auch als analytische Kategorien an Zulauf und Plausibilität gewonnen, um politische Organisationsformen im Wandel und im Mittelpunkt des Politikgeschehens in zahlreichen Ländern in den Blick zu nehmen. Das Ziel des vorliegenden Bandes besteht darin, das Vokabular von Horizontalität und Vertikalität aus der radikalen Demokratietheorie aufzugreifen, mit der etablierten Parteienforschung zusammenzudenken und auf Typenbildung inklusive Analysen prominenter Fallbeispiele aus ganz Europa anzuwenden. Welche Formen horizontaler und vertikaler Parteiorganisation sind insbesondere seit 2010 in Europa entstanden und durch welche Merkmale und Funktionsweisen zeichnen sie sich aus? Was bedeutet es überhaupt, dass eine Partei ›horizontal‹ oder ›vertikal‹ geprägt ist? Welche Spielarten horizontaler und vertikaler Parteiorganisation gibt es im Allgemeinen und wie stehen sie im Verhältnis zueinander? Die Antworten auf diese Fragen werden im Kontext dieses Einleitungskapitels skizzenhaft angerissen und dann im Laufe des Bandes sukzessiv herausgearbeitet. Die Hauptthese besteht darin, dass Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs (VNTs) jeweils paradigmatische Spielarten horizontaler bzw. vertikaler Parteiorganisation darstellen und die Funktionsweise von Horizontalität bzw. Vertikalität im Parteiwesen exemplarisch zur Schau stellen. Dieses Argument wird sowohl durch eine Bestandsaufnahme radikaldemokratischer Theoriedebatten zu Horizontalität und Vertikalität als auch mit einer Lektüre einflussreicher Theorien der Parteiorganisation in der klassischen Parteienforschung untermauert und in den einzelnen Kapiteln anhand illustrativer Fallbeispiele aus dem linken, zentristischen und rechten Parteienspektrum veranschaulicht.
Im Folgenden wird der Gegenstand des Bandes in fünf Blöcken präsentiert, die eine Vorschau der nachfolgenden Kapitel bieten: 1) erste theoretische Überlegungen zum Themenkomplex Horizontalität, Vertikalität und Parteiorganisation; 2) eine Bestandsaufnahme der etablierten Bezugspunkte zu Parteiorganisation im Wandel innerhalb der modernen Parteienforschung; 3) die Herausarbeitung der diskursiv-organisatorische Forschungsperspektive dieses Bandes; 4) anschließende Überlegungen zum analytischen Vorgehen und zur Quellengrundlage in den einzelnen Kapiteln; und schließlich 5) ein Gesamtüberblick über die Struktur des Bandes.
1.1Horizontalität, Vertikalität und politische Organisation: erste Überlegungen
Als erster theoretischer Ausgangspunkt fungiert die Begegnung zweier Politikformen sowie Diskussionsstränge in der Forschung – nämlich radikaler Demokratie und Populismus – im Kontext der neuen Krisen- und Protestkonjunktur der frühen 2010er Jahre. Vor dem Hintergrund der Platzbewegungen gab es in der radikalen Demokratietheorie rege Diskussionen über den ›horizontalen‹ und radikaldemokratischen Charakter dieser Bewegungen als netzwerkartige und präfigurative Praxis einer selbstverwalteten Organisation von Demokratie auf den Plätzen (vgl. Stavrides 2012; Prentoulis und Thomassen 2013; Sitrin und Azzellini 2014; Butler 2015) und/oder als Ausdruck der immanenten Widerstandskraft einer global verkehrenden Multitude (vgl. Lorey 2012; Hardt und Negri 2013; Kioupkiolis und Katsambekis 2014). Es kristallisierten sich innerhalb dieser Rezeption insbesondere zwei prominent vertretene Theoriestränge heraus: ein um Hardts und Negris (2002; 2004) Theorie des Empire und der Multitude zentrierter Strang hob das führungslose und unkoordinierte Zusammenkommen körperlicher Singularitäten in »offenen, hierarchiefreien Versammlungen« (Hardt und Negri 2013, 62) ohne jegliche Überführung in ›vertikale‹ repräsentationsbasierte Strukturen hervor, wohingegen ein weiterer Theoriestrang im Anschluss an die Diskurs- und Hegemonietheorie Laclaus und Mouffes ([1985] 2012) gerade den Moment der Überführung radikaldemokratischer Protest- in gegenhegemoniale (auch populistische) Führungs- und Herrschaftsansprüche als Dreh- und Angelpunkt jeglichen Potenzials für radikalen politischen Wandel fokussierte. Für Beobachter:innen wie Gerbaudo (2017a; 2017b) und Mouffe (2018; Errejón und Mouffe 2015) bestand das Interessante an den Platzprotesten nicht zuletzt darin, dass diese fruchtbare Kombinationsmöglichkeiten von Horizontalität und Vertikalität, von radikaler Demokratie und Populismus aufzeigten. In diesem Zusammenhang plädierte Mouffe mit Blick auf den Aufstieg linkspopulistischer Projekte wie Syriza und Podemos für eine »neue politische Organisationsform«, die die verschiedensten Protestforderungen sowohl radikaldemokratisch in »horizontale Ausdrucksformen« einbinden als auch vertikal um den Namen eines populistisch reklamierten Volkssubjekts mit dem Anspruch auf die Erlangung der Regierungsmacht zusammenführen müsse (Errejón und Mouffe 2015, 113 f.).
Bereits in diesen Überlegungen deutet sich an, dass das Spannungsverhältnis zwischen radikaler Demokratie und Populismus einen aufschlussreichen theoretischen Ausgangspunkt für eine Annäherung an Horizontalität und Vertikalität bieten kann. Insbesondere im Spiegel der radikalen Demokratietheorie Laclaus und Mouffes ([1985] 2012) und der Populismustheorie Laclaus (2005a; 2005b) weist das Verhältnis von radikaler Demokratie und Populismus einen illustrativen Charakter für eine grundlegende Spannung zwischen Horizontalität und Vertikalität auf, die sich in der jeweils konstitutiven Funktion der horizontalen Autonomie intersektionaler Kämpfe und der vertikalen Repräsentations- und Identifikationsfunktion hegemonialer Führung verdichtet. So gesehen können Horizontalität und Vertikalität nicht nur als Diskursstrukturen, sondern auch als Organisationslogiken bei der Aushandlung kollektiver Identitätskonstruktionen betrachtet werden. Hierfür bieten wiederum parteipolitische Experimente in Anknüpfung an diverse Protestphänomene seit 2010 ein besonders aufschlussreiches Feld, wie Mouffes Plädoyer für eine Synthese horizontaler und vertikaler Ausdrucksformen im Rahmen des Linkspopulismus nahelegt. Dabei sind Horizontalität und Vertikalität nicht mit radikaler Demokratie bzw. Populismus gleichzusetzen und stellen gegenseitig konstitutive Facetten organisatorischer Praxis dar: Es gibt keine Horizontalität ohne Vertikalität und umgekehrt (vgl. auch Prentoulis und Thomassen 2013).
In Kapitel 2 werden erste theoretische Überlegungen zu Horizontalität, Vertikalität und politischer Organisation präsentiert, indem dieses Spannungsfeld ausgehend von den Debatten zum Phänomen der globalen Platzbewegungen und zum Verhältnis zwischen radikaler Demokratie und Populismus innerhalb der radikalen Demokratietheorie herausgearbeitet wird. Im Anschluss an diese Überlegungen wird eine Unterscheidung zwischen Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs als horizontalen und vertikalen Ausdrucksformen im Kontext der Parteiorganisation vorgeschlagen und im Zuge der nachfolgenden Kapitel im Dialog mit der etablierten Parteienforschung weiterentwickelt.
1.2Parteiorganisation im Wandel: eine Bestandsaufnahme
In der modernen Parteienforschung sind Diskussionen über Parteiorganisation im Wandel von einer immer wieder rekurrierenden Reihe theoretischer Bezugspunkte geprägt: vom sog. ehernen Gesetz der Oligarchie (Michels [1911] 1925) und dem Übergang von der elitären Kaderpartei des 19. Jahrhunderts zur Massenpartei im Sinne Duvergers ([1951] 1959) über die Wandeldiagnosen Kirchheimers (1965) und Panebiancos (1982) bis hin zur Kartellpartei-These von Katz und Mair (1995; 2018). Bereits in den Klassikern von Michels ([1911] 1925) und Duverger ([1951] 1959) mit dessen Klassifikation von Parteiorganisationsformen lassen sich Anhaltspunkte identifizieren, um Horizontalität und Vertikalität als konstitutive Facetten parteiförmiger Organisationspraxis zu begreifen: etwa die funktionale Differenzierung zwischen den Führenden und den Geführten bei Michels oder auch Duvergers Begrifflichkeiten von mittelbarer und unmittelbarer Struktur sowie horizontalen und vertikalen Bindungen, die eine Einordnung der verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung des Beziehungsgeflechts zwischen Basis und Führung im Rahmen einer Parteiorganisation ermöglichen. Eine horizontale Bindungslogik von Interaktions- und Koordinationsmechanismen zwischen funktional äquivalenten Organisationseinheiten geht insbesondere mit einer mittelbaren Struktur einher, wohingegen vertikale Bindungen durch die Vermittlung der niedrigsten Organisationseinheiten über die höheren Ebenen in den meisten (unmittelbaren) Massenparteien und in besonders strammer Ausprägung bei den kommunistischen Zellenparteien identifiziert werden. Durch die Wandeldiagnosen Kirchheimers (1965; [1966] 1990) mit der catch-all party bzw. Allerwelts-/Volkspartei sowie Panebiancos (1982) mit dessen Unterscheidung zwischen der bürokratischen Massenpartei und der professional-elektoralen Partei wird nicht nur ein Formwandel der Massenparteien der Nachkriegszeit beschrieben, sondern auch die Möglichkeit angedeutet, vertikale Bindungen nicht nur an der pyramidenförmigen Integration der niedrigsten Organisationsebenen über intermediäre Abläufe und Strukturen festzumachen, sondern gerade an der Aushöhlung und Umgehung solcher organisierten Zwischeninstanzen durch zunehmend professionalisierte und führungszentrierte Organisationsformen. Für dieses Verständnis von Vertikalität als Ausdrucksform von »Entinstitutionalisierung« (Panebianco 1982, 486) zugunsten einer mediatisierten und zentralisierten Führungsspitze lassen sich auch in der Kartellisierungsdiagnose von Katz und Mair (1995; 2018) Anhaltspunkte finden.
In Kapitel 3 werden mithilfe dieser Reise durch einflussreiche Theorien der Parteiorganisation in der etablierten Parteienforschung weiterführende Überlegungen zu Horizontalität, Vertikalität und Parteiorganisation präsentiert. Horizontalität und Vertikalität lassen sich demnach als Organisationslogiken auffassen, die sich um das Ausmaß der inneren Differenzierung und Pluralisierung der Grundelemente sowie deren Bindungslogik und Beziehungsgeflecht zur Führung drehen. Kennzeichnend für Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs ist die Zuspitzung einer horizontalen bzw. vertikalen Logik, indem sie jeweils auf horizontale Koordinationsbindungen zwischen verbündeten Bewegungsorganisationen oder vertikale plebiszitäre Bindungen zwischen einer undifferenzierten Basis und einer einheitlichen Führungsspitze unter weitgehendem Verzicht auf intermediäre Instanzen setzen.
1.3Horizontale und vertikale Parteitypen: ein diskursiv-organisatorischer Forschungsansatz
Dieser Band schlägt einen diskursiv-organisatorischen Forschungsansatz zur Untersuchung von Horizontalität und Vertikalität vor, der die diskurs- und hegemonietheoretischen Überlegungen im Anschluss an Laclau und Mouffe mit klassischen Theorien der Parteiorganisation zusammendenkt. Dieser integrierte Ansatz ist deshalb »diskursiv-organisatorisch«, da er Organisationen in einem diskursiven Sinne als materiell instituierte und performativ aufgeführte Arrangements relationaler Sinn- und Identitätsstiftungen begreift, in denen Kategorien wie Mitglied, Führung und Beschlussorgane mit Bedeutung gefüllt, in einem (tendenziell horizontal oder vertikal geprägten) Beziehungsgeflecht zueinander gesetzt und in eine tägliche Praxis der dadurch konstituierten Subjekte in deren Verhältnissen untereinander übersetzt werden. Damit wird in Anlehnung an das expansive Diskursverständnis Laclaus und Mouffes ([1985] 2012) die materielle und performative Dimension von Diskurs verstärkt aufgegriffen und in Bezug auf Konstruktions- und Aushandlungsprozesse kollektiver Identitäten im Rahmen dauerhaft angelegter Organisationsstrukturen gedacht.
Aus dieser Forschungsperspektive wird Horizontalität als Logik der inneren Differenzierung, Pluralisierung und koordinierten Verflachung, Vertikalität hingegen als Logik der Vereinheitlichung, Konzentrierung und plebiszitären Zuspitzung aufgefasst. Horizontalität in der Parteiorganisation bedeutet grundsätzlich, dass autonom organisierte und außerhalb der Parteiorganisation jeweils eine eigenständige Existenz führende Akteur:innen als Grundeinheit der Parteiorganisation fungieren und durch kollektive Repräsentanz in Form eigener parteiinterner Plattformen sowie kollektiv besetzter Führungsstrukturen der Partei horizontale Koordinationsbindungen eingehen, wohingegen Vertikalität in diesem Kontext bedeutet, dass eine möglichst undifferenzierte Basis von Einzelpersonen als Grundeinheiten der Organisation durch plebiszitäre Akklamation gegenüber einer einheitlichen Führungsspitze unter weitgehender Umgehung intermediärer Instanzen vertikale Bindungen aufweist. Im horizontalen Szenario ist die Voraussetzung einer kollektiven Führungsspitze auf oberster Exekutivebene der Partei zentral, damit die Exekutivmacht nicht nur horizontal auf mehrere Repräsentant:innen der jeweiligen Sektoren verflacht wird, sondern deren organisierte Präsenz in Form eines kollektiven Koordinationsmechanismus auch von der Basis- auf die Führungsebene übertragen wird. Nach einer vertikalen Logik hingegen sind die Mitglieder in ihrer Funktion als Einzelpersonen weitgehend undifferenziert und in ein einheitliches Akklamationsverhältnis zu einer einzigen Führungsspitze gesetzt.
Die jeweils paradigmatischen Spielarten horizontaler bzw. vertikaler Parteiorganisation in diesem Sinne bilden Bewegungsparteien, in denen dezentral organisierte Bewegungsräume die Grundeinheiten darstellen und in der kollektiven Führungsspitze der Partei kollektiv vertreten sind, sowie Volksparteien neuen Typs, in denen die undifferenzierte Basis aus einer möglichst breiten Masse von mithilfe niedrigschwelliger Eintrittshürden und Mitmach-Angeboten registrierten und partizipierenden Einzelpersonen besteht, die von einem stark mediatisierten Hyperleader (in Anlehnung an Gerbaudo 2019) als aufständisches Subjekt des angestrebten politischen Wandels versammelt und aufgerufen werden. Der paradigmatische Charakter dieser Parteitypen für Horizontalität und Vertikalität ist nicht zuletzt damit verbunden, dass sie der Mitgliederbasis als entscheidungstragendem Subjekt einen konstitutiven Platz innerhalb der Parteiorganisation zuweisen und sie dadurch zum expliziten Gegenstand organisatorischer Vermittlung im Beziehungsgeflecht zwischen Basis und Führung machen – im Gegensatz zu anderen möglichen Spielarten horizontaler und vertikaler Parteiorganisation wie etwa lokalen party machines (in ihrer Blütezeit im 19. Jahrhundert in den USA) oder auch Business-Firm-Parteien, die eine minimal eingebundene oder überhaupt keine Mitgliedschaft voraussetzen.
In Kapitel 4 wird der diskursiv-organisatorische Forschungsansatz systematisch neben einer Konzeptualisierung von Horizontalität, Vertikalität, Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird das, was als Standardmodell der modernen Mitgliederpartei bezeichnet wird und sich durch eine intermediäre Einhegung vertikaler Bindungen auszeichnet, als etablierte Spielart der Parteipolitik und somit als Kontrast zu den ausgeprägt horizontalen und vertikalen Parteiformen konzeptualisiert. In der Diskussion zu horizontalen und vertikalen Parteitypen wird neben Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs auf andere mögliche Erscheinungsformen von Horizontalität und Vertikalität eingegangen: von klientelisch-korporatistischen Parteimaschinen mit weitgehend autonomen lokalen Einheiten bis hin zu Business-Firm-Parteien und autoritär-patrimonialen Staatsparteien. In Kapiteln 5 bis 7 werden Bewegungsparteien, Volksparteien neuen Typs und hybride sowie benachbarte Parteitypen – wie etwa Mischformen mit Bewegungspartei- und VNT-Elementen, Übergänge vom einen Typus zum anderen, bewegungsnahe Parteien in Abgrenzung von Bewegungsparteien und moderne Klassenavantgardeparteien als vertikale Spielart im Gegensatz zu VNTs – im Einzelnen untersucht und an illustrativen Fallbeispielen aus ganz Europa veranschaulicht.
1.4Analytisches Vorgehen und Quellengrundlage
Die Anwendung des diskursiv-organisatorischen Ansatzes setzt ein integriertes Vorgehen unter Berücksichtigung einer breiten Palette an Quellenmaterialien voraus. Das sehr umfassende Verständnis von Diskurs in Anlehnung an Laclau und Mouffe hat zur Folge, dass die Analyse diskursiv(-organisatorisch)er Praktiken nicht von vornherein auf einen nach Quellenart systematisch abgegrenzten Korpus beschränkt werden kann (z.B. nur Parteiprogramme und/oder Statute; vgl. hierzu auch Kim 2022a). Außerdem besagt das performative Verständnis von Organisation, dass nicht nur formelle Regelwerke und Statute, sondern auch die täglichen Praktiken der Inszenierung und Übersetzung dieser in dynamische Beziehungsmuster zwischen den ausgemachten Subjekten einer Parteiorganisation berücksichtigt werden müssten. Dies stellt jede Analyse vor die Herausforderung, dass die in diesem Sinne relevanten Quellenmaterialien potenziell unendlich sind. Dementsprechend muss auf Grundlage des einschlägigen Fallwissens sowie Entscheidungsvermögens des Autors situativ und fallspezifisch bestimmt werden, welche Quellen(-arten) im Rahmen einer kompakten Fallanalyse von Relevanz sind (man denke beispielsweise an autoritäre Staatsparteien, die grundsätzlich keine Wahlprogramme erstellen und diese Form von Quellen insofern unbrauchbar machen).
Im Kontext dieses Bandes nehmen empirische Fallbeispiele einen vor allem illustrativen Charakter für die Konzept- und Typenbildung ein und sind deshalb primär von thick description im Zusammenspiel mit Primärquellen verschiedenster Art geprägt. Für die Fallbeispiele in Kapiteln 5 bis 7 fließen grundsätzlich diverse Materialien in die Analyse ein: von offiziellen Statuten, einschlägigen Programmdokumenten und Informationsmaterialien für Neumitglieder bis hin zu Wahlwerbespots in kontextuell wichtigen Wahlkämpfen. Alle Quellen wurden in der Originalsprache herangezogen und von mir ins Deutsche übersetzt. Angesichts des illustrativen Charakters der Fallbeispiele wird die Analyse generell kompakt gehalten und durch das konzeptuelle Vokabular von Horizontalität, Vertikalität und den für diese jeweils kennzeichnenden Relationsdynamiken zwischen Basis und Führung strukturiert, ohne dabei auf anspruchsvolleren diskursanalytischen Jargon zurückzugreifen. Die Überblicksabschnitte über Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs aus dem linken, zentristischen und rechten Parteienspektrum, an die die Fallbeispiele anschließen, bleiben auf allgemein beschreibender Ebene angesiedelt. Das übergreifende Ziel des Bandes besteht in diesem Sinne in einem produktiven Ineinandergreifen zwischen konzeptueller Reflexion über den horizontalen und vertikalen Charakter dieser Parteitypen einerseits und einer möglichst zugänglichen Veranschaulichung an empirischen Beispielen andererseits.
1.5Struktur des Bandes
Der vorliegende Band besteht neben Einleitung und Fazit aus sechs Kapiteln, die sich in zwei Hauptblöcke einteilen lassen: die Herausarbeitung der theoretischen Grundlagen und des analytischen Rahmens (Kapitel 2–4) und die Analyse spezifischer Parteitypen mit Fallbeispielen (Kapitel 5–7). Innerhalb beider Blöcke weisen die einzelnen Kapitel eine weitgehend ähnliche Struktur sowie Vorgehensweise auf.
In Kapitel 2 erfolgt eine erste theoretische Annäherung an Horizontalität und Vertikalität im Spiegel radikaler Demokratietheorien, beginnend mit den Debatten innerhalb dieser Theorietradition vor dem Hintergrund der globalen Platzbewegungen ab 2010. In diesem Zusammenhang wird der diskurs- und hegemonietheoretische Strang um Laclau und Mouffe fokussiert, der ein konzeptuelles Vokabular zur Erfassung des Spannungsverhältnisses zwischen radikaler Demokratie und Populismus sowie Horizontalität und Vertikalität bereitstellt. In Kapitel 3 werden zentrale theoretische Bezugspunkte zu Parteiorganisation aus der klassischen Parteienforschung – von Michels und Duverger über Kirchheimer und Panebianco bis hin zu Katz und Mair – in den Blick genommen, um insbesondere Anhaltspunkte für Horizontalität und Vertikalität als Kategorien zur Erfassung der Funktionsweise von Parteiorganisationen zu identifizieren. In Kapitel 4 werden schließlich die Überlegungen aus den beiden vorherigen Kapiteln zusammengebracht, um einen diskursiv-organisatorischen Ansatz zu Horizontalität und Vertikalität herauszuarbeiten. Neben der Konzeptualisierung von Horizontalität und Vertikalität sowie Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs als hierfür paradigmatischen Spielarten wird das Standardmodell der modernen Mitgliederpartei als kontrastierende etablierte Parteiform eingeführt und eine Reihe anderer möglicher Erscheinungsformen horizontaler und vertikaler Parteiorganisation – von klientelisch-korporatistischen Parteimaschinen bis hin zu Business-Firm-Parteien und autoritär-patrimonialen Staatsparteien – vorgestellt. Insbesondere Kapitel 2 und 3 folgen mit der Lektüre der einschlägigen Theorien sowie abschließenden Überlegungen zu Horizontalität und Vertikalität einem schrittweisen Aufbau, während Kapitel 4 um eine sukzessive Konzeptualisierung von Horizontalität, Vertikalität und der einschlägigen Parteitypen strukturiert ist.
In Kapitel 5 wird der Typus der Bewegungspartei fokussiert und die diskursiv-organisatorische Konzeptualisierung dieses Parteityps von der etablierten Forschungsliteratur seit dem Definitionsvorschlag Kitschelts (2006) abgegrenzt, die an dieser Stelle als interaktiv-mobilisierungsbezogener Ansatz bezeichnet wird. Der analytische Teil des Kapitels besteht aus allgemeinen Überblicksabschnitten über Bewegungsparteien aus dem linken, zentristischen und rechten Spektrum und anschließenden Fallbeispielen – CUP in Katalonien, Együtt in Ungarn und Konfederacja in Polen. In Kapitel 6 wird eine ähnliche Grundstruktur verwendet: Ausgehend von einer Konzeptualisierung unter Berücksichtigung der Begriffe der Volkspartei (im Sinne Kirchheimers) und der Partei neuen Typs (aus dem leninistischen und später dem allgemeinen publizistischen Sprachgebrauch) wird ein Überblick über VNTs von links, der Mitte und von rechts mit den Fallbeispielen Podemos in Spanien, Fünf-Sterne Bewegung in Italien und Front National/Rassemblement Bleu Marine in Frankreich präsentiert. In Kapitel 7 werden schließlich Mischformen, Übergänge und Diffusionsprozesse in den Blick genommen: Hierzu gehören munizipalistische Plattformen (mit diversen Beispielen aus Spanien, Kroatien und Serbien), eklektische Mischungen von Bewegungspartei- und VNT-Elementen (z.B. Más País in Spanien), Übergänge vom einen Typus zum anderen (z.B. Syriza in Griechenland), bewegungsnahe Parteien in Abgrenzung von Bewegungsparteien (z.B. AfD in Deutschland, Labour Party unter Jeremy Corbyn in Großbritannien) und moderne Klassenavantgardeparteien als vertikale Spielart mit kontrastierenden Elementen zu VNTs (mit Fallbeispiel Partei der Arbeit in Belgien). Ergänzt werden Kapitel 5 bis 7 jeweils mit einem kurzen Exkurs am Ende des Kapitels, der gesonderte Fragestellungen von aktuellem Interesse in den Blick nimmt: ob die AfD als Bewegungspartei (Kapitel 5) und das Bündnis Sahra Wagenknecht als Volkspartei neuen Typs einzustufen sind (Kapitel 6) und wie sich der Typus der Digitalpartei im Sinne Gerbaudos (2019) mit Blick auf Horizontalität und Vertikalität einordnen lässt (Kapitel 7).
In Kapitel 8 werden neben einer kompakten Zusammenfassung der Ergebnisse einige Schlussfolgerungen gezogen, Erscheinungsmuster der einzelnen Parteitypen identifiziert und weiterführende Überlegungen zu deren zukünftiger Entwicklung sowie Erforschung präsentiert. Im Fokus stehen dabei die Implikationen mit Blick auf das Verhältnis von Horizontalität und Vertikalität sowie allgemein identifizierbare Muster hinsichtlich der Entstehungsbedingungen, Entwicklungspfade sowie länderspezifischen Verteilung von Bewegungsparteien und Volksparteien neuen Typs. Außerdem werden weiterführende Forschungsperspektiven und -fragestellungen rund um diese Parteitypen in den Blick genommen.
2.Horizontalität und Vertikalität in der Protestkonjunktur: Radikale Demokratie trifft auf Populismus
2.1Einleitung und Problemlage
Als theoretischer Ausgangspunkt dieses Bandes dient die Begegnung zweier Politikformen sowie Diskussionsstränge in der Forschung – nämlich radikaler Demokratie und Populismus – im Kontext der neuen politischen Konjunkturlage der 2010er Jahre. Das Jahr 2010 markierte zum einen den Beginn einer multiplen Krisensituation im europäischen Kontext: Das erste Troika-Memorandum im Mai 2010 zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit des griechischen Staates signalisierte den Beginn einer Staatsschuldenkrise mit extern verhängten Austeritätsmaßnahmen an der Peripherie des Euroraums, die massenhafte Protestbewegungen hervorrief und in mehreren Ländern politische Krisen mit dem Zerfall amtierender Regierungen sowie die umstrittene Bildung technokratisch geführter und/oder ›nationaler Einheitsregierungen‹ zur Folge hatte. Zum anderen trat mit dem neuen Jahrzehnt ein globaler Protestzyklus um die sog. Platzbewegungen (engl. movements of the squares) ein, beginnend mit den Antiregierungsprotesten in Tunesien ab Dezember 2010 sowie deren Verbreitung in andere Länder des MENA-Raums und schließlich in Form der Indignados- bzw. Aganaktismenoi-Proteste gegen Austerität und für »echte Demokratie« auch nach Spanien und Griechenland. Vor diesem Hintergrund gab es rege Diskussionen innerhalb der radikalen Demokratietheorie über den radikaldemokratischen Charakter dieser Bewegungen als präfigurative Praxis einer selbstverwalteten Organisation von Demokratie in situ (vgl. Stavrides 2012; Prentoulis und Thomassen 2013; Sitrin und Azzellini 2014; Butler 2015) und/oder als Ausdruck der immanenten Widerstandskraft einer global verkehrenden Multitude (vgl. Lorey 2012; Hardt und Negri 2013; Kioupkiolis und Katsambekis 2014). Dabei wurden im Laufe des Jahrzehnts Diagnosen laut, die insbesondere in Anlehnung an Ernesto Laclaus (2005a; 2005b) Theorie des Populismus entweder das Phänomen der Platzbewegungen selbst (vgl. Gerbaudo 2017a; Katsambekis und Kioupkiolis 2019) und/oder das daraus resultierende Gelegenheitsfenster für radikalen Wandel durch Parteien (vgl. Stavrakakis und Katsambekis 2014; Errejón und Mouffe 2015; García Agustín und Briziarelli 2017; Mouffe 2018) mit (Links-)Populismus in Verbindung brachten. Gerade mit dem Aufkommen bzw. Aufstieg von Parteien wie Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien, die in Anknüpfung an die Platzproteste mit neuen Formen politischer Organisationspraxis und mit dem Anspruch antraten, durch die Erlangung der Regierungsmacht im Namen eines aufständischen Volkssubjekts die Forderungen nach »echter Demokratie« einzulösen, machte sich ein produktives, wenn auch unauflösbares Spannungsverhältnis nicht nur zwischen radikaler Demokratie und Populismus, sondern auch zwischen Horizontalität und Vertikalität bemerkbar.
Das Vokabular von Horizontalität insbesondere in Abgrenzung von Vertikalität findet in der zeitgenössischen radikalen Demokratietheorie breite Verwendung, um eine dezentralisierte, netzwerkartige, tendenziell hierarchielose und selbstverwaltete Praxis politischer Organisation zu beschreiben. Der Begriff gewann vor dem Hintergrund der Alterglobalisierungsbewegungen der 1990er und 2000er Jahre an Zulauf (vgl. etwa Sitrin 2006; 2012) und wurde um die Jahrtausendwende verstärkt vom postoperaistischen Strang der radikalen Demokratietheorie um Michael Hardt und Antonio Negri (2002; 2004) aufgegriffen. Im Kontext der Platzbewegungen ab 2010 wurde der horizontale Charakter dieser Proteste rege diskutiert, wobei die Interventionen von Chantal Mouffe (2018; 2023; Errejón und Mouffe 2015) darauf abzielten, die Diskussion in Richtung eines Zusammendenkens von Horizontalität mit Vertikalität, (Links-)Populismus und Parteipolitik zu lenken. Mouffe betonte hierbei die »Synergien« zwischen radikaler Demokratie und Populismus und plädierte für eine »neue politische Organisationsform«, die die verschiedensten Forderungen sowohl radikaldemokratisch in »horizontale Ausdrucksformen« einbinden als auch vertikal um den Namen eines populistisch reklamierten Volkssubjekts zusammenführen müsse (Errejón und Mouffe 2015, 113 f.). Dadurch wird das Verhältnis von Horizontalität und Vertikalität sowie radikaler Demokratie und Populismus nicht zuletzt zu einer Frage politischer und insbesondere parteiförmiger Organisation – gerade in Bezug auf jene Parteiformationen, die auf dem Terrain des elektoralen Wettbewerbs an die Platzproteste anknüpften, aber auch darüber hinaus mit Blick auf einen theoretischen und analytischen Rahmen zur Erforschung horizontaler und vertikaler Parteiorganisation im Allgemeinen. Das Ziel des vorliegenden Bandes besteht darin, einen solchen Rahmen herauszuarbeiten und im Laufe der kommenden Kapitel sukzessiv zu entwickeln.
Dieses Kapitel geht in drei Hauptschritten vor: Zunächst wird der Debattenstand innerhalb der radikalen Demokratietheorie vor dem Hintergrund der globalen Platzprotestwelle in Bezug auf Horizontalität und Vertikalität in den Blick genommen. Hierbei stehen insbesondere zwei Theoriestränge im Mittelpunkt, die in der Rezeption des Phänomens der Platzbewegungen in den Vordergrund gerückt sind: ein biopolitisch-immanentistischer Strang um Hardt und Negri einerseits und ein postfundamental-hegemonietheoretischer um Laclau und Mouffe andererseits. In einem zweiten Schritt wird dieser zweitgenannte Strang für eine gezielte Reflexion über das Spannungsfeld zwischen Horizontalität und Vertikalität aufgegriffen, das sich nicht zuletzt im spannungsreichen Verhältnis zwischen radikaler Demokratie und Populismus zeigt. Abschließend werden erste Überlegungen zum Verhältnis von Horizontalität und Vertikalität in der Erforschung politischer (insbesondere parteiförmiger) Organisation präsentiert und damit auch Brücken zum Hauptinteresse der darauffolgenden Kapitel geschlagen.
2.2Radikale Demokratietheorie nach den Plätzen: zum Verhältnis von Horizontalität und Vertikalität
Radikale Demokratietheorien gehen vom grundsätzlich kontingenten und politisch instituierten Charakter jeglicher sozialen Ordnung aus und heben somit die immer wieder sichtbar werdende Anfechtbarkeit etablierter politischer Systeme durch Protestakteur:innen verschiedenster Couleur als Grundmerkmal gesellschaftlichen Zusammenlebens hervor (vgl. als Überblick etwa Comtesse et al. 2019; Flügel-Martinsen 2020). So gesehen wird Demokratie in mehrerer Hinsicht radikal gedacht: Die Möglichkeit von Demokratie entsteht überhaupt erst aus ihrer radikalen, d.h. konstitutiven und identitätsgebenden, Unvollkommenheit, die selbst wiederum Wege zu ihrer Radikalisierung öffnet, indem etwa die unerfüllten Versprechen demokratischer Ordnung (z.B. ›Freiheit und Gleichheit für alle‹) reklamiert und auf immer mehr Lebensbereiche sowie Menschengruppen ausgeweitet werden. Das Phänomen der globalen Platzbewegungen – von den im Dezember 2010 aufgeflammten Protesten in der MENA-Region zu den Indignados in Spanien, Aganaktismenoi in Griechenland oder auch Occupy Wall Street – legte eine Affinität mit solchen Theorieperspektiven nahe: Schließlich handelte es sich hierbei um Proteste, die sich durch zentrale Appelle an ›echte Demokratie‹, ein Repertoire öffentlicher Platzbesetzungen und -versammlungen im Namen des gesamten ›Volkes‹, der ›Bürgerschaft‹ oder auch der ›99 Prozent‹ und durch das tendenzielle Fehlen zentralisierter Führungsstrukturen auszeichneten. Die von Menschenmengen gefüllten öffentlichen Plätze in aller Welt schienen zur Bühne eines radikaldemokratischen Moments geworden zu sein: Vor dem Hintergrund der neuen Protestkonjunktur erlebten radikaldemokratische Ansätze eine regelrechte Theoriekonjunktur, die von sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnosen über publizistische Beiträge in der medialen Öffentlichkeit hin zum populärwissenschaftlichen Literaturbereich (z.B. Mason 2011; Graeber 2012) reichte. Begriffe wie Horizontalität und Horizontalismus, die an der Schnittstelle von aktivistischen und theoretischen Subkulturen zum geläufigen Sprachcode gehörten, fanden auf einmal und mit besonders aktuellem Anwendungspotenzial ein breiteres Publikum.
Genauer gesagt waren es vor allem zwei Stränge innerhalb dieser breit gefassten Theorietradition, in denen sich der Debatten- und Rezeptionsstand zum Phänomen der globalen Platzbewegungen weitgehend herauskristallisierte: biopolitisch-immanentistische Ansätze einerseits (insbesondere um Hardts und Negris postoperaistische Theorie der Multitude) und postfundamental-hegemonietheoretische Perspektiven andererseits (insbesondere um Laclaus und Mouffes postmarxistische Theorie des Politischen). Auf theoretischer Ebene verdichtet sich der Unterschied zwischen den beiden nicht zuletzt in der Frage, wie politische Subjekte entstehen: Für Hardt und Negri (2002; 2004) weist die Herrschaft des »Empire« im Zeitalter der Globalisierung grundsätzlich einen netzwerkartigen, über unzählige dezentrale Knoten verkehrenden Charakter auf (z.B. das Internet im Gegensatz zu traditionellen Print- und Rundfunkmedien), aus denen wiederum die »Multitude« als Vielzahl an Bündelungen widerstandsfähiger Singularitäten eine immanente Widerstandskraft entfaltet. Für Laclau und Mouffe ([1985] 2012; vgl. auch Laclau 1990) hingegen dreht sich Politik als Kampf um Hegemonie um konkurrierende Gründungsversuche gesellschaftlicher Ordnung, bei der wiederum die diskursive Konstruktion eines ›Volkes‹ als symbolisch privilegierter Kategorie demokratischer Politik insbesondere im Spätwerk Laclaus (2005c) eine Schlüsselrolle einnimmt (zum »postfundamentalen« Charakter dieser Theorieperspektive siehe Marchart 2010). Im Kontext der Alterglobalisierungsbewegungen der 1990er und 2000er Jahre wurde Hardt und Negris Denken neben ähnlich gelagerten Ansätzen zu einem wichtigen Referenzpunkt, beispielsweise in Form von Hakim Beys Vorstellung der »Temporary Autonomous Zones«, die sich in diversen Versuchen der Schaffung von Freiräumen aktivistisch-subkultureller Autonomie jenseits von Staat und Kommerz niederschlug – von selbstverwalteten sozialen Zentren bis hin zu linksalternativen Medien wie Indymedia und Netzdienstanbietern wie Riseup (vgl. Gerbaudo 2017c). Gerade im Nachgang des sog. Battle of Seattle 1999 – das als vorläufiger Höhepunkt der dezentralen Alterglobalisierungsproteste galt (in diesem Fall gegen die Welthandelsorganisation, später zahlenmäßig übertroffen durch die Anti-G8-Proteste 2001 in Genua) – blühten jene Theorieansätze auf, die entweder ein »posthegemoniales« Zeitalter verkündeten (vgl. Beasley-Murray 2003; Day 2005; Arditi 2007; Lash 2007) oder auch in ähnlicher Hinsicht den netzwerkartigen bzw. rhizomatischen, jenseits zentralisierter Hierarchien und Institutionen operierenden Charakter von Herrschaft und Widerstand hervorhoben (z.B. Hardt und Negri 2002; 2004; Holloway 2002). Im Kontext der neuen Protestkonjunktur der 2010er Jahre war es aber anscheinend nicht nur dieser Theoriestrang, sondern auch jener um Laclau und Mouffe, der eine erhöhte Aktualität nicht zuletzt für viele Protestakteur:innen beanspruchen konnte, indem er – so Gerbaudos (2017a; 2017c) These – dem neuen Protestgeist die passenden Bezugspunkte bereitstellte: die Berufung auf ein souveränes ›Volk‹, den Kampf um die strategische Aneignung und Ausweitung von Begriffen wie ›Demokratie‹ und ›Freiheit‹ sowie den Anspruch auf eine mehrheitsfähig-populäre (statt einer minoritär-subkulturellen) Identität, der durch massenhafte Mobilisierungsaufrufe auf Mainstream-Digitalplattformen wie Facebook und Twitter inszeniert wurde.
So gesehen war der radikaldemokratische Moment Anfang der 2010er Jahre auch ein »populistischer Moment«, wie Mouffe (2018) in ihren späteren Schriften argumentierte und damit an einen länger etablierten Strang gegenwartsdiagnostischer Diskussionen in der Populismusforschung über die Sternstunde oder auch das Zeitalter des Populismus anknüpfte (vgl. Krastev 2011; Mudde 2016; Brubaker 2017; Gerbaudo 2017d). Anders als zahlreiche Beobachter:innen, die Populismus als inhärent illiberales und gegen die liberale Demokratie gerichtetes Phänomen deuteten (vgl. etwa Mudde und Rovira Kaltwasser 2017; Mudde 2021), argumentierte Mouffe (2018), dass ein linker Populismus im Anschluss an ihre mit Laclau formulierte radikale Demokratietheorie (vgl. Laclau und Mouffe [1985] 2012) zu einer Vertiefung sowie Radikalisierung der liberalen Demokratie im Namen von ›Freiheit und Gleichheit für alle‹ – und in diesem Zusammenhang auch zu einer wirksamen Bekämpfung des Rechtspopulismus – beitragen kann. Für Beobachter:innen wie Gerbaudo und Mouffe boten gerade die Platzbewegungen die Gelegenheit, Populismus in Anlehnung an Laclaus (2005a) Theorie in einem produktiven Zusammenspiel mit radikaler Demokratie in Betracht zu nehmen: Gerbaudo (2017a, 7) sah in den Platzbewegungen eine Synthese aus »the neo-anarchist method of horizontality and the populist demand for sovereignty«, die er als »citizenism« bezeichnete. Aus dieser Sicht waren radikale Demokratie und Populismus keine strikten Gegensätze, sondern kombinierbare Optionen bei der Konstruktion einer kollektiven Identität und in der Organisationspraxis horizontal geprägter Protestbewegungen. So gesehen stellte sich die Frage nach der Aushandlung von Horizontalität und Vertikalität – sowohl in Bezug auf die grundlegende Spannung zwischen radikaldemokratischem Pluralismus einerseits und populistischer Privilegierung der zentralen Kategorie des ›Volkes‹ andererseits (vgl. Laclau 2005c) als auch mit Blick auf mögliche Implikationen für die organisatorische Dimension.
Gerade in den verschiedenen Diskussionen innerhalb der radikalen Demokratietheorie identifizierten zahlreiche Beobachter:innen der Platzbewegungen eine grundsätzliche Spannung zwischen horizontaler Autonomie und vertikaler hegemonialer Führung (vgl. Prentoulis und Thomassen 2013; Kioupkiolis und Katsambekis 2014; Sitrin und Azzellini 2014; Kioupkiolis 2016; Eklundh 2019), wobei Autonomie in diesen Beiträgen häufig in Anlehnung an Hardt und Negri als schwarmartiges Versammeln einer Multitude in dezentral-horizontalen Netzwerken von Platzversammlungen aufgefasst wurde, während Hegemonie im Sinne von Laclau und Mouffe auf den Anspruch des versammelten Kollektivsubjekts verwies, demokratische Ordnung neu zu (be-)gründen und die Konturen des gesellschaftlichen Zusammenlebens neu zu definieren. Für Hardt und Negri (2013, 62) bestand der radikaldemokratische Charakter dieser Proteste im Zusammenkommen körperlicher Singularitäten in »offenen, hierarchiefreien Versammlungen«, ohne dabei in repräsentationsbasierte und hierarchische Strukturen überführt zu werden, wohingegen für Gerbaudo (2017b, 41) das Radikale an diesen Protesten nicht zuletzt in deren »radical reclaiming of citizenship« sowie in der Formulierung alternativer (gegenhegemonialer) Herrschaftsansprüche im Namen demokratischer Souveränität gegenüber einem als korrupt und oligarchisch wahrgenommenen System zu beobachten war. Nach Hardt und Negri könnten solche Proteste nur in dem Maße radikaldemokratisch sein, wie sie ihren horizontal vernetzten Charakter jenseits jeglicher Hierarchie und Repräsentation beibehalten, wohingegen für Mouffe (2018, 82) gerade das vertikale Moment hegemonialer Führung unverzichtbar ist, um die »demokratischen Forderungen« der Plätze in radikalen politischen Wandel auf dem Terrain von Institutionen und Wahlen zu überführen – entgegen einem »rein horizontalistische[n] Verständnis von radikaler Demokratie«, wie sie in ihrem Plädoyer für ein Zusammendenken von radikaler Demokratie und Linkspopulismus betont. Ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden Denkrichtungen zeigt sich nicht zuletzt in gegensätzlichen Deutungen des Verhältnisses der Platzproteste zur Frage der Repräsentation: Ausgehend u.a. vom berühmten Slogan der Indignados – »Sie repräsentieren uns nicht!« – entwickelte Isabell Lorey (2012; 2020) ein präsentisches Verständnis von radikaler Demokratie als versammelter körperlicher Präsenz in Abgrenzung gegen jegliche Repräsentation, wohingegen der damalige Podemos-Stratege Íñigo Errejón und Mouffe (2015) sich in ihrem Gesprächsband darüber einig waren, dass ebendieser Slogan nicht von einer Ablehnung von Repräsentation als solcher, sondern vom Wunsch nach anderen (demokratischeren) Repräsentationsformen sowie Repräsentant:innen zeugte, dem ein linkspopulistisches Projekt nach ihrer Auffassung entsprechen vermag.
Aus einer an Laclau und Mouffe angelehnten Theorieperspektive öffnet sich ein Blick auf Horizontalität und Vertikalität als konstitutive Dimensionen politischer – und nicht zuletzt organisatorischer – Praxis, deren Aushandlung das Spannungsverhältnis zwischen radikaler Demokratie und Populismus bestimmt. Im Linkspopulismus komme es darauf an, so Mouffe, eine »neue politische Organisationsform« zu erfinden, die »horizontale Ausdrucksformen« der verschiedensten demokratischen Forderungen ermöglichen als auch diese vertikal in ein Hegemonieprojekt um den Namen eines Volkssubjekts zusammenführen müsse (Errejón und Mouffe 2015, 113 f.). So gesehen wird das Verhältnis von radikaler Demokratie und Populismus, von Horizontalität und Vertikalität nicht zuletzt zu einer Frage der organisatorischen Aushandlung. Diese ist wiederum nicht nur strategischer Natur – wie Mouffes (2018) Überlegungen zum »populistischen Moment« der 2010er Jahre im Anschluss an den radikaldemokratischen Moment der Platzproteste nahelegen – sondern auch eine grundlegend theoretische: Gerade dem Frühwerk Laclaus und Mouffes ([1985] 2012) zu radikaler Demokratie lässt sich ein Verständnis von Autonomie und Horizontalität entnehmen, wobei diese anders als bei Hardt und Negri nicht als striktes Gegenteil in einem Nullsummenspielverhältnis zu Vertikalität verstanden wird, sondern in einem produktiven Spannungsfeld verortet wird, das sich nicht zuletzt in der Akzentverschiebung von radikaler Demokratie zu Populismus im Spätwerk Laclaus und Mouffes nachzeichnen lässt. Im Folgenden wird mit Blick auf die Herausarbeitung eines theoretisch und analytisch brauchbaren Konzepts von Horizontalität und Vertikalität zunächst eine Einbettung in die radikaldemokratische Theorietradition unternommen und das Verhältnis zwischen radikaler Demokratie und Populismus im Spiegel verschiedener radikaler Demokratietheorien unter die Lupe genommen, um daraus wiederum ein Verständnis von Horizontalität und Vertikalität in theoretischer und analytischer Hinsicht zu entwickeln.
2.3Radikale Demokratie und Populismus: Grundzüge eines Spannungsverhältnisses
In der »postfundamentalen« Denktradition (vgl. hierzu Marchart 2010) wird radikale Demokratie grundsätzlich in Bezug auf die radikale Kontingenz und Unvollkommenheit gesellschaftlicher Ordnung gedacht. In dieser Hinsicht ist die Demokratietheorie Claude Leforts richtungsweisend: Für Lefort bildet Demokratie die erste Gesellschaftsform überhaupt, »die die Unbestimmtheit in ihre Form aufnimmt und erhält« und in diesem Sinne nach seiner berühmten Formulierung »die Grundlagen aller Gewißheit auflöst« (Lefort [1986] 1990, 291, 296). Im Gegensatz zur absoluten Monarchie wird in der Demokratie demnach der Ort der Macht von einer transzendentalen Grundlage (wie z.B. dem Gottesgnadentum) entbunden und zur »Leerstelle« gemacht, die einem ergebnisoffenen »Konflikt der kollektiven Willensäußerungen unterworfen« und damit grundsätzlich zu dessen kontingenten und temporären Resultat reduziert wird (Lefort