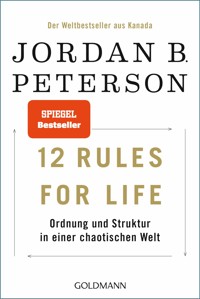19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Der aktuell einflussreichste Vordenker der westlichen Welt" New York Times Mit seinem internationalen Bestseller 12 Rules for Life half Professor Jordan B. Peterson als Psychologe und gefeierter Professor an der Harvard University Millionen von Menschen, Ordnung in das Chaos ihres Lebens zu bringen. In Beyond Order – Jenseits der Ordnung konzentriert er sich auf die Gefahr die von zu viel Struktur ausgeht. Er liefert zwölf weitere lebensrettende Prinzipien, die helfen unserem ewigen Wunsch, die Welt zu ordnen zu widerstehen. Denn ein Übermaß an Ordnung fordert unweigerlich seinen Tribut: sie lässt uns bis zur Unterwerfung versteinern. Denn zu viel Sicherheit ist ebenso gefährlich wie ein Übermaß an Chaos das uns mit Instabilität und Angst bedroht. Stattdessen sollten wir uns auf unseren Instinkt verlassen, um Sinn und Zweck zu finden, auch – und gerade – wenn wir uns machtlos fühlen. Jenseits der Ordnung ist ein Aufruf, die beiden grundlegenden Prinzipien der Realität – Chaos und Ordnung – ins Gleichgewicht zu bringen und den schmalen Pfad mutig zu beschreiten, der sie trennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
JORDAN B. PETERSON
BEYOND ORDER – JENSEITS DER ORDNUNG
12 weitere Regeln für das Leben
JORDAN B. PETERSON
BEYOND ORDER
JENSEITS DER ORDNUNG
12 weitere Regeln für das Leben
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
3. Auflage 2023
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Copyright © 2020 Jordan B. Peterson. Originally Published in English by Portfolio, an imprint of Penguin Random House
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Projektleitung: Georg Hodolitsch; Isabella Steidl
Übersetzung: Astrid Gravert; Antoinette Gittinger; Hans Freundl und Norbert Juraschitz
Redaktion: Dr. Daniel Bussenius
Korrektorat: Anja Hilgarth; Anke Schenker
Umschlaggestaltung: in Anlehnung an das Cover der Originalausgabe Marc-Torben Fischer, München
Satz: ZeroSoft SRL, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-428-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-815-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-816-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Für meine Frau Tammy Maureen Peterson, die ich seit fünfzig Jahren innig liebe und die meiner Meinung nach in jeder Hinsicht über alle Maßen bewundernswürdig ist.
Inhalt
Eine Vorbemerkung des Autors in Zeiten der Pandemie
Ouvertüre
Regel 1
Machen Sie soziale Einrichtungen oder gestalterisches Wirken nicht gedankenlos schlecht
Regel 2
Stellen Sie sich vor, wer Sie sein könnten, und arbeiten Sie dann zielstrebig darauf hin
Regel 3
Verstecken Sie Unerwünschtes auf keinen Fall im Nebel
Regel 4
Beachten Sie, dass Möglichkeiten schlummern, wo Verantwortung abgelehnt wurde
Regel 5
Tun Sie nichts, was Sie verabscheuen
Regel 6
Geben Sie Ideologien auf
Regel 7
Arbeiten Sie so hart, wie Sie können, an mindestens einer Sache und sehen Sie, was passiert
Regel 8
Versuchen Sie, ein Zimmer in Ihrem Zuhause so schön wie möglich zu machen
Regel 9
Wenn alte Erinnerungen Sie noch immer quälen, schreiben Sie diese mit Sorgfalt vollständig nieder
Regel 10
Planen und taktieren Sie mit Bedacht, um die Romantik in Ihrer Beziehung aufrechtzuerhalten
Regel 11
Lassen Sie nicht zu, dass Sie verbittert, betrügerisch oder arrogant werden
Regel 12
Seien Sie trotz der eigenen Leiden dankbar
Coda
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Eine Vorbemerkung des Autors in Zeiten der Pandemie
Es ist eine schwierige Aufgabe, während einer globalen Krise, die durch die Ausbreitung von COVID-19 entstanden ist, ein Sachbuch zu schreiben. Es erscheint absurd, dass man in dieser herausfordernden Zeit überhaupt an etwas anders denken kann als an diese Krankheit. Dennoch wäre es falsch, das Denken vollständig an dieser Pandemie auszurichten, denn irgendwann wird das normale Leben zurückkehren und wieder in den Vordergrund rücken. Das bedeutet, dass ein Autor gegenwärtig zwangsläufig einen Fehler machen muss, entweder indem er sich zu sehr auf die Pandemie konzentriert, die eine unbestimmte Dauer hat, und ein Buch vorlegt, das schon beim Erscheinen überholt ist, oder indem er die Pandemie ignoriert und damit den sprichwörtlichen Elefanten im Raum übersieht.
Nachdem ich darüber nachgedacht und das Thema mit meinem Verlag besprochen hatte, entschloss ich mich, Beyond Order. 12 Weitere Regeln für das Leben entsprechend dem schon vor einigen Jahren festgelegten Plan zu schreiben und mich darin auf Themen zu konzentrieren, die sich nicht spezifisch auf die heutige Zeit beziehen (und damit eher den zweiten als den erstgenannten Fehler zu riskieren). Ich glaube, dass die Menschen, die das Buch lesen oder sich die Audiofassung anhören werden, es als eine gewisse Erleichterung empfinden werden, wenn sie ihre Aufmerksamkeit etwas anderem als dem Coronavirus zuwenden können und der Zerstörung, die es nach sich gezogen hat.
Ouvertüre
Am 5. Februar 2020 wachte ich auf einer Intensivstation in Moskau auf. Ich war mit fünfzehn Zentimeter breiten Gurten an den Seiten des Bettes festgebunden, weil ich auch trotz Bewusstlosigkeit noch sehr unruhig war und versucht hatte, mir die Kanülen aus dem Arm zu reißen und aus der Intensivstation wegzulaufen. Ich war verwirrt und beunruhigt, weil ich nicht wusste, wo ich mich befand, und von Menschen umgeben war, die in einer mir fremden Sprache redeten, und auch weil meine Tochter Mikhaila und ihr Ehemann Andrej nicht da waren, die mich nur kurze Stunden besuchen durften und denen nicht erlaubt worden war, während meiner Aufwachphase anwesend zu sein. Ich war auch wütend darüber, dass ich überhaupt hier war, und fuhr meine Tochter an, als sie einige Stunden später erschien. Ich fühlte mich verraten, was aber der Wirklichkeit vollkommen widersprach. Die Menschen hier hatten sich mit großer Sorgfalt meiner vielfältigen Nöte angenommen, nachdem die enorme logistische Herausforderung bewältigt worden war, in einem völlig fremden Land medizinische Hilfe zu organisieren. Ich erinnere mich an nichts mehr, was in den vorangegangenen Wochen mit mir geschehen war, und ich weiß auch praktisch nichts darüber, was zwischen diesem Augenblick und meiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Toronto Mitte Dezember passiert war. Wenn ich an die ersten Tage des Jahres zurückzudenken versuche, fallen mir als Erstes die Stunden ein, in denen ich an diesem Buch arbeitete.
Einen Großteil von Beyond Order habe ich in einer Phase geschrieben und überarbeitet, in der meine Familie von mehreren aufeinanderfolgenden und sich überschneidenden schweren Erkrankungen heimgesucht wurde, worüber auch öffentlich berichtet wurde, sodass dazu einige nähere Erläuterungen erforderlich sind. Zunächst musste sich Mikhaila im Januar 2019 einem Eingriff unterziehen, bei dem ihr künstliches Sprunggelenk ersetzt wurde, das ihr vor ungefähr zehn Jahren implantiert worden war, aber nicht richtig saß und ihr immer wieder heftige Schmerzen bereitete, ihre Beweglichkeit beeinträchtigte und schließlich fast völlig versagte. Ich verbrachte eine Woche bei ihr in einem Krankenhaus in Zürich, wo die Operation vorgenommen wurde und ihre Frührehabilitation stattfand.
Anfang März unterzog sich dann meine Ehefrau Tammy in Toronto einem chirurgischen Eingriff, der bei einer häufigen und gut behandelbaren Art von Nierenkrebs routinemäßig durchgeführt wird. Eineinhalb Monate nach dieser Operation, bei der ein Drittel des betroffenen Organs entfernt worden war, erfuhren wir, dass Tammy an einem extrem seltenen bösartigen Tumor litt, bei dem die Sterblichkeit binnen eines Jahres annähernd einhundert Prozent beträgt.
Zwei Wochen später entfernten die behandelnden Chirurgen die verbliebenen zwei Drittel der befallenen Niere sowie einen großen Teil des damit verbundenen abdominalen lymphatischen Systems. Dieser Eingriff brachte zwar den Krebs anscheinend zum Stillstand, führte jedoch zu starkem Austritt von Flüssigkeit (bis zu vier Liter am Tag) aus ihrem nun stark geschädigten lymphatischen System – es war ein sogenannter chylöser Aszites –, was fast noch bedrohlicher war als die ursprüngliche Erkrankung. Wir fuhren nach Philadelphia zu einem Team von Spezialisten, denen es nach der Injektion von Mohnöl-Farbstoff, der zur Bildkontrastverstärkung bei CT- und MRI-Aufnahmen dient, innerhalb von sechsundneunzig Stunden gelang, den Flüssigkeitsaustritt zu stoppen. Dieser große Erfolg wurde an genau jenem Tag erzielt, auf den unser dreißigster Hochzeitstag fiel. Meine Frau erholte sich rasch und allem Anschein nach auch vollständig – was eindrucksvoll belegt, dass jeder auch eine gewisse Portion Glück im Leben braucht, zum anderen aber wohl auch ihrer bewundernswerten Kraft und ihrem Selbstbehauptungswillen geschuldet war.
Während all dieser Ereignisse ging es aber leider auch mit meiner Gesundheit bergab. Ich hatte Anfang 2017 ein angstlösendes Mittel einzunehmen begonnen, nachdem ich eine Autoimmunreaktion auf etwas entwickelt hatte, das ich in der Weihnachtszeit 2016 zu mir genommen hatte.[1]
Aufgrund der Reaktion auf das Nahrungsmittel litt ich unter akuten, dauerhaften Ängsten und fror ständig, auch wenn ich mehrere Schichten Kleidung anzog. Außerdem sank mein Blutdruck so stark, dass mir beim Aufstehen jedes Mal schwarz wurde vor den Augen und ich mich bis zu einem Dutzend Mal niederkauern musste, bevor ich es abermals versuchen konnte. Zudem litt ich unter extremen Schlafstörungen. Mein Hausarzt verschrieb mir Benzodiazepin sowie Schlaftabletten. Letztere nahm ich nur wenige Male, dann ließ ich sie weg; meine heftigen Symptome, auch die Schlaflosigkeit, verschwanden durch das Benzodiazepin fast augenblicklich, wodurch das Schlafmittel überflüssig wurde. Fast drei Jahre lang schluckte ich Benzodiazepin, weil mein Leben in dieser Zeit ungewöhnlich aufreibend war (es war eine Phase, in der in das beschauliche Leben eines Universitätsprofessors und Arztes, das ich bis dahin führte, die turbulente und fordernde Realität einer öffentlichen Person einbrach) und weil ich glaubte, dass dieses Medikament, wie oft über die Benzodiazepine gesagt wird, ein relativ harmloses Mittel sei.
Im März 2019 änderte sich dann einiges, als meine Frau ihren Kampf gegen die Krankheit aufnahm. Meine Ängste hatten sich spürbar verstärkt im Gefolge der erwähnten Krankenhauseinlieferung von Mikhaila, ihrer Operation und nachfolgenden Erholung. Daher bat ich meinen Hausarzt um eine höhere Dosierung des Benzodiazepins, damit ich nicht ständig mit meinen Ängsten beschäftigt war oder andere damit behelligte. Doch nach dieser Anpassung stellte sich eine deutliche Stimmungsverschlechterung ein. Ich verlangte abermals eine Erhöhung der Dosis. (Mittlerweile hatten wir es mit Tammys zweiter Operation und deren Komplikationen zu tun, und dieser Tatsache schrieb ich meine noch weiter gestiegenen Ängste zu. Ich kam nicht auf den Gedanken, dass sich eine paradoxe Reaktion auf das Medikament entwickelt haben könnte (welche später diagnostiziert wurde), sondern glaubte, dass eine Depressionsneigung, die mich früher längere Zeit geplagt hatte, wiedergekehrt sei.)[2] Im Mai dieses Jahres aber setzte ich Benzodiazepin schließlich vollständig ab und probierte im Verlauf von einer Woche zwei Dosen Ketamin, das mir ein Psychiater empfohlen hatte, den ich konsultierte. Ketamin, ein nichtstandardmäßiges schmerzstillendes Mittel und Psychedelikum, zeigt manchmal sehr starke, unmittelbar eintretende positive Wirkungen bei Depressionen. Bei mir allerdings bewirkte es nur zwei eineinhalbstündige Höllentrips. Mir war hundeelend und ich wurde von einem überwältigenden Schuldgefühl und von Gefühlen völliger Vergeblichkeit übermannt.
Ein paar Tage nach der zweiten Ketamin-Einnahme machten sich die Auswirkungen des kalten Benzodiazepin-Entzugs bemerkbar, die einfach unerträglich waren – Angstzustände, wie ich sie noch nie gekannt hatte, eine unbeherrschbare Bewegungsunruhe (was als Akathisie bezeichnet wird), erdrückende Gedanken an Selbstvernichtung und das völlige Abhandenkommen jeglicher Glücksempfindungen. Ein Freund unserer Familie, ein Arzt, klärte mich über die Gefahren eines plötzlichen Benzodiazepin-Entzugs auf. Deshalb begann ich wieder eine Benzodiazepin-Pille einzunehmen – allerdings niedrigerer dosiert als vorher. Daraufhin verschwanden viele, wenn auch nicht alle meiner Symptome. Um auch noch die restlichen zu vertreiben, begann ich ein Antidepressivum zu schlucken, das mir in der Vergangenheit schon häufig geholfen hatte. Jetzt aber sorgte es nur dafür, dass ich mich so erschöpft und ausgelaugt fühlte, dass ich täglich zusätzlich vier Stunden oder mehr Schlaf benötigte – was in Anbetracht von Tammys ernsten Gesundheitsproblemen nicht hilfreich war – und dass sich zudem mein Appetit verdoppelte oder verdreifachte.
Nach ungefähr drei Monaten mit fürchterlichen Angstzuständen, unkontrollierbarer Hypersomnie, schier unerträglicher Akathisie und exzessiv gesteigertem Appetit begab ich mich in eine amerikanische Klinik, die nach eigenen Angaben auf raschen Benzodiazepin-Entzug spezialisiert war. Obwohl sich die Psychiater in der Klinik redlich bemühten, gelang es ihnen nur in begrenztem Maß, meine Benzodiazepin-Dosis herunterzufahren, während sich bei mir bereits die negativen Folgen dieses teilweisen Entzugs zeigten, die durch die dort angebotene stationäre Behandlung nicht in den Griff zu bekommen waren.
Dennoch blieb ich von Mitte August, kurz nachdem sich Tammy von den Komplikationen ihres Eingriffs erholt hatte, bis Ende November in dieser Klinik und kehrte schließlich in ziemlich angeschlagenem Zustand nach Toronto zurück. Mittlerweile hatte sich die Akathisie (der unkontrollierbare Bewegungsdrang) so sehr verschlimmert, dass ich in keiner Position mehr auch nur für kurze Zeit sitzen oder liegen konnte, ohne heftige Schmerzen zu empfinden. Im Dezember ließ ich mich in ein örtliches Krankenhaus einweisen, und das ist der letzte Augenblick, an den ich mich erinnere, bevor ich schließlich in Moskau wieder aufwachte. Wie ich später erfuhr, hatten Mikhaila und Andrej mich Anfang Januar 2020 aus dem Krankenhaus in Toronto herausgeholt, weil sie glaubten, dass die Behandlung, die ich dort erhielt, mir mehr schaden als nützen würde (eine Einschätzung, der ich voll zustimmte, sobald ich davon erfuhr).
Die Situation, in der ich mich befand, nachdem ich in Moskau das Bewusstsein wiedererlangt hatte, wurde dadurch kompliziert, dass ich mir in Kanada eine schwere Lungenentzündung zugezogen hatte, was aber erst auf der Moskauer Intensivstation entdeckt wurde. In erster Linie aber war ich in diese Klinik gekommen, weil hier ein Verfahren zur Benzodiazepin-Entgiftung durchgeführt wird, das in Nordamerika nicht bekannt ist oder als zu gefährlich eingestuft wird. Da ich auch schrittweise Reduzierungen der Dosis nicht vertragen hatte – abgesehen von der anfänglichen Verringerung vor mehreren Monaten –, versetzte mich die Klinik in ein künstliches Koma, sodass ich bewusstlos war, als die besonders schlimmen Entzugserscheinungen auftraten. Diese Behandlung begann am 5. Januar und dauerte neun Tage, in denen ich auch künstlich beatmet wurde. Am 14. Januar wurde die Narkose beendet und der Intubationsschlauch entfernt. Ich wurde für ein paar Stunden wach und gab in dieser Phase Mikhaila zu verstehen, dass die Akathisie verschwunden sei, woran ich mich aber nicht erinnere.
Am 23. Januar wurde ich auf eine andere Intensivstation verlegt, die auf neurologische Rehabilitation spezialisiert ist. Ich erinnere mich, dass ich am 26. Januar für kurze Zeit wach wurde, bis ich schließlich am 5. Februar, wie bereits erwähnt, wieder vollständig das Bewusstsein erlangte – zehn Tage, in denen ich ein intensives, mit Wahnbildern angefülltes Delirium durchlebte. Als dies vorbei war, kam ich in ein etwas wohnlicher wirkendes Rehabilitationszentrum in einem Moskauer Vorort. Dort musste ich erst wieder lernen, zu gehen, Treppen hinauf- und hinabzusteigen, mir die Schnürsenkel selbst zu binden, selbstständig ins Bett zu gehen, meine Hände in der richtigen Position auf eine Computer-Tastatur zu legen und zu tippen. Anscheinend hatte ich auch Sehschwierigkeiten, oder besser gesagt, ich tat mich schwer, meine Gliedmaßen in Verbindung mit meinen Wahrnehmungen zu bewegen. Einige Wochen später, nachdem die Wahrnehmungs- und Koordinationsprobleme abgeklungen waren, reiste ich zusammen mit Mikhaila, Andrej und ihrem Kind nach Florida, wo wir auf eine friedliche Zeit der Erholung in der warmen Sonne hofften (worauf wir uns sehr freuten nach der grauen Kälte im Moskauer Winter). Das war, kurz bevor die sich aufbauende COVID-19-Pandemie weltweit für Beunruhigung sorgte.
In Florida versuchte ich die Medikamente abzusetzen, die man mir in der Moskauer Klinik verordnet hatte, obwohl ich in der linken Hand und im linken Fuß noch eine gewisse Taubheit verspürte, die beiden Gliedmaßen zitterten, ebenso meine Stirnmuskeln, ich Krampfanfälle bekam und von quälender Angst befallen wurde. Diese Symptome verstärkten sich markant, als ich die Medikamente weiter reduzierte, sodass ich ungefähr zwei Monate später wieder zu der ursprünglichen in Russland verordneten Dosierung zurückkehrte. Dies war für mich eine schwere Niederlage, denn der Versuch, die Medikamente »auszuschleichen«, war von einer optimistischen Einstellung motiviert worden, die nun nachhaltig erschüttert wurde, als ich wieder zu jenem Maß an Medikation zurückkehrte, von dem ich mich zu einem hohen Preis zu befreien versucht hatte. Zum Glück standen mir in dieser Zeit Angehörige und Freunde zur Seite, und ihre Unterstützung motivierte mich, durchzuhalten und weiterzumachen, auch als meine Symptome immer unerträglicher wurden, vor allem in den Morgenstunden.
Ende Mai, drei Monate nach der Abreise aus Russland, wurde klar, dass sich mein Zustand verschlechterte, statt sich zu bessern, und mir erschien es unvertretbar und unfair, weiter jene Menschen in die Pflicht zu nehmen, die ich liebte und die dieses Gefühl erwiderten. Mikhaila und Andrej hatten Kontakt zu einer Klinik in Serbien aufgenommen, die bei der Benzodiazepin-Entgiftung einen neuen Ansatz verfolgte. Dort brachten sie mich hin, nur zwei Tage, nachdem das Land nach der pandemiebedingten Schließung wieder geöffnet worden war.
Ich möchte nicht behaupten, dass die Ereignisse, die über meine Frau, über mich und all jene Menschen hereinbrachen, die meine Frau pflegten und versorgten, am Ende zu irgendetwas gut gewesen seien. Was meiner Frau widerfuhr, war schrecklich. Sie machte mehr als ein halbes Jahr lang alle zwei oder drei Tage eine schwere, lebensbedrohliche Gesundheitskrise durch und musste dann auch noch mit meiner Krankheit und meiner Abwesenheit zurechtkommen. Ich hingegen hatte ständig mit dem Verlust eines Menschen zu rechnen, der mir seit fünfzig Jahren nahestand und mit dem ich seit dreißig Jahren verheiratet war; ich erlebte die fürchterlichen Auswirkungen dieser Situation auf ihre übrigen Angehörigen, auch auf unsere Kinder, und die grauenhaften Folgen einer Medikamentenabhängigkeit, in die ich, ohne es zu wollen, hineingeraten war. Ich möchte nichts davon schönreden und behaupten, wir wären bessere Menschen geworden dadurch, dass wir all dies durchgemacht haben. Ich kann aber sagen, dass die Erfahrung der Todesnähe meine Frau dazu veranlasst hat, sich intensiver und ernsthafter gewissen Aspekten ihrer spirituellen und schöpferischen Entwicklung zuzuwenden, als sie es sonst getan hätte, und dass ich mich beim Schreiben und Überarbeiten dieses Buches bemüht habe, nur Worte zu verwenden, die ihre Bedeutung auch unter Bedingungen extremen Leidens bewahren konnten. Wir haben es zweifellos unseren Familienangehörigen und Freunden zu verdanken (die in der Schlussbetrachtung dieses Buches namentlich genannt werden), dass wir noch am Leben sind, es ist aber auch festzuhalten, dass die Arbeit des Schreibens, die ich während der gesamten hier dargestellten Phase – mit Ausnahme der Monate, die ich bewusstlos in Russland verbrachte – nicht aufgegeben habe, mir einen Grund zum Weiterleben gegeben hat und mir zum anderen eine Möglichkeit verschafft hat, die Tragfähigkeit der Gedanken zu überprüfen, mit denen ich mich beschäftigte.
Ich glaube, ich habe niemals behauptet – weder in meinem vorhergehenden Buch noch im vorliegenden –, dass es zwangsläufig ausreichend wäre, gemäß den hier vorgestellten Regeln zu leben. Vielmehr habe ich Folgendes erklärt – zumindest hoffe ich, dass ich es deutlich machen konnte: Wenn Sie vom Chaos heimgesucht oder überwältigt werden, wenn die Welt es schlecht mit Ihnen meint oder Sie einen geliebten Menschen durch Krankheit verlieren oder wenn durch tyrannische Gewalt etwas niedergerissen wird, das Sie aufgebaut haben und wertschätzen, dann ist es hilfreich und heilsam, auch die ganze Geschichte zu kennen. All dieses Unglück ist nur die eine, die bittere Hälfte der Geschichte des menschlichen Daseins, in der das heroische Element der Erlösung noch nicht zum Tragen kommt und auch nicht die Erhabenheit des menschlichen Geistes, die es erfordert, auch ein gewisses Maß an Verantwortung zu übernehmen. Wir missachten diese Ergänzung der Geschichte auf eigenes Risiko, denn das Leben ist so schwierig, dass es uns den höchsten Preis abverlangen kann, wenn wir den heroischen Teil unseres Daseins aus den Augen verlieren. Das sollten wir vermeiden. Wir müssen uns vielmehr ein Herz fassen und den Mut aufbringen, die Dinge sorgfältig und gründlich zu betrachten und auf jene Art zu leben, die uns als Möglichkeit gegeben ist.
Sie verfügen in sich selbst über Kraftquellen, auf die Sie bauen können, und auch wenn diese vielleicht nicht vollständig genutzt werden können, reichen sie aus. Ihnen erschließt sich alles, was Sie lernen können, wenn Sie den Irrtum akzeptieren können. Ihnen stehen Medikamente und Krankenhäuser zur Verfügung, Sie haben Ärzte und Pfleger, die sich aufrichtig und engagiert um Sie kümmern und Ihnen helfen, den Tag zu überstehen. Außerdem haben Sie Ihren persönlichen Charakter und Ihren Mut, und auch wenn alles in Trümmern liegt und Sie kurz davor sind, das Handtuch zu werfen, ist da immer noch der Charakter und der Mut jener Menschen, um die Sie sich sorgen und die sich um Sie sorgen. Und mit all dem, vielleicht, nur vielleicht, können Sie es schaffen. Ich kann Ihnen berichten, was mich gerettet hat, fürs Erste wenigstens – die Liebe, die ich für meine Familie empfinde, die Liebe, die sie mir entgegenbringt, die Unterstützung, die sie und meine Freunde mir haben zuteilwerden lassen, und die Tatsache, dass ich noch sinnvolle Arbeit hatte, mit der ich mich abmühen konnte, als ich mich in diesem tiefen Abgrund befand. Ich musste mich zwingen, mich an den Computer zu setzen. Ich musste mich zwingen, mich zu konzentrieren und zu atmen und in den schier endlosen Monaten, in denen ich von Angst und Schrecken gepeinigt wurde, der Versuchung zu widerstehen, alles hinzuwerfen. Ich glaube auch, wenn ich mich der Verbitterung hätte anheimfallen lassen, wäre ich ein und für alle Mal untergegangen – aber ich hatte das Glück, dass mir ein solches Schicksal erspart blieb.
Könnte es nicht sein (auch wenn uns dies nicht immer aus der furchtbaren Lage erlösen mag, in der wir uns befinden), dass wir besser mit Unsicherheit umzugehen verstünden, mit der Tyrannei der Kultur, der Missgunst anderer Leute, wenn wir bessere und mutigere Menschen wären? Wenn wir nach höheren Zielen strebten? Wenn wir wahrhaftiger wären? Würden dann nicht die nutzbringenden Elemente der Erfahrung in unserem Umfeld eher zum Tragen kommen? Wenn Ihre Ziele edel genug wären, Ihr Mut ausreichend und Ihr Streben nach Wahrheit unerschütterlich, wäre es dann nicht möglich, dass das Gute, das dadurch entstehen würde … ja, vielleicht auch den Schrecken rechtfertigen würde? Das mag übertrieben klingen, kommt aber der Sache schon nahe. Solche Haltungen und Handlungen könnten uns zumindest einen Sinn vermitteln, mit dessen Hilfe wir verhindern können, dass uns diese Begegnung mit dem Schrecklichen und dem Furchtbaren zerreibt und die Welt, die uns umgibt, in gewissem Sinn in eine Hölle verwandelt.
Warum der Titel Beyond Order? Das ist eigentlich recht einfach. Ordnung ist erforschtes Terrain. Für uns sind die Dinge in Ordnung, wenn Handlungen, die wir für angemessen halten, jene Ergebnisse erbringen, die wir angestrebt haben. Solche Ergebnisse betrachten wir als positiv, denn sie zeigen uns zum einen, dass wir dem, was wir uns wünschen, nähergekommen sind, und zum anderen, dass unsere Theorie darüber, wie die Welt funktioniert, weiterhin einigermaßen zutreffend ist. Doch jeder Zustand der Ordnung, ganz gleich, wie abgesichert und komfortabel er erscheinen mag, hat Unzulänglichkeiten. Unser Wissen darüber, wie wir uns in der Welt zu verhalten haben, bleibt stets unvollkommen – zum einen, weil wir überhaupt nichts wissen über das große Unbekannte, zum anderen aufgrund unserer absichtlichen Blindheit und schließlich auch, weil sich die Welt immer weiterbewegt, gemäß ihrer entropischen Funktionsweise, und sich auf unerwartete Art verändert. Zudem kann sich die Ordnung, die wir der Welt auferlegen möchten, zu sehr verfestigen als Folge unüberlegter Versuche, alles Unbekannte zu eliminieren. Wenn solche Versuche zu weit gehen, droht der Totalitarismus, der getrieben ist von dem Wunsch, vollständige Kontrolle auszuüben, auch wo eine derartige Form von Kontrolle gar nicht möglich ist, nicht einmal in der Theorie. Daraus erwächst das Risiko, dass alle psychologischen und gesellschaftlichen Veränderungen beschränkt werden, die erforderlich sind, um die Anpassung an eine im stetigen Wandel begriffene Welt zu bewerkstelligen. Und so sehen wir uns schließlich unausweichlich gezwungen, die Ordnung zu durchbrechen und uns ihrem Gegenteil auszuliefern: dem Chaos.
Wenn Ordnung ein Zustand ist, in dem sich das, was wir erstreben, gewissermaßen von selbst manifestiert – sofern wir in Übereinstimmung mit unserem mühevoll erworbenen Wissen handeln –, dann ist Chaos ein Zustand, in dem das, was wir nicht erwarten oder bislang nicht beachtet haben, plötzlich hervorspringt aus dem Potenzial dessen, was uns umgibt. Dass etwas in der Vergangenheit schon oftmals geschehen ist, ist keine Garantie dafür, dass es sich auch in Zukunft wieder auf diese Weise ereignen wird.1 Es gibt immer einen Bereich jenseits dessen, was wir wissen und was wir vorhersagen können. Chaos ist Anomalie, Neuartigkeit, Unberechenbarkeit, Disruption, und nicht selten auch Niedergang, weil sich das, was wir als selbstverständlich erachten, als unsicher erweist. Bisweilen manifestiert es sich auf sanfte Art, enthüllt seine Geheimnisse durch eine Erfahrung, die uns neugierig macht, in den Bann schlägt und unser Interesse weckt. Das ist vor allem dann wahrscheinlich, wenn auch nicht unvermeidlich, wenn wir uns mit gewissenhafter Vorbereitung und Disziplin einem Sachverhalt zu nähern versuchen, den wir nicht auf Anhieb verstehen. Andere Male macht sich das Unerwartete auf furchtbare, schlagartige oder zufällige Weise bemerkbar, sodass wir aus der Bahn geworfen werden, zusammenbrechen und uns nur mit großer Mühe wieder aufrichten können – wenn überhaupt.
Weder der Zustand der Ordnung noch der Zustand des Chaos ist grundsätzlich dem anderen vorzuziehen. Das wäre eine falsche Sichtweise. Gleichwohl habe ich mich in meinem vorhergehenden Buch 12 Rules for Life: Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt mehr darauf konzentriert, wie man die Auswirkungen eines Übermaßes an Chaos in den Griff bekommen kann.2 Auf plötzliche oder unvorhersehbare Veränderungen reagieren wir, indem wir uns physiologisch und psychologisch auf das Schlimmste gefasst machen. Da aber allein Gott weiß, wie dieses Schlimmste aussehen kann, müssen wir uns in unserer Unwissenheit auf alle Eventualitäten vorbereiten. Das Problem dieses ständigen Sich-Vorbereitens besteht darin, dass es uns an den Rand der Erschöpfung bringt. Daraus folgt keineswegs, dass das Chaos ausgeschaltet werden muss (was ohnehin unmöglich ist), gleichwohl müssen wir mit dem Unbekannten vorsichtig umgehen, wie ich in meinem vorherigen Buch immer wieder betont habe. Was nicht mit dem Neuen in Berührung kommt, das erstarrt, und zweifellos wäre ein Leben, dem die Neugier abgeht – jener Instinkt, der uns hinaustreibt in das Unbekannte –, eine sehr reduzierte Form des Daseins. Das Neue ist auch das Aufregende, das Anziehende und das Provokative, jedenfalls sofern es nicht mit einer Intensität und Geschwindigkeit auf uns einstürzt, die unser Dasein auf unerträgliche Weise untergräbt und destabilisiert.
Wie die 12 Rules for Life bietet auch das vorliegende Buch eine Erläuterung von Lebensregeln, die einer längeren, zweiundvierzig Regeln umfassenden Liste entstammen, die ursprünglich auf der Online-Plattform Quora veröffentlicht wurde, einem digitalen Auskunftsdienst, der Antworten auf konkrete Fragen gibt. Das übergreifende Thema von Beyond Order ist – im Unterschied zu meinem vorherigen Buch – die Frage, wie man den Gefahren, die ein Übermaß an Ordnung und Kontrolle mit sich bringt, geschickt aus dem Weg gehen kann. Weil unser Verständnis stets unzureichend ist (wie wir feststellen, wenn sich Dinge, über die wir Kontrolle anstreben, dennoch unserem Zugriff entziehen oder schieflaufen), müssen wir mit einem Bein in der Sphäre der Ordnung stehen und das andere vorsichtig und versuchsweise in den Bereich jenseits davon ausstrecken. So werden wir dazu gebracht, zu forschen und zu erkunden und unser Wissen zu vertiefen, während wir an der Grenze stehen, sicher genug, um unsere Angst beherrschen zu können, aber auch lernend, beständig lernend, wenn wir es mit Erscheinungen zu tun bekommen, mit denen wir noch nicht unseren Frieden geschlossen oder auf die wir uns noch nicht eingestellt haben. Dieser Instinkt des Suchens nach Sinn – etwas, das wesentlich tiefer reicht als das reine Denken –, der uns Orientierung ermöglicht im Leben, damit wir nicht überwältigt werden von dem, was jenseits von uns liegt oder, was ebenso gefährlich wäre, ins Lächerliche entstellt oder verkümmert ist durch überholte, verengte oder zu hochmütig zur Schau gestellte Werte- und Glaubenssysteme.
Worum geht es nun im Einzelnen? Regel 1 bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen stabilen, berechenbaren sozialen Strukturen und der individuellen geistigen Gesundheit und betont, dass solche Strukturen durch kreative Menschen stets verbessert und auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, damit sie ihre Vitalität bewahren können. Regel 2 untersucht anhand eines jahrhundertealten alchemistischen Motivs und gestützt auf mannigfache überkommene und moderne Erzählungen das Wesen und die Herausbildung der integrierten menschlichen Persönlichkeit. Regel 3 warnt vor den Gefahren, die sich einstellen können, wenn man sich verschließt vor den Informationen (die von zentraler Bedeutung sind für die kontinuierliche Auffrischung der Psyche), die durch das Auftreten negativer Emotionen wie Schmerz, Angst und Furcht übermittelt werden. Regel 4 stellt heraus, dass sich Sinnhaftigkeit, die den Menschen aufrechterhält, weniger im Glück finden lässt, das ein flüchtiges Ding ist, sondern eher in der freiwilligen Übernahme von Verantwortung für sich selbst und für andere. Regel 5 erläutert anhand eines Beispiels aus meiner Praxis als klinischer Psychologe, wie wichtig es für den Menschen und die Gesellschaft ist, den Forderungen des Gewissens zu folgen. Regel 6 beschreibt die Gefahr, die damit verbunden ist, wenn man die Ursachen komplexer individueller und sozialer Probleme Einzelvariablen wie Geschlecht, sozialer Schicht oder Macht zuschreibt. Regel 7 erläutert den grundlegenden Zusammenhang zwischen diszipliniertem, auf ein konkretes Ziel gerichtetem Streben und der Herausbildung der Fähigkeit des menschlichen Charakters, Resilienz im Angesicht von Not zu entwickeln. Regel 8 konzentriert sich auf die Bedeutung des ästhetischen Erlebens als einer Wegweisung zum Wahren, Guten und Tragfähigen in der Welt der menschlichen Erfahrung. Regel 9 erläutert, dass vergangene Erlebnisse, die in der Erinnerung angstbeladen sind, ihren Schrecken verlieren können, wenn man sie schriftlich niederlegt und sich freiwillig ein weiteres Mal mit ihnen auseinandersetzt. Regel 10 betont, wie wichtig das klare Gespräch ist für die Aufrechterhaltung von gutem Willen, gegenseitiger Wertschätzung und harmonischem Zusammenwirken, ohne die es keine wahre Liebe geben kann. Regel 11 beschreibt zunächst die Welt des menschlichen Erlebens im Hinblick darauf, wodurch drei verbreitete, aber gefährliche Muster der psychologischen Reaktion motiviert werden, schildert die fatalen Auswirkungen, die sich ergeben, wenn man einem dieser Muster oder gar allen dreien zum Opfer fällt, und zeigt einen alternativen Weg auf. Regel 12 weist darauf hin, dass Dankbarkeit in Anbetracht der unausweichlichen Tragödien des Lebens als eine grundlegende Manifestation jenes bewundernswerten moralischen Mutes anzusehen ist, den wir aufbringen müssen, um unseren beschwerlichen Weg weiter fortsetzen zu können.[3]
Ich hoffe, dass meine Darstellung eines weiteren Sets von zwölf Lebensregeln diesmal vielleicht noch verständlicher und eingängiger ist als jene vor drei Jahren, als ich das erste Dutzend Regeln vorstellte – nicht zuletzt auch aufgrund des sehr informativen Feedbacks, das ich im Gefolge meiner Bemühungen erhalten habe, meine Ideen für ein internationales Publikum in persönlichen Vorträgen, auf YouTube sowie durch meinen Podcast und meinen Blog zu formulieren.[4] Darüber hinaus hoffe ich, dass es mir gelungen ist, einige Punkte zu klären, die in meinem vorhergehenden Werk vielleicht nicht optimal ausgearbeitet wurden, aber zugleich auch viel Neues und Originelles zu präsentieren. Zu guter Letzt hoffe ich, dass auch dieses Buch für viele Menschen wieder ebenso hilfreich sein möge wie das erste Set von zwölf Lebensregeln. Mit großer Dankbarkeit habe ich die Berichte der vielen Menschen gelesen, die bekundeten, dass ihnen die Gedanken und die Geschichten, die ich ihnen nahebringen und mit ihnen teilen durfte, Kraft gegeben haben.
Regel 1
Machen Sie soziale Einrichtungen oder gestalterisches Wirken nicht gedankenlos schlecht
Vereinsamung und Verwirrung
Viele Jahre lang hatte ich einen Klienten, der lebte ganz für sich allein.[5] Neben seiner Wohnsituation war er noch in vielerlei anderer Hinsicht isoliert. Er hatte praktisch keine familiären Bindungen. Seine beiden Töchter waren ins Ausland gezogen, und er besaß keine anderen Verwandten mehr außer seinem Vater und seiner Schwester, von denen er sich entfremdet hatte. Seine Frau und Mutter seiner Kinder war vor ein paar Jahren verstorben, und die einzige Beziehung, die er in den mehr als eineinhalb Jahrzehnten hatte, in denen er zu mir kam, endete auf tragische Weise, als seine neue Partnerin bei einem Autounfall ums Leben kam.
Als wir miteinander zu arbeiten begannen, verliefen unsere Gespräche anfänglich sehr holprig. Er war nicht vertraut mit den Feinheiten sozialer Interaktion, und daher mangelte seinem verbalen und nonverbalen Verhalten jener tanzähnliche Rhythmus und die Harmonie, die kennzeichnend sind für Menschen, die im sozialen Umgang versiert sind. Als Kind war er von beiden Elternteilen völlig vernachlässigt und auch regelrecht entmutigt worden. Sein Vater – der die meiste Zeit abwesend war – legte ein gleichgültiges und sadistisches Verhalten an den Tag, und seine Mutter war chronische Alkoholikerin. Auch in der Schule war er ständig gehänselt und drangsaliert worden, und in seiner gesamten Schulzeit war er nicht auf einen einzigen Lehrer getroffen, der ihn wirklich ernst genommen hätte. Diese Erfahrungen hatten bei meinem Klienten eine Neigung zur Depression hervorgebracht oder zumindest eine vorhandene biologische Tendenz in diese Richtung verstärkt. Er war daher schroff, reizbar und oft etwas sprunghaft, als fühle er sich missverstanden oder sei in einem Gespräch unerwartet unterbrochen worden. Dieses Verhalten sorgte dafür, dass er auch als Erwachsener, vor allem an seinem Arbeitsplatz, immer wieder das Ziel von Mobbing wurde.
Ich stellte in unseren Gesprächen jedoch bald fest, dass es relativ gut lief, wenn ich mich weitgehend zurückhielt und ihn reden ließ. Er kam jede Woche oder alle zwei Wochen, und dann unterhielten wir uns über die Dinge, die ihn in den vergangenen sieben oder vierzehn Tagen beschäftigt oder umgetrieben hatten. Wenn ich in den ersten fünfzig Minuten unserer einstündigen Sitzungen nichts sagte und nur aufmerksam zuhörte, konnten wir uns in den verbleibenden zehn Minuten auf eine relative normale, von wechselseitigem Austausch geprägte Weise unterhalten. Dieses Muster behielten wir über zehn Jahre bei, in denen es mir zunehmend besser gelang, meinen Mund zu halten (etwas, das mir zugegebenermaßen ein wenig schwerfällt). Doch im Lauf der Zeit merkte ich, dass der Anteil der Zeit, in der er negative Themen mit mir besprach, zurückging. Unsere Gespräche – sein Monolog, genauer gesagt – hatten immer mit etwas angefangen, das ihn ärgerte, und waren nur selten darüber hinausgekommen. Doch er bemühte sich sehr außerhalb unserer Treffen, suchte sich Freunde, ging zu Kunstveranstaltungen und Musikfestivals und entdeckte sein lange schlummerndes Talent für das Komponieren von Liedern und das Gitarrespielen. Als er seine sozialen Beziehungen weiter verstärkte, begann er Lösungen für die Probleme zu entwickeln, die er mit mir besprach, und im letzten Teil unserer Sitzungen auch über positivere Aspekte seines Lebens zu reden. Es ging zwar nur langsam voran, aber er machte stetige kleine Fortschritte. Als er mich das erste Mal aufsuchte, konnten wir nicht zusammen an einem Tisch in einem Café sitzen – oder an irgendeinem anderen öffentlichen Ort – und so etwas wie ein reales Gespräch führen, ohne dass er wie gelähmt verstummte. Als sich die Behandlung dem Ende neigte, las er seine Gedichte vor kleinen Gruppen von Menschen vor und hatte sich sogar schon als Stand-up-Comedian versucht.
Er war das beste und anschaulichste Beispiel für etwas, das ich in meiner mehr als zwanzigjährigen Praxis als Psychologe gelernt habe: Menschen brauchen die beständige Kommunikation mit anderen, um ihren Geist in Schuss zu halten. Wir alle müssen denken, um die Dinge zu ordnen, aber wir denken meist über das Reden. Wir müssen über die Vergangenheit reden, damit wir die banalen, übertriebenen Ängste, die uns sonst quälen würden, von jenen Erfahrungen unterscheiden können, die wirklich wertvoll sind. Wir müssen über die Natur der Gegenwart reden und über unsere Pläne für die Zukunft. Wir müssen die Strategien und Taktiken, die wir entwickeln, dem Urteil anderer aussetzen, um ihre Tauglichkeit und Belastbarkeit zu prüfen. Wir müssen auch uns selbst zuhören, wenn wir reden, damit wir unsere unfertigen körperlichen Reaktionen, unsere Motivationen und Gefühle in etwas Artikuliertes und Organisiertes umwandeln und all jene Sorgen und Ängste abstreifen können, die übertrieben und irrational sind. Wir müssen reden – um uns zu erinnern, wie auch um zu vergessen.
Mein Klient brauchte dringend jemanden, der ihm zuhörte. Darüber hinaus musste er ein vollwertiges Mitglied größerer, komplexerer sozialer Gruppen werden – was er in unseren gemeinsamen Sitzungen zu planen begann und dann eigenständig umsetzte. Er war der Versuchung erlegen, die Bedeutung zwischenmenschlicher Interaktionen und Beziehungen geringzuschätzen, weil er aufgrund seiner Lebensgeschichte, die von Einsamkeit und schlechter Behandlung geprägt war, nur geringe Chancen hatte, Gesundheit und Wohlergehen zu erlangen. Doch er arbeitete sich hoch und trat ein in die Welt.
Geistige Gesundheit als soziale Institution
Für Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, die beiden berühmten Tiefenpsychologen, war geistige Gesundheit ein Charakteristikum des individuellen Verstandes. Der Mensch galt ihnen als psychisch gesund, wenn die in ihm vorhandenen Teilpersönlichkeiten integriert waren und in ausgeglichener Weise ihren Ausdruck fanden. Das Es, der unbewusste Teil der Psyche (es repräsentiert die Natur in uns, mit all ihrer Macht und ihrer Fremdartigkeit), das Über-Ich (die bisweilen unterdrückende Repräsentation der gesellschaftlichen Ordnung) und das Ich (das Ego, die Persönlichkeit im engeren Sinn, angesiedelt zwischen diesen beiden beherrschenden Kräften) – sie alle erfüllten spezielle Funktionen nach Auffassung Freuds, der als Erster dieses Strukturmodell der Psyche entwickelte. Das Es, das Ich und das Über-Ich standen zueinander in Wechselwirkung, vergleichbar etwa der Exekutive, der Legislative und der Judikative eines modernen Staatswesens. Jung, obgleich stark von Freud beeinflusst, untergliederte die menschliche Psyche etwas anders. Seiner Ansicht nach muss das Ich des Menschen seinen richtigen Platz in der Beziehung zum Schatten finden (der dunklen Seite der Persönlichkeit), zur Anima beziehungsweise dem Animus (dem gegengeschlechtlichen und daher oft unterdrückten Persönlichkeitsanteil des Menschen) und zum Selbst (der Einheit der Gesamtpersönlichkeit, die alle Anlagen und Potenziale eines Subjekts enthält). Alle diese unterschiedlichen Teilentitäten haben nach Freud und Jung eines gemeinsam: Sie existieren im Inneren des Menschen, ungeachtet seiner äußeren Umgebung. Doch der Mensch ist ein soziales Wesen – ganz und gar –, und außerhalb von uns, draußen in der sozialen Welt, herrscht kein Mangel an Wissen und Wegweisung. Warum sollen wir uns allein auf unsere begrenzten Ressourcen stützen, um den Weg zu finden oder uns auf unbekanntem Terrain zu orientieren, wenn wir auch Schilder und Wegweiser nutzen können, die dort schon von anderen aufgestellt wurden? Freud und Jung konzentrierten sich zu stark auf die autonome Psyche und schenkten der Bedeutung der sozialen Gemeinschaft für die Erhaltung der psychischen Gesundheit des Menschen zu wenig Beachtung.
Aus diesen Gründen beurteile ich die persönliche Situation neuer Klienten, bevor ich mit ihnen zu arbeiten beginne, anhand einiger Dimensionen, die sich auf die soziale Welt beziehen. Wurden in ihrer schulischen Bildung ihre intellektuellen Fähigkeiten oder Bestrebungen berücksichtigt und zum Tragen gebracht? Nutzen sie ihre Freizeit auf umsichtige, sinnvolle und produktive Weise? Haben sie tragfähige und ausformulierte Zukunftspläne für sich entwickelt? Sind sie (und die Menschen, die ihnen nahestehen) frei von ernsten gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Problemen? Haben sie Freunde und ein Sozialleben? Haben sie eine stabile und befriedigende intime Partnerschaft? Enge und funktionierende familiäre oder verwandtschaftliche Beziehungen? Einen Beruf – oder zumindest einen Job –, auf den sie sich verlassen können, der ihnen ein finanzielles Auskommen ermöglicht und ihnen Zufriedenheit vermittelt und Chancen eröffnet? Lautet die Antwort auf drei oder mehr dieser Fragen Nein, gehe ich davon aus, dass mein neuer Klient nur unzureichend eingebunden ist in die zwischenmenschliche Welt und deshalb in der Gefahr schwebt, in eine psychologische Abwärtsspirale zu geraten. Menschen existieren durch andere Menschen und nicht allein als Einzelwesen. Ein Mensch muss nicht in optimaler Weise aufgestellt sein, sofern er durch sein Verhalten zumindest ein Minimum an Akzeptanz bei anderen findet. Vereinfacht ausgedrückt: Wir verlagern das Problem der geistigen Gesundheit nach außen. Dass Menschen geistig gesund bleiben, hängt nicht nur davon ab, dass ihre Psyche intakt ist, es hat auch damit zu tun, dass sie von den Menschen, die sie umgeben, stets daran erinnert werden, wie man denkt, handelt und spricht.
Wenn Sie anfangen, vom geraden und schmalen Weg abzuweichen – sich also unangemessen zu verhalten beginnen –, werden die anderen Menschen auf Ihre Fehler reagieren, bevor diese zu gravierend werden, und Sie höflich darauf aufmerksam machen, Sie auslachen oder Sie auch kritisieren und damit wieder in die Spur bringen. Sie werden die Stirn runzeln, lächeln (oder auch nicht) und Ihr Verhalten anpassen (oder auch nicht). Mit anderen Worten, wenn andere Menschen Sie um sich haben möchten, werden sie Sie ständig daran erinnern, sich nicht danebenzubenehmen, Sie aber zugleich auch immer wieder ermuntern, Ihr Bestes zu geben. Sie müssen die Zeichen und Hinweise beachten, wahrnehmen und entsprechend reagieren. Dann bleibt Ihre Motivation vielleicht erhalten, Sie bleiben Teil der Gemeinschaft und müssen nicht den langen Weg nach unten antreten. Schon allein deshalb sollten Sie Ihre Eingebundenheit in die Welt anderer Menschen wertschätzen – die Welt von Freunden, Angehörigen und Gegnern gleichermaßen –, trotz aller Ängste und Enttäuschungen, die soziale Interaktionen häufig mit sich bringen.
Doch wie entwickelten wir den breiten Konsens bezüglich des sozialen Verhaltens, das unsere psychologische Stabilität stützt? Das ist eine gewaltige Aufgabe – wenn nicht eine unlösbare – angesichts der Komplexität, mit der wir ständig konfrontiert sind. »Sollen wir dieses Ziel verfolgen oder jenes?«, »Wie wertvoll ist diese Arbeit im Vergleich zu jener?«, »Wer ist kompetenter oder kreativer oder durchsetzungsfähiger und sollte deshalb mit Autorität ausgestattet werden?«. Die Antworten auf solche Fragen werden meistens im Gefolge intensiver Aushandlungsprozesse – verbaler oder nonverbaler Art – formuliert, in denen individuelle Handlungen, Zusammenarbeit und Wettbewerb geregelt werden. Was wir als wertvoll oder beachtenswert einstufen, wird Teil des sozialen Kontrakts, Teil des Systems von Belohnungen und Bestrafungen, die zugemessen werden entsprechend Befolgung oder Nichtbefolgung, Teil dessen, was uns beständig erinnert: »Hier ist etwas, das wertgeschätzt wird. Betrachte dieses (nimm es wahr) und nicht irgendetwas anderes. Handele dementsprechend (auf dieses Ziel gerichtet) und nicht auf irgendeine andere Art.« Die Ausrichtung an solchen Hinweisen und Erinnerungen stellt zum großen Teil die geistige Gesundheit dar und wird uns ab der frühesten Phase unseres Lebens abverlangt. Ohne die Vermittlung der sozialen Welt wäre es uns nicht möglich, unsere Psyche zu ordnen, wir würden schlicht überwältigt werden von der Welt.
Vom Sinn des Zeigens
Ich habe das große Glück, eine Enkeltochter zu haben, Elizabeth Scarlett Peterson Korikova, geboren im August 2017. Ich habe sie aufmerksam beobachtet, als sie aufwuchs, und versuchte zu verstehen, was sie antreibt und was sie will. Mit eineinhalb Jahren zeigte sie allerlei hinreißende Verhaltensweisen – sie kicherte und lachte, wenn sie gekitzelt wurde, klatschte andere ab, stieß andere mit dem Kopf an und rieb mit ihnen die Nasen. Am bemerkenswertesten aber war meiner Meinung nach ihr Verhalten, wenn sie auf etwas zeigte.
Sie hatte ihren Zeigefinger entdeckt, mit dem sie alle Gegenstände in der Welt konkretisierte, die ihr interessant erschienen. Das gefiel ihr sehr, vor allem wenn es die Aufmerksamkeit der Erwachsenen erregte, wenn sie mit dem Finger auf etwas deutete. Das wies darauf hin, auf eine spezifische Weise, die durch nichts anderes zu ersetzen war, dass ihre Handlung und ihre Absicht eine Bedeutung hatten – was zumindest zum Teil als eine Verhaltensweise oder eine Einstellung zu verstehen ist, die darauf zielt, die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu lenken. Kein Wunder, dass ihr das großen Spaß machte. Wir alle konkurrieren um Aufmerksamkeit, in persönlicher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Keine andere Währung ist wertvoller für uns. Kinder, Erwachsene und Gesellschaften vertrocknen ohne sie. Andere dazu zu bewegen, sich mit dem zu beschäftigen, was man selbst wichtig oder interessant findet, bestätigt zum einen die Wichtigkeit dessen, womit man sich selbst befasst, und zum anderen, und das ist das Entscheidende, bestätigt es einem selbst, dass man der respektierte Mittelpunkt einer bewussten Erfahrung ist und einen Beitrag leistet zur gemeinschaftlichen Welt. Das Zeigen ist zudem ein wichtiger Vorläufer der Sprachentwicklung. Etwas zu benennen – das Wort zu verwenden, das es dafür gibt – ist von grundlegender Bedeutung, um darauf hinzuweisen, um es von anderen Dingen zu unterscheiden und es abzugrenzen für den individuellen oder sozialen Gebrauch.
Wenn meine Enkeltochter auf etwas zeigte, tat sie dies öffentlich und allgemein sichtbar. Wenn sie auf etwas deutete, konnte sie unmittelbar beobachten, wie die Menschen in ihrer Umgebung reagierten. Es ist ziemlich witzlos, auf etwas zu zeigen, das keinen anderen interessiert. Daher richtete sie ihren Zeigefinger auf etwas, das sie interessant fand, und blickte dann umher, um zu sehen, ob auch andere sich dieser Sache zuwandten. So lernte sie schon früh eine wichtige Lektion: Wenn man nicht kommuniziert über Dinge, die andere Menschen beschäftigen, dann besteht das Risiko, dass der Wert der eigenen Kommunikation – sogar der Wert des eigenen Daseins – sich gegen Null entwickeln kann. Auf diese Weise begann meine Enkeltochter die komplexe Wertehierarchie zu erkunden, die ihre Familie und ihr größeres gesellschaftliches Umfeld bestimmte.
Scarlett lernt nun das Sprechen – eine weiterentwickelte Form des Zeigens (und des Erforschens). Jedes Wort ist ein Fingerzeig, aber auch eine Vereinfachung oder Verallgemeinerung. Etwas zu benennen bedeutet nicht nur, dass man es abhebt von einem unbegrenzten Hintergrund potenziell benennbarer Dinge, sondern zugleich, dass man es einer Gruppe zuordnet oder kategorisiert, anhand vieler weiterer Phänomene seiner allgemeinen Verwendbarkeit oder Bedeutung. Wir gebrauchen zum Beispiel das Wort »Boden«, fügen aber keine spezifischen ergänzenden Bezeichnungen für die verschiedenen Arten von Böden hinzu, mit denen wir es zu tun haben (Böden aus Beton, Holz, Lehm oder Glas), geschweige für die zahllosen Variationen der Farbe, der Textur und der Schattierung, welche die Böden im Einzelnen ausmachen, die unser Gewicht tragen. Wir bedienen uns gewissermaßen einer Darstellung in niedriger Auflösung: Wenn uns der Boden trägt und wir darauf gehen können und er sich in einem Gebäude befindet, dann ist das einfach ein »Boden«, und das ist ausreichend präzise. Das Wort unterscheidet Böden zum Beispiel von Wänden, reduziert aber zugleich die Unterschiedlichkeit der konkreten Böden, die es gibt, auf ein einziges Konzept – ebene, stabile und begehbare Oberflächen im Inneren von Gebäuden.
Die Wörter, die wir verwenden, sind Werkzeuge, die unsere Erfahrung subjektiv und für uns persönlich strukturieren – aber zugleich auch sozial determiniert sind. Wir würden das Wort »Boden« nicht kennen und benutzen, wenn wir uns nicht alle darauf verständigt hätten, dass Böden etwas hinreichend Wichtiges sind, dass ein eigenes Wort dafür gerechtfertigt ist. Daher ist die Tatsache, dass man etwas benennt (und sich davor natürlich auf die Bezeichnung einigt), ein wichtiger Teil des Prozesses, durch den eine unendlich komplexe Welt von Erscheinungen und Fakten auf eine funktionale Welt von Werten reduziert wird. Es ist die beständige Interaktion mit sozialen Institutionen, die diese Reduzierung – diese Spezifizierung – ermöglicht.
Worauf sollen wir zeigen?
Die soziale Welt verengt und spezifiziert die Welt für uns und markiert das Wichtige. Aber was bedeutet »wichtig«? Das Individuum wird durch die soziale Welt geformt. Doch auch soziale Institutionen werden geformt durch die Bedürfnisse der Individuen, die sie schaffen. Es müssen Vereinbarungen getroffen werden, um die grundlegenden Bedürfnisse des Lebens zu bewältigen. Wir können nicht ohne Nahrung, Wasser, saubere Luft und Obdach leben. Weniger selbstverständlich ist es, dass wir Gemeinschaft, Spiel, Berührung und Intimität brauchen. Dies alles sind biologische und psychologische Notwendigkeiten (und diese Liste ist noch bei weitem nicht vollständig). Wir müssen die Elemente der Welt kennzeichnen und uns nutzbar machen, mittels derer wir diese Bedürfnisse befriedigen können. Aufgrund der Tatsache, dass wir zutiefst soziale Wesen sind, wird die Situation durch weitere Einschränkungen kompliziert: Wir müssen die Welt auf eine Weise wahrnehmen und entsprechend handeln, die es uns ermöglicht, unsere biologischen und psychologischen Bedürfnisse zu decken – aber da keiner von uns in völliger Abgeschiedenheit lebt oder leben kann, müssen wir dies auf eine Weise tun, die von den anderen anerkannt wird. Das heißt, dass die Lösungen, die wir für unsere grundlegenden biologischen Probleme finden, auch sozial akzeptabel und umsetzbar sein müssen.
Es lohnt sich, sich noch etwas eingehender damit zu beschäftigen, wie die Notwendigkeit das Universum der möglichen Lösungsansätze und Umsetzungspläne begrenzt. Zum einen muss der Plan, wie bereits angedeutet, im Prinzip ein tatsächlich vorhandenes Problem lösen. Zum Zweiten muss er auch anderen Menschen attraktiv erscheinen – häufig im Widerstreit mit anderen Plänen –, denn sonst würden die anderen nicht mitziehen oder sogar dagegen ankämpfen. Wenn ich etwas wertschätze, muss ich daher überlegen, wie ich diese Wertschätzung umsetze, damit auch andere davon profitieren können. Es reicht nicht, wenn es nur für mich gut ist: Es muss gut für mich sein und für die Menschen in meinem Umfeld. Aber selbst das ist oft nicht ausreichend – das heißt, es gibt noch weitere Zwänge bezüglich der Art, wie man die Welt wahrnehmen und entsprechend handeln soll. Die Art, wie ich die Welt sehe und wertschätze – was eng mit den Plänen verbunden ist, die ich entwickle –, muss für mich, meine Familie und die größere Gemeinschaft praktikabel sein. Zudem muss diese Art des Herangehens konkret heute umsetzbar sein und darf nicht zu einem wirren Durcheinander von morgen, nächster Woche, nächstem Monat und dem nächsten Jahr (oder vielleicht gar dem nächsten Jahrzehnt oder nächsten Jahrhundert) ausarten. Eine gute Lösung für ein Problem, das mit Leiden oder Schmerzen verbunden ist, muss wiederholbar sein – oder, anders gesagt, iterierbar –, ohne sich durch die Wiederholungen durch andere Menschen und zu anderen Zeiten zu verschlechtern.
Diese universellen Zwänge, die biologischer Art sind und von der Gesellschaft auferlegt werden, reduzieren die Komplexität der Welt gewissermaßen auf einen Bereich universell verständlicher Werte. Das ist von eminenter Bedeutung, denn es gibt unbegrenzte Probleme und theoretisch unbegrenzte potenzielle Lösungen, aber nur eine relativ begrenzte Zahl von Lösungen, die gleichermaßen praktisch, psychologisch und sozial umsetzbar sind. Dass die Lösungen begrenzt sind, verweist darauf, dass es so etwas wie eine natürliche Ethik gibt – ähnlich variabel vielleicht wie die menschlichen Sprachen, aber dennoch mit einer soliden und universell erkennbaren Grundlage. Aufgrund dieser natürlichen Ethik ist die gedankenlose Herabwürdigung sozialer Institutionen falsch und gefährlich zugleich: falsch und gefährlich, weil sich diese Institutionen entwickelt haben, um Lösungen zu finden für Probleme, die gelöst werden müssen, damit das Leben weitergeht. Sie sind keineswegs vollkommen – doch sie zu verbessern und nicht zu verschlechtern ist ein schwieriges Unterfangen.
Ich nehme also die Komplexität der Welt und reduziere sie auf einen einzigen Punkt, damit ich handeln kann, wobei ich stets auch die anderen Menschen und deren künftiges Leben in die Betrachtung miteinbeziehe. Wie bewerkstellige ich das? Indem ich kommuniziere und verhandle. Indem ich das hochkomplexe kognitive Problem an die Ressourcen der größeren, umfassenderen Welt auslagere. Die Individuen, die eine Gesellschaft bilden, kooperieren und konkurrieren linguistisch (wenn auch linguistische Interaktion keineswegs die Mittel der Kooperation und der Konkurrenz ersetzen kann). Worte werden gemeinschaftlich formuliert, und alle müssen sich über deren Verwendung verständigen. Der verbale Rahmen, der uns dabei hilft, die Welt abzugrenzen, ist ein Ergebnis der Wertelandschaft, die von der Gesellschaft geschaffen wird, wird aber auch begrenzt durch die erbarmungslose Realität. Dies hilft, der Landschaft eine Gestalt zu geben, und zwar nicht irgendeine altbekannte Gestalt. Hier kommen nun Hierarchien – funktionale, produktive Hierarchien – ins Spiel.
Grundlegende Lebensbedürfnisse müssen befriedigt werden, sonst verhungern die Menschen oder verdursten oder sterben durch Unterkühlung – oder an Vereinsamung oder dem Fehlen von Berührung. Was getan werden muss, das muss spezifiziert und geplant werden. Die dafür erforderlichen Fähigkeiten müssen entwickelt werden. Diese Spezifizierung, Planung und Entwicklung von Fähigkeiten wie auch die Umsetzung des ausgearbeiteten Plans müssen im sozialen Rahmen erfolgen, mit der Mitwirkung anderer (und unter Berücksichtigung von deren Konkurrenz). Einigen wird es besser gelingen, die anstehenden Probleme zu lösen, anderen weniger gut. Diese Varianz der Fähigkeiten (wie auch die Vielfalt der vorhandenen Probleme und die Unmöglichkeit, jeden in sämtlichen Fähigkeiten auszubilden) bringt eine hierarchische Struktur hervor – die idealerweise auf echter Kompetenz in Bezug auf das Ziel beruht. Eine solche Hierarchie ist im Kern ein gesellschaftlich strukturiertes Instrument, das eingesetzt werden muss zur effektiven Erledigung der notwendigen und wichtigen Aufgaben. Zugleich aber ist sie auch eine soziale Institution, die Fortschritt und Frieden ermöglicht.
Von unten nach oben
Der Konsens, aus dem unsere expliziten und unausgesprochenen Annahmen über Werte hervorgehen, die unsere Gesellschaft prägen, ist historischen Ursprungs und bildete sich im Laufe von Jahrmillionen heraus. Die Frage »Wie soll ich handeln?« ist nur die kurzfristige, auf die unmittelbare Situation bezogene Variante der grundsätzlichen Frage »Wie soll ich überleben?«. Es ist daher aufschlussreich, den Blick in die ferne Vergangenheit zu richten – weit nach hinten in der Kette der Evolution, zurück zum Ursprung – und sich damit zu befassen, wie sich die Vorstellung vom Wichtigen entwickelte. Die meisten der phylogenetisch ältesten vielzelligen Organismen (bis hierher zurückzugehen reicht für unsere Zwecke) bestehen aus relativ undifferenzierten sensomotorischen Zellen.1 Diese Zellen bilden bestimmte Tatsachen oder Merkmale der Umgebung direkt in ihren molekularen Motoren ab, und zwar in einer Eins-zu-eins-Beziehung. Stimulus A führt zu Antwort A und zu nichts anderem, Stimulus B führt zu Antwort B. In differenzierteren und komplexeren Organismen – den größeren und bekannteren Bewohnern der natürlichen Welt – sind die sensorischen und motorischen Funktionen getrennt und spezialisiert; es gibt Zellen, welche die Muster der Welt erfassen, während andere Zellen die Muster der motorischen Leistung erzeugen. Diese Differenzierung ermöglicht es, ein breiteres Spektrum von Mustern zu erkennen und abzubilden, und auch die Bandbreite der Aktionen und Reaktionen wird dadurch erweitert. Manchmal entwickelt sich noch ein dritter Zelltyp – Nervenzellen –, der als Vermittlungsinstanz zwischen den beiden Ersteren fungiert. Bei Spezies, die eine neurale operative Ebene ausgebildet haben, kann »derselbe« Input zu unterschiedlichem Output führen (was zum Beispiel von Veränderungen der Umweltbedingungen abhängig ist, unter denen die Tiere leben, oder auch von internen psychophysikalischen Bedingungen).
Wenn Nervensysteme differenzierter und vielschichtiger werden und sich immer mehr neurale Vermittlungsebenen herausbilden, wird auch die Beziehung zwischen Fakten und motorischer Leistung zunehmend komplexer, unvorhersehbarer und vielschichtiger. Vermeintlich identische Dinge oder Situationen können auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden, und auch wenn zwei Dinge auf dieselbe Weise wahrgenommen werden, können daraus unterschiedliche Verhaltensweisen folgen. Es ist sehr schwierig, selbst isolierte Labortiere so sehr einzuengen, dass sie unter Versuchsbedingungen, die so identisch wie möglich gehalten werden, ein erwartungsgemäßes Verhalten zeigen. Wenn sich das neurale Gewebe, das zwischen Wahrnehmung und Handlung vermittelt, vervielfacht, differenziert es sich auch. Es entstehen grundlegende motivationale Systeme, auch als Antriebe bezeichnet (Hunger, Durst, Aggression etc.), die zu einer weitergehenden sensorischen und verhaltensbezogenen Spezifizierung und Variabilität führen. Die weiterführenden Motivationen – die nicht klar abgegrenzt sind – sind Gefühlssysteme. Kognitive Systeme entwickeln sich erst wesentlich später und treten zuerst in Form von Fantasien auf und später – aber nur bei Menschen – als voll entwickelte Sprache. In den komplexesten Lebewesen (insbesondere beim Menschen) entwickelt sich eine hierarchische Struktur, von Reflexen über Antriebe bis zur sprachvermittelten Handlung, die erst organisiert werden muss, bevor sie als Einheit fungieren und auf ein Ziel ausgerichtet werden kann.2
Wie hat sich diese Hierarchie – eine Struktur, die größtenteils von unten herauf gewachsen ist – im Laufe der langen Zeiträume der Evolution herausgebildet? Hier kommen wir auf dieselbe Antwort wie beim Thema Zusammenarbeit und Wettbewerb – das ständige Ringen um Ressourcen und Rang –, das den Kampf um Überleben und Reproduktion bestimmt. Dies vollzieht sich in den unermesslich langen Zeitspannen der Evolutionsentwicklung, aber auch in der viel kürzeren Lebenszeit der Einzelwesen. Durch das Aushandeln der Stellung werden die Organismen in allgegenwärtige Hierarchien eingeordnet, die den Zugang zu vitalen Ressourcen wie Obdach, Nahrung und Gefährten bestimmen. Alle Lebewesen mit hinreichender Komplexität und zumindest minimal ausgebildeten sozialen Strukturen haben ihren speziellen Platz und wissen das auch. Alle sozialen Lebewesen lernen, was andere Gruppenmitglieder für wertvoll halten, und leiten daraus, wie auch aus der Einsicht in ihre eigene Position, ein differenziertes implizites und explizites Verständnis von Wert an sich ab. Kurz gesagt: Die interne Hierarchie, die Fakten in Handlungen umsetzt, spiegelt die externe Hierarchie sozialer Organisationen wider. So verstehen zum Beispiel die Mitglieder einer Gruppe von Schimpansen ihre eigene soziale Welt und deren hierarchische Schichtung auf einem sehr hohen Detaillierungsgrad. Sie wissen, was wichtig ist und wer privilegierten Zugang dazu hat. Sie spüren, dass von diesen Dingen ihr Überleben und ihre Reproduktion abhängen, was auch tatsächlich der Fall ist.3
Ein Neugeborenes ist bereits mit allen grundlegenden Reflexen ausgestattet: Es kann saugen, schreien und erschrecken. Diese bilden die Basis für die Entwicklung einer Fülle von praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sich im Laufe des Reifungsprozesses herausbilden. Im Alter von zwei Jahren (in Bezug auf manche Fertigkeiten auch schon viel früher) können sich Kinder mit all ihren Sinnen orientieren, aufrecht gehen, ihre mit opponierbaren Daumen ausgestatteten Hände zu unterschiedlichsten Zwecken einsetzen und ihre Bedürfnisse und Wünsche gleichermaßen nonverbal und verbal kommunizieren – und diese Liste ist keineswegs vollständig. Diese enorme Bandbreite an Verhaltensmöglichkeiten ist eingebunden in ein komplexes Gemenge aus Emotionen und motivationalen Antrieben (Wut, Traurigkeit, Angst, Freude, Verwunderung und mehr) und dann dahingehend organisiert, dass sie die spezifischen, begrenzten Wünsche des Kindes sowohl für den Moment als auch über längere Zeiträume erfüllen kann.
Das heranwachsende Kind muss auch die Abläufe vervollkommnen, die es ihm ermöglichen, seine aktuell vorherrschende Motivationslage mit seinen anderen inneren Motivationslagen abzustimmen (so müssen zum Beispiel die voneinander getrennten Bedürfnisse Essen, Schlafen und Spielen nebeneinander zu existieren lernen, damit sich alle von ihnen auf optimale Weise entfalten können) und mit den Anforderungen, Routineabläufen und Chancen des sozialen Umfelds umzugehen. Diese Verfeinerung und Vervollkommnung beginnt in der Beziehung des Kindes zur Mutter und im spontanen Spielverhalten innerhalb dieses eingegrenzten, aber gleichwohl sozialen Kontexts. Wenn der Reifungsprozess des Kindes dann fortschreitet in ein Stadium, in dem die innere Hierarchie der emotionalen und motivationalen Funktionen, wenn auch vielleicht nur zeitweilig, in einen Rahmen eingebettet werden kann, der durch ein bewusstes, kommunizierbares abstraktes Ziel gebildet wird (»Spielen wir drinnen im Haus«), ist das Kind so weit, mit anderen Kindern zu spielen – und dies im Laufe der Zeit auf eine zunehmend komplexere und differenziertere Weise zu tun.4
Mit anderen zu spielen hat zur Voraussetzung (wie der berühmte Entwicklungspsychologe Jean Piaget dargestellt hat5), dass sich die Spielpartner gemeinschaftlich auf ein von allen geteiltes Ziel verständigen. Diese kollektive Verständigung auf ein gemeinschaftliches Ziel – den Zweck des Spiels – in Verbindung mit Regeln, die das Zusammenwirken und den Wettbewerb im Hinblick auf dieses Ziel bestimmen, konstituiert einen vollwertigen sozialen Mikrokosmos. Alle Gesellschaften kann man als Variationen dieses Spiel-Themas betrachten – E pluribus unum[6] – und in allen funktionsfähigen und geordneten Gesellschaften kommen die Grundregeln des Fair Play im Zuge ihrer Wechselbezüglichkeit über alle situativen und zeitlichen Zusammenhänge hinweg unausweichlich zum Tragen. Wie Problemlösungen müssen auch Spiele wiederholbar sein, wenn sie Bestand haben sollen, und es gibt bestimmte Prinzipien, die sich auf die Voraussetzungen dieser Wiederholbarkeit beziehen und sie untermauern. Piaget nahm zum Beispiel an, dass Spiele, die auf Freiwilligkeit beruhen, jenen überlegen sind, die unter Gewaltandrohung betrieben werden, weil von der Energie, die auf das Spiel verwendet werden könnte, ein Teil für die Durchsetzung des Zwangs vergeudet werden muss. Es gibt Hinweise, dass auch unsere nichtmenschlichen Verwandten solche auf Freiwilligkeit beruhende spielähnliche Vereinbarungen hervorgebracht haben.6
Zu den allgemeinen Regeln des Fair Play gehört auch die Fähigkeit, die Emotionen und die Motivationen zu regulieren, während man gemeinschaftlich und konkurrierend das Ziel des Spiels verfolgt (das ist eine Grundvoraussetzung für das Spielen überhaupt), wie auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, wechselseitig nutzbringende Interaktionen im zeitlichen Ablauf und in den unterschiedlichen Situationen zu ermöglichen, wie wir bereits dargestellt haben. Und das Leben ist nicht nur einfach ein Spiel, sondern eine Abfolge von Spielen, die alle etwas miteinander gemeinsam haben (wodurch auch immer ein Spiel definiert werden mag), aber auch jeweils einzigartig sind (sonst gäbe es keinen Grund für unterschiedliche Arten von Spielen). Es gibt immer zumindest einen Anfang (den Kindergarten, einen Spielstand von 0:0, eine erste Verabredung, einen Einstieg in den Beruf), von dem aus man auf Verbesserungen hinarbeiten muss; eine Verfahrensweise, mittels derer diese Verbesserungen erzielt werden sollen, und ein angestrebtes Ziel (Abschluss einer weiterführenden Schule, ein Siegtreffer, eine dauerhafte Liebesbeziehung, eine prestigeträchtige Berufskarriere). Wegen dieser Gemeinsamkeit gibt es auch eine Ethik – besser gesagt, eine Meta-Ethik –, die sich in allen Arten von Spielen von unten herauf entwickelt. Der beste Spieler ist daher nicht derjenige, der ein Spiel gewinnt, sondern derjenige, der von der größtmöglichen Zahl anderer Spieler immer wieder dazu eingeladen wird, weitere Spiele zu bestreiten. Aus diesem Grund, der Ihnen vielleicht nicht unmittelbar einsichtig erscheint, sagen Sie zu Ihren Kindern: »Es geht nicht darum, ob du gewinnst oder verlierst. Es geht darum, wie du das Spiel spielst.«[7] Wie sollen Sie spielen, um der am meisten geschätzte Mitspieler zu werden? Welche Struktur muss sich in Ihnen selbst herausbilden, damit Sie in der Lage sind, entsprechend zu spielen? Diese beiden Fragen sind miteinander verbunden, denn die Struktur, die es Ihnen ermöglicht, das Spiel in entsprechender Weise zu spielen (und zwar mit immer größerer, gewissermaßen automatisierter oder gewohnheitsmäßiger Präzision), wird sich erst herausbilden, wenn Sie die Kunst des angemessenen Spielens kontinuierlich praktizieren und einüben. Wo können Sie das Spielen lernen? Überall … wenn Sie Glück haben und einen wachen Geist.
Die Nützlichkeit des Narren
Es ist hilfreich, wenn man einen Platz im unteren Teil einer Hierarchie einnimmt. Dies kann der Entwicklung von Dankbarkeit und Demut zuträglich sein. Dankbarkeit. Es gibt Menschen, die über mehr Sachkenntnis und Wissen verfügen als man selbst, und darüber sollte man froh sein. Es gibt viele interessante Nischen, die man besetzen kann in Anbetracht der zahlreichen komplexen und ernstzunehmenden Probleme, die es zu lösen gilt. Dass es Menschen gibt, die diese Nischen mit fachkundigem Wissen und Erfahrung ausfüllen, ist etwas, für das man wirklich dankbar sein sollte. Demut. Es ist besser, davon auszugehen, dass die eigenen Kenntnisse ungenügend sind und man noch viel lernen muss, anstatt zu meinen, man würde bereits über ausreichend Wissen verfügen, wodurch man sich dem Risiko ausliefern würde, blind durch die Welt zu gehen. Es ist viel besser, sich mit dem anzufreunden, was man nicht weiß, statt mit dem, was man weiß, denn Ersteres steht in Hülle und Fülle zur Verfügung, während Letzteres nur begrenzt vorhanden ist. Wenn man in eine Sackgasse geraten oder in die Ecke gedrängt worden ist – oftmals durch das halsstarrige Festhalten an irgendwelchen unbewusst gehegten und gepflegten Annahmen –, kann einem nur das helfen, was man noch nicht gelernt hat.