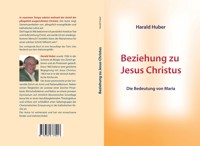
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In rasantem Tempo wächst weltweit der Anteil der pfingstlich ausgerichteten Christen. Der Autor zeigt Gemeinsamkeiten von pfingstlich-evangelikaler und katholischer Lehre auf. Die Frage ist: Wie bekomme ich persönlich Anteil an Tod und Auferstehung Christi, wie werde ich ein wiedergeborener Mensch? Inwiefern kann der Marianismus für einen solchen Schritt hilfreich sein? Das vorliegende Buch ist eine Neuauflage des Titels "Das Nardenöl aus dem Alabastergefäß".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Harald Huber
Beziehung zu Jesus Christus
Die Bedeutung von Maria
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright-Hinweis:Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
© Copyright Harald Huber Alle Rechte vorbehalten Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 HamburgISBN 978-3-384-37822-4 (e-Book-Ausgabe) ISBN 978-3-384-37821-7 (Paperback-Ausgabe)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel: Maria im Vexierbild
2. Kapitel: Das Nardenöl aus dem Alabastergefäß
3. Kapitel: Totensalbung und Auferstehung
4. Kapitel: Das Geheimnis der Nacktheit Christi
5. Kapitel: Balthasar Staehelin – Das marianische Unbewusste
6. Kapitel: Maria und Penelope
7. Kapitel: Exkurs für evangelische Leser über gewisse Katholica
8. Kapitel: Maria im Dornenwald – Unbefleckt empfangen mit der Sünde hautnah an sich
9. Kapitel: Die Sonne und der Mond
10. Kapitel: Der marianische Rosenkranz und das Einhorn
11. Kapitel: Franziskus von Assisi – der frühe Vorläufer unserer Zeit
12. Kapitel: Gottesanbetung und Verehrung von Menschen
13. Kapitel: Louis Maria Grignion von Montfort
14. Kapitel: Die Geschichte der alten Konzilien und die Theotokos
15. Kapitel: Die Herz-Jesu-Verehrung – Ihre erste Entwicklung
16. Kapitel: Paray-le-Monial und die Päpste
17. Kapitel: Faustyna Kowalska – Patronin der pfingstlichen Protestanten
18. Kapitel: Der Schrei des Bartimäus und die katholische Messe
19. Kapitel: Das Kerygma – die geistlichen Grundprinzipien
Wo nicht anders angegeben ist, werden die Bibelstellen der Einheitsübersetzung 1entnommen.
1 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart. (Für die Psalmen und das Neue Testament auch im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bibelgesellschaft.)
Vorwort
Man kann ein Buch schreiben, indem man sich überlegt, wie es wohl am meisten Leser findet und bei diesen am besten ankommt. Das vorliegende Buch ist nicht so entstanden. Zunächst hatte es sich langsam zusammengefügt, zum Teil aus früher gehaltenen Ansprachen und zum Teil aus Kapiteln, die sich zuvor geformt haben. Dabei war eigentlich immer die Vorgabe, dass es ein Buch werden sollte, das sowohl von Katholiken als auch von pfingstlich ausgerichteten Protestanten gelesen werden könnte. Das drängte sich auf, da ich als überzeugter Katholik nun schon längere Zeit zwar am Samstagabend in die katholische Messe gehe, am Sonntag aber in den Gottesdienst der nahegelegenen Pfingstgemeinde. Darüber habe ich mich in einem längeren Artikel in der Zeitschrift ›Charisma‹ ausführlich geäußert.2 Es ergab sich aber, dass beim Schreiben des Buches das Thema ›Maria‹ in den meisten Kapiteln immer mehr in den Vordergrund rückte; allerdings in einer Art und Weise, welche die von Katholiken der Jungfrau Maria gleichsam als geistlicher Mutter gezollte Ehre deutlich und entschieden absetzt von der Anbetung Gottes. Um dies hervorzuheben, habe ich deshalb die Fürwörter für die drei Personen von Gott dem Herrn immer groß geschrieben, auch in Zitaten aus Büchern, wo dies nicht so gehandhabt wird. Während man annehmen kann, dass bei einem Großteil der Protestanten Ausführungen über Maria automatisch mindestens zu ausweichenden Reaktionen führen, muss ich befürchten, dass meine marianischen Ausführungen auch bei vielen Katholiken auf Ablehnung stoßen. Den einen werden sie zu herabsetzend erscheinen und die andern können mit dem Marianismus nichts mehr anfangen. Ich möchte deshalb dieses Vorwort mit einem Text Heinrich Bullingers abschließen, der als Nachfolger Zwinglis immerhin schon zur zweiten Generation der Reformatoren gehört und sich mit einer ausgedehnten Korrespondenz praktisch mit allen führenden Persönlichkeiten der evangelischen Seite ins Einvernehmen zu setzen versuchte. Ich möchte diesen Text auch zur Ehre Marias, der Mutter des Herrn, anführen:
»Die himmlische Frau
Nach Pfingsten wird die Jungfrau Maria in der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt; es wird also nichts mehr berichtet über ihren weiteren Lebenslauf, nichts über ihr Alter oder über die Dauer ihres Lebens, wie und wo sie starb und begraben oder überführt wurde, was ich keineswegs als sonderbar betrachte. Denn was ist zu verwundern, wenn der Herr nicht wollte, dass der Tod und das Grab seiner geliebten und seligen Mutter in der Schrift erwähnt oder beschrieben werde? Es ist sicher außer Zweifel, dass sie selber jetzt im Himmel lebt mit ihrem Sohn, in dem sie das ewige Heil erlangt hat. Ich weiß wohl, was Nicephoros in seiner Geschichte über Tod und das Begräbnis der Jungfrau-Mutter erzählt. Es ist aber nicht verwunderlich, dass in den päpstlichen Dekreten der Bericht vom Heimgang der heiligen Maria verurteilt und unter die apokryphen Schriften gezählt wird. Daher mögen alle lernen, wie unfruchtbar und gefährlich es ist, neugierig zu forschen und darüber reden zu wollen, was uns in der Heiligen Schrift vorenthalten ist. Es möge uns genügen, schlicht und einfach zu glauben und zu bekennen, dass die Jungfrau Maria, die liebe Mutter unseres Herrn Jesus Christus, durch die Gnade und das Blut ihres eigenen Sohnes ganz geheiligt und durch die Gabe des Heiligen Geistes überreich beschenkt und allen Frauen vorgezogen, und endlich, wie von den Engeln selber, von allen Geschlechtern wahrhaft selig gepriesen, jetzt glücklich mit Christus im Himmel lebe und dass sie ewige Jungfrau genannt werde und auch sei und bleibe, nämlich Gottesgebärerin, deren Andenken unter den Gläubigen in der Kirche stetig und festlich, jedoch fromm und nicht abergläubisch sein soll.«
Heinrich Bullinger (1504-1575)3
2Charisma-Verlag, Gerhard Bially, Mendelssohnstraße 2A, D-40233 Düsseldorf, Nr. 123, Jan.-März 2003
3 Text des Nachfolgers von Ulrich Zwingli, dem Reformator in Zürich. Zitiert aus: Otto Karrer, Maria in Dichtung und Deutung, Zürich 1962, S. 221. Vgl. auch Reintraud Schimmelpfennig, Die Geschichte der Marienverehrung im deutschen Protestantismus, Paderborn 1952; Walter Tappolet, Das Marienlob der Reformatoren, Tübingen 1962
1. Kapitel: Maria im Vexierbild
Maria, die Mutter des Herrn, wird in der Bibel nur selten erwähnt und nur ganz wenige Worte sind von ihr überliefert. Biblisch orientierte Christen weisen u. a. immer wieder darauf hin, dass der Stellenwert von Maria in katholischer Lehre und Praxis dazu in keinem Verhältnis stehe. Es erweist sich aber, dass insbesondere die Worte und Taten des Herrn in den Evangelien in gewissem Sinne vielschichtigen Charakter haben. Die entsprechenden Texte gleichen einem Vexierbild. Das sind diese im 19. Jahrhundert beliebten Federzeichnungen, welche man mit zugekniffenen Augen und eventuell verdreht anschauen muss, um eine bestimmte Figur zu entdecken, die auf den ersten Blick nicht sichtbar war. Man sieht z. B. ein paar Rehe und Hasen im Wald und unten steht die Frage: »Wo ist der Jäger?« Wenn man das Bild dreht und dazu etwas blinzelt, erblickt man mit etwas Phantasie dann plötzlich den Jäger, dessen Umrisse durch ein paar Striche festgehalten werden, welche vorher als Strukturen von Ästen und Rehköpfen erschienen. So ist es auch mit den biblischen Texten und Bildern. Man kann immer die Frage stellen: »Wo ist Maria?«, selbst wenn sie gar nicht erwähnt wird. Und mit etwas Phantasie wird man sie dann relativ oft auch an entscheidender Stelle erkennen.
Natürlich wissen wir, dass man bei der Auslegung der Bibel nicht einfach raten darf oder gar eigene Gedanken hineinprojizieren. Es ist auf den Heiligen Geist zu hören, denn Gott selbst spricht durch die Menschen, welche die Bibel geschrieben haben, und in den Evangelien sind es auch Worte und Taten des Wortes Gottes, Jesus Christus, selbst, welche berichtet werden, so dass die Prägung durch die Menschen, welche das überliefert haben, bis zu einem Minimum verdünnt ist, und, wie wir glauben, Gott hat ihr Reden bis zur Unfehlbarkeit gefügt; und es ist deshalb der Geist Gottes, der die Sprache und die Taten Gottes in der Bibel versteht. Er erkennt unter dem Mantel der Heiligen Schrift Jesus Christus, das eigentliche Wort Gottes. Natürlich, immer wenn wir auf den Geist hören wollen, bedürfen wir einer Autorität, welche bei der Unterscheidung der Geister mitwirkt. Das Christentum ist also keine ›Buchreligion‹, wie das von den Moslems behauptet wird; dies gilt nicht einmal für das Judentum.4 Allerdings hat das – von wem auch immer verschuldete – Irrewerden an der kirchlichen Autorität und die Leugnung der Gaben des Geistes für gewisse Epochen ein Zurückfallen auf den – von Menschen verfassten – Wortlaut der Bibel unausweichlich gemacht und dabei ist auch ein Rationalismus in die Auslegung der Bibel eingezogen und von Menschen ausgesprochene Mitteilungen des Heiligen Geistes haben eine rein menschliche Interpretation erhalten.
Oft wird den Katholiken vorgeworfen, sie würden neben den drei Personen Gottes eine vierte Person, Maria, als Gott verehren – also eine ›Quaternität‹, welche übrigens der Psychologe C. G. Jung – Sohn eines protestantischen Pfarrers, aber sonst in einem krass spiritistischen Umfeld aufgewachsen5 – in seiner Lehre von den Archetypen zum Prinzip erhoben hat, wobei alle vier Personen aber doch eher Teil der Schöpfung bleiben. Demgegenüber hat mal einer gesagt, dasselbe gelte für einen gewissen Protestantismus: als Viertes werde die Heilige Schrift den drei Personen Gottes gleichgestellt. Obwohl wir glauben, dass in unserer Zeit viele Christgläubigen in hohem Maße den Beistand des Heiligen Geistes wiedererhalten haben, wollen wir uns aus verschiedenen Gründen nahe an den Wortlaut der Bibel halten, der aber immerhin öfters mal aus sich selbst eine mehrschichtige Auslegung zulässt oder gar nahelegt. Diese Auffassung scheint durch die Gleichnisse Christi, die der Herr Seinen Jüngern selbst auslegt, gestützt zu werden. Damit sind wir wieder beim Vexierbild.
Wir wollen die Art, wie Auslegung sein kann, am Beispiel des Textes im Markus-Evangelium betreffend die Heilung der ›blutflüssigen Frau‹6 zeigen. Maria kommt nicht vor. Aber, kommt sie wirklich nicht vor? Wenn wir die kranke Frau in den Blick nehmen, welche voller Gefühle der Unwürdigkeit ist – denn nach jüdischer Auffassung ist sie unrein und dürfte niemals Jesus oder sonst jemanden berühren – und welche nun voller Scham nur den äußersten Zipfel des Gewandes von Jesus berührt, so dass Er sie im Gedränge gar nicht sehen kann, erinnert sie uns dann nicht an jene frommen Katholiken, welche sich so unwürdig vorkommen, dass sie es nicht wagen, Auge und Stimme zu Jesus – oder gar zum Vater im Himmel – zu erheben, sondern sich nur an Maria wenden, wie wenn sie barmherziger wäre als der Herr selbst und wie wenn nur sie bei Ihm Zutritt hätte und nicht auch wir sündigen, aber durch den Glauben mit Gott versöhnten Menschen.
Damit haben wir das Geheimnis verraten: der Mantel Christi ist Maria. Sehen das alle? Vielleicht müssen wir das Bild noch etwas hin und her wenden, die Augen etwas zusammenkneifen, damit wir nicht beim Vordergründigen hängen bleiben, sondern die Phantasie des Heiligen Geistes walten lassen! Vielleicht sehen wir dann Jesus noch im Mutterleib, von der Mutter ›ummantelt‹. Und vielleicht sehen wir dann auch die normalerweise unsichtbaren Bande, die auch nach der Geburt von der Mutter ausgingen und Ihn umhüllten, wie das Mutterliebe immer tut. Und vielleicht sehen wir dann auch, wie Maria diese unsichtbare Hülle hat sichtbar werden lassen, indem sie liebevoll erst kleine und dann immer größere Kleider für ihren Sohn verfertigt hat, bis sie dann auch den Mantel gemacht hat, den Er damals im Gedränge trug, sowie auch das Untergewand, das die Soldaten unter dem Kreuz nicht zerteilten, weil es so kunstvoll aus einem Stück gewoben war. Eine alte Legende hält denn auch klar fest, dass Maria jenes Kleid gewoben habe. Und auch Franziskus von Assisi hat Maria als das ›Gewand‹ Christi gepriesen.7
So ergibt sich, dass die kranke Frau mit dem Mantel die Liebe Mariens, ja Maria selbst berührt und das Evangelium eine ganz klare Aussage darüber enthält, was Jesus von einer solchen Marienfrömmigkeit hält. Zunächst ist festzuhalten, dass die Frau gesund wird. Es ist aber nicht der Mantel oder Maria, woher die Heilung kommt. Der Herr stellt klar: »Es ist eine Kraft von mir ausgegangen.« Dann aber möchte Er selbst mit der geheilten Frau direkten Kontakt aufnehmen. Gegen den Widerstand Seiner Jünger und gegen den Willen der Frau spricht Er diese direkt an. Er selbst stellt die Beziehung her, die sie sich nicht getraut hat anzustreben. Die oben geschilderte marianische Frömmigkeit kann nur Vorstufe, geistliches Durchgangsstadium sein. Der Herr selbst will sich unser erbarmen und auch die Barmherzigkeit Mariens hat ihren Ursprung in der Barmherzigkeit Gottes. Zudem liegt die Macht der Vergebung und Heilung ursprünglich bei Gott. Vermittlung muss in Glaubensdingen immer zur Unmittelbarkeit führen.
Wir haben uns ein erstes Vexierbild angeschaut und wollen nun unseren Blick auf ein weiteres werfen.
4Vgl. Alan Schreck, Christ und Katholik, Münchenschwarzach 1991, S. 49-60
5 Vgl. die Belege in: Els Nannen, Carl Gustav Jung – der getriebene Visionär, Berneck 1991, S. 13ff
6Mk. 5, 24b-34
7Vgl. den »Gruß an die selige Jungfrau Maria« von Franz von Assisi, welcher die Anrufung enthält: »Sei gegrüßt du Sein Gewand« in: Die Schriften des heiligen Franziskus von Assisi, Hrsg. Lothar Hardick und Engelbert Grau, Werl/Wf. 1983, oder in: Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen Schweiz (der katholischen Kirche), Zug 1998, Nr. 779,7
2. Kapitel: Das Nardenöl aus dem Alabastergefäß
Im Markus-Evangelium8 ist folgende Begebenheit zu lesen: Eine Frau kommt mit einem Alabastergefäß voll kostbarstem Nardenöl, zerbricht das Gefäß und gießt das Öl über das Haupt des Herrn. Dies war zweifellos ein Liebeserweis. Das kostbare Öl und das kostbare Gefäß weisen jedoch auf etwas hin, was in ihrem Herzen vorgegangen ist. Solche Gefäße aus antikem Glas wurden damals oft für die Aufbewahrung kostbarer Spezereien und Öle verwendet. Sie waren dann oben zugeschweißt. Um sie zu öffnen, musste man die Spitze abbrechen. Dies ist der Grund, warum es heißt, die Frau habe das Gefäß zerbrochen. Das zugeschweißte Gefäß ist ein Zeichen für eine Jungfräulichkeit, welche geöffnet wird für den Herrn. Das Nardenöl, das sich im Gefäß befindet, ist ein Zeichen für das Verströmen der Liebe, welche den Herrn umgibt. In der Parallelstelle bei Johannes9 heißt es, dass das ganze Haus vom Duft des Öls erfüllt worden sei. Das ist eine Anspielung auf die Stelle im Hohelied: »Solange der König an der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft.«10
Kann es sein, dass das Herz eines sündigen Menschen in der Tiefe einen solchen Kern hat, der wie Maria jungfräulich geblieben ist, und bei allem, was Jesus tut und erleidet, in mütterlicher Weise mitgeht? Oder ist es so, dass Gottvater dann, wenn die Stunde gekommen ist, wo wir zum Glauben kommen sollen, das Herz des Menschen mit diesem Nardenöl beschenkt als ein Akt der vorauseilenden Gnade? Bedeutet es dies, wenn Jesus von jenen spricht, die der Vater im Himmel zu Ihm führt, Ihm schenkt?11Die Frage ist, woher hat die Frau das teure Nardenöl? Dazu gibt es wohl drei Antworten, die alle richtig sein können: Sie hat es geschenkt bekommen; sie hat alles verkauft, um dieses Öl zu kaufen; und sie hatte es schon immer in ihrem Acker – aber jetzt erst ausgegraben.12
Zurück zur Begebenheit damals in Bethanien: Der Herr hat drei Worte für diese Handlung der Frau, welche die Bedeutung erhellen.
Erstens sagt er: »Sie hat im voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt.« Die Frau hat eine Beziehung zu Christus hergestellt, der dann für sie am Kreuz gestorben ist. Diese Salbe ist wieder etwas wie der Mantel Christi. Das Alabastergefäß und die Salbe stehen für das Marianische in jedem Gläubigen. Gemeint ist dabei Maria, welche als Mutter des Herrn wie niemand sonst mit Seinem Sterben – und Auferstehen – mitgeht. Es fällt auf, dass sich beim Tod Jesu gleich mehrere Frauen versammeln, die Salbe gebracht haben, Totensalbe. Damit soll ausgedrückt werden, dass es in der menschlichen Seele etwas gibt, das sich mit Jesus so intim verbindet wie eine Salbe und das deshalb mit Ihm stirbt und die ganze Seele nachzieht. Neben Maria, der Mutter des Herrn, sind es Mütter von Aposteln: Salomé, die Mutter der Zebedäussöhne Jakobus und Johannes, Maria, die ›Schwester‹ der Mutter des Herrn und Mutter von Jakobus dem Jüngeren und Joses (Söhne des Alphäus/Kleophas), und Maria von Magdala, die den Aposteln die gute Nachricht von der Auferstehung des Herrn überbringen wird und deshalb den Ehrentitel ›apostola apostolorum‹ erhalten hat.13
Der Herr sagt weiterhin: »Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.« Dies sind wiederum Federstriche, welche zu Maria gehören. Wir hören den Jubel »Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter«14 und wir erinnern uns an jene Frau, die gerufen hat: »Selig ist der Leib der Dich getragen und selig die Brüste, die Dich gestillt haben!«15 Die Antwort des Herrn dazu ist nicht Gegensatz, sondern Ergänzung: »Selig, die das Wort Gottes hören und bewahren.« Und wer hat wie Maria das Wort Gottes empfangen und in sich, durch ihre mütterliche Liebe, ›bewahrt‹? Dadurch, dass wir den Herrn – das Wort Gottes – in unser Herz aufnehmen, dadurch, dass wir den Herrn als Sterbenden mit unserer Liebe umfangen, haben wir alle Maria in uns. Wir fragen uns, inwiefern dieses Wort, dass immer dann, wenn das Evangelium verkündet wird, auch von der Frau in Bethanien die Rede ist, in Erfüllung gegangen sei. Von der Salbung des Herrn ist doch nicht oft die Rede. Aber echte Verkündigung bleibt nicht dabei stehen, einfach festzuhalten, dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben und auferstanden sei. Damit dies für uns wahr wird, müssen wir »Jesus in unser Herz aufnehmen«. Wir müssen Ihn salben mit unserer Herzsalbe wie jede Mutter ihren Sohn unter dem Herzen getragen und damit gesalbt hat, damit wir mit Ihm sterben und auferstehen und so Seine Erlösungstat an uns wirksam wird. Dies ist das ›Geheimnis des Glaubens‹, das Ursakrament der Gläubigen.
Es soll aber keiner sagen können, mein Herz ist nicht rein genug, ich besitze nicht dieses Alabastergefäß mit Nardenöl, ich kann Jesus nicht salben. Der Vater im Himmel schenkt das jedem. Auch die Frau, welche Jesus seinerzeit gesalbt hatte, war eine Sünderin. In der Parallelstelle bei Lukas16 steht ausdrücklich, dass es eine »Sünderin« war, »die in der Stadt lebte«.
Es fällt auf, dass hier Jesus wieder von jemandem berührt wird, der unrein ist. Diese Frau salbt den Herrn nicht bloß mit kostbarem Öl, sondern auch mit ihren Tränen. Darin kommt ihre Reue zum Ausdruck. Sie trocknet die Füße des Herrn sodann mit ihrem Haar und küsst sie. Die katholische Kirche lehrt, dass derjenige, der entschieden ist, sich taufen zu lassen, schon vor der Taufe die Rechtfertigungsgnade erhält17 und dass derjenige, welcher aus vollkommener Gottesliebe bereut, auch bei schwerer Sünde schon vor der Lossprechung die Rechtfertigungsgnade erneut erhält; der Herr sagt denn auch zum Pharisäer Simon: »... ihr werden ihre vielen Sünden nachgelassen, weil sie eine große Liebe hat.«18 Dass ihre Liebe aber daraus hervorging, dass Er ihr bereits vergeben hatte, hat Er mit dem Gleichnis vom Gläubiger angedeutet, der dem einen viel und dem andern wenig nachlässt, wonach der eine ihn mehr und der andere weniger liebt. Die Tränen sind offensichtlich so gut wie das Nardenöl.19 Sie selbst ist unmittelbar mit dem Herrn in Verbindung getreten und hat damit an Seinem Tod und Seiner Auferstehung Anteil erhalten. Der Herr bestätigt den Vorgang und sagt zur Sünderin: »Deine Sünden sind dir vergeben« und »dein Glaube hat dir geholfen, gehe in Frieden«.
Gegenüber dem Pharisäer hält Jesus indessen ausdrücklich fest, dass dieser Ihm kein Wasser für die Füße gereicht, ihn zur Begrüßung nicht geküsst hat und seine Haare nicht – wie damals üblich – gesalbt hat. Der Pharisäer ist der Gläubige, dessen Glaube nur im Kopf ist, der zum Herrn auf Distanz bleibt, für den die Frau mit dem Nardenöl eben nicht zum Evangelium gehört. Für den Pharisäer ist der Zeitpunkt des echten Glaubens noch nicht gekommen. Hat er sich dagegen schuldhaft gesperrt, obwohl der Herr bei ihm eingekehrt ist, oder wird er erst später berufen? Wir können uns vorstellen, dass er später aussätzig und damit nach dem mosaischen Gesetz ›unrein‹ wurde, damit offenbar werde, dass seine ganze Gerechtigkeit nicht ausreiche, sondern dass er den Herrn hätte für Seinen Tod salben sollen! Bei Markus und Matthäus20 findet die Szene im Hause ›Simons des Aussätzigen‹ statt. Als sie schrieben, mag der seinerzeitige Hausherr bereits aussätzig geworden sein und jeder wusste das.
8Mk. 14, 3-9; Parallelstellen in: Mt. 26, 6-13; Lk. 7, 36-50; Joh. 12, 1-8
9 Joh. 12,3
10Hld. 1,12
11 Joh. 6,44
12Mt. 13, 44-46
13 Mt. 27, 55; Mk. 15, 40; Joh. 19, 25
14 Lk. 1, 48
15Lk. 11,27
16Lk. 7,37
17Dies wird durch die Anerkennung der Bluttaufe und der Begierdetaufe belegt. Vgl. Ott Ludwig, Grundriss der Katholischen Dogmatik, 5. Aufl. Freiburg 1961, S. 427
18Ott Ludwig, a.a.O., S.509f (§10)
19 Ich lege Wert auf die Bemerkung, dass nicht nur das Alabastergefäß und das Nardenöl, d. h. Maria, die Verbindung zwischen der sündigen Seele und Jesus Christus schafft, sondern die Seele tritt auch neben Maria und erhält – wie sie – eine unmittelbare Intimität mit dem Herrn.
20 Mk. 14, 3 u. Mt. 26, 6/7
3. Kapitel: Totensalbung und Auferstehung
Es gibt in den Evangelien eine Frauenfigur, welche der Frau, die den Herrn gesalbt hat, ihrem Wesen entsprechend sehr nahe steht. Es ist dies Maria von Bethanien, die Schwester von Martha und von Lazarus, den der Herr auferweckt hat. Von diesem Lazarus berichtet merkwürdigerweise nur der Evangelist Johannes.21 Die beiden Schwestern Maria und Martha werden indessen auch bei Lukas erwähnt22. Dabei wird die charakterliche Verwandtschaft von Maria von Bethanien mit der Frau mit der Salbe offenbar. Maria sitzt zu Füßen des Herrn, um Ihm zuzuhören, oder wohl besser, um einfach bei Ihm zu sein und Ihn in ihr Herz aufzunehmen im Gegensatz zu ihrer Schwester, die sich geschäftig bemüht, den Gästen im Haus zu dienen. So wie die Frau mit der Salbe gescholten wird, sie habe diese verschwendet,23 so wird Maria gescholten, sie helfe nicht bei der Arbeit. Aber auch Maria wird wie die Frau mit der Salbe vom Herrn in Schutz genommen und gelobt: »Sie hat das Bessere erwählt.«
Johannes berichtet, wie bereits erwähnt, als einziger Evangelist von der Auferweckung des Lazarus, des Bruders von Maria und Martha. Irgendwie gehören die drei Geschwister in einem theologischen Sinn zusammen. Martha ist diejenige, welche – eigentlich für Lazarus – das Glaubensbekenntnis spricht: »Alles, worum Du Gott bittest, wird Gott Dir geben.« – »Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag.« – »Ja, Herr, ich glaube, dass Du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Martha ist ein Beispiel für den intellektuellen Glauben, der auf dem Denken und Willen beruht, wir können vielleicht sagen, für einen männlichen Glauben. Dieser bedarf einer Ergänzung. Nicht umsonst heißt es danach: »Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu Ihm. Und sie und die mit ihr gingen, weinten bis Jesus auch weinte.« Neben dem männlichen, intellektuellen Glauben Marthas bedarf es des weiblichen Glaubens des Herzens, für den Maria steht. Martha weiß das. Beides ist nötig für die Auferweckung des Lazarus und für unser aller Auferweckung im Herrn. Vielleicht kann man sagen, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, hat in diesem Sinne sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Seelenteil. Freilich haben die beiden Teile je nach Geschlecht eine verschieden intensive Beziehung zum Körper.
Johannes berichtet nicht von der Episode, wo Maria von Bethanien zu Füßen des Herrn sitzt. Dafür erzählt er die Geschichte der Salbung des Herrn von Maria von Bethanien und beim Bericht von der Auferweckung des Lazarus, der nur bei ihm vorkommt, fügt er ausdrücklich hinzu: Es war die Frau, welche den Herrn gesalbt hat.24 Es ist umstritten, ob Johannes das Evangelium von Lukas gekannt hat, als er sein eigenes schrieb. Aber diese Ersetzung eines Berichtes aus den früheren Evangelien durch einen neuen Bericht hat eine Parallele in der Ersetzung des Berichtes vom letzten Abendmahle durch den Bericht von der Fußwaschung. Es wird im geistlichen Bereich eine vertiefte Aussage erreicht. Die Frau mit der Salbung wird jetzt in die Nähe zur Auferweckung des Lazarus gerückt. In dieser ist die Auferstehung aller Gläubigen auf Grund der Auferstehung Christi vorgeformt. Die Salbung auf den Tod hin kommt damit auch in Beziehung zur Auferstehung. Wer den Herrn mit seiner Liebe für den Tod salbt, wird auch an Seiner Auferstehung Anteil haben – schon jetzt durch ein Geschehen in seinem Herzen, dann aber in seiner Ganzheit, wenn der Herr wiederkommt in Herrlichkeit.
Bereits die Kirchenväter haben diskutiert, ob die verschiedenen Frauen, die den Herrn nach den Berichten von Markus, Lukas und Johannes gesalbt haben, identisch gewesen seien. Dabei brachten sie noch eine weitere Frau ins Spiel, nämlich Maria von Magdala, wodurch diese zur »großen Sünderin« wurde, obwohl es von ihr bloß heißt, der Herr habe sie von sieben Dämonen befreit.25 Bereits Augustinus (354–430) hat die Einheit autoritativ festgestellt und ab Gregor dem Großen (540–604) war die Sachlage unbestritten. Moderne Exegeten haben mit dieser Bibelauslegung Mühe und unterscheiden mindestens drei Frauen. Wieso aber konnten die Väter die Identität postulieren? Hatten sie bessere Erkenntnisquellen? Dies im wissenschaftlichen Sinne sicher nicht. Für sie ging es um eine theologische Aussage. Sie handelten ähnlich wie vermutlich bereits der Evangelist Johannes. Der Bezug zur Auferstehung sollte verstärkt werden.
Maria Magdalena war die erste, welcher der auferstandene Herr begegnete.26 Und sie war diejenige, welche diese Nachricht den versammelten Jüngern überbracht hat.27 Deswegen wurde sie von den Kirchenvätern ›apostola apostolorum‹, Apostelin der Apostel genannt. So wie die Frau mit der Salbe den Herrn in Liebe eingehüllt hat und so mit Ihm gestorben ist, so ist sie auch wieder mit dem Herrn auferstanden. Und dafür steht Maria Magdalena. Sie ist nun gleichsam der weibliche Seelenteil der Apostel, diese erfahren nach und nach in ihrem Herzen, dass der Herr auferstanden ist und dass sie daran Anteil haben, insofern sie vorher auch mit ihrem Herzen den Tod des Herrn mitvollzogen haben. Maria Magdalena vertritt hier ihr ›Geheimnis des Glaubens‹. Die Apostel Johannes und Petrus sind dann zum Grab gerannt und haben gleichsam amtlich festgestellt, dass dieses leer war und dass der Herr auferstanden sein musste wie vorausgesagt.28 Dies war die intellektuelle Seite ihres Auferstehungsglaubens.
Der Kirchenvater Ambrosius (339–397) macht eine erstaunliche Bemerkung zur Begegnung von Maria Magdalena mit dem Auferstandenen. Und es kommt auch hier – wie bei der Salbung mit Nardenöl aus dem Alabastergefäß der Bezug zu Maria, der Mutter des Herrn, zur Sprache. Er sagt: »Als Maria begann, sich Ihm (dem auferstandenen Herrn) zuzuwenden, nannte Er sie ›Maria‹, das heißt, sie empfing den Namen derjenigen, welche Christus geboren hat; die Seele gebiert nämlich geistlicherweise Christus.«29
21 Joh. 11,1-45
22Lk. 10,38-42
23 Mk. 14,4f; Math. 26,8f; Joh. 12,4f
24Joh. 11,2
25Mk. 16,9
26Mk. 16,9; Joh. 20,11-17
27Joh. 20,18
28Joh. 20,2-10
29 Hugo Rahner, Symbole der Kirche, Salzburg 1964, S. 59: »quando converti incipit, Maria vocatur, hoc est nomen eius accipit quae parturit Christum; est enim anima quae spiritualiter parturit Christum.«
4. Kapitel: Das Geheimnis der Nacktheit Christi
Wir haben den Mantel Christi als Chiffre für Maria erkannt, welche zwischen dem Hilfe suchenden Menschen und Christus steht. Wir haben aber auch gesehen, dass Christus den direkten Kontakt sucht. Sein Haupt ist ja nicht verhüllt und wir können uns auch vorstellen, wie Seine Füße in den Sandalen unter dem Mantel hervorschauen.
Es fällt auf – und ergibt sich von selbst – dass die Frau mit der Salbe Jesus das Haupt30 oder die Füße31 gesalbt hat, vielleicht auch beides. Auch hier ist eine unmittelbare, bei der Salbung der Füße fast intime Beziehung vorhanden. Aber der sündige Mensch salbt Jesus mit der Salbe aus dem Alabastergefäß – oder mit seinen Tränen der Reue auch in unmittelbarer Weise. Wir haben die Salbe bereits mit Maria identifiziert. Maria ist nun im sündigen Menschen drinnen. Er ist Anna (Hannah) – wie die Mutter Marias nach der Mutter von Samuel genannt wird – d. h. jeder Mensch ist schwanger mit Maria und Maria ist die Mutter des Herrn.
Verehrung Marias heißt in diesem Moment, dass der sündige Mensch das ihm geschenkte Organ, Jesus aufzunehmen, freisetzt und zum Zuge kommen lässt. Anna grüßt Maria. Und sie bittet Maria, beim Herrn für sie einzutreten. Dies wird oft missverstanden als die Haltung der blutflüssigen Frau, welche nicht wagt, direkten Kontakt mit Jesus aufzunehmen. Es entspricht vielmehr der Frau, welche die ihr geschenkte Salbe über Jesus ausgießt. Die Salbe bedeckt die Haut Jesu und hat eine unmittelbare Beziehung zu Ihm, aber sie ist ein Stück von dieser Frau selbst. Maria ist die Tochter von Anna und damit ein Stück von ihr, aber die Mutter von Jesus. Anna trägt Maria und Maria Jesus. Jesus ist so auch in Anna und sie in Ihm. Damit aber wird Anna – die für die Gläubigen steht – neu geboren und Leib Christi. So ist sie auch Tochter (oder Sohn) von Maria.
Jesus möchte mit den sündigen Menschen eine unmittelbare Beziehung haben, damit diese Anteil an Seiner Auferstehung haben. Ein Zeichen dafür ist, dass Er an entscheidender Stelle immer wieder nackt erscheint. Er bleibt dabei zwar von der Liebe Marias umhüllt, bietet sich aber gleichzeitig an, auch von allen Gläubigen unter dem Herzen getragen zu werden.
Nackt ist Er bei Seiner Geburt. Wir können uns vorstellen, dass die drei Weisen aus dem Morgenland Ihn ebenfalls nackt gesehen und angebetet haben, wie die katholische Kirche die ihrem Wesen nach (nicht aber in ihrer Gestalt) zum Leib des Herrn gewandelte Hostie für die Anbetung enthüllt. Nackt war Er auch, als er im Tempel dargebracht und beschnitten wurde. Entkleidet war Er vielleicht auch als Ihn Johannes der Täufer zur Taufe im Jordan untertauchte. Nackt war Er schließlich bei der Geißelung und vor allem am Kreuz. Seine Kleider haben die Soldaten unter sich geteilt und um das Untergewand haben sie das Los gezogen.
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Jesus auch nach Seinem Tod für die Grablegung nicht mehr gekleidet wurde. Er wurde von Nikodemus und Joseph von Arimathäa vom Kreuz abgenommen und dann praktisch unverzüglich in der nahen Grabstätte abgelegt. Alles musste in Eile geschehen. Vom Tod bis zum Sonnenuntergang waren ca. drei Stunden. In dieser Zeit musste die Bewilligung von Pilatus eingeholt werden, der noch überprüfen ließ, ob Jesus wirklich tot sei, und es musste ein Grabtuch gekauft werden und Spezereien. Und vor sechs Uhr mussten sich alle noch für den großen Sabbat rüsten. Wenn wir davon ausgehen, dass das in Turin aufbewahrte Grabtuch wirklich das damals verwendete war, so wurde dieses unter und über dem nackten Körper Jesu ausgebreitet und Jesus lag vermutlich in einer Grabnische, wobei er auf dem einen Teil des Tuches lag und der andere über Ihn gebreitet war –und zwar womöglich so, dass dieser Teil zugleich auf den Rändern einer Art von Trog auflag.32 Jesus ist zuvor weder gewaschen noch gesalbt worden. Nikodemus hat die von ihm mitgebrachten Spezereien zum Teil auf dem Stein unter dem unteren Teil des Grabtuches und zum Teil auf dem oberen Teil des Tuches ausgebreitet. Die Frauen am Grab wollten den Leichnam nach dem Sabbat – als Jesus bereits auferstanden war – salben. Trotzdem kann nicht unbedingt bloß von einem provisorischen Begräbnis gesprochen werden. Es entsprach jüdischer Sitte, blutüberströmte Tote zusammen mit ihrem Blut zu begraben und weder zu waschen, noch einzukleiden.
Als Auferstandener erscheint Jesus immer in Kleidern. Es sind aber nicht jene, die Er vor Seiner Kreuzigung getragen hat, sondern sie gehören zu Seinem Auferstehungsleib, so wie ja auch Engel in Kleidern erscheinen. Dabei ist an den Vorgang auf dem Berg Tabor zu erinnern, wo nicht nur der Körper von Jesus, sondern auch dessen Kleider verklärt wurden. Sie wurden »weiß wie das Licht«.33 Darin ist eine Vorwegnahme Seiner Erscheinung als Auferstandener zu sehen.
Irgendwie wandelt sich auch das Verhältnis von Maria zu Jesus mit dessen Tod und Auferstehung. War sie zunächst hauptsächlich Seine Mutter und Er von ihr physisch abhängig, so ist Er nun vor allem ihr Gott und sie hat den Grund ihrer Existenz in Ihm. Sie hat Ihn mit Schmerzen aus ihrem Herzen neu geboren.
Dasselbe gilt für die Gläubigen, in denen Maria mit dem Kinde lebt. Jesus – und nicht Maria – wird zur Grundlage ihrer Existenz. Wenn Jesus am Kreuz dem Jünger Johannes Maria zur Mutter gibt,34 so tritt dieser durchaus an die Stelle von Jesus. Er sorgt für Maria und nicht Maria für ihn.
Dass Maria Jesus im Tempel verloren hat,35 ist ein Hinweis darauf, dass dieser eine direkte Beziehung zu den sündigen Menschen haben will und dass sie keineswegs die übermächtige Mutter bleibt, die Ihn umsorgt, sondern dass schließlich Er es ist, der Maria trägt, so wie Er alle Gläubigen trägt. Es gibt die Bilder des erhöhten Herrn mit einer kleinen Maria auf dem Arm.36
Es gibt bei der Kreuzigung eine letzte Steigerung der Nacktheit Christi. Dies ist die Öffnung der Seitenwunde, der Herzwunde durch den Soldaten. Wenn Wasser und Blut daraus hervorquellen, so ist das nur ein Symbol für das, was wirklich geschieht, nämlich dafür, dass Jesus nun auch Sein Herz und Sein Innerstes den Gläubigen offenbart. Dies ist eine Entblößung, gegenüber welcher Seine bisherige Nacktheit jeweils nur ein Zeichen war. Er will mit Seinem Innersten in uns sein, damit wir in Ihm sein können – so wie Er im Vater ist und der Vater in Ihm.37





























