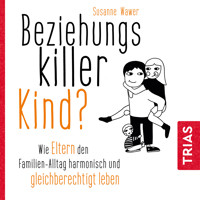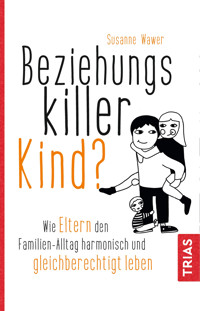
16,99 €
Mehr erfahren.
Raus aus der Beziehungskrise Die Kinder lernen laufen, aber in der Beziehung läuft nichts mehr? Mama schmeißt den Haushalt und Papa bringt das Geld nach Hause? Willkommen in der Familienfalle. Aus modernen, gleichberechtigten Partnern werden schneller traditionelle Familieneltern, als ihnen lieb ist. Häufig fallen Paare - zunächst unbemerkt - in alte Rollenmuster zurück, wenn das erste Kind geboren wird. Auf Dauer macht das beide unzufrieden. Kommt Ihnen bekannt vor? Bevor es richtig knallt, machen Sie jetzt Nägel mit Köpf(ch)en: Bedürfnisse erkennen und kommunizieren, den Alltag gerechter aufteilen, mit dem Partner Sinnlichkeit aufleben lassen, den Spagat zwischen all den Ansprüchen meistern - so wird die Elternbeziehung wieder zur Liebesbeziehung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Beziehungskiller Kind?
Wie Eltern den Familien-Alltag harmonisch und gleichberechtigt leben
Susanne Wawer
1. Auflage 2020
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Baby bedeutet oft Beziehungskrise – warum?
Anderen Müttern geht es genauso
Ein Dilemma unserer Zeit
Mit Kindern kommen Krisen
Wie kann eine Annäherung gelingen?
Wie lange hält die Liebe?
Wenn die Lust verschwindet ...
Die Kleinfamilie – ein längst überholtes Modell?
Trennungen sind belastend
Angenehme Trennungen sind Ausnahmen
Bleiben kann eine gute Idee sein
Gründe für Trennungen
Der Perfektionismus der Mütter
Traditionelle Rollenbilder
Attachment Parenting
Die Bedürfnisse von Babys
Bindung zulasten der Mütter
Wer macht wie viel im Haushalt?
Mehr Männer helfen mehr mit
Und wie ist es bei uns zu Hause?
Verantwortung teilen ist schwer
Warum sind Frauen so oft die Verantwortlichen?
Gerechte Aufteilung erfordert Verhandlungen
Veränderungen bedeuten Frust
Beide Partner brauchen Freiheiten
Verhandeln fällt vielen schwer
Achtung: Erschöpfung!
Prioritäten setzen
Vorsicht: Rollenfalle!
Teamarbeit – auch in der Familie
Effizienz kontra Kinderwunsch
Mütter wollen perfekt sein
Emanzipation der Mütter
Geben wir Rollenbilder weiter?
Kampf gegen Geschlechterstereotype
Lassen sich Aufgaben gerecht teilen?
Mütter sind oft intuitiver
Grenzen ziehen und Verantwortung abgeben
Freiheiten einfordern
Gesunden Abstand herstellen
Kinder bringen die Partnerschaft in Gefahr
Und plötzlich passiert es doch!
Kontakte zu anderen Müttern suchen
Die Bedürfnisse sind unterschiedlich
Kränkungen führen zum Rückzug
Wenn Liebende sich voneinander entfremden
Viele Mütter haben Schuldgefühle
Weg vom Partner, hin zum Kind
Veränderte Liebesgeschichten
Warum ziehen sich Partner zurück?
Wünsche äußern
Kinder verändern die Eltern
Selbstständigkeit aufgeben
Die Ehe macht Ungleichheit leichter
Es sind alles nur Phasen
Finanzielle Abhängigkeit
Anders als geplant
Weniger arbeiten braucht Vertrauen
Arbeiten und Kinder
Man kann nicht alles haben
Wenn das Geld fehlt
Permanenter Stress
Der Wunsch nach Teilzeit
Arbeit als Belastung
Für die wenigsten ist Arbeit erfüllend
Wir hätten Investmentbanker werden sollen
Zusammenbleiben trotz Schwierigkeiten
Wir müssen reden
Vorauseilender Gehorsam
Passiv-aggressive Mütter
Belastungen der Väter
Unangenehme Dinge ansprechen
Wertschätzend und konstruktiv diskutieren
Erwartungen aussprechen
Wünsche konstruktiv statt destruktiv äußern
Wohlwollend und mit Respekt
Auskotzen hilft
Defensive Konflikttaktik
Schluckt den Ärger nicht runter!
Apokalyptische Reiter in Beziehungen
Stellvertreterkriege vermeiden
Manchmal hilft auch Lästern
Eine Therapie kann helfen
Körperliche Nähe gehört dazu
Affären sind keine Lösung
Keine Lust auf Sex?
Spuren der Geburt
Weitere Gründe für mangelnde Lust
Die Welt dreht sich nur noch um das Baby
Über Sex reden
Kein Vertrauen in die eigenen Gefühle
Kinder verhindern Sex
Begierde braucht Abstand
Stress und Sicherheit
Ungewissheit und Distanz
Muttermythos
Das Wiederentdecken der Lust
Eifersucht kann helfen
Krisen bewahren uns vor dem Stillstand
Humor macht das Leben angenehmer
Insider schaffen Verbundenheit
Partnerschaft braucht Pflege
Nehmt euch Zeit füreinander!
Veränderungen brauchen Erschütterungen
Zeigt Interesse am anderen!
Zeit zu zweit
Liebe ist Arbeit
Bei anderen läuft es auch nicht rund
Sprecht mit anderen Eltern
Der eigene Weg ist nicht unbedingt der beste
Trennung – manchmal die bessere Lösung
Gewalt gegen Frauen ist nicht selten
Trennung kann eine gute Lösung sein
Angst vor der Trennung hat oft finanzielle Gründe
Trennung als schmerzvolle Erfahrung
Wenn die Beziehung in die Brüche geht
Lange Vorlaufzeiten
Finanzielle Angst
Für Kinder hat eine Trennung oft zwei Seiten
Viele bleiben aus Pflichtbewusstsein zusammen
Erschüttertes Vertrauen zu den Eltern
Konflikte zwischen den Eltern
Rechtsstreit um Kinder
Betreuung im Wechselmodell
Manchmal ist ein Rechtsbeistand nötig
Kinder als Waffe
Oft haben Frauen das Nachsehen
Geringschätzung unbezahlter Familienarbeit
Kindesunterhalt
Die »betrogenen« Väter
Jugendamt als Vermittler
Alleinerziehend – so war das nicht gedacht
Ein Einkommen reicht oft kaum aus
Selbstbewusste Alleinerziehende
Zukunftsträume
Was kann die Politik für Familien tun?
Viele würden gern weniger arbeiten
Eltern sind produktiver
Arbeit in der Zukunft
Kinderbetreuung verbessern
Armutsfaktor Kind
Geringeres Familieneinkommen
Ehegattensplitting beenden
Armutsquote senken
Andere Formen des Zusammenlebens
Bullerbü-Fantasien
Freunde statt Familie
Kinder sind wertvoll
Plötzlich Vorbild
Seite an Seite über den Windelberg
Sinn statt Glück
Beziehungen sind wertvoll
Literaturverzeichnis
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Baby bedeutet oft Beziehungskrise – warum?
Am Anfang unserer Beziehung war für mich klar: Wir sind anders als andere Paare. Wir begegneten uns auf Augenhöhe und konnten über alles sprechen. Besonders über die unbequemen Dinge. Es gab weder Tabus noch besonders große Scham. Dann wurde ich schwanger und die Sache mit der Gleichberechtigung wurde schwieriger, genauso wie das Reden. Denn plötzlich waren da nicht nur wir, sondern all die Bilder davon, was Eltern und besonders Mütter tun und lassen müssten. Wir dachten zwar, dass wir über all diesen Klischees und Erwartungen stehen würden, aber ehrlich gesagt, hatten wir genau dieselben Probleme wie alle anderen Paare auch.
Vielleicht war es bei euch ganz ähnlich. Vielleicht habt auch ihr euch langsam, aber sicher voneinander entfernt, und du warst zeitweise enttäuscht von deinem Partner, hast es aber für dich behalten, um euer frisch gebautes Nest nicht zu beschmutzen. Vielleicht hast auch du dich über lange Strecken wie ein Automat gefühlt, der nur dazu da ist, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. Vielleicht hattest auch du das Gefühl, in deinen Aufgaben zu verschwinden, und hast du dich für solche Gefühle und Gedanken genauso geschämt wie ich.
Wenn fast alle Mütter die gleichen Probleme haben, ist es vielleicht gar nicht deine Schuld. Möglicherweise stimmt hier einfach etwas nicht. Vielleicht sind wir noch lange nicht so gleichberechtigt, wie wir immer denken.
Mein Mann und ich haben mittlerweile zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Mit unserem ersten Kind veränderten sich nicht nur mein Alltag und mein Stresslevel, sondern auch die Beziehung zu meinem Partner. Tatsächlich schafften wir es noch ein paar Monate, uns weiter wie ein Paar zu verhalten, aber langsam bewegten wir uns voneinander weg. Was er Tag für Tag erlebte, war so verschieden von dem, was ich erlebte, unsere Belastungen und Sorgen so unterschiedlich, dass es immer weniger Momente der Nähe zwischen uns gab.
Wenn ich versuche, mir einen idealen Partner nach der Geburt des ersten Kindes vorzustellen, dann ist viel unrealistische Idylle dabei. In meiner Wunschvorstellung geht mein Partner kaum arbeiten und wir laufen ziemlich häufig zu dritt über duftende Kräuterwiesen. Wenn das Baby ausnahmsweise mal nicht durchschläft, wechseln wir uns nachts ab. Wir müssen uns nicht absprechen oder gar streiten, weil alles von allein läuft und jeder sieht, was zu tun ist, und zupackt. Aber das ist nicht nur dann unrealistisch, wenn man uns kennt. Auch ohne dieses Wissen gibt es in dem Traumszenario nicht genug Geld für die kleine Familie, die plötzlich permanent neue Bodys, Strampler, Strumpfhosen und mehr Platz braucht.
Ein weiteres Problem war, dass ich mit dem Baby plötzlich viel zu müde war, um mir genauere Gedanken darüber zu machen, was ich wollte. Diese unausgesprochenen Erwartungen, die sich auch aus Werbebildern und Naivität speisten, ließen mich immer unzufriedener werden.
Anderen Müttern geht es genauso
Aber ich war nicht allein. Wenn ich andere Mütter nach ihrer Partnerschaft fragte, brach fast immer eine Lawine an Beschwerden los, und ich stellte fest, dass fast alle mit denselben Problemen zu kämpfen hatten. Alle fanden den Spagat zwischen Muttersein und Lovebirds schwierig, fast alle fühlten sich mit der Verantwortung für das Kind alleingelassen und bemängelten eine ungerechte Aufgabenverteilung.
Was uns einte, war: Wir wussten nicht so richtig, wie wir es besser machen sollten. Wir wollten schließlich keine Motz- und Schimpfkühe werden. Im Grunde erwarteten wir von den Vätern unserer Kinder, dass sie sich ganz von selbst in diese viel beschriebenen neuen Väter verwandelten, die selbstverständlich Dreigänge-Menüs inklusive Beikost kochen, nachdem sie dafür eingekauft haben, immer die aktuelle Schuhgröße des Kindes kennen, die Wäsche schon aufgehängt haben, bevor wir dazu kommen, und wie durch Zauberhand im Halbtags-Homeoffice ein ausreichendes Familieneinkommen verdienen. Kurzum: Wir erwarteten von den Vätern dieselben unrealistischen Kunststücke, wie sie auch von Müttern erwartet wurden. Und nichts passierte. Wir wurden nur immer unzufriedener.
Manche der Mütter, die ich im Laufe der Jahre kennenlernte, sind inzwischen alleinerziehend, nachdem sie lange frustriert waren. Manche stecken in deprimierenden Beziehungen und trauen sich wegen der Kinder oder der hohen finanziellen und emotionalen Kosten nicht, sich von ihrem Partner zu lösen. Manche Eltern sind glücklich miteinander. Bei einigen von ihnen hat es zwischendurch ordentlich gerappelt. Sie haben sich gestritten, die Erwartungen und falschen Werbeversprechen klein gehauen, waren kurzzeitig in Affären verschwunden und haben sich danach wieder neu und realistischer zusammengesetzt. So ungefähr war es auch bei uns.
Ein Dilemma unserer Zeit
Ich möchte in diesem Buch meine Geschichte als Beispiel für ein weit verbreitetes Dilemma unserer Zeit erzählen. Dabei werde ich aus Gründen der Lesbarkeit von »Müttern«, »Vätern« und »Partnern« sprechen, wohlwissend und meinend, dass Rollen durchaus vertauscht sein können und dass mit »Partnern« auch »Partnerinnen« angesprochen sind.
Heutigen Familien fehlt es an geeigneten Vorbildern für eine gleichberechtigte Partnerschaft und Organisation der Familienaufgaben. Probleme und Benachteiligungen werden offen benannt und angeprangert, große Medien sind sich einig darüber, dass es ein Problem ist, wenn der Anteil von Frauen in Führungsetagen im einstelligen Prozentbereich liegt und sie im Schnitt weniger als die Hälfte der Rente der Männer bekommen.
Doch mit dem ersten Kind geraten bei vielen Familien die Vorsätze, ihr aufgeklärtes, gleichberechtigtes Leben weiterzuführen, ins Wanken. Denn die Gleichberechtigung, über die sich die meisten Eltern einig sind, kommt da an ihre Grenze, wo es um das Wohl des Kindes geht.
Leider hat sich das Mutterbild in Deutschland nicht mit emanzipiert. Noch immer sind die meisten Mütter die Hauptverantwortlichen für die Kinder, auch wenn die Sorgepflicht zu gleichen Teilen bei beiden Eltern liegt. Dieses Auseinanderklaffen von Einstellungen und gelebter Realität führt in zahlreichen Familien zu einer starken Belastung der Mütter und in der Folge zu Unmut, Vorwürfen und Konflikten in der Partnerschaft.
Mir hat es geholfen, zu verstehen, dass es vielen Familien so geht und dass die Schuld nicht allein bei uns liegt. Es ist ein Problem unserer Zeit. Deshalb möchte ich versuchen, euch ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr die Schwierigkeiten, die das Elternsein heute mit sich bringt, gemeinsam besser bewältigen könnt.
Die Lösungen sind oft erstaunlich trivial und setzen bei der Kommunikation zwischen den Partnern an. Aber im stressigen Alltag und angesichts unserer Erziehung und unserer Rahmenbedingungen ist es eben doch nicht so leicht. Der erste Schritt zur Veränderung – davon bin ich überzeugt – ist, zu erkennen, was schiefläuft. Erst dann können wir anfangen, uns zu fragen, wie wir es besser machen wollen, um glücklich, offen und respektvoll miteinander alt zu werden. Ich hoffe, dieses Buch hilft euch dabei.
Susanne Wawer
Mit Kindern kommen Krisen
Der Moment, in dem ich ernsthaft anfing, darüber nachzudenken, was ich realistischer Weise von meiner Partnerschaft mit Kindern erwarten konnte, wurde durch meinen Mann erzwungen. Wir lagen zusammen im Bett, wie es abends wieder öfter vorkam. Unser zweites Kind war etwa zwei Jahre alt und ich schlief meistens bei ihm, legte mich aber seit kurzem abends zu meinem Mann und blieb dort, bis mich ein Kind rief, was immer vorkam. Auch bei meiner Tochter hatte ich lange geschlafen, da sie nachts immer mehrmals aufwachte und wir uns darauf geeinigt hatten, dass der, der sich tagsüber stärker konzentrieren muss, ungestörter schlafen darf. Das war mein Mann.
Ich hatte mich in meine Mutterrolle hineingefunden und war eine dieser sehr ambitionierten, geistig unterforderten Akademikermütter, die sich ein bisschen zu viele Gedanken um die Aufzucht und Pflege ihrer Kinder machen. Da wir keine Angehörigen in der Nähe haben, hatten wir kaum Hilfe. Und weil wir uns zumindest übergangsweise auf das Einverdienermodell geeinigt hatten, war ich größtenteils für die Kinder und den Haushalt zuständig. Ich ernährte meine Kinder gesund, organisierte Treffen mit anderen Kindern, machte Ausflüge mit ihnen in den Wald, auf Spielplätze und baute Legotürme. Meine Kinder trugen schicke, biozertifizierte Klamotten und bevor ich etwas für sie kaufte, las ich alle verfügbaren Rezensionen. Natürlich war ich auch Elternvertreterin in der Kita.
Aus irgendeinem Grund dachte ich bis zu diesem Abend, dass das, was ich tat und was mich bis an den Rand der Erschöpfung in Beschlag nahm, genug sei. Ich dachte, indem ich eine gute Mutter bin, wäre ich auch eine gute Partnerin. Für mich war meine Selbstaufgabe ein Geschenk an die ganze Familie. Aber als mein Mann die Worte sagte, die das alles infrage stellten, zerbrach diese Illusion. Er sagte, dass er nicht mehr wisse, ob er mich noch liebe. Ich hörte es in meinem Innern knacken und dachte nur: Da ist gerade etwas kaputtgegangen. Er redete weiter darüber, dass er so nicht leben wolle, so entfernt, so nebeneinanderher, jeder in seinem Hamsterrad, in dem er für die Familie rennt, aber den anderen nicht wirklich sieht. Nicht mit dieser gegenseitigen Bissigkeit und Lieblosigkeit. Ich hörte ihm in meinem Schockmodus zu, war aber zu überrascht, um richtig zu verstehen, was er sagte. Wie die Nachricht vom Tod eines nahen Angehörigen tropfte das Verstehen nur langsam in mein Bewusstsein.
Ich werde nicht von all den Tränen und Verletzungen schreiben, die dieser Moment zur Folge hatte. Das Wichtigste war, dass dieser Abend eine Kehrtwende darstellte. Dieser Abend, die Zweifel und die Unzufriedenheit meines Mannes hatten alles infrage gestellt, von dem ich dachte, es sei unumstößlich.
Wie kann eine Annäherung gelingen?
In den folgenden Tagen und Wochen fingen wir wieder an, miteinander zu sprechen und uns Briefe zu schreiben wie zu Anfang unserer Beziehung. Wir hörten auf, uns zu schonen und uns unser Leben schönzureden, um unser Nest nicht zu beschmutzen oder zu gefährden. Stattdessen sprachen wir über unangenehme Dinge. Darüber, dass wir uns im Lauf der Jahre in andere Leute verliebt hatten, über unsere Sehnsüchte und was uns verletzt hatte, darüber, was wir am anderen hassten, aber uns nie getraut hatten, auszusprechen. Wir fanden zurück zu der Schonungslosigkeit, die unseren Umgang früher ausgemacht hatte, und wir überlegten uns ernsthaft, wie ein Leben im Fall einer Trennung aussehen würde.
Und als wir uns nach Wochen darüber klar wurden, dass diese Aussicht für uns beide wenig verheißungsvoll war, fragten wir uns, was wir voneinander wollten und erwarten konnten. Ich wurde zufriedener, weil ich mich von dem Bild einer glücklichen, gleichberechtigten Partnerschaft mit Kindern verabschiedete, bei der ich meinem Partner jede Schieflage vorwarf. Stattdessen lernte ich es zu schätzen, dass auf mir nicht der Druck der finanziellen Versorgung lastete. Ich genoss es, mit meinen Kindern Zeit verbringen zu dürfen und durch Kita und Schule Zeit zum Schreiben zu finden.
Rückblickend denke ich, dass wir eine Art Paartherapie ohne Therapeuten gemacht haben. Wenn wir es uns in unserem Leben und in unseren Rollen allzu gemütlich gemacht haben, ist meist ein ordentlicher Knall nötig, damit wir aus der Routine herauskatapultiert werden. Bei anderen Paaren, die weniger schonungslos miteinander reden, hat eine Affäre oder ihre greifbare Nähe diesen Knall bewirkt. Bei wieder anderen war es ein plötzlicher Schicksalsschlag, der Tod eines nahen Verwandten oder eine ernste Erkrankung, der ihnen verdeutlichte, dass das Leben zu kurz ist, um es mit zusammengebissenen Zähnen in Unzufriedenheit zu verbringen.
Beziehungstipps
Nimm direkte oder indirekte Äußerungen von Unzufriedenheit deines Partners immer ernst.
Höhen und Tiefen gehören zu jeder Beziehung dazu, doch grundlegende Schwierigkeiten solltet ihr unbedingt ansprechen oder klären.
Keine Angst vor Krisen und Veränderungen! Wer gemeinsame Kinder hat, meint es gewöhnlich einigermaßen ernst.
Wenn du dich deinem Partner wieder annähern willst, solltest du bereit sein, Ideale zu hinterfragen, Prioritäten anders zu setzen und am gegenseitigen Umgang zu arbeiten.
Wie lange hält die Liebe?
Als wir zu einer diamantenen Hochzeit eingeladen waren, fragte ich mich, ob wir überhaupt so lange leben würden, dass wir unseren sechzigsten Hochzeitstag erlebten. Und angesichts unserer paar Jahre Zusammensein und der kümmerlichen Ehedauer fragte ich mich: Wie viele Verletzungen, wie viel Betrug und wie viel Zuversicht verbergen sich hinter diesen sechzig Jahren? Wie oft mussten sie sich neu erfinden und zweifelten an ihrer Liebe? Wie oft haben sie sich gefragt, ob sie den anderen weiter aushalten oder doch lieber weglaufen wollen?
Denn mit den Jahren verändern wir uns. Kinder verändern uns, aber auch das Leben mit seinen zahlreichen anderen Herausforderungen. Und jede dieser Verschiebungen muss in einer Beziehung mit vollzogen werden. Es stellen sich neue Fragen und die Leidenschaft gerät angesichts des Alltags nicht selten unter die Räder. Wenn wir jeden Tag sehen, wie der oder die Geliebte aufs Klo geht und (hoffentlich) hinter sich die Tür schließt, wenn wir hören, wie das Fenster geöffnet und die Klospülung betätigt wird, wenn wir sehen, wie sich der oder die andere kratzt, popelt, wie er oder sie hustet, niest, rülpst und stundenlang auf dem Sofa liegt und Chips essend Candy Crush spielt, dann geht dabei unweigerlich der zarte Duft des Frühlings, der ihn oder sie früher umgab, verloren. Es passiert nicht sofort, sondern ganz langsam und Stück für Stück. Alltag und Leidenschaft sind schwer unter einen Hut zu bringen.
Wenn die Lust verschwindet ...
Anne, 37(1)
Nie hat er sich um den Haushalt gekümmert!
Manchmal scheitern Beziehungen an scheinbar kleinen Dingen. So häuften sich bei Anne und ihrem Mann die Ärgernisse so lange an, dass ihre Beziehung schließlich unter ihnen begraben wurde.
Wir waren acht Jahre zusammen und haben zwei Kinder, die im Abstand von einem Jahr geboren wurden. Bei beiden bin ich nach kurzer Elternzeit wieder arbeiten gegangen. Mein Mann und ich haben uns die Aufgaben geteilt: Ich arbeitete tagsüber, er abends. Und so gaben wir uns die Klinke in die Hand. Neben Kindern, Job und Haushalt hatten wir keine Zeit mehr für uns als Paar und die Leidenschaft ging langsam, aber sicher verloren. Irgendwann hat es mir gereicht und wir haben uns getrennt. Für ihn kam das unverhofft und war ein Schlag ins Gesicht, aber für mich war die Trennung eine Befreiung. Mein Mann war den ganzen Tag zu Hause, aber er hat es einfach nicht geschafft, sich um den Haushalt zu kümmern.
Das häufigste Problem langjähriger Beziehungen ist dieses langsame Verschwinden der Lust angesichts der zahlreichen deprimierenden Kleinigkeiten, die ein gemeinsamer Haushalt und Routinen mit sich bringen. Leider gibt es kein Pauschalrezept dafür, wie man diesem Verlust entgeht. Die Lösungen sind so individuell wie die Fäden, die Menschen zusammenhalten.
Mittlerweile glaube ich, dass bei den wenigsten Paaren die Liebe über Jahre hinweg trotz des Alltags auf hohem Niveau erhalten bleibt. Vielleicht reden sie nicht darüber wie wir, vielleicht geben sie sich instinktiv manchmal mehr Mühe oder erzeugen Bedrohlichkeiten, die ihrer Beziehung ein wenig mehr Würze verleihen. Doch Paartherapeuten wissen, dass es Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, um Partnern wieder zu einem respekt- und liebevolleren Umgang zu verhelfen. Das kann man Arbeit oder Raffinesse nennen.
Beziehungstipps
Abnehmende Lust hat viele Gesichter: Vielleicht lässt dein Partner dich selten ausreden oder rollt bei Bemerkungen mit den Augen, vielleicht berührt ihr euch wenig, habt kaum Sex oder ihr geht euch bewusst oder unbewusst aus dem Weg. Vielleicht könnt ihr euren Partner nicht mehr riechen oder seid schon genervt, wenn er nur den Mund aufmacht.
Wenn ihr spürt, dass euch die Lust aufeinander abhandenkommt, nehmt euch die Zeit, euch zu fragen, was euch fehlt und was ihr euch wünscht. Lasst das euren Partner dann auch wissen.
Auch nach vielen gemeinsamen Jahren solltet ihr noch bereit sein, dem anderen die Chance auf Veränderung zu geben und euch wieder mit Wertschätzung zu begegnen.
Die Kleinfamilie – ein längst überholtes Modell?
Immer mehr Kinder in Deutschland (2017 etwa 17 Prozent) wachsen bei nur einem Elternteil auf. Vor zwanzig Jahren waren es noch 12 Prozent. Daran ändert auch die in Deutschland zwar umstrittene, aber immer noch geltende steuerliche Bevorteilung des Versorgermodells durch das Ehegattensplitting nichts. Die meisten Trennungskinder haben Eltern, die sich einmal liebten und dann an den Herausforderungen des gemeinsamen Lebens scheiterten.
Die steigende Zahl von Alleinerziehenden zeigt, dass sich Menschen nicht durch staatliche Anreize dazu bringen lassen, zusammenzubleiben. Auch die hohen Kosten einer Scheidung und die höheren Lebenshaltungskosten, die eine doppelte Haushaltsführung bedeuten, ändert anscheinend nichts daran, dass Paare sich trotz gemeinsamer Kinder trennen. Derzeit wird etwa jede dritte Ehe geschieden. Wir leben in einer Zeit, in der sich die Menschen nicht mehr von Gott oder ihrer Familie sagen lassen, mit wem sie zusammenleben sollen. Individualität und Unabhängigkeit sind heute hohe Werte.
Trennungen sind belastend
Diese Freiheit ist einerseits ein großer Vorteil gegenüber Zeiten, in denen es aufgrund gesellschaftlicher Zwänge kaum möglich war, sich zu trennen, und Partner stattdessen in gewalttätigen oder erniedrigenden Ehen verharrten. Auf der anderen Seite stehen die hohen Kosten von Trennungen. Nicht nur, dass es in vielen Fällen wirtschaftlich deutlich von Nachteil ist, aus einem Haushalt zwei zu machen. In einer erschreckend hohen Zahl der Fälle sind Trennungen auch von hässlichen und teilweise kostspieligen Streitereien, verletzten Gefühlen und Gehässigkeiten begleitet, die natürlich nicht nur die Eltern belasten, sondern auch die Kinder.
Der Klassiker ist, dass Kinder infolge einer Trennung unter Loyalitätskonflikten leiden. Sie wollen es Mama und Papa recht machen und geraten an ihre Grenzen. Wenn sie um den Streit ihrer Eltern wissen, fühlen sie sich vielleicht unwohl in der Kleidung, die der andere Elternteil gekauft hat, oder trauen sich nicht, von positiven oder negativen Erlebnissen beim anderen zu erzählen.
Doch nicht nur der Streit (um Sorge, Unterhalt, verletzte Gefühle), der sich gewöhnlich an Trennungen anschließt, belastet Kinder, sondern auch die Wechsel zwischen den getrennten Elternhäusern. Denn nicht nur Personen geben Kindern Sicherheit und Halt, sondern auch das Wohnumfeld.
Angenehme Trennungen sind Ausnahmen
Eltern, die ich flüchtig kenne und die es den Kindern leicht machen, d.h. so wenig wie möglich ändern wollten, haben ihre Familienwohnung behalten und eine kleinere Wohnung dazu gemietet. Sie wechseln sich mit der Betreuung der Kinder in den Wohnungen ab, was den Kindern ein großes Maß an Stabilität gibt. So ein Arrangement verlangt jedoch viel Kooperationsbereitschaft von den Eltern und ist bei konfliktreicheren Konstellationen sicher eher ungeeignet.
Wie dieser Fall zeigt, ist es durchaus möglich, eine Trennung für die Beteiligten schonend und liebevoll über die Bühne zu bringen. Dazu gehört jedoch ein großes Maß an Disziplin und Vernunft. Leider sind Menschen aber nicht nur rationale Wesen, die sich bei ihrem Handeln in erster Linie am Wohl des Kindes orientieren, sondern sie sind besonders in Trennungssituationen recht emotional.
Ich kenne wenige Eltern, die es geschafft haben, sich gütlich und einvernehmlich zu trennen, und zahlreiche Eltern, die ich gern ordentlich durchschütteln möchte, damit sie aufhören, den Ex-Partner vor dem Kind schlechtzumachen. Das betrifft Väter genauso wie Mütter. Und es zieht sich durch alle Schichten. Der Grund dafür ist die oft vernachlässigte emotionale Seite von Trennungen. Eine Scheidung oder Trennung ist fast immer ein erschütterndes Ereignis, das sich oft über viele Jahre hinzieht und von zahlreichen Verunsicherungen, Schuldgefühlen, Verletzungen und Momenten tiefer Trauer begleitet wird.
Bleiben kann eine gute Idee sein
Zwar liegt es mir fern, Werbung für die heterosexuelle Kleinfamilie zu machen. Kinder können auch bei einem Elternteil, bei gleichgeschlechtlichen Paaren oder in Patchworkfamilien behütet und glücklich aufwachsen. Aber nach meinem Gefühl und meiner Erfahrung tut es Kindern wie Eltern gut, wenn es mehr als eine nahe Bezugsperson gibt. Denn eigentlich ist einer zu wenig. Außerdem bin ich fest davon überzeugt, dass viele Beziehungen sich retten ließen, wenn beide Partner bereit wären, an sich und ihrem Umgang zu arbeiten und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Dazu gehören innere Stärke, die Fähigkeit zu verzeihen und gegenseitiges Vertrauen.
Eine Paartherapeutin von Bekannten beginnt ihre Sitzungen immer mit der Frage nach gemeinsamen Kindern. Wenn die Frage mit »Ja« beantwortet wird, schließt sie mit dem Paar per Handschlag einen Vertrag, in dem sie vereinbaren, dass sie sich ein Jahr lang nicht trennen und in dieser Zeit an sich arbeiten. Was sich hinter diesem »Vertrag« verbirgt, ist jahrelange Erfahrung damit, was es im Einzelnen und besonders für Kinder bedeutet, wenn Partner sich trennen. Sie weiß, dass Menschen ihre Krisen überwinden können, wenn sie wollen und bereit sind, etwas dafür zu tun.
Nahezu alle Alleinerziehenden, die ich kennenlernte, haben in der einen oder anderen Form unter der enormen Belastung, der ständigen Geldnot und der zerbrochenen Beziehung gelitten. Denn jede Aktivität ohne Kind muss organisiert werden. Wenn das Kind zum Beispiel Fieber hat und noch klein ist, können Alleinerziehende nicht einkaufen gehen. Sie sitzen beim Kind und ernähren sich von Resten, bis der Lieferdienst kommt oder sie wieder das Haus verlassen können. Und wenn sie erschöpft, selbst krank oder genervt sind, gibt es niemanden, der sie ablösen kann, der das Kind genauso gut kennt wie sie selbst, der als Korrektiv dient oder der sie in den Arm nimmt und sagt: »Du machst das alles ganz wunderbar.«
Wenn man nicht gerade Spitzenverdiener mit flexiblen Arbeitszeiten ist und über ein verlässliches Netzwerk von betreuungswilligen Helfern verfügt, ist das Dasein als alleinerziehender Elternteil eine permanente Herausforderung.
Beziehungstipps
Trennungskinder leiden häufig unter Loyalitätskonflikten und unter Streitereien zwischen den Eltern.
Wenn ihr über eine Trennung nachdenkt, macht euch bewusst, dass Kinder immer die Verlierer sind.
Versucht euch möglichst genau die Konsequenzen einer Trennung für alle Beteiligten vorzustellen.
Wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist eine gute Therapie oft einer langwierigen und verletzenden Scheidung vorzuziehen. Dabei lernt ihr, euch besser in den anderen hineinzuversetzen, zu verzeihen und auf euren Stärken als Paar aufzubauen.
Verlange nicht von deinem Partner, dass er gleichzeitig dein bester Freund, bombastischer Liebhaber, Großverdiener und Meister der Einfühlsamkeit ist. Realistische Erwartungen sorgen für weit weniger Enttäuschungen.
Gründe für Trennungen
Jährlich werden in Deutschland 160 000 Ehen geschieden, das ist mehr als jede dritte. Davon waren 2015 in 135 000 Fällen minderjährige Kinder betroffen. Über die Trennungen unverheirateter Eltern gibt es keine verlässlichen Zahlen. In einer amerikanischen Studie wurden 69 Prozent der Scheidungen von Frauen eingereicht. Ähnlich verhält es sich in Deutschland.
Aber warum werden so viele Ehen geschieden und warum sind es so oft gemeinsame Kinder, die dabei eine entscheidende Rolle spielen? Ist es tatsächlich die Belastung, die im Vorfeld unterschätzt wird? Und warum schaffen manche Eltern es einigermaßen glimpflich durch diese turbulente Zeit mit kleinen Kindern, während andere scheitern?
Zunächst einmal werden Ehen geschieden, weil die Umstände es zulassen und die Werte unserer Gesellschaft es begünstigen. Sie werden aus denselben Gründen geschieden, aus denen in Deutschland so wenig Kinder geboren werden. Kinder sind kein Garant für Glück. Ganz im Gegenteil. Und genau wie ein Partner machen sie das Leben manchmal schwerer und anstrengender. Kinder laufen dem individuellen Glück und der Freiheit, wie sie heute an zahlreichen Stellen propagiert werden, entgegen. Sie schränken die Freiheit des Einzelnen ein, erfordern Kompromisse und bringen Konflikte mit sich. Darüber hinaus gefährden sie den Wohlstand, erzeugen enorme Kosten und verringern die Flexibilität.
Wenn ich ganz ehrlich bin, wundert es mich überhaupt nicht, dass Partnerschaften mit kleinen Kindern unglücklicher werden und in die Brüche gehen. Die Baby- und Kleinkindzeit stellt wohl jede Beziehung vor eine enorme Belastungsprobe. Die Zeit nach der Geburt des ersten Kindes stellt das Leben des Paares nachhaltig auf den Kopf, denn die jungen Eltern haben kaum noch Zeit füreinander. In den meisten Fällen ändert sich für die Mutter so gut wie alles, für den Vater nicht ganz so viel. Doch die Beziehungszufriedenheit sinkt bei beiden.
Das größte Problem ist die erlebte Ungerechtigkeit, die oft durch die Einschränkungen nach der Geburt des ersten Kindes entsteht. Ein weiterer oft genannter Grund für Trennungen ist ein als zu gering empfundenes Familieneinkommen. Beide Hauptgründe thematisieren die Verteilung von unbezahlter Familien- und bezahlter Erwerbsarbeit. Denn das mangelnde Familieneinkommen hängt direkt mit der eingeschränkten Arbeitskraft mindestens eines Elternteils zusammen.
Fast immer geht es bei Trennungen also um die Unzufriedenheit und die Belastung auf Seiten der Frauen, die sich natürlich auch sexuell ausdrückt. Befragungen zeigen regelmäßig den alarmierenden Zustand junger Mütter. Sie sind überlastet und kranken an ihrem Perfektionismus. All dieser Stress und die Überlastung führen dazu, dass die Partner sich weniger nah sind, weniger Sex haben und weniger miteinander reden (abgesehen von praktischen Absprachen).
Schuld sind neben schlechten Rahmenbedingungen und mangelnden Vorbildern die eigenen Ansprüche. Viele Frauen sehen sich in der Pflicht, liebevolle, entspannte Mütter und attraktive Ehefrauen zu sein, die ganz nebenbei eine Karriere stemmen.
Der Perfektionismus der Mütter
Ich finde mich in solchen Beschreibungen zu hundert Prozent wieder. Obwohl ich anfangs dachte, ich würde die ganze Sache mit den Kindern weit lässiger handhaben als die sogenannten Helikopter, die Öko-Muttis und die Überambitionierten, war ich am Ende genauso wie sie. Ich war überrascht von der Angst, die mich plötzlich befiel. Panisch kontrollierte ich alle paar Minuten, ob mein schlafendes Kind noch atmet (plötzlicher Kindstod), kaufte Bodys, die mehr kosteten als meine Pullover, informierte mich über Schadstoffe, Entwicklungsstand, Impfschäden und all die anderen Themen, mit denen ich von allen Seiten konfrontiert und verängstigt wurde. Ich wollte mit dem Baby alles richtig machen, jedes Bedürfnis richtig erkennen und entsprechend reagieren. Deshalb zweifelte ich jedes Mal, wenn es weinte, an meiner Eignung als Mutter und hatte Angst, zu versagen. Gleichzeitig wollte ich den Haushalt gerecht aufteilen und trotz Mutterschaft attraktiv sein. Ich fühlte mich zunehmend für alles, was das Kind, den Haushalt und die Beziehung betraf, verantwortlich.
Das Leben junger Väter ist von diesem Perfektionismus gewöhnlich weniger betroffen. Sie sind jedoch häufiger berufstätig als Männer ohne Kinder. Umfragen zeigen zudem, dass sie sich stärker als Versorger empfinden und unter dem Druck, der damit einhergeht, leiden. Auch beklagen sie sich öfter, ihre Kinder zu wenig zu sehen. Wenn darüber hinaus die Frau immer unzufriedener, vorwurfsvoller und weniger zärtlich wird, ist das natürlich frustrierend.
Der Standardfall ist der, dass die Mutter angesichts des Drucks und der Aufgaben, die auf ihr lasten, am Ende ihrer Kräfte ist und sich mehr Unterstützung wünscht, der Vater hingegen fühlt sich sexuell vernachlässigst und leidet unter dem Versorgungsdruck. Bei näherer Betrachtung und etwas vereinfacht handelt es sich also um ein simples Verteilungsproblem: Die junge Mutter macht zu viel, der Partner bekommt zu wenig. Bemühten sich die Partner möglichst früh um eine wunschgemäße Verteilung von Arbeit, Fürsorge und Haushalt, könnten sie viel zufriedener sein. Klingt einfach, ist es aber am Ende doch nicht. Denn solchen simplen Lösungen stehen oft hartnäckige Rollenbilder, kommunikatives Unvermögen und eine nicht besonders hilfreiche Familienpolitik entgegen.
Beziehungstipps
Häufig ist der Hauptgrund für Trennungen die erlebte Ungerechtigkeit zwischen Partnern bzw. die Konflikte, die sich aus einer Aufgabenverteilung zulasten der Mutter ergeben.
Verhandelt und besprecht deshalb möglichst vor der Geburt, wie ihr Aufgaben und Arbeit mit Kind untereinander aufteilen wollt.
Macht euch nicht verrückt, verlangt euch nicht zu viel ab, versucht eure Grenzen zu erkennen und zu verteidigen.