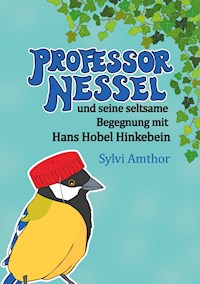Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Satiren und Essays, rund um Kind und Katz und Kegel
Das E-Book Bieza Pig Cola wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Satire,Humor,Familie,Kind und Kegel,Essays
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Beteiligten und näheren Umstände habe ich wieder unkenntlich gemacht, aber manche Orte stehen im Original.
Für alle, die mich und meine Familie kennen: nicht jede Situation ist genau so geschehen, manchmal habe ich eine Geschichte aus mehreren Ereignissen zusammenfabuliert oder sie einer anderen Person zugeschrieben. Auch die Protagonisten sind oft eine Kompilation mehrerer Personen. Ein bisschen dramaturgische Freiheit habe ich mir also wieder erlaubt.
Übersicht
1. Bieza Pig Cola
2.Neues, altes Haus
3. Es geht um die Wurst
4. Dutsie dutsie duu
5. Mozart meets Michelle
6. Soll und Haben
7. Die Zeit, mein geliebter Feind
8. Die Kaffee-Diva
9. Ero-Tick
10. Limericks ab 18
11. Schnick, schnack, zwickeldizwack
12. Du ersehnter, heißgeliebter, fernebleibender Schlaf
13. Das Liegestuhl-Phänomen
14. Sammelsurium eines Strandspaziergangs
15. Das Spaghetti-Mysterium
16. Spintisieren über die Klamotte, die verflixte
17. Der Macho-Kater, II
18. Fliegen-Trilogie
19. Shigeru – Tagebuch einer besonderen Zeit
20. In der Werkstatt
21. Der Piepkasten
22. Abenteuer um 17.00 Uhr
23. Wahnsinns-Bilder
24. Eins plus eins macht acht
25. Spintisieren im stillen Kämmerlein - Schockbilder
26. Wenn die Askese nix gewese
27. Tanten-Terror, I
28. Tanten-Terror, II
29. Spintisieren über Deutsch
30. Die nicht geschriebene Geschichte
31. Erzieherin in der Kita – mein unbeschreibbarer Beruf
32. Frühlingsgefühle
33. Neues von Onkel Ulrich
34. Schreib-Schnösel
35. Der Individuelle
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie schön, dass du noch mehr von meinen schrulligen Erlebnissen lesen möchtest! Man könnte meinen, mit den knapp 40, die ich jetzt zu Beginn dieses Bands war, wäre ich etwas abgeklärter und käme besser mit den Unbilden des Lebens zurecht. Pustekuchen, irgendwie schaffe ich es bis heute, in skurrile Situationen zu geraten.
Ich verrate dir hier auch, dass ich mit fast 60 tatsächlich noch ein weiteres Mal meinen Job gewechselt habe. Weil die Sozial-Empathische in mir in ernste Probleme kam mit der Groteske, zu der sich manche Einrichtung, die sich mit kleinen und großen Menschen beschäftigt, heute entwickelt hat. Erzieherinnen wie ich, aber auch Kranken- und Altenpfleger wissen, wovon ich spreche. Wie gut, dass mir trotzdem der Humor nicht abhandengekommen ist! Wenn er auch mittlerweile der Ansicht ist, dass angesichts manch... will mal sagen ‚seltsamer‘ Entwicklungen in unserer Gesellschaft nicht nur die Satire, sondern auch der Sarkasmus zuweilen eine Daseinsberechtigung hat...
Ich wünsche dir also viel Spaß und gute Unterhaltung, mit den vielen Fettnäpfchen, die das Leben bis heute noch für mich aufstellt. Für den Kloß im Hals, für den bisweilen sarkastische Anwandlungen womöglich mal sorgen, bitte ich um Entschuldigung. Das ‚Abgeklärt-Sein‘ des Alters hat mich bisher halt noch nicht ereilt. Aber ich versichere dir, dass die meisten Geschichten lustig sind, oder nur ein kleines bisschen böse. Na ja, manchmal auch ein kleines bisschen mehr.
Wenn dir dieser zweite Band zufällig als erstes in die Hände gefallen ist, keine Sorge, die meisten Geschichten verstehen sich von selbst. Aus dem Alltag, wie viele ihn kennen, mit notorischem Geld- und Zeitmangel, 48 Stunden Arbeit in 24 hinein quetschen mit Haushalt, Mann, Kind, Job und den Missverständnissen und Verstrickungen, mit denen das Schicksal uns zuweilen ein Bein stellt. Aber gut, wenn wir danach wieder aufstehen, das Krönchen richten und weitermachen.
Hier noch einmal der Hinweis von Band I: Ich bin Jahrgang 1963, Internet und Handy gab’s fast 30 Jahre meines Lebens nicht. Zum Verständnis mancher Geschichten. Da fällt mir gerade ein, dass auf dem Speicher noch alte Straßenkarten und Atlanten verstauben, die könnte ich mal in die Kita zum Verbasteln mitnehmen. Und den Kindern erklären, dass die noch aus der Zeit stammen, als die Gummistiefel noch aus Holz waren...
Es grüßt dich herzlich,
Sylvi Amthor
Bieza Pig Cola
Wir Franken sind ein lustigeres Völkchen, als es manchmal den Anschein hat. Zugegeben, Fremden gegenüber sind wir eher wortkarg. Auch mit dem Loben haben wir’s nicht so: „Ni:eß gschend, is genuch geloubt“ (Nichts geschimpft ist genug gelobt). Aber wir haben ein weiches Herz, was sich gerne mal in unserer Aussprache widerspiegelt. Wer braucht denn scharfe Luft und womöglich noch Feuchtigkeit produzierende Konsonanten wie ‚p‘ und ‚t‘ und ‚k‘, wenn man mit ‚d‘, ‚b’ und ‚g‘ auch weiß, was gemeint ist.
Wann hat man als Mutter junger Kinder Gelegenheit, mal ganz alleine Urlaub zu machen? Eher selten. Wann könnte man ihn gut gebrauchen? Eher öfter. Das ist ein Dilemma. Ähnlich verhält es sich mit den Finanzen. Was kostet ein schöner Urlaub? Viel Geld. Wieviel davon hat man dafür zur Verfügung? Eher weniger.
Ich rückte diesem Umstand eines Tages zu Leibe, nach ein paar besonders anstrengenden Wochen. Mia weigerte sich plötzlich, in die Schule zu gehen, weil Alfi, der ‚brave Bub‘ aus dem ersten Band, auf dem Schulweg den großen Mann markierte. Markus frönte zu der Zeit intensiv seinem Modellbau-Hobby, so dass sich dauerhaft halbfertige, nach Kleber stinkende Modelle auf unserem Wohnzimmertisch ausbreiteten. Mein Oberchef im Supermarkt, in dem ich momentan jobbe, raunzte uns kleine Auffüller bei jeder sich bietenden Gelegenheit an; schlecht gelaunt wegen Rücklauf seines Umsatzes von 400.000 auf 385.000 Euro. Und unsere Waschmaschine führte gegen uns einen heimtückischen Anschlag aus; auf unerklärliche Weise versah sie unsere Kleider mit zahlreichen, zwar im brütendheißen Juli recht praktischen, aber eher unansehnlichen Luftlöchern.
An einem Freitagnachmittag verfrachtete ich zunächst Mia zu Oma Charlotte und Opa Rudolf. Ich gab Markus, der aufgrund einer nostalgischen Anwandlung in ein Miniaturmodell eines Fliegers namens ‚Ikarus‘ am Wohnzimmertisch versunken war, einen Kuss; nicht dass er das bemerkt hätte. Dann packte ich ein paar noch unversehrte Klamotten ein und fuhr den Main entlang. Spontan hielt ich in irgendeinem schönen Dörfchen an und suchte nach dem hiesigen Gasthaus. Das Glück war mit mir, die Übernachtung kostete nur 35 Euro.
Ich ging am Main spazieren, ließ Steine darin titschern, legte Blumenmandalas auf Baumstümpfe und schlief und schrieb viel. Das tat gut. Damit hätte ich mich auch zufrieden gegeben, als mir am Sonntag beim Abendessen noch ein besonderes Highlight beschert wurde.
Der Besitzer des Gasthofs war Italiener, sein Essen war echt klasse und am Sonntagabend gönnte ich mir mehr als nur eine Pizza. Der Barbera war wohltemperiert, der Espresso heiß und stark, die Antipasti misti ein Traum aus zartem Parmaschinken mit kühler, saftiger Melone, pikant mariniertem Grillgemüse, italienischer Salami und einem Parmesan, der auf der Zunge zerging. Alles schön garniert mit frischem Feldsalat, Rucola, Tomaten, Basilikum und Oliven. Mhhm! Dass ich diese Köstlichkeit dann nicht so ganz mit der ihr gebührenden Aufmerksamkeit genießen konnte, lag am Tisch hinter mir.
Dort ließ sich nämlich eine Großfamilie nieder, bestehend aus neun oder zehn Personen im Alter von schätzungsweise 2 bis 80 Jahren. Bereits das Auswählen der Mahlzeiten diente ihnen zum regen Gedankenaustausch. Da erkundigte sich etwa ein älterer Herr nach der Wesenheit der Shrimps. Eine zarte Frauenstimme erklärte, das wären so kleine Würmer, die ein gewisser Manfred im Sportheim Ochsenfurt des Öfteren äße. Woraufhin ein weiterer Herr, anscheinend etwas unkonzentriert, wissen wollte, warum denn der Manfred um Gottes Willen Würmer äße! Die zarte Frauenstimme versuchte deutlich zu machen, dass dies keine Würmer wären, vielmehr brate ihre Chefin diese in der Pfanne mit Sahnesauce und sie wären wirklich sehr lecker. Dann wurden die Würmer ad acta gelegt und man konzentrierte sich auf die Kindermägen.
Auf der Speisekarte stieß man auf die ‚Pizza Piccola‘. Diese wurde aber von einem Herrn in echt fränkischer Manier ausgesprochen und klang zunächst wie ein großes, „Big“, und beim zweiten Versuch dann wie ein versautes Limonadengetränk auf laschem Hefeteig, also „Bieza Pig Cola“. Woraufhin auch prompt eines der Kinder fragte, ob da auch bestimmt Cola drin wäre? Man war sich darüber am Tisch nicht so ganz einig, trotzdem wurde das schweinische Ding bestellt.
Im weiteren Verlauf des Essens, „Mama, warum ist da keine Cola drin?“, wurde dann über den hartnäckigen Schnupfen eines der Sprösslinge diskutiert. Ein weiterer Herr mit sonorer Stimme stellte selbstlos seinen Kompressor zur Verfügung, den man mit einer schmalen Düse ausstatten könne. Das fetze dann so richtig durch und mache dem Schnupfen bestimmt den Garaus. Gott sei Dank war ich bei der automatischen Visualisierung des Vernommenen in meinem Kopf schon beim Espresso angelangt.
Eine Minute später konnte ich mich davon überzeugen, dass dieses Dörfchen durchaus am Puls der Zeit war, auch, was die Jugend anbelangte. Denn eines der Kinder wollte wissen, ob denn die ‚Peppa Wutz‘ schon um wäre. Und hoffte durch wiederholtes Nachfragen, den negativen Bescheid vielleicht doch noch zu einem günstigeren zu wandeln. Nach einem mehrmaligen „Mama, ist die Peppa Wutz immer noch um?“ brummte ein Herr, das könne man doch heutzutage alles „schtriemen“. Woraufhin der Ältere seine Stimme erhob und erklärte, dass er demjenigen, der bei seinen kleinen „Engelie“ Striemen verursachte, zeigen würde, „wua der Baddel den Most höült“ und der könne gerne mit seinem „Ächa-Knübbel“, der immer hinter der Haustür in Bereitschaft stünde, schmerzhafte Bekanntschaft machen, den würde er nämlich schön auf dem Rücken des Unholds tanzen lassen! Den Eichen-Knüppel vermutete ich als fränkisches Pendant des amerikanischen Baseball-Schlägers.
Ich war schon am Bezahlen, als ich den Sonorigen verwundert feststellten hörte, dass sein Räucherlachs überhaupt nicht rauche. Der Ältere murrte noch, dass seine Pasta so gar nicht wie eine Paste aussehe, eher wie Nudeln. Außerdem wären die viel zu hart. Von „al dende“ halte er gar nix, weil sich das „babbige Zeuch“ so gemein unter sein Gebiss schob.
Ich nahm schnell meine schon gepackte Tasche und verließ den Gasthof fluchtartig. Nämlich um mir draußen vor der Türe erst einmal den Bauch vor Lachen zu halten und die Tränen von der Backe zu wischen. Am liebsten wäre ich noch einmal hineingegangen und hätte die fidele Truppe gefragt: „Kann man euch buchen?“
Rundum zufrieden stieg ich in unsere alte Karre. Ich hatte nicht nur ein erholsames Wochenende gehabt, sondern auch gut gegessen wie selten und zum Schluss noch einmal herzhaft gelacht, wie lange nicht mehr. Und hatte Stoff bekommen für eine neue Geschichte.
Neues, altes Haus
Ich erinnere mich noch gut an jenen Tag, im März 2004. Nicht, dass ich sonst so fit bin mit Daten und Zahlen. Geburtstagswünsche an meine Lieben kommen auch mal erst nach einer Woche an. Mit einer zwar ehrlich gemeinten, zerknirschten, aber beinahe schon obligatorischen Entschuldigung. Meine Handynummer ist schon fast so alt wie Methusalem, aber ich kann sie immer noch nicht auswendig, ebensowenig mein Autokennzeichen. Wenn ich umziehe, muss ich mir meine neue Adresse griffbereit notieren; diese verdammten Postleitzahlen sind so gar nicht meins.
Doch im März 2004 geschah so Denkwürdiges im Leben meiner kleinen Familie, dass dieser Zeitpunkt sogar in meinem eher kläglichen Daten-Gedächtnis Fuß gefasst hat.
Ein Spaziergang in das schöne Tal mit seinen hohen Fichten und glitzernden Birken in unserem kleinen Vorort bei Würzburg war heute ein Muss. Nach dem langen, grau-nassen Winter gingen wir drei uns in unserer kleinen Wohnung mittlerweile gehörig auf die Nerven. Doch jetzt im Frühling würde das besser werden.
Wieder zuhause, gestärkt von der frischen Märzluft, zog ich Jacke und Boots aus, schlüpfte in meine Hausschuhe und kickte die Bestandteile des Kegelspiels beiseite, das Mia und Markus heute morgen unbedingt spielen mussten, noch vor Schule und Arbeit. Auch wenn dafür nur fünf Minuten Zeit gewesen war. Dann bemerkte ich, dass der Anrufbeantworter blinkte. Oma Charlie:
„Ruf sofort an. Es ist nichts passiert, aber es ist dringend.“
Meine Alarmglocken schlugen an. Oma Charlie fand es nicht einmal dringend, als sie vor einiger Zeit einen schlimmen Herzanfall hatte. Ich drückte die Rückruftaste. Als ich mich meldete, bekam ich jedoch kein ‚Hallo‘ oder ‚Wie geht’s‘, sondern: „Ich geb’ dich an Opa weiter.“
Was, zum Teufel, war da los? Doch auch Opa Rudolf kam gleich zur Sache: „Willst du ein Haus?“
Wie bitte? Ich musste mich erst einmal setzen. Hätte er mich gefragt, ob ich ein Flugzeug wolle, wäre ich nicht überraschter gewesen. In anderen Familien mit monetärer Fülle mochten solche Dinge vielleicht an der Tagesordnung sein. Doch als einfacher Handwerker und Hausfrau mussten meine Eltern froh sein, ihr eigenes Haus finanzieren zu können.
„Opa, was ist los? Welches Haus, wieso, weshalb und vor allem warum?“
Es stellte sich heraus, dass es sich um das Haus neben Opas eigenem handelte. Es hatte einmal meinem Onkel gehört; die beiden Männer hatten ihre Häuser Ende der 50er zusammen hochgezogen. Ich war als Kind sehr gerne dort drüben gewesen. Im Laufe der Jahre war es durch verschiedene Hände gegangen und hatte darunter ein wenig gelitten. Jetzt sollte es erneut veräußert werden und Opa Rudolf wollte es für meine kleine Familie erstehen. Wir würden uns aber einen nicht geringen Kredit aufnehmen müssen, um es wieder bewohnbar zu machen.
Ich schluckte ein paarmal. Vor Überraschung und Freude, aber auch vor Angst. Markus war zurzeit in Kurzarbeit, ich schaffte neben Mia und Haushalt nur Mini-Jobs. Wie sollten wir so eine Sache stemmen? „Ich muss mit Markus darüber sprechen.“
„Es hat schon einige Interessenten gegeben. Ich rufe jetzt dort an und sage fest für euch zu.“
Au weh. Opa Rudolf hatte sich in die Sache bereits verbissen. Ich kannte das, diesen Zug hatte ich von ihm geerbt.
„Aber...“
„Nichts aber. Absagen kannst du immer noch. Ich rufe da jetzt sofort an, dass ihr das Haus nehmen werdet, verstanden?“
„Ja, Papa“, sagte ich folgsam, trotz meines gestandenen Alters. Dann legte ich auf und starrte ins Nichts. Ich hatte eben mal schnell ein Haus erstanden.
„Ja, sag mal, spinnst du?“
Schuldbewusst zog ich den Kopf ein. Markus’ Reaktion war mehr als berechtigt.
Mein Gatte tigerte aufgebracht im Wohnzimmer auf und ab. „Du weißt schon, dass meine Firma bald pleite macht?“
Ich nickte auf diese eher rhetorische Frage. Markus bewarb sich schon seit einigen Wochen bei anderen Firmen.
„Und dass du dir dann einen Ganztagsjob suchen musst?“
Ich nickte erneut.
„Und dass wir dann in einem der Kuhkäffer hocken, aus denen wir als Kinder unbedingt heraus wollten?“
Ich seufzte. Meine Sturm- und Drangzeit war längst vorüber. Nach dem denkwürdigen Anruf von Opa Rudolf hatten sich heute den ganzen Tag lang Bilder von Gemüsebeeten, einer schönen Terrasse mit Topfpflanzen, Rasen und Obstbäumen und einem eigenen Kreativ-Zimmer für mich in meine Gehirnwindungen geschlichen.
„Was ist denn los?“ Markus’ lautstarke Empörung hatte Mia angelockt.
„Deine Mutter hat heute ein Haus gekauft.“
Ich hob den Zeigefinger. „Also eigentlich bekommen wir es von Opa Rudolf geschenkt...“ „Bekämen“, verbesserte ich mich schnell. Um meinen beiden Lieben die Illusion einer Option zu lassen.
„Was?“ Mias Augen weiteten sich. „Aber ich will nicht weg von hier!“
Ich zog mein Kind in die Arme. Ich verstand sie, war sie doch vor einem halben Jahr erst hier in die Schule gekommen. Und Veränderungen mochte Mia noch weniger als ihr Vater. „Es wäre direkt neben Oma und Opa. Du könntest sie jeden Tag besuchen. Und wir hätten einen eigenen Garten und Platz für ein Haustier...“
Mia richtete sich auf. „Könnte ich dann auch ein Häschen haben? Oder zwei?“
Markus stöhnte auf, griff sich an die Stirn und ging in die Küche. Er holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank; wir hörten das Ploppen, als er den Deckel abmachte.
Ich strich Mia übers Haar. „Platz genug für einen Hasenstall hätten wir dort auf jeden Fall“, sagte ich vage. Ich wollte nicht schon wieder etwas ohne Markus versprechen. Sonst hätte ich zwar demnächst ein Haus, aber vielleicht keinen Mann mehr.
„Okay.“ Mia sprang von meinem Schoß auf und hüpfte in ihr Zimmer. Dabei sang sie: „Wir haben bald ein Ha – aus, und auch einen Gar – ten, da spielen drin zwei Häs – chen...“
Aus der Küche vernahm ich ein noch lauteres Stöhnen und kurz darauf noch einmal das Ploppen eines Bierdeckels. Ich stand auf und ging zu meinem Mann. Mit gesenktem Kopf und verschränkten Armen lehnte er am Sideboard, zwei Bierflaschen standen oben drauf. Ich lehnte mich daneben, legte den Arm um ihn und schwieg. Ich hatte für heute genug angerichtet.
Nach einer Weile hob Markus den Kopf, blickte zum Fenster hinaus und brummte: „Ich wollte schon immer mal einen richtigen Grill. Nicht die kleinen, ledschigen Dinger vom Baumarkt für den Balkon. Einen richtig großen für eine Terrasse, vielleicht so einen mit Lavasteinen. Oder einen dieser neuen Smoker...“
Ich schmiegte meinen Kopf an seine Schulter und drückte ihn fest. Wie schön, dass wir noch Träume haben konnten.
Unglaubwürdig? Zu viel künstliche Spannung hineingedichtet? Von wegen. Wer mich und meine Familie kennt, weiß, dass das damals wirklich so war!
Es geht um die Wurst
Markus und ich sprachen am Abend noch einmal ausführlich über Opa Rudolfs Angebot und beschlossen, es anzunehmen. Zwei Wochen später hatten wir einen Kredit und konnten beginnen, unser neues, altes Haus wieder herzurichten. Während der Renovierung fand Opa Rudolf eine wunderbare Gelegenheit, der Gemüse- und Apfelplage in Band I, mit der er uns jedes Jahr ‚beglückte‘, eine weitere hinzuzufügen: Es handelte sich um die Wurst.
Es mussten täglich etliche Leute auf unserer Baustelle versorgt werden. Von Ende März bis Mitte August fuhr Markus – er war gerade arbeitslos geworden – täglich nach Neuendorf. Opa Lorenz, Markus’ Vater, der sich als Maler und Tapezierer im Ruhestand für Wände und Türen zuständig fühlte, war ebenfalls jeden Tag da. Mia und ich beehrten unseren Neuerwerb meistens mittwochs und an den Wochenenden. Von April bis Juli kam dann mehrmals die Woche noch Christian, der Heizungsbauer und in sporadischen Blöcken unser Freund Phillip, der Elektriker. Opa Rudolf und Oma Charlie boten sich an, unter der Woche für das leibliche Wohl aller zu sorgen. Leichtsinnigerweise, und ich gebe zu auch bequemerweise, sagte ich zu und öffnete damit Opa Rudolf Tür und Tor für seine Wurstbrötchen.
Zwei- bis dreimal jeden Tag, jede Woche, jeden Monat: Wurstbrötchen. Mit Aufschnitt. Zwar abwechselnd garniert mit Essiggürkchen, Eiern und eingelegten Paprikastreifen, aber Wurstbrötchen. Wurstbrötchen am Morgen, Wurstbrötchen am Mittag, Wurstbrötchen am Abend. Wurstbrötchen zum Abwinken.
Lorenz nahm in den ersten zwei Wochen drei Kilo zu und beschränkte darauf seine Wurstbrötchenration auf ein halbes pro Tag, um Opa Rudolf nicht zu kränken. Markus, der unter der Wurst keine Butter mochte, verweigerte die Wurstbrötchen ohne Rücksicht auf Verluste schon am dritten Tag. Christian, der sehr höflich war, aß von jeder Platte zwei Wurstbrötchen und beeilte sich ansonsten sehr, mit seiner Arbeit fertig zu werden. Phillip, der Beneidenswerte, war Vegetarier – „So was gibt’s auch, dass einer keine Wurst nicht isst?“ – und las die Wurstscheiben feinsäuberlich von den Brötchen herunter. Mia popelte von den Wurstbrötchen alles außer Gelbwurst herunter und ich erfand – eingedenk Markus’ Apfelallergie – brillanterweise eine Wurst-Unverträglichkeit und murmelte etwas von schädlichem Glutamat und Pökelsalzen.
Zweimal in der Woche kaufte Opa Rudolf drei Pfund Aufschnitt. „Weil man ja nie weiß, wer alles kommt“ und „Weil sie sich ja nicht so lange hält“, die Wurst.
Hier sollte ich vielleicht gerechterweise einräumen, dass Opa Rudolf normalerweise alles andere als verschwenderisch war. Ganz im Gegenteil. Er war einer der sparsamsten Menschen, die ich kannte. Es war vielmehr eine etwas eigentümliche Denkweise, die ihn zu solchen Handlungen trieb. Wenn jemand „Nein, danke“ sagte, dann traute er sich seiner Ansicht nach vielleicht nicht „Ja, bitte“ zu sagen. Und wer äußerte, dass er bitte nur EIN Brötchen mochte, würde bestimmt mindestens drei essen. Auf meine Anregung hin, die Leute einfach zu fragen, ob und wie viel sie essen mochten, antwortete er pikiert: „Fragen tut man nur einen Kranken.“ Der Sinn dieser Aussage blieb mir gänzlich verschlossen. Weiterhin musste, wenn alle schon pappsatt waren, mindestens noch die Hälfte übrig bleiben. Sonst hätte man ja als geizig gelten und im Dorf ‚ausgebracht’ werden können. Übrigens hat meine Schwester Aurora diesen Zug geerbt und auf Kuchen übertragen. Zum Kaffeekränzchen gibt es bei ihr stets so viel Kuchen, dass jeder noch eine Portion für den nächsten Tag mitnehmen kann. Und muss, das ist Ehrensache! Doch zurück zur Wurst.
Von den bereits erwähnten drei Pfund halbwöchentlich wurde etwa ein halbes gegessen. Den Rest musste Oma Charlie einfrieren, den gab es in Form von überbackenen Wurstnudeln einmal pro Woche im Hause Amthor. Obwohl Opa Rudolf nach einigen Wochen die Wurstnudeln zum Hals heraushingen, kam er nicht auf die Idee, dass es uns anderen mit der Wurst genauso gehen könnte!
Markus und ich rechneten kürzlich aus, wie viel Aufschnitt Oma Charlie mittlerweile in ihrer Gefriertruhe haben musste: von insgesamt sechs Pfund Wurst die Woche wurde zirka eines gegessen, eines verwurstelt zu Wurstnudeln, das machte nach Adam Riese vier Pfund übrig. Seit März mussten die sich auf 70 Pfund summiert haben! 70 Pfund Wurst! 35 Kilo! Jetzt wusste ich auch, warum Opa Rudolf im Juni eine weitere Gefriertruhe gekauft hatte! Oma Charlie schwieg dazu. Ich wusste, dass sie niemals etwas wegwarf und es hätte mich brennend interessiert, was sie mit den 35 Kilo Wurst anstellte. Es war mir allerdings in letzter Zeit aufgefallen, dass genau zu der Zeit von Opa Rudolfs Mittagsschläfchen auffallend viele Katzen im Garten umher stromerten.
Für das Helferfest gegen Ende wurden dann auch dezent Vorschläge an mich herangetragen, wie „vegetarischer Abend“ oder „bloß nicht Würste grillen, eher italienische Küche mit eingelegtem Gemüse, Salaten und Spaghetti Napoli oder Penne aglio et olio“. Samstags, wo ich für die Versorgung zuständig war, musste ich mir regelmäßig auf flehentliche Bitten unserer Helfer etwas ausdenken, das auch nicht im Entferntesten etwas mit Wurst zu tun hatte. Ebenso regelmäßig musste ich mir aber auch von Opa Rudolf anhören, dass „Eiersändwitschis“ und Tomaten-Mozarella-Brötchen nichts Gescheites für schwer arbeitende Männer wären und diese wahrscheinlich heilfroh wären, wenn sie montags ihre Wurstbrötchen wieder kriegten!
Aber getreu der Weisheit ‚Es ist nichts so blöd, dass es nicht auch für etwas gut ist’, hatte auch die Wurstplage etwas für sich: Wenn sich Oma Charlie – wie, muss man nicht wissen – der Wurst entledigt hatte, kriegten Markus und ich die neue Kühltruhe.
Opa Rudolf hatte nämlich kürzlich verkündet, dass „... man ja wieder mal eine halbe Sau kaufen kann, jetzt, wo die Kinder bald da sind und die neue Kühltruhe auch“, woraufhin Oma Charlie geistesgegenwärtig dieselbe als Einzugsgeschenk deklariert hatte. Weil die wäre ja nun schon mal da und so hätte man gewissermaßen was gespart. Opa Rudolf war’s nach kurzer Überlegung recht so. Denn fürs Sparen hatte er immer ein offenes Ohr. Außer, wenn es um die Wurst ging.
Dutsie dutsie duu
Klammer auf: Man bedenke bitte, dass sich diese Geschichte hier 2004 abspielte und wundere sich nicht über Dinge, die heute so ganz anders sind. Zum Beispiel nach Orten im Handy zu googeln, war noch nicht drin. Klammer zu.
Unsere Beziehungen sind, falls sie andauern, Veränderungen unterworfen, das ist normal. Am deutlichsten sieht man das an der längsten Beziehung, die wir im Allgemeinen haben, der zu unseren Eltern. Erst ist man das Kind, das versorgt werden muss, später dann selbst Vater oder Mutter, wird aber immer noch mit Erfahrungswissen und hoffentlich mit Babysitting bedacht. Irgendwann wechselt das, das ist der Lauf des Lebens. Dann sind wir es, die unsere Eltern betreuen und betüddeln. Etwa wenn der Vater, der jetzt Opa heißt, nur mehr noch mit 60 Stundenkilometern auf der Landstraße herumgurkt und Oma die Bürste in den Brotkorb, das Brot aber in den Putzschrank stellt. Allerdings gibt es auch manchmal kuriose Zwischenstadien.
Ich freute mich wirklich sehr auf unser neues, altes Haus. Es war mir auch klar, dass noch viel daran gemacht werden musste, bevor wir einziehen konnten. Auch, dass das Dorfleben Nachteile hatte. Zum Beispiel würde ich den Nachbarn Bescheid sagen müssen, bevor ich das erste Mal Taiji im Garten machte. Sonst lief ich vielleicht Gefahr, dass sie den Krankenwagen holten mit den Männern mit den weißen Kitteln. Keineswegs gefasst aber war ich darauf, dass Opa Rudolf mich in höchste Verwirrung versetzen würde.
Als ich von zuhause ausgezogen war, war ich siebzehn gewesen, nun war ich 40. Bei den Besuchen in den letzten Jahren war das Verhältnis zu meinen Eltern ganz klar definiert. Ich war nun selbst Mama, Ehefrau, Hausfrau und Erzieherin und damit irgendwie ebenbürtig. Nie hätte ich damit gerechnet, dass das einmal ganz anders werden würde.
Die ersten Anzeichen traten auf, als wir unseren Rasen mähen mussten, damit er durch die Materialtransporte nicht Schaden litt. Als Markus dies tat, erklärte Opa Rudolf ihm den Rasenmäher in zwei, drei Sätzen und begab sich dann wieder ins Haus. Als ich an der Reihe war, setzte er zu einem halbstündigen Vortrag an, blieb dann angespannt am Rand des Rasens stehen und beäugte scharf jeden Handgriff, den ich tat. Ich tat das als Relikt der typischen Vater-Ängstlichkeit ab. Verbunden mit der Frauen-und-Technik-Sache seiner Generation und schmunzelte darüber.
Bald schmunzelte ich jedoch nicht mehr. Denn im Haus wurde mir eine nicht sehr attraktive Rolle zugeteilt. Sie beschränkte sich auf Kaffeekochen und Brotzeit machen für die schwer schuftenden Männer, Kehren und Schutt wegschaffen, was das Zeug hielt, Mia und ihre Freunde betreuen und auf Handlangerdienste für Werkzeug und Utensilien. Und ich war der Informationsbote von einem zum anderen. Als ich mich einmal beschwerte, durfte ich ein Schlitzchen für ein Kabel in eine Mauer schlagen. Eines! Ich muss sagen, ich fand es genauso hübsch wie die anderen. Schade, dass es wieder zugemacht werden musste.
Ich fügte mich, mit dem Gedanken, dass dies eine absehbare Zeit wäre. Ich konnte ja nicht ahnen, dass meine Fügsamkeit auf eine verdammt harte Probe gestellt werden würde...
.
An einem Tag bat mich Markus, doch bitte ein Geschäft ausfindig zu machen, das Nageldübel führte, ohne die er mit der Arbeit nicht weiterkam. Ich machte den fatalen Fehler, Opa Rudolf danach zu fragen.
„Der Müller in Hammelburg könnte die haben. Oder der
Obi.“
„Dann fahre ich erst einmal zum Obi.“
„Aber die haben nicht immer jede Größe!“
„Na, dann rufe ich dort erst mal an.“
„Da kann man nicht anrufen.“
„???“
„Außerdem findest du den Obi nicht.“
„Du erklärst mir bestimmt, wo er ist.“
„Das ist zu kompliziert, das findest du nicht.“
Ich fand es vor allem an der Zeit, meinen Vater über meine Ortsfindungs-Qualitäten aufzuklären: „Papa, wir wohnen in dem wesentlich größeren Würzburg und ich fahre da überall hin. Außerdem habe ich meine Freundin Leonie schon jedes Mal in München aufgestöbert, obwohl sie dort schon fünf Mal umgezogen ist.“ Ich verzichtete darauf, ihn damit zu konfrontieren, dass seine eigenen Fahrten sich mittlerweile auf die nächste, sechs Kilometer entfernte Kleinstadt beschränkten. Und dreimal im Jahr nach Würzburg. „Ich finde den Obi, glaub mir.“
Er war anscheinend nicht zu überzeugen: „Da brauchst du ewig. Ich fahre dich.“
Mein trotz der Verwirrungsversuche meines Vaters noch einigermaßen funktionierender Verstand sagte mir, dass es eigentlich Unsinn war, wenn wir zu zweit fuhren. Wenn er unbedingt fahren wollte, gerne. Aber dann hätte ich in der Zwischenzeit etwas anderes machen können. Doch ich fügte mich. Er half uns so viel, da durfte er auch ein paar Marotten ausleben.
Vater verkündete, dass er sich erst noch umziehen müsse. Ich wartete also, bis er umgezogen war. Dann sagte er, er müsse Markus fragen, ob wir noch Kartuschen mit grauem Silikon hätten. Und nachschauen, ob er selbst noch etwas brauchte. Ich angelte nach meiner Handtasche, setzte mich ins Auto und las Zeitung.
Nach einer Weile trat Vater zu mir und bedeutete mir, das Fenster herunter zu lassen. Ich ließ herunter.
„Gib mir deine Tasche und frage Markus, ob Lorenz vielleicht noch weißes Acryl braucht.“
Ich wurde immer verwirrter. Wieso hatte Vater nicht selbst gefragt? Und weshalb wollte er meine Tasche haben? Nicht denken, mahnte ich mich, einfach machen