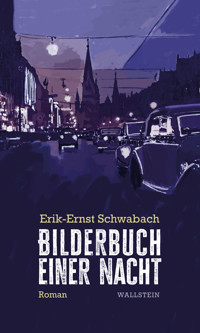
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Sensation: Im Nachlass von Erik-Ernst Schwabach entdeckt. Ein virtuoser Großstadtroman aus den 1920er-Jahren. Eine Herbstnacht in einer Großstadt – es könnte Berlin sein – in den 1920er-Jahren: Erik-Ernst Schwabachs Protagonisten haben eines gemeinsam. Sie alle sind in dieser Nacht auf der Suche nach Anerkennung, Liebe, Sex, gesellschaftlichem Aufstieg und natürlich Geld: der junge, frisch verheiratete Arzt, der auf einer Gesellschaft in einer Bankiersvilla beinahe zu einem Seitensprung verführt wird; der mittellose Arbeiter, der sich zur Mitwirkung an einem Einbruch überreden lässt; die Hausfrau, die ohne Wissen ihres Mannes anschaffen geht; die Barmädchen im Café Budapest oder in der Kolibri Bar; die Bordellbesitzerin, die als »Baronin« firmiert; die Schauspielerin und der aufstrebende Dichter. Was und wie Ihnen geschieht, erzählt Schwabach in kunstvoll mal mehr, mal weniger lose miteinander verknüpften Episoden. Das »Bilderbuch einer Nacht« kann sich durchaus messen mit den bekannten Großstadtromanen eines John Dos Passos oder Alfred Döblin. Mit knappen markanten Sätzen, oft im inneren Monolog gehalten und mit Einschüben, Gedankensplittern und kurzen stakkatohaften Beschreibungen versetzt, oszilliert der Roman zwischen Expressionismus und magischem Realismus. Virtuos spielend mit all den Klischees der 20er Jahre schafft Schwabach eine Atmosphäre, der man sich nicht entziehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erik-Ernst Schwabach
Bilderbuch einer Nacht
Roman
Herausgegeben
und mit einem Nachwort
von Peter Widlok
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2025
www.wallstein-verlag.de
Wallstein Verlag GmbH, Geiststr. 11, 37073 Göttingen
Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com)
unter Verwendung eines Porträts von Ernst Sandau:
Erik-Ernst Schwabach, um 1913, Familiennachlass.
ISBN (Print) 978-3-8353-5878-2
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8915-1
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8916-8
Inhalt
Einholen
Merz und Larssen, Coiffeure
Visite
Tischordnung
Omnibus
Stundenliebe
Das Abendkleid
Die beiden Barone
P. p. c.
Moroses Intermezzo
Einzug der Gäste
Anplauderung
Rummel
Diner I
Eva und die Schlange
Diner II
Vorort
Ring frei!
Die Wahrheit
Besuch in der Küche
Abreise
Kolibri-Bar
Patrouille
Bridge – Bücher – Bilder
Ein Loch in die Decke
Und das war Kampen
Ein Schnaps und noch einer
Schüsse
B 2 1523
Operation
Himbeerwasser
Der Baron und die Dame.
Unverhofft kommt oft
Polizei
Heimweg durch die Nacht.
Margot Schmalz.
Betten
Die Träne
Sonntags morgens ganz früh
Peter Widlok: Erik-Ernst Schwabach – ein Vergessener der Literaturgeschichte
Editorische Notiz
Bildnachweis
»Hol’s der Teufel«, sagte mein Freund.
»Komm, wir gehen ein Stück.«
Sherwood Anderson
Es ist der 20. Oktober 193 . ., gegen sechs Uhr nachmittags. Tagsüber hat das Wetter der meteorologischen Voraussage entsprochen: bewölkt, frische nordöstliche Winde, ziemlich kühl, keine nennenswerten Niederschläge. Aber jetzt beginnt es doch zu regnen.
Draußen auf dem Lande mag der Bauer, der eben im Hof seine Pferde abschirrt, noch in ein letztes abendliches Dämmerlicht schauen. Aber hier in der Stadt, wo die Geschäfte bereits ihre Auslagen beleuchtet haben, aus den unendlichen Fenstern die Gaskronen und elektrischen Birnen ihren Schein auf Gassen und Höfe werfen, auf der Straße die Bogenlampen und Kandelaber entzündet sind, die Lichtreklamen spielen, die Gefährte mit brennenden Scheinwerfern und Laternen fahren, haben all diese künstlichen Lichter längst den letzten Abglanz des Tages gefressen: Hier hat schon die Nacht begonnen, diese Oktobernacht, die zu durchstreifen ich aufbreche.
Ich werde diese Nacht ohne Plan durchstreifen, kreuz und quer, ohne nach den Straßenschildern zu schauen; ich werde es ganz dem Zufall überlassen, ob ich geradeaus gehe, ob ich in eine Seitengasse einbiege, in welche Häuser, Läden, Wohnungen ich trete, unter welche Menschen ich mich mischen und welche Bekanntschaften ich schließen werde, Bekanntschaften für diese eine Nacht nur, die am Morgen mit dem kommenden Tag wieder verblassen mögen wie die Projektionen auf einer Kinoleinwand, wenn es wieder hell im Saale wird.
Ich weiß nicht, worauf ich stoßen werde, wenn ich das Bilderbuch dieser Nacht durchblättere; möglicherweise auf Schicksale, die sich eben bedeutsam kreuzen, auf andre, die sich eben vollenden, und wieder andre, die in dieser Nacht eben erst beginnen – wie soll ich es vorher wissen? Denn diese Nacht ist ja keine besondere Nacht; es ist nur eine ganz beliebige Nacht unter den vielen Tausenden von Nächten, die sich an die Tage unseres Lebens anreihen und von denen wir die meisten verschlafen. Darum ist es sehr leicht möglich, daß in jeder anderen Nacht mehr geschehen ist, in jeder anderen Nacht mehr geschehen wird als gerade in der heutigen; daß der gleiche Zufall, der mich in ein Haus, in eine Wohnung führt, mich gerade das Nebenhaus oder die Nachbarwohnung verfehlen läßt, in der sich einzig das begibt, was in dieser Nacht wirklich einer Aufzeichnung wert gewesen wäre. Aber ich kann nichts anderes tun als mich treiben lassen und im Grunde kann kein Mensch mehr tun sein lebelang.
Ich schlage die erste Seite des Bilderbuches auf: des Bilderbuches der Nacht vom 20. bis 21. Oktober 193. . Jetzt ist es schon sechs Uhr vorbei und draußen ganz dunkel. Ich sagte wohl schon, daß es zu regnen begonnen hat.
Einholen.
Ja! Der Regen fällt ganz fein. Die Rinden der längst entlaubten Bäume, die die Straßen säumen, glänzen matt im Widerschein der Laternen. Frau Ilse sieht aus dem Fenster ihrer Wohnung, wie Bürgersteig und Damm feucht schimmern und die Frauen mit aufgespannten Schirmen gehen. Sie entschließt sich daher, ihre hohen Gummigaloschen überzuziehen. Das wäre an sich überflüssig; denn der Regen ist bis jetzt kaum mehr als ein Nieseln, ein fallender Nebel; und sie hat keinen langen Weg zu machen; aber Ilse trägt diese Russenstiefel gern; sie glaubt nämlich, zu starke Beine zu haben. In Wahrheit sind es die wohlgestalteten kräftigen Beine eines großen und kräftigen Mädchens, das in seiner Kindheit barfuß über die Äcker gelaufen ist, Ähren gesammelt und Kartoffeln geklaubt hat; Seidenstrümpfe freilich und Eidechsenschuhe sind für überzüchtetere Fesseln gedacht.
Ilse also zieht die Galoschen an, den hellen Regenmantel; sie setzt die dunkle Kappe auf und ergreift die große schweinslederne Einkaufstasche, die ihr Mann ihr zum Geburtstag geschenkt hat; bis vor wenigen Minuten hat sie ihr Abendkleid aufgebügelt; jetzt muß sie noch die Lebensmittel zum morgigen Sonntag besorgen. Im Schlächterladen, ihrer Wohnung grad gegenüber, verlangt sie Hammelkoteletts; sie ißt sie nicht gern; aber Peter mag sie; und überdies hat sie in der Speisekammer noch eine Büchse grüner Bohnen zu stehen. Es ist wundervoll hell in der Schlächterei; die Wände sind mit blinkenden Fliesen ausgelegt; und während der Metzger mit seinem breiten Beil die Koteletten vom Stück abtrennt, betrachtet Ilse die Tierleiber, die im Hintergrund des Geschäftes an großen Haken von einer Stange herabhängen. Das Fleisch leuchtet satt, tief und bläulich rot; auf der matt-fahlen Außenhaut in der Nähe der verbogenen Schwanzstummel sitzen die lilafarbenen Schlachthaus-Stempel wie auf einem amtlichen Aktenstück. »Ich möchte«, denkt Ilse, »einmal einen ganz großen Braten einkaufen können; oder am liebsten« - das ist noch ein Kindertraum aus dem Märchenbuch – »einmal dabei sein, wenn ein ganzer Ochse am Spieß gebraten wird.«
Klatschend wirft der Schlächter die Koteletten auf einen Bogen Pergamentpapier, den er vorher auf die Platte seiner Waage ausgebreitet hat, deren Nadel mit der roten Spitze sich zitternd in Bewegung setzt: »Etwas über ein Pfund«; mit der Andeutung eines Fragezeichens in der Stimme: »1,56 . .?«, und abschließend: »Sonst noch Wünsche, Frau Doktor?«
Eigentlich wollte Ilse für das morgige Abendbrot von hier gleich noch ein halbes Pfund gemischten Aufschnitt mitnehmen; aber jetzt beschließt sie, es lieber im Feinkostladen zu kaufen. »Danke! Das wäre alles«, antwortet sie und nimmt den Kassenzettel entgegen. Beim Zahlen bemerkt sie, daß sie weniger Geld im Portemonnaie hat, als sie eigentlich noch zu haben glaubte; und dann fällt ihr ein, daß sie am Morgen die Gasrechnung bezahlen mußte. Sie steckt das Wechselgeld ein, legt das Paket in ihre Tasche und verläßt den Laden.
Es liegt zwar eine kleine, recht gute Feinkosthandlung in unmittelbarer Nähe, aber Ilse fühlt sich zu dem großen Delikatessengeschäft in der Hauptstraße hingezogen: Es ist ein so prächtiger Laden und »nur um ein paar Pfennige teurer«.
Es dauert lange, bis sie es wagt, den Damm zu überschreiten. Aber an Regentagen, wenn der Asphalt die Laternen und die Scheinwerfer der Autos widerspiegelt, fühlt sie sich von all diesen flirrenden, tanzenden, blendenden Lichtern immer wieder so verwirrt und eingeschüchtert wie vor Jahren, als sie zum ersten Mal in die Hauptstadt gekommen war, sechzehnjährig, unbeholfen, und die Erfüllung ihres Landmädchenwunsches, in der Stadt zu sein, mit angstvoller Verlorenheit und unendlicher Müdigkeit bezahlte: kleine Warenhausverkäuferin. Bis – ein heißes Glücksgefühl durchströmt sie, wenn sie daran zurückdenkt – bis dann Peter gekommen ist.
Endlich kreuzt sie die Straße, sie atmet auf, als sie auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig angelangt ist; und gleich bleibt sie vor der verlockenden Auslage eines Orientbazars stehen. Immer wieder liebäugelt sie mit einem schwarzen gold und silber bestickten japanischen Kimono: Der Preis ist angeheftet: 32,–. Sicher würde Peter ihn ihr zu Weihnachten schenken; Peter ist ein großer Verschwender, wenn er ihr eine Freude mit einem Geschenk machen kann; aber sie wagt es nicht, ihm diesen Wunsch anzuvertrauen. Sie hat einmal der Versuchung nicht widerstehen können, in diesem Laden aus ihrer persönlichen Sparbüchse eine schwarz-goldne Lackdose zu kaufen; sie mit Zigaretten zu füllen und Peter auf den Schreibtisch zu stellen. Erst schien er sich sehr zu freuen; aber kaum eine Woche später war das Kästchen verschwunden, fort war es; in einen Schub verbannt.
Ilse hatte nicht weiter gefragt. Sie hatte verstanden. Ihr Kästchen gehörte zu den vielen Dingen, die Peter geschmacklos nannte und die sie darum nicht mehr hübsch finden durfte, wie Stoffpuppen oder Stoff-Hunde auf dem Sofa, die doch eigentlich sehr lustig waren. Aber Ilse fügt sich tiefgläubig Peters besserer Einsicht, auch wenn sie nicht begreift. Und so ist womöglich auch dieser herrliche Kimono abscheulich, und sie fürchtet, Peter durch diesen Wunsch zu verraten, daß sie womöglich noch immer einen schlechten Geschmack hat; denn sie liebt ihren Mann und möchte ihm nicht mißfallen. Aber es kostet sie einen tiefen Seufzer, sich von dem Schaufenster loszureißen und ihre Sehnsucht nach dem prächtigen Stück endgültig zu begraben.
Sie geht weiter, ohne sich noch vor anderen Schaufenstern aufzuhalten; sie wandelt sowieso auf verbotenen Pfaden; denn sie weiß im vorhinein, daß sie jetzt beim Einkauf mehr Geld ausgeben wird, als es der Haushaltsetat erlaubt. Ob sie lieber noch umkehrt? Aber schon betritt sie den Delikateß-Laden.
Der ist wie stets kurz vor Geschäftsschluß überfüllt: Ilse muß geraume Zeit warten, bis der junge blonde Verkäufer im schneeweißen Kittel herbeieilen wird, um sie zu bedienen. Das ist schlimm; denn infolgedessen hat sie so viel Zeit, alle die auf einer breiten Tafel ausgestellten Leckerbissen Revue passieren zu lassen. Eben läßt sich eine platinblonde Dame mit der zu ihrer Haarfarbe abgestimmten Nonchalance zwei Hummer beiseite legen. Hummer sind ebenso unerreichbare Kostbarkeiten wie die beiden Silberfüchse, die der Platinblonden um Hals und Schultern liegen und ihr bis über die Taille herabfallen: Die Sterne, die begehrt man nicht. Aber es gibt andre Leckerbissen genug, die sie zur Verschwendung verlocken: zierliche Teigschiffchen mit Gemüsemayonnaise und mit Krebsschwänzen umlegt; prangende Tomaten, deren Inneres mit feingehackten Pilzen und Artischockenböden gefüllt ist, von Spargelspitzen umrandet; bunte Salate aller Art und Namen: italienischer, russischer, griechischer, Eier- Geflügel- Fleisch- Ochsenmaul- Herings- Krabben- Kartoffelsalat; Schüsseln mit grünen und schwarzen Oliven; Terrinen mit Gänseleberpasteten und Gänseleberpasteten im Brotteig, deren Scheiben von tief braunschwarzen Trüffelstücken durchsetzt sind; Forellen in Aspik; Scheiben kalten Rheinlachses und Streifen geräucherten Lachses; glänzende Spickaale; silberne Sardellen; goldgelbe Makrelen; halbe gebratene Hähnchen; Schälchen mit Mixpickles; selbst kommune Gurken erscheinen in dieser erlesenen Umgebung als besondere Leckereien. Und die Wand entlang auf den Paneelen stehen nicht weniger verlockende Dinge: Büchsen mit kalifornischen Früchten, Flaschen mit pikanten Saucen; kleine Eimer mit Marmelade, Töpfe mit Ingwer, Konfitüren, Schokolade. »Was darf es sein, gnädige Frau?«
Ilse folgt dem Verkäufer an den Tisch, auf dem unter Glasglocken Braten und Fleischwaren zu Schaustücken gemacht worden sind. »Gekochter Schinken, gnädige Frau?« Aber der mild gesalzene Landschinken mit seiner schneeigen Fettumrahmung ist unwiderstehlich und nur etwas teurer. Und wie soll sie es über sich bringen, Schlagwurst zu verlangen, wo neben der Wurstplatte ein rosenrotes Roastbeef geradezu aufreizend aufgebaut ist. Roastbeef also, und da es so leicht austrocknet, wenn es dünn geschnitten bis zum nächsten Abend liegen muß, verlangt sie zwei dicke Scheiben; so wird aus dem benötigten Viertelpfund fast ein halbes. Eine Brüssler Traube kommt hinzu; Obst ist notwendig für Peter; und weil sie mit soviel Selbstüberwindung den Salaten widerstanden hat, belohnt sich Ilse schließlich mit einem Päckchen Feigen. Als sie zahlt, stellt sie mit Schrecken fest, daß sie fast zwei Mark mehr ausgegeben hat, als sie durfte. »Nur das eine Mal!« redet sie sich zu. »Der Monat ist zwar nicht mehr lang. Dafür bringe ichs im nächsten ein. Und wo wir heute abend eingeladen sind.« Und während sie nun schnell nach Hause eilt, um ja zur Zeit zurück zu sein, wenn Peter heimkommt, denkt sie weiter: »Wir werden eben morgen ein kleines Fest feiern. Ich ziehe den blauen Hausanzug von vorigem Weihnachten an und das Spitzenhemd, das er mir mitgebracht und das ich noch gar nicht getragen habe. Und vielleicht machen wir eine Flasche Wein auf.« Es ist freilich gar kein besonderer Anlaß für ein Fest vorhanden; aber was tut das? Wenn man sich liebt, kann man immer Feste feiern.
Als Ilse jetzt die Treppen hinaufsteigt und die Wohnungstür aufschließt, freut sie sich auf Peter, auf den morgigen Abend, auf das ganze Leben. Ilse ist glücklich.
Merz und Larssen, Coiffeure.
Herr Friedrich von Merz und Larssen, Coiffeure, onduliert die stattliche blonde Vierzigerin; Fräulein Margot hält die linke Hand der Dame auf ihrem Schoß und ist gerade dabei, ihre Fingernägel oval zu feilen: die Kundin, Frau Generaldirektor Eleanor Hellwirt, blättert mit der rechten in einem Journal. Als wohlhabende Dame ist sie mit ihrem Aussehen und auch sonst leidlich mit der Welt zufrieden.
»Recht weich, Herr Friedrich«, ordnet sie an, »recht weich. Wir sind heute abend eingeladen. Und wenn ich zu fest onduliert bin, sagt mein Mann ›Du siehst aus wie eine Schlächtersfrau, Elli!‹ sagt er dann.«
»Selbstverständlich, gnädige Frau! Ganz duftig und weich!« lächelt Herr Friedrich, dessen Schwester mit einem Schlächter verheiratet ist, im Spiegel zurück. Auch Fräulein Margot strahlt Frau Hellwirt an: »Den ganzen Tag nichts zu tun; aber natürlich sonnabends, wenn man schon nicht weiß wohin, um dreiviertel sieben erscheinen.« – »Jawohl, gnädige Frau! Im Gigli-Film war ich. Der singt ja unvergleichlich schön!«
»Nichts gegen Caruso!« schränkt die Frau Generaldirektor ein; sie liebt es nicht, wenn irgend jemand Untergeordnetes ein unumwundenes Lob ausspricht.
Der Lehrling Max, blaß, ein wenig verpickelt, eigentlich gar nicht vorhanden, tagaus, tagein damit beschäftigt, Haare wegzufegen, Becken zu reinigen, Hähne zu putzen, Shampoo anzurühren, Kaffee zu brühen und Botengänge zu machen, der Lehrling Max öffnet den Kojenvorhang spaltenweit und ruft: »Fräulein Margot, ans Telephon bitte!«
Privatgespräche im Geschäft sind den Angestellten des Salon Merz und Larssen strengstens untersagt. Bei Fräulein Margot drückt die Ehefrau ein Auge zu; oder eigentlich nicht bei Fräulein Margot, sondern bei Baron Koloman von Fidirz. Herr von Fidirz kommt seit Jahren täglich zum Rasieren und alle vierzehn Tage zur großen Bedienung; und überdies hat Herr von Fidirz schon zwei Mal in diesem Jahr Herrn Merz ein Stück Weges in seinem Auto mitgenommen, keinem gewöhnlichen Auto etwa, sondern einem Chrysler-Super. Herr von Fidirz ist nämlich selbst in der Autobranche. Er braucht am Apparat seinen Namen gar nicht erst zu nennen; jemand anderes würde es gar nicht wagen, Todesfälle ausgenommen, Fräulein Margot während der Geschäftsstunden anzuläuten; und Fräulein Weißbach, die, schwarz gefärbt und in Sünden ein wenig außer Fasson geraten, an der Kasse sitzt und das Telephon bedient, antwortet schmelzend: »Fräulein Margot? Einen Augenblick, bitte Herr Baron!« Fräulein Margot kommt und nimmt den Hörer.
Das Gespräch scheint unerfreulich zu sein. »Wenn nicht, dann nicht!« sagt die Maniküre.
Drüben erklärt der Baron: »Ich bin in erst letzter Minute eingeladen worden. Zu Waldherzens; Du weißt doch, Bankier Waldherz von der Frankfurter Bank. Geschäftlich sehr wichtige Leute; ich kann da unmöglich absagen. Wir treffen uns dafür morgen!«
»Morgen geh ich zu meinen Eltern.«
»Wohin? Zu deinen Eltern?«
»Du gestattest wohl, daß ich noch Eltern habe. Und jetzt bin ich bei einer Bedienung.« Fräulein Margot hängt ab.
»Nun?« fragt die Frau Generaldirektor leutseligen Tones, »Sicher der Freund, nicht wahr? Eine nette Verabredung für den Sonntag getroffen? Kino? Oder tanzen gehen?«
Laut und sausend läuft im gleichen Augenblick der Fönapparat an und enthebt somit Fräulein Margot der Antwort; sie lächelt der Dame still in die Augen, »alte Ziege!«, und entstöpselt das Flakon mit dem Perlmutt-Nagellack: Geruch von Azeton; und von nebenan einströmend ein unbestimmbarer Duft von Ozon und warmen Shampoo.
Fräulein Margot weiß nicht, daß die Blonde sich für die Abendgesellschaft bei Waldherzens schön machen läßt und Baron Koloman zum Tischherrn bekommen wird! Die Gedanken beider Damen kreisen um den Auto-Gentlemanagenten:
»Ich gehe fremd! Jawohl, noch heute gehe ich fremd! Das paßt mir nicht länger. Antanzen, wenn der Herr befiehlt, und brav abwarten, wenn er was Besseres vorhat. Dafür müßte einer wohl schon sehr viel reicher sein und sehr viel spendabler. Aber die Tour auf große Liebe. Und ich Idiotin fall ihm auch immer wieder drauf rein. Wahrscheinlich ist es das Ungarische! Dabei weiß ich doch, wieviel Butter der Junge auf dem Kopf hat.«
Und die andre:
»Wenn er heute abend bei Waldherzens ist und mich im Wagen nach Hause fahren sollte. Allein. Döring muß schon gegen zehn zum Zug nach Paris. Ich kann mir nicht helfen! Er hat sowas: Wahrscheinlich das Ungarische. Lilli Waldherz sagt zwar, daß er dauernd mit so kleinen Mädchen herumlaufen soll. Komische Geschmäcker haben diese Männer. Immerhin! Immerhin! Immerhin!…«
Herr Friedrich tritt zurück und betrachtet sein Werk. Er ist seit sechs Wochen mit einer kleinen hübschen Person verheiratet; es gibt augenblicklich keine störenden erotischen Probleme in seinem Leben. Heute abend kommen sein Schwager und zwei Kollegen zum Skat. »Danke sehr, gnädige Frau!« Und desgleichen Fräulein Margot: »Danke sehr, gnädige Frau!«
Fräulein Weißbach an der Kasse gibt der Frau Generaldirektor auf den 20-Mark-Schein heraus: sie läßt das Trinkgeld diskret in die Hand Herrn Friedrichs und Fräulein Margots gleiten; ebenso diskret gleitet es aus deren Hand in die Seitentasche ihrer weißen Mäntel. »Danke sehr, gnädige Frau!« Sie fühlen nicht einmal heimlich nach, wieviel es ist. Man kennt die Dame als »saft«; dreißig Pfennige pro Kopf und Nase sind das höchste der Gefühle.
Der Lehrling Max säubert eilig die Koje. In den Glasvitrinen des Ladens schimmern die bizarren, farbigen Parfümflakons, die Haarwasser-Flaschen, die Salben- und Cremetöpfchen. Herr Larssen ist mit dem Samstag-Geschäft zufrieden. Die Tür geht noch immer, Damen warten im Vorraum. »Mein Partner Merz ist natürlich schon nach Haus. Ich arbeite mich ab, und er gibt das Geld aus. Ich muß dieser Tage mal mit Emilie sprechen. Wenn der Schwiegervater fünf Mille herausrücken würde, könnte ich allein ein Geschäft aufmachen … – – –«
»Bitte sehr, die nächste Dame«, ruft Herr Friedrich. Vor neun wird die erste Runde nicht steigen können!
Fräulein Margot ist nun sowieso schon alles egal. Es riecht immer stärker nach Bayrum, Chypre und Mitsouko. »Max, brühen Sie uns noch einen Kaffee auf, aber stark!«
Visite.
Dr. Peter Paulsen beendet seine Abendvisite in der Privatklinik Geheimrat Schloßbergs, dessen Assistenzarzt er ist. Er betritt das Zimmer 19, in dem ein hoffnungsloser Fall liegt: Kaufmann Willensen; Magencarcinom. Es kann sich nur noch um ein paar Tage handeln bis zum Exitus.
Zimmer 19; ein Zimmer wie tausend andere Klinikzimmer; weißgrau in abwaschbarer Ölfarbe gestrichene Wände mit einem braunen Fries; ein bläulicher Linoleumbelag; ein weißlackiertes Bett; ein Kleiderschrank aus Kiefernholz; ein imitiert ledernes Sofa; ein lackierter metallener Nachttisch; ein ebensolcher Krankentisch; ein Sessel in der Ecke; zwei Stühle; im übrigen stehen all diese Stücke sauber auf einem neben der Tür aufgehängten Inventarverzeichnis aufgeschrieben: ebenso die stahlgestochene idyllische Phantasielandschaft im Eichenrahmen an der Wand, und die jetzt zugezogenen derben, gelblichen Leinenvorhänge vor einem Fenster, das auf einen Hof mit zwei kümmerlichen verkrüppelten Bäumen sieht; unter dem Fensterbrett ein Radiator; und alles ist mit einem unbestimmten Geruch von Betäubungs- und Desinfektionsmitteln und Eau de Cologne imprägniert.
Als Dr. Paulsen das Zimmer betritt, schaut der apathisch vor sich hin dämmernde Kranke auf. Das Licht der verhängten Nachttischlampe vertieft die Schatten in seinem schmalen Gesicht. Die eingefallenen Augen glänzen fiebrig. Flüchtig schaut Paulsen auf die Fieberkurve und stellt an ihren Zacken fest, daß die Kachexie unaufhaltsam fortschreitet. »Nun, wie geht es heute?« fragt er in ermunterndem Ton. »Wie es geht, Doktor? Besser, wie immer, wenn Sie kommen. Sonst, taxiere ich, sachte dem Ende zu.« Er richtet sich halb auf. »Hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich?«
»Aber selbstverständlich«, antwortet Dr. Paulsen und zieht sich mit dem Fuß einen Stuhl nahe ans Krankenbett heran. Gleich sieben. Um halb neun bei Waldherzens. Nach Hause. Umziehen. Kostet eine Taxe. »Was kann ich für Sie tun?«
»Es ist das so!« murmelt der Kranke. »Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Sie wissen, ich bin verheiratet; eine gute Frau; aber wie Frauen eben selbst nach siebenundzwanzigjähriger Ehe noch sind – es soll kein Vorwurf sein; immerhin …« Die Stimme des Kranken wird mit einem Mal entschlossener und fester: »Machen wir’s kurz! Ich habe eine Freundin, ein Mädchen, das bei mir im Geschäft arbeitet. Man soll das nicht! Schön! Es hat sich eben so ergeben. Und sie hat mir viel bedeutet. Sie verstehen! Ich möchte sie gern noch einmal sehen. Nun ist tagsüber meine Frau hier. Wenn es noch schlechter geht, wird sie auch des Nachts bleiben. Nicht mehr viel Zeit zu verlieren also! Könnten Sie das Mädchen anrufen, Doktor, und es richten, daß sie heute Abend auf eine halbe Stunde herkommt? Zum Adieusagen! Und ich möchte ihr einen Scheck geben. Wollte das nicht alles im Testament …–« Er unterbricht diesen Satz und fährt fort: »Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür!« Und indem er ihm vom Nachttisch einen Zettel hinreicht: »Hier ist die Telephonnummer. Es meldet sich Reiche. Fragen Sie nach Fräulein Erna Henke, bitte! Würden Sie das tun?«
»In Ordnung!« nickt der Arzt. »Ich rufe gleich an! Aber verpetzen Sie mich nicht dem Geheimrat!«
Der kranke Kaufmann lächelt erleichtert, steckt dem Arzt eine müde und heiße Hand hin; nimmt den Scherz auf: »Verpetzen Sie mich nicht. Ich halte den Mund; still wie das Grab; sehr bald im wahren Sinne des Wortes.«
»Unsinn!« knurrt Paulsen.
»Sind wir Kinder, Doktor?« fragt der Patient zurück.
Der Arzt legt aufstehend als einzige Antwort seine Hand fest auf die Schulter des Mannes im Bett. Dann will er die Morphiumspritze fertig machen. Aber der Kranke winkt ab: »Später! Wenn sie dagewesen ist! Möchte so lange klar bleiben.«
»Dann muß Ihnen die Nachtschwester die Injektion geben.«
»Das bleibt sich gleich. Hauptsache, es ist Morphium!«
Dr. Paulsen geht den kahlen Gang mit seinen weißen blanken Türen hinunter; gedämpft von irgendwoher dringt das Wimmern einer Kreißenden an sein Ohr, gewohnte Töne, die nicht bis ins Bewußtsein vorstoßen. Er kommt ins Büro; grüßt die Oberin; streift den weißen Kittel ab; nimmt am Schreibtisch Platz, der mit Rechnungsbüchern, Briefen, Drucksachen, medikamentösen Ärztemustern bedeckt ist; rückt den Telephonapparat näher; vergleicht den Zettel, den ihm der Patient gegeben hat; dreht die Nummernscheibe; horcht; das Besetztzeichen; legt ärgerlich den Hörer wieder auf; »wenn man schon eilig ist.«
»Also nichts Besonderes weiter heute abend, Frau Oberin. Nummer zwölf soll versuchen, ohne Schlafmittel auszukommen. Richtig! Bestellen Sie eine Klinikpackung Virogen. Der Geheimrat will es in Neun ausprobieren. Und ich bin heute abend eingeladen. Unter B 2.1523 zu erreichen. Bis Mitternacht etwa, denke ich. Und Schwester Martha soll später neunzehn sein M geben, wenn der Besuch fort ist.«
»Der Besuch?!« Der Ton der dicken blauweiß Gestreiften protestiert gegen solchen flagranten Verstoß gegen die Klinik-Ordnung, die Weltordnung schlechthin.
»Eine Ausnahme! Regelung einer unaufschiebbaren Familienangelegenheit«, sagt der Arzt und enthebt die Oberin der Antwort, indem er erneut den Hörer hochnimmt und die angegebene Nummer wieder wählt.
Eine hagere Frauenstimme meldet sich: »Hier Reiche.«
»Könnte ich, bitte, Fräulein Erna Henke sprechen?«
»Mal sehen, ob sie da ist. ’n Augenblick!«
Durch den Apparat dringen die unbestimmbaren Geräusche einer fremden Wohnung an sein Ohr. Mechanisch liest er einen vor ihm liegenden bläulichen dünnpapierigen Zettel: Abaneuron. Acethylbromdiacethylcarbomit. Hochwirksames Nervenberuhigungsmittel für jede Tageszeit. Ohne Beeinträchtigung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit. »Hier Erna Henke.«
»Hier Dr. Paulsen! Ich spreche im Auftrag von Herrn Willensen.«
»Herrn Willensen?« Sehr erstaunt; beunruhigt.
Er richtet seinen Auftrag aus. Drüben entsteht eine kleine Pause. Und dann fragt die Stimme unsicher: »Wie geht es ihm denn?«
»Nicht sehr gut.«
»Nicht sehr gut«, wiederholt die Stimme. »Ich esse nur fertig, und dann komme ich runter. Pardon. Nummer 13 fährt doch in die Nähe?«
»Bis beinahe vor die Tür.«
»Danke Ihnen sehr.«
Paulsen hängt zögernd ab. Erwartete er noch ein Wort von drüben, sollte er selbst noch etwas sagen? Nein! Es gab nichts mehr mitzuteilen. »Ich gehe also jetzt.« Er zieht den Mantel über, greift zum weichen grauen Hut. »Gute Nacht, Frau Oberin.«
»Gute Nacht, Herr Doktor«.
Tischordnung.
Waldherzens können in ihrem Eßzimmer sechzig Personen setzen; aber Frau Lilly zieht Einladungen im kleinen Kreise vor. Im kleinen Kreis ist es immer am behaglichsten. Man muß es nur verstehen, die Leute zu bitten, die wirklich zueinander passen. Künstler und Bankleute haben sich so viel zu sagen, Philosophen und Industrielle, Gelehrte und hohe Ministerialbeamte; kurz gesagt: Leute, die etwas bedeuten. Prominenz ist die beste Grundlage für intime Diners: »Nur daß Du diese Paulsens einladen mußtest, Walter; wie soll man mit denen eine vernünftige Tischordnung zuwege bringen?«
Walter blickt aus einem dicken Buch über Franz II. auf; außerberuflich pflegt er neben seinem chronischen Nierenleiden sein chronisches Interesse für Geschichte: »In der Klinik hat ihn mir Geheimrat Schloßberg besonders warm ans Herz gelegt. Er hält so viel von ihm. Sein Assistent. Aber hier in der Stadt sonst ohne jede Beziehungen. Bei Ihnen, hat Schloßberg gesagt, lernt er wichtige Menschen kennen. Außerdem hat mich Paulsens Vater einmal behandelt, als ich noch in unserer Essener Filiale saß.«
»Aber diese unmögliche Frau!«
»Wieso unmöglich?«
»Wieso unmöglich? Ich habe mich nach ihr erkundigt; ein Warenhaus-Fräulein; sein früheres Verhältnis; wem soll ich diese Person zu Tisch geben?«
»Sie sind zum ersten Mal bei uns im Haus; da könnte ich sie selbst … – – –«
»Du nimmst Frau von Barnegg!«
»Gewiß, Liebste! Wie Du bestimmst.«
»Ob ich sie Sven Marken gebe; er ist so oft bei uns; sozusagen Kind im Hause; nein; Marken muß die Tornow führen; der Dichter und die große Schauspielerin; die Leute sollen sich wohl bei uns fühlen; Koloman wäre natürlich ganz der richtige; aber dem muß ich Eleanor geben; sie hat mich darum gebeten, und sie kommt in das gefährliche Alter, die gute Elli; aber an seine andere Seite setz’ ich die Paulsen; so kleine Mädchen sind ja sein Geschmack; äußere Dich doch auch einmal, Walter! Was hälst Du von ihm, Barnegg? Das ginge allenfalls; und wenn er Frau Blömssen an seiner linken hat, ist er genügend geehrt; warte; ich muß das erst mal aufzeichnen.«
Lilly Waldherz geht zum Schreibtisch hinüber, nimmt ein Stück Papier und beginnt, die Tischordnung sauber aufzumalen:
HELLWIRT – HAUSFRAU – GEH. BLÖMSSEN – GERALDINE TORNOW – SVEN MARKEN – ...
Waldherz starrt in den Kamin, wo elektrisch angestrahlte Holzscheite ein Feuer vortäuschen; man muß es eben heraushaben, Räume nicht nur reich, sondern auch behaglich einzurichten; diese vereinigen beide Vorzüge; sie sind architektonisch und finanziell gut angelegt. Der Schreibtisch, an dem Frau Lilly ihre Tischordnung dichtet, ein signiertes Louis-XIV-Stück (12.000 Mk.); die Stühle, Sessel, Bergèren: Pièces uniques in der gleichen Preislage; an den Wänden, von Rampenlämpchen angeschienen, Bilder auf Namen expertisiert, die man anderswo im Baedeker mit einem Stern bezeichnet findet. (Versicherungswert 420 000). Die Bibliothek: Plein Maroquin Rouge, Dixhuitième Siècle, Estampes par Boucher, Eisen, Fragonard; Voltaire 90 Bände; Mellanges de Pièces; Voyage de Télémach; les Jardins de Versailles; Goethe, Ausgabe letzter Hand auf Velin; (siehe Cohen, Fürstenberg, Goedeke). Waldherzens freuen sich an ihrem Besitz ehrlich und ohne Heuchelei; warum auch nicht, wo alles gut und teuer ist; persönlicher Geschmack liegt unter der Tausend-Mark-Grenze.
»Neben Marken Frau Meister; sag ihr ein paar freundliche Worte über ihre Feuilletons; Dr. Paulsen führt sie; HAUSHERR – FRAU VON BARNEGG – BARON KOLOMAN – FRAU HELLWIRT –«, sie murmelt weitere Namen; malt; erhebt sich: »So geht es; schau mal her!« Der Bankier beugt sich gehorsam über die Tischordnung: »Sehr gut, Liebste.«
Und Frau Lilly zärtlich: »Nimm bei Tisch nicht von den Spargelspitzen, Walter! Denk an Deine Niere! Wir essen um halb neun.«
Beide verlassen die Bibliothek; ein Diener kommt, leert die Aschenschalen und lüftet. Und in die profane Nacht draußen entweicht der Duft der spezialangefertigten Zigaretten des Bankiers und des »Paris-Paris« seiner Gattin (38,50 pro Flacon).
Omnibus.
Ehe Dr. Paulsen aus der Klinik auf die Straße tritt, sieht er auf seine Armbanduhr: »Sieben vorüber. Knappe Zeit. Aber besser jetzt den Bus und nachher mit Ilse ein Taxi.«
Eilig geht er der Haltestelle zu. Es regnet. Er schlägt den Kragen hoch. Die Klinikstraße liegt still, ausgestorben, die wenigen blassen Laternen scheinen sie eher noch dunkler zu machen. Er schaut auf: »Die kahlen Bäume sollte man im Winter fortnehmen. Sie sehen unzufrieden aus.«
An der Haltestelle wartet außer ihm nur noch eine ältere Frau im Umschlagetuch. Sie trägt eine wachsleinene Markttasche, aus der das Ende eines Stückes Landbrot herauslugt. Bei seinem Anblick spürt Peter Paulsen, daß er Hunger hat: »Hoffentlich geht man bei Waldherzens pünktlich zu Tisch; sicher gibt es gut zu essen bei den Leuten. Mal umsonst schlemmen, gar nicht so übel. Ilse macht sich nicht viel aus Essen. Oder doch? Ich habe eigentlich noch nie darüber nachgedacht. Sie spricht ja nie von ihren Wünschen, wenn man sie nicht direkt und dringend ausfragt. Merkwürdiges Mädchen. Und der Bus kommt natürlich nicht!« Er zieht aus der Brusttasche ein Zigarettenetui; entzündet eine Zigarette. Raucht. Schaut auf die alte Frau. Die steht fast unbeweglich. Sie würde ebenso unbeweglich stehen, wenn sie des Nachts 25 Minuten auf den letzten Wagen zu warten hätte. Die Zigarette ist billig und nicht gut. Hier in Wind und Regen schmeckt sie schon gar nicht: »Ob dieses Fräulein Henke wohl bald zu meiner Nummer 19 kommen wird? Ich möchte eigentlich wissen, wie sie aussieht. Fräulein Henke am Sterbebett. Scheußlich. Menschen nah um Dich. Und den einen kennt man gar nicht und vom andern bis vor einer halben Stunde wenig mehr als sein inoperables Geschwulst. Na endlich kommt er.«
Der Bus; die alte Frau klettert mühsam hinein; der Schaffner hilft ihr. Zu Dr. Paulsen sagt er: »Beeilen, bitte!« Der steigt aufs Verdeck. Die hinterste Bank ist frei. Der Wagen fährt schon wieder; eine graue proletarische Straße hinunter. »Hier noch jemand ohne Fahrschein?« – »25! Danke!« Durch die Straße draußen kehren arbeitsmüde Menschen heim; die Geschäfte schließen; Jalousien rollen herab; die Gemüsehändler räumen ihre Kisten und Stellagen, welche auf der äußeren Auslage standen, herein. Aus dem Bürohaus am Ende der Straße strahlen große blauschimmernde Lampen in Mattglasgehäusen: Hier sind jetzt die Reinemachefrauen am Werk.
Der Bus fährt über eine Brücke, badet seinen Widerschein im nächtigen schwarzen Wasser und dringt jetzt in eine vornehmere Welt ein: dunkel auch sie; dunkler noch als das Arbeiterviertel; verfinsterte Häuser, deren Fenster durch dichte Vorhänge abgeschlossen werden. Es gibt hier auch keine Geschäfte; in diese Gegend haben die Kaufleute zu liefern, nicht in ihr sich anzusiedeln. Solid und ruhig selbst in der Nacht sandsteinerne Staatsgebäude an Plätzen mit Grünanlagen und Denkmälern. Regen.
Starkes, rötliches Licht; hochaufgehängte Bogenlampen. Der Bus hält lange. An diesem Schnittpunkt der Linien zur City und zum Westen wechselt der Wagen seine Besetzung. Einen Augenblick lang ist das obere Deck fast geleert. Dann wird es gestürmt von Menschen, die anders ausschauen als die bisherigen Fahrgäste: Monteure, Handwerker, Maurermeister, Handlungsreisende, kleine Büroangestellte. Jetzt kommen Männer mit Aktentaschen, dicken Ulstern, gewichtigen Gesichtern: Beamte, Kaufleute, Bürovorsteher, Rayonchefs, Anwälte und ein paar mittelgut gekleidete Mädchen, deren eines neben Peter zu sitzen kommt. »Leicht basedoid«, stellt er fest; »blutarm, wahrscheinlich Mensesbeschwerden. Höhere Tochter; vielleicht kleiner Adel; Edeltipse in einem Ministerium.« Das Mädchen vertieft sich in einen leicht zerlesenen Roman aus einer Zwanzig-Pfennig-Leihbücherei. Peter überfällt mit einem Mal eine abgrundtiefe Müdigkeit; ein leichtes Frösteln; der tote Punkt.
»Das Mädchen sieht aus wie seiner Zeit Olga, die ich heiraten sollte. Ihr Vater hatte ganz hübsch Geld und eine Professur. Es wäre sehr nützlich gewesen und hätte meine lieben Eltern gefreut. Jetzt sind sie bitterböse. Um ein Haar! Diese Motorradfahrer fahren auch wie die Verrückten. Natürlich. Ilse ist keine ›Partie‹. Die in mich investierten Erziehungsgelder rentieren mäßig. LANDESBANK. KAPITAL 60.000.000 MARK. WAS DIE BRAUT FÜR EINE TRAUUNG, IST BULLRICHSALZ FÜR DIE VERDAUUNG. Was läuft hier für ein Film? Das Mündel seiner Exzellenz. Habe ich nicht gesehen, werde ich nicht sehen. Ich hätte sie natürlich nicht zu heiraten brauchen. DAS DEUTSCHE OPERNHAUS, DEINE OPER. Selbstverständlich habe ich’s auch aus justament getan. Olga hätte mir sicher auf Grund endokriner Störungen dauernd Szenen gemacht. Mit Ilse bin ich glücklich. Sie ist immer gleichmäßig, nett, zärtlich und dankbar. Dabei hätte ich dankbar zu sein. CAFE EUROPA. RESI-SCHIRME. Was mag solche Lichtreklame wohl pro Abend kosten? Als Junge habe ich immer gedacht, Gummischuhe müssen etwas Unbezahlbares sein. Wie sie sich wohl bei Waldherzens machen wird? Gott, habe ich keine Lust mehr, hinzugehen. Jetzt ins Bett dürfen. Schlafen. Ilse muß mir noch Kaffee brühen. Wenn der Mensch kein Geld hat, braucht er Beziehungen. Zum Kotzen. Was mich an ihr hält: das Unerweckte; eigentlich habe ich sie noch nie ganz gehabt. Wo sind wir eigentlich? Ach hier erst! Noch sieben Minuten.«
Das Mädchen, das Olga ähnlich sieht, steigt aus. Eine Dame in einem imitierten Nerz nimmt ihren Platz ein und hüstelt ebenso imitiert. Es ist wirklich sehr rauchig hier oben geworden: eine blaue Luft. Aber daran ist sie aus der Bar gewöhnt. Sie will nur ihren Freund moralisch strafen, der sie zwingt, im überfüllten Omnibus zu fahren. Der balanciert am Rand der Bank weiter vorn: Kamelhaarmantel mit Rückenspange und superamerikanischen Schultern; das ganze Paar eines schönen Tages fertig aus einem Bildstreifen in die Wirklichkeit gehüpfte Filmstatisten. »Wieviel Menschen es doch gibt, bei denen man sich nicht vorstellen kann, daß sie einmal Babies waren, auf dem Topf gesessen haben, in die Schule gegangen sind. Sie sind es auch wahrscheinlich nicht. Fortpflanzung: vermutlich das Märchen vom Storch für Mediziner und Erwachsene.«
Der weite Boulevard des Westens; ein angestrahltes Warenhaus; Verkehrsampeln; Geschäfte; Bierhäuser; in weißen, blauen, roten Lichtbuchstaben die Firmenschilder; ein Kinopalast; der Himmel strahlt diese Helligkeit zurück wie eine Feuersbrunst; der Bus umfährt den Platz um eine große Kirche, langsam im sich stauenden Verkehr; ein neuer, langer, breiter Boulevard.
Peter erhebt sich; er klettert die Treppe hinunter, steigt aus, ehe der Wagen noch ganz hält. Auf dem Häuserdach gegenüber flammt in bunten elektrischen Birnen der Negerkopf einer Schokoladenmarke auf und verdreht die Augen. Peter hastet über den Damm, biegt in eine der Seitenstraßen der Avenue. Nummer 38. Er durchschreitet den Hausflur, gelangt in den Hof, Gartenhaus, drei Treppen; blickt empor: Jeden Abend wieder ist dieser sein Blick auf das warm erleuchtete Fenster, hinter dem jemand auf ihn wartet, der ihn liebt, seines Tages bester Augenblick. Und er denkt es so stark, daß er das halblaut vor sich hin murmeln muß: »Nein! Nicht aus justament; verdammt nicht aus justament; aus Liebe; aus hundsgemeiner Liebe!«
Stundenliebe.
Zugezogene, ein wenig angegraute rosa Fenstervorhänge; ein Stück Schmiedeberger Teppich; ein Spiegelschrank in Creme-Schleiflack (einige Stellen etwas abgestoßen); ein ebensolcher Toilettentisch mit Puderdose, Kamm, Bürste, einem Flacon Lavendel-Orange, einer Kristallschale als Aschenbecher benutzt; ein Waschtisch mit Marmorplatte, fließendem Wasser, warm und kalt; Wasserglas, Zahnbürste, Seife, Nagelstäbchen, Odol, Chlorodont, Waschlappen, hypermangansaures Kali. An der Wand: Odaliske im Harem, Schwindt: die Postkutsche, die Sixtinische Madonna und eine Radierung, bezeichnet »Der Backfisch«; ein breites zugedecktes Bett; eine mit einem weißen Laken bezogene Couch; diverse Kissen, zum Teil mit applizierten Rosen.
Rechtsanwalt Dr. Fritz v. Barnegg knüpft sich seinen Schlips. Die Dame, hier genannt Frau Helga, streift sich das Kleid über die schwarze Spitzenhemdhose. Barnegg hat es eilig. Sein Haar ist zerzaust; aber es ist nicht mehr viel Haar. »Ich muß um ein halb neun auf einer Gesellschaft sein. Es dauert eben doch immer länger, als man vorher denkt.«
»Ich beeil’ mich«, sagt die Dame, genannt Frau Helga, deren Kopf eben aus dem Kleid auftaucht, und sie zieht die dunkelblaue Seide an ihrem Körper herunter. Barnegg streift Weste und Rock über. Die Frau setzt ein Hütchen mit einem Halbschleier auf, schlüpft in ihren Mantel, ergreift die Handtasche, deren Inhalt sie mit einem automatischen Blick überfliegt: »Sieht man sich wieder?«
»Ich denke schon!«
Sie reichen sich die Hand. Sagen: »Guten Abend.« Die Dame, genannt Frau Helga, verläßt das Zimmer. Barnegg tritt zum Toilettentisch, klaubt von der dort liegenden Bürste ein paar dunkle Frauenhaare ab und bringt seinen Kopf in Ordnung. Er entzündet eine Zigarette mit Strohmundstück, sechs Pfennig das Stück, und legt zwei zusammengefaltete Zwanzig-Mark-Scheine neben die Puderdose.
Die Tür öffnet sich, und die Frau Baronin kommt herein: Sehr dick, gespannt in einem malvenfarbigen Nachmittagskleid mit halblangen Ärmeln und in allerbester Laune: »Na, zufrieden, Doktorchen?«
»Ganz gut, ganz gut«, nickt der Besuch.
»Eine fabelhafte Figur, das müssen Sie zugeben«, heischt die Baronin Anerkennung.
»Hm! Etwas zu viel Brust. Aber ein sehr einnehmendes Wesen.«





























