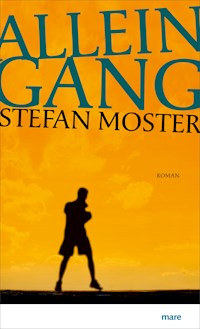Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Musik ist Simons Beruf und seine Berufung. Doch eines Tages auf einer Sommertournee durch Finnland, als er in einer Kirche Bartóks Solosonate für Violine spielt, passiert es: Zwei Finger der linken Hand verweigern ihren Dienst, Simon muss das Konzert abbrechen. Er ahnt, dass es sich nicht um einen einmaligen Aussetzer handelt, sondern um einen nicht heilbaren Defekt. Während er noch unter Schock steht, bietet eine Musikerkollegin an, ihm für eine Weile ihr Ferienhäuschen auf einer Schäreninsel zu überlassen, damit er Klarheit über seine Lage gewinnen kann. Ganz allein macht Simon sich mit der Natur der kleinen Insel vertraut, dem Meer, den Bäumen, den Möwen, lernt Bootfahren und Holzhacken. Und sucht nach einer Antwort auf die Frage, was er ohne seine Geige sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
mare
Stefan Moster
Bin das noch ich
Roman
mare
© 2023 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung plainpicture/Philippe Lesprit
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-825-0
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-712-3
www.mare.de
»Wenn du auslöschst Sinn und Ton –was hörst du dann?«
Frage eines japanischen Zen-Meisters des 11. Jahrhunderts an seine Schüler
Inhalt
Teil I
Teil II
Erster Tag
Zweiter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Siebter Tag
Achter Tag
Neunter Tag
Zehnter Tag
Elfter Tag
Zwölfter Tag
Dreizehnter Tag
Vierzehnter Tag
Fünfzehnter Tag
Sechzehnter Tag
Siebzehnter Tag
Achtzehnter Tag
Neunzehnter Tag
Zwanzigster Tag
Einundzwanzigster Tag
Zweiundzwanzigster Tag
Teil III
Das Notenheft
Teil IV
Zweiunddreißigster Tag
Sechsunddreißigster Tag
Siebenunddreißigster Tag
Achtunddreißigster Tag
Einundvierzigster Tag
Zweiundvierzigster, dreiundvierzigster, vierundvierzigster, fünfundvierzigster Tag
Letzte Tage
Tage und Nächte
Anmerkung
Dank
I
Am Flughafen, beim Übergang vom luftseitigen in den landseitigen Bereich, hat er insgeheim auf eine persönliche Begrüßung gehofft, sich aber vergeblich nach einem Schild oder Bildschirm mit der Aufschrift Simon Abrameit umgesehen und eine leichte Enttäuschung nicht leugnen können. Jetzt, da er nach einer Fahrt mit der S-Bahn in die Innenstadt aus dem Bahnhofsgebäude in den hellen Mittag tritt und an der Haltestelle für die Charterbusse tatsächlich bekannte Gesichter vor sich sieht, zögert er, auf sie zuzugehen. Es hat mit seiner linken Hand zu tun. Sie ist unzuverlässig geworden, aber die lachenden Menschen vor dem Reisebus, die in den nächsten Tagen mit ihm musizieren werden, erwarten, dass er mit unbeeinträchtigter Spielfreude zu ihnen kommt.
Das Handicap macht ihn empfindlich. Er hat es schon im Flugzeug bemerkt, als ihn nach dem Einstieg, beim üblichen Kampf um den Stauraum für die Gepäckstücke, ein Mann anbellte: »Ihre Stradivari nimmt zu viel Platz weg!« Anstatt mit der üblichen Replik, die er für solche Fälle parat hält – man solle froh sein, dass er kein Cello mit sich führe –, aus der Defensive zu finden, fühlte er sich unversehens in die Kindheit zurückversetzt und erinnerte sich daran, wie es gewesen war, immer und überall mit dem Geigenkasten gesichtet zu werden und entsprechende Kommentare einstecken zu müssen. Dann störte ihn der Kasten plötzlich. Es gab immer einen Grund, die Geige bei sich zu haben, Unterricht, Orchesterprobe, ein Vorspiel in einem Altersheim, es war normal, mit dem Instrument unterwegs zu sein. Aber eben nur für ihn. Für alle anderen nicht.
Mit einem schnellen Klatschen macht die Gegenwart wieder auf sich aufmerksam: Tauben. Wie überall auf der Welt bevölkern sie auch den Bahnhofsplatz in Helsinki, trippeln zwischen den Passanten umher, stürzen sich von den Simsen, fliegen in Trupps ihre Runden. Scharen von Dohlen kommen hinzu, außerdem einzeln patrouillierende Krähen, aber was da oben kreischend Bogen fliegt und weiß aufleuchtet, das sind Möwen, weil es von hier aus nicht weit ist bis zum Meer. Simon blickt zum Himmel, bevor er die letzten Schritte zu dem Bus mit den geöffneten Ladeklappen macht und von Menschen, die er kennt und die ihn wiedererkennen, empfangen wird. Binnen weniger Sekunden ist er Teil ihrer Gemeinschaft und vergisst vorläufig seine heimlichen Zweifel, ob er es wirklich sein dürfte.
Der Bussteig teilt sich in Licht und Schatten. Wo die Sonne hinscheint, lächelt man sich durch getönte Brillengläser an, wo das Vordach schützt, spürt man Gänsehaut an den Oberarmen, die man zur Begrüßung leicht berührt. Weitere Männer und Frauen mit unterschiedlich großen Instrumentenkoffern kommen hinzu, vom Flughafen, vom Fähranleger, vom Zug, und Simon breitet nun seinerseits die Arme aus. Wie auch nicht, alle freuen sich über die Begegnung und mindestens ebenso sehr darüber, endlich wieder auftreten und ihren Beruf ausüben zu können, nachdem es ihnen während der Pandemie erschwert, gar untersagt worden ist, aber auch weil sie Freundinnen, Freunde, Weggefährten wiedersehen, musikalisch Gleichgesinnte aus verschiedenen Ländern. Nur aus Russland ist diesmal niemand dabei. Russen haben es schwer, außerhalb ihres Landes Auftrittsmöglichkeiten zu finden, Jurij hingegen, der Geiger aus Charkiw, ist da, so wie in den Vorjahren auch, und diesmal schützt ihn seine Schüchternheit nicht vor besonderer Herzlichkeit. Allerdings wirkt er noch scheuer als sonst, als befürchtete er, jemand könnte es missbilligen, dass er in diesen Zeiten als Mann mittleren Alters im Ausland Musik macht. Ansonsten wird sein Land von Oksana und Marjana vertreten. Woher sie kommen, hat Simon vergessen. Es ist ihm immer schwergefallen, sich die Namen der ukrainischen Städte zu merken, abgesehen von den dreien, in denen er gewesen ist. Erst jetzt, da sie in Schutt und Asche gelegt werden, lernt er allmählich, auch die anderen Städte auseinanderzuhalten. Und schon sieht er Männer vor sich, die ihre Frauen und Kinder an die Grenze begleiten, sich von ihnen verabschieden und dann umkehren, um in den Krieg zu gehen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der diese Bilder im Kopf hat, womöglich steigert das unsere Freude über das Zusammenkommen sogar.
Manche verzichten noch auf Umarmungen und Wangenküsse. Sie begnügen sich damit, Faust oder Ellenbogen anzubieten, verbunden mit einem Schulterzucken und einem Gesichtsausdruck, der die Geste ironisch begleitet und das Bedauern etwas unbeholfen kaschiert. Die Stimmung löst sich trotzdem, es wird gelacht, erst recht, als eine Möwe einen zielsicheren Angriff fliegt und einer hochgewachsenen Cellistin aus Amsterdam die Eiskugel von der Waffel pflückt. Der Vogel ist verblüffend schnell und dabei vorsichtig genug, um die Beute beim Zuschnappen nicht einfach in der Mitte zu zerteilen und somit zu verlieren. Eine unversehrte weiße Kugel schwebt im gelben Schnabel auf das Dach des Bahnhofsvorbaus, wo sie behutsam abgelegt und ohne Zögern aufgegessen wird.
»Die werden immer dreister«, stellt einer der einheimischen Kollegen fest. Und sofort weiß ein anderer eine ähnliche Episode zu berichten, die von einer dritten Geschichte überboten wird, in der verschmutzte Kleider auf dem Weg zu einem Konzert vorkommen. Die Möwe, die umstandslos das Eis verspeist, verrät keinerlei Scham.
Für die Menschen ist es Zeit, den Bus zu besteigen, denn der Fahrer im kurzärmeligen weißen Hemd tritt seine Zigarette aus. Er wird seine Passagiere in eine Kleinstadt bringen, wo sie eine Woche lang in wechselnden Besetzungen Kammermusik machen werden, als Duo, als Trio, im Quartett oder allein. Während der Fahrt bleiben nur die Köpfe der Cellokoffer starr, alle anderen neigen sich den Sitznachbarn jenseits des Ganges zu, beugen sich nach vorn, drehen sich nach hinten. Eine Stunde sind sie unterwegs, so lange wird unablässig in mehreren Sprachen die Lage besprochen, mehrmals fallen die Namen Odessa, Charkiw und Mariupol, Namen von Städten mit Orchestern, Konzertleben, musikalischer Tradition. Aber es wird auch berichtet, wie man in den vom Krieg verschonten Teilen Europas über die Runden gekommen ist während der endlos erscheinenden Monate stillgelegter Kultur, wie man sich durchgeschlagen hat mit sporadischen Auftritten und Online-Formaten, und Mai, die seit Jahren hier im Norden Europas in einem Orchester spielt, aber in Leipzig studiert hat, sagt zu dem neben ihr sitzenden Simon: »Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich freue.«
Er antwortet mit einem Lächeln und einem langen Nicken.
»Ich habe ja das Privileg einer festen Stelle, aber wie hast du die Zeit überstanden?«, fragt die Frau mit den schmalen Schultern, deren Gesichtszüge nichts Europäisches an sich haben, in deren Deutsch aber nicht die geringste asiatische Tönung zu hören ist.
Mai ist ein Mensch, zu dem man ehrlich sein möchte, doch Simon will die ausgelassene Stimmung nicht stören, während der Bus über die Autobahn nach Osten gleitet, unter einer unabsehbaren Herde Schäfchenwolken am nordisch blauen Himmel. Beim langen Blick in ihr Gesicht fällt ihm das Wort Indochine ein, das Bilder melancholischer Eleganz nach sich zieht, wie aus einem französischen Film über die Kolonialzeit, obwohl das gar nicht zu Mai passt, deren Körper zwar zart ist, aber weniger von eleganten als von zweckmäßigen Bewegungen in Betrieb gehalten wird. Keine verträumte Schwermut bremst sie, ihre Gebärden wirken kurz und geschickt, klar und gezielt, trotzdem weckt der Blick ihrer Augen den Impuls, sie auf Französisch anzusprechen, und Simon sagt tatsächlich pardon, meint aber sein Zaudern und beeilt sich, eine Antwort zu geben. Auf Deutsch schönt er die Bilanz der letzten Jahre, spricht von der kleinen Tournee, die er im Frühjahr machen konnte, einige Stationen in der französischen Provinz, das D-Dur-Konzert von Prokofjew, eine Besonderheit für einen wie ihn, der nur noch selten die Gelegenheit erhält, als Solist mit Orchester die großen Violinkonzerte zu spielen. Allerdings scheint er seine Miene nicht mit der nötigen Glaubwürdigkeit zu unterlegen, denn die Fragerin zieht die Augenbrauen so weit hoch, dass sich Falten auf ihrer Stirn bilden, und lässt sich auch nicht von seinem Einwurf ablenken, Prokofjew stamme übrigens aus der Ostukraine, was die meisten Leute gar nicht wüssten.
Verschweigst du mir etwas?
Simon beteuert, für den Sommer sei sein Kalender gut gefüllt, seine Agentin habe es geschafft, ihn mit dem Soloprogramm vielerorts unterzubringen.
»Was wirst du spielen?«
»Bach und …«
»Ja?«
»Bartók.«
Er sagt es mit Verzögerung, als wäre es eine Anmaßung, dieses radikale Stück mit seinen haarsträubenden Schwierigkeiten aufzuführen, wenn man nicht zu den größten Interpreten seiner Zeit gehört.
Aber Mai strahlt, und ihr Vordermann dreht sich zu ihm um und äußert sich anerkennend. Beide versichern, sich das Konzert auf jeden Fall anhören zu wollen, und Simon fühlt sich erleichtert, als hätte er soeben die offizielle Erlaubnis erhalten, das Recital mit der C-Dur-Sonate und der d-Moll-Partita von Johann Sebastian Bach gefolgt von der Sonate für Violine solo von Béla Bartók zu spielen. Dass seine Erleichterung nur an der Oberfläche bleibt und nicht ins Innerste dringt, behält er für sich.
Sie erreichen den Zielort, der Bus überquert den Fluss, man sieht Holzhäuser in verschiedenen Farben den Altstadthügel bevölkern, und ganz oben das Dach der Kirche, die sie hier Dom nennen, obschon ihr Format eher einer Kapelle gleicht, jedenfalls nach den Maßstäben des katholischen Teils von Europa. Alle schauen hin, man spürt, wie sich die Vorfreude im Blick auf den Auftrittsort bündelt. Es ist nicht der Moment, die anderen zu beunruhigen. Keine dunklen Befürchtungen jetzt. Nicht an die neuerdings unberechenbaren Finger der linken Hand denken. Niemand soll an seiner Verlässlichkeit als Mitspieler zweifeln.
Zusammen mit Mai sowie einer Bratschistin und einem Cellisten der Helsinkier Philharmoniker probt er am nächsten Tag Dvořáks Zypressen und Janáčeks Intime Briefe, wobei ihn das Zusammenspiel derart beflügelt, dass es ihm gelingt, der Angst zu trotzen und die Finger der linken Hand unter Kontrolle zu behalten, trotz der Schmerzen, die sich stellenweise bemerkbar machen. Er ist froh, nur die zweite Geige zu spielen, er ist glücklich, spielen zu können. Niemand merkt etwas, und als er am Abend fehlerfrei durch das Konzert kommt, sickert etwas von seiner Erleichterung doch tiefer ein. Er feiert sogar, trinkt beim gemeinsamen Essen unter freiem Himmel Wein und berauscht sich an der Nähe der anderen. Man könnte meinen, denkt er, die hellen Nächte des Nordens wären eingerichtet worden, damit sich die Menschen im Sommer länger betrachten können.
»Was macht ihr eigentlich im Winter, wenn es immer nur dunkel ist?«, hört er eine Stimme auf Englisch mit französischem Akzent fragen und sofort darauf eine mit mutmaßlich finnischer Färbung antworten: »Wir machen das Licht an.«
Er lacht mit und vergisst sich, und wahrscheinlich ist es genau das, was er will, nicht an sich und seine Mühen denken, nicht an die Verzweiflung, die ihn immer wieder packte, als er vorab seinen Part der Quartette alleine einstudierte, weil er dabei keineswegs immer fehlerfrei blieb. Jedes dritte, vierte Mal ließen ihn die Finger im Stich. Wenn er ehrlich ist, muss er sich eingestehen, dass er hier, bei diesem Festival, ein gefährliches Spiel mit der Wahrscheinlichkeit riskiert, aber an diesem Abend betäubt er die Ehrlichkeit und trinkt. Am nächsten Tag muss er nicht auftreten, sein Solokonzert ist erst für den Tag darauf vorgesehen.
Das Programm soll sein Phönixflug werden: das große Aufschwingen, das ihn über das Mittelmaß erhebt, zu dem er sich seit einer halben Ewigkeit verurteilt sieht. Mit Bach und Bartók könnte es gelingen. Er hat lange überlegt, welche der sechs Bach-Stücke er ins Programm aufnehmen soll, und sich schließlich für die Sonate C-Dur entschieden, die, weil Bartók sich darauf bezogen hatte, unumgänglich war und die auch Menuhin bei der Uraufführung von Bartóks Stück in der Carnegie Hall im Programm gehabt hatte, sowie für die Partita in d-Moll, wegen der Ciaccona, an die Bartók schon mit den ersten Takten anknüpft. Dafür lobte ihn sogar seine Agentin, sehr gut, die Chaconne wollen alle hören, der Bach nimmt den Bartók auf seinen Flügeln mit, so hatte sie sich ausgedrückt, vielleicht unter Gebrauch einer russischen Redensart. Sie schien der Ansicht zu sein, man müsse ein komplexes und dem breiten Publikum wenig bekanntes modernes Stück wie Bartóks Solosonate im Schatten von Bach ins Programm schmuggeln, geradeso, als wäre es nicht eines der bedeutendsten Werke, die je für Violine allein geschrieben wurden, wie schon Yehudi Menuhin sagte, der das Stück in Auftrag gegeben und damit den klammen und überdies kranken Komponisten eine Weile über Wasser gehalten hatte. Es gehört zum Größten, was man als Solist seinem Publikum geben kann. Zumal in Kombination mit Bach. Ein solches Programm kann man nicht einmal exzentrisch nennen, andere haben es vor ihm gespielt, natürlich, eben aufgrund des inneren Zusammenhangs, doch allzu oft kommen die beiden Komponisten trotzdem nicht in Kombination zur Aufführung, weshalb man durchaus einen gewissen Aha-Effekt erwarten darf. Olga wusste das, sonst hätte sie versucht, ihm den anspruchsvollen Bartók auszureden.
Welche Bedeutung das Programm für ihn als Künstler hat, wurde nicht besprochen. Man sagt seiner Agentin nicht, man habe das Gefühl, der Dynamik des Daseins auf die Spur zu kommen, wenn man diese Werke spielt, gar den innersten Kern der Existenz zu berühren. Man sagt es schon deshalb nicht, weil man sich mit slawischem Akzent genuschelte Bemerkungen über die faustischen Fixierungen der Deutschen ersparen will, man sagt auch nicht, man hoffe, durch ein solches Recital die Aufmerksamkeit auf sein wahres Können als Musiker zu lenken und vielleicht doch noch einmal die Chance zu erhalten, eine Platte aufzunehmen. Stattdessen sagt man schlicht, das wäre doch ein interessantes Programm, und die Agentin sagt, ja, zumal wegen der überschaubaren Kosten, wenn man es damit vergleicht, was die Veranstalter ein Trio oder gar ein Quartett kosten würde.
Das Erhabene und das Banale – oft nicht nur benachbart, sondern verzahnt. »Ich versuche, bei der Gage in den vierstelligen Bereich zu kommen«, hatte Olga subsumiert. »Bach macht es möglich.«
Und dann steht er endlich allein im Altarraum des kapellengroßen Doms aus dem späten Mittelalter, unter einem Votivschiff mit drei Masten, bei dessen Anblick er kurz Rettungsboot denkt, bevor er sich verneigt. Ausgerechnet hier, fernab der Metropolen, soll der Phönixflug beginnen. Immerhin sind Mikrofone für einen Mitschnitt aufgebaut, wer weiß, was daraus wird. Und die räumlichen Voraussetzungen stimmen. Die Kirche mit den grob verputzten Wänden voller Fresken im volkskunsthaften Stil besitzt kompakte Ausmaße und eine ausgewogene Akustik. Ihr leichter Hall lässt noch die zartesten Flageoletts hörbar schwingen, dämpft spitze Töne diskret ab, ohne dass schnelle Tonfolgen verschwimmen. Einen besseren Klangraum für Solostücke kann man sich kaum denken, er modelliert die Einzelstimme fast perfekt. Man darf allerdings nicht danebengreifen, denn auch Fehler werden nahezu vollkommen zu Gehör gebracht. Man präsentiert sich hier auf einer Bühne gnadenloser Deutlichkeit. Der Vorteil: Im Publikum rührt sich nichts mehr, sobald er die ersten Töne des Adagio, mit dem die C-Dur-Sonate beginnt, in den Raum stellt. Mit langen Strichen kleidet er das Gewölbe aus, ganz selbstverständlich ersetzt Bachs Architektur das vorhandene Gemäuer.
Der langsame Einstieg macht es den Fingern leicht, aber die knapp vier Minuten des ersten Satzes sind zu kurz, um die Angst zu entkräften. Die Fuge dauert mehr als doppelt so lang, und nach wenigen Takten merkt er, dass es schwer wird. Schnell melden sich die Schmerzen, und nicht nur das, auch dieses spezielle Sträuben in den Fingern stellt sich ein, vorsichtshalber spielt er den Satz möglichst ungeschönt, um das Publikum an Rauheiten und Härten zu gewöhnen, sodass es nicht unbedingt auffällt, sollte es ungewollt zu ungeschliffenen Tönen kommen. Beim Largo glaubt er, sich beruhigen zu können, aber er hat die Triller unterschätzt, die bei einem so langsamen Satz besonders deutlich hörbar werden, und vom Allegro an muss er kämpfen. In der hellhörigen Akustik des Gotteshauses kämpft er sich auch durch die folgende Partita. Angst schleicht sich in die Töne, nimmt ihnen die Strahlkraft, was ihm wiederum bewusst wird und die Angst vervielfacht. Es gleicht einer übermenschlichen Anstrengung, die grandiose Komposition mit schmerzenden Fingern zum Leben zu erwecken, bei aller Qual wundert es ihn, dass es ihm überhaupt gelingt, womöglich spielen die Finger aus Respekt vor dem großen Werk noch einmal mit, als letztes Zugeständnis, denkt er mitten im Kampf, und er schafft es tatsächlich, auch in der Ciaccona nicht abzustürzen, obwohl er es kaum erträgt, sie nicht mit dem gewünschten Ausdruck darbieten zu können. Fehlerfrei bleibt er trotzdem, und danach ist der erste Teil des Recitals zu Ende.
Die Pause reicht gerade aus, um die Erschöpfung zu veratmen und das herandrängende Verzweiflungszittern abzuwehren. Entgegen den Gepflogenheiten dieses Festivals mischt er sich nicht im milden Abend vor der Kirche unters Volk, sondern zieht sich in den hintersten Winkel der als Garderobe dienenden Sakristei zurück und fixiert eine Viertelstunde lang die weiß gekalkte Wand.
Dann öffnet jemand die Tür zum Kirchenraum. Er stimmt kurz nach, geht hinaus und nimmt den Bartók mit der Entschlossenheit desjenigen in Angriff, der weiß, dass ihm bei diesem Flug der Absturz droht.
Während des gesamten ersten Teils balanciert er in tückischen Turbulenzen, was womöglich interessant klingt, weil prekär, wie es dem wechselhaften, unberechenbaren Werk auch durchaus ansteht, beim Pizzicato der letzten sechs Takte – piano, pianissimo – kommen ihm vor Anstrengung die Tränen, was wegen seines schweißnassen Gesichts eventuell nicht auffällt, und er meint, Ergriffenheit im Publikum zu spüren, Ergriffenheit und Erwartung, in die hinein er das Fugenthema des zweiten Teils setzt, rau und resolut, einmal, zweimal, dreimal, bei jedem Themeneinsatz mit zunehmender Komplexität und, was man im mittelalterlichen Kirchenraum nicht hört, mit wachsender Panik, die nun infernalisch in seinem Körper tobt, als schreiende Vorausnahme des Sturzes in den Abgrund, der dann tatsächlich folgt, wie von der Panik prophezeit, bei dem atypischen Akkord in Takt 18, immerhin an einer wirklich schweren Stelle.
Als der dritte Finger das A und der vierte das Cis greifen soll, schmerzt die Hand nicht nur, wie sie bei diesem Griff ohnehin geschmerzt hätte, sondern erstarrt in einer Qual, die den ganzen Arm sowie die linke Schulter lahmlegt. Und wer die Schwingen nicht mehr strecken kann, stürzt ab.
Mai verfolgt es aus nächster, fast schon intimer Nähe, nämlich vom Seitenschiff aus, wo bei den Konzerten des Festivals diejenigen sitzen dürfen, die ihre Auftritte bereits hinter sich oder noch vor sich haben. Sie merkt sofort, dass er nicht bloß den Faden verloren hat und ihm auch keine Saite gerissen ist. Sie erkennt den falschen, weil übermäßig starken und krampfhaften Kraftaufwand der linken Hand, die alles daransetzt, die Angst zu bezwingen, und sie sieht mit an, wie die zur Panik potenzierte Angst sämtliche Mechanismen der Selbstbeherrschung entkräftet, worauf seine Gesichtszüge bersten und er das Spiel abbricht.
Mit angewinkelt erhobenen Armen hält er Instrument und Bogen vom Körper weg, wie um sie vor einem steigenden Wasserpegel in Sicherheit zu bringen oder wie um sich zu ergeben. Gleichzeitig weiten sich seine Pupillen zu einem Starren, das nichts sieht, dann lösen sich Kopf und Schultern aus der Arretierung, die Arme sacken herab, Hüften und Knie geben nach, kurz sieht es aus, als bräche er zusammen, doch fängt er sich, lässt einen Laut entweichen, wie er üblicherweise dem Schmerz entspringt, schüttelt den Kopf auf unkontrollierte Art, die auch nickende Bewegungen enthält, scheinbar das Äußerste, was er an Botschaft noch ans Publikum vermitteln kann, und rettet sich schließlich vor dem verstörten Raunen durch die Seitentür in die Sakristei.
Dort wartet Mai auf ihn. Ohne auch nur eine Frage zu stellen, nimmt sie ihm Instrument und Bogen aus der Hand, verstaut sie im Koffer, klappt diesen entschlossen zu und sagt: »Komm.«
Im Taxi führt sie ein Telefonat in der Sprache der Einheimischen, die Simon nicht versteht. Sie klingt energisch, dann wieder beschwichtigend, zwischendurch auch bekümmert, aber ihr Bemühen, ruhig zu bleiben, zieht sich durch das Gespräch. Simon nimmt alles wie durch einen Schleier wahr, auch die prüfenden Seitenblicke, die ihm gelten. Er sagt kein Wort, weil er keinen Ton herausbekommt. Ich stehe unter Schock, denkt es irgendwo in ihm. Ich stehe unter Schock.
Sein Sichtfeld verengt sich, bald nimmt er nichts weiter wahr als Mais Schemen neben sich. Schock und Trance. Was werde ich noch alles verlieren?
Immerhin: Als die Wagentür aufgeht, steht Mai wieder dreidimensional da, auch der Ort kommt ihm bekannt vor, der Zugang zum Hotel, gegenüber der große Platz mit den Bushaltestellen und dem Marktcafé, das aus einem Imbisswagen und einer Ansammlung von Stühlen und Tischen aus weißem Plastik besteht. Pop-up, denkt er und lacht gespenstisch in sich hinein. Plastikstühle biegen sich unter übergewichtigen Personen, die wie im Chor zu ihm herüberstarren.
»Schockschwerenot«, spauzt er und lacht laut auf wegen des grotesken Wortes. Dabei sucht er mit den Augen Mais Gesicht, das ernsthaft besorgt aussieht. Sie scheut sich nicht, ihn wie einen Invaliden ins Hotel zu führen, sie kann nicht anders, er spürt ihre Entschlossenheit. Fest und stabil verkantet sie seinen Arm und lässt ihn auch nicht los, als sie sich an der Rezeption den Schlüssel geben lässt.
Simon fügt sich, wird aber zögerlich, weil ihn das Gefühl beschleicht, etwas vergessen zu haben. Er hat die Hände frei, die verdammten Hände, und er trägt auch nichts auf dem Rücken. Das beunruhigt ihn, trotzdem überlässt er sich dem Zug von Mais Entschlusskraft.
Im Zimmer führt sie ihn zum Bett. Dann löst sie den Griff. Sogleich sinkt er nieder, lässt die Schultern hängen, aber er blickt kurz auf, lächelt gar und kippt dann einfach zur Seite. So schön still hier, so angenehm kühl und so weich. In Anzug und Schuhen liegt er mit angewinkelten Beinen auf dem Bett, ohne den geringsten Wunsch, die Welt möge wieder Konturen annehmen. Soll doch alles verdämmern und sich auflösen. Probehalber schließt er die Augen, doch es passiert nichts, weder holt ihn der Schlaf, noch berührt ihn eine tröstende Hand.
Ein plötzlicher Gedanke sorgt dafür, dass er die Augen wieder aufreißt. Wo ist die Geige? Er hebt sogar den Kopf ein wenig an.
Mai steht mit dem Rücken zum Fenster und schaut auf ihn herab. Sie lässt ihn nicht aus den Augen, sie lächelt nicht, sie hält lediglich den Blick so stabil wie vorhin den Arm. Simon lässt den Kopf wieder sinken. Ich muss etwas sagen, denkt er, ich muss mich bedanken, ich muss sie fragen, wo die Geige ist, er atmet in langen Zügen, so wie er es vor Konzerten gegen die Aufregung tut, stattdessen hört er sich sagen: »Jetzt kann ich mich umbringen.«
Zunächst folgt darauf nichts. Es bleibt still und kühl. Dann schlägt das Bett kurz Wellen, weil Mai sich auf dem Rand niederlässt. Gleich. Gleich wird sich die tröstende Hand irgendwo niederlassen, auf dem Kopf vielleicht oder auf der Schulter. Aber nein. Keine Berührung erlöst ihn. Stattdessen ein kurzes Räuspern.
»Überlege es dir eine Woche«, sagt sie so neutral wie ein mit Blockbuchstaben geschriebener Text.
Das empört ihn derart, dass er sich mit einem Ruck aufsetzt. Dabei sieht er, dass der Instrumentenkoffer auf dem Schreibtisch liegt, was ihn wiederum schlagartig beruhigt, sodass der Impuls, seiner Empörung Ausdruck zu verleihen, erlischt. Er sieht die Frau neben sich an und spürt ihre Schulter an seiner. Indochine.
»Eine Woche? Warum eine Woche?«
»Von mir aus auch länger. Aber du könntest mit einer Woche anfangen.«
Sie meint es ernst. Ihr Blick hält weiterhin stand. Er beugt sich nach vorn und streckt die Hand aus, sodass er mit den Fingerspitzen den Geigenkasten auf dem Schreibtisch berühren kann.
»Keine Sorge, sie ist drin«, sagt Mai und lächelt.
Er nickt, dann will er wissen, wie es ausgesehen hat.
»Was?«
»Das, was in der Kirche passiert ist. Was haben die Leute gesehen?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Einen Zusammenbruch. Vielleicht eine Kreislaufschwäche.«
»Und du? Was hast du gesehen?«
»Ich habe gesehen, dass deine Finger versagt haben und ein Blitz in dich gefahren ist.«
Sie wendet den Blick immer noch nicht ab.
»Weißt du, was das bedeutet?«
Sie nickt.
»Ich kann mich umbringen.«
»Wie gesagt: Überleg’s dir.«
»Und wo? Hier vielleicht?«
»Nicht hier. Zu Hause.«
Zu Hause. Bisher ist das für ihn die Situation gewesen, in der er Musik macht, denn wenn er spielt, hat er das Gefühl, zu sein, wo er sein will. Aber Mai meint es weniger abstrakt, und so denkt er mit Grauen an die kahle Räumlichkeit, die nach dem Konzertsommer sein Zuhause werden soll. Noch hat er sich darin nicht aufgehalten. In den letzten Wochen ist er von Hotelzimmer zu Hotelzimmer gereist, an geliehene Orte, wie immer auf Tournee und in der Festivalsaison, nicht weiter tragisch, solange man als Fixpunkt ein Hauptquartier besitzt. Aber Anfang des Jahres hatte man ihm sein vertrautes Berliner Basislager in Form einer Eigenbedarfskündigung weggenommen und ihn vor die Aufgabe gestellt, innerhalb von drei Monaten als Musiker ohne Festanstellung eine Wohnung zu finden. Er musste seine Sachen in einer Halle mit Lagerabteilen unterbringen, verärgert, weil an der Stelle der Halle kein Wohnhaus für schwer vermittelbare Mieter stand. In München hatte ein Mäzen achtzig Wohnheimwohnungen für Musikstudenten bauen lassen. Warum nahm sich das niemand zum Vorbild? Nach Wochen in einer Pension kam er schließlich im ehemaligen Büro einer Spedition unter, in einem umgewidmeten Gewerbegebiet am S-Bahn-Ring, zwischen Werkstätten, Künstlerateliers und Studios für asiatische Kampfsportarten. Annonciert gewesen war es als Loft, was unzählige Interessenten angezogen hatte, die sich jedoch alle davon abschrecken ließen, dass der kahle Raum mit der langen Reihe schlecht isolierter Fenster aussah wie das ehemalige Büro einer Spedition, und zwar einer dubiosen. Er unterschrieb den Mietvertrag, weil es keine Nachbarn gab, die, wenn er übte, schon nach einer halben Stunde an die Wand hämmern würden. Ein brauchbarer Ort für Musiker. Für andere eher nicht.
Schon sieht er sich das ehemalige Speditionsbüro allein und ohne Instrument betreten und stöhnt unwillkürlich auf.
»Das Mobiliar meiner neuen Wohnung besteht aus unausgepackten Umzugskartons. Ich habe dort noch keine einzige Nacht verbracht. Nicht mal an die Hausnummer kann ich mich erinnern.«
In Mais Ohren klingt das offenbar wenig dramatisch, denn sie lächelt erneut. Wohl nicht über seine vermeintliche Heimatlosigkeit, sondern über das Lebenszeichen, das im Pathos seiner Sätze liegt.
»Was wäre die Alternative?«
Er zuckt mit den Schultern.
»Eltern? Geschwister? Freunde?«
Er schüttelt matt den Kopf.
»Freundin?«
Er schüttelt energisch den Kopf.
Weiterhin hält sie die Hände bei sich, sie steht auf und tritt ans Fenster, schaut hinaus, wie man es tut, wenn man nachdenkt, er sieht, wie sich ihr Mund bewegt, die Lippen beim Überlegen zusammengekniffen werden. Dann nickt sie entschlossen und dreht sich zu ihm um: »Du kannst die Insel haben.«
II
Darja,
seit die meisten Vögel fortgezogen sind, aufs Meer hinaus oder manche vielleicht auch schon nach Süden, kann es nachmittags, wenn kein Wind geht oder nur ein schwacher aus dem Norden oder Osten, vollkommen still werden, fast beunruhigend still, bis eine der verbliebenen Sturmmöwen oder Küstenseeschwalben einen Schrei ausstößt und meldet, dass die Erde weiterhin bewohnt wird.
Als ich heute auf eine solche lautlose Leerstelle aufmerksam wurde, musste ich an einen Satz denken, den du in einem Interview gesagt hast: Manchmal sei die Stille wichtiger als die Noten.
Auf das Interview war ich in einer Zeitung gestoßen, die ich eigentlich nicht lese, beim Frühstück in einem Hotel in einer Stadt, an die ich mich nicht mehr erinnere. Es hatte nur ein Blatt ausgelegen, zum Glück, denn sonst hätte ich deine Worte nicht entdeckt. So aber las ich sie und erging mich in der aufregenden Vorstellung, derjenige zu sein, der das Gespräch mit dir führt, in einem besseren Hotel, einem, das deinem Renommee entspricht, oder gar bei dir zu Hause, in der kleinen ruhigen Straße in Holland Park, am Küchentisch.
Das Violinspiel bereite dir erst seit zehn Jahren echte Freude, sagst du. Bis dahin sei es nur Arbeit und mit Angst verbunden gewesen. Mit der Angst, nicht gut genug zu sein. Du hättest keine Kindheit gehabt, sagst du, weil man immer nur von dir verlangt habe, zu üben. Tagaus, tagein nur üben, üben, üben: präzise, genau, perfekt.
Weißt du, wie Bartók das nannte? Musikalische Zwangsarbeit. Das viele Üben könne die Ursache dafür sein, dass man nichts von der Welt sehe.
Entschuldige. Ist mir gerade eingefallen. Obwohl ich mich gar nicht ablenken lassen will. Du erzählst vom schwierigen Verhältnis zu deiner Mutter, lässt durchblicken, sie weniger geliebt zu haben als deinen Vater, und gibst zu, bei deiner Flucht in den Westen keine Trauer um den Verlust deiner Eltern empfunden zu haben. Erst später sei dir bewusst geworden, was du ihnen zugemutet hast. Sie hatten nicht nur dich, sondern deinetwegen auch ihre Arbeit und ihre Anerkennung verloren.
Damals warst du egoistisch. Im Interview bist du ehrlich, mit dir im Reinen, strahlst die Lebensklugheit eines Menschen aus, der sich gerettet und der etwas über sich gelernt hat. Bach habe dir dabei geholfen, sagst du. Alles habe mit Bach begonnen. Bach sei wie eine Improvisation gewesen, bei der du dir Zeit nehmen und unterschiedliche Artikulationen ausprobieren konntest. »Bach lässt dir unendlich viel Freiheit«, sagst du, und ich verstehe es so, dass er dir half, deinen persönlichen Ton zu treffen.
Gleichzeitig hättest du den Wert der Leerstellen entdeckt, die Stille, die manchmal wichtiger sei als die Noten. Ton und Stille gehörten zusammen.
Hätte ich tatsächlich das Gespräch mit dir geführt, Darja, hätte ich jeden deiner Sätze mit der Ehrfurcht aufgenommen, mit der ich seit Jahren deine Kunst bewundere – seit ich dich bei dem Wettbewerb, an dem wir beide vor Jahrzehnten teilnahmen, Bartóks Solosonate spielen hörte. Weißt du das noch? Ich glaube schon, denn es war im Jahr vor deiner Flucht, vor der großen Wende in deinem Leben, auf die du dich damals vielleicht schon innerlich vorbereitetest, aber an mich wirst du dich nicht erinnern, dafür hast du seitdem zu viele bedeutende Persönlichkeiten getroffen. Du bist rasch berühmt geworden, man hat dich Politikern, Mäzenaten, gefragten Künstlern und den absoluten Größen der Musikwelt vorgestellt: deinesgleichen.
Jeden deiner Sätze hätte ich unangetastet hingenommen, und würden wir uns heute unterhalten, wäre das genauso. Eines aber wäre anders: Ich würde mich trauen, dir Fragen zu stellen. Vielleicht würde ich dich sogar bitten, manches aus anderer Perspektive zu bedenken. Zum Beispiel das mit der Stille. Ich würde dich fragen, was es bedeutet, wenn nur noch Stille herrscht. Wenn die Noten verstummen und nicht einmal mehr Bachs notierte Freiheit der Artikulation hilft, den Ton zu treffen, weil es keinen Ton mehr gibt. Was, wenn man keinen Bach mehr spielen kann? Und auch nichts sonst. Was dann, Darja?
Erster Tag
Sie werden von Schreien empfangen, dringlichen, womöglich drohenden, nasalen Schreien, mit gellendem Glissando in die Länge und in höchste Lagen gezogen, bis sie sich beim schrillsten Ton überschlagen und in kläffende Silben zerfallen, immer wieder und unbändig laut.
»Sturmmöwen«, ruft Mai vom Cockpit aus, dann kommt das Boot am Anleger zum Halten, und es folgen die Anweisungen einer Kapitänin, die den Passagier zum Matrosen machen: Mit der Vorleine in der Hand steigt Simon auf den Steg und hält das Boot, bis der Außenborder ausgeschaltet und hochgeklappt ist. Die Möwen beruhigen sich nicht, unwillkürlich zieht man als Mensch den Kopf ein.
»Man merkt, dass ich eine Zeit lang nicht hier war«, stellt Mai, die in verblüffender Schnelligkeit zwei Fender positioniert und knotenkundig das Boot vertäut hat, fest.
Als wollten die Möwen sie Lügen strafen, lassen sie die letzten Töne aus den Schnäbeln fallen, verstummen und landen teils auf dem Wasser, teils am Ufer.
»Siehst du die zwei dort drüben? Die bauen seit Jahren ihr Nest auf demselben Stein.«
Mais Zeigefinger weist auf einen von Flechten überzogenen Felsbrocken im seichten Wasser der Bucht. Dort stößt eine Möwe im Stehen einen einzelnen Schrei aus, der noch ein bisschen empört klingt, aber vielleicht der Begrüßung dient, während eine zweite vom selben Stein aus ein paar Bogen um das Boot fliegt. Simon wundert sich. Dass man Möwen persönlich kennen kann. Die sehen doch alle gleich aus.
Sein Gepäck und die Taschen mit den Lebensmitteln dürfen vorerst unter dem Schönwetterhimmel auf dem Steg bleiben. Mit Regen ist nicht zu rechnen, auch Diebstahl muss nicht befürchtet werden, denn auf dieser Insel wohnt niemand. Trotzdem schnallt sich Simon den Geigenkoffer auf den Rücken, als er Mai folgt, um den Ort zu besichtigen, an dem er die nächsten Tage verbringen wird.
Sie schließt die Tür des Gebäudes, das ein Kind als Haus bezeichnen würde, auf und ermuntert ihn, einzutreten. Die aus dicken Blockbalken errichtete Hütte besteht aus einem Raum mit Kochnische und Schlafecke, der vielleicht fünf mal fünf Meter misst. Trotz mehrerer Sprossenfenster herrscht Dämmerlicht, denn die Zeit hat das Holz von Boden, Wänden, Decken dunkel werden lassen. Hier fühlt man sich entweder geborgen oder bedrückt, das ahnt er gleich, so wie er auf den ersten Blick sieht, dass hier jemand gewohnt hat, genau genommen sieht es aus, als wäre der Raum kürzlich erst verlassen worden, und auch nur vorübergehend. Es hängen Küchentücher am Haken, Ölund Essigflaschen springen in der Kochecke ins Auge, auf dem Tisch liegen Utensilien herum, ein Kartenspiel, Kugelschreiber, Bleistifte, eine angebrochene Packung Servietten, ein Korkenzieher, dazwischen steht eine halb abgebrannte Kerze in einem Leuchter mit Tragehenkel neben einer großen Kaffeetasse mit Fischmotiv.
Mai schaltet den Kühlschrank ein, dessen Aggregat dank des Solarmoduls vor der Hütte sogleich zu brummen anfängt, dann bückt sie sich, um einen kleinen Hebel am Ventil der grauen Gasflasche umzulegen, und prüft, ob Brennstoff in den zweiflammigen Kocher strömt. Anschließend zeigt sie dem Gast, wo er Besteck, Geschirr, Töpfe, Pfannen findet, all das Banale, das man als Mensch braucht, um sich zu versorgen.
Anstatt auf die Gegenstände zu blicken, auf die sie jeweils weist, bleibt Simons Aufmerksamkeit bei der Frau, denn seit sie die Hütte betreten haben, bewegt sie sich nicht mehr so zwanglos wie vorhin im Boot. Er glaubt zu erkennen, dass sie es vermeidet, die Wirkung des Raumes im Ganzen aufzunehmen, als hielte sie ihr Blickfeld vorsätzlich eng. Sie nimmt keinen einzigen Gegenstand in die Hand, und die Reihe der unterschiedlich großen Gummistiefel neben der Tür würdigt sie keines Blickes.
Warum?
Mit unleserlichem Blick begegnet sie der Frage, die in seinem Gesicht geschrieben steht, dann wendet sie sich den Schlafplätzen zu, einem Ehebett und einem Stockbett, das abgetrennt durch einen Vorhang in einem Alkoven steht.