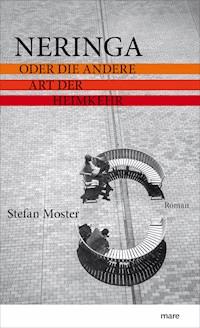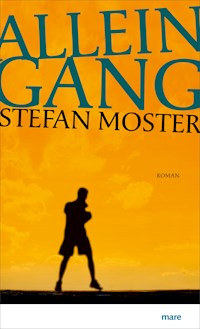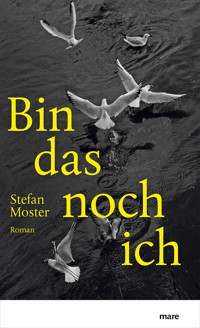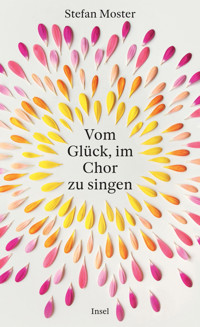
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Singen ist die Sprache des Glücks
In Deutschland gibt es 60.000 Amateurchöre, und es werden immer mehr. Singen im Chor ist weit mehr als nur eine musikalische Darbietung – es ist ein Gemeinschaftserlebnis, das Glücksgefühle weckt, Stress abbaut und sogar das Leben verlängern kann. In seinem kenntnisreichen und unterhaltsamen Buch begibt sich Stefan Moster auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Chöre. Vom Profiensemble bis zum kleinen Laienchor, vom Männergesangverein bis zum queeren Vokalensemble – er beleuchtet die Vielfalt und die besondere Magie des Chorsingens.
Mit humorvollen und tiefgründigen Geschichten aus der Geschichte und Gegenwart des Chorgesangs zeigt Moster auf, wie Singen Menschen verbindet und Emotionen weckt. Er gibt spannende Einblicke in die verschiedenen Facetten, von historischen Anekdoten über die Rolle von Chören in der Politik bis hin zu überraschenden Momenten wie dem Chorgesang der Roten Armee in der Rudi Carell Show.
Stefan Moster zeigt die faszinierende Welt des Chors und beschreibt, was das Singen in der Gemeinschaft so besonders macht. Ein Muss für alle, die Singen lieben, sei es als aktive Sängerin oder als begeisterter Zuhörer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Stefan Moster
Vom Glück, im Chor zu singen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Erstausgabe, 2025.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin 2025© Stefan Moster 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung und -foto: Pauline Altmann, Palingen
eISBN 978-3-458-78447-0
www.insel-verlag.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Die schöne Welt
Stimmung
Einfach gut
Körper, Atem, Stimme
Nicht allein dastehen
Kulturerbe
Bildungswerk
Gemischt
Divers
Vom Glück, im Chor zu singen
Freudengesang
Schmerzerfüllt, tränenreich
Die Oratorien der kleinen Chöre
Sängerische Intelligenz
Gemeinschaft und Musik
Klang, Gefühle, Sinn
Was beim Zuhören passiert
Ergriffenheit
Stimme und Ohr
Ansteckung
Im Trend
Im Konzert
Choreografie
Chöre in Kirchen
Geistlich, weltlich, menschlich
Credo
Der andere Chor
Politik versus Religion
Gemeinsame Sache
Mit und ohne Uniform
Krieg und Frieden
Gesang und Niedertracht
Arbeiter und, ja, Arbeiterinnen
Liberté, j’écris ton nom
Mein lieber Herr Gesangsverein
Männer
Knaben
Mädchen
Frauen
Proud voices
In anderen Ländern
Glanz ohne Glamour: die Probe
Abläufe
Chemie
Eine spezielle Konstellation
Menschen, die Chöre leiten
Wer gibt den Takt vor?
Jede Stimme wird gehört
Repertoirefragen
Pop
Altersstimmen
Mitsingen
Nachbemerkung
Dank
Informationen zum Buch
Die schöne Welt
Am späten Nachmittag, nachdem die Kaffeetafel abgeräumt war, trafen sie ein, zu Fuß, mit dem Fahrrad, einige mit dem Auto. Einzeln, zu zweit oder in Grüppchen traten sie durch das Gartentor, plaudernd, ohne Eile, kleine Männer, große Männer, dicke, dünne, manche mit krummen Beinen, einige mit auffallend großen Bauern- oder Handwerkerhänden, andere mit weißen, weichen Buchhalterfingern, allesamt gekämmt und die Hälse im engen, von einem Schlipsknoten eingeschnürten weißen Hemdkragen. Es stand Feierliches bevor, man trug schwarzen Anzug, der freilich bei keinem so richtig gut saß, aber vorläufig wurde weiterhin werktäglich und im Dialekt geplaudert, auch dann noch, als alle bereits das von Gemüsebeeten und Obstbäumen umrahmte Rasenstück im Garten erreicht hatten.
Im Haus herrschte Aufregung. Mein Großvater richtete seine Krawatte und reckte den Hals, als wäre er einer der Männer, die gerade sein Grundstück bevölkerten, während meine Großmutter eindringlich meinen Onkel beschwor, nicht »Die schöne Welt« singen zu lassen. Mein Onkel beschwichtigte, gab aber kein Versprechen ab. Stumm vor Nervosität räusperte sich mein Großvater ein ums andere Mal. Er feierte an diesem Tag einen runden Geburtstag, und zu diesem Anlass hatten sich beide Chöre, denen er angehörte, eingefunden, um ihm ein Ständchen zu bringen, der Männergesangverein Heiterkeit und der Männergesangverein Einigkeit, beide geleitet von seinem Sohn, meinem Onkel. Durchs Küchenfenster sah mein Großvater im Sonntagsstaat zu, wie sich hundert Männer, die er allesamt kannte, in Chorformation aufstellten, und wie der Dirigent, der sein Sohn war, vor ihnen Position bezog. Sobald die Formation stand, trat er in einer seltenen Mischung aus schüchternem Zögern und mannhafter Entschlossenheit in Begleitung seiner Frau durch die Haustür auf die Eingangstreppe, um von dieser Warte aus den Sängergruß entgegenzunehmen.
Ich sah alles aus kindlicher Perspektive von der Seite und war ebenfalls gespannt, denn ich wusste, was kam, und wusste daher auch, dass es mich faszinieren würde.
Zuerst versiegte das Geplauder binnen weniger Sekunden vollkommen, die Männer stellten ihre Bewegungen ein, setzten andächtige Mienen auf und blickten auf meinen Onkel, den Dirigenten. Nur der blinde Mann genau in der Mitte der ersten Reihe hielt den Kopf schräg, als wollte er das Ohr dorthin richten, wohin die anderen schauten.
Für einen Moment herrschte absolute Stille, bis mein Onkel die Stimmgabel gegen den Handballen schlug, kurz ans Ohr hielt und die Töne für die jeweilige Stimmlage angab. Die Männer wiederholten die Töne mit gespitzten Lippen. Es folgte ein weiterer Augenblick der Stille, dann gab mein Onkel mit beiden Händen den Einsatz, und die Stimmen, die eben noch in mundartlichem Tonfall geplaudert und gelacht hatten, schraubten sich zu etwas Kostbarem, Feierlichem in die Höhe, zu etwas, wofür das Kind keinen Begriff hatte, wofür es vielleicht auch gar kein Wort gibt, nämlich zu dieser ganz speziellen Form der Lautbildung, wie sie nur ein a cappella singender Chor hervorbringt.
Wo das Alltägliche war, herrschte nunmehr das Erhabene, in dessen Dienst Menschen, die gerade noch über banale Dinge gesprochen hatten, ihre Stimmen stellten: »O wie schön ist dei-hei-he-ne Welt, Vater, wenn sie golden strahha-let!«
Sie sangen also doch »Die schöne Welt«. Meine Großmutter quittierte es mit einem kurzen unwilligen Kopfschütteln, das aber schnell erstarb, denn ihr ging es wie allen, die zuhörten: Sie war bewegt. Genau aus diesem Grund hatte sie das Lied verhindern wollen. Sie wusste, dass auch ihr Mann nicht gegen seine Rührung ankommen würde. Bei den zurückliegenden Anlässen waren ihm schon während der ersten Zeile Tränen in die Augen geschossen. Sie wollte ihn davor bewahren, als Jubilar so exponiert in seiner Ergriffenheit dazustehen. Ihr Sohn hingegen hatte als Chorleiter im Sinn, durch den Gesang ein Maximum an Gefühl hervorzurufen, einen kathartischen emotionalen Strom, der die Seele von allem reinigte, was nicht pure Andacht war. Und kaum ein Werk eignete sich dafür so gut wie »Die schöne Welt«, das in Wahrheit gar nicht so hieß, sondern nur von meiner Großmutter in Unkenntnis des eigentlichen Titels so genannt wurde.
Tatsächlich trägt besagtes Kunstlied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte in As-Dur den Titel Im Abendroth. Franz Schubert hatte es 1825 auf ein Gedicht von Karl Lappe komponiert, veröffentlicht wurde es 1832 postum. Im Grunde handelt es sich um das intime Gebet eines Menschen, und Schubert vertonte es dementsprechend für eine Einzelstimme. Trotzdem existieren zahlreiche Chorfassungen davon, als würde das Lied danach verlangen, in der Gemeinschaft gesungen zu werden. Vermutlich hat es damit zu tun, dass in der lyrischen Rede des Textes etwas zum Ausdruck kommt, dem sich viele Menschen anschließen möchten: das tiefe Einverständnis mit der Schöpfung, das einen angesichts des Sonnenuntergangs erfüllt:
O wie schön ist deine Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet!
Wenn dein Glanz herniederfällt,
Und den Staub mit Schimmer malet;
Wenn das Roth, das in der Wolke blinkt,
In mein stilles Fenster sinkt!
Vor allem aber muss es damit zu tun haben, dass Lappes Gedicht von Schuberts Komposition so sehr aufgewertet wird, dass der Gestus des Textes vollkommen in der Musik aufgeht, mit dem Effekt, dass die Aussage erhalten bleibt, zugleich aber einzelne Laute (etwa die Sch-Laute, von denen es eine ganze Reihe gibt, aber besonders natürlich die Vokale, die das Strahlen ebenso verkörpern wie das Schimmern) den musikalischen Ausdruck noch verstärken.
Schuberts Lied ist genial, dabei jedoch einfach genug, um von einem Laienchor überzeugend vorgetragen werden zu können. Den hundert Männern in unserem Garten gelang dies so vortrefflich, dass niemand von ihrem Gesang unberührt blieb. Die Ergriffenheit war allgemein, sie packte jeden und jede, sie stiftete Gemeinschaft. Gemeinsam standen wir vor Gottes Schöpfung. Ihr Anblick forderte unseren Gesang heraus, da es angesichts ihrer Schönheit mit schnödem Sprechen nicht getan war, und der Chor übernahm diese Aufgabe stellvertretend für uns alle.
Später stiftete dann auch die Rückkehr ins Profane auf ihre Weise Gemeinschaft. Es wurde ein Imbiss an die Sänger ausgeteilt, allgemeines Plaudern und Lachen erfüllte den anbrechenden Abend, und als die Sänger schließlich gingen, in Grüppchen, zu zweit, nur wenige einzeln, hatten sie zweihundert Mettbrötchen verzehrt und fünfzig Flaschen Weißwein getrunken.
Sie hatten mehr als nur dieses eine Lied gesungen, aber ich bin mir sicher, dass ihnen auf dem Nachhauseweg vor allem die zweite Strophe von Schuberts Abendroth noch in den Ohren klang:
Könnt’ ich klagen, könnt’ ich zagen?
Irre seyn an dir und mir?
Nein, ich will im Busen tragen
Deinen Himmel schon dahier.
Und dies Herz, eh’ es zusammenbricht,
Trinkt noch Gluth und schlürft noch Licht.
Haus und Hof waren die gleichen wie zuvor, aber dank des Chors lag aus meiner Kindersicht nun ein Glanz darüber, den es vorher nicht gegeben hatte. Und mein Großvater blieb den restlichen Abend über still. Es war kein frommes Wort gesprochen, aber trotzdem der Rand des Himmels berührt worden.
Schuberts Lied war ein Gebet, das auch Weltlichen offenstand. Und als der Chor es sang, konnte man glauben, dass es aus dem Mund der ganzen Menschheit kam.
Stimmung
Die Männer, die nach dem Geburtstagsständchen und der anschließenden Verköstigung unseren Garten verließen, hatten beste Laune, ihre Wangen wiesen rote Tönung auf, aufgeräumt gingen sie in den Abend. Waren sie glücklich? Und wenn ja, welchen Anteil hatte der Chorgesang daran?
Falls auf die musik- und biopsychologische Forschung Verlass ist, müssen sie glücklich gewesen sein. Etliche wissenschaftliche Studien haben nämlich stichhaltige Indizien dafür gesammelt, dass Singen Glücksgefühle erzeugt. Menschen, die im Chor singen, wissen das natürlich seit jeher, aber nur wenige werden exakt beschreiben können, wie das physiologisch und neurologisch zu erklären ist.
Die Mitglieder der beiden Männergesangvereine, die meinem Großvater »Die schöne Welt« sangen, hätten es vermutlich auch nicht gekonnt. Gefragt nach der positiven Wirkung des Singens, hätten sie sich womöglich auf die Namen ihrer Chöre berufen und die Begriffe Heiterkeit und Einigkeit ins Spiel gebracht. Damit wäre dann aus ihrer Sicht alles erklärt gewesen: Singen im Chor macht munter und stärkt den Zusammenhalt.
Erkundigt man sich bei Menschen, die in Chören aktiv sind, danach, wie sich das gemeinschaftliche Singen auf ihre Stimmung auswirkt, hört man aus den unterschiedlichsten Mündern ähnliche Formulierungen. Es mache Freude, bereite gute Laune, steigere das Wohlbefinden, wirke entspannend, baue Stress ab, könne sogar Ängste und seelische Belastungen mindern. Überdies wirke es erhebend, befreiend, beflügelnd, beglückend und sorge für einen klaren Kopf. Bisweilen fallen auch ambitionierte Äußerungen, wie die, man tauche in eine andere Welt ein, das Singen sei ein Weg, die eigene Mitte zu finden, der Chorgesang mithin ein natürliches Antidepressivum, weil man alles aus sich heraussinge.
Wer diesen Aussagen mit Skepsis begegnet, sollte einfach ein Chorkonzert besuchen, sich in eine der vorderen Reihen setzen und die Sänger bei der Arbeit betrachten. Anzeichen von Missmut wird er oder sie kaum beobachten können. Kein Mensch kann grimmig aus voller Kehle singen. Sollte einer Sopranistin oder einem Tenor beim Einsingen eine Laus über die Leber gelaufen sein, merkt man davon nichts mehr.
Beim Singen geschieht etwas mit dem Menschen, weshalb es kein Wunder ist, dass ihm überall auf der Welt eine wichtige Rolle zukommt. Eine Kultur, in der nicht gesungen wird, gibt es auf diesem Planeten nicht. Bei manchen Völkern erhält der Gesang sogar eine außerordentlich große Bedeutung, etwa bei den Aborigines in Australien, die ihr Land in mythische Songlines (im Deutschen oft als Traumpfade bezeichnet) gliedern und diese von Generation zu Generation weitergeben – durch Gesang. Oder bei den im dünn besiedelten Norden lebenden Sámi, die in ihren traditionellen Joiks alle möglichen Naturphänomene und Tiere, aber auch Menschen besingen, um dem Gegenstand ihres Gesanges näher zu kommen, wobei sie kein fertiges Lied mitbringen, sondern es sich vom angesungenen Objekt eingeben lassen. Oder bei den im Osten Sibiriens lebenden Tschuktschen, die jedem neugeborenen Kind eine Melodie mitgeben, als ein Bestandteil der Identität, den man in kein Formular eintragen, sondern nur singen kann und der dem Kind Glück im Leben bringen soll.
Klingt fantastisch, auch ein bisschen fremd, doch nur für den ersten Moment, denn kennen wir nicht aus eigener Erfahrung das Phänomen, eine Melodie in uns zu haben, die sich in einer außergewöhnlichen Situation, zum Beispiel wenn wir allein am Meer stehen, meldet und gesungen werden will, jedes Mal die gleiche, geradeso als trüge jeder Mensch eine persönliche Hymne in sich?
»Gesang ist Dasein«, schreibt Rilke in seinem dritten Sonett an Orpheus. In Wahrheit sind wir alle Singende, viele von uns praktizieren nur zu selten und bringen sich um die Erfahrung, wie es ist, wenn sich die Sinne öffnen, der Körper in Schwingung gerät und die Haltung sich ändert, sodass man meint, zwei Zentimeter zu wachsen. Das Hochgefühl ist keine Einbildung, es stecken wissenschaftlich belegte Fakten dahinter: Beim Singen werden Glücks- und Bindungshormone ausgeschüttet.
Dazu gleich mehr, zuvor dürfen wir aber das zweite Wort nicht vergessen, das die Mitglieder der Männergesangvereine in die Debatte über die Dimensionen des Chorgesangs geworfen hätten: die Einigkeit. Oder auch: das Glück der Gemeinschaft.
Ob man die Menschen, die im Chor neben, hinter oder vor einem stehen, mag oder nicht, man spürt beim Singen mit ihnen in jedem Fall eine gemeinsame Resonanz. Alle tragen zum Entstehen derselben Musik bei, da werden Fragen der Sympathie obsolet. Durch die Musik fühlt man sich mit den anderen und mit der Welt mehr verbunden als sonst. Das tut gut, darum suchen so viele die Gelegenheit, sich in diesen Gefühlszustand hineinzubegeben, zum Beispiel beim Singen der Lieder in einer Kirche, oder beim Einstimmen in die Gesänge in einem Fußballstadion. In beiden Fällen können die Singenden durchaus gefordert werden, denn manche Lieder im Gesangbuch verlangen der Gemeinde höchste Töne und anspruchsvolle Intervallsprünge ab oder weisen rhythmische Raffinessen auf. Und wer schon mal versucht hat, im Chor Zehntausender You’ll Never Walk Alone mitzusingen, weiß, dass es sich dabei keineswegs um einen Gassenhauer handelt, den man auf Anhieb grölen kann. In manche Fan-Schals ist der wortreiche Text eingewoben, damit man mitlesen kann, wenn man den Schal in die Höhe hält. Es wäre hilfreich, zusätzlich die Noten vor sich zu haben.
»Gänsehaut pur«, heißt es oft, wenn von solchen kollektiven Gesangsmomenten die Rede ist. Was damit gemeint ist, versteht man schon, wenn man in einem Konzertmitschnitt sieht und hört, wie fünfzigtausend Menschen die Lieder von Coldplay mitsingen, von der ersten bis zur letzten Zeile, und dabei vollkommen glücklich wirken.
Mit solchen Gelegenheitserfahrungen im gemeinschaftlichen Singen kommen viele Menschen irgendwann in Berührung. Es sind einzelne Momente emotionaler Ausschläge. Tritt man einem Chor bei, verstetigt sich etwas davon. Manche Musikwissenschaftler und Musiktherapeuten sehen im Chorsingen das menschliche Bedürfnis nach Gemeinschaft und Gemeinsamkeit auf geradezu ideale Weise erfüllt, denn im Chor braucht man sich gegenseitig, formt gemeinsam Harmonien und löst Dissonanzen auf. Gemeinsames Singen bedeutet gemeinsame Frequenz, nicht nur im metaphorischen Sinn. Eine Studie der Universität Göteborg kommt zu dem Ergebnis, dass bei Menschen, die im Chor singen, das Herz nach einer gewissen Zeit im gleichen Takt schlägt, wobei sich der Herzrhythmus stabilisiert. Und wenn Menschen ihre Handlungen aufeinander abstimmen, wie beim gemeinsamen Musizieren, synchronisieren sich auch ihre Hirnwellen. Interbrain Synchrony nennt man das, und erforscht hat es zum Beipiel das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik durch Messungen der Gehirnströme bei zusammen spielenden Musikern.
Das Gehirn ist ein soziales Organ, das Herz schlägt gern im Gleichklang, und beim gemeinsamen Singen funktioniert das besonders gut, weil man zusammen etwas gestaltet und dabei auch noch gemeinsam atmet. Dies wiederum ist eine unmittelbare Erfahrung, der man sich nicht entziehen kann und die man von außen bloß deshalb nicht in ihrer ganzen Eindeutigkeit als körperlichen Akt wahrnimmt, weil sie im Rahmen kultureller Konventionen stattfindet: in Choraufstellung, mit aufgeschlagener Chormappe oder leuchtendem Tablet, vielleicht sogar in Konzertkleidung auf einer Bühne, vor Publikum.
Einfach gut
»Was passiert beim Singen im Chor eigentlich mit mir? Diese Frage werden viele für sich persönlich schon beantwortet haben, aber vielleicht nicht unbedingt in physiologischer Hinsicht. Ich kann mir jedenfalls nur schwer vorstellen, dass die Arbeiter, Handwerker, Bauern und Buchhalter der Männergesangvereine Heiterkeit und Einigkeit ein klares Bild davon gehabt haben sollten, was sich bei ihnen hormonell tat, als sie beim Geburtstag meines Großvaters Schubert sangen. Womöglich wussten sie nicht einmal, dass beim Singen Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die das Belohnungssystem aktivieren. Sie fühlten sich nach ihrem Auftritt einfach gut (schon bevor sie zur Weißweinverkostung schritten), so wie sich jeder Mensch nach dem Singen gut fühlt. Ein bisschen wie nach leichtem Sport. Man hat sich angestrengt, aber nicht zu sehr, man spürt, wie das Herz-Kreislauf-System auf angenehme Art in Schwung gekommen ist.
Dass man sich rundum etwas Gutes tut, wenn man im Chor singt, ist längst bewiesen. Es hat viel damit zu tun, dass man beim Singen lernt, wie man richtig atmet, nämlich in den unteren Teil der Lunge hinein (»in den Bauch«, wie man landläufig sagt). Von dieser Atemtechnik profitieren Gehirn und Herz und alle anderen Organe, weil sie für gute Durchblutung sorgt.
Ein weiterer Effekt: man steht gut da, im Sinn des Wortes, denn richtiges Atmen entspannt den Brustkorb und stärkt die Rückenmuskulatur. Man trainiert sich singend wie beim Dauerlauf und gewinnt nebenbei eine aufrechte Haltung.
Gleichzeitig sortiert sich hormonell so einiges. Einer Studie konnte ich entnehmen, dass Menschen, die sich als eher nicht glücklich bezeichnet hatten, nach drei Monaten wöchentlicher Chorproben angaben, sich als Sänger glücklich zu fühlen. Sie brachten damit zum Ausdruck, was ihre Speichelproben bestätigten: Ihre Oxytocin-Werte waren gestiegen. Dieser stresslindernde und das Wohlbefinden steigernde, als Hormon wirksame Botenstoff ist bei den innigsten Momenten aktiv, bei der Geburt und beim Stillen, kommt aber auch bei sozialen Interaktionen zwischen Geschlechtspartnern zum Einsatz, was ihm das Synonym »Kuschelhormon« eingebracht hat.
Mit dem Oxytocin allein ist es nicht getan. Eine andere Studie weist bei Mitgliedern eines Kirchenchors, der Mozarts Requiem sang, einen Anstieg des Immunoglobulins A nach, eines Hormons, das bei der Abwehr von Krankheitserregern in den Schleimhäuten aktiv wird. Und eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen aus verschiedenen Ländern belegt, dass es beim Singen zur Freisetzung von Endorphinen, Serotonin und Dopamin kommt. Außerdem wird noch die Zirbeldrüse aktiviert und dort Melatonin ausgeschüttet, das Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, ausgleichend wirkt, bei Winterdepressionen eingesetzt wird und selbst bei der Krebsprophylaxe und Krebstherapie zum Einsatz kommt.
Die Faktenlage ist also überzeugend: Wer singt, tut etwas für sein Wohlbefinden und stärkt sein Immunsystem. Die Männer der Gesangvereine Heiterkeit und Einigkeit waren gewappnet – ob sie das nun im Bewusstsein hatten oder nicht.
Vermutlich verbirgt sich hier einer der Gründe, warum uns Chöre wie eine Phalanx der Entschlossenheit gegenüberzutreten scheinen, wach im Gesicht und mit Spannung im Körper, bereit, sich dem Leben zu stellen, was immer es bringen mag.
Wer gut bei Stimme ist, steht gut im Leben. – Das wäre der Umkehrschluss der Erfahrung, dass Unwohlsein auf die Stimme schlägt. Die Stichhaltigkeit dieser These kann man an sich selbst überprüfen. In schlechter Verfassung singt es sich schlecht. Der leidende Mensch bringt nicht genügend Atemluft hinter sein Lied. Wer trauert, bekommt keinen Ton heraus.
Vielleicht hat es deshalb in diversen Kulturen Klageweiber gegeben, die stellvertretend für diejenigen, denen es die Stimme verschlagen hatte, im Chor lamentierten. Und womöglich ist der Chor, der das Requiem von Mozart, Verdi, Brahms, Ligeti oder Penderecki singt, die Fortsetzung und Erweiterung dieser folkloristischen Tradition in die Kunst. Als würde er mit seinem sängerischen Können die ausgefeilten Kompositionen im kulturellen Auftrag darbieten und stellvertretend für die gesamte Menschheit rufen: Libera me Domine, de morte aeterna (Befreie mich, Herr, vom ewigen Tod)!
Körper, Atem, Stimme
Erstaunlich, wie schnell man beim Gebet landet, wenn man sich Gedanken über den Gebrauch der Stimme macht! Im Nu führen die Überlegungen vom biochemischen Botenstoff zur kosmischen Erfahrung, wohl weil der Gesang von innen kommt, aber im weiten Raum Widerhall sucht.
Wenden wir uns noch einmal der Körperlichkeit des Singens zu. Sie erschöpft sich natürlich nicht in den hormonellen Abläufen, so dopamingesättigt sie sein mögen, denn beim Singen werden an die hundert Muskeln beansprucht. Im Einsatz sind der Vokaltrakt, die Stimmlippen im Kehlkopf, Zwerchfell und Lunge sowie Muskeln in Gesicht, Nacken, Brust, Bauch und Rücken. Das Singen verlangt, damit es die optimale Unterstützung erfährt, ein spezielles Verhältnis zum eigenen Körper, das nichts gemein hat mit der Haltung, in der wir in den Spiegel schauen. Beim Singen kann ich nicht den Bauch einziehen. Formende Unterwäsche hat auch in einem Frauenchor nichts verloren. Man darf den Gürtel nicht zu eng schnallen und sich nicht in ein Kleid zwängen, das einem die Luft zum Atmen nimmt. Will ich singen, muss ich vergessen können, wie ich aussehe, denn der Atem, den die Stimme braucht, um sich entfalten zu können, ist auf den ganzen Körper angewiesen, so wie er ist. Beim Singen wird der Körper zum Instrument, und für dieses Instrument gelten weder DIN-Normen noch Ideal-Maße. Wer als Instrument erklingen will, muss in seinem Resonanzkörper zu Hause sein. Mit einem Wort: Das Singen begünstigt das Eins-Sein mit dem eigenen Körper, und es würde mich wundern, wenn nicht auch hierin einer der Gründe läge, warum Singen glücklich machen kann.
Damit, dass man als Sängerin oder Sänger seinen Körper einsetzt, ist es nicht getan, denn sobald man sich auf eine Bühne begibt, zeigt man sich auch in seiner ganzen leiblichen Gestalt. Bin ich selbst der Resonanzkörper, kann ich mich nicht hinter einem Instrument verstecken. Ich stehe unverdeckt vorm Publikum und präsentiere mich, wie ich bin.
Das Publikum wiederum blickt auf den Chor und sieht alle Arten von Menschen, alle Ausprägungen von physischer Gestalt vor sich. Besonders deutlich wird das, wenn Chöre nicht dicht an dicht in klassischer Aufstellung dastehen, sondern in lockerer Formation. Dann repräsentieren die sechzehn Mitglieder eines Kammerchors sechzehn Varianten der menschlichen Erscheinung und der Blick auf den Chor gleicht dem Blick auf den Menschen an sich.
Gewiss denken die wenigsten beim Besuch eines Chorkonzerts an die körperliche Dimension des Singens, denn sie kommen wegen der Musik, also wegen des Kulturgenusses. Wir neigen sogar dazu, den Gedanken an den Körper zu verdrängen, indem wir bei der Beschreibung von gelungenem Gesang zu ganz und gar unkörperlichen Adjektiven wie »himmlisch« greifen. Die Menschen aber, die auf der Bühne stehen und uns den Genuss bereiten, wissen, dass sie keine Engel sind und es der ganz und gar irdische Körper ist, der die himmlischen Töne ermöglicht. Das herrliche Halleluja kommt aus den Bäuchen, Lungen, Kehlen, Rachen, Mündern von Menschen wie du und ich.
Beim Streichen mit dem Bogen über die Saiten einer Violine, beim Blasen ins Schilfrohr des Oboen-Mundstücks, beim Berühren der Tasten eines Flügels kann »himmlische« Musik entstehen, aber wer ein Instrument spielt, führt keine Handlung aus, die außerhalb der Musik lebensnotwendig wäre, nicht einmal im Falle des Blasinstruments, obwohl dabei Atemluft eingesetzt wird, denn Pusten ist nicht Atmen.
Das Singen hingegen lebt vom Atmen, also von dem, was wir für die entscheidende Lebensfunktion halten. Ohne Atem kein Leben. Ohne Atmen kein Singen. Singen ist das große Atmen, der Gesang im Chor die großartigste Atembekundung, die es gibt. Wir betrachten es nie mit Gleichgültigkeit, wie sie da zusammenstehen, die so unterschiedlichen Körper, die sich im Dienst der Musik synchronisieren und im Gleichtakt atmen, um eine gemeinsame Stimme zu finden.
Klingt pathetisch? Klar. Lässt sich aber nicht vermeiden, wenn man der Sache gerecht werden will. Chorgesang ist schließlich angewandtes Pathos, also, laut der Definition im Duden: »feierliches Ergriffensein, leidenschaftlich bewegter Gefühlsausdruck«.
Als Voraussetzung aller Lebensfunktionen trägt der Atem auch die Stimme. Diese wiederum ist die Voraussetzung der Verständigung. Was mit der Stimme gemacht wird, spricht uns an – je schöner es klingt, desto mehr.
Nicht allein dastehen
Anders als beim Sologesang steht man im Chor nicht allein da. Was für eine Erleichterung! Zwar kann man sich nicht ganz verstecken, selbst wenn man in der letzten Reihe steht, und man sollte aus der Tatsache, dass man einer oder eine von vielen ist, nicht die Lizenz zum falschen Ton ableiten, aber ob es gut klingt, hängt nicht allein von einem selbst ab.
Im Konzert eines Frauenchors sah ich, wie eine Sängerin, die in der ersten Reihe stand, plötzlich aufhörte zu singen, ihren Platz verließ und an den seitlichen Rand der Bühne trat. Ihre Mitsängerinnen reagierten in keiner Weise, und ich konnte nicht hören, dass sich der Gesamtklang wesentlich verändert hätte, obwohl nur noch fünfzehn statt sechzehn Sängerinnen aktiv waren. Später stellte sich heraus, dass die Sopranistin ein Stimmproblem bekommen hatte und darum lieber ausgestiegen war, als einen Missklang zu verursachen. Ihre Kolleginnen glichen ihr Ausscheiden souverän aus. Als Solistin hätte sie das Konzert abbrechen müssen.
Das Entstehen von Interbrain Synchrony und die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin sind messbare Beweise dafür, dass im Chor eine Beziehung zu den Mitsingenden aufgebaut wird und die Wirkung auf das Befinden daher noch intensiver ausfällt, als wenn man alleine singt. Zusätzlich wird das Gemeinschaftsgefühl durch Aspekte gestärkt, die keiner Messung bedürfen, weil sie auch ohne Faktenbasis sofort einleuchten:
Wie gut sich die Mitglieder eines Chores verstehen müssen, ist schwer zu bestimmen. Dass alle miteinander befreundet sind, dürfte eher unwahrscheinlich sein, aber der Clou im Chor besteht darin, dass eine Verbindung entsteht, die weder Verwandtschaft noch Freundschaft noch das Begehren benötigt.
Man sieht sich regelmäßig zu allen Zeiten des Jahres, verbringt viele Stunden miteinander, hat ein gemeinsames Ziel.
Man teilt die Verpflichtung, regelmäßig zur Probe zu kommen, arbeitet gemeinsam an etwas, das größer ist als jeder Einzelne für sich. Man teilt den Wunsch, gemeinsam ein Kunstwerk entstehen zu lassen.
Es zählt jede Stimme, aber es könnte notfalls auch auf eine verzichtet werden. Wer mitmacht, muss richtig mitmachen, alle sind darauf angewiesen, dass alle tun, was verlangt wird.
Es ist egal, wie man aussieht. Es ist egal, was man für ein Typ ist. Es kommt darauf an, dass man den Ton trifft.
In einem Chor spielt es keine Rolle, was man beruflich macht (falls es sich nicht um einen Polizeichor, Feuerwehrchor, Ärztechor, Lokführerchor handelt, es gibt von der Sorte mehr, als man glaubt). Die politische Einstellung schlägt nicht zu Buche (sofern man nicht einem Ensemble angehört, das sich auf politische Lieder spezialisiert hat), die soziale Zugehörigkeit tritt in den Hintergrund, und das Religiöse löst sich im gemeinsamen Jauchzen und Frohlocken von Gläubigen und Atheisten auf. Außerdem handelt es sich beim Singen im Chor um den seltenen Fall, dass verschiedene Generationen gemeinsam etwas tun. Welche Sportart bringt eine achtzehnjährige Frau und einen achtzigjährigen Mann zusammen? Im Chor singen sie ganz selbstverständlich dasselbe Oratorium.
Man teilt eine Freude. Man macht die Erfahrung, mit den Aufgaben und Projekten gemeinsam zu wachsen.
Man lernt eine gemeinsame Sprache: die Sprache des jeweiligen Werks. Man »spricht« denselben Text.
Jeder trägt seine Stimme bei. Jede bringt ihre Töne mit. Dann wird der Klang angeglichen, sodass die vielen Stimmen zum Klangkörper werden.