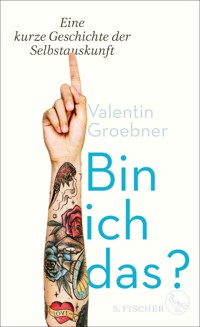
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was steckt eigentlich hinter dem neuen Zwang, sich zu zeigen? Mit viel Humor, Selbstironie und klugen Beobachtungen erzählt Valentin Groebner – »eine(r) der coolsten Geschichtswissenschaftler momentan überhaupt« (litera.taz) – seine kurze Geschichte der Selbstauskunft. Denn ob im Bewerbungsgespräch oder per Instagram-Account, bei der Teambildung oder im Dating-Profil: Ohne Selbstauskunft geht heute nichts. Sie ist sowohl Lockstoff als auch Pflicht, steht für Reklame in eigener Sache und das Versprechen auf Intensität und Erlösung, in den Tretmühlen der digitalen Kanäle ebenso wie in politischen Debatten um kollektive Zugehörigkeit. Aber wie viel davon ist eigentlich Zwang, und wie viel Lust? Was haben wir, was haben andere vom inflationären Ich-Sagen und Wir-Sagen? Diesen Fragen geht Valentin Groebner auf der Suche nach dem Alltäglichen nach. Er zeigt, was historische Beschwörungen der Heimat mit offenherzigen Tattoos gemeinsam haben, und was den Umgang mit alten Familienfotos und demonstrative Rituale des Paar-Glücks (Stichwort Liebesschlösser an Brückengeländern) verbindet. Doch ist öffentliche Intimität wirklich die Währung für Erfolg – oder eine Falle?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Valentin Groebner
Bin ich das?
Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft
Über dieses Buch
Vom Bewerbungsgespräch bis zum Instagram Account, von der Teambildung bis zum Dating-Profil: Ohne Selbstauskunft geht es nicht. Sie ist Lockstoff und Pflicht, Reklame in eigener Sache und Versprechen auf Intensität und Erlösung, in den Tretmühlen der digitalen Kanäle ebenso wie in politischen Debatten um kollektive Zugehörigkeit.Der Lust und dem Zwang zum Ich- und Wir-Sagen geht Valentin Groebner in seiner amüsanten Geschichte des Alltäglichen nach. Er verknüpft historische Beschwörungen der Heimat mit offenherzigen Tattoos, die wilden Rebellen von früher mit den etwas melancholischen Leistungsträgern von heute, den Umgang mit alten Familienfotos mit den demonstrativen Ritualen des Paarglücks. Und er fragt: Ist öffentliche Intimität wirklich die Währung für Erfolg – oder eine Falle?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Valentin Groebner, geboren 1962 in Wien, lehrt als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Er ist Autor zahlreicher Bücher zur Kultur- und Wissenschaftsgeschichte; seit 2017 ist er Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sein neues Buch ist eine ziemlich persönliche Geschichte über die Frage, warum wir uns im 21. Jahrhundert endlos zur Schau stellen und selbst intime Einblicke in unser (Seelen-)Leben öffentlich machen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491446-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Wer?
Nahgeschichte
Geschichte als Slogan
Immunsysteme
1. Ich-Sagen
Erforsche Dich selbst
Gefühlsübertragung
Bezahl mich fürs Fernsehen
2. Auftreten
Erinnere Dich
Erzählen ist Arbeit
Zeig Dich
Vor dem Spiegel
3. Heimatkunde
Selbsteingemeindungen
Wo ist der Feind?
Ein kompliziertes Wort
Die Heimat von früher
Rückkehr in die Endlosschleife
4. Auf Klassenfahrt
Döh-bling
Wenn alles stimmt
Sex im Sozialreaktor
5. Bilder aus der Vergangenheit
Fotomassen
Erinnerungsmaschinen
Fragile Überreste
6. Unter die Haut
Im Reich der Zeichen
Öffentliche Empfindungen
Unwiderruflich Ich
Übermut und Langeweile
7. Bescherung
Der Herr der Wünsche
Wunscherfüllungen
Im Namen der Liebe
Wunscherfüllung Teil 2
Ursachenforschung
Neujahr
8. Hinterher, jetzt
Meine Befürchtungen, das bin Ich
Regeln für Erwachsene
Stimmungsaufhellende Mittel
Dank
Wer?
Zeige dich. Gib Auskunft über das, was du schön findest. Erzähl deine Geschichte, deine Herkunft, deine Wünsche. Reden über sich selbst als öffentliche Intimität ist im 21. Jahrhundert nicht nur Merkmal von Teilhabe und Offenheit, sondern gilt als unverzichtbar für privaten und beruflichen Erfolg. Geht das? Um welchen Preis?
Davon handelt dieses Buch. Was geschieht, wenn ich erzähle, woher ich komme? In wen verwandle ich mich, wenn ich von mir als Mitglied einer Gemeinschaft berichte? Oder mehrerer – denn Heimat ist ja offensichtlich nicht nur ein Ort, sondern auch ein kollektiver Zustand. Was geschieht, wenn ich Fotografien von früher zeige oder, noch intimer, die Zeichen auf meiner Haut? Verbinden sie mich mit anderen, oder demonstrieren sie unüberbrückbare Unterschiede und Gegensätze?
Seit der Einführung der Beichte vor acht und der Erfindung des autobiographischen Versuchs vor viereinhalb Jahrhunderten soll Selbstauskunft die Person, die da über sich Auskunft gibt, verbessern. Selbstauskunft ist deswegen anstrengend. Und Selbstauskunft ist Arbeit an der Verwandlung – also potenziell endlos, weil sie immer etwas wiedergutmachen soll an der eigenen Geschichte und an ihren Lücken. Mindestens so sehr wie von der Vergangenheit handelt sie deshalb von der Zukunft, von den eigenen Wünschen. Und sie dreht sich nicht nur um mich, sondern fast noch mehr um jene Personen, Institutionen und Kanäle, von denen ich abhängig bin und für die ich mich deshalb präsentiere. Sie ist ein Spiegelkabinett. Hat es einen Ausgang?
Nahgeschichte
Der eigene Alltag ist eine eher unübersichtliche Zone. In ihm warten Überraschungen und Ungeheuer; er ist Nahgeschichte, ganz persönlich. Ich bin Historiker, und deswegen bin ich in diesem Buch in der Nachfolge der Alltagsgeschichte unterwegs, der Geschichtswerkstätten und der »Microstoria« der 1970er und 1980er Jahre. Die engagierten Kolleginnen und Kollegen von damals wollten die subjektiven Erfahrungen ganz gewöhnlicher Frauen und Männer in der Vergangenheit rekonstruieren. Deren Wirklichkeiten und Wahrnehmungen sahen häufig sehr anders aus als die großen Fortschrittserzählungen der üblichen Politik-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Die subjektiven Erfahrungen und Selbstbilder derjenigen, die historische Veränderungen miterlebt hatten, wollten zu den vertrauten Geschichtsbildern nicht passen. Diese Widersprüche lösten engagierte Debatten über die Praxis historischer Forschung aus, die aus ihnen ordentliche polemische Verve und politische Energie bezogen.[1]
Vierzig Jahre später hat sich das Verhältnis zwischen dem subjektiven Erleben und den anonymen großen Strukturen umgedreht. Als bemerkenswert, berichtenswürdig und »authentisch« gilt gerade das Individuelle, Persönliche, emotional Gefärbte, zumal im Zusammenhang mit kollektiven Vergangenheiten, die als »Reservoir« für das eigene Selbstbild und die eigene »Identität« aufgefasst werden – ein Wort, das in diesem Buch absichtlich nicht verwendet wird.[2] Die Vergangenheit ist im 21. Jahrhundert zum Ich-Material in einem ganz wörtlichen Sinn geworden, zum Rohstoff für smarte Unterhaltungsangebote vom historischen Erlebnisparcours bis zum Wellness-Hotel, von den Werbeagenturen ganz zu schweigen.
So hatten sich das die Aktivistinnen in italienischen Fabriken, in Historiker- und Hausbesetzerkollektiven der 1970er Jahre nicht vorgestellt, als sie die Alltagsgeschichte, die Geschichte von unten und die Microstoria erfanden, die gleichzeitig Konzepte und Kampfrufe waren. Aber Ideen sind gerade dann erfolgreich, wenn sie sich selbständig machen und verwandeln, bis sie kaum mehr wiederzuerkennen sind. Und der Alltag ist der Ort, wo die Ideen konkret werden und sich in Dinge und Handlungen verwandeln – oder eben nicht. Mein eigener Alltag ist das, was ich am genauesten kenne, und gleichzeitig das, was meiner Kontrolle weitgehend entzogen ist. Kann ich bestimmen, welche Plakate ich täglich sehe, in welchen Staus ich stehe, welche behördlichen Bestimmungen meine Einkäufe, Reisen, Konsumgewohnheiten regeln?
Nicht in den ereignisreichen Jahren 2020 und 2021, in denen dieses Buch entstanden ist. Sie standen unter dem Zeichen staatlicher Bekämpfung einer neuen ansteckenden Krankheit. Sie veränderte überall auf der Welt den Alltag dramatisch, in einer Weise, die sich vorher niemand vorstellen konnte – oder mochte, entsprechende Planspiele und Notfallpläne hatte es durchaus gegeben.[3] Nur waren die eben Theorie gewesen. Der Alltag dagegen ist Praxis, eigene Praxis. Und Zumutung.
Dem Praktischen, das man sich nicht ausgesucht hat, ist diese Nahgeschichte gewidmet. Man könnte sie auch eine Geschichte in Zeitlupe nennen: einen Gegenwartsgegenstand in verlangsamter Wiederholung ansehen. In diesem Modus – »noch einmal, aber ganz langsam« – sieht das Alltägliche und vermeintlich Vertraute plötzlich erstaunlich fremd aus. Nahgeschichte mag nach Nacktschnecke klingen. Wie diese ist sie etwas glitschig – und klebrig. Ich hafte an dem, was mich anödet, anheimelnd nah. Aber Nahgeschichte ermöglicht Selbstbefragung. Ich weiß über das banale Alltägliche sehr viel weniger, als es mir selbst vorkommt.
Geschichte als Slogan
Oktober 2020, eine Polizeistreife im Zug hinter Passau an der österreichisch-deutschen Grenze. Zusammen mit den uniformierten Beamten sei ein bewaffneter Polizist in Zivil durch die Waggons gegangen, schreibt die Freundin. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit bärtigem, runenverziertem Totenkopf auf dem Rücken und der weißen Aufschrift: »See you in Valhalla«.
Der Staatsdiener, der hier seinen Job macht, will gleichzeitig etwas über sich selbst mitteilen. Der Slogan auf seinem Pullover ist offensichtlich eine Einladung – aber wohin? Das nicht weit entfernte Walhalla im niederbayrischen Oberstauf, ein neoantiker Supertempel zum Andenken an große Germanen, 1842 eröffnet, hat er offensichtlich nicht gemeint, sonst wäre die Schreibweise anders.[1] Was wissen wir über den Ort, der auf Englisch Valhalla heißt?
Okay, Historiker, schlag nach. Valhalla war für die frühmittelalterlichen heidnischen nordischen Krieger die große Belohnung im Jenseits, also Endziel, finales Zuhause. Nur Männer kamen dort hin. Die Wikinger, weiß die neuere Forschung, waren nicht sehr nett zu ihren Frauen. Archäologische Analysen ihrer Gräber zeigen, dass 37 Prozent der weiblichen Kinder bei ihnen unterernährt waren, gegenüber 7 Prozent der männlichen. In der Mitte des 6. Jahrhunderts erlebte Nordeuropa nach gewaltigen Vulkanausbrüchen mit globalen Folgen mehrjährige Dauerwinter. Sie ließen gleichzeitig mit dem Zerfall des römischen Imperiums eine extrem gewalttätige Elite aufsteigen, eine »gangster culture«, wie eine neue Studie sie nennt.[2] Ihre berühmten Raubzüge unternahmen sie nicht ganz freiwillig. Groß und blond, wie sie in den Comics und Filmen erscheinen, waren die wenigsten von ihnen. Die Krieger auf den Drachenbooten, das haben genetische Analysen von Fundmaterial aus ganz Europa gezeigt, waren sehr heterogener Herkunft: Wikinger war keine Abstammung, sondern ein Beruf.[3] Valhalla als Heimat gewalttätiger unfreiwilliger Junggesellen und Klimaflüchtlinge, ziemlich arme Schweine, wenn man den ganzen Ethno-Kitsch weglässt – will man da wirklich hin?
Immunsysteme
Ob Polizist in Bayern oder Professor in der Schweiz, jede und jeder kommt sich selbst einzigartig und so außergewöhnlich wie möglich vor. Aber das eigene Wohlbefinden, und noch viele andere Dinge mehr, wie Arbeitsmöglichkeiten, Bewegungsfreiheit, Selbstbestimmung, sind direkt abhängig von unsichtbaren, machtvollen Kollektivkörpern. Sie sind, wie wir 2020 gelernt haben, als Immunsysteme organisiert.
In Immunsystemen ist man immer Teil eines Kollektivs, unabhängig davon, als wie individuell man sich selbst beschreibt und ob man mitmachen will oder nicht. Dem reiselustigen Mikroorganismus, der im Herbst 2019 zum ersten Mal beschrieben worden war, waren die fein differenzierten Selbstbeschreibungen seiner menschlichen Wirtsorganismen – juristische und politische Unterschiede, religiöse und kulturelle Zugehörigkeiten – völlig egal. Das Virus reproduzierte sich in schiitischen Pilgern und maoistischen Parteikadern, in sächsischen Altenpflegerinnen und im britischen Premierminister. Der neue Mitbewohner machte keinen Unterschied zwischen den Körpern, deren Inhaber sich so verschieden vorgekommen waren.
Die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Krankheit ließen all die einzigartigen Individualitäten ebenfalls unwichtig aussehen. Einreise- und Ausgangssperren, die Verpflichtung zu Gesichtsmasken, Quarantäne und zum Daheimbleiben galten für alle, ausnahmslos. Der Wechsel vom selbstverständlichen Reisen zum behördlich untersagten Risikoverhalten war ebenfalls drastisch – wie war das noch mit der selbstbestimmten Mobilität und Individualität als unseren westlichen Werten, auf die wir so stolz waren? Die Digitalisierung war plötzlich nicht mehr selbst gewähltes Werkzeug oder zusätzliche Option, sondern Zwang; die einzig verbliebene Möglichkeit für Musik, Theater und Treffen ohne Maske. Was vorher verlockendes neues Mehr an Kontakt gewesen war, war jetzt seine etwas pixelige Simulation. Vom glitzernden Simulakrum zum einzig noch möglichen Ersatz: Ging ziemlich flott.
August 2020, ein Witz. Ein Immunologe und ein Kardiologe werden in den USA gekidnapped. Erst einmal, sagen die Entführer zu ihnen, müssten sie herausfinden, wer von beiden der Wichtigere sei. Den anderen würden sie erschießen. Also: Wer leiste den größeren Beitrag für die Menschheit? »Ich«, ruft der Herzspezialist, »habe Medikamente entwickelt, die Leben von Millionen Menschen verlängert haben!« Die Kidnapper sind beeindruckt. »Und Sie?«, fragen sie den Immunologen. »Wissen Sie«, sagt der, »das Immunsystem ist extrem kompliziert, und …« »Erschießen Sie mich doch jetzt gleich«, sagt der Kardiologe.[1]
Diesen Witz erzählen offensichtlich Mediziner einander; wenigstens kommen sie in ihm sehr gut weg. Der eine Arzt ist extrem bescheiden, der andere gibt sofort zu, dass sein Kollege wichtiger sei als er. Lob hatten amerikanische Ärzte im Coronajahr 2020/21 offenbar nötig – notfalls eben selbst gespendetes. Die Gesundheitssysteme des wohlhabenden Westens, die kostspieligsten des Planeten, sahen gar nicht gut aus angesichts der ansteckenden Krankheit. Ich-Sagen, erinnert uns der Witz, findet immer vor Publikum statt. Für wen und zu wessen Nutzen erzähle ich von mir?
Wer von Herkunft und Heimat redet, das zeigt der bayrische Polizist mit seinem Wikingerpullover, gibt dabei sehr viel weniger über kollektive Zugehörigkeiten aus der Vergangenheit Auskunft als über sich selbst, jetzt. Aber wer von sich selbst spricht, präsentiert seine eigene individuelle Besonderheit gewöhnlich – ganz wie der Polizist – mit Verweisen auf Altes. Diese Auswahl aus der Vergangenheit, dieses kleine Stück von früher, so die Botschaft, das bin ich. Denn dafür wird die Vergangenheit am häufigsten gebraucht – zur Selbstdarstellung.
Wer sich auf diese Weise mit der Vergangenheit beschäftigt, möchte, dass sie von ihm selbst handelt, ganz persönlich. Das Bild, das in diesem Spiegel erscheint, ist faszinierend: Es verspricht, dass man sich durch eine neu installierte Ich-Geschichte aus der Vergangenheit selbst verändern könnte und irgendwie verbessern, erfundenen nordischen Kriegern ähnlicher werden, wenigstens auf dem Weg nach Valhalla. Gleichzeitig bleibt offen, was die Wikinger eigentlich mit dem enthusiastischen (oder ironischen) Geschichtsbenutzer zu tun haben. Auffallend nordisch sah der bayrische Grenzpolizist jedenfalls nicht aus. Außerdem ist es ein bisschen beunruhigend, wenn ein bewaffneter Beamter auf diese Weise auftritt. Zeigt er tief gefühlte Zugehörigkeit, halb völkisch, halb Gegenkultur, oder nur einen kitschigen Kapuzenpullover aus dem Versandhandel?
Nahgeschichte ist unübersichtlich. Geschichte als Wissenschaft und die Beschäftigung mit dem Alltäglichen und Flüchtigen – real, aber schnell vergänglich – kriegt man nicht sauber getrennt. Aber genau diese Vermischungen interessieren mich, und um sie geht es in diesem Buch. Und um mich, notwendigerweise. Andere Leute als mich finde ich viel interessanter. Aber ohne Ich geht es nicht, denn mit dem schreibe ich. Mein Ich ist Antriebs- und Fehlerquelle in einem. In der Wissenschaft ohnehin, denn die beruht darauf, dass jemand Informationen und Geschichten zur Verfügung stellt, die andere für ihre eigenen Zwecke weiterverwenden können. Damit das funktioniert, muss der Autor etwas über sich sagen: Wo er herkommt, wo er hinwill. Irgendjemand muss den Text ja geschrieben haben, und das ist weder »man« noch »wir« noch »die Forschung«. Also gebe ich besser darüber Auskunft. Worüber rede ich, wenn ich von meiner eigenen Unverwechselbarkeit spreche oder dem, was ich dafür halte, von meinen Gefühlen und Erfahrungen?
Ich-Sagen, darum geht es im ersten Kapitel, ist weder unmittelbar noch besonders persönlich, sondern seit ein paar Jahrhunderten bestimmt von rhetorischen Kunststücken, Zwangssystemen und Projekten radikaler Selbstverbesserung. Ich-Sagen und erst recht Ich-Schreiben kommt gerne locker, spontan und ganz natürlich daher. Aber es ist Aufgabe vor und für Publikum, in ganz bestimmten Kanälen und nach deren Spielregeln – ziemlich strikten Regeln.
Sich zu zeigen und von sich zu erzählen, zeigt das zweite Kapitel, ist also Arbeit. Für wen tue ich das? In welchem Spiegel erscheine ich, wenn ich von meiner Geschichte und meinen eigenen Erinnerungen berichte, und wie souverän bin ich dabei?
Mit meinem Gegenstück im Plural, dem Wir, ist das noch ein bisschen komplizierter. Wir ist keine Gesamtheit, sondern eine Einkaufstasche, in der immer etwas fehlt. Deswegen der große Appetit, den dieses Partizip entwickelt. Appetit auf Festspiele, auf Männerchöre, auf Feinde – denn ohne die weiß man nicht, wo man hingehört – und besonders auf jene besonderen Orte, die auf den Namen Heimat hören. Von den Produktionsbedingungen des Wir, der Heimat und ihrer wechselvollen Geschichte handelt Kapitel drei.
Bei mir daheim sind aber nicht alle gleich, da können wir noch so innig vom Wir und von der Heimat singen. Kapitel vier macht einen Lokaltermin an dem Ort, aus dem ich selbst komme: Willkommen in Wien-Döbling. Packen Sie eine Jause ein, wir gehen auf Klassenfahrt. In welche Richtung geht es nach unten, nach oben und ins Bürgertum?
Kapitel fünf handelt von einer anderen Form der Selbstauskunft – von Bildern. Das Zeitalter der analogen Fotografie ist um die Jahrtausendwende zu Ende gegangen. Damit haben sich Fotos als banale Alltagsgegenstände in Überreste einer unwiderruflich verschwundenen Vergangenheit verwandelt. Sie liegen zu Millionen in Schachteln und verstaubten Alben auf jedermanns Dachboden herum. Was geschieht mit den privaten Massenbildern in der eigenen Erinnerung und in jenen digitalen Kanälen, in die sie neu eingespeist werden?
Sehr viel haltbarer als alte Fotos sind die bunten Zeichen, die man sich unter die Haut stechen lässt. Tätowierungen, überlegt Kapitel sechs, sind Selbstauskunft in einer ganz besonderen Form: »Dieses Zeichen auf meiner Haut«, sagt die Person, die es trägt, »das bin ich.« Und zwar für immer. So demonstrativ diese Zeichen auf rebellische Gegenkultur und exotische Fremde verweisen, aus der Nähe betrachtet erzählen sie eine ganz andere Geschichte. In ihr geht es ums Wünschen, und die meisten dieser Wünsche sind fromm, wohlanständig, ziemlich brav, und handeln von Zugehörigkeit. Und von dem, was man nicht festhalten kann, auch wenn man es sich unauslöschlich auf den Körper schreibt.
Um dieses Wunderland der Wünsche geht es im siebten Kapitel. Wünschen ist nicht immer ganz so freiwillig, wie es auf den ersten Blick aussieht; nicht nur zu Weihnachten, dem Fest der Wünsche und der Liebe, sondern auch bei der großen Bescherung, dem Leben als Paar. Was sagen meine Wünsche über mich? Was geschieht mit ihnen, wenn sie Wirklichkeit werden? Die Selbstauskunft ist dem Wunsch nach Selbstveränderung nirgendwo so eng verbunden wie an jenem magischen Ort, an dem dann alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ein Ortstermin im Land der Liebe also, zu Weihnachten und im Rest des Jahres: Kann man es dort auf Dauer aushalten?
Nicht das, was Du nicht weißt, bringt Dich in Schwierigkeiten, hat Mark Twain 1890 geschrieben: Sondern das, worüber Du Dir ganz sicher bist. Nur dass es nicht stimmt.[2] Die Krisen rund um die ansteckende neue Krankheit in den Jahren 2020/21 haben auch die Modi der Selbstauskunft verändert, wenn es um Ängste, Pflichten und Vertrauen geht. Und ums Selbstvertrauen erst recht. Was lässt sich daraus lernen?
1.Ich-Sagen
»It makes you blind / it does you in
it makes you think you’re pretty tough«
Stephin Merritt & The Magnetic Fields
Jetzt geht es um mich. Nur um mich. Ich sage Dir alles, liebe Leserin, lieber Leser, gleich am Anfang. Wer von sich selbst redet, sagt natürlich die Wahrheit. Und er spricht das Französisch von vor 440 Jahren. Michel de Montaigne, »Essais«, Vorwort, erster Satz. »Dieses Buch, Leser, gibt redlich Rechenschaft. Ich will, dass man mich in meiner einfachen und alltäglichen Lebensweise sehe, ohne Beschönigung und Künstelei, denn ich stelle mich als der dar, der ich bin. Ich selber, Leser, bin der Inhalt meines Buchs. Geschrieben zu Montaigne, am 1. März des Jahres 1580.«
Im Sommer 2019 klingt das etwas anders. Ein großer, gut beleuchteter Tagungsraum: Versammlung aller leitenden Mitarbeiter, die Chefs hatten sie einberufen. Der eingeladene Spezialist stieg aufs Podium und griff zum Mikrophon. Er war der ehemalige Personalchef einer großen Fluglinie, im besten Alter, sehr blond, und hinter ihm leuchtete ein Schriftzug auf. »Beyond Leadership«: Das sei die neue Zauberformel für Kommunikation, sagte der Blonde, viele große Firmen wendeten sie an, mit enormem Erfolg für Börsenkurse und Performance. Der Blonde war sehr gut darin, die Spannung steigen zu lassen, wie der Zauberer auf dem Kindergeburtstag. Jetzt! Jeder von uns, sagte er, solle sich seinem Nachbarn zuwenden und ihm sagen, wer wir jetzt gerade sind. Und wie wir uns fühlen, in diesem Moment, zwei Minuten lang. Dann solle der Nachbar uns dafür eine Minute lang Feedback geben – nur Positives, das sei wichtig. Und dann wir ihm, ebenfalls eine Minute. Diese Technik, sagte der blonde Zauberer im engen Anzug, heiße »connect«. Sie sei der Schlüssel zum Erfolg aller großen Firmen, die er berate, Banken, Versicherungen, die Deutsche Bahn, alle.
Sag, wer Du bist. Sag, was Du fühlst. Selbstauskunft ist gut, für alle. Und sie ist nicht nur gut, sondern unverzichtbar. Ganz ehrlich, einfach und natürlich, unverstellt und ohne Künstelei. Aber geht das, über sich selbst Auskunft geben? Und was verbindet einen Philosophen aus dem 16. mit einem Motivationstrainer im 21. Jahrhundert?
Erforsche Dich selbst
Die Geschichte natürlich: Seit dem 4. Laterankonzil von 1215 war jeder gläubige Christ verpflichtet, einmal pro Jahr bei einem Priester die Beichte abzulegen und ihm alle seine Verfehlungen und Sünden zu berichten. Besonders dafür abgetrennte Räume im Inneren der Kirchen wurden erst dreihundert Jahre später üblich. Öffentlich stattfinden sollte das auch später. »Selbstkritik«, schrieb Rosa Luxemburg 1916, »rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und Lebenslicht der proletarischen Bewegung«, und ab den 1920er Jahren wurde von jedem Mitglied der kommunistischen Partei erwartet, den Parteigenossen regelmäßig über sich und die eigenen Fehler Auskunft zu geben. »Im Modus der Singularität«, schrieb der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz 2016, »wird das eigene Leben nicht einfach gelebt, sondern ausgestellt. Das spätmoderne Subjekt performed sein besonderes Selbst vor den Anderen, die Publikum werden.«[1]
Der Juristenkollege, der bei der Betriebsversammlung neben mir saß und dem blonden Personalchef aufmerksam zugehört hatte, wandte sich mir zu. Er schwieg mich zwei Minuten lang an. Dann lobte ich ihn eine Minute lang dafür. »Sehen Sie«, sagte Blondi von »Beyond Leadership«, als sein Publikum mit den Feedback-Runden fertig war, »ist die Stimmung im Raum jetzt nicht völlig anders?« Wir versammelten Wissenschaftler klatschten alle brav Beifall.
Was hätten wir denn sonst tun sollen? Selbstauskunft ist freiwillige Unfreiwilligkeit. Michel de Montaignes Auskunft über sich selbst von 1580 war ein so erfolgreiches Buch, dass es als »Essais« – wörtlich: Versuche – gleich einer ganzen Literaturgattung den Namen gegeben hat. Montaigne war allerdings nicht der zurückgezogene Philosoph, als der er sich in seinem Buch präsentierte. Um ihn tobte ein blutiger Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten, und er war mittendrin als Vermittler – der Riss zwischen den religiösen Parteien lief quer durch seine eigene Familie.
In seinen Essays ist davon nicht die Rede. Sie heißen »Über das Nichtstun«, »Über die Lüge«, »Über die Einbildungskraft«, aber auch: »Über die Grausamkeit« und »Durch verschiedene Mittel gelangt man zum selben Ziel«. Montaigne interessierte die Verwandlung und die Unkontrollierbarkeit der Dinge. Er wolle, schreibt er, »hier nichts weiter als mich selber entdecken, wie ich bin, und bin morgen vielleicht schon ein anderer«. Und: »Die beste an meinen körperlichen Anlagen ist die Biegsamkeit.«[2]
Während Montaigne schrieb, wurde überall in Europa die Zensur eingeführt. Das Sanctum Officium, die katholische Inquisition, begann Jagd zu machen auf wankelmütige Katholiken, auf Protestanten, auf Wiedertäufer und Juden, die nur zum Schein katholische Messen und Beichten besuchten und zu Hause heimlich ihre eigenen, ganz anderen religiösen Riten befolgten. Ihre protestantischen Kollegen, die reformierten Konsistorien, ließen Andersgläubige ebenfalls verfolgen und hinrichten; so im calvinistischen Genf den Arzt Michel Servet, der sich öffentlich für Gewissensfreiheit ausgesprochen hatte. Und als man im protestantischen Basel herausfand, dass ein ketzerischer Wiedertäufer jahrelang unerkannt unter falschem Namen in der Stadt gelebt hatte, ließ man seinen Leichnam ausgraben – er war friedlich im Bett gestorben – und nachträglich verbrennen. Die religiösen Obrigkeiten in der Welt, die Montaigne bewohnte, wollten ganz genau wissen, woran ihre Untertanen glaubten.[3]
Kontrollier Dein Gewissen. Geh zur Beichte. Sag, was Du denkst. Selbstauskunft handelt aber stets von sehr viel mehr als nur von der Person, die da von sich erzählen soll. 1581, ein Jahr nach Erscheinen der »Essais«, begab sich Michel de Montaigne auf eine lange Reise quer durch Europa, in die Schweiz und nach Italien, sein fertiges Buch im Gepäck. In Rom holte er sich vom Papst die offizielle Druckerlaubnis. Die katholische Zensurbehörde prüfte die Essays und gab ihm die Genehmigung, unter der Bedingung allerdings, dass er in der zweiten Auflage zwei lobende Erwähnungen protestantischer Autoren streiche. Montaigne versprach das – und hielt sich nicht daran, sondern fügte in die stark erweiterte zweite und dritte Auflage der Essays noch mehr ketzerische Texte ein.[4] Dem Erfolg des Buchs, das rasch ins Lateinische, Englische und Italienische übersetzt wurde, hat das nicht geschadet. »Ich, Leser, bin selber der Gegenstand meines Buches.« Aber ist es klug, immer die Wahrheit über sich mitzuteilen?
Schreib alles auf, um Dich selbst an Deine eigenen guten Vorsätze zu erinnern, sagten die strengen protestantischen Pastoren des 16. und 17. Jahrhunderts. Führe Tagebuch. Notiere Deine Wünsche, Deine Versuchungen, damit Du an Dir arbeiten kannst; damit Du die Wahrheit sagen kannst und Rechenschaft ablegen über Deine eigenen Verfehlungen. Der gottesfürchtige Engländer Samuel Pepys notierte deswegen Mitte des 17. Jahrhunderts in London zerknirscht, wie oft er ins Theater ging (Sünde), wie viel Geld er dort für Wein und Leckereien ausgab (Sünde), wie der Vorname der Prostituierten lautete, die er dort unzüchtig angefasst hatte (Sünde), wie sie ihn angefasst hatten, wie oft er gekommen war und wie sehr er das hinterher bereute.[5]
Pepys’ Tagebuch füllt in den modernen Ausgaben zehn Bände, es ist gut dreitausend Seiten dick. Seine sexuellen Handlungen beschrieb er in einer Mischung aus spanischen, italienischen und lateinischen Worten – Samuel Pepys wollte alles über sich aufschreiben, aber nicht, dass seine Frau es lesen konnte. Ein Jahrhundert später notierte ein neugieriger Göttinger Professor namens Georg Christoph Lichtenberg seinen ehelichen Beischlaf ebenso sorgfältig wie ein Zürcher Pfarrer, Johann Kaspar Lavater, in selbst erfundenen geheimen Abkürzungen. Im 19. Jahrhundert war diese Art Selbstaufzeichnung so verbreitet, dass wir von Victor Hugo, Robert Schumann und Arthur Schnitzler sehr genau wissen, wie oft sie Sex hatten und mit wem.[6]
Schreib alles über Dich auf. Erfahre mehr über Dich selbst, indem Du alles aufschreibst. Werde ein kontrollierterer, besserer Mensch, indem Du alles über Dich aufschreibst. Dann, aber nur dann, wirst Du endlich ganz Du sein. Mit deutlicher ironischer Spitze gegen die übliche kulturpessimistische Kritik an der Digitalisierung hat der Soziologe Armin Nassehi bemerkt, Schriftlichkeit und Praktiken der Selbstbeschreibung seien historisch vermutlich die wirksamsten Instrumente von Selbstmanagement. Mit ihrem Versprechen, von Fremd- auf Selbstkontrolle umschalten zu können, sei »schriftgeleitete Bildung das zivilisatorisch vielleicht wirkmächtigste (Selbst-)Optimierungsprogramm überhaupt«.[7]





























