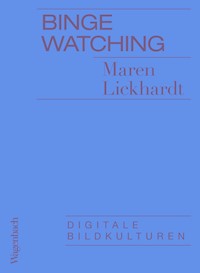
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer abschalten will, hat 15 Sekunden. Netflix hat das (fast) unterbrechungsfreie Streaming revolutioniert und damit das Binge Watching zum Geschäftsmodell erhoben. Die User entscheiden, welche Filme und Serien sie schauen – und vor allem wie lange. Doch was ist »bingewatchen« überhaupt? Und wie selbstbestimmt ist das wirklich? Historische Vorläufer des vermeintlich unkontrollierten Medienkonsums gibt es jedenfalls zuhauf: von den Bücherfressern um 1800 bis hin zum Zappen mit der Fernbedienung – stets begleitet von kulturkritischen Warnungen. Maren Lickhardt über die Geschichte autonomer Medienrezeption, neue Freiräume und alte Abhängigkeiten – und die (Serien-)Ästhetik der »bingeability«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schlaflos auf Netflix: Ist Binge Watching unkontrollierter Exzess - oder nicht doch eher Gemeinschaftserlebnis und Praktik selbstbestimmter User? Maren Lickhardt über die Geschichte autonomer Medienrezeption, neue Freiräume und alte Abhängigkeiten - und die (Serien-)Ästhetik der »bingeability«.
Maren Lickhardt
BINGE WATCHING
Veränderte Rezeption, veränderte Produktion?
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
DIGITALE BILDKULTUREN
Durch die Digitalisierung haben Bilder einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dass sie sich einfacher und variabler denn je herstellen und so schnell wie nie verbreiten und teilen lassen, führt nicht nur zur vielbeschworenen »Bilderflut«, sondern verleiht Bildern auch zusätzliche Funktionen. Erstmals können sich Menschen mit Bildern genauso selbstverständlich austauschen wie mit gesprochener oder geschriebener Sprache. Der schon vor Jahren proklamierte »Iconic Turn« ist Realität geworden.
Die Reihe DIGITALE BILDKULTUREN widmet sich den wichtigsten neuen Formen und Verwendungsweisen von Bildern und ordnet sie kulturgeschichtlich ein. Selfies, Meme, Fake-Bilder oder Bildproteste haben Vorläufer in der analogen Welt. Doch konnten sie nur aus der Logik und Infrastruktur der digitalen Medien heraus entstehen. Nun geht es darum, Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden und ästhetische, kulturelle sowie soziopolitische Zusammenhänge herzustellen.
Die Bände der Reihe werden ergänzt durch die Website www.digitale-bildkulturen.de. Dort wird weiterführendes und jeweils aktualisiertes Material zu den einzelnen Bildphänomenen gesammelt und ein Glossar zu den Schlüsselbegriffen der DIGITALEN BILDKULTUREN bereitgestellt.
Herausgegeben von
Annekathrin Kohout und Wolfgang Ullrich
Maren Lickhardt / Mediale Umgebung
1 | Kontrollverlust? Bingewatchen und Bücherfressen
Sich vor ein Empfangsgerät setzen, eine Serie anwählen, innerhalb einer Session ohne Unterbrechung Folge um Folge weiterschauen, vielleicht gar bis zum Ende der Staffel … das ist Binge Watching. Klingt nach Exzess, oder?
Während für Binge Watching im Englischen mehr oder weniger synonym auch die sportlich konnotierte Bezeichnung media marathoning kursiert, implizieren bedeutungsähnliche Wörter im Deutschen das Moment des ungesunden Übermaßes: »Komaglotzen« oder »Durchsuchten«. An Kontrollverlust und Abhängigkeit zu denken liegt bei dem Begriff Binge Watching zunächst ohnehin auf der Hand, schließlich bezeichnet das Verb »to binge« exzessives Essen und Trinken. Beim Binge Watching liegt das exzessive Moment nun in extremem Medienkonsum.
Sich in Medienkonsum zu verlieren ist allerdings keineswegs neu. Entsprechende Bedenken hat es in den vergangenen 200 Jahren immer wieder gegeben, auch in Bezug auf die Literatur. Johann Rudolph Gottlieb Beyer beschwerte sich beispielsweise Ende des 18. Jahrhunderts über die sogenannte Lesesucht/Lesewut. »Daher sieht man Bücherleser und Leserinnen, die mit dem Buche in der Hand aufstehen und zu Bette gehen, sich damit zu Tische setzen, es neben der Arbeit liegen haben, auf Spaziergängen sich damit tragen, und sich von der einmal angefangenen Lektüre nicht wieder trennen können, bis sie sie vollendet haben. Aber kaum ist die letzte Seite eines Buches verschlungen, so sehen sie sich schon wieder gierig um, wo sie ein anderes herbekommen wollen; und wo sie nur irgend etwas auf einer Toilette, auf einem Pulte, oder sonst wo, erblicken, […] da nehmen sie es mit, und verschlingen es mit einer Art von Heißhunger. Kein Tabaksbruder, keine Kaffeeschwester, kein Weintrinker, kein Spielgeist kann so an seine Pfeife, Bouteille, an den Spiel- oder Kaffeetisch, attachirt seyn, als manche Lesehungrige an ihre Lesereyen.«1
Dass Binge Watching in Feuilleton und Wissenschaften diskursiv oftmals eher in den Kontext von Lesen als von Fernsehen gerückt wird – zum Beispiel die sogenannten »Qualitätsserien« als »neue Gesellschaftsromane« (dazu am Ende mehr) –, hat nicht nur etwas mit den rezipierten Inhalten zu tun, sondern auch mit den Modi der Rezeption: Bücher kann man überall mit sich herumtragen, für Nachschub ist schnell gesorgt; in der Netz- oder Streamingkultur sind schier unerschöpfliche Inhalte zeitlich und räumlich stets zugänglich, weil kein Programmschema vorgegeben ist und die benötigten Endgeräte transportabel sind. Die Parallelen zum Bücherfressen (und Unterschiede zum linearen Fernsehen) reichen noch weiter: So wie man beim Lesen Vorworte, Anmerkungen und so weiter überblättern kann, lassen sich beim Streamen Intros skippen oder Szenen im Zehn-Sekunden-Takt überspringen. Man kann in Büchern vor- und zurückblättern und auf Netflix im Stream – sehend – ›vor- und zurückspulen‹. Außerdem lassen sich Bücher bewusst langsamer oder schneller lesen, aber hier ist die Technik überlegen, sofern man kein Problem mit bleiernen oder micky-mausigen Stimmen hat: Auf Netflix lässt sich der Inhalt in 0,5- bis 1,5-facher Geschwindigkeit abspielen; auf YouTube sogar in 0,25- bis 2-facher. Allerdings bleibt Lesen etwas Aktives, während man Streamen nebenbei betreiben und in anderweitige (auch berufliche) Beschäftigungen integrieren kann.
Die genannten Praktiken mögen verdeutlichen, dass Binge Watching nicht notwendigerweise für Zügellosigkeit steht, sondern im Gegenteil mit nicht unerheblichen Möglichkeiten der Kontrolle auf Seite der Rezipient:innen einhergeht. Wie beim Bücherlesen gibt es beim Bingewatchen nicht irgendeinen Flow in dem Sinn, wie Raymond Williams das Durchlaufen des linearen Programmfernsehens beschreibt, sondern Binge-Einheiten und Binge-Begrenzungen: Man zählt nicht in Stunden, sondern in Episoden;2 Ziel ist es oft, ein Format zu Ende gesehen zu haben.3 Im Allgemeinen sagen Binge Watcher eher, man habe eine bestimmte Staffel durchgebinget, und seltener, man habe das ganze Wochenende gebinget. So kontraintuitiv es sein mag, der Faktor Zeit spielt beim Bingewatchen eine untergeordnete Rolle, auch wenn »ein Binge« eher nicht nur zwei Folgen oder zwei Stunden dauert.
Letztlich geht es – auch das eine Parallele zur Diskussion um die Lesesucht des 18. Jahrhunderts – in hohem Maß um die rezipierten Artefakte, die in gute und schlechte unterschieden werden. Wenngleich Binge Watching durchaus in schier bulimischen Konsum, in leeres Glotzen münden kann, werden die »guten Gegenstände« um ihrer selbst willen aufgesaugt wie Wissen. Hier gelangt man wieder zur Etymologie: Bei traditioneller Bauweise muss ein aus Holz gefertigtes Boot eine Weile lang Feuchtigkeit aufnehmen, damit alle Fugen dicht sind, bevor es verkehrssicher zu Wasser gelassen werden kann. Man verwendet im Deutschen dafür hin und wieder den Begriff »dichtquellen«. Und genau dafür wurde gemäß dem Oxford Dictionary in einem englischen Dialekt Mitte des 18. Jahrhunderts das Verb »to binge« ursprünglich gebraucht. In diesem Sinne führt Binge Watching also bestenfalls dazu, dass die Rezipient:innen am Ende ebenso gesättigt, erfüllt und angereichert sind wie ein Holzschiff, das schwimmt.
2 | Von der Fernbedienung zu Netflix: Rezipient:innen übernehmen die Kontrolle
Warum bingewatchen? Die beste Antwort ist womöglich die Gegenfrage: Warum nicht, wenn es technisch möglich ist? Dass es mittlerweile technisch möglich ist, hat einen medienhistorischen Vorlauf. Medientechnische Innovationen basieren stets auf bereits bestehenden Wunschkonstellationen.4 Technische Möglichkeiten, Wünsche und Praktiken verändern sich in einer Ko-Evolution beziehungsweise einem Prozess der gegenseitigen Beeinflussung. Bingewatchen ist in diesem Fall aber nicht das Resultat eines zunehmend exzessiven Medienkonsums, sondern im Gegenteil, wie insbesondere die Medienwissenschaftlerin Mareike Jenner betont, das einer medien- und technikgeschichtlichen Entwicklung hin zu mehr Autonomie und Kontrolle seitens der Rezipient:innen. Und obwohl Bingewatchen als Praxis erstaunlich viel mit Lesen zu tun hat, ist der medientechnische Hintergrund eng verknüpft mit der Entwicklung des Fernsehens. So haben Erfindungen wie die Fernbedienung, Videorecorder und DVD-Player erheblich dazu beigetragen, dass sich die Zuschauer:innen vom Flow des Programms im linearen Fernsehen emanzipieren konnten.5
Die Fernbedienung verbreitet sich (zunächst langsam) von den fünfziger Jahren an.6 In Deutschland setzt sie sich erst ab den siebziger und achtziger Jahren durch, als sich das Programmangebot – zumindest wenn man nach der Senderanzahl geht – diversifiziert. Nun kann gezappt und damit auf komfortable Weise ausgewählt werden, was man sieht; der mühevolle Gang zum Fernsehgerät bleibt den Zuschauer:innen erspart. In dem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass das Wort »binge«, wie Emil Steiner gezeigt hat, vereinzelt schon ab den späten vierziger Jahren im US-amerikanischen Raum mit Bezug zu Medienkonsum auftauchte. Zunächst bezeichnete es dabei auch die Überfülle an Fernsehprogrammen, zwischen denen man sich entscheiden konnte, und nicht nur die Länge des Konsums: Binge bezog sich also erst einmal auf das reichhaltig gedeckte Buffet und nicht auf die verzehrte Menge.7
Einen wesentlich emanzipatorischeren Effekt als die Fernbedienung hatte die Einführung des Videorecorders, da er es ermöglichte, zeitlich unabhängig vom linearen Programmfluss fernzusehen.8 Aber die Programmierung der Recorder funktionierte nicht immer; Eltern und Freund:innen, die man mit der Aufnahme betraute, falls man keine Programmierfunktion hatte, vergaßen hin und wieder, auf den Record-Knopf zu drücken; und manchmal reichte die gewählte Kassette nicht aus, weil Shows zeitlich überzogen. VHS-Kassetten hatten (und das ist das Wichtigste) ohnehin eine vergleichsweise kurze Laufzeit und benötigten (ähnlich wie Bücher) sehr viel Platz im Schrank.
Zwei andere Entwicklungen waren entscheidend dafür, dass das selbstbestimmte Bingewatchen entstehen konnte: Zum einen läutete HBO eine neue Ära des Fernsehens ein;9 zum anderen setzten sich die platzsparenden DVDs auf dem Home-Video-Markt durch.10 Beides fällt in die späten neunziger Jahre. Die eng mit dem Pay-TV-Sender HBO verknüpfte Revolutionierung der Fernsehserie durch Qualitätsformate wie zum Beispiel Sex and the City (1998–2004) und The Sopranos (1999–2007) machte das Format der TV-Serie überhaupt erst für ein breiteres Publikum außerhalb spezifischer Fankulturen zu einem sammlungswürdigen Objekt und beförderte neben dem Abonnent:innen-Markt auch den DVD-Markt.11 Im Grunde konnte von nun an gebinget werden (obwohl der Begriff erst später vor allem von Netflix verbreitet wurde), ja man musste es gewissermaßen sogar tun, wenn man eine DVD-Box nur für kurze Zeit in der Videothek ausgeliehen hatte.12
Für selbstbestimmten Videokonsum bedeutete die Gründung der Plattform YouTube 2005 einen Meilenstein. Rezipient:innen konnten erstmals umsonst und legal Videos in großer Zahl eigenständig abrufen und ohne Zwischenspeicherung ansehen. Dass YouTube die technische Initialzündung für Binge Watching darstellt, mag erst einmal erstaunen, denn YouTube war (und ist) ein Prosumer-Phänomen: Die Rezipient:innen stellen Videos aller Art ein und werden so selbst zu Produzent:innen beziehungsweise schlüpfen in die Doppelrolle von Content-Lieferant:innen und -Konsument:innen. Erst viel später begann YouTube auch, Eigenproduktionen zu veröffentlichen wie andere Streamingdienste. An Streamingdiensten, die von Beginn an professionell produzierte Inhalte im Angebot hatten, sind für den deutschen Markt Amazon Prime, Disney+, WOW, Magenta und allen voran Netflix zu erwähnen.
Angefangen hat Netflix als Video-on-Demand-Service. Nach der Markteinführung von DVDs war das Unternehmen ab 1997 als computerbasiertes Video-Verleihsystem tätig, bei dem eine Wunschliste postalisch abgearbeitet wurde, sodass der Nachschub für die Rezipient:innen niederschwellig gesichert war. Inspiriert durch YouTube starteten die Gründer Reed Hastings und Marc Randolph 2007 ihren Online-Streamingdienst. Gegen Ende 2010 expandierte Netflix in Länder außerhalb der USA; 2016 war der Streamingdienst fast überall auf der Welt verfügbar.13
Netflix war und ist aus zwei Gründen entscheidend für das Phänomen Binge Watching. Zum einen etablierte sich auf Netflix die technische Voraussetzung für den automatischen, ungestörten Rezeptionsfluss, den »insulated flow«,14





























