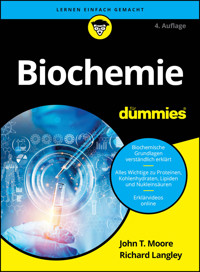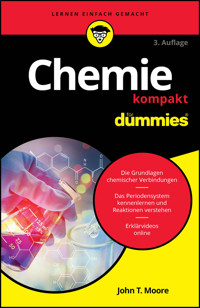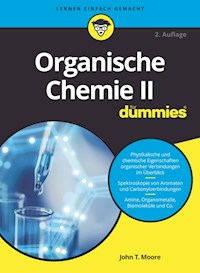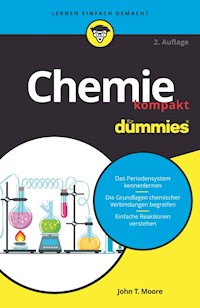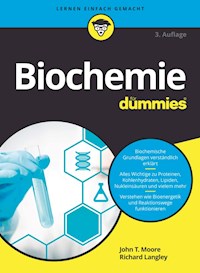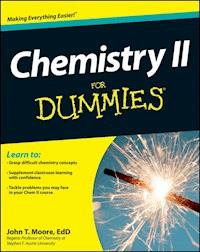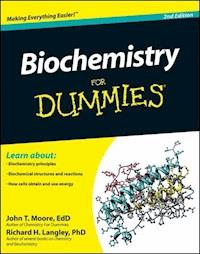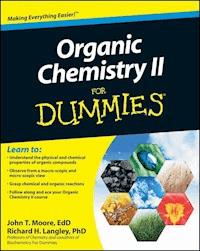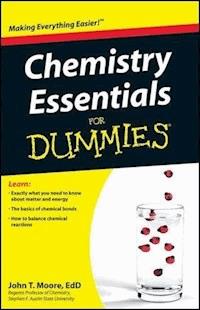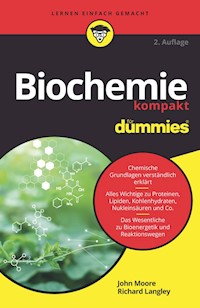
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Stehen Sie auf Kriegsfuß mit der Biochemie? Diese ganzen Formeln und Reaktionen sind überhaupt nicht Ihr Ding? Die nächste Prüfung steht vor der Tür? Kein Problem! "Biochemie kompakt für Dummies" erklärt Ihnen das Wichtigste, was Sie über Biochemie wissen müssen. Sie werden so einfach wie möglich und so komplex wie nötig in die Welt der Kohlenhydrate, Lipide, Proteine, Nukleinsäuren, Vitamine, Hormone und Co. eingeführt. So leicht und kompakt kann Biochemie sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Biochemie kompakt für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. vollständig überarbeitete Auflage 2023
© 2023 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Original English language © 2011 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe © 2011 by Wiley Publishing, Inc. Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: ipopba – stock.adobe.comKorrektur: Isolde Kommer
Print ISBN: 978-3-527-72101-6ePub ISBN: 978-3-527-84308-4
Über die Autoren
John Moore wuchs am Fuße der Berge des westlichen North Carolina auf. Er besuchte die University of North Carolina in Asheville, wo er seinen Bachelor-Abschluss in Chemie erhielt. An der Furman University in Greenville, South Carolina, erreichte er seinen Master-Abschluss in Chemie. Nach seinem Wehrdienst in der US Army entschied er sich, die Lehrerlaufbahn einzuschlagen. 1971 wurde er Mitarbeiter an der chemischen Fakultät der Stephen F. Austin State University in Nacogdoches im Staate Texas, wo er bis heute Chemie unterrichtet. 1985 begann er zeitweise wieder zu studieren und promovierte schließlich in Erziehungswissenschaft an der Texas A&M University. Während der letzten fünf Jahre arbeitete er als Co-Editor (zusammen mit einem seiner früheren Studenten) am »Chemie für Kinder«-Teil des Journal of Chemical Education. 2003 wurde sein erstes Buch, Chemie für Dummies, veröffentlicht, kurz darauf gefolgt von Chemistry Made Simple. John Moores Hobbys sind Kochen und das Schnitzen kunstvoller Messerhandgriffe aus tropischem Holz.
Richard Langley wuchs im südwestlichen Teil von Ohio auf. Er besuchte die Miami University in Oxford, Ohio, wo er seine Bachelor-Abschlüsse in Chemie und Mineralogie sowie etwas später auch seinen Master-Abschluss in Chemie erhielt. Die nächste Stufe auf der Karriereleiter führte ihn an die University of Nebraska, wo er in Chemie promovierte. Danach nahm er eine Postdoc-Stelle an der Arizona State University in Tempe, Arizona, an, gefolgt von einer Gast-Juniorprofessur an der University of Wisconsin in River Falls. 1982 erhielt er eine Stelle an der Stephen F. Austin State University in Texas. Während der vergangenen sieben Jahre nahm er dort zusammen mit John Moore die Prüfung für den Leistungskurs Chemie ab. John Moore und er haben zusammen verschiedene Buchprojekte realisiert wie Chemistry for the Utterly Confused. Zu Richard Langleys Hobbys gehören Schmuckherstellung und Science-Fiction.
Über die Überarbeiterinnen und Fachkorrektoren
Dr. Susanne Katharina Hemschemeier forschte viele Jahre als Mikrobiologin und Proteinbiochemikerin an der Universität Bielefeld, in Gießen und an der UCLA in Los Angeles, bevor sie die praktische Arbeit im Labor an den Nagel hängte und sich in Mainz mit der Erstellung von E-Learning-Materialien für das Chemie- und Biochemiestudium befasste. Sie arbeitet derzeit als selbstständige Autorin und Übersetzerin für wissenschaftliche Texte und lebt mit ihrer Familie in Berlin und Stuttgart.
Dr. Tina Micksch, geb. Schäfer, forschte einige Jahre als Biochemikerin an der Technischen Universität Dresden. In dieser Zeit befasste sie sich mit der Modifizierung von Implantatmaterialien mittels biologisch aktiver Moleküle. Sie lebt mit ihrer Familie in Dresden.
Alfons Winkelmann: Autor, Übersetzer und Lektor. Er studierte Chemie in Düsseldorf und Chemie und Germanistik in Aachen und arbeitet seit über 30 Jahren als Übersetzer von Belletristik und Sachbüchern (unter anderem auch für die … für Dummies-Reihe von Wiley-VCH).
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Über die Überarbeiterinnen und Fachkorrektoren
Einleitung
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Teil I: Vorhang auf: die Grundlagen der Biochemie
Kapitel 1: Chemie: Was Sie darüber wissen sollten
Warum interessieren Sie sich für Biochemie?
Chemie und das ganze Drumherum
Kapitel 2: Einfach eintauchen: die Chemie des Wassers
Was Sie über Wasser wissen sollten
Die Wasserstoffionenkonzentration: Säuren und Basen
Starke und schwache Säuren: die Brönsted-Lowry-Definition
Säure oder Base? Wenn die Entscheidung schwerfällt
Puffer und pH-Kontrolle
Kapitel 3: Kohlenstoff und die organische Chemie
Die besondere Rolle des Kohlenstoffs auf der Erde
Komplizierte Zahlenspiele: Kohlenstoffbindungen
Hier ist was los! Die funktionellen Gruppen eines Moleküls
Kapitel 4: Ein wenig Biologie: die Zelltypen
Pro- und eukaryotische Zelltypen
Typische Bestandteile einer Tierzelle
Ein kurzer Blick in eine Pflanzenzelle
Teil II: Das Fleisch der Biochemie: Proteine
Kapitel 5: Aminosäuren: die Bausteine der Proteine
Die »magischen« 20 Aminosäuren
Kapitel 6: Struktur und Funktion von Proteinen
Proteine – mehr als nur das Steak auf Ihrem Teller
Die Primärstruktur: was alle Proteine verbindet
Proteine isolieren und analysieren
Kapitel 7: Enzymkinetik: mit Hilfe schneller ans Ziel
Enzymklassifizierung: Wer macht den Job?
Enzyme als Katalysatoren: Wir machen Tempo
Einige Bemerkungen zur Kinetik
Enzymaktivitäten messen: die Michaelis-Menten-Gleichung
Enzymhemmung: der Bolzen im Getriebe
Enzymregulierung
Teil III: Kohlenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren und mehr
Kapitel 8: Wir wecken Gelüste: Kohlenhydrate
Eigenschaften von Kohlenhydraten
Ein zuckersüßes Thema: die Monosaccharide
Wenn sich Zucker die Hände reichen: Oligosaccharide
Jeder hat seine Stärken: Brot, Nudeln und Kartoffeln
Da feiern die Termiten: Zellulose im Angebot
Glykoproteine
Kapitel 9: Lipide und Membranen
Ohne Lipide geht nichts: ein Überblick
Die Fettsäuren in Fetten und Ölen
Alles andere als einfach: komplexe Lipide
Membranen: Bipolarität und Doppelschicht
Die wilden drei – Prostaglandine, Thromboxane und Leukotriene
Kapitel 10: Nukleinsäuren und der Code des Lebens
Nukleotide: die Bausteine der DNA und RNA
Vom Nukleosid über das Nukleotid zur Nukleinsäure
Dogmatisches Wissen ist gefragt …
Aminosäuren verknüpfen: eine Bauanleitung
Kapitel 11: Vitamine und Nährstoffe
Nur ein Apfel am Tag? Das Einmaleins der Vitamine
Vitamin A
Wer A sagt, muss auch B sagen: die Vitamine der B-Gruppe
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Kapitel 12: Die stillen Akteure: Hormone
Strukturen einiger Schlüsselhormone
Wie bei Dornröschen: die Prohormone
Kampf oder Flucht: Hormonfunktion
Teil IV: Bioenergetik und Reaktionswege
Kapitel 13: Leben und Energie
Der Energiestoffwechsel
Essen oder fasten?
Kapitel 14: Vom Katabolismus zum Anabolismus
Metabolismus Teil I: Glykolyse
Metabolismus Teil II: der Zitratzyklus (Krebs-Zyklus, Zitronensäurezyklus)
Metabolismus Teil III: Elektronentransport und oxidative Phosphorylierung
Investition in die Zukunft: Biosynthese
Kapitel 15: Ein »anrüchiges« Thema: Stickstoff in biologischen Systemen
Ringelreihen mit Stickstoffen: Purine
Die Biosynthese von Pyrimidinen
Abfallbeseitigung: der Harnstoffzyklus
Teil V: Genetik: Warum wir sind, was wir sind
Kapitel 16: DNA kopieren
Aus eins mach zwei: DNA-Replikation
Die Mechanismen der DNA-Reparatur
Mutationen: gut, schlecht oder neutral
Mendel wäre begeistert: Methoden der DNA-Analyse
Ein spannungsreiches Thema: DNA-Sequenzierung
Kapitel 17: Schön abschreiben bitte! RNA-Transkription
Arten der RNA
Was RNA-Polymerasen brauchen
Transkription stromauf, stromab
Die RNA-Polymerase der Prokaryoten
Die Extras der Eukaryoten: mRNA-Modifikation
Der genetische Code
Modelle der Genregulation
Kapitel 18: Korrekt übersetzen – die Translation
Bitte keine Fehler!
Das Team stellt sich vor
Und … Anpfiff: Proteinsynthese
Unterschiede bei eukaryotischen Zellen
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 19: Zehn beeindruckende Einsatzgebiete der Biochemie (plus eins)
Ames-Test
Schwangerschaftstests
HIV-Tests
Brustkrebsuntersuchungen
Pränatale Gentests
Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel (»Genfood«)
Gentechnik
Klonen
Gentherapie
Das Humangenomprojekt
mRNA-Impfstoffe
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1: K
S
-Werte einiger biologisch relevanter Säuren
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Freigesetzte Energien (∆G°′) einiger hochenergetischer Biomoleküle...
Kapitel 14
Tabelle 14.1: ATP-Ausbeute für jeden Schritt des Glukosestoffwechsels
Tabelle 14.2: Einige physiologisch relevante Redoxpotenziale (E´°)
Tabelle 14.3: Essenzielle und nicht essenzielle Aminosäuren für Erwachsene (* es...
Kapitel 15
Tabelle 15.1: Glucogene und ketogene Aminosäuren
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Der universelle genetische Code
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Periodensystem der Elemente © malachy120 –
stock.adobe.com
Abbildung 1.2: Atomaufbau sowie Form der s- und p-Orbitale © Eakglory –
stock.ad
...
Abbildung 1.3: Ionische Bindung zwischen Natrium und Chlor zu Natriumchlorid (Ko...
Abbildung 1.4: Kovalente Bindung: Teilung von Elektronen zwischen zwei Atomen © ...
Abbildung 1.5: Metallische Bindung © Reuel Sa –
stock.adobe.com
Abbildung 1.6: sp
2
-Hybridorbitale mit zwei nicht hybridisierten p...
Abbildung 1.7: Beispiel für die Struktur eines (Eisen-)Komplexes (Häm – Bestandt...
Abbildung 1.8: Prinzip einer Standardwasserstoffelektrode © SAMYA –
stock.adobe.
...
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Struktur eines Wassermoleküls
Abbildung 2.2: Struktur eines typischen amphipathischen Moleküls mit hydrophilen...
Abbildung 2.3: Struktur einer Mizelle aus amphipathischen Molekülen, deren hydro...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Oben: unverzweigte Kohlenwasserstoffkette (Linolsäure) in vereinf...
Abbildung 3.2: Sauerstoff- und schwefelhaltige funktionelle Gruppen
Abbildung 3.3: Einige stickstoffhaltige funktionelle Gruppen
Abbildung 3.4: Acetale, Hemiacetale, Hemiketale und Ketale
Abbildung 3.5: cis- und trans-Isomere
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Vereinfachte Darstellung einer prokaryotischen Zelle © Zizo –
sto
...
Abbildung 4.2: Vereinfachte Darstellung einer Tierzelle © La Gorda –
stock.adobe
...
Abbildung 4.3: Pflanzenzelle © achiichiii –
stock.adobe.com
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Bildung eines Zwitterions
Abbildung 5.2: (a) Zwitterionenform, (b) protonierte Form, (c) deprotonierte For...
Abbildung 5.3: Unpolare Aminosäuren
Abbildung 5.4: Polare und ungeladene (neutrale) Aminosäuren
Abbildung 5.5: Saure Aminosäuren
Abbildung 5.6: Basische Aminosäuren
Abbildung 5.7: Wie sich zwei Cysteine reversibel zu Cystin verbinden
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Ständig wiederholte Einheit des Proteinrückgrats
Abbildung 6.2: Struktur von Insulin © tasty_cat –
stock.adobe.com
Abbildung 6.3: Wasserstoffbrückenbindung zwischen zwei Peptidbindungen
Abbildung 6.4: Die α-Helix © LuckySoul –
stock.adobe.com
Abbildung 6.5a: Paralleles β-Faltblatt, chemische Struktur und schematische Dars...
Abbildung 6.5b: Antiparalleles β-Faltblatt, chemische Struktur (oben) und schema...
Abbildung 6.6: Elektrophorese © Julia –
stock.adobe.com
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Entfernung von Wasserstoffatomen durch Oxidoreduktasen
Abbildung 7.2: Allgemeine (unvollständige) Phosphotransferase-Reaktion
Abbildung 7.3: Allgemeine Darstellung einer Peptidase-katalysierten Reaktion
Abbildung 7.4: Allgemeine Darstellung zweier Lyase-katalysierter Reaktionen
Abbildung 7.5: Reaktionen der Ligasen Pyruvat-Carboxylase und Acetyl-CoA-Synthet...
Abbildung 7.6: Das Induced-Fit-Modell der Enzymkatalyse © O Sweet Nature –
stock
...
Abbildung 7.7: Der Einfluss eines Enzyms auf eine Reaktion © natros –
stock.adob
...
Abbildung 7.8: Graph der Reaktionsgeschwindigkeit V im Verhältnis zur Substratko...
Abbildung 7.9: Lineweaver-Burk-Diagramm
Abbildung 7.10: Lineweaver-Burk-Diagramm für eine nichtkompetitive Hemmung
Abbildung 7.11: Lineweaver-Burk-Diagramm für eine kompetitive Hemmung
Kapitel 8
Abbildung 8.1 Chirales und achirales Objekt © Reuel Sa –
stock.adobe.com
Abbildung 8.2: Eine chirale Verbindung: Limonen © AlexandraDaryl –
stock.adobe.c
...
Abbildung 8.3: Die D-Glukose in der Fischer-Projektion
Abbildung 8.4: Strukturvarianten der D-Aldohexosen
Abbildung 8.5: Ein Pyranosering (6-er Ring)
Abbildung 8.6: Glukoseformen in der Haworth-Schreibweise © Peter Hermes Furian –...
Abbildung 8.7: Ein Furanosering
Abbildung 8.8: Offenkettige und Furanose-Form der D-Fruktose
Abbildung 8.9: Glyzeraldehyd und Dihydroxyaceton
Abbildung 8.10: Die Pfeile weisen auf jene Alkoholgruppen hin, deren Lage bestim...
Abbildung 8.11: Die Struktur von Maltose mit α-(1,4)-glykosidischer Bindung
Abbildung 8.12: Zellobiose mit einer β-(1,4)-glykosidischen Bind...
Abbildung 8.13: Struktur von Saccharose, die durch die Verbindung einer α-D-Gluk...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Die Beziehungen zwischen den einzelnen Lipidgruppen
Abbildung 9.2: Die Struktur eines Seifenmoleküls
Abbildung 9.3: Struktur von Glyzerin
Abbildung 9.4: Struktur eines typischen Fettes. Die beiden oberen Ketten sind ge...
Abbildung 9.5: Beispiele für Phosphatidylethanolamin und Phosphatidylcholin
Abbildung 9.6: Struktur von Sphingosin
Abbildung 9.7: Sphingomyelin © logos2012 –
stock.adobe.com
Abbildung 9.8: Membranständige und integrale Proteine © tyrone –
stock.adobe.com
Abbildung 9.9: Das Grundgerüst eines Steroids
Abbildung 9.10: Strukturen der Arachidonsäure, eines typischen Prostaglandins, v...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Die Struktur von Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C), Thymin (T)...
Abbildung 10.2: Ribose und Desoxyribose. Beachten Sie das Fehlen von O am Kohlen...
Abbildung 10.3: Struktur der Phosphorsäure © molekuul.be –
stock.adobe.com
Abbildung 10.4: Allgemeine Reaktion für die Bildung eines Nukleosids
Abbildung 10.5: Struktur des Nukleosids Adenosin (Adenin + Ribose)
Abbildung 10.6: Struktur von Adenosinmonophosphat (AMP) und Lage der 5′- und 3′-...
Abbildung 10.7: Vereinfachte Darstellung der Verbindung zweier Nukleotide
Abbildung 10.8: Die Bildung einer Peptidbindung
Abbildung 10.9: Resonanzstabilisierung einer Peptidbindung
Abbildung 10.10: Zwei Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien) bilden s...
Abbildung 10.11: Drei Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien) bilden s...
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Beta-Carotin © bacsica –
stock.adobe.com
Abbildung 11.2: Strukturen von Vitamin B1 (Thiamin) und Thiaminpyrophosphat (TPP...
Abbildung 11.3: Struktur von Flavinadenindinukleotid (FAD) und der Bestandteile ...
Abbildung 11.4: Strukturen von Nikotinsäure, Nikotinamid und Nikotinamid-Adenin-...
Abbildung 11.5: Struktur von Biotin © bacsica –
stock.adobe.com
Abbildung 11.6: Struktur der Pantothensäure © molekuul.be –
stock.adobe.com
Abbildung 11.7: Struktur des Hydroxocobalamin, umgangssprachlich Vitamin B12 © m...
Abbildung 11.8: Struktur von Vitamin C © eshana_blue –
stock.adobe.com
Abbildung 11.9: Struktur von α-Tocopherol (Vitamin E)
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Testosteron © molekuul.be –
stock.adobe.com
Abbildung 12.2: Aldosteron © Zizo –
stock.adobe.com
Abbildung 12.3: Kortisol © eshana_blue –
stock.adobe.com
Abbildung 12.4: Strukturen von Progesteron (einem Östrogen) © esha...
Abbildung 12.5: Adrenalin (links) und Noradrenalin (rechts) © logos2012...
Abbildung 12.6: Struktur von zyklischem AMP (cAMP)
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Struktur von ATP
Abbildung 13.2: Struktur von ADP
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Die Reaktionsschritte der Glykolyse
Abbildung 14.2: Schema der Laktatgärung © VectorMine –
stock.adobe.com
Abbildung 14.3: Struktur von Acetyl-CoA und HS-CoA © logos2012 –
stock.adobe.com
Abbildung 14.4: Zitratzyklus (Krebs-Zyklus) © logos2012 – stock.adobe.com
Abbildung 14.5: Strukturen der Zwischenprodukte des Zitratzyklus
Abbildung 14.6: Vereinfachtes Schema der Bildung von Acetyl-CoA
Abbildung 14.7: Die Elektronentransportkette mit kaskadenartiger Anordnung der E...
Abbildung 14.8: Hämgrundgerüst eines Cytochroms mit möglichen Seitenketten (R)
Abbildung 14.9: Allgemeine Reaktionsschritte im β-Oxidationszyklus (Fettsäurezyk...
Abbildung 14.10: Fettsäuresynthese
Abbildung 14.11: Synthese von Alanin
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Die Purinstickstoffbasen
Abbildung 15.2: Aktivierung von α-D-Ribose-5‘-phosphat zu PRPP
Abbildung 15.3: Synthese von Carbamoylphosphat
Abbildung 15.4: Umwandlung von UTP in CTP
Abbildung 15.5: Struktur von Harnsäure
Abbildung 15.6: Allgemeine Transaminierungsreaktion
Abbildung 15.7: Bildung von Carbamoylphosphat
Abbildung 15.8: Überblick über den Harnstoffzyklus © Ali –
stock.adobe.com
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Schema der DNA-Replikation mit Leit- und Folgestrang © olando –
Abbildung 16.2: Vereinfachte Darstellung des Prepriming-Komplexes
Abbildung 16.3: Detaillierte Darstellung der Vorgänge an der Replikationsgabel
Abbildung 16.4: Struktur eines Thymin-Dimers
Abbildung 16.5: Typisches Bild nach einer Gelelektrophorese © extender_01 –
stoc
...
Abbildung 16.6: Öffnung eines Plasmids mit einem Restriktionsenzym (zum Beispiel...
Abbildung 16.7: Ribose, Desoxyribose und Didesoxyribose
Abbildung 16.8: Vergleich der einzelnen Ergebnisse für einen Vaterschaftstest
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Darstellung der verknüpften Nukleotide (GTP und zweite Base) am ...
Abbildung 17.2: Allgemeine Struktur einer mRNA-Kappe
Abbildung 17.3: Das lac-Operon © Alfons Winkelmann
Abbildung 17.4: Struktur von methyliertem Cytosin
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Strukturen von Methionin- und Formylmethionin-beladener tRNA
Abbildung 18.2: Wichtige Strukturelemente einer tRNA
Abbildung 18.3: Beispiel einer Aminoacyl-tRNA
Abbildung 18.4: Struktur eines Aminoacyl-Adenylats
Abbildung 18.5: Die Struktur von Inosin
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Einleitung
Willkommen bei Biochemie kompakt für Dummies!
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich dazu entschlossen haben, in die faszinierende Welt der Biochemie einzutauchen. Die Biochemie ist zwar ein sehr komplexes Teilgebiet der Chemie, doch die Prinzipien sind eigentlich einfach und vor allem ungeheuer spannend. Schließlich geht es in diesem Buch um Sie und die Frage, warum Sie eigentlich leben und wie Sie funktionieren (oder auch nicht). Ja, schon ein ehrgeiziges Projekt – doch wir wollen uns hier auf die wichtigsten Dinge beschränken. Uns kommt es vor allem darauf an, dass Sie verstehen, was in Ihrem Körper passiert – chemisch betrachtet jedenfalls.
Vielleicht erkennen Sie nach der Lektüre des Buches die Zusammenhänge von Stoffwechselwegen und wissen, warum auf- und abbauende Reaktionen gleichzeitig in einer Zelle ablaufen können, wieso bestimmte pH-Werte im Blut schlecht für Ihren Metabolismus sind oder welche Komponenten auf keinen Fall in Ihrer Ernährung fehlen sollten. Die Biochemie hat viele Facetten, jedoch lassen sich nicht alle in einem Buch mit diesem beschränkten Umfang darstellen. Der eine Leser wird der Meinung sein, dass wichtige Prozesse fehlen, einer anderen Leserin werden die zahlreichen Reaktionsgleichungen Kopfzerbrechen bereiten. Vieles können wir an dieser Stelle nur anreißen – wenn Sie dann später noch mehr erfahren wollen, sind wir froh, dass wir mit diesem extrem kurz gefassten Buch vielleicht Ihr Interesse geweckt haben.
Über dieses Buch
Biochemie kompakt für Dummies bietet einen Überblick über den Stoff, der in einem typischen Biochemiegrundkurs an der Uni oder Fachhochschule gelehrt wird. Wir haben uns bemüht, den Stoff so aktuell wie möglich zu halten, aber seien Sie sich bewusst, dass sich der Wissensstand täglich ändert. Die Grundlagen bleiben jedoch gleich, daher haben wir uns im Großen und Ganzen darauf konzentriert. Wir haben auch Informationen über einige Themen der Biochemie eingefügt, die Sie vielleicht aus dem Alltagsleben kennen, wie Gentherapie, Gentests, gentechnisch veränderte Nahrung und so weiter.
Natürlich werden Sie sehr viele chemische Formeln und Reaktionen in diesem Buch finden, ohne die es nun mal auch in der Biochemie nicht geht. Daher behandeln wir im ersten Teil vor allem die wesentlichen Grundlagen der Chemie, soweit sie für unser Thema relevant sind.
Wenn Sie sich eine Weile damit beschäftigt haben, werden diese Formeln und Reaktionen zu »alten Bekannten«, und Sie werden gewisse biochemische Zusammenhänge daraufhin viel leichter verstehen und nachvollziehen können.
Törichte Annahmen über den Leser
Wir vermuten – und wir alle wissen, wie falsch solche Vermutungen sein können –, dass Sie zu einer der folgenden Gruppen gehören:
Studierende, die ein Biochemieseminar absolvieren
Leute, die einfach nur etwas über Biochemie lernen möchten
Menschen, die endlich wissen wollen, was im Stoffwechsel passiert
Egal, aus welchem Grund auch immer Sie dieses Buch zur Hand genommen haben – wir hoffen, dass Sie Spaß beim Lesen haben und dass es Ihnen hilft, die Biochemie besser zu verstehen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Wir geben Ihnen hier einen sehr kurzen Abriss über die Themen, die wir in den verschiedenen Teilen dieses Buches abhandeln. Nutzen Sie bitte die folgenden Kurzbeschreibungen und das Inhaltsverzeichnis, um Ihre persönliche Studierstrategie festzulegen.
Teil I: Vorhang auf: Grundlagen der Biochemie
Dieser Teil behandelt die grundlegenden Aspekte der Chemie und Biochemie. Soweit Sie es sowieso nicht schon wissen, lernen Sie alles Wesentliche aus der Chemie kennen, was Sie bei der weiteren Beschäftigung mit der Biochemie benötigen: Arten chemischer Bindungen, Redoxreaktionen und -potenziale, pH-Werte und Puffer. Weiterhin finden Sie ein Kapitel, in dem das Wichtigste über die organische Chemie zusammengefasst ist, angefangen von funktionellen Gruppen bis hin zu Isomeren.
Zum Abschluss besprechen wir noch etwas aus der Biologie, das für das weitere Verständnis ebenfalls wichtig ist, nämlich die Zellen, und wir erklären den Unterschied zwischen pro- und eukaryotischen Zellen.
Teil II: Das Fleisch der Biochemie: Proteine
In diesem Teil konzentrieren wir uns ganz auf die Proteine. Wir stellen Aminosäuren vor, die Bausteine der Proteine, und erklären die unterschiedlichen Ebenen der Proteinstruktur. Schließlich beenden wir diesen Teil mit einer Betrachtung der Enzymkinetik, wobei Katalysatoren und Inhibitoren näher beleuchtet werden.
Teil III: Kohlenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren und mehr
In diesem Teil beweisen wir Ihnen, dass Biochemie auch manchmal zuckersüß sein kann und Kohlenhydrate oft sehr komplexe Moleküle sind. Von den Lipiden gehen wir weiter zu den Nukleinsäuren DNA und RNA und dem genetischen Code, bevor wir uns zum Schluss die Vitamine und Hormone ansehen.
Teil IV: Bioenergetik und Reaktionswege
Am Ende dreht sich alles um Energie, auf die eine oder andere Weise: Woher kommt sie und wohin geht sie. In diesem Teil werfen wir einen Blick auf die Zusammenhänge zwischen Energiebereithaltung und Energieverbrauch. Hier treffen Sie auf einen treuen Freund, das Adenosintriphosphat oder kurz ATP, ohne das gar nichts geht, und wir widmen uns dem Zitronensäurezyklus.
Teil V: Genetik: Warum wir sind, was wir sind
In diesem Teil bringen wir Ihnen näher, wie sich DNA im Prozess der Replikation kopiert, und wir zeigen Ihnen einige praktische Anwendungen der DNA-Sequenzierung. Danach heißt es: Bühne frei für RNA- und Proteinsynthese!
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Der Schlussteil dieses Buches dreht sich um zehn (plus eine extra) großartige Anwendungen der Biochemie im täglichen Leben.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Falls Sie schon einmal ein … für Dummies-Buch gelesen haben, werden Ihnen einige Symbole bekannt vorkommen. Trotzdem hier noch einmal ihre Bedeutungen:
Dieses Symbol soll eine Art Wink mit dem Zaunpfahl sein, dass es hier um Themen geht, die Sie zum besseren Verständnis lieber nicht mehr vergessen sollten, je weiter Sie sich in die Welt der Biochemie hineinwagen.
Dieses Symbol taucht immer dann auf, wenn wir etwas Wichtiges aufzeigen möchten, das im weiteren Verlauf noch benötigt wird.
Dieses Symbol finden Sie immer dann, wenn wir auf etwas hinweisen wollen, das möglicherweise für Sie gefährlich sein könnte.
Dieses Symbol steht für Informationen, die einen direkten Bezug zwischen der Biochemie und dem Alltag aufdecken.
Und nun … hinein in die Biochemie!
Teil I
Vorhang auf: die Grundlagen der Biochemie
IN DIESEM TEIL …
lernen Sie die Grundlagen der allgemeinen Chemie, der organischen Chemie und der Biochemie kennen.erfahren Sie so einiges über die Chemie des Wassers, des unentbehrlichen Bestandteils allen Lebens auf der Erde.werfen Sie einen Blick auf pH-Wert und Puffereigenschaften.erklären wir den Unterschied zwischen pro- und eukaryotischen Zellen.Kapitel 1
Chemie: Was Sie darüber wissen sollten
IN DIESEM KAPITEL
Warum die Chemie so wichtig istDie chemischen GrundlagenVom Atom bis zu RedoxpotenzialenIn diesem Kapitel erläutern wir alles, was an Chemie für die biochemischen Vorgänge wichtig ist, mit denen wir uns im Rest dieses Buches noch oft befassen werden.
Warum interessieren Sie sich für Biochemie?
Die Antwort auf diese Frage könnte lauten: »Wieso denn nicht?« oder »Na ja, weil es im Studium verlangt wird!« Die erste Antwort ist gar nicht so schlecht, zeigt sie doch ein gewisses Interesse an diesem spannenden Thema. Vielleicht sitzen Sie gelegentlich abends auf dem Sofa und denken über die Komplexität des Lebens nach. Allein die Tatsache, dass Sie auf dem Sofa sitzen können, erfordert eine Unmenge chemischer Reaktionen, die permanent im Körper ablaufen und perfekt zusammenwirken müssen. Als ich mich zum ersten Mal mit den minimalen strukturellen Unterschieden zwischen Stärke und Zellulose befasst habe, war ich völlig verblüfft: Nur ein winziger Unterschied in der chemischen Bindung zweier Substanzen ist dafür verantwortlich, dass eine Kartoffel essbar und nicht hart und trocken wie Holz ist! So entstand letztlich auch dieses Buch.
Egal, um welche Prozesse des Lebens es sich auch immer handelt – Biochemiker interessiert vor allem, wie Leben funktioniert. Werfen wir daher als Erstes einen Blick auf das, was allen Vorgängen im Körper zugrunde liegt: die chemischen Abläufe.
Stecken Sie gerade mitten in einem (Bio-)Chemiestudium oder hatten Sie Chemie als Leistungsfach in der Schule, können Sie die ersten drei Kapitel überspringen (vielleicht möchten Sie sich aber einige Details noch einmal vergegenwärtigen?). Ansonsten bieten wir Ihnen jetzt in allerknappster Form einen kleinen »Grundkurs Chemie«.
Chemie und das ganze Drumherum
Die Chemie ist, kurz gesagt, die Wissenschaft, die sich mit den Eigenschaften von Stoffen und deren Umwandlung beschäftigt. Sie beruht auf Erkenntnissen der Physik und bildet die Grundlage für einen guten Teil der Biologie. Aha! Da haben wir es schon. Wie wir bereits gesehen haben, geht es in der Biochemie um die Umwandlung von Stoffen im Körper. Um diese Umwandlungen besser zu verstehen, sind also Kenntnisse in der Chemie unerlässlich. Fangen wir daher ganz von vorn an, beim (fast) Allerkleinsten, nämlich den Atomen und Molekülen.
Elemente, Atome, Moleküle und Verbindungen
In der Chemie, also auch in der Biochemie, haben wir es mit Elementen, Atomen, Molekülen und Verbindungen zu tun.
Elemente sind die Grundstoffe, auf denen alles beruht, wie zum Beispiel Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff. Die Elemente werden im sogenannten Periodensystem nach ihren jeweiligen atomaren Eigenschaften aufgelistet und sortiert (siehe Abbildung 1.1). Elemente bestehen also aus Atomen.
Die Elemente werden im Periodensystem nach ihrer Masse angeordnet. Die Einheit hierfür ist das u, die atomare Masseneinheit. Ein u entspricht definitionsgemäß 1/12 der Masse eines Kohlenstoffatoms. Wasserstoff hat also die Atommasse 1, Sauerstoff 16, Phosphor 30 (nicht ganz genau, weil es von vielen Elementen Isotope gibt, das heißt mehrere »Ausgaben« des Elements, jedoch mit unterschiedlicher Masse).
Der historischen Bezeichnung nach sind Atome »Elementarteilchen, die sich nicht mehr weiter teilen lassen«, (von griech. »átomos«, das Unteilbare; dass das Atom sehr wohl teilbar ist, hat man erst sehr viel später entdeckt). Alle Eigenschaften eines Elements werden durch die Eigenschaften der Atome bestimmt, also deren innerem Aufbau und räumlicher Anordnung.
Abbildung 1.1: Periodensystem der Elemente © malachy120 – stock.adobe.com
Vereinfacht ausgedrückt bestehen Atome aus positiv geladenen Protonen und neutralen Neutronen. Beide bilden den Atomkern. Um diesen Kern kreisen negativ geladene Elektronen. Sie dürfen jedoch nicht nach Belieben kreisen, sondern müssen sich an bestimmte Aufenthaltsorte in bestimmten Abständen zu den Protonen und Neutronen halten – sie befinden sich in sogenannten Orbitalen, die jeweils nur eine bestimmte Zahl an Elektronen aufnehmen können. Die Orbitale werden der Reihe nach als s, p, d, f …-Orbital bezeichnet. Die Elektronen auf den äußeren Orbitalen sind für chemische Reaktionen (und für bestimmte andere Erscheinungen) wesentlich, man nennt sie auch Valenzelektronen. Den Atomaufbau zeigt Abbildung 1.2.
Abbildung 1.2: Atomaufbau sowie Form der s- und p-Orbitale © Eakglory – stock.adobe.com
Moleküle setzen sich aus gleichen oder verschiedenen Atomen zusammen. Es gibt Moleküle, die nur aus Atomen des gleichen Elements bestehen, beispielsweise Wasserstoff oder Sauerstoff (H2 oder O2), oder solche aus mehreren Elementen, beispielsweise Phosphorsäure H3PO4.
Die tiefgestellten Ziffern neben dem Elementsymbol sagen etwas über die Anzahl der jeweiligen Elemente in der Verbindung aus. Im Fall der Phosphorsäure bedeutet dies: 3 Atome Wasserstoff verbinden sich mit einem Atom Phosphor und 4 Atomen Sauerstoff.
Verbindungen bestehen aus einer Vielzahl von verschiedenen Atomen und/oder Molekülen der unterschiedlichsten Art. Ein Beispiel ist Essigsäure CH3COOH, die aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff besteht. Alle Atome sind durch eine chemische Bindung miteinander verknüpft.
Warum jedoch gehen Atome überhaupt Verbindungen ein? Hier kommen Energie und Stabilität ins Spiel. Betrachten wir das Periodensystem der Elemente, so werden wir feststellen, dass die stabilsten Atome die Edelgase Helium, Neon, Argon, Xenon und Krypton sind (Radon und Organesson lassen wir aus dem Spiel, die sind radioaktiv und zerfallen daher rasch zu anderen Elementen). Das ist unter anderem daran zu erkennen, dass sie nur sehr schwer, wenn überhaupt, mit anderen Elementen reagieren, also Verbindungen eingehen. Edelgase haben vollständig mit Elektronen aufgefüllte äußere Schalen, daher die Stabilität. Den anderen Elementen fehlen entweder Elektronen oder sie haben eines oder mehrere zu viel in der äußeren Schale. Sie sind daher aus Stabilitätsgründen bestrebt, diese Schale zu vervollständigen. Und dies können sie auf verschiedene Art und Weise erreichen.
Die Bindungsarten
Atome können auf vier verschiedene Arten miteinander verbunden sein, die wir in den folgenden Abschnitten erklären.
Ionenbindung
Fangen wir mit der Ionenbindung an (siehe Abbildung 1.3).
Abbildung 1.3: Ionische Bindung zwischen Natrium und Chlor zu Natriumchlorid (Kochsalz) © Reuel Sa – stock.adobe.com
Grundsätzlich gilt: Ein Atom besitzt die gleiche Anzahl an positiv geladenen Protonen wie negativ geladenen Elektronen (die Neutronen spielen hier, da neutral, keine Rolle). Es ist daher nach außen neutral. Will ein Atom die Konfiguration eines Edelgases erreichen und gibt es dazu ein oder mehrere Elektronen ab oder nimmt eines oder mehrere auf, so ändert sich dadurch seine Ladung. Es wird positiv (bei Abgabe eines oder mehrerer Elektronen) oder negativ (bei Aufnahme eines oder mehrerer Elektronen). Nun weiß jeder, dass sich entgegengesetzte elektrische Ladungen anziehen, und zwar sehr stark. Daraus resultiert eine im Allgemeinen sehr starke Bindung zwischen Atomen.
Kovalente Bindung
Nun gibt es jedoch auch Atome, die sich nicht von ihrem Eigentum, den Elektronen, trennen wollen. Sie teilen sie lieber nur mit den anderen. So ist es beispielsweise bei allen gasförmigen Elementen (außer den oben erwähnten Edelgasen), die sich stets zu Molekülen zusammenschließen. Dabei teilt jedes einzelne Atom so viele Elektronen mit dem anderen, dass beide im Endeffekt ein »gefülltes Orbital«, eine Edelgaskonfiguration, aufweisen.
So hat ein Chloratom sieben Außenelektronen und teilt sich mit einem »Kollegen« ein Elektron, sodass beide im Mittel acht Elektronen besitzen und das Orbital damit gefüllt ist. Ein Sauerstoffatom hat sechs Außenelektronen und teilt sich mit einem anderen zwei Elektronen. Eine praktische Lösung, nicht wahr? Das Ganze funktioniert übrigens auch sehr gut mit zwei verschiedenen Atomen, wie zum Beispiel mit Wasserstoff und Chlor, die sich zu Chlorwasserstoff verbinden, gemeinhin Salzsäure (siehe Abbildung 1.4).
Abbildung 1.4: Kovalente Bindung: Teilung von Elektronen zwischen zwei Atomen © natros – stock.adobe.com
Wie aus der Abbildung zu ersehen, spricht man von bindenden und nicht bindenden (einsamen) Elektronenpaaren.
Metallische Bindung
Diese Art der Bindung sei hier nur kurz erwähnt, da sie bei der Biochemie eigentlich keine Rolle spielt. Metallatome verlieren leicht ihre äußeren Elektronen und bilden positiv geladene Ionen. Sie werden dann von einer Wolke aus negativ geladenen Elektronen umgeben, die sich ziemlich frei bewegen (können). Darauf beruht die hohe elektrische Leitfähigkeit vieler Metalle (siehe Abbildung 1.5).
Abbildung 1.5: Metallische Bindung © Reuel Sa – stock.adobe.com
Hybridisierung
Bei Kohlenstoffverbindungen, mit denen wir es im Weiteren zu tun haben werden, spielt jedoch noch eine andere Sache eine entscheidende Rolle: die Hybridisierung, bei der verschiedene Orbitale zu einem Hybridorbital verschmelzen. Sehen wir uns das mal genauer an.
Die Elektronen bewegen sich in verschiedenen Orbitalen. Das (energetisch) niedrigste Orbital ist das kugelförmige s-Orbital mit zwei Elektronen (1s-Orbital). Energetisch höher auf der nächsten Stufe liegen das nächste s-Orbital (2s-Orbital, ebenfalls kugelförmig) und drei hantelförmige p-Orbitale in x-, y- und z-Richtung, sodass dort insgesamt sechs Elektronen Platz hätten, zusammen mit den Elektronen aus dem 2s-Orbital also acht – was die Konfiguration des Edelgases Neon ergeben würde.
Der Kohlenstoff hat jedoch nur vier Außenelektronen (4. Gruppe im Periodensystem): Zwei besetzen das energetisch niedrigere 2s-Orbital und zwei je ein energetisch höheres p-Orbital. Günstiger wäre es für den Kohlenstoff jedoch, wenn alle Elektronen dieselbe Energie hätten. Das kann tatsächlich geschehen, und zwar dadurch, dass sich zwei oder mehr Orbitale »mischen«, »hybridisieren«. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: Es können sich jeweils 1 2s-Orbital und 1 p-Orbital mischen, dann spricht man von einem sp-Hybridorbital, und entsprechend 1 s-Orbital mit 2 oder gar drei p-Orbitalen, woraus sich sp2- beziehungsweise sp3-Orbitale ergeben. Schwierig vorzustellen? Dann betrachten Sie Abbildung 1.6.
Abbildung 1.6: sp2-Hybridorbitale mit zwei nicht hybridisierten p-Orbitalen (Ethylen) © natros – stock.adobe.com
Aus der Abbildung lässt sich übrigens noch etwas anderes erkennen, dass es nämlich verschiedene Arten der Bindung gibt. Diejenige zwischen den hybridisierten Orbitalen nennt man σ-Bindung (die relativ stark ist) und diejenige zwischen nicht-hybridisierten Orbitalen heißt π-Bindung (die etwas schwächer ist). Wir haben es hier mit einer Doppelbindung zu tun, was durch die beiden Striche zwischen den C-Atomen darunter angedeutet wird.
Interessant, nicht? Je nach Grad der Hybridisierung können also Einfachbindungen, Doppelbindungen und Dreifachbindungen eingegangen werden! Was das für Konsequenzen hat, sehen wir in den nächsten Kapiteln.
Weitere Arten von Bindungen, Bedeutung der Elektronegativität
Wie wir gesehen haben, können sich verschiedene Atome miteinander zu Molekülen verbinden. Nun sind diese Atome nicht alle gleich, sondern haben durchaus sehr unterschiedliche Eigenschaften. Die einen haben mehr Protonen im Kern, die anderen mehr Elektronen in der äußeren Hülle. Das hat Konsequenzen bei einer Verbindung der beiden. Betrachten wir beispielsweise das Wasser, eine Verbindung aus Sauerstoff und Wasserstoff. Sauerstoff ist ein wesentlich schwereres Element als Wasserstoff, er verfügt über wesentlich mehr Protonen als der Wasserstoff mit seinem einen und einzigen. So viele Protonen haben natürlich auch eine wesentlich höhere Anziehungskraft auf die Elektronen. Dagegen kommt der Wasserstoff nicht an. Im Endergebnis halten sich die Elektronen daher wesentlich stärker beim Sauerstoff auf als beim Wasserstoff, was wiederum bedeutet, dass der Sauerstoff »negativer« geladen ist als der Wasserstoff. Man spricht davon, dass der Sauerstoff elektronegativer ist als der Wasserstoff, zudem ist eine solche Verbindung polar, das heißt, sie besitzt einen mehr negativen und einen mehr positiven Pol, weil die Elektronen ja stärker zu einer Seite gezogen werden.
Die Elektronegativität ist ein relatives Maß für die Fähigkeit eines Atoms, innerhalb einer Verbindung die bindenden Elektronen auf seine Seite zu ziehen. Sie hängt von der Kernladung und der Größe des Atoms ab, wobei gilt, dass die Elektronegativität höher wird, je weniger Elektronen zur Edelgasschale fehlen. Je weiter rechts also ein Element im Periodensystem steht, desto elektronegativer ist es. So ist zum Beispiel Fluor – F – das Element mit der höchsten Elektronegativität. Es gibt verschiedene Skalen der Einteilung von elektronegativen Elementen.
Je größer der Unterschied in der Elektronegativität der Atome einer Verbindung ist, desto polarer ist die Verbindung.
Für das Wassermolekül bedeutet dies, dass die Seite mit dem Sauerstoff negativer geladen ist als die Seite mit dem Wasserstoff. Sind jetzt viele Wassermoleküle beisammen, so hat das interessante Konsequenzen. Wie wir bereits festgestellt haben, ziehen sich Gegensätze an (eine Binsenweisheit, klar). Was liegt daher näher als die Vermutung, dass die negative Seite des einen Wassermoleküls und die positive Seite des anderen einander näherkommen? Und genauso ist es. Es entsteht eine Bindung zwischen den einzelnen Molekülen, die allerdings längst nicht so stark ist wie eine »echte« kovalente Bindung. Dennoch ergeben sich daraus einige Folgen, über die wir ebenfalls in den nächsten Kapiteln sprechen werden. Hier sei nur so viel gesagt, dass es sich bei dieser Art der Bindung um eine Wasserstoffbrückenbindung handelt. Eine solche Bindung ist verwandt mit der Dipol-Dipol-Wechselwirkung, nur dass Letztere meist wesentlich schwächer ist und auch zwischen anderen Atomen als Sauerstoff und Wasserstoff auftritt. Wasserstoffbrückenbindungen existieren nicht nur im Wasser, sondern allgemeinen zwischen Verbindungen mit OH-Gruppen.
Weitere sehr schwache Bindungen entstehen durch die sogenannten Van-der-Waals- und die London-Dispersionskräfte. Sie treten aufgrund der ständigen Bewegung der Elektronen in einem Atom auf, wodurch zeitweilig eine geringfügige Ladungsverschiebung entsteht, also ein temporärer Dipol innerhalb des Moleküls.
Einfluss der Bindungsstärke auf die Eigenschaften einer Substanz
Die physikalischen Eigenschaften der Substanzen wie Schmelz- und Siedepunkt oder Löslichkeit hängen eng zusammen mit den Kräften zwischen den Molekülen, den intermolekularen Kräften. Logisch, oder?
Schmelz- und Siedepunkte
So hat ein Salz wie das Natriumchlorid wegen der starken Bindungskräfte zwischen den Natrium- und Chlorid-Ionen einen deutlich höheren Schmelzpunkt als zum Beispiel Wasser, das im festen und flüssigen Zustand ja im Wesentlichen von den Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten wird.
Bei Verbindungen wie Kohlenwasserstoffen hängen Schmelz- und Siedepunkte (meist) unter anderem von der Länge der Kette ab, also von der Menge an zusammenhaltenden C-H-Bindungen. So schmilzt Methan (CH4) bereits bei –184 °C, während Decan (C10H22) erst bei –30 °C schmilzt. Gleiches gilt natürlich auch für die Siedepunkte (Methan: –164 °C, Decan +174 °C).
Löslichkeit
Nicht jeder mag Wasser – auch einige Moleküle reagieren außerordentlich abweisend, wenn sie mit Wasser in Kontakt gebracht werden. Die Ursache dieser hydrophoben Reaktion liegt in den Bereichen einer Verbindung (siehe unten), die nur aus Wasserstoff und Kohlenstoff bestehen. Beide Elemente gehen recht friedlich miteinander um, und keines versucht, die gemeinsamen Elektronen auf seine Seite zu ziehen – die Elektronegativität unterscheidet sich nur wenig. Kohlenwasserstoffreiche Regionen sind daher unpolar