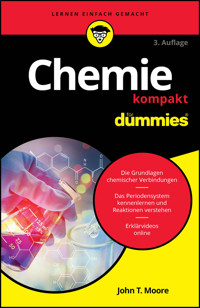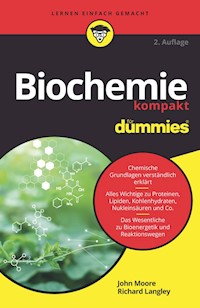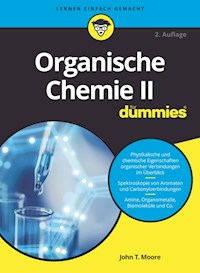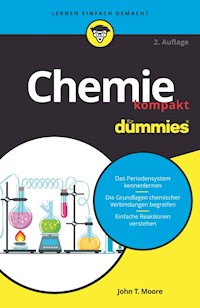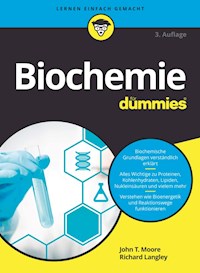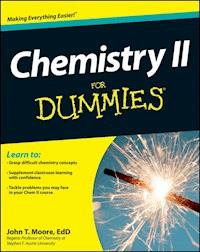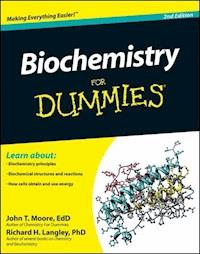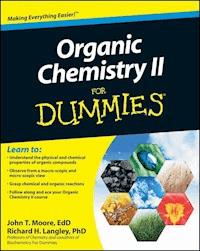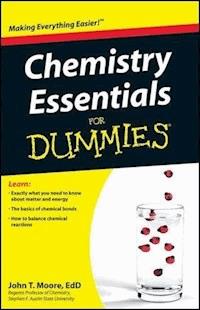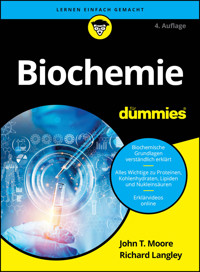
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Die Chemie des Lebens verstehen
Stehen Sie auf Kriegsfuß mit der Biochemie? Diese ganzen Formeln und Reaktionen sind überhaupt nicht Ihr Ding? Die nächste Prüfung steht vor der Tür? Kein Problem! Dieses Buch erklärt Ihnen, was Sie über Biochemie wissen müssen. Es führt Sie so einfach wie möglich und so komplex wie nötig in die Welt der Kohlenhydrate, Lipide, Proteine, Nukleinsäuren, Vitamine, Hormone und Co. ein. Zu einzelnen Themen finden Sie auch Videos online, die Sie beim Lernen unterstützen. So leicht kann Biochemie sein und Sie müssen die nächste Prüfung gewiss nicht fürchten.
Sie erfahren
- Wie Aminosäuren interagieren und wie Peptidbindungen aufgebaut sind
- Alles zum Thema Enzymkinetik und der Michaelis-Menten-Gleichung
- Wie der Körper durch Glykolyse und Citratzyklus Energie gewinnt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Biochemie für Dummies
Schummelseite
WICHTIGE FORMELN
pH-Wert und Co.:
Henderson-Hasselbalch-Gleichung:
Michaelis-Menten-Gleichung:
FUNKTIONELLE GRUPPEN
DIE SECHS ENZYMKLASSEN
Enzymklasse
Aufgabe
Oxidoreduktasen
Redoxreaktion
Transferasen
Übertragung von Atomgruppen
Hydrolasen
Hydrolyse
Lyasen
Addition an eine Doppelbindung oder die Bildung einer Doppelbindung
Isomerasen
Isomerisierung von Molekülen
Ligasen
Zwei Moleküle miteinander verbinden
DER UNIVERSELLE GENETISCHE CODE
1. Base
2. Base
3. Base
U
C
A
G
U
UUU Phe
UCU Ser
UAU Tyr
UGU Cys
U
UUC Phe
UCC Ser
UAC Tyr
UGC Cys
C
UUA Leu
UCA Ser
UAA Stop
UGA Stop
A
UUG Leu
UCG Ser
UAG Stop
UGG Trp
G
C
CUU Leu
CCU Pro
CAU His
CGU Arg
U
CUC Leu
CCC Pro
CAC His
CGC Arg
C
CUA Leu
CCA Pro
CAA Gln
CGA Arg
A
CUG Leu
CCG Pro
CAG Gln
CGG Arg
G
A
AUU Ile
ACU Thr
AAU Asn
AGU Ser
U
AUC Ile
ACC Thr
AAC Asn
AGC Ser
C
AUA Ile
ACA Thr
AAA Lys
AGA Arg
A
AUG Start/Met
ACG Thr
AAG Lys
AGG Arg
G
G
GUU Val
GCU Ala
GAU Asp
GGU Gly
U
GUC Val
GCC Ala
GAC Asp
GGC Gly
C
GUA Val
GCA Ala
GAA Glu
GGA Gly
A
GUG Val
GCG Ala
GAG Glu
GGG Gly
G
Biochemie für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
4. Auflage 2026
© 2026 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Original English language edition Biochemie für Dummies © 2020 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Biochemie für Dummies © 2017 by Wiley Publishing, Inc. Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Der Verlag und die Autoren dieses Werks haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet, einschließlich einer gründlichen Überprüfung des Inhalts. Jedoch übernehmen weder der Verlag noch die Autoren Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich der Genauigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Werks. Insbesondere schließen sie jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich Gewährleistungen der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Bei der Erstellung dieses Werks wurden bestimmte KI-Systeme eingesetzt. Es kann keine Garantie durch Vertriebsmitarbeiter, schriftliche Verkaufsunterlagen oder Werbeaussagen übernommen oder erweitert werden. Der Verweis auf eine Organisation, Website oder ein Produkt als Quelle für weitere Informationen impliziert keine Unterstützung oder Empfehlungen durch den Verlag und die Autoren. Der Verkauf dieses Werks erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Verlag keine professionellen Dienstleistungen erbringt. Die enthaltenen Ratschläge und Strategien sind möglicherweise nicht für Ihre Situation geeignet. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Spezialisten. Leser sollten sich darüber im Klaren sein, dass die in diesem Werk aufgeführten Websites zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung und dem Zeitpunkt des Lesens geändert sein können oder nicht mehr existieren. Weder der Verlag noch die Autoren haften für entgangene Gewinne oder sonstige wirtschaftliche Schäden, einschließlich besonderer, zufälliger, Folgeschäden oder sonstiger Schäden.
Coverfoto: jittawit.21 - stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-72377-5ePub ISBN: 978-3-527-85453-0
Über die Autoren
John Moore besuchte die University of North Carolina in Asheville, wo er seinen Bachelor-Abschluss in Chemie erhielt. An der Furman University in Greenville, South Carolina, erreichte er seinen Master-Abschluss in Chemie. 1971 wurde er Mitarbeiter an der Chemie-Fakultät der Stephen F. Austin State University in Nacogdoches im Staate Texas, wo er bis heute Chemie unterrichtet. 1985 begann er zeitweise wieder zu studieren und promovierte schließlich in Erziehungswissenschaft an der Texas A&M University. 2003 wurde sein erstes Buch, Chemie für Dummies, veröffentlicht, kurz darauf gefolgt von Chemistry made simple.
Richard Langley besuchte die Miami University in Oxford, Ohio, wo er seine Bachelor-Abschlüsse in Chemie und Mineralogie sowie etwas später auch seinen Master-Abschluss in Chemie erhielt. Die nächste Stufe auf der Karriereleiter führte ihn an die University of Nebraska, wo er in Chemie promovierte. Danach nahm er eine Postdoc-Stelle an der Arizona State University in Tempe, Arizona, an, gefolgt von einer Gast-Juniorprofessur an der University of Wisconsin in River Falls. 1982 erhielt er eine Stelle an der Stephen F. Austin State University in Texas. John Moore und er haben zusammen verschiedene Buchprojekte realisiert wie Chemistry for the utterly confused.
Über die Überarbeiterin
Dr. Susanne Katharina Hemschemeier forschte viele Jahre als Mikrobiologin und Proteinbiochemikerin an der Universität Bielefeld, in Gießen und an der UCLA in Los Angeles, bevor sie die praktische Arbeit im Labor an den Nagel hängte und sich in Mainz mit der Erstellung von E-Learning-Materialien für das Chemie- und Biochemiestudium befasste. Sie arbeitet derzeit als selbstständige Autorin und Übersetzerin für wissenschaftliche Texte und lebt mit ihrer Familie in Berlin und Stuttgart.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Über die Überarbeiterin
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Vorhang auf: Grundlagen der Biochemie
Kapitel 1: Biochemie: Was Sie darüber wissen sollten – und wozu
Warum interessieren Sie sich für Biochemie?
Was genau ist eigentlich Biochemie?
Pro- und eukaryotische Zelltypen
Typische Bestandteile einer Tierzelle
Ein kurzer Blick in eine Pflanzenzelle
Kapitel 2: Eintauchen: Die Chemie des Wassers
Was Sie über H
2
O (Wasser) wissen sollten
Die Wasserstoffionenkonzentration: Säuren und Basen
Puffer und pH-Kontrolle
Kapitel 3: Spaß mit Kohlenstoff: Organische Chemie
Die Rolle des Kohlenstoffs im Laufe der Zeit
Komplizierte Zahlenspiele: Kohlenstoffbindungen
Magische Anziehungskräfte – Bindungsstärken
Hier ist was los! Die funktionellen Gruppen eines Moleküls
Gleiche Zusammensetzung, andere Struktur: Isomerie
Teil II: Das Fleisch der Biochemie: Proteine
Kapitel 4: Aminosäuren: Die Bausteine der Proteine
Allgemeine Eigenschaften der Aminosäuren
Die »magischen« 20 Aminosäuren
Die selteneren Ausnahmen
Nicht zu vergessen: Nicht proteinogene Aminosäuren
Aminosäuren verknüpfen: Eine Bauanleitung
Kapitel 5: Struktur und Funktion von Proteinen
Proteine – mehr als nur das Steak auf Ihrem Teller
Die Primärstruktur: Was alle Proteine verbindet
Sekundärstruktur: Fast jedes Protein hat sie
Tertiärstruktur: Eine Strukturebene vieler Proteine
Quartärstruktur: Proteine aus mehreren Untereinheiten
Proteine isolieren und analysieren
Kapitel 6: Enzymkinetik: Mit Hilfe schneller ans Ziel
Enzymklassifizierung: Wer macht den Job?
Enzyme als Katalysatoren: Wir machen Tempo
Einige Bemerkungen zur Kinetik
Enzymaktivitäten messen: Die Michaelis-Menten-Gleichung
Enzymhemmung: Der Bolzen im Getriebe
Enzymregulierung
Teil III: Kohlenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren und mehr
Kapitel 7: Wecken Gelüste: Kohlenhydrate
Eigenschaften von Kohlenhydraten
Ein zuckersüßes Thema: Die Monosaccharide
Wenn sich Zucker die Hände reichen: Oligosaccharide
Kapitel 8: Lipide und Membranen
Ohne Fett geht nichts: Ein Überblick
Ein fettes Thema: Triglyzeride
Alles andere als einfach: Komplexe Lipide
Membranen: Bipolarität und Doppelschicht
Prostaglandine, Thromboxane und Leukotriene – die wilden Drei
Kapitel 9: Nukleinsäuren und der Code des Lebens
Nukleotide: Die Bausteine der DNA und RNA
Vom Nukleosid über das Nukleotid zur Nukleinsäure
Dogmatisches Wissen ist gefragt …
Kapitel 10: Vitamine und Nährstoffe
Mehr als nur ein Apfel am Tag: Das Einmaleins der Vitamine
Wer A sagt, muss auch B sagen: Die Vitamine der B-Gruppe
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Kapitel 11: Die stillen Akteure: Hormone
Strukturen einiger Schlüsselhormone
Wie bei Dornröschen: Die Prohormone
Kampf oder Flucht: Hormonfunktion
Teil IV: Bioenergetik und Reaktionswege
Kapitel 12: Leben und Energie
ATP: Energiespritze für alle Systeme
Mit ATP verwandte Moleküle
Stoffwechsel in Zahlen
Kapitel 13: ATP: Das Währungssystem des Körpers
Metabolismus Teil I: Glykolyse
Metabolismus Teil II: Der Citratzyklus (Krebs-Zyklus)
Metabolismus Teil III: Elektronentransport und oxidative Phosphorylierung
Investition in die Zukunft: Biosynthese
Kapitel 14: Ein »anrüchiges« Thema: Stickstoff in biologischen Systemen
Ringelrein mit Stickstoffen: Purine
Die Biosynthese von Pyrimidinen
Noch mal zum Anfang: Katabolismus
Abfallbeseitigung: Der Harnstoffzyklus
Aminosäuren, ein letzter Akt …
Stoffwechselkrankheiten und ihre Ursachen
Teil V: Genetik: Warum wir sind, was wir sind
Kapitel 15: DNA fotokopieren
Aus eins mach zwei: DNA-Replikation
Mendel wäre begeistert: Rekombinante DNA
Ein spannungsreiches Thema: DNA-Analyse
Erbkrankheiten und andere Anwendungsmöglichkeiten der DNA-Analytik
Kapitel 16: Schön abschreiben bitte! RNA-Transkription
Arten der RNA
Was RNA-Polymerasen brauchen
Transkription stromauf, stromab
Der genetische Code
Modelle der Genregulation
Kapitel 17: Korrekt übersetzen – Translation
Bitte keine Fehler!
Das Team
Und … Anpfiff: Proteinsynthese
Unterschiede bei eukaryotischen Zellen
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 18: Zehn beeindruckende Einsatzgebiete der Biochemie
Ames-Test
Schwangerschaftstests
HIV-Tests
Brustkrebsuntersuchungen
Pränatale Gentests
PKU-Screening
Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel (»Genfood«)
Gentechnik
Klonen
Gentherapie
Kapitel 19: Zehn Karrierewege in der Biochemie
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Pflanzenzüchter
Qualitätskontrollanalytiker
Klinischer Forschungsassistent
Technischer Redakteur
Biochemischer Entwicklungsingenieur
Marktforschungsanalytiker
Patentanwalt
Pharmareferent
Biostatistiker
Ein letzter Tipp …
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Die pH-Skala mit den entsprechenden Wasserstoffionenkonzentrationen
Tabelle 2.2: K
S
-Werte biologisch relevanter Säuren
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Mögliche Bindungen von Kohlenstoff mit einigen ausgewählten Nichtmetallen
Tabelle 3.2: Säure-Base-Eigenschaften biologisch relevanter funktioneller Gruppen
Kapitel 4
Tabelle 4.1: pK
s
-Werte für Aminosäuren
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Die sechs grundsätzlichen Enzymklassen
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Häufig vorkommende Fettsäuren
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Beziehungen zwischen einigen Werten von ΔG°′ und K
Tabelle 12.2: Freigesetzte Energien (ΔG°′) einiger hochenergetischer Biomoleküle im Vergleich...
Tabelle 12.3: ATP-Ausbeute für jeden Schritt des Glukosestoffwechsels
Tabelle 12.4: ATP-Ausbeute für jeden Schritt des Stearinsäurestoffwechsels
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Einige physiologisch relevante Redoxpotentiale (E′°)
Tabelle 13.2: Essenzielle und nichtessenzielle Aminosäuren für Erwachsene (* essenziell für H...
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Zehn Enzyme, die an der Inosinsynthese beteiligt sind
Tabelle 14.2: Glukogene und ketogene Aminosäuren
Kapitel 15
Tabelle 15.1: Einige Erbkrankheiten des Menschen
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Der universelle genetische Code
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Basenpaarungsregeln der Wobble-Hypothese
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Vereinfachte Darstellung einer prokaryotischen Zelle
Abbildung 1.2: Vereinfachte Darstellung einer Tierzelle
Abbildung 1.3: Vereinfachte Darstellung einer Pflanzenzelle
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Struktur eines Wassermoleküls
Abbildung 2.2: Struktur eines typischen amphipathischen Moleküls mi...
Abbildung 2.3: Struktur einer Mizelle aus amphipatischen Molekülen,...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Oben: unverzweigte Kohlenwasserstoffkette (Hexan), e...
Abbildung 3.2: Beispiele für Alkan, Alken, Alkin und einen aromatis...
Abbildung 3.3: Sauerstoff- und schwefelhaltige funktionelle Gruppen
Abbildung 3.4: Einige stickstoffhaltige funktionelle Gruppen
Abbildung 3.5: Phosphorhaltige funktionelle Gruppen
Abbildung 3.6: Acetale, Hemiacetale, Hemiketale und Ketale
Abbildung 3.7: Cis- und trans-Isomere
Abbildung 3.8: Die Struktur von D-Glukose, einem Zucker mit vier ch...
Abbildung 3.9: Fischer-Projektionen, die den Unterschied zwischen z...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Bildung eines Zwitterions
Abbildung 4.2: (a) Zwitterionenform, (b) protonierte Form, (c) depr...
Abbildung 4.3: Zwei verschiedene Möglichkeiten, die Fischer-Pr...
Abbildung 4.4: Unpolare Aminosäuren
Abbildung 4.5: Polare und ungeladene (neutrale) Aminosäuren
Abbildung 4.6: Saure Aminosäuren
Abbildung 4.7: Basische Aminosäuren
Abbildung 4.8: Zwei weniger häufige Aminosäuren
Abbildung 4.9: Wie sich zwei Cysteinmoleküle zu Cystin verbinden
Abbildung 4.10: Die Bildung einer Peptidbindung
Abbildung 4.11: Mesomeriestabilisierung einer Peptidbindung
Abbildung 4.12: Ein Tripeptid
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Ständig wiederholte Einheit des Proteinrückgrats
Abbildung 5.2: Struktur von Rinderinsulin
Abbildung 5.3: Wasserstoffbrückenbindung zwischen zwei Peptidbindun...
Abbildung 5.4: Die α-Helix
Abbildung 5.5a: Paralleles β-Faltblatt, chemische Struktur und schematische Darstellun...
Abbildung 5.5b: Antiparalleles β-Faltblatt, chemische Struktur (oben) und schematische...
Abbildung 5.6: Einige Tertiärstrukturen von Proteinen
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Allgemeine (stöchiometrisch nicht korrekte) Darstell...
Abbildung 6.2: Allgemeine Darstellung zweier Hydrolase-katalysierte...
Abbildung 6.3: Allgemeine Darstellung zweier Lyase-katalysierter Re...
Abbildung 6.4: Beispiele für Isomerasereaktionen durch eine Racemas...
Abbildung 6.5: Reaktionen der Ligasen Pyruvat-Carboxylase und Acety...
Abbildung 6.6: Das Schlüssel-Schloss-Prinzip der Enzymkatalyse
Abbildung 6.7: Das Induced-Fit-Modell der Enzymkatalyse
Abbildung 6.8: Der Einfluss eines Enzyms auf eine Reaktion
Abbildung 6.9: Graph der Reaktionsgeschwindigkeit V im Verhältnis z...
Abbildung 6.10: Lineweaver-Burk-Diagramm
Abbildung 6.11: Woolf-Diagramm
Abbildung 6.12: Eadie-Hofstee-Diagramm
Abbildung 6.13: Ein Lineweaver-Burk-Diagramm für eine nichtkompeti...
Abbildung 6.14: Ein Lineweaver-Burk-Diagramm für eine kompetitive ...
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Das Verhältnis zwischen dreidimensionaler Struktur u...
Abbildung 7.2: Struktur von D-Glukose
Abbildung 7.3: Strukturvarianten der D-Aldohexosen
Abbildung 7.4: Strukturvarianten der D-Ketohexosen
Abbildung 7.5: Ein Pyranosering
Abbildung 7.6: Die Haworth-Projektionen für die Pyranose-Strukturen...
Abbildung 7.7: Ein Furanosering
Abbildung 7.8: Zwei Formen der D-Fruktose
Abbildung 7.9: Zwei Strukturen der D-Ribose
Abbildung 7.10: D-Ribitol
Abbildung 7.11: D-Ribonsäure, eine Aldonsäure
Abbildung 7.12: D-Riburonsäure, eine Uronsäure
Abbildung 7.13: D-Ribose-1-phosphat
Abbildung 7.14: Glyzerinaldehyd und Dihydroxyaceton
Abbildung 7.15: Die Pfeile weisen auf jene Alkoholgruppen hin, der...
Abbildung 7.16: Die Struktur von Maltose mit einer α-(1,4)-glykosi...
Abbildung 7.17: Zellobiose mit einer β-(1,4)-glykosidischen Bindun...
Abbildung 7.18: Struktur von Saccharose, die durch die Verbindung ...
Abbildung 7.19: Sich wiederholt aneinanderlagernde Disaccharideinh...
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Die Beziehungen zwischen den einzelnen Lipidgruppen
Abbildung 8.2: Die Struktur eines Seifenmoleküls
Abbildung 8.3: Struktur von Glyzerin (auch Glyzerol genannt)
Abbildung 8.4: Struktur eines typischen Fettes: Die beiden oberen K...
Abbildung 8.5: Beispiele für die allgemeinen Strukturen von Phospha...
Abbildung 8.6: Alkoholkomponenten von Lipiden
Abbildung 8.7: Struktur von Sphingosin
Abbildung 8.8: Vereinfachte Darstellung einer Lipiddoppelschicht
Abbildung 8.9: Ein integrales Protein, das die Membran nicht ganz d...
Abbildung 8.10: Ein integrales Protein, das die Membran vollständi...
Abbildung 8.11: Das Grundgerüst eines Steroids
Abbildung 8.12: Strukturen der Arachidonsäure, eines typischen Pro...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Grundstrukturen von Purinen (oben) und Pyrimidinen (...
Abbildung 9.2: Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C), Thymin (T) und ...
Abbildung 9.3: Strukturen der Zucker in Nukleinsäuren
Abbildung 9.4: Struktur von Phosphorsäure
Abbildung 9.5: Allgemeine Reaktion für die Bildung eines Nukleosids
Abbildung 9.6: Struktur des Nukleosids Adenosin
Abbildung 9.7: Allgemeine Reaktion für die Bildung eines Nukleotids
Abbildung 9.8: Struktur von Adenosinmonophosphat (AMP)
Abbildung 9.9: Vereinfachte Darstellung der Verbindung zweier Nukle...
Abbildung 9.10: Die Lage der 5′- und 3′-Kohlenstoffatome bei Adeno...
Abbildung 9.11: Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien) ...
Abbildung 9.12: Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien) ...
Abbildung 9.13: Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien) ...
Abbildung 9.14: Die Sekundärstruktur der DNA
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Strukturen von Vitamin B
1
(Thiamin) und Thiaminpyr...
Abbildung 10.2: Struktur von Flavinadenindinukleotid (FAD) und der...
Abbildung 10.3: Strukturen von Nikotinsäure, Nikotinamid und Nikot...
Abbildung 10.4: Strukturen von Pyridoxin, Pyridoxal, Pyridoxamin u...
Abbildung 10.5: Struktur von Biotin
Abbildung 10.6: Strukturen von Folsäure und Tetrahydrofolat
Abbildung 10.7: Struktur der Pantothensäure
Abbildung 10.8: Struktur von Methylcobalamin
Abbildung 10.9: Strukturen von 11-trans-Retinol und β-Carotin. Bea...
Abbildung 10.10: Strukturen von Ergosterin, Vitamin D
2
, 7-Dehydrocholesterin und Vita...
Abbildung 10.11: Struktur von α-Tocopherol (Vitamin E)
Abbildung 10.12: Struktur von Vitamin K
1
Abbildung 10.13: Struktur von Vitamin C
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Strukturen von Somatostatin und des Thyreotropin-R...
Abbildung 11.2: Strukturen von Progesteron (ein Östrogen) und Test...
Abbildung 11.3: Die Struktur von Thyroxin, Triiodthyronin, Adrenal...
Abbildung 11.4: Schema der Hormonsteuerung im Körper
Abbildung 11.5: Struktur von zyklischem AMP (cAMP)
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Struktur von ATP
Abbildung 12.2: Struktur von ADP
Abbildung 12.3: Struktur von AMP
Abbildung 12.4: Magnesiumkomplexe von ATP und ADP
Abbildung 12.5: Strukturen einiger hochenergetischer Moleküle
Abbildung 12.6: Zwei Reaktionen, die von Nukleosid-Monophosphat- u...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Die Reaktionsschritte der Glykolyse
Abbildung 13.2: Moleküle der Glykolyse
Abbildung 13.3: Reaktionsschritte der Glukoneogenese
Abbildung 13.4: Reaktionsschritte der alkoholischen Gärung
Abbildung 13.5: Struktur von Acetyl-CoA
Abbildung 13.6: Citratzyklus (Krebs-Zyklus)
Abbildung 13.7: Strukturen der Zwischenprodukte des Citratzyklus
Abbildung 13.8: Vereinfachtes Schema der Bildung von Acetyl-CoA
Abbildung 13.9: Strukturen von TPP, Liponamid und Acetylliponamid
Abbildung 13.10: Struktur von cis-Aconitat
Abbildung 13.11: Eintrittsorte der Aminosäuren in Glykolyse und C...
Abbildung 13.12: Allgemeine Strukturen der oxidierten und reduzie...
Abbildung 13.13: Hämgrundgerüst eines Cytochroms mit möglichen Se...
Abbildung 13.14: Reaktionsschritte der Elektronentransportkette
Abbildung 13.15: Die Elektronentransportkette mit kaskadenartiger...
Abbildung 13.16: Allgemeine Reaktionsschritte im β-Oxidationszykl...
Abbildung 13.17: Bildung von Ketonkörpern
Abbildung 13.18: Synthese von Malonyl-CoA
Abbildung 13.19: Fettsäuresynthese
Abbildung 13.20: Bildung von Phosphatidat
Abbildung 13.21: Bildung von Sphingosin
Abbildung 13.22: Gleichgewicht zwischen α-Ketoglutarat und Glutam...
Abbildung 13.23: Synthese von Alanin
Abbildung 13.24: Synthese von Tyrosin
Abbildung 13.25: Synthese von Serin
Abbildung 13.26: Synthese von Prolin
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Purinstickstoffbasen
Abbildung 14.2: Aktivierung von α-D-Ribose-5′-phosphat zu PRPP
Abbildung 14.3: Zehn Reaktionsschritte zur Umwandlung von 5′-Phosp...
Abbildung 14.4: Umwandlung von IMP zu AMP
Abbildung 14.5: Umwandlung von IMP zu GMP
Abbildung 14.6: Synthese von Carbamoylphosphat
Abbildung 14.7: Bildung von Orotat aus Carbamoylphosphat
Abbildung 14.8: Umwandlung von Orotat zu Uridylat (UMP)
Abbildung 14.9: Umwandlung von UTP zu CTP
Abbildung 14.10: Struktur von Harnsäure
Abbildung 14.11: Allgemeine Transaminierungsreaktion
Abbildung 14.12: Bildung von Carbamoylphosphat
Abbildung 14.13: Überblick über den Harnstoffzyklus
Abbildung 14.14: Verbindungen aus dem Harnstoffzyklus
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Schematische Darstellung der Basenpaarung in einem...
Abbildung 15.2: Vereinfachte Darstellung des Replikationsprozesses
Abbildung 15.3: Detaillierteres Schema der DNA-Replikation
Abbildung 15.4: Vereinfachte Darstellung des Prepriming-Komplexes
Abbildung 15.5: Die Primase synthetisiert am Primosom den RNA-Prim...
Abbildung 15.6: Detaillierte Darstellung der Vorgänge an der Repli...
Abbildung 15.7: Struktur eines Thymin-Dimers
Abbildung 15.8: Die Purine
Abbildung 15.9: Die Pyrimidine
Abbildung 15.10: Öffnung eines Plasmids mit einem Restriktionsenz...
Abbildung 15.11: Gelelektrophorese unterschiedlich geladener Mole...
Abbildung 15.12: Strukturen von Ribose, Desoxyribose und Didesoxy...
Abbildung 15.13: Vergleich der einzelnen Ergebnisse für einen Vat...
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Struktur von ATP
Abbildung 16.2: Prokaryotische und eukaryotische Promotoren
Abbildung 16.3: Anheftung des zweiten Nukleotids (hier im Beispiel...
Abbildung 16.4: Die Haarnadelschleife und der sich daran anschließ...
Abbildung 16.5: Allgemeine Struktur einer mRNA-Kappe
Abbildung 16.6: Die Anheftung einer Aminosäure an das Adenosin am ...
Abbildung 16.7: Strukturen von Methionin und Formyl-Methionin
Abbildung 16.8: Die Startsignale
Abbildung 16.9: Schema eines Operons
Abbildung 16.10: Das lac-Operon
Abbildung 16.11: Strukturen von Laktose und Allolaktose
Abbildung 16.12: Struktur von methyliertem Cytosin
Abbildung 16.13: Struktur von Estron, einem natürlichen Östrogen
Abbildung 16.14: Reaktion, die von Histonacetyl-Transferasen (HAT...
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Vereinfachtes Schema der Struktur einer 16S-rRNA
Abbildung 17.2: Strukturen von Methionin- und Formylmethionin-bela...
Abbildung 17.3: Struktur von Inosin
Abbildung 17.4: Wichtige Strukturelemente einer tRNA
Abbildung 17.5: Beispiel einer Aminoacyl-tRNA
Abbildung 17.6: Struktur eines Aminoacyl-Adenylats
Abbildung 17.7: Strukturen von Serin, Valin und Threonin
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Fangen Sie an zu lesen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
Einleitung
Willkommen bei Biochemie für Dummies!
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich dazu entschlossen haben, in die faszinierende Welt der Biochemie einzutauchen. Die Biochemie ist zwar ein sehr komplexes Teilgebiet der Chemie, doch die Prinzipien sind eigentlich einfach und vor allem ungeheuer spannend. Schließlich geht es in diesem Buch um Sie und die Frage, warum Sie eigentlich leben und wie Sie funktionieren (oder auch nicht). Ja, schon ein ehrgeiziges Projekt – doch wir wollen uns hier auf die wichtigsten Dinge beschränken. Uns kommt es vor allem darauf an, dass Sie verstehen, was in Ihrem Körper passiert und was uns als Lebewesen ausmacht – chemisch betrachtet jedenfalls.
Mit etwas Einsatz von Ihrer Seite werden Sie mithilfe diese Buches den Biochemiekurs an der Universität leicht meistern oder sich als interessierter Leser freuen, wenn Sie auf eine Reaktionsgleichung blicken und sofort verstehen, was dort passiert – warum Energie nötig ist, Energie gebildet wird oder was am Ende bei der ganzen Sache herauskommt. Vielleicht erkennen Sie nach der Lektüre des Buches die Zusammenhänge von Stoffwechselwegen und wissen, warum auf- und abbauende Reaktionen gleichzeitig in einer Zelle ablaufen können, wieso bestimmte pH-Werte im Blut schlecht für Ihren Metabolismus sind oder warum die Biochemie für bestimmte Berufsfelder wie die Forensik oder die Pränataldiagnostik so unverzichtbar ist. Viele Fragen, viele Antworten … dieses Buch kann hoffentlich dazu beitragen, Ihr Wissen zu vermehren und Sie für diese unglaublich spannende Wissenschaft zu begeistern.
Die Biochemie hat viele Facetten, jedoch lassen sich nicht alle in einem Buch mit diesem beschränkten Umfang darstellen. Der eine Leser wird der Meinung sein, dass wichtige Prozesse fehlen, dem anderen werden die komplizierten Reaktionsgleichungen Kopfzerbrechen bereiten. Wir können an dieser Stelle viele Prozesse nur anreißen, aber auch langweilige Reaktionsabläufe (die Sie ja einfach überblättern können) gehören nun einmal dazu. Und wenn Sie dann doch später noch mehr wissen wollen, sind wir froh, dass wir mit diesem extrem kurz gefassten Buch vielleicht Ihr Interesse geweckt haben.
Sie werden nach der Lektüre mehr über Ihren Körper wissen, warum Sie bestimmte Nahrungsmittel benötigen, was passiert, wenn diese in der Nahrung fehlen, und warum es den Gesundheitszustand des Organismus beeinträchtigen kann, wenn Reaktionen nicht optimal ablaufen. Genetische Defekte, ein verschobenes Elektrolytgleichgewicht, ein zu geringer pH-Wert im Blut und andere Probleme können dem Körper zu schaffen machen. Und was dann? In diesem Fall kann die Biochemie ein Weg sein, dem Organismus zu helfen, seine Gesundheitsbalance wiederzufinden. Nein, keine Sorge, wir werden an dieser Stelle bestimmt nicht mit den Ärzten konkurrieren wollen, doch Sie werden vielleicht etwas besser verstehen, warum bestimmte Therapien bei Stoffwechselstörungen sinnvoll oder sogar lebensnotwendig sein können.
Über dieses Buch
Biochemie für Dummies bietet einen Überblick über den Stoff, der in einem typischen Biochemiegrundkurs an der Uni oder Fachhochschule gelehrt wird. Wir haben uns bemüht, den Stoff so aktuell wie möglich zu halten, aber seien Sie sich bewusst, dass sich der Wissensstand täglich ändert. Die Grundlagen bleiben jedoch gleich, daher haben wir uns im Großen und Ganzen darauf konzentriert. Wir haben auch Informationen über einige Themen der Biochemie eingefügt, die Sie vielleicht aus dem Alltagsleben kennen, wie Forensik, Klonen, Gentherapie, Gentests, gentechnisch veränderte Nahrung und so weiter.
Wenn Sie durch dieses Buch blättern, werden Sie sehr viele chemische Strukturen und Reaktionen sehen, ohne die es leider in der Biochemie nicht geht.
Falls Sie bereits ein Semester organische Chemie absolviert haben, wissen Sie, was Sie erwartet! Viele der chemischen Strukturen sind dann alte Bekannte! Doch selbst wenn Sie mit organischer Chemie nicht vertraut sein sollten, werden Sie viele Aspekte in diesem Buch interessant finden und für Ihr Leben behalten.
Konventionen in diesem Buch
Wir haben die Themen in diesem Buch logisch aufeinander aufgebaut, und zwar in ähnlicher Reihenfolge, wie sie auch in einem Biochemiekurs vermittelt werden. Wir haben uns sehr auf chemische Strukturen und Reaktionen konzentriert. Versuchen Sie, die in den Text eingefügten Abbildungen möglichst in der vorgegebenen Reihenfolge zu betrachten. Die Symbole weisen auf Dinge hin, die für Sie vielleicht in mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung sein könnten. Wenn Sie gerade einen Biochemiekurs absolvieren, können Sie dieses recht günstige Buch auch nutzen, um den Inhalt der oft deutlich teureren Fachliteratur besser zu verstehen.
Was Sie nicht lesen müssen
Lesen Sie nur das, was von echtem Nutzen für Sie ist. Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, bei denen Sie noch Hilfe brauchen. Wenn Sie eher an den Alltagsanwendungen der Biochemie interessiert sind, lesen Sie doch nur jene Abschnitte, die mit dem Wahre-Welt-Symbol markiert sind. Wenn Sie aber stattdessen Hilfe beim Verstehen der allgemeinen biochemischen Thematiken brauchen, überspringen Sie ruhig die praktischen Anwendungen. Mal ehrlich – Sie haben nicht wirklich viel für dieses Buch bezahlt, also fühlen Sie sich bitte nicht verpflichtet, jede einzelne Seite ausführlich durchzulesen. Wenn Sie dann fertig sind, können Sie das Buch in Ihr Bücherregal stellen, vielleicht gleich neben Chemie für Dummies, Das Große Gesundheitsbuch und Eine kurze Geschichte der Zeit als Unterhaltungsmedium.
Törichte Annahmen über den Leser
Wir vermuten – und wir alle wissen, wie falsch solche Vermutungen sein können –, dass Sie zu einer der folgenden Gruppen gehören:
Studenten, die einen Biochemiekurs absolvieren müssen
Leute, die einfach nur etwas über Biochemie lernen möchten
Menschen, die endlich wissen wollen, was im Stoffwechsel passiert
Wenn Sie sich nicht in einer der genannten Kategorien wiederfinden, hoffen wir trotzdem, dass Ihnen die Lektüre des Buches Freude bereiten wird.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Wir geben Ihnen hier einen sehr kurzen Abriss über die Themen, die wir in den verschiedenen Teilen dieses Buches abhandeln. Nutzen Sie bitte die folgenden Kurzbeschreibungen und das Inhaltsverzeichnis, um Ihre persönliche Studierstrategie festzulegen.
Teil I: Vorhang auf: Grundlagen der Biochemie
Dieser Teil behandelt die grundlegenden Aspekte der Chemie und Biochemie. Im ersten Kapitel erfahren Sie, wie die Biochemie mit den anderen Fachgebieten der Chemie und Biologie in Beziehung steht. Gleichzeitig erhalten Sie eine Menge Informationen über die verschiedenen Zelltypen und ihre Bestandteile. In Kapitel 2 rekapitulieren wir einige Aspekte der Chemie des Wassers, wie pH-Wert und Puffer, die einen direkten Bezug zur Biochemie haben. Und schließlich finden Sie in einem weiteren Kapitel das Wichtigste über die organische Chemie zusammengefasst, angefangen von funktionellen Gruppen bis hin zu Isomeren.
Teil II: Das Fleisch der Biochemie: Proteine
In diesem Teil konzentrieren wir uns ganz auf die Proteine. Wir stellen Aminosäuren vor, die Bausteine der Proteine. Mit diesen Bausteinen im Handgepäck können Sie im nächsten Kapitel die Grundlagen von Aminosäuresequenzen verstehen lernen sowie die unterschiedlichen Ebenen der Proteinstruktur. Schließlich beenden wir diesen Teil mit einer Betrachtung der Enzymkinetik, wobei Katalysatoren (Stoffe, die Reaktionsabläufe beschleunigen) und Inhibitoren (Stoffe, die chemische Reaktionen hemmen) näher beleuchtet werden.
Teil III: Kohlenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren und mehr
In diesem Teil zeigen wir Ihnen eine Reihe biochemischer Stoffe. Sie werden erkennen, dass Kohlenhydrate viel komplexer sind, als das Stück Kuchen, das Sie gerade verspeist haben, Ihnen vielleicht weismachen will. Wir beweisen Ihnen, dass Biochemie auch manchmal zuckersüß sein kann! Dann schwenken wir zu den Lipiden, wie zum Beispiel den Steroiden. Als Nächstes folgen die Nukleinsäuren und der genetische Code (da Vinci lässt grüßen) des Lebens, zusammen mit DNA und RNA. Danach sind die Vitamine an der Reihe und schließlich die Hormone.
Teil IV: Bioenergetik und Reaktionswege
Am Ende geht alles in Energie über, auf die eine oder andere Weise. In den Kapiteln dieses Teils werfen wir einen Blick auf die Zusammenhänge zwischen Energiebereithaltung und Energieverbrauch. Hier treffen Sie auch unseren treuen Freund ATP und nehmen den Kampf mit dem legendären Citratzyklus auf. Zum Schluss werfen wir Sie, nachdem Sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich sowieso schon ganz heiß drauf sind, in den wahrlich übel riechenden Sumpf der Stickstoffchemie.
Teil V: Genetik: Warum wir sind, was wir sind
In diesem Teil bringen wir Ihnen näher, wie sich DNA im Prozess der Replikation kopiert, und wir zeigen Ihnen einige der praktischen Anwendungen der DNA-Sequenzierung. Danach heißt es Bühne frei für RNA und Proteinsynthese. Außerdem werden wir Ihnen etwas über das Humangenomprojekt erzählen.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Der Schlussteil dieses Buches dreht sich um zehn großartige Anwendungen der Biochemie im täglichen Leben und stellt zehn etwas weniger typische Berufe im Bereich der Biochemie vor.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Falls Sie schon einmal ein … für Dummies-Buch gelesen haben, werden Ihnen einige Symbole bekannt vorkommen, aber trotzdem hier noch einmal eine Zusammenfassung der Bedeutungen:
Dieses Symbol soll eine Art Wink mit dem Zaunpfahl für solche Themen sein, die Sie zum besseren Verständnis lieber nicht mehr vergessen sollten, je weiter Sie sich in die Welt der Biochemie hineinwagen wollen.
Wir nutzen dieses Symbol, um Ihnen einen Hinweis zu geben, wie man ein bestimmtes Thema am besten und schnellsten verinnerlichen kann. Wir zwei Autoren haben zusammengerechnet fast 70 Jahre Lehrerfahrung, daher kennen wir etliche Kniffe und Tricks und wollen Ihnen diese auch gerne verraten.
Dieses Symbol steht für Informationen, die einen direkten Bezug zwischen Biochemie und alltäglichen Dingen aufdecken.
Das Warnung-Symbol weist auf eine Prozedur oder eine mögliche Reaktion hin, die gefährlich sein kann. Wir nennen es auch unser »Was Sie lieber nicht selbst zu Hause ausprobieren sollten«-Symbol.
Hier werden Sie auf Erklärvideos hingewiesen, die Sie unter http://wiley-vch.de/ISBN9783527723775 finden.
Wie es weitergeht
Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie viel Wissen Sie sich aneignen möchten und wo Ihre persönlichen Ziele liegen. Wie in den … für Dummies-Büchern üblich, haben wir auch in diesem versucht, alle Kapitel unabhängig voneinander zu verfassen, damit Sie sich ein Kapitel herauspicken und es verstehen können, ohne die vorhergehenden gelesen haben zu müssen. Wenn Sie sich mit den Themen aus anorganischer und organischer Chemie bereits vertraut fühlen, können Sie Teil I auch einfach überspringen. Wenn Sie hingegen auf der Suche nach einem allgemeinen Überblick über die Biochemie sind, können Sie gern das ganze Buch durchstöbern. Und falls Sie auf ein Thema stoßen, das Sie besonders interessiert, lesen Sie einfach weiter.
Wir hoffen, egal wer Sie sind oder aus welchem Grund auch immer Sie dieses Buch zur Hand genommen haben, dass Sie Spaß beim Lesen haben und dass es Ihnen hilft, Biochemie besser zu verstehen.
Teil I
Vorhang auf: Grundlagen der Biochemie
IN DIESEM TEIL …
Wir werden uns einige grundlegende Aspekte der allgemeinen Chemie, der organischen Chemie und der Biochemie anschauen. Dann werden wir einen Schritt zurücktreten und die Biochemie im Kontext mit anderen chemischen und biologischen Disziplinen betrachten. Sie lernen verschiedene Zelltypen und deren Bestandteile kennen, wir wenden uns dann der Chemie des Wassers zu und werfen einen Blick auf pH-Wert und Puffereigenschaften. Am Ende werden Sie Ihr Wissen über die organische Chemie solide aufgefrischt haben und bereit sein für den Auftritt der Biochemie in Teil II.
Kapitel 1
Biochemie: Was Sie darüber wissen sollten – und wozu
IN DIESEM KAPITEL
Warum die Biochemie so wichtig istBestandteile einer tierischen Zelle und deren FunktionDie Unterschiede zwischen Tier- und PflanzenzellenWenn Sie sich bereits für einen Biochemiekurs an der Universität eingeschrieben haben, können Sie dieses Kapitel vermutlich gleich überspringen und zu den Abschnitten weiterblättern, in denen es um diejenigen Themen geht, die Ihnen noch Probleme bereiten. Wenn Sie allerdings noch darüber nachdenken sollten, einen Kurs zu belegen, oder einfach mehr über die Biochemie wissen wollen, lesen Sie ruhig weiter. In diesem Kapitel erläutern wir unterschiedliche Zelltypen und den Zellaufbau – zwei extrem wichtige Themen für alle biochemischen Vorgänge, mit denen wir uns noch befassen werden.
Viele Menschen neigen gelegentlich dazu, sich zu sehr mit technischen Details zu beschäftigen und den Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren, doch in diesem Kapitel müssen wir uns mit eben diesen Details befassen, um eine Basis für alle weiteren Diskussionen zu schaffen.
Warum interessieren Sie sich für Biochemie?
Die Antwort auf diese Frage könnte lauten: »Wieso denn nicht?« oder »Na ja, weil es im Studium verlangt wird!«
Die erste Antwort ist eigentlich gar nicht so schlecht und zeigt zumindest ein gewisses Interesse an diesem spannenden Thema. Egal ob wir Vorgänge in der Natur oder uns selbst betrachten – alle Lebewesen wachsen, vermehren sich, altern, sterben, und jeder dieser Prozesse ist biochemischer Natur. Vielleicht sitzen Sie gelegentlich abends auf dem Sofa und denken über die Komplexität des Lebens nach. Allein die Tatsache, dass Sie auf dem Sofa sitzen und über Ihre Existenz nachdenken können, erfordert eine Unmenge chemischer Reaktionen, die permanent im Körper ablaufen und perfekt zusammenwirken müssen. Als ich mich zum ersten Mal mit den minimalen strukturellen Unterschieden zwischen Stärke und Zellulose befasst habe, war ich völlig verblüfft: Nur ein winziger Unterschied in der chemischen Bindung zwischen den ansonsten identischen Untereinheiten zweier Substanzen ist dafür verantwortlich, dass eine Kartoffel essbar und nicht hart und trocken wie Holz ist. Ich wollte mehr über die Chemie der lebenden Dinge wissen, und so entstand im Endeffekt auch dieses Buch. Wenn Sie sich für die Biochemie interessieren, müssen Sie zwar auch die Details lernen, doch manchmal sollten Sie trotzdem einfach den Blick über den Bücherrand schweifen lassen und sich an der Vielfalt und Schönheit des Lebens erfreuen. Die Biochemie ist ohne Zweifel eine sehr lebendige Wissenschaft.
Was genau ist eigentlich Biochemie?
Die Biochemie ist die Chemie der lebendigen Dinge. Biochemiker befassen sich mit den chemischen Reaktionen, die auf molekularer Ebene in allen Organismen ablaufen. Normalerweise wird die Biochemie als Teil der Chemie betrachtet, mitunter wird sie jedoch auch als Teilgebiet der Biologie eingestuft oder in anderen Hochschulen von der Biologie und Chemie völlig getrennt gelehrt.
Die Biochemie ist etwas Besonderes, da sie die verschiedenen Aspekte vieler anderer Teilgebiete der Chemie in sich vereint. Da alles Leben (zumindest auf der Erde) auf Kohlenstoff basiert, spielt die organische Chemie natürlich eine besondere Rolle in der Biochemie. Sehr oft wollen Biochemiker wissen, wie schnell chemische Reaktionen ablaufen – mit diesem Thema beschäftigt sich die physikalische Chemie. Häufig spielen Metalle eine wichtige Rolle in biochemischen Strukturen (so wie das Eisen im Hämoglobin) – ganz klar ein Fall für die anorganische Chemie, oder Biochemiker verwenden komplizierte Apparaturen und Verfahren, um die Zusammensetzung und Struktur von Stoffen zu entschlüsseln – eine Aufgabe, die in den Bereich der analytischen Chemie fällt. Die Biochemie ist eng mit der Molekularbiologie verwandt, die sich ebenfalls mit lebenden Systemen auf molekularer Ebene befasst, doch die Biochemie konzentriert sich dabei eher auf die einzelnen chemischen Reaktionen.
Biochemiker können den Elektronentransport innerhalb einer Zelle verfolgen oder sich mit den Verdauungsabläufen im Darm befassen. Egal, um welche Prozesse des Lebens es sich auch immer handelt – Biochemiker interessiert vor allem, wie Leben funktioniert.
Pro- und eukaryotische Zelltypen
Alle lebenden Organismen bestehen aus Zellen – sofern man jedenfalls Viren außer Acht lässt, die sich nicht eindeutig lebenden oder nicht lebenden Organismen zuordnen lassen und auch keine Zellen sind. Eine Zelle ist so etwas Ähnliches wie eine mittelalterliche Stadt. Die Arbeitsmaschinerie der Zelle steckt quasi »hinter Mauern« – auch als Zellmembran bezeichnet. Und ebenso wie die Stadtbürger mit der Außenwelt kommunizieren müssen, ist auch der Inhalt einer Zelle nicht vollständig von der Umwelt abgeschottet. Alle Bürger sind hungrig, daher müssen Nahrungsmittel in die Stadt hineintransportiert und die Abfallstoffe entsprechend beseitigt werden. Ebenso wie die Bürger einer Stadt arbeiten, um Produkte für die Gesellschaft der Außenwelt als Tauschobjekte herzustellen, produzieren auch die »Bewohner« einer Zelle Stoffe, die für das Leben außerhalb der Zelle bestimmt sind.
Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Zellen: prokaryotische und eukaryotische Zellen. (Noch mal zur Erinnerung: Viren teilen zwar einige Eigenschaften mit Zellen, werden aber von vielen Wissenschaftlern nicht zu den Lebewesen gezählt.) Die Prokaryoten sind die einfachsten und evolutionsbiologisch ältesten Zellen, während die Eukaryoten eher so etwas wie das komplexer aufgebaute »Nachfolgemodell« darstellen. Alle Bakterien und die Archaeen (urtümliche Einzeller, die oft extreme Temperaturen oder Salzkonzentrationen vertragen können und die in Bezug auf ihre Eigenschaften irgendwo zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen liegen) sind Prokaryoten, da sie keinen echten Zellkern haben.
Wie sich pro- und eukaryotische Zellen unterscheiden, steckt bereits im Namen. Prokaryoten haben keinen Zellkern (»pro-«, also vor, oder »eu-«, mit echtem karyon oder Zellkern). Die Eukaryoten besitzen einen membranumhüllten Zellkern, während das genetische Material bei Prokaryoten einfach so in der Zelle herumliegt. Doch das ist nur einer von vielen Unterschieden …
Prokaryoten
Zu den Prokaryoten zählen die Bakterien, die Blaualgen, die gar keine Algen, sondern Photosynthese betreibende Bakterien sind, und die bereits oben erwähnten Archaeen oder Archebakterien. Obwohl den Prokaryoten ein echter Zellkern fehlt, gibt es einige typische Strukturen im Inneren dieser Zellen. Die Abgrenzung der Zelle nach außen besteht meistens aus drei Komponenten: einer relativ stabilen Zellwand, einer äußeren Membran (nur bei gramnegativen Prokaryoten) und einer innen liegenden Plasmamembran. Während die Zellwand vor allem für Festigkeit und Struktur der Zelle sorgt (so wie die Mauer einer Festung) und die äußere Membran viele Stoffe, aber eben nicht alles passieren lässt (und vielleicht am ehesten mit einem Wassergraben zu vergleichen ist), kontrolliert die innere Membran sehr genau (wie die Zugbrücken an den Stadttoren), welche Stoffe in die Zelle hinein- oder aus der Zelle heraustransportiert werden dürfen. Alles, was in die Zelle gelangt, landet in einer Art Suppe, dem Zytoplasma, das die ganze Zelle ausfüllt. Abbildung 1.1 zeigt die stark vereinfachte Darstellung einer prokaryotischen Zelle.
Eukaryoten
Eukaryoten sind Tiere, Pflanzen, Pilze und viele Einzeller (also auch Sie, lieber Leser!). Eukaryotische Zellen sind in der Evolution erst später entstanden und sehr viel komplizierter aufgebaut als die Prokaryoten. Sie besitzen neben einem echten Zellkern verschiedene, von Membranen umschlossene Kompartimente (die Organellen). Eukaryoten können ein- oder mehrzellig sein und enthalten deutlich mehr und sehr viel komplizierter verpacktes genetisches Material als Prokaryoten.
Abbildung 1.1: Vereinfachte Darstellung einer prokaryotischen Zelle
Typische Bestandteile einer Tierzelle
Alle tierischen Zellen (die, wie Sie jetzt wissen, immer Eukaryoten sind) besitzen eine Reihe klar definierter innerer Strukturen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und in den meisten Fällen zu den Organellen zählen. Die wichtigsten Organellen sind im Folgenden aufgelistet. Abbildung 1.2 zeigt ein vereinfachtes Schema einer tierischen Zelle. Pflanzenzellen haben noch weitere Bestandteile wie beispielsweise Chloroplasten, die Orte der Photosynthese.
Abbildung 1.2: Vereinfachte Darstellung einer Tierzelle
Plasmamembran
Endoplasmatisches Retikulum
Lysosomen
Nukleus (Zellkern) und Nukleolus (Kernkörperchen)
Zentriolen
Golgi-Apparat
Mitochondrien
Ribosomen
Die wichtigsten Bestandteile einer tierischen Zelle sind:
Die Plasmamembran (auch Zytoplasmamembran genannt) trennt alle Komponenten innerhalb einer Zelle von der Außenwelt. Die Flüssigkeit in der Zelle wird als Plasma oder Zytoplasma bezeichnet. Für eine uneingeschränkte Zellfunktion ist es sehr wichtig, dass diese Flüssigkeit nicht verloren geht. Gleichzeitig müssen allerdings lebensnotwendige Stoffe in der Lage sein, die Plasmamembran zu passieren. Andere Substanzen, die während des Stoffwechsels anfallen und nicht mehr benötigt werden, müssen aus der Zelle in die Außenwelt abgegeben werden können (sonst wäre die Zelle irgendwann eine ziemliche Müllhalde).
Der Transport von Nähr- oder Abfallstoffen durch eine Membran kann entweder aktiv oder passiv erfolgen. Beim aktiven Transport, der immer gegen ein Konzentrationsgefälle stattfindet, ist eine Art Fahrschein erforderlich, damit ein Stoff in die Zelle hinein- (oder aus der Zelle heraus-) geschleust wird. Die Währung, mit der die Zelle diesen Fahrschein bezahlt, ist Energie. Der passive Transport erfordert hingegen keinen Energieaufwand der Zelle, da die Stoffe hier in Richtung eines Konzentrationsgefälles befördert werden, wie beispielsweise bei der Diffusion, der Osmose oder der Filtration.
Die Zentriolen
sind so etwas Ähnliches wie die »Zugführer« einer Zelle. Sie organisieren die Ausrichtung von bestimmten zellulären Strukturkomponenten wie den Mikrotubuli, die während der Zellteilung dafür sorgen, dass sich jeweils ein halber Satz der Chromosomen nach der Zellteilung in jeder der beiden Tochterzellen befindet.
Das endoplasmatische Retikulum
oder ER ist eine Art Röhrensystem. Sie können sich eine Zelle wie eine kleine Fabrik vorstellen, die von einem weit verzweigten System aus Gängen durchzogen ist. Das
raue
endoplasmatische Retikulum (RER, englisch rough = rauh) ist mit Ribosomen besetzt, den Orten der Proteinsynthese (mehr über Ribosomen und ihre Funktion erfahren Sie weiter hinten in diesem Kapitel), und dient quasi als Montagehalle dieser Minifirma. Das
glatte
endoplasmatische Retikulum (SER, englisch smooth = glatt) ist eher eine Art Lagerhalle für beispielsweise Calcium, hier werden jedoch auch Hormone produziert und Abfallstoffe für die Entsorgung durch die Müllabfuhr vorbereitet.
Der Golgi-Apparat
ist so etwas wie das Postsystem der Zelle. Er sieht ein bisschen wie ein winziger Irrgarten aus, in dessen Inneren von der Zelle produzierte Substanzen in kleine, membranumschlossene Säckchen, die Vesikel, verpackt werden. Diese Vesikel werden dann wie Pakete an andere Organellen geschickt oder zur Plasmamembran transportiert, wenn sie Exportartikel beinhalten, die außerhalb der Zelle benötigt werden. Die Zellmembran ist gespickt mit »Zollstationen« (kleine Kanäle), durch die die Vesikel ihren Inhalt kontrolliert in die Außenwelt abgeben und so für andere Zellen oder Organe verfügbar machen können.
Die Lysosomen
sind die Müllabfuhr der Zelle. Sie enthalten Verdauungsenzyme, die potenziell zellschädigende Substanzen in harmlosere Stoffe zerlegen (in
Kapitel 6
finden Sie weitere Infos über Enzyme). Die Produkte dieses Verdaus können dann gefahrlos wieder in die Zelle entlassen werden. Lysosomen verdauen auch »tote« Organellen. Dieser Gedanke mag Sie vielleicht etwas beunruhigen, doch auch die
Autodigestion
(so heißt dieser Vorgang) ist ein normaler Prozess im Leben jeder Zelle, der wohl eher in die Kategorie »Recycling« als unter »Kannibalismus« fallen dürfte.
Die Mitochondrien
(Einzahl: das Mitochondrium) sind die Energie produzierenden Kraftwerke der Zelle. Mitochondrien nutzen Nährstoffe, speziell das Kohlenhydrat
Glukose
, um Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP – siehe auch
Kapitel 13
) zu produzieren.
Nukleus und Nukleoli: Jede Zelle besitzt einen Zellkern (Nukleus), in dessen Inneren das oder die Kernkörperchen (Nukleolus beziehungsweise die Nukleoli) liegen. Zellkern und Kernkörperchen fungieren zusammen als Kontrollzentrum der Zelle und sind der Ursprung aller zukünftigen Zellgenerationen. Der Nukleus ist von einer doppelwandigen Zellmembran umhüllt. Im Allgemeinen enthält der Nukleus eine Substanz, die Chromatin genannt wird und die aus Erbgut mit einer Verpackung in Form von Proteinen besteht. Wenn die Zelle ein Stadium erreicht, an dem sie sich teilen möchte, verdichtet sich das Chromatin zu den Chromosomen, der Transportform des Erbgutes.
Neben der Aufgabe, genetisches Material für zukünftige Generationen zur Verfügung zu stellen, werden im Zellkern zwei weitere wichtige Substanzen produziert, um die genetische Information in eine für den Stoffwechsel lesbare Form zu übersetzen – so ähnlich wie ein 3-D-Drucker digitale Informationen nutzt, um daraus irgendeinen Gegenstand herzustellen. Die Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA, englisch messenger = der Bote) und die Transfer-Ribonukleinsäure (tRNA) sorgen gemeinsam dafür, dass die im Erbgut hinterlegte Information in ein Protein übersetzt wird. Im Zellkern wird noch ein weiterer Ribonukleinsäuretyp produziert, die ribosomale Ribonukleinsäure (rRNA), die für den Aufbau der Ribosomen benötigt wird. (In Kapitel 9 finden Sie alles zu Nukleinsäuren.)
Ribosomen
sind kleine, kugelige Strukturen aus Proteinen und Ribonukleinsäuren (rRNA) – Miniproduktionsanlagen, an denen die einzelnen Aminosäuren zu Proteinen zusammengesetzt werden. Viele dieser am Ribosom synthetisierten Proteine sind Enzyme, die für fast alle Stoffwechselprozesse in einem Organismus benötigt werden, andere Proteine bauen beispielsweise als Strukturproteine Muskeln, Bindegewebe oder Haare auf oder dienen als Transportmoleküle für Sauerstoff, Eisen oder Fette im Blut. (
Teil II
dieses Buches ist den Aminosäuren, Proteinen und Enzymen gewidmet.)
Ein kurzer Blick in eine Pflanzenzelle
Pflanzenzellen sind ähnlich aufgebaut wie Tierzellen, zusätzlich besitzen sie jedoch eine feste Zellwand, eine deutlich größere Vakuole als Tierzellen sowie in den meisten Fällen Chloroplasten für die Energiegewinnung. Abbildung 1.3 veranschaulicht den Aufbau einer typischen Pflanzenzelle.
Abbildung 1.3: Vereinfachte Darstellung einer Pflanzenzelle
Die Zellwand besteht aus Zellulose, die genau wie Stärke ein Polymer aus Hunderten bis Tausenden von Glukoseeinheiten ist. Die Zellwand sorgt für Struktur und Stabilität.
Die große Vakuole einer Pflanzenzelle dient als eine Art Lager für die »sperrigen« Stärkemoleküle. Glukose, ein Zucker, der während der Photosynthese entsteht, wird in das lagerfähige Polymer Stärke umgewandelt, indem zahlreiche Moleküle Glukose aneinandergeheftet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Stärke dann erneut als Energiequelle dienen und wieder in ihre Bestandteile zerlegt werden. (In Kapitel 7 dreht es sich hauptsächlich um Glukose und andere Kohlenhydrate.)
Chloroplasten sind hoch spezialisierte chemische Fabriken. Hier findet die Photosynthese statt, bei der der Blattfarbstoff Chlorophyll die Energie des Sonnenlichts einfängt und nutzt, um aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Glukose herzustellen und Sauerstoff freizusetzen.
Die grüne Farbe vieler Pflanzen wird durch die magnesiumhaltige Verbindung Chlorophyll verursacht, die an der Photosynthese beteiligt ist.
Nun wissen Sie, wie typische pro- und eukaryotische Zellen aussehen – und damit können wir endlich zur Biochemie übergehen!
Kapitel 2
Eintauchen: Die Chemie des Wassers
IN DIESEM KAPITEL
Das Wasser und seine Aufgaben im StoffwechselDer Unterschied zwischen Säuren und BasenSäure-Base-GleichgewichteDer pH-Wert von PuffernWasser zählt nicht nur für Menschen zu den wichtigsten Stoffen auf der Erde. Wir trinken Wasser pur, als Limonade oder in Tee und Kaffee, regulieren unsere Körpertemperatur durch Schwitzen, wir gehen schwimmen, transportieren Abfälle mit Wasser in die Kanalisation oder gewinnen elektrische Energie aus Wasserkraftwerken. In welcher Form auch immer – ohne Wasser könnten wir nicht leben.
Biochemisch betrachtet ist Wasser definitiv einer der Hauptdarsteller auf der Bühne des Lebens. Kein Transportprozess im Körper würde ohne Wasser funktionieren, was übrigens auch für die meisten biochemischen Reaktionen gilt, die nur in wasserhaltiger Umgebung oder unter direkter Beteiligung von Wassermolekülen ablaufen können.
In diesem Kapitel sehen wir uns die Struktur und Eigenschaften des Wassermoleküls genauer an. Wir erklären, wie sich Wasser als Lösungsmittel verhält, und beschäftigen uns mit der Chemie von Säuren und Basen und dem Gleichgewicht, dem beide unterliegen. Zum Schluss erläutern wir die Begriffe pH-Wert und Puffer näher und gehen dabei auf die Henderson-Hasselbalch-Gleichung ein. Ein ehrgeiziges Programm – holen Sie sich eine Tasse Tee, setzen Sie sich gemütlich hin und tauchen Sie mit uns in die faszinierende Welt der Wasserchemie ein!
Was Sie über H2O (Wasser) wissen sollten
Das Leben auf der Erde ist untrennbar mit der Existenz von Wasser verbunden, das gilt auch für uns Menschen. Unser Körper besteht zu etwa 70 Prozent aus Wasser (was noch nicht einmal besonders aufregend ist – Quallen bringen es auf einen Wasseranteil von 98 bis 99 Prozent!). Der größte Teil dieses Wassers (55 Prozent) befindet sich intrazellulär, also innerhalb der Zellen. Die verbleibenden 45 Prozent des Körperwassers sind extrazellulär, also außerhalb der Zellen, und verteilen sich wie folgt:
Blutplasma (8 Prozent)
interstitielle Flüssigkeit und Lymphe (22 Prozent)
Bindegewebe, Knorpel und Knochen (15 Prozent)
Wasser wird auch als Lösungsmittel für eine Vielzahl biochemischer Reaktionen gebraucht, die im Körper ablaufen:
Wasser sorgt für den Stofftransport durch die Membranen und befördert Stoffe in die Zelle oder aus der Zelle heraus.
Wasser ist für die Erhaltung der Körpertemperatur verantwortlich.
Wasser ist ein Lösungsmittel im Verdauungs- und Exkretionssystem und transportiert gelöste Stoffe.