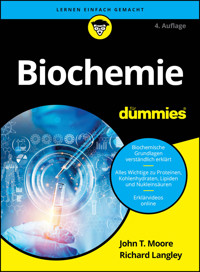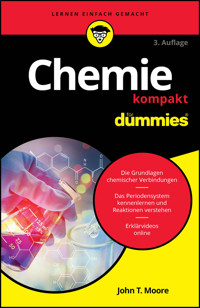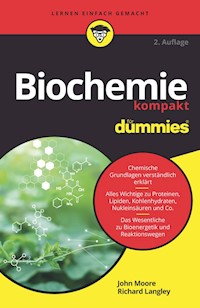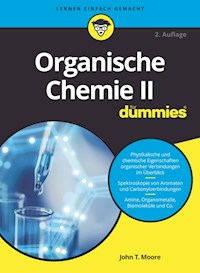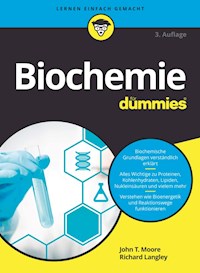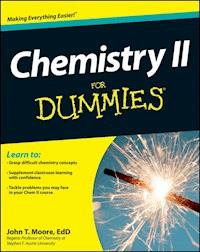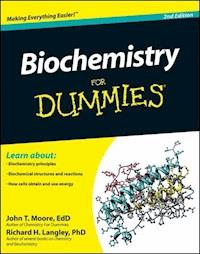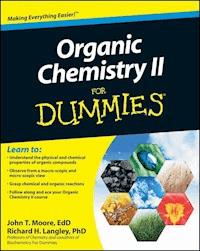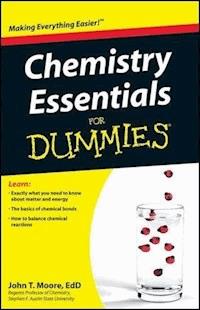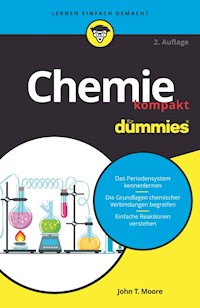
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Ein solides Fundament ist die beste Basis alles Wissens: Das ist zwar eine Binsenweisheit, trotzdem fehlt es bei vielen Menschen in den Naturwissenschaften gerade an diesem Fundament. "Chemie kompakt für Dummies" schafft da Abhilfe. Hier erfahren Sie das Wichtigste zu den Elementen, dem Ablauf von Reaktionen, dem Aufbau des Periodensystems und vielem mehr. Das Buch enthält die wichtigsten Grundlagen der Chemie, angefangen bei einfachen Konzepten, wie Materie, bis hin zu komplexeren Themen, wie der organischen Chemie. Auch alltägliche Themen, wie die Fraktionierung von Rohöl oder die Entstehung von Luftverschmutzung, kommen nicht zu kurz. Nach seinem Bestseller "Chemie für Dummies" gibt Ihnen John T. Moore hier einen schnellen und doch fundierten Überblick über die Welt der Atome, Aggregatzustände und Co.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Chemie kompakt für Dummies
Schummelseite
© mit freundlicher Genehmigung von Ulf Ritgen und Stefanie Ortanderl; entnommen aus
Chemie für Dummies – das Lehrbuch
BINDUNG
Bei der Bindung nehmen Atome Elektronen auf, geben sie ab oder teilen sie mit anderen Atomen. Dabei wird die Anzahl der Elektronen des nächsten Edelgases angestrebt.Metall + Nichtmetall = IonenbindungNichtmetall + Nichtmetall = kovalente BindungElektronen-Füll-Muster: 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5fDARSTELLUNG VON ISOTOPEN
X = Elementsymbol, Z = Atomzahl (Zahl der Protonen), A = Massenzahl (Zahl der Protonen + Neutronen)
Nützliche Konversionen und metrische Präfixe
Temperaturumrechnungen:
°C=(°F - 32)K=°C + 273Druckumrechnung: 1 atm = 760 mm Hg = 760 torr
1 torr = 0,133 · 103 Pa (Pascal)
Übliche metrische Umrechnungen:
Milli… = 0,001Zenti… = Kilo… = 1000Lösungskonzentration
Gewicht/Gewicht(G/G)% = (gelöster Stoffin Gramm/Lösung in Gramm) · 100
Molarität (M) = Molekülmasse des gelösten Stoffes/Liter Lösung
Teilchen/Million (ppm) = Gelöster Stoff in Gramm/1.000.000 Gramm Lösung = mg/l
Säuren und Basen
Eine Säure ist ein H+-Geber, eine Base ein H+-Nehmer.
REDOX
Chemie kompakt für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2020
© 2020 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Original English language edition © 2010 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe © 2010 by Wiley Publishing, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © vectortatu/stock.adobe.comKorrektur: Isolde Kommer
Print ISBN: 978-3-527-71745-3ePub ISBN: 978-3-527-82748-0
Inhaltsverzeichnis
Cover
Einführung
Über dieses Buch
Teil I: Grundlegende Konzepte der Chemie
Kapitel 1: Was ist Chemie und warum sollte man darüber etwas wissen?
Was ist genau Chemie?
Kapitel 2: Materie und Energie
Zustände der Materie: makroskopische und mikroskopische Sicht
Eis in Alaska, Wasser in Texas: Materie wechselt den Zustand
Reine Substanzen und Mischungen
Sie haben ja nette Eigenschaften bekommen
Energie (Ach, hätte ich doch mehr davon!)
Kapitel 3: Kleiner als ein Atom? – Die Struktur des Atoms
Subatomare Teilchen: So, das ist also ein Atom
Der Kern: Mittelpunkt
Wo sind nun diese Elektronen?
Elektronenkonfigurationen (das Bett der Elektronen)
Isotope und Ionen: Dies sind einige meiner Lieblingsthemen
Kapitel 4: Das Periodensystem
Das Wiederholen von Mustern der Periodizität
Wie die Elemente im Periodensystem angeordnet sind
Teil II: Drum prüfe, wie sich Atome verbinden
Kapitel 5: Gegensätze ziehen sich an: Ionenbindungen
Die Magie der Ionenbindung: Natrium + Chlor = Tafelsalz
Positiv und negativ geladen: Kationen und Anionen
Polyatomare Ionen
Ionenbindungen
Das Benennen von Ionenverbindungen
Elektrolyte und Nichtelektrolyte
Kapitel 6: Kovalente Bindung: brüderlich teilen
Grundlagen der kovalenten Bindung
Das Benennen von binären kovalenten Verbindungen
So viele Formeln, so wenig Zeit
Einige Atome sind attraktiver als andere
Wie sieht Wasser wirklich aus?
Kapitel 7: Chemisches Kochen: chemische Reaktionen
Was Sie haben und was Sie kriegen: Ausgangsstoffe und Produkte
Wie treten Reaktionen auf? – Die Kollisionstheorie
Was für eine Reaktion bin ich?
Chemisches Gleichgewicht
Das Prinzip von Le Chatelier
Schnelle und langsame Reaktionen: chemische Kinetik
Kapitel 8: Elektrochemie: Batterien für Teekannen
Da gehen sie hin, die Elektronen: Redoxreaktionen
Strom an und los: elektrochemische Batterien
Teil III: Das Mol, der beste Freund des Chemikers
Kapitel 9: Das Mol: Atome zum Anfassen
Das Zählen durch Wiegen
Paare, Dutzende, alte Riese und Mole
Chemische Reaktionen und das Mol
Kapitel 10: Sauer und bitter: Säuren und Basen
Eigenschaften von Säuren und Basen, makroskopisch betrachtet
Wie sehen Säuren und Basen aus? – Ein Blick durchs Mikroskop
Ätzend oder trinkbar: starke und schwache Säuren und Basen
Ein altes Abführmittel und Rotkohl: Säure-Base-Indikatoren
Wie sauer ist mein Kaffee? – Die pH-Skala
Puffer: die pH-Controllettis
Kapitel 11: Ballons, Reifen und Pressluftflaschen: die wunderbare Welt der Gase
Auch Gase halten sich an Gesetze: Gasgesetze
Kapitel 12: Kohlenstoff: organische Chemie
Kohlenwasserstoffe: vom Einfachen zum Komplexen
Funktionelle Gruppen
Teil IV: Chemie im Alltag: Nutzen und Probleme
Kapitel 13: Erdöl: Chemikalien für Verbrennung und Gestaltung
Sei nicht so roh, raffiniert kommt man weiter
Kapitel 14: Polymere: Gleich und Gleich gesellt sich gern
Natürliche Monomere und Polymere
Wie man synthetische Monomere und Polymere klassifiziert
Kapitel 15: Hust! Hust! Keuch! Keuch! Luftverschmutzung
Zivilisation und Atmosphäre (oder: Wo der ganze Schlamassel anfängt)
Atmen oder nicht atmen: unsere Atmosphäre
Hände weg von meinem Ozon: Haarspray, FCKWs und das Ozonloch
Ist Ihnen auch so heiß? – Der Treibhauseffekt
Braune Luft? – Fotochemischer Smog
»Ich zerrfliiiiiiiiiiiiiieße!« – Saurer Regen
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 16: Zehn zufällige Entdeckungen in der Chemie
Archimedes: alles mit Muße
Die Vulkanisierung von Gummi
Rechts und links drehende Moleküle
William Perkin und die Farbe Lila
Kekulé: ein schöner Traum
Die Entdeckung der Radioaktivität
Eine schlüpfrige Sache: Teflon
Nicht nur für Sträflinge: Haftnotizen
Lass wachsen
Süßer als Zucker
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Die drei größeren subatomaren Teilchen
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Einige monoatomare Kationen
Tabelle 5.2: Einige monoatomare Anionen
Tabelle 5.3: Einige Metalle mit mehr als einer Oxidationzahl
Tabelle 5.4: Einige wichtige polyatomare Ionen
Tabelle 5.5: Die Benennung von FeNH4(SO4)2
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Präfixe für binäre kovalente Verbindungen
Tabelle 6.2: Die Vorhersage molekularer Form
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Löslichkeiten einiger ausgewählter Ionenverbindungen
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Im Haushalt gebräuchliche Säuren
Tabelle 10.2: Im Haushalt gebräuchliche Basen
Tabelle 10.3: Bekannte starke Säuren
Tabelle 10.4: Durchschnittliche pH-Werte bekannter Substanzen
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Die acht ersten Alkane (C
n
H
2n+2
)
Tabelle 12.2: Was riecht denn da so streng?
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Polymere
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Fester, flüssiger und gasförmiger Zust...
Abbildung 2.2: Klassifizierung der Materie
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Die Darstellung eines bestimmten Eleme...
Abbildung 3.2: Die Darstellung von Uran
Abbildung 3.3: Grundzustand und angeregter Zustand im...
Abbildung 3.4: Die Isotope des Wasserstoffs
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Kristallstruktur des Tafelsalzes
Abbildung 5.2: Aufstellung der Formel des Magnesiumbr...
Abbildung 5.3: Darstellung der Formel für Aluminiumox...
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Die Bildung der kovalenten Bindung bei...
Abbildung 6.2: Elektronenpunkt- und Lewis-Formeln
Abbildung 6.3: Die Form der Dreifachbindung beim Stic...
Abbildung 6.4: Die Bildung des Kohlendioxids
Abbildung 6.5: Zwei mögliche Verbindungen von C
2
H
6
O
Abbildung 6.6: Die Elektronenpunktformel und Lewis-Fo...
Abbildung 6.7: Elektronenpunktformel und Lewis-Formel...
Abbildung 6.8: Verdichtete Strukturformeln für C
2
H
4
O
Abbildung 6.9: Elektronegativität der Elemente
Abbildung 6.10: Polarkovalente Bindung beim HF und b...
Abbildung 6.11: Polarkovalente Bindung beim Wasser
Abbildung 6.12: Wasserstoffbrückenbindung beim Wasse...
Abbildung 6.13: Die Struktur von Eis
Abbildung 6.14: Übliche Molekülformen
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Exotherme Reaktion von A-B + C
→
Abbildung 7.2: Die endotherme Reaktion von A-B + C
→
...
Abbildung 7.3: Das Haber-Bosch-Ammoniaksystem im Glei...
Abbildung 7.4: Steigerung der Konzentration eines Aus...
Abbildung 7.5: Wiederherstellung des Gleichgewichts
Abbildung 7.6: Temperaturerhöhung bei einer exotherme...
Abbildung 7.7: Die Wirkung der Temperatur auf die kin...
Abbildung 7.8: Der Prozess heterogener Katalyse
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Eine Daniell-Zelle
Abbildung 8.2: Eine Trockenbatterie
Abbildung 8.3: Der Bleiakku (Autobatterie)
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Die Reaktion von NH3 mit HCl
Abbildung 10.2: Die Titration einer Säure mit einer ...
Abbildung 10.3: Die pH-Skala
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Das Verhältnis von Druck und Volumen...
Abbildung 11.2: Das Verhältnis von Temperatur und Vo...
Abbildung 11.3: Das Verhältnis von Druck und Tempera...
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Die ersten drei Alkane
Abbildung 12.2: Strukturformeln von Butan
Abbildung 12.3: Isobutan
Abbildung 12.4: Benennung eines Alkans
Abbildung 12.5: Ethen
Abbildung 12.6: Ethin (Acetylen)
Abbildung 12.7: Benzol
Abbildung 12.8: Die funktionelle Gruppe der Carbonsä...
Abbildung 12.9: Synthese eines Esters
Abbildung 12.10: Die funktionellen Gruppen der Alde...
Abbildung 12.11: Die funktionellen Gruppen der Amin...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Die fraktionierte Destillation von E...
Abbildung 13.2: Katalytisches Reformieren von n-Hexa...
Abbildung 13.3: Die Oktanskala
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Zellulose und Stärke
Abbildung 14.2: Die Polymerisation von Ethylen
Abbildung 14.3: Propylen und Polypropylen
Abbildung 14.4: Stryrol und Polystyrol
Abbildung 14.5: Vinylchlorid und Polyvinylchlorid
Abbildung 14.6: Tetrafluorethylen und Polytetrafluor...
Abbildung 14.7: Die Synthese von PET
Abbildung 14.8: Die Synthese von Nylon 6,6
Abbildung 14.9: Die Synthese eines Silikons
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Seitenliste
1
2
5
6
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
232
233
Einführung
Die erste Hürde für das Verständnis der Chemie haben Sie bereits überwunden: Sie haben sich dieses Buch ausgesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute den Titel lesen, das Wort Chemie sehen und sich wieder entfernen, als flüchteten sie vor Pest-Bakterien.
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich mich schon im Urlaub mit jemandem unterhalten habe, bis die gefürchtete Frage kam: »Was machen Sie eigentlich?«
»Ich bin Lehrer«, antwortete ich.
»Echt? Und was unterrichten Sie?«
Ich wappne mich, knirsche mit den Zähnen und antworte mit meiner freundlichsten Stimme: »Chemie.«
Ich sehe den gewissen Gesichtsausdruck und höre: »Wow, habe ich in der Schule abgewählt.« »War einfach zu schwierig.« Oder: »Sie müssen ziemlich schlau sein, wenn Sie Chemie unterrichten.« Oder auch nur: »Tschüss!«
Ich glaube, viele Leute denken ähnlich, weil sie vermuten, die Chemie sei zu abstrakt, zu mathematisch und zu weit weg von der Realität ihres Lebens. Auf die eine oder andere Weise kommen wir jedoch alle mit Chemie in Berührung.
Erinnern Sie sich daran, wie Sie als Kind Wasser zum Sprudeln gebracht und aus Essig einen kleinen Vulkan gemacht haben? Kochen oder putzen Sie oder benutzen Sie Nagellackentferner? All das ist Chemie. Ich hatte als Kind niemals einen Chemiebaukasten, mochte aber schon immer die Naturwissenschaft. Mein Chemielehrer auf der High-School war ein großartiger Biologielehrer, hatte aber nicht so viel Ahnung von Chemie. Als ich jedoch auf einer anderen Schule meinen ersten Chemiekurs hatte, nahm mich das Labor regelrecht gefangen. Ich hatte Spaß an den vielen Farben und auch an den festen Stoffen, die man aus Lösungen gewinnen konnte. Und ich war davon fasziniert, neue Verbindungen synthetisch herzustellen, d. h. etwas zu produzieren, das vielleicht vorher noch niemand erzeugt hatte. Ich wollte unbedingt in einem Chemieunternehmen arbeiten und Forschung betreiben. Aber dann entdeckte ich meine zweite Leidenschaft: die Lehre.
Chemie wird manchmal »zentrale Wissenschaft« genannt (meistens von Chemikern), denn um Biologie, Geologie oder sogar Physik zu verstehen, wird ein gutes Verständnis der Chemie vorausgesetzt. Unsere Welt ist eine chemische, und ich hoffe, es wird ihnen Spaß machen, die chemische Natur unserer Welt zu entdecken – und dass Sie dann das Wort Chemie nicht mehr so schrecklich finden.
Über dieses Buch
Mein Ziel ist nicht, Sie mit diesem Buch zu einem Chemieguru zu machen. Ich möchte Ihnen einfach ein grundlegendes Verständnis einiger chemischer Schwerpunkte vermitteln, die im Allgemeinen an höheren Schulen vorkommen. Wenn Sie einen Kurs besuchen, benutzen Sie dieses Buch einfach als Referenz in Verbindung mit Ihren Notizen und Ihrem Lehrbuch.
Den Leuten einfach nur beim Tennis zuzuschauen, aus welchem Grund auch immer, macht Sie noch nicht zu einem Tennisstar. Sie benötigen Praxis. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Chemie. Sie ist kein Zuschauersport. Wenn Sie einen Chemiekurs besuchen, sollten Sie unbedingt auch praktisch arbeiten. Ich zeige Ihnen, wie man bestimmte Problemtypen anpackt – die Gasgesetze zum Beispiel. Benutzen Sie aber bitte das Lehrbuch für praktische Aufgaben. Okay, das ist Arbeit, kann aber eine Menge Spaß machen.
Icons, die in diesem Buch verwendet werden
Wenn Sie schon andere für Dummies-Bücher gelesen haben, dann kennen Sie natürlich die Icons, die in diesem Buch verwendet werden. Aber hier ist noch mal eine kurze Erklärung für all diejenigen, die damit nicht so vertraut sind:
Dieses Icon verweist auf einen Tipp für den schnellsten und/oder leichtesten Weg, eine Aufgabe durchzuführen oder ein Konzept zu erforschen. Es stellt gewisses Material bereit, dessen Kenntnis ganz einfach nützlich ist, und weiteres Material, das Ihnen Zeit und Frust erspart.
Dieses Erinnerungs-Icon soll einen Anstoß dafür liefern, diese Sache wirklich wichtig zu nehmen und sie sich zu merken.
Ich verwende dieses Zeichen, wenn ich einen Sicherheitshinweis geben möchte, insbesondere, wenn ich beschreibe, wie chemische Substanzen zu mischen sind.
Ich verwende dieses Icon relativ selten, da ich den Inhalt möglichst einfach gehalten habe. In den Fällen aber, in denen ich meine Erklärungen über das Basiswissen hinaus ausweite, zeige ich das mit diesem Icon an. Man kann über diese Stelle natürlich hinwegspringen, aber es könnte ja sein, dass Sie an einer detaillierteren Beschreibung einer Sache interessiert sind.
Teil I
Grundlegende Konzepte der Chemie
IN DIESEM TEIL …
Wenn Sie neu in der Chemie sind, sieht das Ganze vielleicht etwas furchterregend aus. Ich begegne jeden Tag Studenten, die sich selbst verrückt machen, indem sie sich einreden, für die Chemie nicht geeignet zu sein.
Jeder kann die Chemie begreifen. Wenn Sie kochen, putzen oder einfach nur da sind, sind Sie Teil der chemischen Welt.
Ich arbeite viel mit Grundschülern und sie lieben Naturwissenschaften. Ich zeige ihnen ein paar chemische Reaktionen (Essig mit Soda zum Beispiel) und schon drehen sie durch. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso.
Die Kapitel von Teil I vermitteln Ihnen den grundlegenden Hintergrund der Chemie. Ich erzähle Ihnen etwas über die Materie und die Zustände, in denen sie sich befinden kann. Ich sage etwas über die Energie einschließlich der Methoden, wie sie gemessen wird. Ich diskutiere die mikroskopische Welt des Atoms und seine grundlegenden Bestandteile. Ich erläutere auch das Periodensystem, das nützlichste Werkzeug für den Chemiker. Sie erfahren auch etwas über Radioaktivität, Kernreaktoren und Atombomben.
Dieser Teil entführt Sie auf eine lustige Reise. Werfen Sie die Maschine schon mal an …
Kapitel 1
Was ist Chemie und warum sollte man darüber etwas wissen?
IN DIESEM KAPITEL
Die Wissenschaft von der Chemie definierenEinen Überblick über Bereiche der Chemie erhaltenÜberall ist ChemieWenn Sie nicht daran interessiert sind, Chemiker zu werden, warum sollten Sie trotzdem an Chemie interessiert sein? Chemie ist ein integraler Bestandteil unserer täglichen Welt und etwas über Chemie zu wissen hilft, mit unserer alltäglichen technischen und chemischen Umwelt besser zurechtzukommen.
Mir macht Chemie richtig Spaß. Sie ist viel mehr als eine einfache Sammlung von Fakten und ein Gebilde von Wissen. Ich denke, es ist faszinierend zu beobachten, wie chemische Veränderungen stattfinden, Unbekanntes herauszufinden, Instrumente zu benutzen, die Sinne zu erweitern und Voraussagen zu machen und zu begreifen, warum sie richtig oder falsch sind. Alles fängt hier mit den Grundlagen an – herzlich willkommen in der faszinierenden Welt der Chemie.
Was ist genau Chemie?
Einfach ausgedrückt behandelt dieser ganze Zweig der Wissenschaft alles über Materie, die irgendetwas ist, das Masse hat und Platz einnimmt. Chemie ist die Studie über die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Materie und die Veränderungen, denen sie ausgesetzt ist.
Chemie kommt hauptsächlich dort ins Spiel, wo Veränderungen stattfinden. Materie besteht entweder aus reinen Substanzen oder aus Mischungen davon. Die Veränderung von einer Substanz in eine andere nennen die Chemiker chemische Änderung oder chemische Reaktion.
Zweige der Chemie
Chemie ist so umfassend, dass sie anfänglich in verschiedene Spezialbereiche unterteilt wurde. Heute jedoch gibt es ein hohes Maß an Überlappung zwischen den verschiedenen Bereichen der Chemie. Hier sind die traditionellen Bereiche der Chemie:
Analytische Chemie:
Dieser Zweig befasst sich mit der Analyse von Substanzen. Es kann sein, dass Chemiker aus diesem Bereich versuchen herauszufinden, welche Substanzen in einer Mischung (qualitative Analyse) sind oder wie viel von einer besonderen Substanz darin enthalten ist (quantitative Analyse).
Biochemie:
Dieser Zweig spezialisiert sich auf lebende Organismen. Biochemiker studieren die chemischen Reaktionen, die auf dem molekularen Niveau eines Organismus stattfinden – der Ebene, in der die Dinge mit bloßem Auge nicht mehr wahrgenommen werden können. Sie studieren Prozesse wie Verdauung, Stoffwechsel, Vermehrung und Atmung. Dabei konzentriert sich ein Biochemiker auf die Reaktionen, die auftreten.
Biotechnik:
Dies ist ein relativ neuer Bereich der chemischen Wissenschaft. Es ist die Anwendung von Biochemie und Biologie, wenn es darum geht, genetisches Material oder Organismen für bestimmte Zwecke zu schaffen oder zu modifizieren. Sie hat die potenziellen Möglichkeiten, genetische Krankheiten zukünftig zu eliminieren.
Anorganische Chemie:
Dieser Zweig befasst sich mit dem Studium anorganischer Verbindungen wie den Salzen. Er schließt das Studium über die Struktur und die Eigenschaften dieser Verbindungen ein. Dazu gehört auch das Studium der einzelnen Elemente der Verbindungen. Anorganische Chemiker würden wahrscheinlich sagen, es handele sich um das Studium aller Verbindungen ohne den Kohlenstoff. Diesen überlassen sie den organischen Chemikern.
Organische Chemie:
Diese ist das Studium des Kohlenstoffs und seiner Verbindungen. Es ist wahrscheinlich der organisierteste Bereich der Chemie – aus gutem Grund. Es gibt Millionen organische Verbindungen und Tausende, die jedes Jahr neu entdeckt oder geschaffen werden. Industrien wie die Kunststoffindustrie, die Ölindustrie und die Pharmaindustrie verlassen sich auf organische Chemiker.
Physikalische Chemie:
Dieser Zweig analysiert, wie und warum sich ein chemisches System so verhält, wie es das tut. Physikalische Chemiker studieren die physikalischen Eigenschaften und das physikalische Verhalten der Materie und versuchen, Modelle und Theorien zu entwickeln, die dieses Verhalten beschreiben.
Makroskopische und mikroskopische Perspektive
Die meisten Chemiker arbeiten wie selbstverständlich in zwei Welten. Die eine ist die makroskopische Welt, die wir wahrnehmen, fühlen und berühren. Dies ist die Welt der fleckigen Laborkittel und Dinge wie Natriumchlorid abzuwiegen, um Dinge wie Wasserstoffgas zu schaffen. Dies ist die Welt der Versuche.
Aber Chemiker arbeiten auch in der mikroskopischen Welt, die Sie und ich nicht direkt sehen, fühlen oder berühren können. Hier arbeiten Chemiker mit Theorien und Modellen. Sie können das Volumen und den Druck eines Gases in der makroskopischen Welt messen, aber sie müssen die Messungen geistig in die mikroskopische Welt übersetzen, wie klein die Gaspartikel auch sind.
Kapitel 2
Materie und Energie
IN DIESEM KAPITEL
Die Zustände der Materie und ihre Änderungen verstehenZwischen reinen Substanzen und Mischungen unterscheidenEigenschaften chemischer Substanzen prüfenVerschiedene Arten der Energie entdeckenEnergie in chemischen Verbindungen messenBetreten Sie ein Zimmer und schalten Sie das Licht an. Schauen Sie sich um– was sehen Sie? Es könnten ein Tisch, einige Stühle, eine Lampe oder ein eingeschlafener Computer sein. Aber alles, was Sie sehen, ist in Wirklichkeit Materie und Energie. Es gibt viele Arten von Materie und von Energie, aber wenn alles gesagt und getan ist, bleiben Materie und Energie übrig. Wissenschaftler pflegten zu glauben, dass diese beiden Dinge getrennt und verschieden sind, heute aber müssen sie feststellen, dass Materie und Energie miteinander verbunden sind. In einer Atombombe oder einem Atomreaktor wird Materie in Energie umgewandelt. Die Science-Fiction des »Star Trek« wird eventuell eines Tages Realität und es wird vielleicht alltäglich, den menschlichen Körper in Energie zu verwandeln, zu befördern und wieder in Materie zurückzuverwandeln. Aber ich bleibe inzwischen bei den Grundlagen von Materie und Energie.
In diesem Kapitel behandele ich die zwei Grundbestandteile des Universums – Materie und Energie. Ich prüfe die verschiedenen Zustände von Materie und das, was geschieht, wenn Materie von einem Zustand in einen anderen übergeht. Ich zeige Ihnen, wie das metrische System verwendet wird, um Materie und Energie zu messen, und wie ich die verschiedenen Arten der Energie prüfe und messe.
Zustände der Materie: makroskopische und mikroskopische Sicht
Sehen Sie sich um. All das Zeug um Sie herum, das Sie sehen – der Stuhl, das Wasser, das Sie trinken, das Papier, worauf dieses Buch gedruckt ist, ist Materie. Materie ist der materielle Teil des Universums. Sie ist irgendetwas, das Masse hat und Platz einnimmt. (Später in diesem Kapitel stelle ich Ihnen die Energie, den anderen Teil des Universums, vor.) Materie kann in einem von drei Zuständen existieren: fest, flüssig und gasförmig.
Festkörper
Die makroskopische Ebene ist diejenige, in der wir direkt mit unseren Sinnen einen festen Körper bemerken, mit einer festen Form und einem festen Volumen. Denken Sie an einen Eiswürfel in einem Glas – es ist ein Festkörper. Sie können den Eiswürfel leicht wiegen und sein Volumen messen. Auf der mikroskopischen Ebene (wo Sachen so klein sind, dass der Mensch sie nicht direkt beobachten kann) sind die Partikel, die das Eis ausmachen, sehr nah zusammen und bewegen sich nur geringfügig (siehe Abbildung 2.1).
Abbildung 2.1: Fester, flüssiger und gasförmiger Zustand der Materie
Der Grund, warum die Partikel, die das Eis ausmachen, (auch als Wassermoleküle bekannt), nah beisammen sind und nur kleine Bewegungen machen, ist der, dass in vielen Festkörpern die Partikel in eine starre, regelmäßig aufgebaute Struktur, das Kristallgitter, eingebunden sind. Die Partikel, die im Kristallgitter enthalten sind, bewegen sich zwar immer noch, aber sehr wenig – es ist mehr eine leichte Vibration. Je nach den Partikeln kann dieses Kristallgitter von verschiedenster Form sein.
Flüssigkeiten
Wenn ein Eiswürfel schmilzt, wird er eine Flüssigkeit. Im Gegensatz zu Festkörpern haben Flüssigkeiten keine feste Form, aber sie haben ein festes Volumen, genau wie feste Körper. Zum Beispiel hat eine Tasse Wasser in einem hohen engen Glas eine andere Form als eine Tasse Wasser auf einem Suppenteller, aber in beiden Fällen ist das Volumen der Tasse gleich – eine Tasse. Warum? Die Partikel in Flüssigkeiten sind viel weiter auseinander als die Partikel in Festkörpern, und sie bewegen sich auch viel mehr herum (siehe Abbildung 2.1 b). Obwohl die Partikel in Flüssigkeiten weiter auseinander sind als in Festkörpern, kann es sein, dass einige Partikel in Flüssigkeiten immer noch nahe beieinander sind, zusammengeballt in kleinen Gruppen. Weil die Partikel in Flüssigkeiten weiter auseinander sind, sind die Anziehungskräfte zwischen ihnen nicht so stark, wie sie in Festkörpern sind, weshalb Flüssigkeiten ja keine feste Form haben. Jedoch sind diese Anziehungskräfte stark genug, die Substanz in einer großen Masse – einer Flüssigkeit – gefangen zu halten.
Gase
Wenn Sie Wasser erhitzen, können Sie es in Dampf umwandeln, die gasförmige Form des Wassers. Ein Gas hat keine feste Form und kein festes Volumen. In einem Gas sind Partikel viel weiter voneinander entfernt als in Festkörpern oder Flüssigkeiten (siehe Abbildung 2.1 c) und sie bewegen sich weitestgehend unabhängig voneinander. Wegen der Entfernung zwischen den Partikeln und der unabhängigen Bewegung dehnt sich Gas aus, um den Bereich zu füllen, in dem es sich befindet.
Eis in Alaska, Wasser in Texas: Materie wechselt den Zustand
Wenn eine Substanz von einem Zustand der Materie in einen anderen übergeht, nennen wir diesen Prozess eine Änderung des Aggregatszustandes. Während dieses Prozesses passieren einige ziemlich interessante Dinge.
Ich löse mich auf! Oh, was für eine Welt!
Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein großes Stück Eis aus Ihrem Kühlschrank und legen es in einen großen Topf auf Ihrem Herd. Wenn Sie die Temperatur des Eises messen, kann es sein, dass Sie zum Beispiel –5° Celsius messen. Wenn Sie die Temperatur ablesen, während Sie das Eis erhitzen, stellen Sie fest, dass die Temperatur des Eises anzusteigen beginnt, da die Hitze vom Ofen bewirkt, dass die Eispartikel beginnen, schneller und schneller im Kristallgitter zu vibrieren. Nach einer Weile bewegen sich manche der Moleküle so schnell, dass sie frei das Gitter verlassen und das Kristallgitter (das seinen festen Körper zunächst behält) schließlich auseinanderbricht. Der Festkörper beginnt, von einem festen Zustand in einen flüssigen überzugehen, was wir schmelzen nennen. Die Temperatur, bei der das Schmelzen beginnt, wird Schmelzpunkt (GP wie Gefrierpunkt) der Substanz genannt. Die Schmelztemperatur für Eis ist 0° Celsius.
Wenn Sie die Temperatur des Eises beobachten, wenn es schmilzt, sehen Sie, dass die Temperatur bei 0° C konstant bleibt, bis das ganze Eis geschmolzen ist. Während Änderungen des Zustands (Phasenänderungen) bleibt die Temperatur konstant, obwohl die Flüssigkeit mehr Energie als das Eis enthält (weil sich die Partikel in Flüssigkeiten schneller als die Partikel in Festkörpern bewegen, wie im vorherigen Abschnitt erwähnt).
Die Siedetemperatur
Wenn Sie einen Topf Wasser erhitzen (oder wenn Sie fortfahren, den im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Topf mit dem Eiswürfel zu erhitzen), steigt die Temperatur des Wassers an, und die Partikel bewegen sich schneller und schneller, während sie die Hitze absorbieren. Die Temperatur steigt an, bis das Wasser die nächste Änderung des Zustands erreicht. Wenn sich die Partikel schneller und schneller bewegen, je nachdem, wie sie erhitzt werden, beginnen sie, die Anziehungskräfte untereinander zu überwinden und als Dampf aufzusteigen. Der Prozess, bei dem sich eine Substanz vom flüssigen in den gasförmigen Zustand bewegt, wird Sieden genannt. Die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zu kochen beginnt, wird der Siedepunkt (SP) genannt. Der SP ist vom atmosphärischen Druck abhängig, aber für Wasser auf Meereshöhe liegt er bei 100 °C. Die Temperatur des kochend heißen Wassers bleibt konstant, bis alles verdampft ist.
Es gibt sowohl Wasser als auch Dampf bei 100 °C. Sie haben dieselbe Temperatur, aber der Dampf hat viel mehr Energie (weil sich die Partikel unabhängig und ziemlich schnell bewegen). Weil Dampf mehr Energie hat, sind Verbrennungen durch Dampf normalerweise viel ernster als die durch kochendes Wasser, weil viel mehr Energie auf Ihre Haut übertragen wird. Ich wurde hieran eines Morgens erinnert, als ich versuchte, eine Falte aus meinem Hemd zu bügeln, das ich anhatte. Meine Haut und ich können bestätigen – Dampf enthält viel Energie!
Ich kann den Prozess des Wassers, das sich von einem Festkörper zu einer Flüssigkeit verwandelt, wie folgt zusammenfassen:
Weil das Grundteilchen in Eis, Wasser und Dampf das Wassermolekül H2O ist, kann derselbe Prozess auch so dargestellt werden:
Hierbei steht (s) für Festkörper, das (l) steht für Flüssigkeit und (g) für Gas. Die Abkürzungen s, l, g sind die Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnungen für solid, liquid und gas. Diese zweite Darstellung ist viel besser, weil die meisten Substanzen im Gegensatz zu H2O keine unterschiedlichen Namen für ihren festen, flüssigen oder gasförmigen Zustand haben.
Gefrierpunkt: das Wunder des Eiswürfels
Wenn Sie eine gasförmige Substanz abkühlen, können Sie die Phasenänderungen genauso beobachten. Die Phasenänderungen sind:
Kondensation, Gas wird zur Flüssigkeit
Gefrieren, Übergang vom flüssigen in den festen Zustand
Die Gaspartikel haben viel Energie, aber da sie abgekühlt sind, ist diese Energie reduziert. Die Anziehungskräfte haben jetzt eine Chance, die Partikel enger zusammenzuziehen, wobei sich Flüssigkeit bildet. Dieser Prozess wird Kondensation genannt. Die Partikel sind jetzt in Klumpen (wie er bei Partikeln in einem flüssigen Zustand charakteristisch ist), aber da mehr Energie durch Abkühlen entfernt wird, beginnen die Partikel, sich auszurichten, und ein Festkörper entsteht. Dieser ist bekannt als Eis. Die Temperatur, bei der dies geschieht, wird Gefriertemperatur (GP) der Substanz genannt.
Die Gefriertemperatur ist die gleiche wie die Schmelztemperatur – es ist der Punkt, an dem die Substanz in der Lage ist, eine Flüssigkeit oder ein Festkörper zu sein.
Ich kann Wasser als Zustandsänderung eines Gases in einen Festkörper darstellen:
Sublimieren Sie das!
Die meisten Substanzen gehen durch die »logische« Fortentwicklung vom Fest- körper zur Flüssigkeit, sobald sie erhitzt werden – oder umgekehrt, wenn sie abgekühlt werden. Aber einige Substanzen gehen direkt vom Festkörper in den gasförmigen Zustand über, ohne jemals eine Flüssigkeit zu werden. Wissenschaftler nennen das Sublimation. Trockeneis – festes Kohlenstoffdioxid CO2(s) ist das klassische Beispiel für Sublimation. Sie können sehen, wie Trockeneispartikel kleiner werden, da der Festkörper beginnt, sich in ein Gas zu verwandeln, aber es bildet sich währenddessen keine Flüssigkeit. Wenn Sie schon mal Trockeneis gesehen haben, dann werden Sie sich daran erinnern, dass es normalerweise von einer weißen Wolke umgeben ist – Zauberer und Theaterproduktionen verwenden oft Trockeneis für das Erzeugen von Kunstnebel. Die weiße Wolke, die Sie normalerweise sehen, ist nicht das Kohlenstoffdioxidgas – das Gas selbst ist farblos. Die weiße Wolke entsteht durch die Kondensation von Wasser in der Luft, die mit dem Trockeneis in Berührung kommt.
Der Prozess der Sublimierung wird so dargestellt:
Reine Substanzen und Mischungen
Einer der Grundprozesse in der Wissenschaft ist die Klassifizierung. Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, können Chemiker Materie als fest, flüssig oder gasförmig klassifizieren. Aber es gibt noch andere Arten, Materie zu klassifizieren. In diesem Abschnitt erörtere ich, wie alle Materie als entweder eine reine Substanz oder als Mischung klassifiziert werden kann (Abbildung 2.2).
Abbildung 2.2: Klassifizierung der Materie
Reine Substanzen
Eine reine Substanz hat eine sichere und konstante Komposition oder eine feste und konstante Erscheinung wie Salz oder Zucker.
Eine reine Substanz kann entweder ein Element oder eine Verbindung sein, aber die Zusammensetzung einer reinen Substanz variiert nicht.