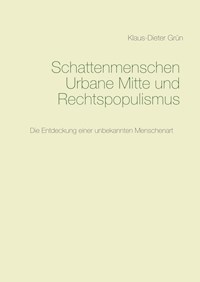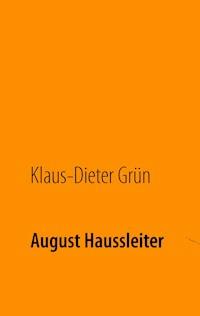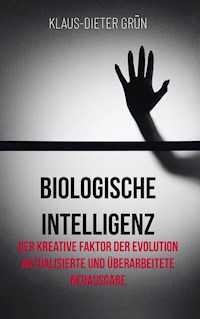
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Als im Jahre 2003 die erste Fassung dieses Buches erschien, basierten eine Reihe der Schlussfolgerungen auf Thesen, die damaligen Theorien z.T. völlig widersprachen. Sind Lebewesen grundsätzlich intelligent, also auch Einzeller und Pflanzen? Können sie durch Lernvorgänge und Schlussfolgerungen erworbene Verhaltensweisen außer über Traditionslernen und nachträgliche mutative Bestätigung auch anders an ihre Nachkommen weitergeben? Hat die bisherige Evolutionstheorie die indirekte Anpassung an die Umwelt durch individuelle Problemlösungen übersehen? Kann es überhaupt ein biologisches Informationsverarbeitungsprogramm geben, welches niemals abgewandelt worden ist und sich bei Lebewesen mit Gehirn allerdings potenziert? Ist es überhaupt denkbar, dass eine prinzipielle Biologische Intelligenz die Evolutionsrichtung von Lebewesen beeinflusst hat und beeinflusst? Nunmehr, nach knapp 20 Jahren, kann festgestellt werden: Die Theorie der Biologischen Intelligenz hat sich in vielfältiger Weise bestätigt. Die Evolutionstheorie selbst steht vor einem großen Wandel, es gibt sowohl eine epigenetische Vererbung erworbener Eigenschaften als auch eine adaptive Mutation, die einen eingeschlagenen Evolutionsweg nachträglich bestätigt! Selbst Insekten können Rechenoperationen erlernen, Echsen erweisen sich als so intelligent wie Vögel, die Intelligenz von Vögeln reicht an die von Primaten heran, und Primaten können hunderte von erlernten Wörtern verwenden. Alle eint ein grundlegendes, individuelles und mit Bewusstseinselementen ausgestattetes Verarbeitungsprogramm: Biologische Intelligenz!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Kurz nachdem die Kreatur aus dem Ei geschlüpft oder geboren worden ist, legt sie sich mit ihrer flüssigen oder festen Umwelt an, bearbeitet sie mit Zilien, Flagellen oder Muskeln, sie schwimmt, krabbelt, gleitet, pulsiert, sie stößt, schreit, atmet und ernährt sich von ihrer Umwelt. Sie passt sich nicht nur der Umwelt an – sie frisst und säuft ihre Umwelt, kämpft und paart sich in ihr, sie `reagiert `oder antwortet nicht nur auf ihre Umwelt, sondern stellt ihr auch Fragen, indem sie sie erkundet. Erinnern wir uns daran, dass der Explorationstrieb ein ebenso grundlegender Primärinstinkt ist wie der Hunger und der Geschlechtstrieb und manchmal sogar noch stärker sein kann.“
Arthur Koestler
Inhalt
Vorwort
1.Kapitel: Die synthetische(darwinistische) Evolutionstheorie oder die Lebewesen als Spielball von Selektion und genetischer Variation durch Mikroevolution
2.Kapitel: Die Problematik zufälliger mutativ entstandener Verhaltensweisen
3.Kapitel: Intelligenz als grundlegendes Lebensphänomen
3.1. Intelligenz ohne Nervensystem (und ohne Gehirn) bei Einzellern
3.1.2. Die Pflanzen
3.2. Vorläufige Hypothese über eine grundlegende „Biologische Intelligenz“
3.3. Biologische Intelligenz bei Mehrzellern
3.3.1. Lebewesen mit oder ohne Nervensystem, aber jeweils auch ohne Gehirn
3.3.2. Biologische Intelligenz bei Weichtieren
3.4. Das Gehirn
3.4.1. Die Potenzierung der Fähigkeiten der Biologischen Intelligenz
3.4.2. Zwischenbemerkung
3.4.3. Insekten
3.4.4. Der Beleg für ein biointelligentes Verarbeitungsprogramm bei Bienen
3.4.5. Echsen und Eidechsen
3.4.6. Echsen schlauer als Vögel?
3.4.7. Die Vögel
3.4.8. Singe, wem Gesang gegeben
3.4.9. …dann eben etwas anderes!
3.4.10. Papageien-und sie sprechen doch!
3.4.11. Die „schwarzen Intelligenzbestien“
Kapitel 4: Die Theorie der „Biologischen Intelligenz“
Kapitel 5: Evolution und Biologische Intelligenz
Glossar
Literaturverzeichnis
Vorwort
Im Jahre 2003 erschien in einem kleinen Verlag mein Buch:“Biologische Intelligenz - Der kreative Faktor der Evolution“.
Darin versuchte ich zu belegen, dass alle Lebewesen über etwas verfügen, was ich „Biologische Intelligenz“ nenne, ein intelligentes Arbeitsprinzip quasi, durch welches Lebewesen in der Lage sind, Außen-und Innenreize zu verarbeiten, diese mit den Erinnerungen an vormalige, ähnliche Situationen und/oder dementsprechenden vererbten Verhaltensweisen zu vergleichen und daraus letztendlich Schlussfolgerungen für ihr Verhalten in dieser derart analysierten Situation zu ziehen.
Diese These, für sich genommen, steht natürlich im Einklang mit den Beobachtungen, die jeder interessierte Mensch in der freien Natur tagtäglich machen kann: Ob eine Amsel nach Regenwürmern sucht, weil sie Hunger, also einen Innenreiz verspürt und sich daraus für sie ergibt, einen Regenwurm zu suchen, um den Hunger zu stillen, zurückzuführen darauf, dass sie den Typus Regenwurm als Nahrungsquelle, ob als vererbtes und/oder erlerntes Muster im Gehirn gespeichert hat, oder ob ein Regenwurm , sobald die Amsel die ihn schützende Blätterschicht beiseite geschafft hat, sich fluchtartig in seine Erdröhre zurückzieht, es sind in der Regel angemessene Verhaltensweisen, die die Lebewesen anwenden.
Nun bedeutet angemessenes Verhalten noch keineswegs, dass hier etwas vorliegt, welches man „Intelligenz“ nennen könnte. Im Sinne von vererbten, zufällig durch die Selektion entstandenen und ständig durch weitere zufällige Verhaltensmutationen verbesserten Verhaltensweisen, könnte man bestenfalls von „Pseudointelligenz“ sprechen1 - so noch heute die Meinung vieler Verhaltensforscher und vor allem von Evolutionsbiologen.
Indirekt bestätigt wird eine solche Auffassung durch eine Vielzahl von nachgewiesenen angeborenen Verhaltensweisen, die durch bestimmte Außen-und Innenreize initiiert, von den jeweiligen Tieren daraufhin eingeleitet werden.
Nun gibt es aber eine Reihe von Experimenten, die zeigen, dass selbst angeborenes Verhalten situationsbedingt verändert werden kann, und diese Veränderung bei der Wiederholung der Ausgangssituation des Experiments erneut abgerufen werden kann. So etwas nennt man „Lernen“.
Könnte es aber nicht auch sein – so meine Argumentation -, dass die Lernfähigkeit einen der wesentlichen Gründe für angeborenes Verhalten an sich darstellt?
Denn dieses, wie wir noch sehen werden, z.T. äußerst komplizierte angeborene Verhalten, hat nicht nur eine verblüffende Passgenauigkeit, um mit individuellen Problemen in einer spezifischen Umwelt zurecht zu kommen, sondern ist jeweils nur ein Teil einer Vielzahl weiterer angeborener Verhaltensweisen, die oftmals aufeinander aufbauen.
Deswegen habe ich mich in meinem Buch sehr ausführlich mit der modernen, auf Darwin zurückgehenden, „synthetischen Evolutionstheorie“ auseinandergesetzt, denn die These, dass angeborene Verhaltensweisen , die wie ein „Schlüssel“ in eine bestimmte Umwelt passen, grundsätzlich durch zufällige “Verhaltensmutationen“, deren „Passgenauigkeit“ die Selektion ausgewählt hat, entstanden seien, ergibt sich nicht aus Experimenten, sondern allein aus dieser Theorie selbst.
Von der Herangehensweise widerspricht es zwar keineswegs wissenschaftlicher Methodik, die in diesem Fall sogar ohne wirklich experimentellem Beweis gewonnenen Schlussfolgerungen einer wissenschaftlichen Theorie argumentativ anzuzweifeln, aber die (synthetische) Evolutionstheorie ist nicht irgendeine Theorie, sondern die (biologische) Theorie überhaupt. Für viele Biologen und Verhaltensforscher stellt sie einen, wenn nicht sogar den absoluten Meilenstein wissenschaftlicher Erkenntnis dar, wie etwa seinerzeit für den Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der ihr geradezu ein Gebet widmete, mit dem er seinen Glauben daran kundtat, dass die „großen Konstrukteure“ (Zufallsmutation und Selektion) schließlich die menschliche Aggression in Mitmenschlichkeit umwandeln würden:
„Das volle und wahre Gefühl von Liebe und Freundschaft können wir nur für Einzelmenschen empfinden, daran kann der beste und stärkste Wille nichts ändern. Doch die großen Konstrukteure können es, denn ich glaube an die Macht der menschlichen Vernunft, ich glaube an die Macht der Selektion und ich glaube, dass Vernunft vernünftige Selektion treibt.“2
Nun wurde diese synthetische Evolutionsbiologie sogar noch durch die „Soziobiologie“ ergänzt, die, während z.B. die „Konrad-Lorenz-Schule“ kooperatives Verhalten als wichtig für den „Arterhalt“ ansah, nunmehr die Lebewesen gleichsam primär als Transporteure ihrer Gene betrachtete und daraus folgerte, dass die unbedingte Erhaltung dieser „egoistischen“ Gene viel besser die vielen Besonderheiten der Kooperation und Symbiose von Lebewesen erklären könnten. Denn, wenn im ursprünglichen darwinschen Sinne, nur der „stärkste“ (=bestangepasste) die meisten Nachkommen haben würde, und insofern ein Günstling der Selektion wäre, dann war es nur schwerlich zu erklären, warum beispielsweise bei fast allen Herdentieren die Kämpfe der männlichen Tiere um die Weibchen ritualisiert stattfinden, anstatt in einem Kampf um Leben und Tod zu enden, denn von der Erhaltung der Art, wie Lorenz es sah, wissen ja die Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes wohl kaum etwas, ja die Art an sich ist eine rein menschliche Klassifizierung.
Geht es aber vor allem darum, dass die eigenen Gene weitergegeben werden, verbietet sich ein Kampf um Leben und Tod deswegen, weil die Verkleinerung der Herde die Überlebensfähigkeit des eigenen (Gen-)Nachwuchses verringern würde: Freßfeinde hätten dann z.B. weniger „Auswahl“. 3
Diese Theorie ist vom Denkansatz dermaßen beeindruckend, dass man nunmehr viele kritische Einwände gegen die „synthetischen“ Evolutionstheorie (wenn es letztlich nur darum ginge, dass sich die Nachkommen eines besser angepassten Individuum, erblich ausgestattet mit dieser „besseren Anpassung“, selektiv ausgewählt „genetisch“ durchsetzen, warum gibt es in der Natur fast überall Altruismus, Symbiose oder Kooperation?) geradezu in sich zusammenfielen, wie etwa z.B. den todesmutigen Kampf von Ameisen gegen einen weit überlegenden Feind, obgleich, außer der Königin selbst, sie gar keine Nachkommen haben können: Sie sind, wenn man so will, „genetisch darauf programmiert“, dass sie die Königinnen-Gene des „Ameisennestes“, die ja auch ihre eigenen sind, als solche auf jeden Fall schützen, sogar mit dem Einsatz ihres Lebens!
Gegen solch eine anerkannte und sogar noch verbesserte Theorie wollte ich in Hinsicht auf vererbte Verhaltensweisen mit dem schlichten Argument der fehlenden Beweise für die Entstehung vererbter Verhaltensweisen durch Mutation und Selektion angehen?
Im Grunde eine lächerliche Idee!
Insofern habe ich allein mehr als 30% des Buchumfanges der ersten Ausgabe der „Kritik des Darwinismus“ gewidmet. Erfreulicherweise ist eine solche intensive Auseinandersetzung heutzutage nicht mehr in dem Maße notwendig, denn in der Zwischenzeit hat sich die Situation tatsächlich grundlegend verändert. Zu den zwei „Konstrukteuren“ haben sich noch weitere hinzugesellt, ja wie das nun alles zusammenpasst, ist eine wissenschaftliche Aufgabe für die Zukunft, wenn sie nicht allein schon daran scheitert, dass vergangene Evolutionsabläufe sich trotz vieler Fossilienfunde nicht mehr schlüssig rekonstruieren lassen.
Wie sehr sich die Ausgangssituation tatsächlich geändert hat, wird ersichtlich, wenn man sich mit den vererbten „intelligent“ erscheinenden Verhaltensweisen beschäftigt, denn bei der Frage, wie denn nun ein vererbtes, passgenaues Verhalten für eine bestimmte Umwelt überhaupt anders als im Sinne von selektiv ausgewählten „Verhaltensmutationen“ entstanden sein könnte, war ich 2003 sogar „gezwungen“, einen eisernen Lehrsatz der synthetischen Evolutionstheorie in Zweifel zu ziehen, der darin bestand, dass keinerlei Umwelterfahrungen je den „Weg“ in die Gene finden könnten, also auch nicht intelligente Schlussfolgerungen für das eigene Verhalten. Ich befand mich in einer Zwickmühle, denn wenn es auch keinerlei Beweise dafür gab, dass komplexe vererbte Verhaltensweisen durch mutativen Zufall entstanden sind, so gab es ebenso wenig Beweise dafür, dass individuelle Verhaltensänderungen, erworben durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt, auf die Nachkommen vererbt werden könnten. Ja, dies schien sogar wissenschaftlich unmöglich zu sein: Niemals und unter keinen Umständen erreicht eine Information aus der Umwelt die Keimzellen, so geradezu das Mantra. Und: Alle Experimente in der Vergangenheit, die die Erblichkeit erworbener Eigenschaften oder erworbener Verhaltensweisen nahe legten, hielten demzufolge einer kritischen Sichtung oder Überprüfung nicht stand – so jedenfalls der allgemeine Tenor der Biologen.4
Aber: Indizien für die Vererbung erworbener Eigenschaften waren bekannt: Dazu zählen Tiere, deren Augenfarbe von der Temperatur der Umwelt abhängt, ebenso wie z.B. ihr Geschlecht; es gab Besonderheiten bei Embryos, die mit ihrem späteren Lebensraum als erwachsene Tiere zu tun hatten5 und es gab, zu meiner Verblüffung und im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung in der Evolutionsbiologie, dennoch Experimente, deren Ergebnisse sich am ehesten im Sinne einer Vererbung erworbener Verhaltensweisen interpretieren ließen.
Da aber selbst eventuell erfolgreiche Experimente in der Biologie teilweise scheinbar nicht mehr bekannt waren oder aber angezweifelt wurden – oftmals ohne sie wiederholt zu haben! – würde, so war ich mir sicher, meine Beweisführung niemanden überzeugen. Es kann ja einfach nicht sein, was nicht sein kann.
Zwar war ich der Meinung, dass es mir möglich war, viele Fallbeispiele dafür zu nennen, dass eine intelligente Verarbeitung von Innen-und Außenreizen zu Schlussfolgerungen bei den Lebewesen führen, die oftmals sogar angeborenes Verhalten selbst verändern konnten, aber da Verhaltensforscher selbst die These einer allgemeinen vorhandenen Lernfähigkeit der Lebewesen vertraten, war der Erkenntniswert meiner These ja als eher gering einzuschätzen. Daher musste ich einerseits die Möglichkeit eröffnen, dass, entgegen allen Einwänden der Wissenschaft, komplexe neu gefundene Verhaltensänderungen eines Individuums sich doch auf irgendeine unbekannte Weise auf die Nachkommen vererben, und gleichzeitig berücksichtigen, dass dies eine ganz, ganz schwache Säule meines „Theoriengebäudes“ war. Deswegen endete das Buch mit einem Kompromiss: Selbst wenn es eine Vererbung erworbener Verhaltensweisen nicht geben würde, dann wäre die „biologische Intelligenz“ ein maßgeblicher Faktor, um die Evolutionsrichtung einer Art zu beeinflussen, einfach deswegen, weil es nachgewiesen war, dass es einzelne, gleichsam kühnere oder „intelligentere“ Exemplaren einer Art gelingen konnte, in einer veränderten oder neuen Umwelt durch selbstgefundene Verhaltensänderungen zu überleben. Da es insbesondere bei differenzierteren, also „höher entwickelten“ Lebewesen, auch z.B. bei Insekten, ein Imitations-und Traditionslernen (von den Eltern auf die Kinder, von einzelnen Herdenmitgliedern auf andere Herdenmitglieder) gibt, konnte es also auch sein, dass zunächst die neue Problemlösung da war, dann als „Tradition“ an die Nachkommen/Herdenmitglieder weitergegeben worden wäre und endlich irgendwann als eine zufällige Verhaltensmutation in den Genen „festschrieben“ wurde.
Dieser Kompromiss konnte natürlich nicht darüber hinweg täuschen, dass ich mit meiner Kritik an der synthetischen (darwinistischen) Evolutionstheorie im Grunde einen Schritt zu weit gegangen war, und dass ich mich mit meinem Rückgriff auf die „alte“ Theorie der vererbten Eigenschaften außerhalb des „wissenschaftlichen Spielfeldrandes“ aufhielt.
Und plötzlich, vollkommen unerwartet, sowohl für die Vertreter der synthetischen Evolutionsbiologie, als auch für mich, sollte sich diese „Verirrung“ in die Gefilde einer längst erledigten Theorie als vom Prinzip her richtig erweisen. Denn es stellte sich heraus, dass es für die Vererbung erworbener Eigenschaften durch Umwelteinwirkungen gar nicht notwendig war, die Gene selbst zu verändern, sondern die Erklärung für plötzliche erfolgreiche Experimente im Sinne der Vererbung erworbener Eigenschaften, beginnend in den 1990iger Jahren, nun darin bestand, dass Umwelt und eigenes Verhalten die Ablesevorgänge für die Gene bei den Nachkommen verändern konnten, weswegen dafür der Begriff Epigenetik gewählt wurde.
Aber selbst mein damaliger Kompromiss erweist sich heute, gleichsam als zweite Säule für meine Theorie, in verblüffender Weise mehr als nur tragbar: Es sieht alles danach aus, als ob es neben rein zufälligen geradezu „zielgerichtete“ Mutationen, adaptive Mutationen genannt, gibt!
Auch in einem ganz entscheidenden weiterem Punkt wurde ich in der Zwischenzeit vielfach bestätigt: Die Intelligenzleistungen von Tieren, seien es Einzeller, Insekten, Vögel, Säugetiere, ja sogar Pflanzen werden heutzutage viel höher eingeschätzt als noch vor ca. 20 Jahren.
Schließlich: Die Frage ob Tiere mit Gehirn über ein Bewusstsein verfügen, ebenfalls eine meiner Thesen, wird im Sinne einer realistisch denkbaren Möglichkeit diskutiert, so etwa von dem deutschen Gehirnforscher Gerhard Roth6, der dies sogar schon im Erscheinungsjahr meines Buches nahelegte.
Es steht außer Frage, dass mir auch eine Reihe von Fehlern unterlaufen sind, so z.B. beim Axolotl, einem südamerikanischen terrestrischen Molch, der in zwei mexikanischen Seen sein Leben lang als Larvenform lebt und sich dennoch vermehren kann. Ich schrieb:“ Bringt man solche Larven (dazu) auf dem Land zu leben…entwickeln sie sich wieder zu normalen, landlebenden Molchen.“ 7
Dies ist so falsch, der Axolotl entwickelt sich überall ganz normal, nur nicht in eben den zwei Seen, weil ihm dort die Möglichkeit fehlt, ein bestimmtes Hormon zu bilden. Verabreicht man einem „unfertigen“ Molch in einem dieser zwei Seen das Schilddrüsenhormon Thyroxin, ist das Problem behoben.
Zweifellos sind solche Fehler, Unrichtigkeiten und Falschinterpretationen ärgerlich, und so sehr ich bemüht bin sie zu vermeiden, so sehr bin ich mir leider sicher, dass sie mir ab und an wieder unterlaufen werden, denn sie lassen sich allein schon deswegen nicht völlig ausschließen, weil die Themenbreite dieses Buches so gewaltig ist.
Und deswegen: Obgleich so manche/r Leser/in diese kleinen Zahlen im Text, die auf eine Fußnote verweisen, als ebenso störend empfinden werden, wie die durch kleinere Schrift gekennzeichneten Zitate, ist dies im ersten Fall eine Rückversicherung für den/die Leser/in, durch einfaches „Googeln“ herauszufinden, ob der/die dort aufgeführte Autor/in nicht etwa ein absoluter „Außenseiter/in“ irgendeiner „Art“ ist – ab und an treffen allerdings auch Außenseiter/innen genau den Punkt, und ich bin bestrebt im Text den Außenseiterstatus eine/s solche/n Autoren/in zu erwähnen – und im Falle des Zitats, kann sofort erkannt werden, dass es sich tatsächlich um ein Zitat und nicht um meine eigene Meinung bzw. meine Interpretation handelt.8
Und so wünsche ich Ihnen nunmehr vor allem eins: Die Erfahrung, dass Leben in seiner unglaublichen Vielfalt immer wieder fasziniert und erstaunt!
Und, dass wir alles tun sollten, um die Lebensvielfalt unseres Planeten zu erhalten!
1 So z.B. der deutsche Evolutionsbiologe Heinrich K. Erben in seinem Buch: Intelligenzen im Kosmos, Die Antwort der Evolutionsbiologie; München 1984.; S. 230 f
2 Lorenz, Konrad; Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression; München 1979(6) S. 258 f
3 Zum „egoistischen Gen“ siehe: Dawkins, Richard; Das egoistische Gen; Reinbeck 1998(Tb). Zur Kritik daran, z.B.: Rose, Steven; Darwins gefährliche Erben. Biologie jenseits der egoistischen Gene; München 2000
4 Die Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften wurde von dem französischen Biologen Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) vertreten, und war die erste in sich abgeschlossene Evolutionstheorie. Er erlebte allerdings im Gegensatz zu Charles Darwin, dessen Theorie zunächst auch Lamarcks Ansatz enthielt, schwerste Anfeindungen unter den Wissenschaftlern seiner Zeit – die Theorie kam einige Jahrzehnte zu früh!
5 Warzenschweinembryos weisen Ansätze von Hornhautschichten an den Hand-und Fußgelenken auf, genau an den Stellen, mit denen sich das erwachsene Warzenschwein bei der Nahrungssuche abstützt; auch die Embryos von Kamelen besitzen schon an den Knien Schwielen , die eigentlich die erwachsenen Kamele sowieso durch das Knien im Sand erwerben würden.
6 Roth, Gerhard; Aus Sicht des Gehirns; ; Frankfurt a.M. 2003, S. 51 f
7 Grün, Klaus-Dieter, Biologische Intelligenz. Der kreative Faktor der Evolution; Mannheim 2003; S. 249
8 Sollten im Zitat Punkte oder verbindende Wörter in Klammern stehen, bedeutet dies, dass ein von mir für die Aussage des Zitates als nicht wichtig eingeschätzter Teil des Textes ausgelassen wurde.
1.Kapitel: Die synthetische (darwinistische) Evolutionstheorie, oder die Lebewesen als Spielball von Selektion und genetischer Variation durch Mikroevolution
Als der britische Biologe Charles Darwin (1809-1892) 1859 seine Theorie von der „Entstehung der Arten“ veröffentlichte, war diese „Theorie“ kaum mehr als eine vage Hypothese, denn sie bestand im Grunde nur aus einem, allerdings recht plausiblen Gedankengang: Da offensichtlich in der Natur eine Konkurrenz unter den Lebewesen bestand – Raubtiere jagten Beutetiere, und die Tiere verschiedener Arten konkurrierten um Futter, ja sogar die Tiere einer Art konkurrierten um Futter, Gebiete und z.B. Weibchen -, und andererseits aus der Tierzucht das Auftreten kleiner Abweichungen, sei es ein besonderes Fell oder etwa eine höhere Milchproduktion bei Kühen, bekannt war, und diese Besonderheiten sich sogar durch intensive Zucht noch steigern ließen, folgerte er , dass die Rolle, die menschliche Züchter bei den Haustieren spielen, in der Natur der allgemeine Konkurrenzkampf einnehmen würde, von ihm Selektion genannt.
Im Laufe von Abermillionen von Jahren hätten sich dann die kleinen Abweichungen der Lebewesen „Stück für Stück“, aufeinander aufbauend, von der Selektion auf ihren Vorteil beim Lebenskampf geprüft, zu der heutigen Tier-und Pflanzenwelt entwickelt.
(Eine kleinere Rolle in seiner Theorie nahm die Vererbung erworbener Eigenschaften ein, die er von Jean-Baptiste Lamarck adaptierte.)
Als guter Biologe und Naturbeobachter konnte er z.B. bei einem Besuch der Galapagos-Inseln feststellen, dass die Schnäbel der dortigen Finken(arten) Unterschiede aufwiesen, die in direktem Zusammenhang mit dem jeweils bevorzugten Futter zu stehen schienen.
Ebenso fiel ihm auf, dass z.B. Schmetterlinge, die eine bestimmte Blüte aufsuchten, besonders lange Saugrüssel „besitzen“, wenn dies die Größe der Blüte „verlangte“. Das war mit der allmählichen Addition kleiner Mutationen, ausgewählt durch die Selektion, gut erklärbar.
Hinzu kam, dass, zum Erstaunen der damaligen Biologen, Fossilien die frühere Existenz von z.T. sehr großen Lebewesen, den Sauriern, belegten, die aus irgendeinem Grund den Kampf ums Dasein verloren hatten.
Diese Evolutionstheorie war zwar in wissenschaftlichen Kreisen zunächst sehr umstritten, aber sie traf den Nerv` der Zeit: Führende Intellektuelle waren begeistert, denn sie versetzte dem Glauben an einen Schöpfergott, der die Pflanzen, die Tiere und den Menschen geschaffen hatte, einen schweren Schlag: Nunmehr konnte die Entwicklung der Lebewesen sich auf ein plausibles „natürliches“ Auswahlverfahren (Selektion) von immer ab und an erneut auftretenden und den Entwicklungsgang verstärkenden positiven kleinen Veränderungen zurückführen lassen.9
Als im Jahre 1900 eine 1865 erschienene Arbeit des Augustinermönches Gregor Mendel (1822-1884) „wiederentdeckt“ wurde, die seine Versuche insbesondere mit der Erbfolge bei Erbsen beschrieb, und sich daraus ergab, dass kleine Veränderungen bzw. Mutationen z.B. der Farbe etc. zwar auch zunächst bei den Folgegenerationen „verschwinden“ konnten, aber dann nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten wieder auftauchten, war einer der Hauptkritikpunkte an Darwins Theorie - müssten nicht die kleinen Veränderungen einzelner Individuen einfach deswegen irrelevant sein, weil das Erbgut der gesamten Population eine Verbreitung letztendlich verhindern würde? – scheinbar widerlegt, denn nun war klar: Kleine Veränderungen konnten im Erbgut weitergegeben werden, selbst wenn sie nicht direkt in Erscheinung traten, ja sie konnten sich auf diese Weise sogar innerhalb der jeweiligen Population, gleichsam unbemerkt, verbreiten, wodurch schließlich die Selektion sogar eine größere Möglichkeit hatte, in dem Moment, in dem sie die Überlebensfähigkeit ihrer „Träger“ z.B. durch Umweltveränderungen erneut verbesserten, die Ausbreitung dieser teils „unsichtbar“ verbreiteten Mutation schneller zu verstärken, in dem die Träger dieser Mutation etwas mehr Nachkommen haben würden, als ihre Artgenossen.
Und so habe schließlich dieses Zusammenspiel immer „höher“ entwickelte Lebewesen hervorgebracht, bis hin zum vernunftbegabten Tier, dem Menschen selbst.10
Im 20.Jahrundert wurde Darwins Evolutionstheorie mit den neuen Forschungsergebnissen insbesondere der Biochemie, der Genetik sowie der Populationsgenetik, der Paläontologie usw. „synchronisiert“, was zu Veränderungen der Theorie insgesamt führte. Zunächst aber, zu Beginn des Jahrhunderts, wurden auch ganz andere Evolutionsfaktoren und Theorien diskutiert: So etwa sprunghafte Entwicklungen (Großmutationen) , oder, wie erwähnt, die Vererbung erworbener Eigenschaften, sowie die These von der Orthogenese, ein Vervollkommnungskonzept der Lebewesen, vertreten u.a. von Henry Bergson (18591941). All diese Konzepte hatten allerdings alsbald Schwierigkeiten, die Fachwelt zu überzeugen. Da halfen weder scheinbar großmutativ entstandene Lupinen11, noch Experimente , die die Vererbung erworbener Eigenschaften nachweisen sollten, und die im Einzelfall scheinbar als Betrug entlarvt worden waren12, noch die Interpretation erstaunlicher Embryonalversuche bei Seeigeln etwas13 - am besten vereinbar mit den vielen neuen Erkenntnissen innerhalb der Biologie erschien die sich dementsprechend modifizierende darwinistische Selektionstheorie.
Deswegen nennt man diese, den neuen biologischen Forschungserbenissen angepasste und somit auch veränderte darwinistische Evolutionstheorie, „synthetische Theorie“. Die synthetische Evolutionstheorie setzt darauf, dass die Faktoren, welche die Ausbildung von Arten und Unterarten offensichtlich nachvollziehbar machten (Mikroevolution oder intraspezifische Evolution; Selektion; Artbildung etc.) auch ausreichend seien, die Entstehung neuer Baupläne für Gattungen, Familien und Ordnungen zu erklären.
Sie ist als solche ohne Zweifel wissenschaftlich beeindruckend und scheinbar fest verankert und hat sich naturgemäß – mit der stetigen Anpassung an ganz neue Forschungsergebnisse auch aus ganz anderen Bereichen, z.B. der Geologie – immer weiter und komplexer „entwickelt“, wodurch die regelmäßig wiederkehrende Kritik an ihren vermeintlichen Schwachpunkten oftmals schon deshalb zum Scheitern verurteilt war und ist, weil sie selbst stets die Antworten auf problematische Bereiche gefunden zu haben glaubt(e).
Hinzu kam, dass , wie immer in der Wissenschaft, einzelne Vertreter der synthetischen Evolutionstheorie einen ganz eigenen Ansatz vertraten und vertreten, die Theorie also nicht so homogen war und ist, wie sie Außenstehenden auf den ersten Blick in populärwissenschaftlichen Publikationen entgegentritt.
Eine solche umfassende und gut ausgebaute Theorie strahlte nun auch aus auf andere Forschungsgebiete, nicht zuletzt auf die Verhaltensforschung. Wenn Lebewesen in ihrem Verhalten ausgezeichnet an ihre Umwelt angepasst sind und wenn feststeht, dass solche Fähigkeiten von einer Generation auf die nächste vererbt werden, dann schien es vielen Verhaltensforscher naheliegend. dass es dafür nur eine rationale Erklärung geben kann: Auch das vererbte Verhalten von Lebewesen ist das Ergebnis mikroevolutionärer, durch die Selektion „herausgefilterter“ Zufallsprozesse, einfacher gesagt: Vererbte Verhaltensweisen sind das Ergebnis von kleinen Verhaltensmutationen/Verhaltensvariationen und der Selektion, denen sie im „Kampf ums Dasein“ ausgesetzt sind! Gestützt wurde diese Auffassung auch dadurch, dass sich herausstellte, dass viele vererbte Verhaltensweisen geradezu „rudimentär“ waren. Beispielsweise schließen sich aus dem Ei geschlüpfte Gänse dem erstbesten „Wesen“ an, welches sie erblicken, dies konnte, wie Konrad Lorenz nachwies, er selbst oder sogar ein Ball sein, und somit stellte er zutreffend fest , dass die kleinen Gänschen keinerlei Vorstellung darüber besaßen, wie eine Gänsemutter überhaupt aussieht. Einzig ihr Instinkt, sich dem erstbesten Objekt anzuschließen, beherrscht ihr Handeln – in der freien Natur wird das erste Wesen, welches sie erblicken, auch tatsächlich in den allermeisten Fällen die Gänsemutter sein!
Wenn also „winzig“ kleine „Verhaltensmomente“ - wie in diesem Fall die Tendenz sich nach dem Schlüpfen irgendeinem „Objekt“ anzuschließen – genügen, um Handlungen in Gang zu setzen, entsprach dies nicht unübersehbar einer „kleinen Verhaltensmutation“?
Etwas wie Intelligenz taucht in diesem theoretischen Denkmodell erst bei den Wirbeltieren auf, und der Mensch erscheint dann auf dieser Stufenleiter der Evolution als ein einsamer Sonderfall, kaum noch von Instinkten (= vererbte Verhaltensweisen) beherrscht, intelligent weil sich seiner selbst bewusst.14
Obgleich viele Zoologen, auf Grund ihrer Forschungsergebnisse, immer verblüffendere Fähigkeiten von Tieren beschrieben, vermochte es die synthetische Evolutionstheorie, sowie die von ihr beeinflussten Verhaltensforscher/innen, diese Fähigkeiten allesamt als zufällig entstanden und dann durch die Selektion herausgefiltert einzuordnen.
Und auch wenn sich Konrad Lorenz, der seine vergleichende Verhaltensforschung als Tierpsychologie ansah und sich vehement z.B. gegen die industrielle Hühnerhaltung aussprach, war es eben diese, von der synthetischen Evolutionstheorie beeinflusste Verhaltensforschung, die sie indirekt mit ermöglichte!15
Kurzum: Alle Lebewesen waren und sind letztendlich Spielbälle einer mikroevolutionären Entwicklung innerhalb ihres Genpools, wobei die Selektion dann allmählich daraus die physische als auch die verhaltensgemäß optimalste Anpassung an eine sich stetig verändernde Umwelt herbeiführt(e).
Nur eine einzige Art hat sich aus diesen evolutionärem Geschehen gelöst: Der Mensch!
Aber plötzlich, Mitte der 1970iger Jahre, geriet die synthetische Theorie ganz unerwartet unter „gegnerisches“ Feuer. Und wenn man sich fragt, wie dies geschehen konnte, dann halte man sich vor Augen, woraus denn diese Theorie trotz all ihrer Verästelungen, trotz all ihrer Populationsrechnungen in Verbindung mit erbbiologischen Gesetzen, trotz ihrer Anpassung an biochemische Erkenntnisse, an die genetische Forschung usw. , eigentlich bestand: Aus der Plausibilität der Idee, dass kleine Veränderungen durch eine starke Selektion auf ihre Tauglichkeit geprüft, die Vielfalt des Lebens hervorgebracht hätten – zwar mittlerweile in isolierten oder separierten Populationen, so die Theorie, weil große Populationen ja doch Einzelentwicklungen genetisch letztendlich verhindern konnten.16 Und da sich einerseits auf allen Ebenen, natürlich auch im Genom eines Lebewesens, diese kleinen Variationen nachweisen lassen und andererseits auch auf allen anderen Ebenen, wenn man es so sehen möchte, eine Selektion stattfindet, und die Theorie sogar noch modernen Forschungsergebnissen angepasst wurde, so war doch alles wunderbar, oder?
Aber etwas unterscheidet diese Theorie grundlegend von anderen naturwissenschaftlichen Theorien: Obwohl sie Mechanismen herausgearbeitet hat, die von Beginn jedweden Lebens gelten sollen und somit die „Ursache“ für das darstellen, was man Evolution nennt, kann sie nicht erklären, warum sich die Entwicklung tatsächlich so vollzogen hat, wie es die gefundenen Fossilien nahelegen, noch kann sie irgendetwas über die zukünftige Entwicklung der Lebewesen voraussagen. Man könnte gegen diesen Gedankengang einwenden, dass die Theorie ja eben von der Zufälligkeit der Varietäten/kleinen Mutationen ausgeht und von daher keinerlei solchen Aussagen möglich wären. Doch dem Argument „steht“ die steuernde Funktion der Selektion entgegen.
Denn wo sind dann heute die Ansätze zu völlig neuen Bauplänen? Im Gegenteil, in der Gegenwart scheint die Evolution geradezu „stehengeblieben“ zu sein, weil die heute existierenden Arten vom Ansatz her eben so gut wie keine zukünftige Evolutionsrichtungen erkennen lassen.
Sollte die Evolution an einem Endpunkt angelangt sein?
Eine Theorie aber, die das vergangene Evolutionsgeschehen nicht wirklich erklären kann und auch aus sich heraus für das zukünftige keine Voraussagen erlaubt, kann letztendlich nicht überprüft werden, so plausibel sie auch daher kommt. Ebenso haben die wenigen „Evolutionsexperimente“, die durchgeführt wurden, auf Grund des Zufallscharakters der Varietäten/kleinen Mutationen und des fehlenden Zeitfaktors keine wirkliche Aussagekraft - kleine Veränderungen, die sich eventuell einstellen, können schon im Genpool vorhanden gewesen sein.
Der Biologe Ludwig von Bertalanffy fasste diese Situation 1970 folgendermaßen zusammen:
„Die Tatsache, dass eine derart vage, ungenügend beweisbare und so weit von der `strengen` Wissenschaft üblicherweise angewandte Kriterien entfernte Theorie zu einem anerkannten Dogma werden konnte, lässt sich meiner Meinung nur auf soziologischer Grundlage erklären. Gesellschaft und Wissenschaft waren so von den Ideen des Mechanismus, Utilitarismus und dem ökonomischen Prinzip des freien Wettbewerbes durchdrungen, dass man das Selektionsprinzip an Gottes Stelle setzte und als die letzte Realität ansah.“17
Auch Karl Raimund Popper, seines Zeichens Erkenntnistheoretiker und Philosoph, bestätigte diese Aussage:
„ Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass der Darwinismus keine überprüfbare wissenschaftliche Theorie ist, sondern ein metaphysisches Forschungsprogramm – ein überprüfbarer Rahmen für überprüfbare wissenschaftliche Theorien…Nun, in dem Umfang, in dem der Darwinismus den Eindruck erweckt (=dass nämlich eine endgültige Erklärung für die Evolution erreicht worden sei) ist er nicht viel besser als die theistische Auffassung der Adaption; es ist daher wichtig zu zeigen, dass der Darwinismus keine wissenschaftliche Theorie ist, sondern metaphysisch.“18
Dieses Statement löste seinerzeit einen Sturm der Entrüstung bei Naturwissenschaftlern aus, der dazu beitrug, dass Popper sich wenig später korrigierte:
„Das (= meine Einschätzung des Darwinismus) ist ein Irrtum, und ich wünsche hier zu bestätigen, dass diese (= der Darwinismus) und andere historische Wissenschaften meiner Meinung nach wissenschaftlichen Charakter besitzen: ihre Hypothesen können in vielen Fällen überprüft werden.“19
Es waren dann die Paläontologen Neil Eldredge und Stephen Jay Gould, die sich daran machten, die Hypothesen in ihrem Fachgebiet zu überprüfen: Wenn kleine Variationen, durch die Selektion auf ihren Vorteil getestet, zu der Vielfalt des Lebens geführt hätten, dann müssten die Fossilien doch durch eine Vielzahl von evolutionären Teilentwicklungen davon Zeugnis ablegen. Aber: Bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa sedimentierte Muscheln und Schnecken, bei denen auf der einen Seite die Muschelschalen immer „dicker“ wurden und andererseits sich gleichzeitig die „Bohrwerkzeuge“ der Schnecken, mit denen sie die Muscheln „aussaugten“, vergrößerten, ergaben die Fossilien ein völlig anderes Bild als man es im Sinne der Theorie hätte erwarten dürfen: Die Arten tauchten relativ plötzlich auf und blieben - abgesehen von recht kleinen Veränderungen - ansonsten für lange Zeit in ihrem Äußeren recht konstant, um dann nicht selten ebenso plötzlich restlos zu verschwinden.
Übergänge, deutlich erkennbare Zwischenglieder der Entwicklung – im Grunde Fehlanzeige!
1972 postulierten Eldredge und Gould ihre These vom „punktierten Gleichgewicht“ und der Evolution per saltum. Erdgeschichtlich gesehen blieben nach diesem Konzept die Arten lange Zeit konstant (= punktiertes Gleichgewicht), um dann plötzlich durch schnell entstehende neue Arten „abgelöst“ zu werden. Die Selektion spielt hierbei nur mehr eine untergeordnete Rolle.
Diese Einschätzung konnte sich auch darauf berufen, dass es mindestens fünf große (neben mehreren kleinen) Aussterbewellen in der Vergangenheit gegeben hatte, bei denen bis zu 90% aller Tier-und Pflanzenarten innerhalb, erdgeschichtlich gesehen, kürzester Zeit ausstarben - die letzte vor ca. 65 Millionen Jahren führte zur Auslöschung der zuvor die Welt „beherrschenden“ Saurier und deren „Platz“ nahmen alsbald die Säugetiere ein.20
Und somit ergab sich ein ganz neues Evolutionsschema: Lange vorherrschende Arten wurden Opfer einer Katastrophe und nicht etwa der Selektion und ihre Rolle übernahmen – so die Interpretation der Fossilien - geradezu „über Nacht“ neu entstandene Arten, die wiederum für lange Zeit ohne besondere Änderungen existierten- bis zur nächsten Katastrophe!. Und daraus folgerten Eldredge und Gould, dass sich dieses Muster am besten durch große Mutationen erklären ließe.
Die Theorie der Makroevolution, also der Evolution der großen Schritte war mit Macht zurückgekehrt!
Es gab also keine Entwicklung hin zu immer komplexeren Arten, sondern wie im Fall der Säugetiere, waren sie oftmals nur diejenigen, die in der „Lotterie des Lebens“ ein Glückslos gezogen hatten. Hätte es keinen Meteoriteneinschlag gegeben, würden die Säugetiere aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin nur die ihnen übrig gebliebenen Lebensräume zwischen den Sauriern besetzen.
Es stellte sich allerdings die Frage: Wie kann es zu solchen „Sprüngen“, also zu völlig neuartigen Bauplänen kommen, die vor allem dann „entstanden“ sein mussten, wenn sich „freie“ Lebensräume boten?
Hier kam diese Theorie ins „stottern“: War es überhaupt vorstellbar, dass an Stelle eines langen Entwicklungsweges mittels kleiner Änderungen, plötzlich genetische Informationen aktiv werden konnten, die zuvor ungenutzt in einer bestimmten Spezies vorhanden gewesen sein mussten oder (in der Vergangenheit) von einer Art auf eine andere übertragen wurden21, und die dann zu den scheinbar relativ abrupt auftretenden neuen Bauplänen führten?
Ein theoretischer Ausweg bot sich schließlich, als Molekular-und Erbbiologen entdeckten, dass spezielle Gene, Hox-und Homgene22 genannt, die Entwicklung von Embryos steuern und schon kleine Störungen der „Tätigkeit“ dieser Gene große Wirkungen zeigen. Solche Gene sind jeweils spezialisiert auf den vorderen, auf den mittleren und den hinteren Teil des Embryos. Dabei wirken sie aufeinander ein, so dass eine Störung der Embryoentwicklung eines Teils Entsprechungen in anderen Teilen hervorruft, und selbst dadurch ausgelöste größere Veränderungen beim fertigen Embryo den Gesamtbauplan nicht grundsätzlich gefährden müssen.
Diese kleinen Änderungen der Hox-Steuerung, so der Genfer Entwicklungsbiologe Denis Duboude, reichen aus , um neue Arten zu erschaffen, gerade weil die Hox-Gene nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen in den Körperbau eingreifen und sich, wie schon gesagt,, dabei gegenseitig beeinflussen.23
In welchem Ausmaß Lebewesen in der Lage sind, sogar Baupläne anderer Arten zu verwenden, konnte Denis Duboude in zwei Experimenten zeigen: Er entnahm Mäusechromosomen das Augen-Gen und schleuste es in Fruchtfliegenlarven ein: Die erwachsenen Fruchtfliegen hatten hernach überall auf dem Körper Insektenaugen, dasselbe geschah , als er bei den Larven das Augen-Gen eines Tintenfisches „einschleuste“.24
Wenn aber die Augen-Gene eines einfacheren Organismus, wie die der Fruchtfliege, in der Lage sind, die komplexeren Inhalte eines Säugetier-Augengens oder eines ebenfalls komplexeren Augengens eines Tintenfisches, zu eigenen zusätzlichen Facettenaugen „umzubauen“, dann wird deutlich, dass alle aus denselben „Grundbestandteilen“ bestehen müssen. Insofern scheint die Natur mit „Hilfe“ der Hox-und Hom-Gene nach einem Baukastenprinzip zu arbeiten.
Damit konnte die Evolutionstheorie der „plötzlichen Sprünge“ sogar einen denkbaren genetischen „Mechanismus“ für diese Sprünge angeben, während andererseits das Grundproblem, das „darwinsche Dilemma“, wie sich denn aus kleinen Variationen im evolutionären Schneckentempo, ausgewählt durch die Selektion, komplizierte Organe wie das Auge oder gar ganz neue Baupläne, wie z.B. der der Vögel, entwickelt haben könnten, niemals wirklich gelöst worden war.25
Dennoch war der „große, alte Mann“ der synthetischen Evolutionstheorie, der Biologe Ernst Mayr (1905-2005), in seinem 2003 auf Deutsch erschienenen Buch „Das ist Evolution“ der Meinung, dass die Theorie der unterbrochenen Gleichgewichte, die Eldregde und Gould aufgestellt hatten, nicht im Widerspruch zur allmählichen darwinistischen Evolution stünde, denn „..in Wirklichkeit (sei dies) ein reines Populationsphänomen und demnach gradualistisch(26).“27
Klare Worte eines mitunter recht streitbaren Wissenschaftlers - ähnliches findet sich selbst heute noch in Wikipediaeinträgen o.ä. -, bezug darauf nehmend, dass die eigentliche Evolution sich in kleinen Mutationsschritten vielfach in „separierten oder isolierten“ Populationen vollzogen haben solle, wobei die Chancen die fossilen Überreste solcher „Entwicklungsinseln“ zu entdecken, dadurch äußerst gering seien. Daraus folgerte Ernst Mayr: Die Interpretation der fehlenden kleinen mutativen Abänderungen bei den bekannten Fossilien als Indiz für eine großmutative Evolution anzusehen, dürfte ein Irrtum gewesen sein!
Aber: im Grunde konnte diese Einschätzung in dieser Eindeutigkeit schon damals nicht mehr uneingeschränkt aufrechterhalten werden, denn anderen Evolutionsbiologen waren sehr wohl schon längere Zeit Evolutionssprünge bekannt.28
Und heute steht -bei aller Zurückhaltung- fest, dass es kaum mehr Zweifel daran gibt, wie „Studien der Tierevolution beispielsweise (zeigen), dass sich Merkmale schon in wenigen Generationen erheblich verändern können.“29
Und noch schlimmer: Auch Ernst Mayrs` “Dogma der allopatrischen Artbildung“30 nach dem „die räumliche Trennung von Populationen einen wirksamen Mechanismus darstellt, neue Spezies hervorzubringen“31, ist mittlerweile geradezu zusammengebrochen32 – ein „Dogma“ , mit der er wie eben beschrieben auch die Großmutationsthese zu entkräften suchte - aber welches vor allem bedeutete, die Vorstellung einer indirekten Beeinflussung der Evolutionsrichtung durch die „neugierigen“ Individuen einer Art, mittels individueller Lernfähigkeit und den daraus resultierenden neuen Verhaltensweisen um neue (Teil-)Umwelten zu besetzen, - etwas was lange Zeit als wichtiger Beitrag zur Spezifikation angesehen wurde -, aufgeben zu müssen. Die Basis dieser Überlegungen bildete die These, dass solche rein lokalen Vorgänge innerhalb einer Gesamtpopulation populationsgenetisch keine Chance hätten, sich durchzusetzen - ein Dogma überdies, welches so vehement vertreten wurde, dass es andere Evolutionsbiologen sogar dazu brachte, davon „abweichende Forschungsergebnisse aktiv zu unterdrücken“33/34
Und ebenso lag Ernst Mayr in einem weiteren Punkt mehr als nur daneben:
„In der Geschichte der Evolutionsbiologie kennt man zahlreiche Fälle, in denen theoretische Vorstellungen einer Überprüfung letztendlich nicht standhielten. Eine solche widerlegte Theorie…ist die Vererbung erworbener Eigenschaften.“35
Diese recht eindeutige Aussage verblüfft gleich mehrfach: Schon 1965 konnte man in Walter Max Zimmermanns „Standardwerk“ zum Stand der Forschung über die Vererbung erworbener Eigenschaften die Schilderung eines erfolgreichen Vererbungsexperiments bei Raupen der Motte Gracilaria stigmatella finden. Deren Raupen pflegen das Blatt, auf dem sie sitzen, von der Spitze her einzurollen, um es derart geschützt, allmählich fressen zu können.36 Nun wurde die Spitze des Blattes „abgeschnitten“ und die Raupen änderten notgedrungen ihr vererbtes Verhalten(!) und rollten es von der Seite her ein. Als man nun die Nachkommen der erwachsen gewordenen Motten wieder auf ganz normale Blätter mit Spitze setzte, rollten selbst in der dritten Generation noch 20% davon das Blatt weiterhin von der Seite ein.
Es handelt sich bei Herrn Zimmermann keineswegs um einen jener Wissenschaftler, die sich „nach dem Lamarckismus sehnen“37, sondern seine Einschätzung in Hinsicht auf den Nachweis einer Vererbung erworbener Eigenschaften war sehr zurückhaltend:“Wenn wir also nur über die Möglichkeit einer somatischen Induktion (=Vererbung erworbener Eigenschaften) diskutieren, müssen wir ja sagen.“38 Und außerdem: Wenn Zimmermann in seinem Buch 1969 ein Experiment aufführt, welches 1933 veröffentlicht wurde, lagen mehr als 30 Jahre dazwischen, Zeit genug, um eventuelle Fehler beim Experiment aufzuspüren, insbesondere wenn man bedenkt, dass Zimmermann damit nicht mehr und nicht weniger als die aktualisierte Neufassung seines Ende der 1920er Jahre erstmals erschienenen Buches vorlegte.
Aber natürlich: Jedes Experiment zur Vererbung erworbener Eigenschaften kann ja Herr Mayr vielleicht nicht kennen, doch: 1990 und 1991 wurden in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „New Scientist“ zwei Artikel veröffentlicht, die sich mit der erstaunlichen Anpassungsfähigkeit von Bakterien an ihre Umwelt beschäftigten und zum Ausdruck brachten, es könne sein, dass Lamarcks Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften diese enormen Fähigkeiten am besten erklären könnte.39
Nun gibt es scheinbar gute Gründe, warum Ernst Mayr Indizien und Experimente, die für eine Vererbung erworbener Eigenschaften sprachen, einfach ignorierte, denn seit Beginn des 20.Jahrunderts galt es bewiesen, dass eine Vererbung erworbener Eigenschaften unmöglich sei und also wissenschaftlich “erledigt“ wäre! Der Biologe August Weismann (1834-1914) postulierte nicht nur eineindeutig, dass Veränderungen durch Umwelteinflüsse keinerlei Auswirkungen auf die folgende Generation haben könnten, weil es unmöglich wäre, dass Umwelteinflüsse das Genom der Keimzellen erreichen und verändern könnten.40 Darüberhinaus hatte August Weismann sicherheitshalber diese These auch durch ein eigenes Experiment untermauert: Er amputierte neugeborenen Ratten die Schwänze, Genration für Generation und konnte schließlich feststellen, dass sich dadurch letztendlich keine erblich gewordene Verringerung der durchschnittlichen Schwanzlänge ergab. Und somit schien ein für alle Mal klar nachgewiesen zu sein, wie es der Wissenschaftspublizist Hoimar von Ditfurth noch 1981 ausdrückte, dass das „Genom…unbelehrbar, unfähig (ist) aus der Umwelt Informationen zu beziehen ...“41
Wie das Zitat belegt, war diese Einschätzung eine sehr „hartnäckige Doktrin“.42
Kurzum: Die Vererbung erworbener Eigenschaften schien in Theorie und Praxis wissenschaftlich widerlegt, und demzufolge leider unmöglich zu sein. Warum also sollte sich ein Wissenschaftler mit einer solchen Theorie beschäftigen - reine Zeitverschwendung! Aber irgendwie sprach schon 1981, also gut ein Jahrzehnt vor den zwei erwähnten Aufsätzen im „New Scientist“43 dann auch folgende kleine „Information“ gegen diese Schlussfolgerung:
„An dieser Stelle sei auf eine wesentliche Eigenschaft der Ratten hingewiesen. Wenn also z.B. bestimmte Futterstücke von Ratten nicht angenommen werden, so darf man sicher sein, dass das auch deren Nachfahren nicht tun, und zwar nicht, weil die Eltern ihnen das beigebracht hätten, sondern allein aus dem Grund, weil die Jungen jenes Wissen sozusagen mit der Muttermilch eingesogen haben. Versuche beweisen dies in nachdrücklichster Form.“ 44
Zumindest Professor Hapke, seinerzeit beim Institut für Pharmakologie und Toxikologie bei der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, störte sich nicht an wissenschaftlichen Unmöglichkeiten, als er erneut 1992 in diesem Zusammenhang ebenfalls betonte:“ Ratten (sind) imstande, Informationen genetisch und molekular an die nächste Generation weiterzugeben.“45
Auch entging folgendes „natürliches“ Experiment den „wachsamen Augen“ von Ernst Mayr: Im Herbst 1961, nach den Aufzeichnungen britischer Ornithologen, verließen einige Mönchsgrasmücken – so der Name dieser Zugvögel - ihren normalen Südkurs auf dem Weg nach Afrika und bogen nach Nordwesten ab, so dass sie den südlichsten Zipfel Englands erreichten. Dort gefiel ihnen offensichtlich das relativ milde Klima, sowie das zusätzliche Nahrungsangebot durch fütternde Vogelfreunde, und einige von ihnen verzichteten daraufhin auf ihren normalen Weiterflug nach Afrika. So entstand eine kleine Winterkolonie von Mönchsgrasmücken, die Jahr für Jahr sogar noch anwuchs. Wie aber konnte das sein? Denn selbst wenn die kleine Flugabweichung erblich sein sollte, müsste sich, da der absolute Großteil der Mönchsgrasmücken eben einen anderen genetisch vorprogrammierten Kurs besitzt, der neue Kurs eigentlich allmählich, populationsgenetisch gesehen, verlieren. Allerdings stellte sich heraus: Die Englandzieher unter den Mönchsgrasmücken waren einfach die ersten in ihrem Sommerquartier und paarten sich dort dann demzufolge zunächst unter „ihresgleichen“.
Der Zoologe Peter Berthold war es, der dann nachweisen konnte, dass dieser Kurzstreckenflug nach England tatsächlich genetisch „fixiert“ war und daraus folgt:“ Bei den Mönchsgrasmücken ist innerhalb weniger Generationen eine Mikroevolution abgelaufen, die nach Lehrmeinung Jahrhunderte hätte dauern müssen.“46
In der angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift „Nature“ kamen die Forscher der Vogelwarte Radolfzell und der Universität Heidelberg zu dem Resümee:
„…es handelt sich um den ersten Fall, dass bei einem Wirbeltier ein erst kürzlich erfolgter, dramatischer evolutionärer Verhaltensumschwung dokumentiert und dessen genetische Verankerung nachgewiesen werden konnte.“47