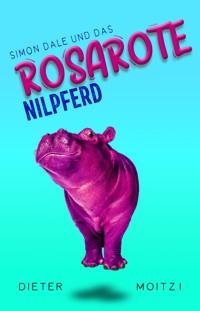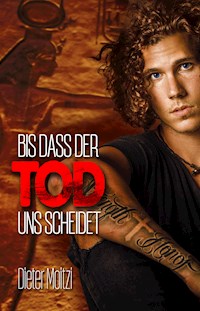
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kommen Sie an Bord der „Queen of Egypt“ – mit diesem neuen Krimi voller Peps und gefühlvollen Momente! Der junge Pariser Barmann Raphaël Poireaut ist nur mäßig erfreut, als seine Tante Agathe ihn einlädt, mit ihr nach Ägypten zu fahren, um im Rahmen einer Nilkreuzfahrt die antiken Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Mit alten Knackern alte Steine besichtigen – Danke, echt ein Supergeschenk. Es überrascht ihn daher gar nicht, dass die Reise denkbar schlecht anhebt. Zuerst begegnet Raphaël einem kühlen, arroganten Italiener, dann stößt er in einer Schiffskabine auf einen erstochenen Touristen. Der Venezianer Stefano di Angeli hat sich von seiner besten Freundin Grazia zu einer Ägyptenreise überreden lassen. Nach sechs Jahren endlich wieder einmal Urlaub. Aber die erste Person, der er begegnet, ist ein Franzose mit blonden Locken und Engelsgesicht, und dieser Junge rührt lang verdrängte, schmerzhafte Erinnerungen wieder auf. Noch dazu beginnt Stefanos Nilkreuzfahrt mit der Entdeckung eines Mordopfers an Bord. Cazzo – sein Schicksal meint es offenbar schlecht mit ihm! Während die ägyptische Polizei unter der Leitung von Oberst Al-Qaïb auf dem Schiff ermittelt, haben Raphaël und Stefano das Gefühl, nicht nur von den Ereignissen überrollt zu werden… sondern auch von den Gefühlen, die unweigerlich in beiden aufkeimen. Wird es ihnen gelingen, die Spreu vom Weizen zu trennen und den Mörder zu finden? Wie lange werden sie sich der Anziehungskraft widersetzen können, die sie aufeinander ausüben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kapitel 1
RAPHAËL
KURZE BESTANDSAUFNAHME. PUNKT EINS: ICH bin am Leben, was bedeutet, dass das Flugzeug nicht abgestürzt ist. Schon mal positiv. Punkt zwei: ich bin total geschlaucht. Weniger positiv, aber mit der Uhrzeit hat das wenig zu tun – die ist nämlich einigermaßen normal. Ich geh selten früher schlafen.
Punkt drei: das Bett. Wartet mal, ich probier aus, ob die Matratze gut gefedert ist. Okay; nicht schlecht. Hart, ohne gleich wie Stahlbeton zu sein, und das Bett ist nicht allzu scheußlich, trotz seines, äh, sagen wir mal: undefinierbaren Stils. Ein bisschen abgenutzt und alt halt, wie der Rest des Schiffs.
Ach ja. Knüller. Ich bin nicht bei mir zuhause, in meinem Bett. Nein, ich bin auf einem Schiff. Der Queen of Egypt, um genau zu sein. ENDLICH!, möchte ich fast sagen. Seit Wochen redet Tantchen von nichts anderem. Queen of Egypt morgens, mittags und abends; hing mir schon zum Hals raus. Wenn Tantchen was im Kopf hat, erinnert sie mich immer an eine zerkratzte Schallplatte. Sie dreht sich, Hopp, springt zurück; dreht sich, Hopp, springt zurück. Man würde am liebsten mit dem Kopf gegen eine Wand rennen.
Also. Im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung.
Bin am Leben, in Ferien, und lieg in einem bequemen Bett. Mein Körper wimmert: »Heia!« Ein Nickerchen wär tatsächlich keine schlechte Idee, so ein Stündchen oder zwei. Immerhin ist es grad mal vier Uhr morgens, Himmelherrgott.
Aber meine grauen Zellen müssen im Standby-Modus sein, weil mein Hirn nichts davon wissen will. Es wandert sich lieber in wirren Gedankengängen und unzusammenhängenden Erinnerungen herum, ein bisschen aufs Geratewohl. Sogar Jordan taucht kurz auf. Ganz kurz, weil ich mich sofort beeile, ihn wieder zu verscheuchen.
Ihr seht aber, wie kaputt ich bin. Weil Jordan! Echt!
ZWEI STUNDEN SPÄTER BIN ICH’S leid und steh auf. Wenn der Schlaf mich nicht beehren will, will er halt nicht.
Ich zieh die dicken Vorhänge auf. Die ersten Sonnenstrahlen betasten zaghaft das Land, als ob sie überprüfen wollten, ob der Morgen schon reif ist. Der große, leere Parkplatz unter meinem Fenster liegt noch im Halbschatten. Ein einsamer Mann in schwarzen Hosen und weißem Hemd raucht auf der Gangway eine Zigarette. Hinter ihm erblicke ich das schräg aufsteigende, mit verdorrtem Gras bewachsene Ufer. Weiter oben verbergen Palmen und Bougainvillea die Straße, auf der wir hierhergetuckert sind.
Mürrisch spring ich unter die Dusche. Ich bin kein Morgenmensch. Absolut nicht. Ich bin auch kein Schiffsmensch.
Danach zieh ich mich an. Shorts, ein Hawaiihemd, Flip-Flops.
Ich versuche, mit den Fingern meine Locken zu zähmen. Vergebene Liebesmüh, eh klar; die machen nie, was ich will. Ich zieh sie schließlich in einem Dutt auf dem Hinterkopf zusammen. Da habt ihr’s, soll euch eine Lehre sein. Bevor ich aufbreche, schnapp ich mir noch meine Sachen – Sonnenbrille, Handy, Block und Bleistift.
Ich verlasse meine Kabine und versetz mich in den Betriebsmodus »Entdecker & Forscher«. Irgendwie komm ich mir vor wie ein Junge an seinem ersten Ferientag in Hintertupfing. Kein Wunder – weil Ferien. Und weil Hintertupfing. Für mich jedenfalls. Mit alten Knackern herumfahren und alte Steine bestaunen, vielen Dank, sehr lieb, tolles Geschenk. Und obwohl mein Reisepass das Gegenteil behauptet, hab ich nicht den Eindruck, das Prädikat »erwachsen« zu verdienen. Zumindest nicht oft.
Der dicke, rote Teppich im Flur dämpft meine Schritte. Ein paar wie Kerzenhalter geformte Wandleuchten spenden fahles Licht.
Knapp vor der großen Treppe, über die man auf die anderen Decks gelangt, stoß ich auf eine Schwingtür. Sie führt zum Amun-Re Sonnendeck hinauf. Dem Oberdeck mit dem irrsinnig originellen Namen.
Ich schieb die Tür auf. Und BÄNG! Die Hitze! Ja du lieber Josef, ist das heiß hier! Das hat mir grade noch gefehlt. Natürlich kann man sich hierzulande mitten im Juni nichts anderes erwarten. Aber das Schiff ist dermaßen überklimatisiert, dass ich dieses Detail vergessen hab.
Vor mir führt eine schmale Wendeltreppe nach oben. Ich öffne rasch alle Knöpfe meines Hemds, bevor ich mich an den Aufstieg mach.
Das Oberdeck ist leer. Erleichterung. Die alten Knacker bleiben mir fürs Erste erspart. Vögel zwitschern halbherzig von den Bäumen am Ufer zu mir herüber, der Fluss klatscht sachte gegen die Schiffswand. Auf der anderen Seite des Decks seh ich einen noch in geheimnisvolle Schatten gehüllten Tresen. Rechts von mir schlummern Tische und Sessel, links Liegestühle in vier langen Reihen. Auf beiden Seiten sind Sonnenplanen über das Deck gespannt.
Selbstverständlich bleib ich nicht lang allein. Das wär ja auch viel zu schön. Ich genieße noch die Stille, als ich hinter mir ein Geräusch vernehme. Ich dreh mich um.
Am Fuß der Treppe steht ein Mann so um die dreißig. Er ist mager, fast schon ausgezehrt, und trägt einen Trainingsanzug. Einen rosafarbenen, bitte. Chic, die Farbe – rosa wird viel zu oft und unverdienterweise verschmäht. Der Mann schaut zu mir hoch. Sein Gesicht erinnert mich an eine kleine Maus: ein bisschen grau, ein bisschen ängstlich, ein bisschen schnüffelnd. Seine dünnen Haare fallen ihm lustlos wie weich gekochte Fadennudeln auf die Schultern.
Wir blicken uns kurz gegenseitig an, ich von oben, er von unten. Schließlich lächeln wir – die Höflichkeit verlangt so was –, und der Mann kommt die Stufen herauf.
Ich hab keine Lust, die dem Anlass entsprechenden Floskeln auszutauschen, also haste ich zur Reling auf der anderen Seite des Decks hinüber.
Und endlich entdecke ich die Aussicht.
Ja heiliger Bimbam!
Ich muss zugeben, es ist wie eine Ohrfeige. Weil vor mir, rechts von mir, links von mir: der Nil.
Bitteschön! Der NIL, verdammt noch mal.
Sein Kobaltblau erstreckt sich bis zum gegenüberliegenden Ufer und fließt in einer kaum wahrnehmbaren Bewegung träge zum weit entfernten Meer. Die aufgehende Sonne färbt das Wasser orange-gelb und verleiht den niedrigen Lehmhäusern entlang des Flusses gestochen scharfe Formen. Sie sehen wie rechteckige Schachteln aus, die hier und da zwei- bis dreistöckig aufeinandergestapelt sind. Schatten zeichnen lange, abgezirkelte Muster auf die Mauern. Mittendrin stechen weiße und gelbe Gebäude aus dem Schachtelhaufen hervor: Moscheen. Die dünnen Minarette, die hoch über den Rest hinausragen, weisen stolz zum Himmel empor. Ein paar Bäume und Palmen heitern das bräunliche Labyrinth mit verstaubtem Grün auf. Hinter der Stadt wabert Morgendunst um eine unwirtliche, steinig-wüstenhafte Bergkette, die der ganzen Landschaft ein noch unwirklicheres Aussehen verleiht.
Ich lass mich in einen Sessel fallen und atme tief durch, nun doch ein wenig aufgerüttelt.
Das ist Ägypten. Ägypten, hier, vor meinen Augen.
Unglaublich. Ich hab Dokumentarsendungen und Fotos gesehen; ich war sogar schon mal in Marokko und Tunesien. Aber das ist nichts verglichen mit dem, was ich hier seh – und was ich hier seh, gleicht einem Traum aus Tausendundeiner Nacht.
Dabei war meine Freude eine enden wollende, als Tantchen ankündigte: »Rat mal, wo wir im Juni hinfahren? Nach Ägypten!« Anstatt zu antworten: »Danke, Tantchen, du bist das liebste Tantchen der Welt«, war ich stinksauer, ich undankbarer Idiot. Stinksauer war ich übrigens – ganz diskret, versteht sich – bis vor knapp einer Minute. Gott sei Dank braucht es mehr, um mein Tantchen zu beeindrucken.
Ich seufze wohlig auf. Der Fluss fließt langsam von links nach rechts, silbern spiegelt die Wasseroberfläche den Himmel wider. Zwei alte Männer mit Turban auf dem Kopf und zerfurchten Gesichtern gleiten in der Ferne an mir vorüber. Ein Fischnetz hängt hinten an ihrem Boot. Ihre schmutzigweißen Dschallabijas flattern in der leichten Morgenbrise.
Sie winken mir zu und lachen natürlich und freundlich wie Leute, die nichts besitzen und trotzdem glücklich sind.
ICH BLEIB EIN WEILCHEN AUF meinem Sessel sitzen, während der junge Morgen erblüht. Mein Blick schweift über die Landschaft. Ich fühl mich verzückt und gleichzeitig erwartungsvoll, wie ein Forschungsreisender von Anno dazumal, der sich fragt, welche Abenteuer ihm in den nächsten Tagen bevorstehen.
Als ich endlich meinen Blick von der Aussicht losreiße, seh ich den Mann im rosa Trainingsanzug am Heck herumfotografieren.
Ich zieh ebenfalls mein Handy aus der Hosentasche und lichte das Panorama ab. Den legendären Fluss und die Fischer. Die vor und hinter meinem Schiff vor Anker liegenden Kreuzfahrtschiffe. Das Ufer gegenüber. Die Berge. Den blassblauen Himmel.
Dann zücke ich Block und Bleistift. Ich fülle drei Seiten mit meinen schnellen, präzisen Zeichnungen. Meine Skizzen bleiben wie immer fragmentarisch, aber mir scheint, ich hab das Wesentliche festgehalten.
Nachdem ich wieder alles in den Hosentaschen meiner Shorts verstaut hab, steh ich auf. Das rosarote Mausmännchen hängt noch immer am Heck herum. Ich wende mich also dem Bug zu. Der ist um die Uhrzeit sicher leer.
Weit gefehlt. Ich bin echt ein Glückskind. Als ich näherkomme, seh ich sofort, dass dort ein junger Mann an der Reling steht.
Wo kommt der denn her? Hat er hier übernachtet, oder was?
Ich lass meinen Blick über seine schwarzen Haare schweifen, hinten und seitlich kurz geschnitten, oben aber länger, so ein Hipster-Haarschnitt halt. Unter seinem weißen T-Shirt zeichnen sich stattliche Muskeln ab. Seine Shorts entblößen wohlgeformte, sonnengebräunte Beine, deren Haare in der Morgensonne wie feine Goldfädchen aussehen.
Wenigstens ein netter Anblick. Von hinten jedenfalls.
Der junge Mann hört mich auf leisen Sohlen näherkommen oder spürt meinen Blick. Er dreht sich um.
Ja, hallöchen, du! Mein Herz macht einen Rückwärtssalto. Schöne Jungs sehe ich in meiner Arbeit haufenweise. Aber der hier gehört zu einer gehobeneren Kategorie. Er hat ein Gesicht wie ein Model, ohne Übertreibung. Wie so ein Typ, den man in »Vogue Homme« oder »GQ« anhimmelt. Kantiges Kinn, Römernase, perfekt getrimmter Dreitagebart. Die Stirn liegt frei, die dichten, nach hinten gekämmten Haare fallen in einer nachlässigen Welle hinters Ohr, als ob sie das freiwillig täten.
Leider teilt der Kerl meine sofortige Freude nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, er reagiert, als ob ein Monster vor ihm stünde. Gott sei Dank hindert ihn die Reling daran zurückzuweichen, sonst wär er schon in den Nil geplumpst.
Das tut dem Selbstwertgefühl gut.
Der Schönling fängt sich im letzten Moment wieder und mustert mich von Kopf bis Fuß. Sein kalter Blick bleibt an meinem nackten Oberkörper hängen, die dicken, aber perfekt geformten Augenbrauen ziehen sich zusammen. Mir fällt auf, dass seine Körpersprache insgesamt Distanz und kaum verhohlene Ablehnung ausstrahlt.
Trotz der sichtbaren Feindseligkeit murmle ich: »Guten Tag.« Vielleicht ein bisschen unterkühlt, aber immerhin. So bin ich erzogen worden. Natürlich füg ich in meinem Kopf »Arschloch!« hinzu, weil Hallo.
Der junge Mann nickt mir zu. Eine schwarze Haarsträhne fällt ihm über die Augen, er streicht sie nach hinten zurück. Er zögert kurz, zumindest kommt es mir so vor; dann dreht er mir wieder den Rücken zu.
Okay, Arschloch. Schmoll ruhig weiter, ist mir völlig egal. Ich brauch keine Männers, auch wenn sie noch so schön sind.
EINE HALBE STUNDE SPÄTER HAT die Sonne ihren Lauf über den wolkenlosen Himmel in Angriff genommen; die Temperatur steigt. Der Hipster-Schrägstrich-Arsch schmollt noch immer in seiner Ecke, als ich mich auf einen schattigen Liegestuhl zurückziehe. Unsere Begegnung war nicht unbedingt von der angenehmen Art, aber wenigstens strafen er und der Kerl in Rosa meine anfängliche Prognose Lügen, was auch was wert ist. Wir sind zumindest drei auf diesem Schiff, die von unten her auf die Sechzig zugehen.
Mit dem Handrücken wisch ich den Schweiß weg, der über meinen Oberkörper rinnt und meine Brusthaare befeuchtet. Ich muss zugeben, ich bin durstig. Vorhin hab ich in der Kabine eine Flasche Wasser in den Kühlschrank gestellt. Wisst ihr was? Die geh ich jetzt holen. Man muss ja immer aufpassen und sich mit ausreichend Flüssigkeit versorgen, wie Tantchen sagen würde. Gut, sie meint damit alkoholische Getränke, aber ihre Aussage bleibt trotzdem weise und wahr.
Der Mann in Rosa hat sich anscheinend auch satt gesehen. Als ich die Wendeltreppe erreiche, steht er schon auf der letzten Stufe unten.
Er wartet auf mich und hält mir die Schwingtür auf.
»Danke«, sag ich höflich.
»Schön, nicht wahr?« bemerkt er freundlich.
Ich schau ihn überrascht an. Seine Stimme hat ein schönes, tiefes Timbre und passt eigentlich überhaupt nicht zu seinem schmächtigen Äußeren und seinem kleinen Mäuschenkopf. Er wedelt affektiert in der Luft herum. »Ich meine die Landschaft und das Morgenlicht.«
Automatisch denk ich: Aha. Eine Schwester. »Sehr schön, ja«, sag ich. »Luxor ist eine Wohltat für die Haut.«
Er gluckst erheitert.
Wir betreten den Gang. Irgendwo fällt leise eine Tür ins Schloss. In der Kabine gegenüber der Schwingtür sind die Insassen auch schon auf. Ich hör, wie eine Frau sagt: »… ich glaub, er hat’s verstanden. Der belästigt dich nicht mehr, Spatzi.«
Spatzi! Grins. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass jemand »Spatzi« zu mir sagt.
Aus den anderen Kabinen dringen ebenfalls Gespräche, kaum lauter als Gemurmel in den Gang heraus; man hört Duschen rauschen. Das Schiff wacht langsam auf. Ein angenehmer Geruch hängt im Korridor, so ein holzig-ledriges Männerparfüm, das mir bekannt vorkommt. Das rosa Mäuschen muss einen ganzen Flakon versprüht haben.
Der junge Mann bleibt vor einer Tür stehen. »Bis später beim Frühstück«, meint er entspannt.
»Bis später«, antworte ich. Als ich an ihm vorbeigehe, steigt mir ein starker, frischer Geruch nach Zitrusfrüchten in die Nase. Aha. Das ledrige Parfum ist also doch nicht seins…
Er dreht den Schlüssel im Schloss herum. »Mein Chéri – bist du munter?«, fragt er, bevor er eintritt. Die Tür fällt leise zu.
Ich hab mich nicht getäuscht. Mein Chéri, nicht meine Chérie. Er ist eine Schwester, ich bin also nicht der einzige Schwule an Bord.
Ich leg die letzten Meter bis zu meiner Kabine zurück und fummle in den Taschen meiner Shorts herum. Handy… Bleistift… Block… Hallo? Wo hab ich bloß den Schlüssel hingetan? Hab ich ihn überhaupt mitgenommen? Scheiße – hoffentlich hab ich mich nicht ausgesperrt…!
Und da –
Auf einmal –
EIN SCHREI, DER MIR DURCH Mark und Bein geht. »AAAAAAAAAAHHHHHHH !«
Ich zucke zusammen, fahr herum, stier den leeren Gang an. Was war das? Wer war das? Wo war das? Was soll ich tun?
»MEIN GOTT! MICHEL!«
Michel?
Eine böse Vorahnung verkrampft mir die Eingeweide.
Die Tür des Mäuschens springt auf. Das Mäuschen höchstpersönlich schießt aus der Kabine wie von einem Skorpion gestochen. Mit hervorstehenden Augen stammelt er: »Michel… Oh mein Gott… Hilfe…«
Meine Beine reagieren spontan, ich lauf zu ihm rüber.
Der Schrei muss alle unsere Kabinennachbarn aufgeschreckt haben, denn die Türen gehen eine nach der anderen auf, als ich an ihnen vorbeilaufe.
Tantchen in der Kabine neben meiner ist die erste, die ihren Kopf in den Gang steckt. Sie trägt ein kakifarbenes Kleid und ihre alten, marokkanischen Hausschuhe. Der Schlafmangel lässt sie ein wenig zerknittert aussehen. »Raph? Was soll denn der Rummel?«, fragt sie.
»Keine Ahnung, Tantchen«, werf ich ihr zu, ohne stehenzubleiben.
»Ja was…?« Sie zögert, dann läuft sie mir hinterher.
Drei Ägypter in braunen Uniformen kommen von der Haupttreppe dahergerannt. Zwei weitere Angestellte in weißen Hemden und schwarzen Hosen tauchen hinter ihnen auf.
Ich erreiche den Mann in Rosa als erster. Der Arme hat sich vor der offenen Tür auf den roten Teppich sinken lassen. Er hat die Hände vor den Kopf geschlagen und wimmert: »Michel… Ach Michel…«
»Gestatten?«, sag ich, bevor ich über ihn drübersteige. Keine Zeit für Feinheiten. Gefolgt von Tantchen stürm ich in die Kabine.
Gott sei Dank ist sie da, meine Tante, muss ich sagen. Ohne sie hätt ich sicher die Krise bekommen. So eine, wo man sich am Boden wälzt, schreit, die Augen aufreißt und sich die Haare rauft.
Grund dafür hätte ich genug. Okay, auf den ersten Blick schaut die Kabine aus wie meine. Bis auf drei Details. Erstens hat hier jemand die beiden Einzelbetten, die in meiner Kabine getrennt sind, zu einem Doppelbett zusammengeschoben. Zweitens könnte man glauben, die Kabine sei im Gegensatz zu meiner mit ihren banalen Farben von Jackson Pollock umdekoriert worden. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Rote Spritzer verzieren die Oberflächen vom Boden bis zur Decke in wilden Klecksern und Rinnsalen.
Zu guter aller Letzt der dritte Unterschied. Der wichtigste, das Detail, das dich sicher macht. Auf dem rechten Bett entdeck ich den berühmten Michel, einen dicken, glatzköpfigen, ungefähr sechzigjährigen Mann im Pyjama. Er liegt auf dem Bauch und scheint noch friedlich zu schlummern.
Mir fällt aber sofort auf, dass Michel keineswegs friedlich schlummert. Ihr könnt mir das jetzt glauben oder auch nicht, aber er ist der Grund für die roten Spritzer. Er liegt in einer Blutlache, die langsam in Bettwäsche und Matratze versickert.
Die Erklärung muss ich auch nicht lange suchen.
Denn in seinem Rücken steckt genau über dem Herzen…
Ein großes Messer.
Kapitel 2
STEFANO
ER HAT DEN EINDRUCK, IN einem Tagtraum zu leben und alles wie durch einen Schleier zu sehen. Wirklich sehen tut er natürlich nicht viel; er kann nur erraten, was ihn umgibt. Die Nacht hüllt alles in tiefstes Schwarz, in den verschiedensten Nuancen. Den Fluss: grafitschwarz. Den mondlosen Himmel: tiefschwarz, mit ein paar blassen Sternen, die unheimlich pulsieren, als ob sie lebendig wären. Und gegenüber einen Landstreifen zwischen verkehrsschwarz und schwarzbraun: das Ufer.
Dann wird alles nach und nach schwarzgrau. Ein einheitliches Schwarzgrau, das sich langsam in Anthrazitgrau verwandelt. Die ersten Farben kommen zum Vorschein, immer noch in Grautönen: granitgrau, grafitgrau, umbragrau. Die ersten Formen bilden sich heraus, Blöcke, Türmchen, Palmen. Wärmere Schattierungen folgen nach, ocker, gelb, beige, mit ein paar Grüntupfern.
Diese Farben begleiten die aufgehende Sonne und wärmen ihn auf, innen wie außen. Stefano ist von Kindheit an für Farben empfänglich gewesen.
Aber er fühlt sich immer noch müde. Müde und melancholisch.
Che cazzo sono!, denkt er. Was bin ich doch für ein Idiot! Ich bin im Urlaub! Der erste Urlaub seit… seit Guido. Und Guido, das war vor sechs Jahren.
Seit sechs Jahren hat Stefano immer nur gearbeitet. Für die Firma. Für die Familie. Sechs Jahre Arbeit ohne Unterbrechung, um zu vergessen. Diese sechs Jahre haben ihn gelehrt, wie sehr unablässiges Arbeiten Wunden desinfiziert, den Geist betäubt, die Schmerzen lindert. Sie haben ihn auch gelehrt, wie müde man wird, wenn man durchgehend arbeitet. Diesen Urlaub hat er sich wirklich verdient.
Warum fühlt er sich dann so unrund, so einsam, so fehl am Platz?
Er steht eigentlich auch bloß wegen Grazia hier am Schiffsbug. Als sie ihre Kabine betreten haben, hat sie einen Blick auf sein Gesicht geworfen und sofort losgeschimpft: »He, wenn du vorhast, die ganze Zeit Trübsal zu blasen, können wir uns einen erholsamen Urlaub in die Haare schmieren! Weißt du was? Du gehst dich jetzt ablenken und kommst zurück, wenn du wieder weißt, wie man lächelt. Avanti, stronzo!«
Mit diesen Worten hat sie ihn rausgeworfen.
Sie hat natürlich recht. Aber porca miseria – manchmal fehlt es ihr an Einfühlsamkeit. Manchmal ist sie wirklich brutal.
DANN HOLT IHN DIE WIRKLICHKEIT ein, wie üblich. Anfangs fällt Stefano gar nicht auf, dass jemand hinter ihm steht. Aber irgendwann spürt er ein Prickeln zwischen den Schultern, als ob jemand versuchen würde, den Baumwollstoff seines T-Shirts mit seinen Blicken zu durchbohren.
Unwillig dreht er sich um. Und –
Wie bitte…
Was ist das denn?
Dio mio!
Beinahe wäre er über Bord gesprungen.
Ein Gespenst! Es gibt kein anderes Wort dafür. Ein Gespenst, das hier auftaucht wie eine persönliche Heimsuchung.
Er erkennt das Gespenst auch sofort wieder. Die blonden Locken, die am Hinterkopf zu einem Dutt zusammengedreht sind. Die schmale, aber stattliche Figur, die einer Renaissancestatue ähnelt. Das verführerische Engelsgesicht, die ungreifbare Schönheit. Das unentschlossene Lächeln.
Moment… Ein Detail passt nicht zu seinen Erinnerungen: die Offenheit, mit der das Gespenst ihn von Kopf bis Fuß mustert.
Stefano begreift schließlich doch noch, dass der Bursche, der ihn so arglos und neugierig anstarrt, nicht ist… nicht sein kann…
Natürlich nicht. Natürlich nicht Guido. Nie wieder Guido.
Je länger Stefano den Störenfried anglotzt, desto mehr fallen ihm die Unterschiede auf. Das Gesicht entpuppt sich als schärfer geschnitten, weniger feinknochig; der Ausdruck ist offener, zumindest anfänglich. Die auf ihn gerichteten Augen, die zuerst Verwunderung, dann Ablehnung ausdrücken, sind blau, nicht stahlgrau. Die Oberlippe sieht dicker aus und verleiht der Mundpartie mehr Sinnlichkeit und zugleich Unschuld. Ja, und der Oberkörper ist natürlich viel behaarter. Übrigens sehr ansprechend, die Behaarung. Selbst der Körper wirkt anders, kompakter, muskulöser. Die Unterarme sind tätowiert, ein paar Lederriemen winden sich um das rechte Handgelenk.
Der Junge vor ihm zieht die Augenbrauen hoch.
Das zwingt ihn endlich zu einer Reaktion. Stefano will sich schon entschuldigen – sein Verhalten ist wirklich unhöflich –, aber leider fällt ihm auf Anhieb nichts Passendes ein.
Der Blonde sagt frostig: »Bonjour«.
Stefano antwortet mit einem Kopfnicken, bevor er sich wieder abwendet. Schade. Ein wenig plaudern wäre nett gewesen, allein schon, um die alten Gespenster endgültig zu verjagen. Wirklich schade. Außerdem wird ihn der Typ jetzt für einen Rüpel halten.
Na ja, sei’s drum. Das wird sich später schon noch richten lassen.
Er betrachtet erneut den Nil. Wenn das Leben bloß auch so friedlich dahinfließen könnte, denkt er. Das wäre irrsinnig fein.
NACH GERAUMER ZEIT BEGIBT SICH Stefano wieder zurück hinunter aufs Tutenchamun Deck. Vielleicht sollte er Grazia aufwecken. Nicht dass ihm nach Lächeln zumute wäre, aber langsam wird es spät.
Er betritt den Gang und sieht, dass er momentan seine Kabine nur schwer erreichen wird können. Seine Nachbarn drängeln sich alle vor einer offenen Tür. Leises Gemurmel und Getuschel erfüllt den Gang. In der Menge entdeckt er auch ein paar ägyptische Schiffsangestellte.
Was ist denn los? Was soll der Auflauf?, fragt Stefano sich. Warum stieren die denn alle auf die Tür, als ob… Santa Madonna! Das Blut stockt ihm in den Adern. Ist was passiert? Grazia! Er fühlt Panik aufkommen. Hat sie einen Unfall gehabt?
Ah. Nein. Seine Kabine liegt auf der anderen Seite des Ganges. Erleichtert schließt er sich der Gruppe an und stellt sich auf die Zehenspitzen, um zu sehen, was los ist. Unwillkürlich fühlt er Neugierde aufsteigen.
Zwei Personen treten schließlich durch die Tür, die alle so fasziniert beobachten. Sie wirken angeschlagen, als hätten sie gerade eine Horrorszene miterlebt. Eine der beiden Personen ist eine kleine, mollige Dame in einem enganliegenden, kakifarbenen Kleid und einem Paar ausgelatschter Lederhausschuhe. Eine gutaussehende Frau mit sanften, harmlosen Zügen, auch wenn man hinter der ernsten Miene eine entschlossene Persönlichkeit erahnen kann.
Hinter ihr erkennt Stefano – den jungen, blonden Mann wieder. Den falschen Guido mit den Engelslocken und dem Engelsgesicht.
Schau mal einer an! Ihm ist nicht einmal aufgefallen, dass der Junge das Oberdeck verlassen hat! Im Gegenlicht formen ein paar aus dem Dutt gerutschte Locken einen Lichtkranz um das Gesicht des blonden Burschen, der im Gang ziemlich blass aussieht.
Die Dame hebt ihre Hand und sagt mit kräftiger Stimme: »Macht Platz, macht Platz! In der Kabine liegt ein Toter, also bleibt, wo ihr seid. Die Spuren müssen noch gesichert werden!«
Wie bitte? Was plappert sie da? Ein Toter? In der Kabine? Und was meint sie mit Spuren?
Instinktiv macht Stefano ein Kreuzzeichen.
Ein ägyptischer Angestellter, ein schwarzhaariger Junge mit glitzernden Augen, tritt vor. Er stammelt auf Englisch: »E-excuse me, Ma’am…«
Die Frau wirft einen Blick auf sein Namensschild, dann unterbricht sie ihn, ebenfalls auf Englisch. »Ach, Hassan. Sei so gut und lauf schnell zur Rezeption hinunter, mein Junge. Sag ihnen, sie sollen die Gangway absperren. Niemand darf das Schiff verlassen. Und dann holst du die Polizei, ja?«
»Aber…«
»Mach schon, Junge! Los, los, spute dich!« Sie wedelt mit der Hand vor seinem Gesicht herum, bis er im Laufschritt lostrabt.
»Und ihr«, sagt sie, während sie sich den anderen zuwendet. »Jetzt steht doch nicht wie angegossen hier herum. Geht in die Bar runter, wo sie uns heut Nacht die Häppchen und Getränke serviert haben.« Auf Englisch fügt sie an die Ägypter gewandt hinzu: »Und ihr, ihr holt bitte die restlichen Leute aus den Kabinen und bringt sie auch in die Bar.« Sie klingt wie ein General, der seinen Truppen den Tagesbefehl ausgibt.
Stefano fühlt sich ebenso deutlich wie unerfreulich an seinen Vater erinnert. Reflexartig murmelt er: »Für wen hält sich denn die? Glaubt sie, dass sie mir Anweisungen geben kann?«
Leider hat die Generalin, wie er die kleine, mollige Dame insgeheim nennt, ein gutes Gehör. Sie wirft Stefano einen vernichtenden Blick zu. Ihre halblangen, grau melierten Haare beben vor Entrüstung. »Ich geb überhaupt keine Anweisungen, ich schlag bloß vor, was jeder mit ein bisschen Hausverstand ohnehin tun würde. Die Polizei wird demnächst eintreffen. Um ihnen die Arbeit zu erleichtern, sollten wir uns alle an einem Ort versammeln. Da muss man kein Einstein sein, dass einem das einleuchtet, oder? Und jetzt – zack, zack, macht schon!« Sie fuchtelt mit der Hand durch die Luft, als wollte sie einen Schwarm Fliegen verjagen.
Ihre Willenskraft ist so stark, dass die Leute tatsächlich ohne Widerrede davonschlurfen. Sogar Stefano, weil er einsieht, dass die gute Frau recht hat.
Während er also Richtung Haupttreppe abzieht, fragt er sich, was Grazia wohl treibt. Im Gang hat er sie nicht gesehen, was ihn ein wenig wundert – die Leute haben eigentlich genug Lärm gemacht. Der hätte sie doch wecken sollen. Er ist so in diesen Gedanken vertieft, dass er zusammenzuckt, als er ihr plötzlich auf der Treppe gegenübersteht. Sie versucht gerade, sich gegen den Strom heraufzukämpfen.
Als sie ihren Freund erblickt, hält sie ihn am Oberarm zurück. »Stefano! Was macht ihr denn alle hier?«
»Anscheinend ist jemand gestorben. Du kannst momentan nicht rauf. Komm mit.«
Grazia zuckt die Schultern und folgt ihm. Typisch Grazia. Wenn sie auf ein Problem stößt, hat sie immer die Gabe, so zu reagieren: sie zuckt die Schultern und meint »vedremo«, schauen wir mal, oder »ogni giorno è abbastanza«, morgen ist auch noch ein Tag.
Stefano seufzt. »Wo kommst du denn her, cara?«
»Von der Rezeption.«
»Von der Rezeption?«
»Ja, wegen der WLAN-Geschichte.«
»Ich dachte, du brauchst kein WLAN.«
»Na ja, ich hab meine Meinung geändert.«
»Warum denn das?«
»Schau, als ich aufgewacht bin, warst du noch nicht zurück. Ich war eine ganze Stunde lang allein und von der Welt abgeschnitten. Komplett abgeschnitten, verstehst du?« Es schaudert sie. »Das hat sich angefühlt, als ob ich tot wäre. Che orrore!«
AUF DEM NEFERTITI DECK – DEM ersten Stock, wenn man so will – befindet sich die gleichnamige Bar. Die Nefertiti Bar. Sie nimmt die gesamte vordere Hälfte des Schiffs ein. Heute Nacht, nachdem man ihnen die Kabinenschlüssel ausgehändigt hat, hat man die Neuankömmlinge hier heraufgebracht und ihnen ein paar Kleinigkeiten zum Essen sowie ein erfrischendes Getränk aus Hibiskusblüten angeboten. »Karkadé« heißt das; Stefano hat einen Kellner danach gefragt. Solche Sachen weiß er halt gern.
Die Nefertiti Bar ist im Grunde nichts anderes als ein großer, lang gestreckter Saal mit einem Tresen rechts neben dem Eingang. Über den Rest des Raumes sind mit altmodischem Stoff überzogene Sofas und Polstersessel verteilt, die um niedrige Tischchen herumstehen. Ganz hinten gibt es auch noch eine kleine Tanzfläche.
Der Saal ist schon gut gefüllt, als Stefano und Grazia ihn betreten. Sie stellen sich auf die rechte Seite. Die Leute sind alle stehengeblieben und diskutieren leise miteinander.
»Was ist denn passiert?«, fragt ein Mann hinter Stefano. Der Italiener glaubt, dass die Frage an ihn gerichtet ist, und will sich schon umdrehen, als eine Frau sagt: »Anscheinend haben wir einen Toten an Bord.«
Ein zweiter Mann meint aufgeregt: »Was? Einen Toten?«
Der erste Mann: »Sicher ein Herzinfarkt…«
Die Frau: »Wundern würde es mich nicht! Die Hitze, sag ich Ihnen! Als ich vorhin das Fenster aufgemacht hab, war?s draußen schon so was von heiß! Ich bin sicher, jemand ist aufs Oberdeck gegangen, und Bumm! War das Herz überfordert!«
Stefano hegt so seine Zweifel, behält sie aber für sich. Er hat auf dem Oberdeck außer dem blonden Burschen und einem anderen Mann in Rosa niemanden gesehen. Den beiden, so ist ihm vorgekommen, hat die Hitze auch nichts ausgemacht. Den blonden Jungen hat er sogar vor ein paar Minuten wiedergesehen. Der ist also ganz sicher noch am Leben.
In dem Moment betreten drei Personen die Bar: die Generalin, der junge Blonde und in der Mitte der Mann im rosa Trainingsanzug. Stefano stellt erleichtert fest, dass auch er noch lebendig ist. Das heißt »lebendig«… Er scheint kaum noch gehen zu können. Die beiden anderen müssen ihn beinahe tragen.
Stefano mustert vor allem den blonden Jungen, ganz diskret natürlich. Die Ähnlichkeit mit Guido beschäftigt ihn noch immer. Aber im Neonlicht der Bar stechen ihm die Unterschiede gleich noch deutlicher ins Auge. Er schämt sich für seinen Aussetzer von vorhin. Er hätte wirklich freundlicher sein sollen. Der Junge kann schließlich nichts dafür, dass er ihn mit einem Gespenst aus der Vergangenheit verwechselt hat. Stefanos Blick bleibt am Oberkörper des Jungen hängen. Allein schon die Behaarung hätte ihm auffallen müssen. Guido hatte gerade mal zwei, drei Härchen auf der Brust.
Der blonde Junge spürt die Intensivmusterung, der sein Oberkörper ausgesetzt ist, und wirft Stefano einen finsteren Blick zu. Dann knöpft er sein Hemd mit einer Hand zu und entzieht somit seine adretten Brusthaare einer allzu eingehenden Überprüfung.
Er und die Generalin schleppen den anderen Mann zu einem Tisch hinüber, der etwas abseits der Menge gelegen ist. Der Kerl in Rosa lässt alles passiv über sich ergehen, während die Dame ihn besorgt betrachtet. Sie setzen sich auf ein Sofa.
Die Generalin raunt dem blonden Jungen etwas ins Ohr. Er hört ihr geduldig zu, nickt kurz und durchquert dann die Menschenmenge, ohne jemanden anzublicken.
DIE VIER ÄGYPTISCHEN REISELEITER EILEN endlich in den Saal herein. Drei Frauen und ein Mann. Jamila, die Reiseleiterin, die sich um Stefanos Gruppe kümmert, geht bis in die Mitte des Saales vor, klatscht in die Hände und ruft: »Alle mal herhören, bitte!«
Die Leute verstummen nach und nach.
»Guten Morgen, werte Gäste«, sagt sie mit ihrer rauchigen Stimme. Ihre rotgelockte Mähne tanzt ihr ums ausdrucksvolle Gesicht. »Ich weiß nicht, ob ihr schon auf dem Laufenden seid, aber es hat da heute Morgen einen… bedauerlichen Vorfall gegeben. Will heißen, einen Todesfall.«
Die Leute fangen wieder an, zu murmeln.
Jamila wedelt energisch mit der Hand herum, um das Gemurmel abzuwürgen. »Ich weiß, es ist wirklich ein Drama. Wir warten jetzt darauf, dass die Polizei eintrifft. Ausnahmsweise hat der Speisesaal schon geöffnet, euer Frühstück erwartet euch also. Ihr müsst nur aufs Nefertari Deck gehen, das liegt gleich unter der Rezeption. Wir werden das jetzt alle tun, eine Gruppe nach der anderen. Die Farahs machen den Anfang.«
Ihre Kollegin Farah, eine kleine Brünette, stellt sich am Eingang auf, hebt die Hand und ruft: »Alle Farahs kommen mit mir mit, bitte!«
Ein Teil der Leute marschiert los. Der Lärmpegel steigt erneut an.
Der blonde Junge hat am Tresen drei kleine Gläser ausgehändigt bekommen. Er bleibt kurz stehen, während sich die Truppe Richtung Ausgang bewegt. Dann schlängelt er sich gekonnt zwischen den Leuten durch und setzt sich wieder an seinen Tisch.
Unwillkürlich folgt Stefanos Blick ihm. Er sieht, wie der Junge der Generalin zwei Gläser hinhält. Der Inhalt scheint irgendein Alkohol zu sein, Cognac oder Whisky.
Sie gibt dem Mann in Rosa ein Glas.
Er nimmt es ihr blicklos ab. Die drei trinken auf ex.
Der Saal leert sich. Nach den Farahs sind die Seifs und dann die Nours an der Reihe. Schließlich bleiben nur noch ungefähr dreißig Personen in der Bar zurück.
»Liebe Jamilas – geht schon mal vor!«, sagt Jamila. »Ich komm sofort nach.«
Grazia und Stefano machen sich Richtung Treppe auf.
IM SPEISESAAL SIND DIE TOURISTEN ebenfalls nach Gruppen aufgeteilt. Stefano und Grazia finden zwei leere Sessel an einem Jamila-Tisch. Sie legen die Stoffservietten über ihre Teller, um anzuzeigen, dass die Plätze besetzt sind, bevor sie zum Büffet in der Mitte des Saales zurückgehen.
Stefano legt sich nur ein paar Sachen auf den Teller; er ist nicht besonders hungrig. Das Wichtigste ist momentan ohnehin Kaffee. Er steht ziemlich lange Schlange, bevor er sich bedienen kann.
Als er an seinen Platz zurückkommt, sitzen bereits fünf Personen um den runden Tisch. Er setzt sich und grüßt.
Seine Tischnachbarin, eine junge, mollige Frau mit kurzen, knallroten Haaren, antwortet ausdruckslos: »Salut.« Neben ihr thront ein junger Schwarzer mit rasiertem Kopf; er ist dermaßen muskelbepackt, dass sein T-Shirt beinahe aus allen Nähten platzt. Er blickt kurz zu Stefano rüber, lächelt sanftmütig und nickt ihm zu.
An seiner Seite sitzt ein Rentnerehepaar. Die Frau ist schlank und hat halblange, braune Haare mit ein paar grauen Strähnen; der Ehemann sieht mit seinem weißen Haar und den blauen Augen noch gut aus, wenn auch ein wenig ausgezehrt. Sie blicken nur flüchtig von ihren Tellern hoch und murmeln ein paar Grußworte.
Und Unglück im Unglück – wen entdeckt Stefano auf dem Sessel ihm gegenüber? Den blonden Jungen. Der ihn mit einem Gesichtsausdruck mustert, als ob er gerade in eine Zitrone gebissen hätte.
Bravo, di Angeli. Dein erster Tag, deine erste Freundschaft, denkt Stefano, bevor er sich mit der Hand übers Haar streicht.
Grazia kommt kurz nach ihm vom Büffet zurück. Sie lässt sich auf ihren Sessel gleiten. Ihr Blick schweift über die schweigende Tischgesellschaft, und sofort setzt sie ihr Galalächeln auf. »Guten Morgen«, sagt sie. »Ma che casino, eh ?« Sie wedelt mit der Hand herum, ihre unzähligen Armreifen klimpern. »Wie heißt das noch bei euch? Was für ein Durcheinander, stimmt?s?«
Der blonde Junge seufzt: »Ja, war nicht besonders angenehm, auf die Art und Weise aufzuwachen.« Er hat eine angenehm melodiöse Stimme.
»W---weiß eigentlich j---jemand, w---was p--passiert ist?«, stammelt der Schwarze mit Bassstimme. »J---jemand s---soll gest---torben sein, hab ich geh---hört. F---furchtbar, nicht?«
Stefano runzelt die Stirn. »Noch furchtbarer ist«, sagt er unüberlegt, »dass wir mit einer Verspätung im Programm rechnen müssen. Wenn die Kreuzfahrt nicht ganz storniert wird. Und das bloß, weil ein Pensionist einen Herzinfarkt gehabt hat…«
Der Blonde schießt ihm einen giftigen Blick zu, bevor er abrupt meint: »Also, Herzinfarkt war das ganz sicher keiner.«
»Ach so? Was war?s denn dann? Und woher weißt du das?«, fragt die junge Frau neben Stefano. Sie redet so schnell, dass sich ihre Worte überschlagen.
»Wissen tu ich es, weil meine Tante und ich die ersten in der Kabine waren«, erklärt der Blonde. »Ich hab also den Toten gesehen. Und das Messer in seinem Rücken deutet eher darauf hin, dass er erstochen wurde.«
Am Tisch verstummen alle und reißen die Augen auf. Selbst Stefano bleibt die Spucke weg. Jemand ist erstochen worden? ERSTOCHEN?, denkt er entsetzt.
Der blonde Junge widmet ihm ein hämisches Lächeln.
Die Generalin – wie es scheint, die Tante des Blondlings – tritt genau in dem Augenblick an den Tisch. Sie nimmt zwischen ihrem Neffen und Grazia Platz. Heiter meint sie: »Hallöchen. Ich bin Agathe.«
Ihre Worte werden von allgemeinem Schweigen begrüßt.
»Was ist denn mit euch los?«, wundert sich die Dame. »Wenn ich mich vorstelle, sagen mir normalerweise alle anderen auch ihre Namen.«
Die junge Frau neben Stefano fängt sich als erste wieder. »Entschuldigung. Ich heiße Caroline. Und mein Mann –«, sie zeigt auf den Schwarzen zu ihrer Rechten, »– heißt Jean.«
Die restlichen Personen am Tisch reagieren ebenfalls. Stefano hört seine Freundin sagen: »Ich bin Grazia. Sehr erfreut!«
Das Rentnerehepaar stellt sich als Lucille und Xavier vor.
Stefano murmelt seinen Namen, ohne den Blick von seinem Teller zu heben.
»Ich bin Raphaël«, meint der blonde Junge.
Erneut herrscht Schweigen am Tisch. Es dauert eine Minute lang, bis Lärm am Eingang des Speisesaals zu hörten ist. Mehrere Stimmen, die auf arabisch diskutieren, und laute Schritte.
Vier schwarzuniformierte Hünen betreten den Saal. Hinter ihnen marschiert ein fünfter Mann in Anzug, Hemd und Krawatte, der sich mit Jamila unterhält.
Die Polizei ist da.
Kapitel 3
RAPHAËL
HAB ICH’S NICHT VON ANFANG an geahnt? Die Reise ist ganz sicher nicht nach meinem Geschmack. Begonnen hat sie jedenfalls schon mal denkbar schlecht. Weil, ein Kadaver auf nüchternen Magen – Danke, super, ich bin ganz begeistert.
Und dann der Italiener. Dieser Stefano. Also echt, Kinder.
Okay, seien wir ehrlich: Er ist gottschön. Ihr müsst euch auch noch einen leichten Akzent dazudenken – der würde ganze Eisberge zum Schmelzen bringen. Aber apropos Eisberge: Er ist sehr frostig. Frostig, arrogant und abweisend. Jedenfalls mir gegenüber. Ich hab bis jetzt noch nicht durchschaut, ob er Streit mit mir sucht, ob ich ihn verunsichere oder ob er mich bloß nicht ausstehen kann. Hingegen hab ich problemlos durchschaut, wie nervtötend die Situation auf die Dauer sein wird. Wenn ich erst einmal eine Woche mit dem Typen an einem Tisch gesessen bin, werd ich mich regelrecht danach sehnen, wieder nach Paris zurückzukehren.
Im Gegensatz zu ihm hat sich seine Freundin Grazia sofort als Lichtblick entpuppt. Eine entzückende junge Frau, und das in jeder Hinsicht. Schlank, bildhübsch, braun gebrannt, mit langen, schwarzen Haaren und energiefunkelnden, mandelförmigen Augen.
Beide übrigens waschechte Italiener wie im Bilderbuch. Ihre Kleidung ist der letzte Schrei, schick, aber unaufdringlich. Dann muss man, glaub ich, wirklich Italiener sein, um diese Lässigkeit und angeborene Selbstsicherheit an den Tag zu legen. Die beiden tun so, als ob ihnen die Welt gehörte, als ob sie nicht die geringste Sorge hätten, als ob die Welt aus lauter Schönheit, Leichtigkeit und Opernarien bestehen würde.
Na ja, ist ja jetzt egal. Die Polizei ist da, vier uniformierte Beamte und ein Polizist in Zivil, und ich kann mich auf Wichtigeres konzentrieren.
Nach längeren Verhandlungen mit Jamila stellt sich der Zivilmensch vor das Büffet. Dürfte so um die fünfzig sein. Großgewachsen, sportlich, die Haare kurz geschnitten und grau an den Schläfen. Ein Gesicht, das mich vage an Omar Sharif erinnert. Ein schöner Mann, wenn man auf Sugar Daddies steht.
Er räuspert sich und sagt: »Meine Damen und Herren, ich bin Oberst Al-Qaïb von der ägyptischen Polizei.« Oh, makelloses Französisch; nur ein leichter Akzent verrät seine Herkunft. »Ich bitte Sie, meine Unterbrechung während des Frühstücks zu entschuldigen, aber ich habe die traurige Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass einer Ihrer Landsmänner heute Morgen tot in seiner Kabine aufgefunden wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich nicht um einen natürlichen Tod, sondern um Mord.«
Seine Ankündigung schlägt ein wie eine Bombe. Die Leute schweigen eine Schrecksekunde lang. Dann fangen sie an, gleichzeitig loszureden.
Nur an unserem Tisch ist es mucksmäuschenstill, weil meine Tischgesellschaft bereits auf dem Laufenden ist. Dank meiner Wenigkeit. Siehst du, Stefano, das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt.
Der Oberst hebt die Hand. Er muss sich ein Weilchen gedulden, bevor er weiterreden kann. »Ja, die Neuigkeiten sind schockierend«, meint er und streicht sich über den Schnurrbart. »Wir werden uns bemühen, das Verbrechen so schnell wie möglich aufzuklären, das dürfen Sie mir glauben. Meine Kollegen sind zurzeit dabei, den Toten und die Kabine zu untersuchen. Mir fällt die Aufgabe zu, die Personen zu verhören, die das Opfer gefunden haben. Am Vormittag werden meine Kollegen auch noch einen kleinen Fragebogen verteilen, den ich Sie bitte, sorgfältig auszufüllen.« Er fügt mit einem kalten Lächeln hinzu: »Ein reines Routineverfahren, machen Sie sich keine Sorgen.«
Jamila unterbricht ihn leise. Er hört höflich zu, dann sagt er: »Zu meinem Bedauern zieht das Verfahren kleine Änderungen in Ihrem Programm nach sich.«
Mir gegenüber lacht Stefano trocken auf. Ich hör ihn murmeln: »Cazzo! Ich habe es gewusst. Unsere Kreuzfahrt können wir uns an den Hut stecken…«
Mich überkommt große Lust, ihm eine runterzuhauen.
»… die Besprechung mit Ihren Reiseleitern wird deswegen auf elf Uhr verschoben«, sagt der Oberst. »Ich hafte jedoch persönlich dafür, dass der für heute Nachmittag vorgesehene Ausflug normal durchgeführt wird. Leider kann ich Ihnen für den Rest der Reise nichts versprechen. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit die Kreuzfahrt nicht abgesagt wird.«
Ich schau mein Gegenüber triumphierend an. »Ha!«, sag ich.
»Pff. Wer solchen Versprechen glaubt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen«, murmelt er zynisch lächelnd, während er mir direkt in die Augen sieht.
Seine Freundin Grazia tut, was ich auch gern getan hätte. Sie boxt ihn in den Oberarm. Geschieht ihm ganz recht. »Stefano! Hör auf, immer so negativ zu sein, per piacere!«, zischt sie ihn an. Ihre Augen blitzen zornig.
»D’accordo, cara«, antwortet Stefano, während er sich den Arm reibt. Stirnrunzelnd wirft er mir einen flüchtigen Blick zu. Dann trinkt er einen Schluck Kaffee.
Der Oberst wünscht uns noch ein angenehmes Frühstück und bittet uns, bis zu seiner Rückkehr im Speisesaal zu verweilen. Als er hinausgeht, lässt er ratlose Gesichter und das dumpfe Summen zahlreicher Diskussionen hinter sich. Die vier schwarzuniformierten Hünen postieren sich zu beiden Seiten des Ausgangs.
DER REST DES FRÜHSTÜCKS VERLÄUFT ohne weitere Zwischenfälle. An unserem Tisch mag keiner den Mord kommentieren, was mir durchaus recht ist. Das Gespräch dreht sich um harmlose Dinge. Das Schiff. Das Frühstück. Das Wetter. Selbst Stefano nimmt an unserem seichten Geschwätz teil und entpuppt sich als überraschend charmanter Mensch. Hin und wieder kommt ihm sogar ein Lächeln aus. Ausschließlich für die anderen Tischgenossen, aber das muss ich wohl nicht extra hervorheben, oder? Ich glaub, er hat wirklich was gegen mich. Könnte es sein, dass er homophob ist? Oder hat er vielleicht Muffensausen, dass ich ihn anbaggere – jeder weiß ja, dass wir Schwule alles befummeln, was über einen Schwanz verfügt?
Ich könnte ihn in der Hinsicht beruhigen – er läuft keine Gefahr, von mir befummelt zu werden. Ja, okay, er sieht wirklich gut aus. Sehr gut sogar, ich gebe es zu. Aber gut Aussehen ist auch nicht das A und O der Welt. Von außen kann etwas noch so schön ausschauen – wenn Scheiße drinsteckt, stinkt’s trotzdem.
Und was beschissene Typen angeht, bin ich geimpft, Dankeschön.
DER ÄGYPTISCHE OBERST KOMMT EINE halbe Stunde später zurück. Schnurstracks marschiert er zu unserem Tisch her und bleibt mit im Rücken verschränkten Armen vor uns stehen.
»Mesdames, Messieurs. Sehr geehrte Damen und Herren.« Er nickt jedem von uns zu. »Erlauben Sie mir… Ich unterbreche Sie womöglich gerade… Aber ich müsste mich mit Madame und Monsieur Poireaut unterhalten. Man hat mir gesagt, sie befänden sich an diesem Tisch.« Er sieht uns freundlich an.
»Madame Poireaut, das bin ich«, antwortet Tantchen. »Und Monsieur, das wäre wohl mein Neffe.« Sie lächelt herzlich.
»In dem Fall… Darf ich Sie bitten, mit mir mitzukommen, werte Madame? Und Monsieur?«
»Selbstverständlich. Gerne sogar.« Tantchen steht auf und streicht ihr Kleid glatt, das sie eine Nummer größer kaufen hätte können – oder sollen.
Ich erhebe mich ebenfalls, aber eher unwillig. Natürlich hab ich mir schon gedacht, dass die Polizei uns befragen wird. Wir waren immerhin die ersten am Tatort. Dennoch hüpft mir das Herz in die Kehle. Ich glaub, man kann so unschuldig wie ein Einhorn sein, man fühlt sich trotzdem unwohl, wenn ein Bulle anfängt, Fragen zu stellen.
Der Oberst wendet sich an unsere Tischgenossen. »Sie können sich jetzt frei auf dem Schiff bewegen. Wir bitten Sie hingegen, selbiges bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Vormittag, werte Damen, werte Herren.«
Er stapft Richtung Ausgang davon. Tante Agathe und ich stapfen hinterdrein.
WIR BEGEBEN UNS WIEDER IN die Nefertiti Bar. Der Saal ist leer, ich seh nur schemenhaft einen Kellner, der im kleinen Kabuff hinter dem Tresen herumwerkelt. Die Klimaanlage surrt diskret vor sich hin.
Der Oberst lässt sich auf einem Sofa nieder und lädt uns mit einer Handbewegung ein, ihm gegenüber Platz zu nehmen.
Wir machen das gehorsam.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten?«, fragt er. Trotz seiner Statur hat er eine Aura, die Zuversicht und Ruhe einflößt, ein bisschen wie ein wohlwollender Onkel.
»Ach, ich hätte gern einen Kaffee«, erwidert meine Tante und schlägt die Beine übereinander. Ich muss mich zurückhalten, um nicht laut loszuprusten. Eingezwängt in ihr kakifarbenes Kleid versucht sie, die mondäne Dame zu spielen. Der Oberst muss ihr gefallen, denn ich hab sie selten so… sagen wir: schmeichelweich gesehen. Mit den alten, marokkanischen Latschen an den Füssen gelingt es ihr jedoch nur zur Hälfte, die schicke Pariserin zu verkörpern, und ich bin sogar noch großzügig, wenn ich sage »nur zur Hälfte«.
»Für mich bitte auch einen Kaffee«, sag ich.
Der Oberst dreht sich zum Tresen rüber und bellt: »Thalathatou qahouatan!«
Wir warten und schweigen uns an. Die Kaffeemaschine brummt und zischt dreimal, dann bringt der Kellner unsere drei Tassen. Mit untertäniger Miene stellt er sie auf dem niedrigen Tischchen ab.
Schau mal her, denn kenn ich doch. Das Bürschchen, das meine Tante vorhin zur Rezeption geschickt hat, um die Polizei zu verständigen.
Wie alt kann der bloß sein? Achtzehn? Älter? Jünger? Schwer zu sagen. Er ist so glattrasiert und seine Haut so zart, dass sein Gesicht beinahe bartlos wirkt. Hübscher Junge jedenfalls, mit fein geschnittenen Gesichtszügen. Schlank und braun gebrannt, schwarze Haare und Augen. Und dann hat er auch noch einen Blick drauf! So einen Schlafzimmerblick, ich schwör’s, die Wimpern stehen regelrecht auf Halbmast.
Er lächelt mich schüchtern an. Auf seinem Namensschild les ich den Namen Hassan.
Ich lächle zurück und sag: »?ukran, Hassan.«
Oh! Er wird knallrot! So was von süß! Ich zwinkere ihm zu, was ihn noch mehr erröten lässt. Er schaut schnell zum Polizisten hinüber und eilt dann noch schneller hinter seinen Tresen zurück.
Ich beäuge seinen Po überhaupt nicht, würd ich nie machen. Ich stelle also auch nicht fest, dass er zum Reinbeißen ist.
Der Oberst zückt eine Schachtel Zigaretten. »Gestatten Sie?«
»Freilich, bitte rauchen Sie, Herr Oberst.« Meine Tante legt den Kopf schief.
Der Oberst zündet sich eine Zigarette an, bläst den Rauch zur Decke hoch, seufzt. Dann räuspert er sich. »Man hat mir mitgeteilt, dass Sie beide den Toten entdeckt haben.«
»Unrichtig, Herr Oberst«, erwidert meine Tante freundlich, aber belehrend.
»Tatsächlich? Man hat mich belogen?« Der Oberst zieht eine Augenbraue hoch.
»Das bezweifle ich sehr, Herr Oberst. Man ist bloß ungenau gewesen. Der arme junge Mann, dessen Namen ich nicht kenne, der hat ihn entdeckt. Mein Neffe und ich sind in seine Kabine gestürmt, nachdem uns seine Schreie aufgeschreckt haben. Das heißt, in gewisser Hinsicht kann man sagen, dass wir die ersten vor Ort waren. Aber die ersten nach dem jungen Mann selbst.«
»Ach ja, stimmt, werte Madame.« Der Oberst saugt an seiner Zigarette. »Ich konstatiere, dass Sie anscheinend einen ausgeprägten Sinn für Gründlichkeit und Genauigkeit haben.«
Tantchen lehnt sich vor. » Herr Oberst, ich arbeite im Innenministerium meines Landes. Seit vierzig Jahren. Da gewöhnt man sich solche Gepflogenheiten an. Vor allem, wenn es darum geht, ein Verbrechen aufzuklären.«
Wie bitte? Ich verschluck mich beinahe an meinem Kaffee. Was ist denn auf einmal mit Tantchen los? Hat sie sich an irgendwelchen Tabletten vergriffen? Oder hat der Oberst es ihr so angetan, dass sie anfängt, Geschichten zu erfinden?
Nur zur Information: ja, Tantchen arbeitet im Innenministerium, das ist kein Geheimnis. Aber sie wirkt und werkt in der Personalabteilung. Das heißt, mit Beförderungen, Prämien und Urlaubsansprüchen kennt sie sich gut aus. Was hingegen Verbrechen betrifft, hat sie bestenfalls den einen oder anderen unlauteren Krankenstand aufgeklärt, und sogar da bin ich mir nicht sicher.
»Aha. Madame ist eine Kollegin…« Der Oberst bleibt ungerührt. Ich hab den Eindruck, auf dieser Welt können ihn nur noch wenige Dinge verblüffen. »Gut zu wissen.«
»Genau. Ich dachte, diese… Auskunft könnte Ihnen hilfreich sein«, antwortet meine Tante vielsagend.
Der Oberst mustert sie, nickt und meint: »Sie haben durchaus recht. Alle Auskünfte, auch wenn sie noch so allgemein1 sind, können uns weiterhelfen. Nicht wahr?«
Anstelle einer Antwort legt mein Tantchen erneut den Kopf schief. Ein zufriedenes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus.
Auweia. Den Ausdruck kenn ich. Und ich kenn mein Tantchen. Die wird ihre Nase in Dinge stecken, die sie nichts angehen, so wahr ich Raphaël heiße.
NACH DIESER EINLEITUNG DAUERT UNSER Gespräch mit dem Polizisten nicht besonders lange. Seine Fragen kommen mir wie Routinefragen vor. Er kennt bereits unsere Namen, Adressen und Geburtsdaten, wahrscheinlich, weil er einen Blick in unsere Reisepässe geworfen hat. Wir haben sie bei unserer Ankunft an der Rezeption hinterlegt und bekommen sie erst kurz vor unserer Abreise zurück.
Der Oberst will wissen, ob wir das Mordopfer kennen, einen gewissen Michel Ardant.
Michel Ardant… Nicht dass ich wüsste. Ich antworte also mit Nein.
Tante Agathe ebenfalls.
Kennen wir vielleicht das rosa Mäuschen, das Monsieur Ardants… »Assistent« war? Sein Name ist Arnaud Leclerc.
Auch nicht.
Ich stelle nebenbei fest, dass der Oberst eine Kunstpause macht, bevor er »Assistent« sagt. Mir fällt auch auf, dass er das Wort mit Gänsefüßchen ausspricht. Er muss also die Anordnung der Betten gesehen und unwillkürlich den richtigen Schluss daraus gezogen haben. Oder er ist gewissenhaft und hat das Mäuschen bereits verhört. In dem Fall bin ich sicher, dass er ihm die Frage gestellt hat. Mit allen notwendigen Höflichkeitsfloskeln, für die er eine große Begabung an den Tag legt.
Wie ist es mit Madame Ardant bestellt, von der Monsieur seit einigen Jahren getrennt lebt?
Nein. Die kennen wir auch nicht.
Wir können also Monsieur Leclercs Behauptung nicht bestätigen, dass die Eheleute zurzeit die Scheidung anstreben und dass Monsieur beschlossen hat, danach seinen… »Assistenten« zu heiraten?
Nein, tut uns leid. Ich hab übrigens recht. Der Oberst hat das Mäuschen verhört, und er hat die Frage gestellt.
Haben wir irgendetwas angefasst, nachdem wir die Kabine des Verblichenen betreten haben? Ist uns etwas Außergewöhnliches aufgefallen?
Wir antworten auch darauf mit Nein.
Was haben wir getan, nachdem wir unsere Kabinen bezogen haben?
Tante Agathe antwortet, dass sie sich ein wenig ausgeruht hat, danach hat sie geduscht und sich angekleidet.
Ich erklär meinerseits, um welche Uhrzeit ich meine Kabine verlassen und was ich getan hab, bevor ich dorthin zurückgekehrt bin. Ich hebe auch die Anwesenheit des rosa Mäuschens hervor, das sich die ganze Zeit auf dem Oberdeck aufgehalten hat.
Da wir der Polizei darüber hinaus nichts zu sagen haben, endet hier das Gespräch.
Der Polizist dankt uns. Er entschuldigt sich umständlich dafür, uns belästigt zu haben.
»Überhaupt nicht«, erwidert meine Tante. Sie lächelt und drückt volle Pulle auf den Knopf »Charme, Kokettieren & Verführung«. »Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Oberst. Falls Sie irgendetwas von mir brauchen, bitte zögern Sie keine Sekunde.«
TANTCHEN UND ICH GEHEN AUF unser Deck zurück. Endlich kann ich die Fragen stellen, die mir auf der Zunge liegen. Ich zische: »Sag mal, Tantchen, was ist denn mit dir los? Du bist seit Neuestem bei der Polizei? Eine Kollegin des Obersts? Hältst du dich jetzt für Kommissarin Laura Gottberg?«
Tantchen bleibt stehen und zuckt die Schultern. »Mein Schatz – ich weiß, was ich tu.«
»Ich auch. Du baggerst den Oberst an, das war kaum zu übersehen. Aber diese Anspielungen, die du gemacht hast? Die Geschichte mit den Auskünften, den renseignements? Hab ich das richtig verstanden – gehörst du zum Geheimdienst?«
»Mach dich nicht lächerlich«, sagt Tantchen, ohne mich anzusehen. »Ich baggere niemanden an. Also wirklich – in meinem Alter.«
Ich grinse. »Weil’s dafür eine Altersbeschränkung gibt…«
»Komm rein.« Sie zieht mich in ihre Kabine. Nachdem sie die Tür zugemacht hat, meint sie: »Hör zu, falls ich unterschwellig auf gewisse Dinge angespielt hab und der Oberst das vielleicht falsch aufgefasst hat, dann deshalb, weil ich nicht möchte, dass er glaubt, wir hätten was mit dem Verbrechen zu tun, okay?«
»Ich glaub nicht, dass er uns verdächtigt«, erwidere ich erstaunt.
Meine Tante schüttelt den Kopf. »Ach, mein Raph. Bist wirklich ein süßes Kerlchen. Denk doch mal nach! Wir sind alle verdächtig. Die Person, die Michel Ardant erstochen hat, ist wahrscheinlich einer von uns. Ein Tourist, verstehst du?
Ich kratze mich am Kopf. Sie hat recht.
»Die ägyptische Polizei kann dem Täter sehr schnell auf die Schliche kommen«, fährt sie fort. »Genauso gut kann es aber auch sein, dass sie nie herausfindet, wer’s wirklich ist. Einen Täter muss sie aber irgendwann vorzeigen können. Sonst verspielt sie ihren Ruf.«
»Und?«
»Und du bist als erster vor Ort gewesen.«
»Bin ich nicht, das hast du doch selber gesagt. Der Mann da war vor mir da, dieser Arnaud Wasweißich…«
»Arnaud Leclerc, genau. Der Arme. In seiner Haut möchte ich auch nicht stecken.« Tantchen schüttelt den Kopf.
»Du glaubst, dass die Polizei ihm das Verbrechen anhängen wird?«, frag ich.
»Wundern würd’s mich nicht. Wenn sie den wahren Täter nicht findet, wird er herhalten müssen… Ein Schwuler, in diesem Land… Ich geb ihm keine großen Chancen. Der Oberst ist imstand und erfindet einen Streit oder so was. Das Messer im Rücken weist ohnehin schon auf ein Eifersuchtsdrama oder Ähnliches hin… Der junge Mann wird sicher als Hauptverdächtiger gelten. Selbst bei uns zuhause in Frankreich würde man sich gewisse Fragen stellen.«
»Wenn er aber unschuldig ist?«
»Genau deshalb hab ich ja dem Oberst meine Hilfe angeboten, mein Schatz. Wegen des armen Jungen. Und deinetwegen auch.« Sie tätschelt mir die Wange. »Ich möchte nicht, dass dir was zustößt.«
Irgendwas passt da nicht zusammen; ihre Erklärungen sind ein bisschen weit hergeholt. »Ich? Versteh ich jetzt nicht. Ich hab doch mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun!«, protestier ich.
»Natürlich nicht. Aber schwul bist du auch. Wir sind hier nicht in Frankreich, vergiss das nicht. Ich glaub, vor Oberst Al-Qaïb sollten wir uns in Hut nehmen. Vertrau meinen Erfahrungen.«
»Wovon redest du denn, verdammt noch mal?«, ruf ich entnervt aus. »Deine Erfahrungen mit Jahresprämien? Oder Urlaubsgeld? Was soll der Scheiß?«
»Mach dich ruhig über mich lustig!«, sagt Tantchen verschnupft. »Wenn man in einem großen Haus wie dem Ministerium arbeitet, trifft man auf unterschiedlichste Personen. Glaub mir, mein Schatz, in vierzig Jahren ist mir so ziemlich alles untergekommen, vom Rührendsten bis zu tiefsten Abgründen. Der menschliche Charakter hat für mich keine Geheimnisse mehr.«
»Trotzdem, oh Brunnen der Weisheit«, erwidere ich nicht ganz unironisch, »der Bulle kommt mir relativ harmlos vor. Er ist so höflich und vertrauenserweckend…«
»Ein Grund mehr, sich vor ihm in Acht zu nehmen. Er erinnert mich an einen schlafenden Löwen. Und du weißt, was man über schlafende Löwen sagt.«
»Dass man sie nicht aufwecken soll…«
»Dass man nicht ihre Eier befummeln soll. So, und jetzt sei ein braver Junge und lass dein Tantchen tun, was zu tun ist. Wirst schon sehen, alles wird wieder gut.« Sie schiebt mich Richtung Tür. »Raus mit dir, mein Schatz. Wir sehen uns zur Besprechung um elf. Ich möchte mir vorher noch über zwei, drei Dinge Klarheit verschaffen.«
Kapitel 4
STEFANO
NACH DEM FRÜHSTÜCK KEHREN GRAZIA und Stefano in ihre Kabine zurück. Sie putzen sich schweigend die Zähne. Während Grazia im Badezimmer gurgelt, setzt sich Stefano mit hängenden Schultern auf sein Bett und blickt auf die Uferböschung, die er durch die Fenstertür sieht. Er fühlt sich mit einem Mal alt. Alt und müde. Er reibt sich die Augen.
Grazia kommt aus dem Bad, wirft einen Blick auf ihren Freund und fragt sanft: »Was ist denn los? Ein Durchhänger?« Sie mustert ihn aufmerksam. »Hat wohl nichts mit dem Typen zu tun, der gestorben ist, vermute ich.«
Stefano schüttelt den Kopf.
»Warum bist du dann so lasch? Seit wir angekommen sind, kommt mir vor, du bist irgendwie verärgert.«
Er zuckt die Schultern, weil er selbst nicht weiß, was mit ihm los ist.
Na ja, nach einem einsamen, aber angenehmen Morgenbeginn ist er plötzlich diesem blonden Jungen gegenübergestanden. Raphaël. Und seither dringen wieder Dinge an die Oberfläche, die Stefano sich jahrelang bemüht hat zu verdrängen.
Seine Gedanken kann man seinem Gesicht wahrscheinlich ganz deutlich ablesen. »Der blonde Junge ist schuld daran, oder?«, fragt Grazia. »Dieser Junge, der unserem Guido zum Verwechseln ähnlichsieht?«
Verbissen nickt Stefano.
»Oh caro mio!« Grazia umarmt ihn. »Ich hab sofort bemerkt, dass er Guidos Ebenbild ist. Er sieht ihm so wahnsinnig ähnlich!«
Stefano bringt keine Antwort hervor. Ein Knoten schnürt ihm die Kehle zu, und seine Augen brennen mit dem Salz ungeweinter Tränen.
»Er geht mir auch ab«, murmelt Grazia. »Mein Gott, wie sehr er mir abgeht, mein Guido…«
Ihre sanfte Stimme lässt ihn beinahe in Tränen ausbrechen. Die Erinnerungen steigen in sukzessiven Wogen auf und überrollen ihn. Im letzten Moment zwickt er sich in die Handfläche. Ein Mann weint nicht, ein Mann beherrscht sich. Wie oft hat ihm sein Vater das eingetrichtert?
Grazia streicht ihm übers Haar. »Aber er ist nicht Guido, Stefano. Er kann nichts dafür, dieser… Wie heißt er noch?«
»Raphaël«, erwidert Stefano tonlos.
»Raphaël«, wiederholt sie. »Du darfst deinen Schmerz oder deine Wut nicht an ihm auslassen.«
»Ich weiß.«
Aber an wem soll er dann seine Wut auslassen? An dem, der das ganze Drama, das ganze Unglück ausgelöst hat? An seinem Vater? Der hat es damals ihren Blicken angesehen. Hat es bemerkt, bevor Stefano selbst etwas aufgefallen ist. Bevor Guido ihm seine Gefühle gestanden hat. Er hat es an ihren Gesten erraten, der Vater. Er hat nie mit seinem Sohn darüber gesprochen, aber Stefano ist sich sicher, dass das der Grund war, warum er Guido gebeten hat, ihn zu verlassen.
Das war auch der Grund, warum er Stefano angeordnet hat, seinen besten Freund ziehen zu lassen.
Und Stefano hat nicht reagiert. Wie ein Idiot, wie ein Feigling hat er gehorcht, wie auch Guido gehorcht hat.
Sie haben nie gelernt, Nein zu sagen. Da liegt die Wurzel des Übels.
Guido ist daran zugrunde gegangen. Weil Stefanos Vater ihn verjagt hat. Und weil Stefano ihn nicht zurückgehalten hat, weil er ihm nicht nachgeeilt ist, und weil danach der Rest von Guidos kleiner Welt auch noch zusammengebrochen ist. Und Guido ist noch weiter weg gegangen. Hat die Welt für immer hinter sich gelassen.
Und Stefano ist in tausend Scherben zerbrochen und versucht seither, sie Stück für Stück wieder zusammenzukitten.
Grazia ist die Einzige, die diese Geschichte kennt. Die Einzige, die genauso gelitten hat, genauso viele Tränen vergossen hat wie er. Guido war immerhin ihr geliebter Halbbruder.
Sie lehnt ihren Kopf an Stefanos Kopf. »Du musst loslassen«, flüstert sie. »Du musst ihn wirklich ziehen lassen. Sonst wird er uns beide unser Leben lang verfolgen.«
»Ich weiß«, gibt er zu. »Aber es ist so schwer. Und jetzt… Mit Raphaël vor meinen Augen…«
Sie lehnt sich zurück und packt ihn an den Schultern. »Versprich mir eins. Versprich mir, dass du dich bemühst. Dass du netter zu dem Jungen bist, dass du ihm eine Chance gibst. Kannst du das für mich tun?«
Stefano nickt. »Ich kann?s versuchen. Versprochen.«
»Ich hab dich lieb. Das weißt du, oder? Wenn Männer mich interessieren würden, wärst du der Mann meines Lebens.«
»Ich hab dich auch lieb, cara.«
SIE GEHEN AUFS OBERDECK, WO Grazia eine Zigarette raucht. Um sich abzulenken, spielen die beiden ihr Lieblingsspiel, das Spiel der Farben. Es besteht daraus, ein Objekt auszuwählen und dann seine genaue Farbschattierung festzustellen.
»Die Häuser da drüben!«, ruft Grazia aus und zeigt auf das gegenüberliegende Ufer.
»Ganz schön schwer«, sagt Stefano und kratzt sich am Kinn. »Beige?«
»Zu unpräzise – du schummelst!«
»Ginster?«
»Eher Kurkuma, nicht?«
»Oder Champagner?«
»Sand?«
Er nickt. »Wie du meinst. Sand also. Und in der Mitte, die Moschee, die über die Häuser hinausragt?«
Sie versuchen es mit Melone, Raps, Safran und Mais, ohne sich einigen zu können. Nach und nach fangen sie aber wieder an zu lächeln. Grazias Lächeln kommt ja immer schnell zum Vorschein. Stefanos hingegen ist eine schwierige Geburt.
Grazia seufzt. »Du lächelst nicht, du ziehst eine Grimasse!«
»Aber nein, ich lächle!«
»Das soll dein schönstes Lächeln sein? Das geht gar nicht, caro! Versuch?s ein bisschen weniger zitronig und ein bisschen knutschiger, per piacere!«
Stefano jammert: »Du gehst immer so hart mit mir um! Ich wusste schon, warum ich eigentlich getrennte Kabinen haben wollte. Ich werde deine Boshaftigkeit keine ganze Woche lang ertragen können!«
Sie lacht. »Ach was – du verehrst mich doch! Und du wolltest getrennte Kabinen, weil du Angst hattest, dass ich deinem Charme erliege. Obwohl du weißt, dass dein Männercharme an mir abprallt…«
Stefano tut so, als ob er schockiert wäre. »Was? Mein Charme macht deine Knie nicht weich? Ma sono irresistibile!«
ALS ES ZEIT WIRD, BEGEBEN sich die beiden wieder in die Nefertiti Bar, um an der Informations-Besprechung teilzunehmen. Der ältere Polizist in Zivil, den sie am Morgen gesehen haben, sitzt gleich neben dem Eingang. Oberst Dingsbums.
Als Stefano und Grazia an ihm vorbeischlendern, hält er ihnen zwei Zettel hin. »Werte Mademoiselle, werter Monsieur. Wie angenehm, Ihr sonniges Lächeln zu sehen! Erlauben Sie mir jedoch… Meine traurige Pflicht, Sie verstehen… Wie angekündigt bitte ich Sie, diese kleinen Formulare auszufüllen. Könnten Sie so nett sein, sie danach an der Rezeption abzugeben?«
»Selbstverständlich, Monsieur«, erwidert Stefano.
»Ich danke Ihnen vielmals. Sollte Ihnen noch etwas einfallen, dass Sie mir sagen wollen… Sollten Sie sich an etwas erinnern, auch die geringste Kleinigkeit… Ich bin hier und stehe zur Verfügung.« Der Oberst lächelt. Sein Lächeln erreicht jedoch seine Augen nicht.
DIE BEIDEN STOßEN ZU DEN restlichen Jamilas, die sich ganz hinten im Saal versammelt haben. Nur die Generalin glänzt durch ihre Abwesenheit, stellt Stefano fest. Die anderen Tischgenossen hingegen, Caroline, Jean, Lucille und Xavier, haben ihnen Sitzplätze an ihrem Tisch freigehalten. Sie winken ihnen zu, als sie die beiden Italiener sehen.
Raphaël befindet sich ebenfalls unter ihnen. Er starrt Stefano mit zusammengekniffenen Augen an.
Grazia lächelt reihum, während sie sich elegant aufs Sofa neben Raphaël gleiten lässt. Sie hält absichtlich einen Platz zwischen sich und dem Jungen frei. »Vieni qui, Stefano«, sagt sie und klopft auf den Sitz. Ihre Armreifen klicken verhalten. »Vergiss nicht, was du mir versprochen hast…«
Stefano geht widerwillig zu ihr rüber. Ihm wäre ehrlich gesagt lieber gewesen, er könnte sich woanders niederlassen. Vorsichtig setzt er sich auf den vorgesehenen Platz und bemüht sich um eine neutrale Miene.
Raphaël nickt ihm zu und brummt so etwas wie: »Was geht ab?«