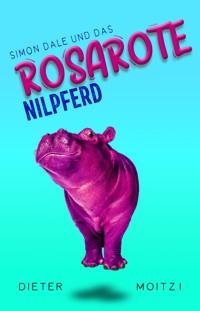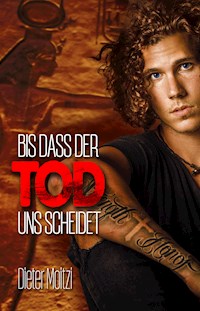3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gewinner des französischen Krimipreises Prix du roman policier - Prix du roman gay 2019 Damien Drechsler hat gerade mit seinem Freund Schluss gemacht und braucht dringend Urlaub. Das griechische Dörfchen Levkos scheint dafür der ideale Ort zu sein – verschlafen, sonnig, ländlich idyllisch, mit einsamen Stränden und kleinen Bars, wo man seine Sorgen ertränken kann. Aber am ersten Abend lernt Damien Nikos kennen, einen flotten, jungen Mann, der sein Herz sofort schneller schlagen lässt. Dann wird er beinahe von einem waghalsigen Autofahrer überfahren. Am nächsten Morgen erfährt er, dass ein alter Mann nur wenige Minuten nach seinem eigenen Missgeschick in einem verdächtigen Autounfall ums Leben gekommen ist. Von da an scheint irgendwie alles schief zu gehen. Ein gut bestückter FKK-Fan versucht, ihn zu verführen; ein fescher Kerl löst ein Missverständnis mit weitreichenden Konsequenzen aus; und last but not least beginnt Damien, sich langsam in Nikos zu verlieben. Es kommt noch schlimmer. Eine Urlauberin wird tot im Schwimmbecken aufgefunden, obwohl sie sich am Vortag bester Gesundheit erfreute. Noch ein Unfall? Oder könnte es sich… um Mord handeln? Neugierig versucht Damien, die eigenartigen Rätsel zu lösen, über die er hier gestolpert ist. Er hat jedoch weder mit einem streitsüchtigen Kommissar gerechnet, noch mit dem unerwarteten Verschwinden einer Reisebegleiterin, noch damit, dass Nikos ihm genau in dem Moment den Laufpass gibt, als er erneut Hoffnung schöpft. Plötzlich hat er mehr Fragen als Antworten… Könnte es sein, dass die Phrase „sie lebten glücklich bis ans Ende ihres Lebens“ nur in Märchen existiert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
1 | Die Frau war eine Katastrophe. Ohne Übertreibung
Die Frau war eine Katastrophe. Ohne Übertreibung. Als sie uns mit ihrem falschen Lächeln am Flughafen abholen kam und ausrief: „Hallo, Freunde! Ich bin die Cindy!“, dachte ich sofort: Oje! Das kann ja heiter werden!
Ich muss zugeben, ich war schlecht aufgelegt. Was die junge Frau betraf, hatte ich mich aber nicht getäuscht. Allein schon der Name, bitte. Cindy! Das bedeutete, dass es in Frankreich zumindest ein Elternpaar gab, das beim Anblick seines Neugeborenen beschlossen hatte: „Nennen wir sie doch Cindy.“
Cindy!
Dabei war ihr Vorname noch das geringste Übel. Unsere Cindy hatte nämlich sprechen gelernt. Leider. Und das mussten wir jetzt ausbaden. Denn sie sprach. Ohne Rücksicht auf Verluste.
„… ist eine Stadt, in der Bauarbeiten immer besonders lange dauern“, freute sie sich gerade.
Ohne hinzuschauen, wusste ich, dass sie sich auf ihrem Sitz neben dem Busfahrer umgedreht hatte. Ich wusste auch rein vom Klang ihrer Stimme her, dass sie noch immer ihr falsches Lächeln aufgesetzt hatte.
„Die Bauarbeiter stoßen nämlich die ganze Zeit auf irgendwelche alten Gemäuer… äh… auf archäologische Funde. Jetzt stellt euch vor: die stammen noch – von den alten Griechen!“
In Athen?, dachte ich gereizt. Hat man noch Worte?
Sie erinnerte mich an diese unsympathische Person, die im Roman meiner Freundin J. D. Fowler, „Das blutige Landhaus“, auftauchte: Miss Mabel Sandhurst. Mabel war ungefähr in Cindys Alter, würde ich sagen, so Mitte zwanzig. J. D. beschrieb sie als eine strohdumme Person, die immer nur Blödsinn daherredete, wahrscheinlich bloß, um ihre Stimmbänder zum Schwingen zu bringen. Es hatte mich dementsprechend wenig überrascht, dass Mabel sich am Anfang von Kapitel sechs erfolgreich erwürgen ließ.
Die Mabel, die wir armen Urlauber ertragen mussten, war zwar nicht braunhaarig wie die Romanfigur. Aber ansonsten war sie Miss Sandhursts exaktes Ebenbild. Sie war genauso üppig, eine echte Weihnachtspute. Sie war genauso aufdringlich. Und sie war genauso belämmert.
Ich konnte jetzt nachvollziehen, warum der Täter im „Blutigen Landhaus“ sie gemeuchelt hatte. Nicht aus Angst, dass sie ihn als Mörder entlarven könnte. Sondern weil sie ihm so auf den Sack ging.
Mittlerweile hatte ich nämlich auch Lust, Mabel, das heißt Cindy zu erwürgen. Ich war knapp davor, meinen Sicherheitsgurt aufzumachen, den Gang nach vorne zu laufen, Cindys Kehle zu umfassen und zuzudrücken. Ganz fest und ganz lang. Seit wir eingestiegen waren, juckte es mich in den Fingern. Seit zwanzig Minuten also.
Zwanzig! Minuten!
Na ja. Als „Thalassa Voyages“-Reisebegleiterin war es Cindys Job, uns während der Busreise Vorabinfos zu Griechenland zu liefern. Schön und gut. Sie hatte uns anfangs die Einwohnerzahl, die Fläche, die Hauptstadt und ein paar klimatische Eigenheiten des Landes aufgezählt.
Dann hatte sie sich aber Taxis, Oliven und Pistazien zugewandt. Fünf Minuten pro Thema. Ohne Scherz. Da hatte ich zum ersten Mal begriffen, dass sie uns bis zum bitteren Ende erbarmungslos zuschwallen würde. In einer Panikaktion hatte ich meinen Rucksack durchstöbert. Ganz umsonst, weil ich vergessen hatte, meine Kopfhörer einzupacken, ich Vollkoffer. Cindys Stuss würde mir also leider nicht erspart bleiben. Immerhin verfügte sie über ein Mikrofon.
„… und deswegen dauern die Bauarbeiten für die Athener U-Bahn viel länger als in Paris…“, erklärte sie gerade verzückt.
Zwei Reihen vor mir fing ein kleiner Junge an zu brüllen, als ob er gegen die Athener U-Bahn allergisch wäre.
Sapperlot! Zuerst warf ich ihm, dann seinen Eltern einen finsteren Blick zu. Seine Mutter streichelte ihm über den Kopf. Sein Vater, der auf der anderen Seite des Ganges saß, lehnte sich zu ihm hinüber und murmelte ihm beruhigende Worte ins Ohr.
Wenn ihr schon dabei seid, warum gebt ihr ihm nicht gleich ein Bonbon?
Wieder mal Anhänger dieser blöden Erziehungsmethode, die besagt, dass Kinder sich unbedingt frei ausdrücken müssen. Egal wo, egal unter welchen Umständen. Nur ja nicht eingreifen.
Die drei waren mir schon beim Boarding in Paris aufgefallen. Kein Wunder – der Kleine hatte die ganze Zeit herumgezappelt und gegreint. Okay, es war sechs Uhr morgens gewesen. Aber auch für mich war das viel zu früh. Ging ich deswegen allen Leuten auf den Keks?
Nein.
Also.
Der Papa hieß Paul-Auguste. Ich hatte seinen Namen so oft gehört, dass ich ihn mir problemlos gemerkt hatte. Ein durch und durch fahler Typ. Er musste um die vierzig sein, hatte ein unscheinbares Gesicht, einen blutarmen Teint, kurz geschnittene, farblose Haare, und trug eine beigefarbene Hornbrille. Sein Poloshirt war wahrscheinlich vor Jahren mal gelb gewesen, und die Farbe seiner Shorts war so eigen, dass es mir nicht gelang, ein passendes Adjektiv zu finden. Am besten war, dass der Typ Sandalen und Socken trug. Die Krönung schlechten Geschmacks.
Der Name seiner edlen Angetrauten war Isaure. Sie sah etwa so alt aus wie er, überragte ihn jedoch um einen Kopf. Ihre braunen Haare trug sie im Pagenschnitt, à la Mireille Matthieu, und ihr Gesichtsausdruck war pedantisch und verkniffen. Wahrscheinlich war sie Mathe-Lehrerin. Das altmodische Kleid, das sie anhatte, war dermaßen scheußlich, dass jede normal konstituierte Person es rituell quasi als Exorzismus verbrannt hätte.
Wenigstens hatten sie ihren Sohn gnädig in normale Kleider gesteckt. Meinen Busenfreund. Er hieß übrigens Théophile. Doch, doch. Théophile. In der Abteilung für Vornamen war das auch ein Schnäppchen.
Cindy plapperte noch immer über die Athener U-Bahn. Die bestand aus genau drei Linien. Das Licht am Ende dieses Tunnels dürften wir also bald sehen. Ich war jedoch überzeugt, dass die Reisebegleiterin mühelos weitere Themen finden würde.
Matt lehnte ich meinen Kopf gegen die Fensterscheibe und warf einen Blick nach draußen.
Der Tag war sonnig, da gab es nichts zu sagen. Der azurblaue Himmel wölbte seine Kuppel ins Unendliche. Kurz erblickte ich in der Ferne die Akropolis. Der Felsen mit seinen Tempeln, weiß und eigenartig, sah wie immer prachtvoll aus. Rund um uns schimmerte Athen in der Mittagshitze. Ich musste unwillkürlich an Petros Markaris denken – sorry, Berufskrankheit. Ich erwartete mir fast, dass Kostas Charitos in seinem Auto schimpfend an uns vorüberfahren würde.
„Schauen Sie mal, Ma’me Marchand – die Akropolis da drüben!“, erschallte es in der Reihe hinter mir. Ohne Mikro, aber auch ganz schön laut.
„Au ja, Ma’me Délatte – wie schön das aussieht auf dem Felsen! Gell, das sieht schön aus, Ma’me Délatte!“
„Oh ja, total schön!“
Scheiße! Einen Moment lang hatte ich die beiden vergessen. Madame Délatte und Madame Marchand. Zwei Rentnerinnen, die in ihrer Jugend wahrscheinlich noch mit Vercingetorix herumgehangen hatten. Sie waren supergeschwätzig. Und superschwerhörig. Darum kam ich in den zweifelhaften Genuss ihrer ununterbrochenen Kommentare, die ohne Pause und Filter auf mich niederprasselten.
„Oh, schauen Sie doch mal, Ma’me Délatte – die Schrift, die die hier verwenden! Echt eigenartig, finden Sie nicht? Mit Buchstaben, die ich vorher noch nie gesehen habe…“
„Ja, wirklich, Ma’me Marchand – eigenartig! Sieht aus wie Russisch, oder?“
Apropos Russisch… Meine Wodkaflasche fiel mir ein. Ein x-ter Seufzer entschlüpfte mir. Wenn man mir wenigstens erlaubt hätte, sie in mein Handgepäck zu stecken! Ein kräftiger Schluck Hochprozentiges hätte sicher meine Laune verbessert. Oder mich zumindest einigermaßen betäubt. Aber nein. Dank der landläufigen Sicherheitsvorschriften steckte die Flasche in meiner Reisetasche, irgendwo zwischen meinen Socken und meinen Unterhosen. Ich hoffte inbrünstig, dass sie die Reise im Bauch des Flugzeugs heil überstanden hatte. Denn das würde mir gerade noch fehlen – dass ich in meinem Hotelzimmer die Reisetasche aufmache und meine ganze Wäsche durchnässt ist und nach Alkohol stinkt.
Ohne Überleitung wechselte Cindy das Thema. Sie konstatierte: „… das Land der tausend Inseln. Griechenland besteht tatsächlich aus mehr als tausend Inseln. Auf manchen leben die… äh… die Inselbewohner, und manche sind… äh… unbewohnt… Poros, Hydra, Spetses, Milos, Sifnos, Paros, Mykonos, Ios, Chios, Santorin, und natürlich auch Lesbos…“
Tausend Inseln – wenn sie uns die alle aufzählt, kann das lang werden…
„Wisst ihr auch, warum sich auf Lesbos die Ösen mehren?“, schrie ein Mann, der ganz hinten saß. Ein echtes Scherzkeks – bei dem ging‘s Witz auf Witz, meistens unter der Gürtellinie.
„Äh… nein, keine Ahnung“, antwortete Cindy mikrofonverstärkt, während sie sich zu uns umdrehte.
Ich machte mich aufs Schlimmste gefasst.
„Weil sie dort die Mösen ehren!“
Reizend!
Alle lachten los.
Außer mir und Isaure, die herumfuhr und erzürnt nach hinten blickte.
Prost Mahlzeit. Zwei Wochen würde ich in Gesellschaft von dieser Mischpoche verbringen, ich verhätscheltes Lieblingskind der Schicksalsgötter. Seufz. Der Autobus rollte unter der Sonne Athens dahin, Cindy plapperte weiter, die beiden Alten hinter mir quasselten, und der Bub greinte.
°°°
Als Athen hinter uns lag, war ich dermaßen schlaff, dass ich die schönen Landschaften draußen nur mehr vage wahrnahm. Am Anfang waren es erdige Hügel, nackte Felsen und sommerverdorrte Vegetation; das vielversprechende Tiefblau des Meeres glitzerte ab und zu zwischen zwei Kuppeln auf.
Dann sah ich den Norden des Peloponnes an mir vorbeiziehen, vor allem seine kurvige Küste, der die Schnellstraße von Korinth nach Patras wie ein endloser Asphaltwurm folgte. Knorrige Olivenbäume streckten ihre silbrigen Blätter nach oben, als ob sie um Regen beteten. Auf der anderen Seite des Golfes kitzelten die dunstigen Berge des Festlandes den Himmel mit ihren zerklüfteten Gipfeln.
Der kleine Théophile war inzwischen mitten im Greinen eingeschlafen. Aber hinter mir hagelte es immer noch Kommentar auf Kommentar. „Ach, schauen Sie mal, Ma’me Délatte…“
„Au ja, Ma’me Marchand!“
Und Cindy ging uns nach wie vor mit ihrem Geplapper auf den Senkel.
Die Fahrt schien eine grausaume Ewigkeit zu dauern. Als der Bus endlich die Schnellstraße verließ, glaubte ich kaum meinen Augen. Die lang gestreckte Bergkette zu unserer Linken rückte in die Ferne, wurde blasser und ging in den Hitzedunst des Hinterlandes über.
Wir fuhren an einem Ortsschild vorbei, auf dem ich das Wort „Levkos“ entzifferte. Es handelte sich um ein Dörfchen mit alten Steinhäusern und engen Gässchen. Rund um einen kleinen Platz dösten eine Kirche, ein Kaffeehaus und eine Taverne vor sich hin sowie ein Geschäft, das „Souvénires Grécque“ anbot. Die fantasiereiche Schreibweise entlockte mir ein müdes Halblächeln (das schrieb man nämlich normalerweise „Souvenirs grecs“).
Das Sträßchen wand sich noch zwei, drei Kilometer lang in Serpentinen zwischen Feldern und Gärten dahin. Dann fuhr der Bus durch ein Eingangstor und bremste vor einem großen Gebäude. Ein Schild kündigte an: „White Beach Hotel“.
Wir waren angekommen. Mitten im schönsten Nirgendwo.
Für solche Orte gab es im Deutschen einen netten Ausdruck: „Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen.“ Wobei ich mir nicht einmal sicher war, ob es in dieser Gegend überhaupt Füchse und Hasen gab.
Die nächsten zwei Wochen drohten mordsmäßig fad zu werden.
°°°
Als ich ausstieg, waren die Leute schon dabei, sich streitlustig um die Buskofferräume zu gruppieren. Ich hörte genervte Schreie. „Passen Sie doch auf, Sie!“ – „Drängeln Sie nicht so!“ – „So ein Rüpel!“ – „Aua! Steht sich’s gut auf meinem Fuß?“
Mein erster Gedanke war recht bösartig: Kratzt euch ruhig die Augen aus, ihr Idioten!
Ich stellte mich etwas abseits hin. Meine Reisetasche konnte warten. Sie würde sich nicht in Luft auflösen, und mein Zimmer auch nicht. Vor allem sollte man diese Kofferkämpfe immer aus der Ferne genießen. Am besten von einem schattigen Platz aus, mit einer Zigarette in der Hand und eine Augenbraue sarkastisch nach oben ziehend.
Ich zückte also meine Zigaretten, zündete mir eine an und sog den ersten Zug genüsslich ein.
Viel Jungvolk war nicht in meiner Reisegruppe, konstatierte ich. Eine einzige junge Frau war in meinem Alter. Daneben bemerkte ich noch zwei Teenie-Burschen, wahrscheinlich ihre Brüder, weil sich die drei ziemlich ähnlich sahen. Und dann noch meinen Kumpel Théophile.
Ansonsten ausschließlich Leute der Altersstufe 40 plus. Vor allem plus. Seufz. Mit meinem derzeitigen Glück waren die Einheimischen auch alle steinalt. Als ob es nicht ausreichte, dass sie so weit weg vom Hotel lebten…
In dem Moment kam ein junger Mann aus dem Hotel. Ah. Hoffnungsschimmer. Weil sehr gutaussehend, der Mann. Meine Laune mochte gerade im Negativbereich sein, aber mein Sehvermögen blieb tadellos, danke schön. Gottseidank, denn hier gab’s genug zu sehen. Der Bursche hatte dunkelblondes Haar und ein schönes, braungebranntes Gesicht mit entschlossener Kinnpartie. Unter seinem schwarzen T-Shirt zeichnete sich ein muskulöser Oberkörper ab. Die weiße Leinenhose diente als Geschenkverpackung für einen athletischen, kleinen Hintern, zwei kräftige Beine und – Oh là là! – eine prächtige Beule.
Im Umdrehen warf mir der Kerl einen flüchtigen Blick zu.
Und plötzlich runzelte er die Stirn. Stemmte die Arme in die Hüften, betrachtete mich genauer und… pöbelte mich schroff auf Griechisch an.
Mein Schwein musste man erst einmal haben! Ein gutaussehender Kerl lief hier frei in der Gegend herum. Und prompt schnauzte er mich an.
2 | So schön konnte kein Mann sein
So schön konnte kein Mann sein, dass er mir heute gefahrlos auf den Sack gehen durfte. Ich tüftelte schon an einer wunderbar knappen Antwort, als der Typ meinen kleinen Rucksack entdeckte. Der stand zu meinen Füßen und trug noch immer das Etikett „Handgepäck – Hand Luggage“.
Endlich begriff er, und sein Gesicht strahlte auf. „Excusez-moi, entschuldigen Sie, aber Sie… äh, Sie sind wohl nicht der neue Gärtner?“, fragte er auf Französisch mit einem schnuckeligen Akzent.
Fast widerstrebend lächelte ich ihn an. „Oh, nein. Ich bin sicher kein Gärtner. Mutter Natur ist mir dafür auch sehr dankbar.“
Der junge Mann lachte, seine schönen, weißen Zähne blitzten auf. „Sie sind also gerade mit den anderen Urlaubsgästen angekommen?“
„Genau!“
Er hielt mir seine Hand entgegen. „Ich heiße Yiorgos. Entschuldigen Sie bitte das Missverständnis.“
„Kein Problem.“ Ich schüttelte seine Hand mit Nachdruck. „Mein Name ist Damien. Damien Drechsler.“
„Sehr erfreut! Und noch einmal Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich sein. Hören Sie, ich bin Ihnen einen Drink schuldig, okay? Im Moment bin ich etwas in Eile, aber vielleicht heute Abend, in der Disco…“
Er trat auf mich zu und drückte mir kurz die Schulter.
Schluck. Sein Parfüm, ein angenehm frischer Zitronenduft, stieg mir in die Nase. Der V-Ausschnitt seines T-Shirts entblößte seine unbehaarte Brust, und ich bemerkte auch, dass seine Brustwarzen wie pflückreife kleine Beeren hervorstanden.
Der schöne Yiorgos ließ meine Schulter wieder los, hob seine Hand zum Gruß und stapfte mit dynamischen Schritten davon. Seine Hose spannte sich bekömmlich über die Schenkel. Wenn man die Sache so betrachtete, könnte mich die Disco heute Abend durchaus reizen. Bloß wegen des Drinks, verstand sich. In allen Ehren und so.
Ich hob meinen Rucksack auf und ging zum Autobus hinüber. Meine Reisetasche stand allein im Kofferraum, traurig und verlassen.
Was für ein passendes Symbol.
°°°
Nach den sommerlichen Lichtverhältnissen brauchten meine Augen einen Augenblick, bis sie sich an die halbdunkle Empfangshalle gewöhnt hatten. Diese war mehr oder minder leer; insgesamt waren wir fünf Personen. Hinter einem lang gezogenen Tresen aus dunklem Holz reichte gerade eine grauhaarige Rezeptionistin einer anderen grauhaarigen Dame ihre Schlüssel – ich erkannte in ihr eine der Urlauberinnen aus meiner Gruppe. Cindy lungerte neben den beiden herum und betrachtete die Decke. Ihr falsches Lächeln war mittlerweile einem ziemlich genervten Gesichtsausdruck gewichen.
Ich latschte an einem Aufzug vorbei, wo eine vierte Frau sich mit ihrem Gepäck abkämpfte. Sie hatte zwei Koffer erfolgreich in die Kabine gehievt, sah ich, aber ein letztes, ziemlich großes Gepäckstück musste noch verstaut werden. Die Frau war dabei, in ihrer Handtasche herumzuwühlen. Sie entnahm ihr schließlich ein Taschentuch, mit dem sie sich die Stirn abwischte.
Eine kleine Schachtel fiel dabei zu Boden.
Ich hob sie auf, warf einen raschen Blick drauf und gab sie ihr zurück. „Verzeihung, Madame – Sie haben da was verloren.“
Die Frau zuckte zusammen und entriss mir die Schachtel. Sie murmelte: „Mademoiselle.“
„Oh, Entschuldigung, Mademoiselle. Sagen Sie, soll ich Ihnen helfen? Der Koffer da schaut recht schwer aus.“
Sie nickte und steckte die Schachtel wieder in ihre Handtasche.
Ich stellte mein Gepäck ab und hob den letzten Koffer auf. Das heißt, ich versuchte es. Weil – Jesus Maria und Josef sowie alle Heiligen! Der war so was von schwer! Da konnten unmöglich bloß Klamotten drin sein; die Dame musste ein ganzes Fertigbauhaus eingepackt haben. Als sie sah, dass mich die Aufgabe leicht überforderte, griff sie mit an. Selbst zu zweit hatten wir alle Mühe der Welt, den letzten Koffer auf die beiden anderen im Lift zu wuchten.
„Sind Sie auf Urlaub hier, oder sind Sie dabei, hierher auszuwandern?“, fragte ich atemlos.
Die Frau warf mir einen bitterbösen Blick zu. Besonders umgänglich sah sie nicht aus. Eine unglückliche Mittvierzigerin, blass und dünn wie ein Nagel, mit zitronigem Gesichtsausdruck und viel zu viel Schminke. Jeder Millimeter ihres Gesichts war mit Make-up zugekleistert; grelle Farben waren auf der lückenlosen Fundierung aufgepinselt. Nach dem Zufallsprinzip.
Claire Beddingford!, sagte ich mir sofort. Die Gouvernante im Roman „Die fünf schwarzen Schafe“, den meine Freundin Billie Jones geschrieben hatte. Eine verbitterte und anfangs recht zurückhaltende Figur. Im Laufe des Buches merkte man aber, dass sie sich in Lord Huntington verguckt hatte; das war einer der Protagonisten der Serie. Billie beschrieb unter anderem die bedauernswerten Schminkversuche der Gouvernante, mit denen sie versuchte, das Objekt ihrer Begierde zu bezirzen. Natürlich wussten aufmerksame Leser von Billies Serie, dass Miss Beddingford sich das sparen konnte. Lord Huntington interessierte sich ausschließlich für seinen Spießgesellen, den feschen Inspektor Forbes. Forbes hatte der armen Claire übrigens auch einen netten Spitznamen verpasst: „the Lemon-Lady“. Zitronenlady.
Zitronenlady passte zu der Frau vor mir auch gut. Eigentlich schade, dass sie so mürrisch und sauer dreinschaute. Mit ein bisschen weniger Schminke und ein bisschen mehr Lächeln wäre sie eine hübsche Frau.
Als wir den Koffer mit dem Fertigbauhaus erledigt hatten, dankte die Zitronenlady mir beiläufig. Sie wandte sich dann der Rezeption zu und rief mit erstaunlich kräftiger Stimme: „Maman! Kommst du, oder was?“
„Sofort, Anne, sofort!“, antwortete die grauhaarige Dame. Sie verabschiedete sich mit herzlichen Worten von der Rezeptionistin und eilte dann durch die Empfangshalle.
Ich hob mein eigenes Gepäck wieder auf und latschte zur Rezeption rüber, während ich mir über die Stirn wischte.
Cindys Empfang war säuerlich-ungeduldig. „Na endlich! Haben Sie doch noch herein gefunden!“
Ich antwortete lieber nicht. Sonst wäre mir sicher ein gehässiger Kommentar rausgerutscht.
„Haben Sie zufällig auch einen Namen? Und kann ich Ihren Voucher haben?“, fragte sie.
Ich gab ihr das Dokument, blieb aber weiter stumm. Wenn man ihr schon kein Benehmen beigebracht hatte, musste sie zumindest lesen gelernt haben. Sie konnte den Voucher also auch ohne meine Mithilfe bewältigen.
„Damien Drechsler. Okay. Ich bin die Cindy, und ich kümmere mich hier im Hotel um die sportlichen Aktivitäten…“
„Um die sportlichen Aktivitäten? Sie? Im Ernst?“, brach ich mein Schweigegelübde und starrte sie verblüfft an.
Cindy blinzelte und atmete tief durch. Ohne sich umzudrehen, ließ sie den Voucher auf den Tresen flattern und sagte: „Zu Ihrer Information, wir organisieren ein Tischtennisturnier, das in einer Stunde anfängt…“
„Der war gut. Sport? Mit mir sicher nicht.“ Ich schüttelte den Kopf. Nach einer kurzen Nachdenkpause erkundigte ich mich mit Honig in der Stimme: „Aber sagen Sie bitte, Mademoiselle – ab wann wird denn das Abendessen serviert?“
Natürlich hatte sie das schon im Bus bis ins letzte Detail erklärt. Aber zur Abwechslung wollte ich sie mal nerven.
Meine Absicht war offenbar ziemlich klar, denn sie warf mir bloß einen „Wenn-Blicke-töten-könnten“-Blick zu. Dann kläffte sie über ihre Schulter: „Madame Régnier, das erklären dann mal Sie, ja?“
Was für ein Trampel. Also echt.
Ich wandte mich lieber an die Rezeptionistin. „Sie heißen Madame Régnier? Sind Sie Französin?“
„Oh, nein. Ich komme aus Belgien.“
„Da schau her! Das ist ja spannend. Wie sind Sie denn in diesem Eck von Griechenland gelandet?“ Ich lehnte mich an den Tresen, als ob mich das wirklich interessieren würde.
Cindy schnallte sofort, dass sie nicht mehr gebraucht wurde. Zumindest nicht von mir. „Bis später!“, knurrte sie verärgert und rauschte von dannen. Wirklich eine zweite Mabel Sandhurst – Körperbau, Benehmen, sinnentleertes Gequatsche, alles war da.
„Ein echter Sonnenstrahl, die Frau“, kommentierte ich.
Madame Régnier kicherte. Sie schob die Schlüssel des Zimmers 217 über den Tresen und sagte: „Nun gut… ich wünsche Ihnen trotzdem einen angenehmen Aufenthalt. Also – was wollten Sie denn wissen?“
°°°
Als ich in meinem Zimmer im zweiten Stock angekommen war, öffnete ich sofort meine Reisetasche und nahm die Flasche Wodka heraus. Sie war unversehrt. Ich seufzte erleichtert auf, bevor ich sie in den Minikühlschrank stellte, den ich unter meinem Nachtkästchen fand. Dann wählte ich Badeshorts und ein sauberes T-Shirt aus und zog mich um. Die Reisetasche mit dem Rest meiner Klamotten landete ohne Ausräumen im Schrank.
Das Zimmer war geräumig, ganz in Weiß und Beige gehalten mit ein paar metallgrauen und rostroten Akzenten. Ich sah mich kurz um, bevor ich die Lampenschalter, die Klimaanlage und die Klospülung ausprobierte. Alles funktionierte einwandfrei.
Ich trat auf den Balkon hinaus. Weiter hinten schimmerte die weite Fläche des Meeres, die an den dunstigen Bergen des Festlandes endete. Direkt unter mir entdeckte ich zwischen dem Hauptgebäude und dem Swimmingpool einen kleinen Park mit Palmen, Platanen, Meereskiefern und Blumensträuchern.
Man hatte zwei Sessel und ein kleines Tischchen auf den Balkon gestellt. Auf letzterem stand ein dunkelroter Aschenbecher mit aufgedrucktem Hotellogo. Toll – ich konnte hier ungestört rauchen.
Ich holte mir schnell meinen Kindle und meine Zigaretten und setzte mich auf einen der Sessel. Ich zündete mir eine Zigarette an und schaltete mein Gerät ein. Billie hatte mir ihr neuestes Manuskript geschickt. „Mr. Crowley’s Last Secret“. Das Buch war zwar noch nicht in den USA erschienen, also gab’s auch keine Deadline. Aber je früher ich damit anfing, desto schneller würde ich bezahlt werden. Und ich las die Manuskripte immer ein erstes Mal durch, bevor ich mit dem Übersetzen begann.
Also, dieser Mister Crowley. Der Titel ging schon mal leicht: „Mister Crowleys letztes Geheimnis“. Ich rauchte, während ich das erste Kapitel verschlang. Wie Billie in ihrer letzten E-Mail erklärt hatte, handelte es sich bei Mister Crowley um den berühmten britischen Okkultisten Aleistair Crowley. Das klang gut.
Die ersten Seiten waren auch spannend. Man fühlte sich sofort in ein dunkles Geheimnis verwickelt und wusste von Anfang an, dass man es bis zum letzten Paragrafen schwer haben würde, den Schuldigen zu finden. Billies Stil war flüssig und poetisch, sie sprang sofort mitten ins Geschehen. Aber ich hatte große Mühe, mich zu konzentrieren. Kam das von der ungewohnten Umgebung? Dem Schlafmangel? Dem Schmerz, der noch immer in mir pochte?
Ich klappte den Kindle zu, ging ins Zimmer zurück und setzte mich aufs Bett. Die Matratze war tadellos, nicht zu fest, nicht zu weich. Alles in allem fand ich das Hotel sehr ansprechend. Alles war schön und funktionell. Kein Fünfsternehotel, aber ich hatte mir auch nicht erwartet, dass Alex das Geld beidhändig zum Fenster hinausschmiss.
Die Stille im Zimmer machte mich hingegen unruhig. Ich hörte eigentlich außer dem Summen der Klimaanlage und einer diskreten Geräuschkulisse, die von draußen hereinkam, genau nichts. Da mir nichts Besseres einfiel, schaltete ich den Fernseher ein.
Ich wurde mit einer Blondine belohnt, die wild auf Griechisch schwadronierte. Eine sonnenbestrahlte Bucht glänzte hinter ihr. Die Kamera schwenkte und zoomte auf einen grauhaarigen Mann, den das Blondchen als Geisel neben sich sitzen hatte. Ich sah, wie er nickte und wie Panik in seinen Augen aufflackerte.
Na ja. Nicht so spannend.
Ich schaltete das Gerät wieder aus.
Dann verließ ich das Zimmer.
°°°
Das Hotel „White Beach“ war weiß und langgezogen und hatte blau angestrichene Balkone. Es ähnelte einem gestrandeten Atlantikdampfer. Ein wenig altmodisch, aber elegant, rank und hoch.
Die Spatzen zwitscherten über mir, während ich langsam durch den Park schlenderte. Die Zikaden sangen ringsum. Ich hörte leise Musik, entspannte Konversationen, Swimmingpool-Geräusche.
Tja, tja, tja.
Viel war hier nicht los. Ich blieb vor dem Becken stehen. Zwei Kinder spielten im Wasser. In einer Ecke diskutierte ein Pärchen in aller Ruhe, ihre Köpfe ragten wie zwei Inseln aus dem türkisfarbenen Wasser. Die grauhaarige Mutter meiner Zitronenlady schwamm bereits ihre ersten Längen, ihre Brustzüge waren energisch und entschlossen.
Auf der anderen Seite des Schwimmbeckens lag eine Bar mit einem großzügig angelegten Gastgarten. Auch dort war die Kundschaft spärlich. Ich erkannte die Zitronenlady in Person; sie saß an einem schattigen Tisch und stierte mit verdrießlicher Miene ins Leere. Ihr Gesichtsausdruck kam mir wie ein Spiegelbild meiner eigenen Laune vor.
Die beiden Alten, die mich mit ihren endlosen Kommentaren auf die Palme gebracht hatten, saßen einen Tisch weiter. Madame Marchand und Madame Délatte. Es überraschte mich nur mäßig, dass sie noch immer quasselten, während sie ihre Umgebung mit forschenden Blicken aufnahmen. Die zwei Gläser mit Ouzo vor ihnen waren schon fast ausgetrunken.
Ich ging rasch um den Swimmingpool herum, ließ die Tischtennistische links liegen und stieg eine Steintreppe hinab. Unten erstreckte sich ein breiter Kieselstrand mit Liegestühlen und gestreiften Sonnenschirmen. Auch hier fand ich keine Menschenmassen vor.
Ich spazierte über den Strand und wagte mich auf eine lange Betonmole hinaus. Das Meer kräuselte sich gelassen, beleckte den Strand und rollte die Kiesel hin und her. Es gluckste und plätscherte, und hier ein Klick, da ein Klack… Die Wellen wogten leicht, kleine Schaumkronen glänzten auf.
Auf dem gegenüberliegenden Ufer ragten die wilden, ungezähmten Berge des Festlandes empor. Der Ausblick war so schön, dass er mir beinahe unwirklich vorkam. Gipfel, Bergkämme, tiefe Furchen und gezackte Halbinseln zeichneten sich in verwaschenen Farben ab. Einer der Gipfel da drüben war übrigens der Parnass, der Sitz der Musen.
Ich zog das T-Shirt aus, wobei mir wieder einmal unliebsam bewusstwurde, wie dünn ich war, warf es mir über die Schulter und ließ mich auf der Mole nieder. Die heiße, salzige Luft strich mir über die Haut. Die Wellen schwappten an Land, einem logischen Prinzip folgend, dass mir total willkürlich vorkam, ohne jeglichen Sinn. Das erinnerte mich an was. An mein Leben nämlich.
Plötzlich vernahm ich Stimmengewirr und Gelächter hinter mir. Ich drehte mich um und erblickte eine Gruppe von Leuten, die sich mit viel Trara um die Tischtennistische versammelten. In ihrer Mitte erkannte ich den Mann, der den geschmackvollen Witz über die Ösen von Lesbos erzählt hatte. Er war offensichtlich mit einer Handvoll Freunde angereist. Alle hatten sie einen eher zweifelhaften Sinn für Humor, wie ich bemerkt hatte. Und alle waren sie auffällig hässlich.
Was bedeutete denn diese Menschenansammlung?
Himmel, ja! Das Tischtennisturnier! Wenn Cindy sah, dass ich ganz allein hier unten saß, würde sie mich sicher für ihr bescheuertes Turnier zwangsrekrutieren wollen. Und ein Tischtennisturnier mit Cindy und der Scherzkekstruppe – nur über meine Leiche!
3 | Ich türmte Richtung Hoteleinfahrt. Zu meiner
Ich türmte Richtung Hoteleinfahrt. Zu meiner Rechten sah ich flüchtig einen Parkplatz, der sich hinter einem Spalier von Pappeln versteckte. Danach kam ein großes, rundes Gebäude. Das handgemalte Schild über seiner Tür verriet Sinn und Zweck der Baulichkeit: „White Beach Bar & Disco“.
Zu meiner Linken standen ein paar kleine Bungalows. Sie sahen unscheinbar aus – vielleicht Unterkünfte fürs Personal?
Plötzlich hörte ich, wie sich eine Frau lautstark aufregte. Ihre Stimme schallte aus dem letzten Bungalow. Ich verstand sogar einzelne Worte, da die Tür weit offenstand.
„Verdammte Scheiße! Ihr geht mir wirklich auf den Arsch!“
Ah. Cindy. Zweifellos. Ihre Stimme hatte mir immerhin drei Stunden lang in den Ohren gelegen.
Sie kreischte noch lauter: „Also? Wo ist er?“
Eine andere Frauenstimme antwortete ebenso erregt: „Woher soll ich das denn wissen? Schau ich aus wie sein Kindermädchen?“
„Niemand weiß also, wo er gerade ist?“
„Nein. Von der Polizei sind wir auch nicht. Kannst du mal aufhören, hier so rumzuschreien!“
„Ich schrei hier rum, solange ich will!“
„Weißt du was? Geh scheißen! Kümmere dich lieber um dein Tischtennisturnier?“
„Leck mich am Arsch!“
Nach diesem poetischen Austausch kam Cindy wie ein Blitz aus dem Bungalow geschossen. Sie rannte mich beinahe um, entschuldigte sich nicht einmal und hastete Richtung Swimmingpool davon.
Ich hatte es mir schon heute Morgen gedacht. Nun hatte ich die definitive Bestätigung: Cindy und ich würden sicher nie Busenfreunde werden.
Gottseidank halfen mir die drei jungen Gärtner, die die große Rasenfläche neben dem Bungalow säuberten, die junge Frau schnell wieder zu vergessen. Sie arbeiteten sorgfältig, ihre nackten Oberkörper waren schweißüberströmt, ihre Muskeln spannten sich.
Ein sehr adretter Anblick. Im Vorbeigehen beobachtete ich sie aus den Augenwinkeln.
Nicht dass ich besessen wäre. Ich war bloß Ästhet.
°°°
Als ich das Eingangstor hinter mir gelassen hatte, befand ich mich in der Pampa, die wir vorher im Bus durchquert hatten. Mit rostigem Maschendraht eingezäunte Gemüse- und Fruchtgärten säumten die Straße; auf beiden Seiten begrenzte sie ein Bewässerungsgraben. Zitronen-, Orangen- und Feigenbäume verströmten berauschende Düfte.
Wie eine Schallwolke waberte das ununterbrochene Zirpen der Zikaden übers Land.
Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss! Ksss!
Das Geräusch hatte eine entspannende, betörende, beinahe einschläfernde Wirkung auf mich. Ich fühlte, wie mich eine gewisse Gelassenheit überkam und die ländliche Schönheit der Gegend mich langsam bezauberte. Die Vegetation wucherte überall in anarchistischer Unordnung über die Zäune. Äste bogen sich unter der Last der Früchte und streckten sich mir entgegen, als wollten sie mich dazu herausfordern, eines ihrer saftigen Geschenke zu pflücken.
Ein Zitronenfalter tanzte vor mir herum, bis es ihm zu fad wurde. Dann brummte plötzlich eine Hummel über meine Schulter und ließ mich zusammenzucken. Die heiße, schwere, starre Luft stand wie ein Block über dem schwarzen Asphalt.
Die Straße wand sich nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links. Ich spazierte müßig dahin, und die Minuten entflatterten in die Hitze des Nachmittags.
Nach der zigsten Kurve erreichte ich einen Friedhof, der sich hinter einer mindestens zwei Meter hohen Mauer aus grauen Steinen verbarg. Die Zypressen, die entlang der Mauer wuchsen, überzogen die Straße mit wunderbar mediterranen Harzgerüchen. Eine kaum sichtbare, kleine Kapelle stand in der Mitte des Friedhofs.
Vor mir machte die Straße noch ein paar halbherzige Kurven, bevor sie die ersten Häuser erreichte. Die rote Kuppel der Dorfkirche ragte hinter den Dächern empor.
Seufzend blieb ich am Straßenrand stehen, um mein T-Shirt wieder anzuziehen.
Aber. Theoretisch klang das einfach. Aber es in die Praxis umzusetzen, entpuppte sich als schwierig. Ich klebte nämlich vor Schweiß; das T-Shirt leistete also aktiven Widerstand.
Zuerst ging alles noch gut. Wie gewohnt fuhr ich mit einem Arm in das Loch des ersten Ärmels, mit dem zweiten in das andere. Als ich jedoch versuchte, den Kopf durch das große Loch in der Mitte zu drücken, blieb ich in genau dieser Position stecken. Meine beiden Arme baumelten aus den Ärmeln heraus, der Kopf war halb ins große Loch gezwängt. Das war’s auch schon.
Ich zerrte am Stoff. Argh! Nichts zu machen. Je mehr ich mich abkämpfte, desto mehr schwitzte ich, und desto hartnäckiger klebte das T-Shirt an meinem Körper. Ich stöhnte und ächzte und fluchte, dass ein ausgewachsener Seemann vor Neid erblasst wäre.
Ich schau sicher aus wie ein Vollkoffer!, dachte ich. Hoffentlich sieht mich niemand!
Mein Kopf ruckelte endlich sachte im Loch vorwärts. In Zentimeterarbeit.
Ich blickte auf. Und was entdeckte ich?
Einen Kerl, der auf der Terrasse des nächstgelegenen Hauses saß. Ein junger, süß aussehender Kerl. Das heißt, soweit ich das aus meiner Perspektive erkennen konnte. Er war wohl gerade beim Enthülsen von Erbsen. Angesichts des Spektakels, das ich darbot, hielt er aber inne. Es wäre ewig schade gewesen, meinen eleganten Kampf mit dem T-Shirt zu verpassen.
Er grinste selbstverständlich von einem Ohr zum anderen.
Durch das Kopfloch des T-Shirts musterte ich ihn mit gerunzelter Stirn. Dann zog ich mit einem festen Ruck am Stoff. Wie durch Zufall funktionierte das Anziehen jetzt, wo ich mir einen Ruf als Clown verschafft hatte, problemlos.
Ich trottete weiter und blickte starr auf die Straße vor mir. Mein Kopf war krebsrot.
Das kam von der Anstrengung. Oder von der Hitze.
°°°
Am Hauptplatz saß eine Mittfünfzigerin im Períptero gleich vor der Kirche. Ich mochte diese griechischen Kioske ganz gern, weil sie einfach praktisch waren. Man konnte dort unter anderem Zeitungen, Süßigkeiten, Schokolade, Eis, Getränke und Zigaretten kaufen.
Die Frau blätterte in einer Zeitschrift, ein kleiner Ventilator drehte sich wie wild vor ihr. Als sie meine Schritte hörte, blickte sie auf und begutachtete mich von oben bis unten.
„Kalispéra sas, kyría; dío ‚Assos International‘ parakaló“, sagte ich und war stolz, noch immer zu wissen, wie man Zigaretten kaufte.
Ich hatte bloß eins vergessen. Im Ausland sollte man es sich immer zweimal überlegen, bevor man den polyglotten Zampano herauskehrt. Die Leute haben nämlich die unangenehme Angewohnheit, in ihrer Landessprache zu antworten. Man kann also noch so viele kleine Phrasen auswendig lernen; wenn man die Antwort genau gar nicht rafft, steht man da wie der größte Blödmann.
Leider nahm die Períptero-Dame ihre Antwortpflicht auch sehr ernst. Sie überschwallte mich mit griechischen Sätzen, die alle lang wie die Odyssee waren, und ihre Stimme wurde so schrill und laut, dass die Zikaden im Umkreis von mehreren Kilometern prompt verstummten.
Ich auch, weil mir nichts anderes überblieb.
Die Dame unterbrach sich schließlich, um mal wieder einzuatmen.
Schnell sagte ich auf Englisch: „Sorry, I don’t speak Greek – ich spreche kein Griechisch.“
Sie brach in schallendes Gelächter aus. Und lachte und lachte. Endlich ließ sie sich dazu herab, mir meine zweite Schachteln Zigaretten zu reichen. Als ich wegging, hörte ich sie noch immer hinter mir kichern.
Ich überquerte den Platz und flüchtete ins Café, das ich vom Bus aus gesehen hatte. Sein Gastgarten lag im Schatten eines alten Baumes mit riesiger Krone. Man hatte das Radio eingeschaltet, und der Klang einer Bouzouki perlte in akustischen Tröpfchen über den Platz.
Ich setzte mich hinten an einen Tisch.
Viel Kundschaft hatte das Café nicht. Bloß drei Opas, die wahrscheinlich schon dem guten, alten Perikles mit nützlichen Ratschlägen ausgeholfen hatten. Sie saßen alle eigenbrötlerisch an ihrem eigenen Tisch und schauten müßig über den Platz, tranken mit ernster Hingabe Kaffee und spielten mit ihren Komboloi. Das waren so Ketten mit kleinen Perlen, die man in einer Hand hin- und herschwenkte, was dann jedes Mal Klack machte.
Alle drei drehten sich zu mir um. Ohne mit der Wimper zu zucken warf einer der Opas den anderen eine kurze Bemerkung zu und schwenkte seine Komboloi. Klack. Klack. Klack.
Die beiden anderen glucksten und schwenkten ihrerseits ihre Komboloi. Klack. Klack. Klack.
Ich hörte hinter mir Schritte über den Schotter knirschen.
Ein erstaunlich blasser Kellner pflanzte sich neben mir auf. „Yássou“, sagte er und deutete den Hauch eines Lächelns an.
„Mía bíra, parakaló“, antwortete ich. Erneut auf Griechisch, weil ich mein Erlebnis am Períptero natürlich schon wieder vergessen hatte.
Doch diesmal war mir das Glück hold. Dem Kellner schien nicht nur Lächeln, sondern auch Geschwätzigkeit verhasst zu sein. Er beschränkte sich also auf die Aufzählung der Biersorten, die sie vorrätig hatten.
Ich bestellte ein Mythos.
Der Kellner knirschte ins Café zurück. Die Opas sahen mich an, scherzten erneut, lachten und ließen ihre Kettchen schwingen. Klack. Klack. Klack.
Nachdem mein Bier serviert worden war, studierte ich den Baum, dann den Hauptplatz mit seinen niedrigen Häusern, schließlich die drei Opas. Viel mehr gab‘s hier nicht zu tun.
Ah, schau mal. Ein schwarz-weiß gescheckter Hund mit zotteligem Fell trottete von irgendwo daher und setzte sich mitten auf die Straße. Er kratzte sich energisch hinter einem Ohr. Als er damit fertig war, sprang er wieder auf die Pfoten, schüttelte sich und gähnte. Sein Blick fiel auf das Café. Er kam herübergetrottet, machte einen großen Bogen um die Opas und strebte auf mich zu.
Besonders gefährlich sah der Wuffi nicht aus. Wem er wohl gehörte? Keinem der drei Opas, so viel war klar; er hatte eher misstrauisch zu ihnen hinübergelugt.
Der Hund schnupperte meine Beine ab. Dann setzte er sich hin und sah mich mit einem treuherzigen Hundeblick an.
Ich beugte mich hinunter und kraulte ihn hinter den Ohren.
Als kleines Dankeschön leckte er mit heißer, rauer Zunge meine Hand ab, bevor er sich zu meinen Füßen ausstreckte. Er stieß einen herzlichen Seufzer aus, bettete seinen Kopf auf seine Vorderpfoten, schloss die Augen und schnarchte binnen Minuten.
Die Opas drehten sich um, Klack, Klack, Klack, schauten uns an, einer gab einen Kommentar ab, Klack, Klack, Klack. Alle drei lachten.
°°°
Die Highlights der folgenden halben Stunde waren ebenso aufregend.
Zwei Frauen in Bikini und einem Strandtuch um die Hüften spazierten diskutierend über den Platz.
Ein Kastenwagen voller Melonen fuhr am Café vorbei.
Ein Bus blieb unter dem alten Baum stehen und spuckte einen einzigen Passagier aus. Der trug einen langen, schwarzen Kaftan und einen hohen, schwarzen Hut auf dem Kopf. Sein Bart war lang und grau meliert, sein weißes Haar trug er im Nacken zu einem Dutt gerollt.
Ein Pope. Wahrscheinlich sogar der Dorfpope.
Der Mann wischte sich mit einem großen Taschentuch übers Gesicht. Als er die drei Opas erblickte, winkte er ihnen zu.
Die drei winkten zurück, warteten, bis er hinter der Kirche verschwunden war, kommentierten und lachten, Klack, Klack, Klack.
Die Zikaden zirpten, die Hitze ließ die Minuten anschwellen. Der Staub tanzte über den Asphalt, die Komboloi klackten regelmäßig.
Ein Mofa kam von links daher. Der Fahrer war ein sonnengebräunter, junger Mann in grünen Badeshorts und einem schwarzen, ärmellosen T-Shirt. Er drehte den Motor ab, lehnte das Mofa gegen eine Mauer und ging zum Períptero hinüber.
Ich trank einen Schluck Bier und merkte an, dass er recht gut gebaut war. Vor allem sein Hintern sah überaus knackig aus.
Der junge Mann kam mit einer Schachtel Zigaretten in der Hand vom Hüttchen zurück. Seine halblangen, schwarzen Haare glänzten in der nackten, weißen Nachmittagssonne. Er war nicht nur recht gut gebaut, verbesserte ich mich augenblicklich – er war sogar sehr gut gebaut. Hallo, hallo, hallöchen! Groß, schlank, muskulös, mit einem vielversprechenden Haargekruse im Ausschnitt. Noch dazu war er irrsinnig fesch.
Moment mal – war das nicht derselbe Junge, der sich einen abgekichert hatte, als ich mit meinem T-Shirt kämpfte? Ja freilich war er das.
Der Junge schwang sich elegant auf sein Mofa. Meine Güte, was für Oberschenkel der hatte! Ich biss mir unbewusst auf die Unterlippe.
Er schaute auf, sein uninteressierter Blick schweifte über das Café…
… und blieb an mir hängen.
Seine Augen weiteten sich flüchtig, bevor er mich angrinste.
Kein Wunder. Ich stierte ihn gerade von oben bis unten an. Und zwar mit einem Gesichtsausdruck… als ob meine Augen soeben gelernt hätten, einen Steifen zu bekommen. Weil halt mein… äh, mein Sinn für Ästhetik so ausgeprägt war, dass ich jegliche Diskretion vergessen hatte.
Ich heftete meinen Blick sofort auf meine Fingernägel und spürte, wie mir auffällige Schamesröte ins Gesicht schoss.
Das Mofa sprang an, Dröht, Dröht, und entfernte sich.
Ich zählte bis zehn, bevor ich wieder aufschaute, um dem Jungen einen letzten Blick hinterherzuwerfen. Er war wirklich eine Augenweide.
Bevor er hinter einem Haus verschwand, drehte sich der Junge um. Und überraschte mich dabei, wie ich ihn schon wieder anstierte.
Er grinste erneut.
Und ich wurde erneut rot.
°°°
So manch einer hätte sich in Levkos sicher gelangweilt. Es tat sich hier gar nichts. Aber mir tat die Ruhe total gut. Ich saß bequem im Schatten herum, hatte ein kühles Bierchen in Greifweite und konnte abchillen. Niemand ging mir auf den Keks. Niemand interessierte sich mehr als notwendig für meine Wenigkeit.
Ein gemütliches Wohlgefühl überkam mich.
Kurz nachdem der Junge auf seinem Mofa verschwunden war, kam jedoch eine Dreiergruppe daherspaziert. Ich erkannte Paul-Auguste, Isaure und den Sohnemann.
Sie blieben vor dem Café stehen, und der Kleine krähte: „Ich will’n Colaaaa!“
Als ob die bekannten Gesichter den sanften Zauber des Dorfes wie eine Seifenblase zerplatzen ließen, sank meine Laune erneut ab. Einzelheiten meines katastrophalen Lebens fielen mir wieder ein: der Wecker, der zu nächtlicher Stunde geläutet hatte; das unverschämt teure Taxi; der Trubel am Roissy-Flughafen; der unbequeme Sitz im Flugzeug; die Busfahrt; Cindy; meine Einsamkeit. Und der tiefere, pochende Schmerz, der „Alex“ hieß.
Eine müde Traurigkeit überrollte mich. Mein Blick wurde trüb, und ich musste schlucken, damit ich nicht anfing zu heulen.
Vage sah ich, wie Paul-Auguste und seine Familie sich zierten, bevor sie einen Tisch auswählten. Ich sah, wie Isaure ein feuchtes Putztuch aus ihrer Handtasche zog und rasch Tisch und Sessel abwischte. Der blasse Kellner musste dann gute zehn Minuten warten, bis sie sich entscheiden konnten, was sie bestellen wollten.
Ich sah auch noch andere Urlauber aus dem Hotel durch die Gegend schlendern. Die ältere Dame und ihre Tochter, die Zitronenlady, zum Beispiel. Die beiden trugen große Strohhüte.
Ich sah, wie Isaure ganz schmale Lippen bekam und ihrem Mann ein paar Worte zuraunte. Er drehte sich um, erkannte die beiden Frauen und runzelte die Stirn.
Ich sah die vulgäre Scherztruppe am Café vorbeispazieren; sie redeten laut durcheinander und lachten.
Aber das alles spielte sich ab, als ob sich ein schwarzer Schleier darüber gesenkt hätte. Ich wollte eigentlich nur eins: ganz, ganz, ganz weit weg sein.
Den Hund berührte das gar nicht. Der schnarchte immer noch unbekümmert zu meinen Füßen.
4 | Ich nahm eine lange, kalte Dusche
Ich nahm eine lange, kalte Dusche, als ich zurück im Hotel war. Das war fast so etwas wie eine Ohrfeige, damit ich endlich aufhörte, mich unnötig zu quälen.
Und die kalte Dusche bewirkte tatsächlich Wunder. Ich zitterte wie Espenlaub, als ich das Badezimmer verließ, aber wenigstens fühlte ich mich etwas besser.
Ich versprühte Parfüm über meinen Körper und zog mich an. Eine ausgewaschene Jeans, mein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „Born This Gay“, ein Paar Turnschuhe. Elegantere Klamotten waren nicht nötig, wir waren schließlich nicht im „Ritz“. Gottseidank.
Ich atmete tief durch und wagte mich in den Hotelgang hinaus. Das erste Abendessen würde sicher eines der unangenehmeren Erlebnisse sein. Schon mal die ganzen Leute, die es zu ertragen galt. Dann kannte ich kein Schwein. Ich würde mich also wieder mal wunderbar einsam fühlen.
Trag’s mit Fassung – that‘s life, lieber Damien. Ich war allein. Ich würde also allein dinieren, den Rest des Abends allein verbringen und dann allein schlafen gehen. Ganz zu schweigen vom Rest meines Lebens, den ich wahrscheinlich auch allein verbringen würde…
Drechsler – jetzt hör bloß auf mit dem Scheiß!
Dieses Mal war es eine andere Art Ohrfeige, die laut durch den Gang hallte. Nämlich eine echte und handfeste, die ich mir eigenhändig verabreichte.
°°°
Im Erdgeschoß surrten Gespräche durch die Halle, als ich an der Rezeption vorbeiging. Heute Nachmittag hatte ich mir das ja nicht so genau angesehen, aber jetzt entdeckte ich, dass neben dem Tresen ein großer Barbereich lag. Dort standen Leute in kleinen Gruppen herum, schlürften Aperitifs und plauderten angeregt. Hauptsächlich auf Griechisch. Die Bar war zeitgenössisch ausgestattet, das heißt im pseudoindustriellen Stil, alles aus Metall und Glas, in Dunkelgrau und ungebleichtem Weiß gehalten und gedämpft beleuchtet.
Ganz hinten vor den Glastüren hatte man einen großen Fernseher aufgestellt. Er war eingeschaltet, der Ton jedoch abgedreht. Es sah ohnehin niemand hin. Außer Madame Régnier hinter ihrem Rezeptionstresen. Die schien direkt fasziniert von den Bildern, die über den Bildschirm huschten.
Unwillkürlich schaute ich auch hin.
Aha, okay. Die Fernsehnachrichten zeigten einen Bericht über einen Unfall. Ich sah eine kurvenreiche Straße, eine Polizeiabsperrung, einen Rettungswagen. Die Kamera zoomte auf eine Böschung und ein ziemlich zerknautschtes deutsches Markenauto. Den Stern auf dem Kühler konnte man kaum mehr als Stern bezeichnen. Wahrscheinlich ein Lenker, der ein anderes Fahrzeug forsch überholt hatte, ätschipätsch. Und dem ganz überraschend ein anderer PKW entgegengekommen war. Man bremst zu spät, und – Bumsti! Ein schöner Mercedes verwandelt sich in Metallorigami.
Unten links entzifferte ich die Buchstaben P-A-T-R-A-S. Ach, deswegen interessierte sich die Rezeptionistin so für den Unfall. Patras war nur wenige Kilometer von hier entfernt.
Mein Magen knurrte. Und meine Wissbegier für Lokalinfos löste sich in Luft auf.
°°°
Ich häufte mir Mezze auf einen Teller und schnappte mir im Vorbeigehen eine Karaffe Retsina, bevor ich den Speisesaal verließ und in den Hotelgarten hinaustrat.
Links von mir befand sich eine Terrasse mit gedeckten Tischen.
Die Rasenfläche vor mir war gerade bewässert worden und glitzerte in den letzten Sonnenstrahlen, als ob man Perlen verstreut hätte. Die hohen Palmen schwankten in der warmen Abendbrise, die Rosensträucher verströmten betörende Düfte.
Ich ließ meinen Blick weiterwandern und sah, wie sich hinter der Bar zwei schemenhafte Silhouetten aufeinander zubewegten. Der Grund für ihr Annäherungsmanöver wurde klar, als sie sich umarmten und mit viel Hingabe, Inbrunst und Zungenspiel küssten.
Ich seufzte auf. Meine Güte, wie romantisch! Plötzlich hatte ich Lust, mein Leben zurückzuspulen und meine Entscheidungen rückgängig zu machen. Eine komplett idiotische Reaktion – mit Alex hätte ich so einen leidenschaftlichen Moment sicher nicht erlebt. Aber wenn man traurig ist, leidet man oft an mangelndem Scharfblick.
Die beiden schemenhaften Personen ließen einander wieder los. Eine der beiden eilte zur Strandstiege hinüber. Es fiel mir nicht schwer, Cindys mollige Formen wiederzuerkennen.
Die andere Person zündete sich eine Zigarette an. Flüchtig sah ich das Gesicht eines jungen Mannes mit Baseballkappe. Sicher ein junger Grieche auf der Suche nach Zuneigung. Oder einfach notgeil. Wer sich Cindy freiwillig antat, musste einen triftigen Grund haben, denn die war sicher kein Honigschlecken.
Ich schüttelte den Kopf und wandte mich der Terrasse zu.
Die ersten Tische waren alle besetzt, also wanderte ich mit gesenktem Kopf weiter. Es duftete nach diversen Sommerparfüms und Feuchtigkeitscremen auf Kokosnussbasis. Dazu gesellte sich der bodenständigere Geruch von Grillkoteletts und Holzkohle – vor der Küche hatte man ein Barbecue aufgebaut.
Endlich entdeckte ich einen freien Platz. Ich wollte ihn gerade anpeilen, als ich hinter mir lautes Gelächter hörte. Ein Mann brüllte: „Du bist echt ein Trottel, René! Ich habe mich beinahe angepisst!“
Charmant. Die Witzboldtruppe aus dem Bus.
Automatisch ging ich weiter. Schade um den freien Platz. Aber neben diesen Leuten zu nachtmahlen fand ich ebenso erstrebenswert wie einen chirurgischen Eingriff.
Als ich am anderen Ende der Terrasse angekommen war, musste ich mir eingestehen, dass die Situation noch schlimmer war als befürchtet. Die Leute schienen sich alle zu kennen; sie diskutierten, lachten, gestikulierten. Ich fühlte mich wie ein Eindringling.
Unentschlossen betrachtete ich noch einmal die Tische links und rechts. Kein einziger Platz frei. Mir kam sogar vor, dass man mir misstrauische Blicke zuwarf und sich fragte, was mich hierher verschlagen hatte.
In dem Moment lachte jemand.
Dann sagte die gleiche Person: „He, dein T-Shirt ist ja super! Wo hast du das denn her?“
Ich blickte auf.
Vor mir saßen die junge Frau, die gleichzeitig mit mir im Hotel angekommen war, und die zwei Jungs, die ich als ihre Brüder identifiziert hatte. Sie zeigte mit dem Messer auf mein T-Shirt und grinste übers ganze Gesicht. Die beiden Burschen schauten ebenfalls zu mir her, aber eher uninteressiert.
Ich lächelte zurück und warf einen raschen Blick auf mein T-Shirt. „Ach, das. Das habe ich auf Internet gefunden, aber das ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch im Angebot haben.“
„Schade. Ich find’s wirklich toll!“
Die junge Frau bemerkte, dass ich einen Teller und eine Karaffe in Händen hielt. „Du suchst nicht zufällig einen Platz?“
„Doch“, antwortete ich. „Aber auf der Terrasse ist schon alles voll. Ich werde in den Speisesaal zurückgehen – der war leer, so viel ich gesehen habe.“
„Ja klar ist der leer. Ist ja viel zu heiß da drinnen. Hey, willst du dich nicht zu uns setzen?“ Sie zeigte auf den leeren Sessel an ihrem Tisch, der mir gar nicht aufgefallen war.
„Ja, gerne. Wenn’s euch nichts ausmacht.“
„Woher denn“, sagte sie.
„Na dann, danke.“ Ich stellte meine Sachen auf den Tisch und streckte die Hand aus. „Ich bin Damien.“
Sie schüttelte sie. „Ich bin Sandrine. Und die beiden hier sind meine Brüder Timothée…“ Sie zeigte auf den Jüngeren. „… und Thomas.“
„Grüß euch, Jungs.“
„Hi.“
„Hi.“
°°°
Während wir aßen, plauderten wir über dies und das. Zuerst über die Reise, dann über das Hotel – im Positiven – und über Cindy – hauptsächlich Negatives. Die beiden Jungs waren nicht sehr gesprächig, aber Cindy entpuppte sich als angenehme Gesellschaft. Außerdem war sie sehr adrett. Ziemlich füllig, aber zufrieden mit ihren Rundungen. Anstatt sie zu verbergen, führte sie sie stolz vor, und was sie anhatte – schwarze Leggings und eine weite, bunte Bluse mit großzügigem Ausschnitt – stand ihr gut. Sie sah aus wie eine Frau, die das Leben in vollen Zügen genoss, enthusiastisch und von ansteckend guter Laune. Sie lachte gern und oft und hatte ein bissiges Mundwerk, dem vor allem unsere Cindy zum Opfer fiel.
Sobald das Dessert verzehrt war, sprangen die Jungs auf und liefen zu einer Gruppe Jugendlicher, die sich bereits in einem Eck versammelten. Sandrine und ich speisten in aller Ruhe fertig, bevor wir zur Poolbar hinübergingen, wo ich uns Kaffee bestellte.
Die junge Frau zuckerte und rührte um. „Also… was machst du so im Leben?“ Sie fuhr sich langsam durch die langen, schwarzen Haare. Ihre großen, blauen Augen sahen mich entwaffnend an.
„Ich bin Übersetzer“, antwortete ich. „Und du?“
„Ich arbeite im Marketing-Sektor. Nichts Aufregendes. Und was übersetzt du genau? Verträge und Gebrauchsanleitungen und so?“
„Oh, nein, Gottseidank nicht! Ich habe mich durch viel Glück auf Krimis spezialisieren können. Das passt toll, weil ich Bücher und vor allem Krimis liebe.“
„Das ist ja lustig – ich auch! Welche Autoren übersetzt du so?“
„Junge englisch- und deutschsprachige Autoren. Ich weiß nicht, ob du die kennst: Renate Karner. Holger Sahn. J. D. Fowler. Billie Jones.“
„Ja sowieso! Billie Jones!“, rief sie aus. „Das ist eine meiner Lieblingsautorinnen! Und du bist der, der ihre Bücher übersetzt! Das ist ja’n Ding!“
„Du kennst Billie?“, wunderte ich mich.
„Und wie! Huntington und Forbes. Die sind ein Hammer!“
Was für ein glücklicher Zufall, dass ich auf jemanden gestoßen war, der die gleichen Bücher mochte wie ich. Was das Thema anging, war Sandrine außerdem genauso leidenschaftlich wie ich und fing sofort an, mich über Billie und Schwulenkrimis auszufragen. Ich war in meinem Element.
Die Fangfrage fiel dann ohne Vorwarnung. „Wie kommt’s eigentlich, dass du ganz allein hier bist?“, fragte Sandrine irgendwann und warf mir einen beiläufigen Blick zu.
„Ach Gottchen, das ist eine komplizierte Geschichte“, wich ich schnell aus. Grad hatte ich noch so schön meine Probleme verdrängt. Auf keinen Fall wollte ich mir den Abend verderben und über mein Liebesfiasko referieren.
„Ach ja? Erzähl!“, sagte Sandrine, als hätte sie meinen Widerwillen nicht gespürt.
„Hör mal, ein anderes Mal gerne, aber nicht jetzt, wenn’s dir nichts ausmacht.“
„Okay. Kein Problem.“ Sie steckte meine Weigerung elegant weg. „Und sonst… hast du vor, dir was anzuschauen? ‚Thalassa Voyages‘ bietet ein paar interessante Exkursionen an.“
„Weiß ich noch nicht so genau. Und du?“
Sandrine nickte eifrig. Sie zählte mir die Liste der Dinge auf, die sie in den nächsten vierzehn Tagen machen wollte. Ich hörte zu und war fasziniert von ihrer überschwänglichen Energie. Sie nannte die Meteora-Klöster, Athen, Olympia und noch viel mehr Sehenswürdigkeiten, die sie besuchen wollte.
Als ihr nichts mehr einfiel, betrachteten wir die Landschaft, über die mittlerweile die Nacht hereingebrochen war. Ein Küstenlüftchen strich über den Strand, griechische Popmusik knarrte diskret im Radio. Das nur wenige Schritte von uns entfernte Meer machte Plitsch und Platsch, und die Kieselsteine klickten und klackten hie und da.
„Au Kacke!“, rief Sandrine plötzlich aus. „Wie spät ist es eigentlich?“ Sie griff nach meiner Hand und starrte auf meine Armbanduhr. „Mein Gott! Hab gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht! Sorry, aber ich muss dann mal. Ich habe Mama versprochen, dass ich sie heute Abend anrufe und ihr erzähle, wie die Reise verlaufen ist.“
„Du bist ja eine zuvorkommende Tochter“, lachte ich.
„Auch. Wenn ich nicht sofort anrufe, würde sie aber vor allem den nächsten Flug nehmen, um persönlich nachzuschauen, ob wir noch am Leben sind! – Okay, ich spute mich. Wir sehen uns sicher noch in der Disco. Bis später.“ Sandrine stand auf und schenkte mir ein freundliches Lächeln. „Danke für den Kaffee.“
„Nichts zu danken, schönes Kind. Bis später.“
Ich sah ihr nach, als sie ins Hotelgebäude zurückeilte.
Gut. Und nun?
Ich stocherte mit dem Löffel in der Tasse herum, als würde der Kaffeesatz Antworten bereithalten. Nein, er hielt gar nichts bereit. Zumindest nicht für meine Augen. Meine Mutter hätte sich austoben können, aber die las die Zukunft in fast allem, ob das jetzt Kaffeesatz war, Tarotkarten oder die Fluglinien von Tauben…
Ehrlich gesagt fühlte ich mich… was wäre wohl das richtige Wort? Ambivalent vielleicht. So irgendwie dazwischen. Als ob ein kleiner Teufel auf meiner linken Schulter und ein kleiner Engel auf meiner rechten Schulter säßen und mir widersprüchliche Vorschläge ins Ohr flüsterten.
Der kleine Teufel schlug vor, ich solle doch hier sitzenbleiben und mir ein Getränk bestellen. Mit Alkohol drin natürlich. Dann noch eins. Und noch eins. Um dann runter an den Strand zu gehen, mich auf einen Liegestuhl fallen zu lassen, ins Leere zu stieren, zu grübeln, traurig zu werden, warum nicht auch kurz mal wieder zu heulen.
Der kleine Engel riet mir sofort von diesem Programm ab und schlug an seiner Stelle einen Verdauungsspaziergang vor.
Die zwei kämpften einen Moment miteinander.
Dann gewann der Engel die Schlacht. Wahrscheinlich, weil ich genug davon hatte, blöd in der Gegend herumzuflennen.
5 | Die junge Nacht lockte geheimnisvoll, die
Die junge Nacht lockte geheimnisvoll, die kleine Landstraße war in warme Dunkelheit gehüllt. Über den schwarzen Bäumen leuchteten Tausende von Diamanten im Samthimmel. Von Zeit zu Zeit blieb ich stehen, um das Firmament zu betrachten, während ich versuchte, bekannte Sternbilder zu finden.
Aber. Ich war ja noch immer ich, also kehrten meine Gedanken nach wenigen Minuten auf vertraute Pfade zurück. Vor allem auf den Pfad namens „Alex“. Wie die Geschichte mit ihm geendet hatte. Die emotionale Wüste, die mein Leben seither war.
Ich fühlte erneut, wie mich das Gewicht meiner Einsamkeit bedrückte.
Scheiße! Schau doch, wie schön es hier ist!, schimpfte mein innerer Engel. Riechst du den Duft der Freiheit nicht, den diese schöne Nacht verströmt?
Mja. Ich roch ihn.
Die Nacht wäre noch schöner, wenn du jemanden hättest, mit dem du sie genießen könntest, warf mein Teufel boshaft ein.
Jetzt hör mir mal gut zu, sagte der Engel. Du solltest endlich lernen, dich auch alleine wohl zu fühlen. Um glücklich zu sein, braucht man nämlich nicht unbedingt eine andere Person an seiner Seite.
Nicht ganz abwegig, antwortete der Teufel. Aber das ist mal wieder einer von den schwierigeren Lernprozessen, gell. Du wirst dich die ganze Zeit hundsmiserabel fühlen. Und du wirst alleine sein.
Allein sein, während du Alleinsein lernst – gehört das nicht irgendwie zum Konzept?, bellte der Engel.
Als ich den Friedhof erreicht hatte, war ich erschöpft. Nicht wegen der zurückgelegten Entfernung, sondern weil es mich längerfristig viel Kraft kostete, immer wieder dieselbe Kacke wiederzukäuen. Ich ließ mich auf die kleine Bank vor der Friedhofsmauer fallen und zog meine Zigaretten heraus.
Der Geruch der Zypressen schwebte durch die Nachtluft. Der Friedhof in meinem Rücken war in rätselhafte Stille gehüllt. Ein heißer Luftstrom verwehte den Rauch meiner Zigarette, während sich der dunkle Himmel über mir wie eine Schutzglocke über einen kostbaren Gegenstand krümmte.
Ich starrte die schwarzen Schemen der drei Straßenlampen am Straßenrand an. Keine von ihnen war eingeschaltet, wie ich geistesabwesend wahrnahm.
Und wenn mein kleiner Engel recht hatte? Nicht in allen Belangen, du lieber Himmel, nein! Aber angesichts dieses Ortes dürften die nächsten zwei Wochen sehr ruhig werden. Sollte ich das nicht ausnützen? Mal provisorisch Bilanz ziehen, mein Leben und seine Basis überdenken? Mir vielleicht sogar neue Ziele setzen – was weiß ich, mehr ausgehen, zum Rauchen aufhören, gesünder leben, Sport betreiben?
Sport betreiben! Der war gut, kicherte mein Teufel.
Der Lärm eines Mofas unterbrach meine Überlegungen. Jemand kam vom Dorf daher. Ich sah den vorderen Scheinwerfer über die Straße gleiten, als ob er suchend Stück für Stück abtastete.
Plötzlich fiel mir das Scheinwerferlicht mitten ins Gesicht.
Momentan erblindet schloss ich die Augen.
Der Fahrer bremste und stellte den Motor ab. Die darauffolgende Stille legte sich über die Nacht wie ein geheimnisvolles Vorzeichen.
Ich öffnete meine Augen wieder und brauchte einen Augenblick, bis ich den Störenfried erkannte. Heute Nachmittag hatte ich ihn ja nur in Shorts und ärmellosem T-Shirt gesehen. Jetzt trug er ein hippes, kariertes Hemd, enge, weiße Jeans und Turnschuhe. Er hatte sein schwarzes Haar aufgegelt, es stand ihm in hübschen Zacken vom Kopf.
Aber Zweifel gab es keinen. Das war derselbe Junge, dem ich heute schon zweimal unter besonderen Umständen begegnet war. Einmal, als er seine Erbsen schälte, und ein zweites Mal, als ich im Gastgarten des Cafés saß.
Der Junge stieg vom Mofa ab, und eine Wolke „Acqua di Giò“ waberte zu mir herüber. Da war wohl jemand in seiner Parfümflasche herumgeschwommen, bevor er außer Haus ging.
Er setzte sich neben mich und warf mir einen flüchtigen Blick zu, bevor er murmelte: „Yássou.“
„Yássou“, antwortete ich, während ich aus den Augenwinkeln zu ihm hinüberlugte. Selbst in dieser zappen Dusterheit war er unleugbar hübsch.
Der Junge deutete auf meine Zigaretten und fragte: „Échis éna tsigáro?“ Seine Augen blitzten im Dunkeln auf. Ich war von seiner weichen, aber tiefen Stimme überrascht.
„Nai… äh… fisiká.“ „Fisiká“, so wusste ich, bedeutete auf Griechisch „klar doch“.
Ich reichte ihm die Schachtel.
Unsere Finger berührten sich. Das dauerte nicht länger als ein Augenzwinkern, aber ich fühlte so etwas wie einen Stromschlag.
Ich zog meine Hand zurück, als ob ich mich verbrannt hätte. Mein Herz schlug plötzlich heftig in meiner Brust, und mein Mund wurde ganz trocken.
Die weißen Zähne des jungen Griechen blinkten in der Finsternis auf.
Um meine Verwirrung zu kaschieren, stotterte ich auf Französisch: „Désolé… äh… tut mir leid, ähm… ich kann… äh… ich kann eigentlich gar kein Griechisch.“
Meine Überraschung war immens, als der Grieche sich in meiner Zigarettenschachtel bediente, sie mir zurückgab und erwiderte: „Das macht nichts. Ich kann ein bisschen Französisch.“
Auf Französisch und akzentfrei, bitteschön. Er stotterte auch viel weniger als ich.
„Echt?“, fragte ich dümmlich.
„Ja. Echt.“ Der Junge klang ziemlich selbstzufrieden.
Wir rauchten vor uns hin. Mein Herz schlug noch immer viel zu schnell, und ein sonderbares, flaues Gefühl machte sich in meinem Bauch breit.
Nach einer kleinen, sechsminütigen Ewigkeit dämpfte der Bursche schließlich seine Zigarette an der Mauer hinter der Bank aus. Seine Bewegung ließ eine frische Parfümwelle zu mir herüberwehen.
„Hast du vielleicht Lust auf einen kleinen Ausflug mit meinem Mofa?“, fragte er plötzlich. Seine Stimme klang rau.
Mein Herz klopfte wie verrückt. Ich hatte fast Angst, dass er es hören könnte.
Natürlich riet mir mein kleiner, innerer Engel, das Angebot abzulehnen. Bloß… jemand hatte bereits geantwortet. Und zwar: „Also, äh, ja. Warum eigentlich nicht?“
Zu meiner großen Verblüffung waren diese Worte aus meinem eigenen Mund gekommen.
„Cool.“ Der Junge stand auf, holte sein Mofa und schwang sich auf den Sitz. „Wollen wir dann?“
Ich ging zu ihm rüber und setzte mich hinter ihn. Als ich mich umdrehte, um die Haltegriffe zu suchen, fasste er mich an den Händen, zog sie nach vorne und kreuzte sie über seiner Taille. Nicht wirklich unangenehm, ganz und gar nicht. Aber… unerwartet. Ja, unerwartet. Durch den Stoff seines Hemdes spürte ich seine angespannten Bauchmuskeln, seine Körperhitze ließ sofort auch meine eigene Körpertemperatur ansteigen.
Der Junge warf das Mofa an.
°°°
Wir fuhren einen engen, gerade einmal zwei Meter breiten Weg entlang, der vom Friedhof abzweigte und durch die Pampa führte, zwischen Gärten und Zitronenplantagen hindurch, die ich links und rechts in der Dunkelheit erahnen konnte. Der Mofascheinwerfer beleuchtete immer nur ein paar Meter Straße vor uns, aber der junge Grieche fuhr flott. Immerhin kannte er die Gegend.
Zumindest hoffte ich das. Mir wäre nämlich lieber gewesen, er würde beide Hände zum Lenken verwenden. Was er genau nicht tat. Immer wieder glitt eine heiße, feuchte Hand über meinen Oberschenkel, um mich hie auf eine kleine Hütte, da auf einen Olivenbaum aufmerksam zu machen. Sogar die Mülldeponie des Dorfes schien ihm zeigenswert. Im Dunkeln sah ich nicht viel, und ich fragte mich, warum er diese Sightseeing-Tour improvisierte. Weil, „dörfliche Mülldeponie by night” – das musste einem erst einmal einfallen!
Der Fahrtwind pfiff mir um die Ohren, während ich spürte, wie sich der heiße, muskulöse Körper des jungen Griechen an mich schmiegte. Sein Parfüm stieg mir in die Nase, und jedes Mal, wenn seine Hand auf meinem Oberschenkel landete, erschauderte ich.
Noch dazu bewegte sich der Junge die ganze Zeit vor mir hin und her. Ich musste sofort wieder an seinen kleinen Knackhintern in den Badeshorts denken. Derselbe kleine Knackhintern rieb also gerade gegen meine Leistengegend. Kein Wunder, dass es in meinen Jeans immer enger wurde.
Um meinen Zustand zu kaschieren, schrie ich ins Ohr des Jungen: „Ich heiße übrigens Damien!“
Nikos drehte seinen Kopf zur Seite. Sein Dreitagebart kratzte über meine Wange. Ich spürte, dass er schon wieder grinste.
„Ich bin Nikos. Sehr erfreut!“, antwortete er.
°°°
Irgendwo in Strandnähe, keine zwanzig Meter vom Meer entfernt, blieb der Junge stehen und stellte den Motor ab.
Ich stieg vom Mofa, bemüht, meinen Schrittbereich so gut wie möglich zu tarnen. Selbst im Dunkeln waren die Nebenwirkungen unseres eng-an-engen Ausfluges zweifellos gut sichtbar. Ich war seit ein paar Wochen Single, darum reagierte mein Körper auch so schnell auf den eines anderen Mannes… noch dazu eines jungen Mannes, der so knackfrisch wie Nikos war…
Ich konzentrierte mich dermaßen auf meine Intimzone, dass ich beinahe hintüber vom Mofa geplumpst wäre.
Nikos fing mich im letzten Moment auf.
Er lachte lauthals auf. „Bist du immer so ungeschickt?“, wollte er wissen, bevor er nach meiner Hand griff.
Ausgestellte Kunstwerke bitte nicht anfassen!, meinte mein innerer Engel streng.