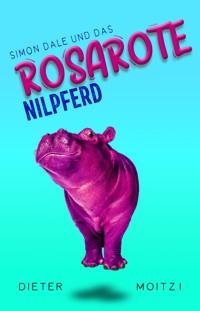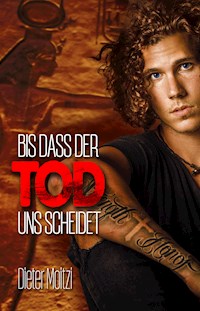3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Leute sagen immer, ich sollte dankbar sein. „Du siehst gut aus, Marc“, sagen sie, „du bist reich, jung und intelligent.“ Okay, wenn man genug Zeit und Gelegenheit hat, verzapft man gern so einen Blödsinn, glaube ich. Sehe ich gut aus? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber anscheinend ja; jedenfalls erlaubt mir mein Aussehen, gut davon zu leben. Ich bin nicht reich, möchte ich anmerken, aber die Männer und Frauen, die für meine Gesellschaft bezahlen, werfen mir genug Krümel ihres Reichtums zu. Ich bin auch noch ziemlich jung, aber seit wann ist das eine persönliche Leistung? Tja, und meine sogenannte Intelligenz… da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Intelligentsein etwas ist, wofür man dankbar sein sollte. Im Großen und Ganzen kann ich mich aber nicht beschweren – mein Leben ist nicht unerträglich. Ich langweile mich ein bisschen, bin ein bisschen melancholisch, und meine Stimmung ist oft so schwarz wie die Kleidung, die ich trage. Und jetzt ist mein Vater gestorben. Das sollte mich nicht tangieren – wir haben jahrelang jegliche Verbindung und jeglichen Umgang miteinander vermieden. Aber plötzlich bricht alles zusammen, und mein Leben verwandelt sich in ein furchtbares Chaos…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vorspann
Für Mama und Papa,
die mir gezeigt haben, wie man liebt
***
“Everything as cold as life
Can no one save you?
Everything as cold as silence
And you never say a word”
Cold, The Cure
***
“It’s nothing as it seems... the little that he needs... it’s home
The little that he sees… is nothing. He concedes… it’s home...”
Nothing As It Seems, Pearl Jam
***
my shoes worn out
from dancing from traipsing
from running up hills
I sit on benches now and sofas
my favourite pastime
in this winter cave:
to hum a childhood lullaby
grey with meaning
and listen to the sound of water
dripping slowly from the timeless ceiling
everything is rust
and mould and memories
the torch flickers time and again
hours go limp and
clocks tick backwards
silhouettes and shades waft over
soaked walls
drawing brave new worlds
I know the tide is rising…
and still what can I do
what do I want to do?
this is it:
sit and watch and listen
and nod at chimera
with contentment
shades drifting, unpublished, Dieter Moitzi
Erster Teil | Ein ganz normales Begräbnis
—107—
Er ist bloß so ein Typ. Ungefähr sechzig, schütteres Haar, klein und schlank; manche würden ihn sogar hager nennen. Seine Haut ist weiß und dünn wie Papier. Schmale Lippen, dürre Gesichtszüge, eine blasierte Haltung. Seine Augen sind… Moment… grau? Ja, grau, glaube ich, stahlfärbig, und sein Blick ist kalt, aber nicht zu kalt. Er ist kein Mann der Extreme; so ein durchschnittlicher Typ halt, der aussieht wie ein Provinzbuchhalter oder ein Kleinstadtnotar.
Jemand, der mich wenig interessiert oder tangiert, der mehr durch die Medien flirrt als durch meine Gedanken.
Und dennoch – wahrscheinlich, weil die Schicksalsgötter mal wieder einen ihrer verschmitzt launischen Tage hatten – ist der Typ mein Vater.
Oder besser gesagt, der Typ war mein Vater. Weil er jetzt tot ist.
—106—
Meine ältere Schwester setzt mich davon in Kenntnis. Es ist halb zehn Uhr abends. Ich sitze auf meinem weißen Sofa und blättere in einem Modemagazin herum. Mein Blick ist so leer wie die Gesichter der Models, die auf den Hochglanzseiten posieren. Sanfte Langeweile sinkt durch die halboffenen Fenster, gleitet über die Wände, sickert aus jedem Möbelstück, glitzert auf den Glas- oder Metalloberflächen und bildet ein bewegungsloses, unsichtbares, träges Raum-Zeit-Kontinuum, das mich wie ein Heiligenschein umgibt.
Ich habe den Fernseher eingeschaltet, aber die Lautstärke auf ein leises Flüstern gedämpft. Die leisen Geräusche einer Spielshow vermischen sich mit dem pausenlosen Rauschen des Verkehrs, das von unten heraufdringt. Von Zeit zu Zeit blicke ich von der Zeitschrift auf und bewundere das weißzahnige Lächeln des Moderators, das mir so echt vorkommt wie eine von einem Straßenhändler in Italien gekaufte Handtasche. Ich schaue mir die Show nicht wirklich an. Sie war bloß eine von mehreren Möglichkeiten, die tödliche Stille meiner Wohnung zu übertönen. Als Alternative hätte ich mir die unaussprechliche Traurigkeit einer Mahler-Symphonie anhören oder die stillen Schreie meiner makellosen Mauern ertragen können.
Dann klingelt das Telefon.
Ich hebe ab und erkenne Raphaëlles Stimme. Meine ältere Schwester. Abgesehen davon, dass sie atemlos klingt, ist sie wie immer. Ihre Wortwahl bleibt präzise, ihre lustlos-kalten Betonungen drücken aus, dass wir nicht auf der Welt sind, um Spaß zu haben, sondern aus anderen Gründen, keiner von ihnen besonders angenehm. So ist Raphaëlle, wenn man sie auf den Punkt bringen möchte: unbeeindruckt, unberührt, winterlich. Am besten stellt man sich einen emotionslosen Roboter vor. Ich spreche natürlich von sogenannten positiven Emotionen. Sie kann sehr wohl knapp und autoritär sein. Sie kann auch einen Wutanfall kriegen, wenn es sein muss.
„Hallo Marc. Raphaëlle am Apparat“, sagt sie. Dann erzählt sie mir ohne Umschweife, was Sache ist. Sie ist gerade bei unserer Mutter, weil der alte Mann gestorben ist.
„Echt? Wann denn? Und wie?“, frage ich.
„Lass mich nachdenken… vor zwei Tagen. Oder war’s vor drei Tagen? Weiß ich nicht so genau. Soll ich Mutter fragen?“
„Nein, lass mal. Ich bin bloß überrascht, dass sie es noch nicht in den Nachrichten gebracht haben. Wo ist sie denn gerade? Mutter, meine ich.“
„In der Küche. Sagte, sie hat Hunger.“
„Macht also gerade noch eine Flasche auf, soll das wohl heißen. Ich hätte es wissen müssen. Aber netter Versuch…“ Ich lasse den Satz in der Schwebe, mein Gehirn ist eine Sekunde lang leer. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich Raphaëlle mein Beileid aussprechen? Wäre das der richtige nächste Schritt?
Ich möchte keinen Fehler machen und frage deshalb: „Muss ich zu euch runterfahren? Ich nehme an, es gibt eine Beerdigung, oder?“
„Na sicher.“ Meine Schwester macht ein seltsames Geräusch, so ein Ding zwischen trockenem Lachen und verschnupftem Schnauben. „Man sagt jedoch nicht Beerdigung dazu; das heißt Trauerfeierlichkeiten, liebster Bruder. Aus gegebenem Anlass hab ich sogar meine Perlen mitgebracht. Man muss glamourös sein, weißt du? Aber du klingst nicht so, als ob du kommen wolltest.“
„Willst du mich verarschen? Während Vaters – Trauerfeierlichkeiten, sagst du? – gefilmt zu werden, Himmel, was gibt es Schöneres auf Erden.“
Meine Schwester seufzt. „Marc, verschon mich mit deinem Sarkasmus, ja? Die Beerdigung findet übermorgen statt. Natürlich solltest du ihr beiwohnen. Aber wenn du ihr lieber fernbleiben möchtest, auch kein Problem. Mach, was du willst. Immerhin bist du ein freier Mensch.“ Ihre Stimme klingt weiterhin eintönig.
„Okay. Ich werde mir den Zugfahrplan anschauen“, antworte ich. „Ich ruf dich irgendwann morgen zurück. Ist das in Ordnung?“
„Perfekt.“
Ich bemerke, wie eigenartig ihre Stimme klingt, heiser und krächzend. „Was ist los mit dir?“, frage ich ungläubig. „Sag bloß nicht, dass du geweint hast!“
„Mach dich nicht lächerlich! Es ist nur so… so verdammt kalt in diesem Haus. Ich glaube, ich hab mich verkühlt. Das ist alles.“
—105—
Was für ein Zufall. Erst heute Morgen habe ich eine Ansichtskarte weggeworfen, die mir mein Vater und meine Mutter vor ungefähr einem Monat geschickt haben. Normalerweise bewahre ich sie nicht auf, aber die hier gefiel mir: ein altes Schwarzweißfoto, das die Ufer des Flusses Nive zeigt, mit drei Hausbooten, die vor einem lang gestreckten, verwahrlosten Schuppen vor Anker liegen. Im Vordergrund steht eine Mauer mit barocken Steinvasen und dickblättrigen Kastanienbäumen. Im fernen Dunst kann man eine Hügellandschaft erraten. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem dunklen und bedrohlichen Fluss und den zwei Buben, die nebeneinander auf einem gepflasterten Kai am Wasser stehen und deren Gesichter wie zwei weiße Flecken aufblinken. Einen respektvollen Abstand einhaltend starren sie auf den fließenden Strom. Sie scheinen irgendwie zusammen dazustehen, wirken aber individuell, abgesondert, jeder in seinem eigenen Universum gefangen.
Ein fotografisches Symbol für meinen Vater und meine Mutter. So denke ich immer an sie, die seltenen Male, wenn ich an sie denke. Mein Vater. Meine Mutter. Ich habe sie nie als Einheit sehen können. Sie haben nie dieses Kernelement gebildet, das man mit dem Wort „Eltern“ zusammenfasst.
Im Grunde genommen war es bloß eine ganz gewöhnliche Ansichtskarte. Etwas an ihr hatte mich jedoch angesprochen. Sonst hätte ich sie nicht in mein Bücherregal gestellt.
Bevor ich sie in den Papierkorb warf, las ich mir den Text auf der Rückseite noch einmal durch. Er lautete: „Bayonne ist sehr schön. Das Wetter ist prächtig. Uns geht es gut. Liebe Grüße.“
Was Vater und Mutter mir schrieben, fiel jedes Mal Wort für Wort gleich aus. Wo auch immer sie hinfuhren, die Städte waren wunderschön. All ihre Reisen wurden von einer strahlenden Sonne beschienen. Es ging ihnen immer gut. Und sie sandten mir immer liebe Grüße. Ihre Karten waren wie Rituale; wenn ich sie las, fühlte sich das so an, als würde ich eine Königin und einen König sehen, die in der Kutsche vorbeifahren und ihren Untertanen zuwinken – eine königliche Zufallsgeste, die man leicht für eine persönliche halten könnte.
Natürlich schrieb die Karten immer meine Mutter in ihrer normalen, unpersönlichen Handschrift. Sie unterschrieb die Karten mit „Deine Mutter“, was mir seltsam vorkam. Jedes Mal hätte ich gewettet, dass sie unabsichtlich mit ihrem Künstlernamen unterschreiben würde.
Meine Schwestern müssen die gleichen Ansichtskarten erhalten haben, gleiches Foto auf der Vorder-, gleicher Text auf der Rückseite. Meine Mutter improvisiert nicht. Mein Vater auch nicht.
Er unterschrieb die Karten ebenfalls. Ein Mann, der seine Pflichten kannte. Er nahm den Stapel, den meine Mutter vorbereitet hatte (ich stellte ihn mir dabei immer lustlos aufseufzend vor) und unterschrieb die Karten eine nach der anderen, wobei er sicher das gleiche Interesse, die gleiche Begeisterung und den gleichen Enthusiasmus zutage legte, den danach ein anonymer Postangestellter beim Abstempeln aufbringen würde.
Eine der wenigen Anknüpfungspunkte zwischen meinem Vater und mir: seine Unterschrift auf ansonsten unpersönlichen Ansichtskarten. Selbst der von meiner Mutter handgeschriebene Text und ihre beiden Unterschriften konnten die Unpersönlichkeit der Karten nicht ausmerzen.
„Vater“, schrieb er immer.
Sonst nichts. Bloß „Vater“.
Was unsere Vater-Sohn-Beziehung perfekt zusammenfasst. Ein hastig gekritzeltes „Vater“ auf einer Ansichtskarte.
Jetzt ist er tot. Was zwischen uns auch nichts mehr ändert.
—104—
Ich sitze im Zug. Der Gare de l‘Est entfernt sich, während ich aus dem Fenster schaue. Für die Jahreszeit unerwartete Sonnenstrahlen – es ist Frühlingsbeginn – überschwemmen die Stadt und schaffen es irgendwie, die trostlose Schäbigkeit der hohen Gebäude auf beiden Seiten der Gleise zu unterstreichen. Alles ist schmutzig und grau; sonnengestreift, aber schmutzig und grau.
Ich bin allein in meinem Abteil. Die Provinzstadt, in die ich unterwegs bin, zieht nicht viele Touristen an. Kein Wunder: abgesehen von einer halbzerfallenen Kirche, einem Renaissance-Pavillon und einem riesigen Atomkraftwerk lädt kein besonderes Tourismushighlight dazu ein, den Zug zu nehmen. Ich habe nie verstanden, warum mein Vater beschlossen hat, sich in diesem verschlafenen Loch zu begraben. Sogar sein ehemaliger Wahlkreis liegt mehrere Kilometer weiter weg. Warum meine Mutter damals mitkam, bleibt ein noch größeres Rätsel.
Ich starre auf die ehemaligen Mühlen von Pantin, die Wassermusik dröhnt aus meinen Kopfhörern. Ich hätte Purcells Musik für die Beerdigung von Queen Mary oder Mozarts Requiem wählen können. Die Majestät und muntere Leichtfertigkeit dieses Händel-Stücks erschienen mir jedoch viel angemessener. Ich weiß, dass Vater kein Georg I. war; ich sitze auch nicht an Bord einer Königsbarke, um einen Ausflug auf der Themse nach Chelsea zu machen, und der Anlass ist ziemlich düster. Aber ich habe keine Lust, den untröstlichen Sohn zu spielen. Morgen wird es genug Unaufrichtigkeit geben, also glaube ich nicht, dass dem schon heute etwas hinzuzufügen ist. Zumindest ehre ich Vater mit ein bisschen barocker Feierlichkeit. Besser als nichts.
Mit einem Seufzer entfalte ich Le Monde. Die Nachricht über Vaters Tod fällt eher mickrig aus und befindet sich im unteren Bereich der Titelseite. „Mehr dazu Seite 8“.
Die Zeitung widmet dem Ereignis eine halbe Seite. Für jemanden, der so viele hohe Positionen innehatte, ist das dürftig. In meinen Augen reicht es natürlich aus. Aber trotzdem. „Jean-Marc Forgeron achtundsechzigjährig verstorben“, lautet die Überschrift.
Oh. Achtundsechzig. Ich wusste nicht, dass er so alt war! Das heißt, ich hätte es wissen müssen, nehme ich an.
Ich lese weiter. „Im Alter von achtundsechzig Jahren starb vergangenen Dienstag der ehemalige Außenhandelsminister und Abgeordnete Jean-Marc Forgeron in Nogent-sur-Seine an einem Herzinfarkt. Nach Bekanntgabe seines Todes wurden in seinem früheren Wahlkreis die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Der Präsident, der derzeit in Moldawien unterwegs ist, drückte der Familie sein Beileid aus. Der Sprecher der Sozialistischen Partei bedauerte in einer Presseaussendung, dass ‚unser Land einen großen Staatsmann verloren hat. Obwohl er im Ruhestand war, kommentierte er die aktuellen politischen Ereignisse immer mit immensem Scharfblick.‘“
Wer schreibt bitte diese Nachrufe? Ist schon sehr dick aufgetragen.
Der Artikel ruft auch den Werdegang meines Vaters in Erinnerung: seine Universitätsjahre, sein politisches Engagement, seine verschiedenen Dienste für die Nation. Er erwähnt die Karriere meiner Mutter, wie sie meinen Vater kennengelernt hat, ihre Hochzeit. Sie kommen kurz auf Raphaëlle zu sprechen, dann Angélique und schließlich mich: „Forgerons Sohn, der derzeit als Tourismusberater in der Hauptstadt arbeitet“.
Tourismusberater? Unwillkürlich muss ich kichern. Den Stuss muss Raphaëlle ihnen erzählt haben.
Der Rest ist pures Blahblahblah. Die Parteiprominenz drückt ihre Trauer aus, Vaters politische Gegner weinen die gleichen Krokodilstränen. Jeder bedauert mit falschem Pathos „den Tod eines loyalen, hart arbeitenden Politikers, der seine ganze Energie und Intelligenz dem Wohl des Landes gewidmet hat“, wie ein Minister es ausdrückt.
Erbärmlich! Für den Fall der Fälle habe ich auch Le Figaro und Libération gekauft. Aber schließlich schlage ich die beiden nicht einmal auf. Meine Nerven würden noch mehr von dem Mumpitz nur schwer ertragen.
Mir ist klar, dass ich betroffen aussehen muss. Ich seufze. Als ob die Situation nicht unangenehm genug wäre. Dann sollte ich besser vor einem Spiegel proben.
—103—
Angélique holt mich vom Bahnhof ab. Sie ist alleine gekommen, was mich nicht unbedingt traurig macht. Während der ganzen Reise habe ich mich gefragt, ob Mutter es wagen würde, hier aufzutauchen. Ich habe auf Nein getippt.
Bingo.
Ich hätte jedoch gewettet, dass Raphaëlle, und nicht Angélique auf dem Bahnsteig stehen würde.
Diese Wette habe ich verloren.
Meine kleine Schwester zieht ein Begräbnisgesicht, als ich aus dem Zug steige. Ihre schwarzen Kleider lassen ihr hageres Gesicht unter der wilden, blonden Mähne weiß aufleuchten. Ihre Augen sind rot unterlaufen. Sie versucht zu lächeln, aber es gelingt ihr nur halb. Ihr Mund verzieht sich eher, als würde sie an einer Zitronenscheibe herumkauen.
Wir schauen uns einen Moment an und akzeptieren stillschweigend, dass der erste Schritt immer der schwierigste ist. Ich möchte etwas Tröstliches sagen, aber mein Hirn ist leergefegt. Seltsam, dass ich ein Talent für Sprachen habe, aber manchmal überhaupt keins für Worte.
Schließlich entscheide ich mich, die Dinge von der leichten Seite anzugehen. „Wo ist denn unser Star? Wo versteckst du sie?“, frage ich und schaue nach links und rechts.
„Mutter, weißt du? Ruht sich aus?“ antwortet meine Schwester und dreht ihr schwaches, zitroniges Lächeln ab. Mit ihrem finsteren Gesicht sieht sie plötzlich Raphaëlle sehr ähnlich. Fast erschreckend ähnlich, wenn man bedenkt, wie verschieden die beiden sind.
Mein Fehler. Ich habe vergessen, dass sie die Einzige ist, die Mutter nahesteht. Deshalb hält sie es für ihre Pflicht, die Frau zu verteidigen und zu beschützen. Das Pflichtgefühl liegt übrigens in meiner Familie. Sie sind alle ganz heiß drauf, ihre Pflicht zu erfüllen, sogar Mutter, trotz ihrer Bemühungen, rebellisch, phantasievoll und farbenfroh zu wirken. Ich bin das schwarze Schaf, in dieser Hinsicht wie in vielen anderen.
Meine Schwester starrt mich noch immer an, Tränen glitzern in ihren hellblauen Augen. Dann räuspert sie sich, was bedeutet „Bis hierher und nicht weiter!“
Das stellt für mich kein Hindernis dar. „Mutter ruht sich aus? Netter Versuch! Muss deine Art sein, mir zu sagen, dass sie k.o. ist. Aber okay. Ist mir sowieso egal.“ Ich breite meine Arme aus und mache einen Schritt, um die Distanz zu überwinden, die uns trennt und die so unüberbrückbar erscheint. „Komm in meine Arme!“
Zuerst zaudert sie, aber dann gibt sie auf und umarmt mich. Sie murmelt mit zittriger Stimme: „Das ist nett? Schön dich zu sehen?“
Wie üblich beendet sie ihre Sätze mit Fragezeichen, als ob sie sich dafür entschuldigen wollte, etwas gesagt zu haben, oder ihren Gesprächspartner um Zustimmung bitten möchte oder sich nicht sicher ist, was sie sagen soll. Vielleicht sind alle drei Gründe involviert. Im Laufe der Jahre habe ich mich an diesen Tick gewöhnt. Sie will es nur allen recht machen, will gefällig sein. Man kann das ihren Genen zuschreiben – mit anderen Worten, ihrem Vater.
Sie schnieft, den Kopf an meine Schulter gelehnt.
„Wag es bloß nicht loszuheulen, Angie!“, sage ich.
Sie weicht zurück und reibt sich die Augen. „Ich bin nicht wie du? Alle können nicht so ein kaltes und steinernes Herz haben wie du?“
„Na hör mal, ich bin der Sohn von Cruella und Lord Voldemort. Dem muss ich doch Rechnung tragen, oder?“
—102—
Die Eingangshalle ist leer. Ich stelle meine Reisetasche ab und werfe einen Blick in den ersten Raum links. Mutter nennt ihn den „Salon Bleu“. Er ist vorwiegend weiß, hat aber viel blaue Designerdetails. Ich entdecke Raphaëlle auf der weißen Ledercouch, sie blättert in einem Einrichtungsmagazin herum, ein halb leeres Glas steht vor ihr auf dem niedrigen Glastisch.
Als ich mich umdrehe, bemerke ich, dass Angélique wie ein Geist nach oben gehuscht ist, ohne unsere Schwester eines Blickes zu würdigen.
Na toll.
Ich gehe zu Raphaëlle rüber und küsse sie auf die Wange. „Hallo.“
Ohne aufzublicken, sagt sie ausdruckslos: „Hi, Marc. Hast du es also doch noch geschafft. Auch wenn du mich nicht wie versprochen angerufen hast.“
„Ich hab stattdessen Angie angerufen. Hat sie es dir nicht gesagt?“
„Nein. Sie hat seit ihrer Ankunft kaum mit mir gesprochen. Nett für dich, dass sie mit dir redet.“ Raphaëlle tut so, als ob sie sich auf einen Artikel über Chintz-Vorhänge konzentrieren würde. Okay, sie ist wütend.
„Komm schon“, sage ich. „Willst du mich übergehen, bis ich wieder abreise? Hör zu, es tut mir leid. Ich weiß, ich hätte dich anrufen sollen. Aber die Dinge waren ein bisschen hektisch.“
„M-hm.“
„Geht’s dir so einigermaßen?“
„Na ja“, seufzt sie und sieht mich schließlich an, „ja, mir geht‘s gut. Danke für die Frage. Schenk dir doch ein Glas ein, ja? Ich hasse es, die Einzige zu sein, die um diese Uhrzeit Alkohol trinkt. Ich fühle mich wie eine Säuferin.“
„Bist du sicher, dass du die Tochter unserer Mutter bist?“ Ich schlendere zur Bar rüber.
„Lass sie in Ruhe“, erwidert Raphaëlle roboterhaft. „Sie macht gerade viel durch.“ Sie meint kein Wort davon, so viel ist klar.
Ich mixe mir einen deftigen Gin Tonic, bevor ich mich auf einen Louis-XV-Stuhl setze. „Ach ja?“, sage ich. „Arme Frau. Wenigstens wird sie wieder im Rampenlicht stehen. Nach all den Jahren…“
Raphaëlle lächelt. „Du wirst dich wohl nie ändern“, meint sie, was fast zustimmend, fast zärtlich klingt. „Und du siehst gut aus, so ganz in Schwarz. Das hat dir schon immer toll gepasst.“
„Vielen Dank. Deshalb trage ich nie etwas anderes.“ Ich zucke die Achseln.
Einen kurzen Moment lang schweigen wir uns an.
„Prost!“ Meine Schwester winkt mir mit ihrem Glas zu. „Schön, dich zu sehen.“
„Ebenfalls. Ein Prost auf die Familie“, erwidere ich.
Wir stieren uns eine Sekunde lang an. Dann kichern wir unwillkürlich los. Sicher eine nervöse Reaktion.
—101—
Am Nachmittag setzt sich Angélique zu uns in den „Salon Bleu“. Die Mädels strengen sich ziemlich an, so dass unser Gespräch auf einer belanglosen, schmerzlich höflichen Ebene verläuft. Aber ein paar halbgarstige Dinge werden trotzdem ausgesprochen und fallen wie Gifttropfen in die Weinkelche eines Borgia-Banketts.
Oberflächlich betrachtet scheinen wir jedoch gut miteinander auszukommen und plaudern über Nichtigkeiten, während harmlose Barockmusik uns gen Abendessen hinplätschert.
Um halb acht begeben wir uns in den Speisesaal und lassen uns in seinem steifen Dekor nieder: dunkle Holztäfelungen an den unteren Wandhälften, Jouy-Wandverkleidungen an den oberen Hälften, Stuck- und Goldverzierungen, Kristallkerzenhalter, Geschirr aus Sèvres-Porzellan. Wir drei, meine Schwestern und ich, sind nach wie vor allein; Mutter beehrt uns nicht mit ihrer Anwesenheit. Tatsächlich habe ich sie seit meiner Ankunft noch nicht zu Gesicht bekommen. Sie hat sich die ganze Zeit in ihrem Zimmer aufgehalten und ignoriert, dass wir da sind. „Madame ruht sich aus“, hat mir der Butler gesagt.
Klar. Ich habe das Gelächter einer Fernsehsitcom gehört, als ich an ihrer Tür vorbeigegangen bin. Und Eiswürfel, die in einem Glas geklirrt haben.
Nicht dass ich mich beschweren möchte. Es könnte ihr durchaus einfallen, eine Show abzuziehen, und ich habe wirklich keine Lust, einer ihrer melodramatischen Szenen beizuwohnen. Ich kenne sie in- und auswendig. Die jetzige Situation gibt ihr wieder die Gelegenheit, eine wichtige Rolle zu spielen. Wie immer wird sie zu dick auftragen und peinlich sein. Ohne sie geht es uns allen besser.
Der erste Gang wird in allgemeiner Stille serviert: œufs cocotte Valentine. Eine höfliche, aber drückende Stimmung liegt in der Luft.
Ich wähle ein unschuldiges Thema und frage Angélique: „Wie geht‘s unserer kleinen Emma?“
Schlechte Themenwahl. Raphaëlle zuckt zusammen, was Angélique im Gegenzug dazu bringt, sie anzufunkeln.
Zum Glück haben wir unsere Vorspeiseneier bereits aufgegessen, und der Butler kommt herein, um die Teller abzuräumen und die Ente und die Bratkartoffeln zu servieren. Das gewährt uns einen kurzen Burgfrieden. Er füllt unsere Gläser, verbeugt sich würdevoll und verlässt den Raum auf Zehenspitzen.
Als er die Tür hinter sich zugezogen hat, antwortet Angélique schließlich. „Emma geht‘s gut, danke. Sie ist so süß? Wir haben ihr letztes Wochenende, weißt du? Haben ihr beigebracht, wie man Mandelkekse macht?“ Nach wie vor scheint sie sich am Ende der Sätze zu fragen, ob sie uns die Wahrheit sagt oder nicht.
„In der Tat – wie süß“, murmelt Raphaëlle.
Ich werfe ihr einen warnenden Blick zu, bevor ich mich wieder Angélique zuwende. „Und Carole? Arbeitet sie immer noch für dieses Pharmaunternehmen?“
„Ja, und ist immer noch ausgelastet? Ich sehe sie kaum? Sie scheint die ganze Zeit unterwegs zu sein, weißt du, auf Geschäftsreisen und so? Diese Woche ist sie zum Beispiel in Tokio?“ Ihr darauffolgender, tiefer Atemzug verrät, wie wütend sie ist. Kaum eine Sekunde später schnappt sie: „Kein Grund, die Augen überzudrehen, Raph? Glaubst du etwa, ich sehe dich nicht? Ich weiß, dass es dir nicht passt? Damit wir alle ein nettes Familienessen genießen können, wäre es möglich, dass du deinen Ekel weniger offen zur Schau stellst?“
„Wie bitte? Ich hab kein Wort gesagt.“ Raphaëlle scheint sich nicht sicher zu sein, ob sie aufhören oder weitermachen soll. Schließlich schlägt ihr Charakter durch. Mit eisiger Entschlossenheit und Worten, die scharfen Dolchen gleichen, meint sie spöttisch: „Aber egal. Ich hab ein Recht auf meine Meinung, und was ich davon halte, dass meine Schwester mit diesen… Lesben zusammenlebt und schlimmer noch: ein Mädchen mit ihnen aufzieht…“
„Raph! Bitte!“, flehe ich sie an. Ich habe Hunger, der Hauptgang riecht wunderbar, ich würde gerne in Ruhe essen.
Zu spät. Unsere Ente wird nach Krieg schmecken.
„Ich kann’s einfach nicht glauben? Ich werde dir mal was sagen, Schwester: Du sitzt gerade? Hier und jetzt? Mit einer anderen schmutzigen Lesbe beim Abendessen?“, faucht Angélique. „Hast du ein Problem damit?“
„Du kennst meine Einstellung. Ich bin konservativ“, meint Raphaëlle. Sie wirft ihr Besteck auf das weiße Damasttischtuch, wo es einen Fettfleck hinterlässt. „Du willst mit diesen Frauen zusammenwohnen? Du willst das Leben eines Kindes mit diesem abnormalen Umfeld versauen, das du mutwillig Familie nennst? Von mir aus! Das ist dein gutes Recht. Aber erwarte dir nicht, dass ich es für vernünftig oder auch nur annähernd richtig halte, dass du so eine unnatürliche Lebensweise wählst!“
Damit bringt sie das Fass zum Überlaufen. Angélique zuckt aus. Sie schreit, und Speichel fliegt über den Tisch: „Geh scheißen! Du willst mir beibringen, was abnormal ist und was nicht? Soll ich dir New York in Erinnerung rufen? Hm? Drogen und eine Abtreibung? Und wer, sag, hat diesen Bastard, diesen Vicomte geheiratet, den alle insgeheim verachten?“
Raphaëlle drückt ihre Serviette so fest, dass die Knöchel hervorstehen und unter der straff gespannten Haut weiß aufschimmern. „Ich hab mich verändert“, flüstert sie, als wollte sie sich selbst davon überzeugen. „Ich hab Gott gefunden.“
Kommt nur mir das so vor, oder klingt sie tatsächlich traurig?
„Verdammt, du Heuchlerin!“, schreit Angélique. „Sag bloß nicht, dass dein Gott will, dass du deine Schwester wie eine verdammte Missgeburt behandelst! Warum reitest du immer auf mir herum? Und Marc? Dein ach so perfekter Bruder? Warum schockiert dich seine Lebensweise nicht? Glaubst du denn immer noch, dass er ein verdammter Heiliger ist? Glaubst du immer noch, dass er ein verdammter Tourismusberater ist? Hast du ihm das wirklich abgenommen?“
„Angélique!“, knurre ich.
Aber sie hört mich nicht. „Unser entzückender Bruder ist um nichts besser als eine Hure? Nicht, dass es mich interessieren würde? Er war schon immer so? Und ich hab ihn trotzdem immer gerngehabt? Also hör auf, ihn wie kostbares Porzellan und mich wie ein Stück Dreck zu behandeln? Okay?“
„Was meinst du damit, er ist um nichts besser als eine Hure?“, fragt Raphaëlle mit tonloser Stimme.
„Komm schon? Aufwachen, bitte? So naiv kannst nicht einmal du sein?“, schnaubt Angélique. „Glaubst du wirklich, dass die fetten, alten Ölmagnaten aus dem Nahen Osten und die pinkhaarigen, amerikanischen Witwen für die Besichtigung des Eiffelturms oder des Louvres zahlen? Jeder kann Marc als bezahlten Begleiter anheuern? Kann sein gutes Aussehen zum fixen Stundensatz genießen? Seinen Körper? Sag bloß nicht, dass dich das überrascht?“
Raphaëlle dreht sich jetzt zu mir herüber, Tränen der Wut in ihren Augen. „Als ich dich gefragt hab, hast du mir gesagt, dass die Gerüchte erstunken und erlogen sind!“, schreit sie. „Und ich hab dir geglaubt! Wie kannst du es wagen mich anzulügen? Wie kannst du es wagen…“
„Scheiß drauf! Ich bin nicht hierhergefahren, um mir so eine Scheiße anzuhören!“, fahre ich auf. Meine beiden Schwestern scheinen bereit, sich mit vereinten Kräften auf mich zu stürzen, aber ich hebe die Hand und verleihe meiner Stimme eine scharfe, zynische Schärfe. „Hört sofort damit auf! Schaut bloß, wie wir drei sind. Schaut euch an, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen! Glaubt ihr nicht, dass Vater stolz wäre, wenn er uns jetzt sehen könnte?“
Das bringt sie definitiv zum Schweigen.
Die darauffolgende Stille ist fast schwerer zu ertragen als der heftige Streit, den wir gerade hatten. Sie fühlt sich an wie eine Niederlage.
—100—
Drei Uhr in der Früh. Ich liege im Bett. Meine Schwestern und ich haben uns mithilfe von drei Flaschen Château Latour und einer mittelmäßigen Flasche Dom Pérignon wieder versöhnt. Deshalb bin ich ziemlich jenseitig. Aber der Schlaf scheint mit mir Verstecken zu spielen.
Aus heiterem Himmel steigt eine Erinnerung auf. Der Tag, an dem Mutter in Gstaad aufkreuzte. Ich muss fünfzehn oder sechzehn gewesen sein.
Vater hatte damals beschlossen, mich in dieses obszön noble Internat zu schicken. Eins von mehreren. Natürlich langweilte ich mich zu Tode, fühlte mich inmitten des Luxus und unter all den schönen, jungen und reichen Menschen fehl am Platz und verachtete diese ganzen südamerikanischen Erben, orientalischen Prinzen und stinkreichen Papaschätzchen. Und trotz ihrer unleugbaren Schönheit lasteten die Berge auf mir wie Gefängnismauern.
Zu meiner Überraschung stellte ich bald fest, dass meine Verachtung, meine Distanz, meine Kälte mich nicht nur beliebt machten, sondern mich sogar in ein Objekt der Begierde verwandelten. Viele Jungs wollten unbedingt meine Freunde werden. Sie boten mir Geschenke an, sie boten mir Geld an. Viel Geld.
Im Gegenzug hielt ich – äußerst selten – meine Freundschaft und viel öfter erotische Gefälligkeiten feil. Was den Unterschied zwischen den beiden ausmacht, habe ich eigentlich nie erkennen können.
Dann bekam die Verwaltung Wind von meinen Geschäften. Ich glaube, diese britische Fotze, Milton, hat mich verraten. Er war ein formloser, farbloser Junge, so steif und langweilig wie die Benimm-dich-Kurse, die sie uns gaben. Natürlich war er eifersüchtig auf meinen Erfolg.
Wie auch immer, der Schulleiter, ein Baron von Arschloch oder so, hatte Angst vor einem möglichen Sexskandal, also beschloss er, mich rauszuwerfen. Vater war zu dieser Zeit mit dem Premierminister in der Karibik unterwegs. Deshalb kam Mutter der Einladung nach, mich abzuholen.
Bevor wir das Internat verließen, bestand Baron von Arschloch darauf, uns in seinem Büro zu empfangen. Es war das erste Mal, dass ich meine Mutter ohne Make-up sah. Sie muss es abgewischt haben, bevor sie das Schulgebäude betrat; ich konnte schwache Spuren von Wimperntusche unter ihren Augen und Reste von Grundierung hinter ihrem Ohr entdecken, als sie mich luftküsste. Ihr Haar war kunstvoll zerzaust, als wollte sie den Eindruck der liebevollen Mutter erwecken, die daher geeilt kam, um ihren Sohn zu retten. Um auch ja nichts dem Zufall zu überlassen, trug sie abgetragene Jeans, Turnschuhe und ein T-Shirt mit, ich schwöre, zwei Löchern. Ich fragte mich, wem sie es wohl abgeluchst hatte: ihrem Gärtner? Vaters Leibwächter?
Jedenfalls servierte man uns Tee in Baron von Arschlochs Büro, einem Raum, der so groß und einladend wirkte wie eine Bahnhofswartehalle. Alles stank nach muffig-staubiger, altmodischer germanischer Schule.
Während der Schulleiter über die Standards der Schule, die Bedeutung von Anstand sowie Moral im Allgemeinen herumlaberte – eine steife und unverständliche Predigt –, betrachtete ich die Falten seiner Hosen, die so scharf gebügelt und ordentlich und regelmäßig waren, dass sie wie ein Symbol für Schweizer Langeweile und Genauigkeit aussahen.
Ich fuhr aus meinem Tagtraum auf, als der Schleimer schlussfolgerte: „Auf die Einzelheiten, warum der Schulrat diese Entscheidung getroffen hat, möchte ich hier nicht eingehen.“ Er saß mit halbherzigem Lächeln da, straff und mit geradem Rücken, und hielt seine Tasse Tee wie einen Schild vor die Brust. „Lassen Sie mich aber betonen, dass diese Institution das Verhalten, das Sie an den Tag gelegt haben, junger Mann, nicht tolerieren kann“
„Was ist denn passiert?“, jaulte meine Mutter auf und streckte ihre Arme in einer theatralischen Geste gen Himmel.
„Ich bitte Sie, werte Frau, diese Angelegenheit mit Ihrem Sohn zu besprechen“, wich der Feigling ihrer Anfrage aus. Dann wollte er wissen, ob ich etwas hinzuzufügen hätte.
Ich sah ihm direkt in die Augen. „Jawohl. Fick dich ins Knie.“ Eine dumme Reaktion, die sich aber gut anfühlte.
Mutter brach plötzlich in ziemlich überzeugende Showtränen aus. Ich hätte es ihr beinahe abgenommen, bis ich etwas unter dem Taschentuch aufblinken sah, mit dem sie sich über die Augen wischte. Ich begriff augenblicklich, dass es sich um ein Fläschchen Glyzerin handeln musste.
Wie peinlich sie doch war! Sie wand sich auf ihrem Stuhl, schluchzte und jammerte „Ich verstehe das alles nicht! Es ist so unglaublich!“ und beschwerte sich, dass sie mir all ihre Liebe geschenkt hatte, dass sie sich so große Sorgen um mich machte, und was sollte bloß aus mir werden ? Baron von Arschlochs Augen begannen, feucht zu werden. Objektiv gesehen war ihre Aufführung bewundernswert. Vor allem hatte ich jedoch große Lust, sie zu ohrfeigen.
„Hab ich dich so erzogen, Marc?“, schnüffelte sie irgendwann.
„Schaut so aus…, Mutter!“, antwortete ich bösartig.
Ich liege in der Dunkelheit und lächle selbstzufrieden. Ich bin immer noch stolz auf meine Antwort.
Der Vollständigkeit halber: Mutter hat mich nie gefragt, warum ich aus dem Internat geflogen bin.
—99—
Das Frühstück am nächsten Morgen ist eine hastige und stille Angelegenheit. Die gute Nachricht ist, dass Mutter ihren Kaffee lieber in ihrem Zimmer zu sich nimmt.
Als wir den fernen Lärm der Kirchenglocken hören, steigen wir widerwillig in Angéliques Auto ein.
Der Tag entpuppt sich als hell, sonnenblau und herrlich. Das überrascht mich nicht. Sogar von seinem Sarg aus scheint Vater alles meisterhaft zu organisieren, als hätte sein Hang für Perfektion ihn überlebt. Wir haben heute eindeutig ein ideales Wetter für Fotografen und Kameraleute.
Als wir den riesigen Platz vor der dunkelgrauen Kirche erreichen, murmelt Raphaëlle etwas ziemlich Unkatholisches. „Heilige Scheiße!“ ist, glaube ich, was wir hören. Ich teile ihre Gefühle. Wir wussten, dass es ein ziemliches Remmidemmi geben würde, aber keiner von uns hatte erwartet, dass so viele Leute auftauchen würden.
Überall stehen schwarze Limousinen herum; es wimmelt von Regierungsmitgliedern, Abgeordneten, Senatoren, Prominenten aus dem Showbusiness, breitschultrigen Sicherheitskräften, Polizisten und Medienleuten. Der Platz summt vor gedämpftem Geplapper; Stars, Starlets und Möchtegernstarlets in Schwarz stehen im frühen Frühlingssonnenschein herum und freuen sich, einander ihren Ruhm ins Gesicht strahlen zu können, zu sehen und gesehen zu werden. Vater ist als Politiker nie besonders beliebt gewesen. aber er bleibt über seinen Tod hinaus einflussreich.
Wir stellen das Auto in einer kleinen Seitenstraße ab. Als wir näher schlendern, sehe ich eine jahrhundertealte Show-Dame, die Gott und die Welt anlächelt. Ihr kurzes, weißes Haar schimmert in der Sonne. Vor Jahren half Vater ihr, eine AIDS-Spendenaktion im Fernsehen zu starten, als die meisten Menschen das Thema noch angestrengt ignorierten. Vater hatte schon immer einen siebten Sinn für pressetaugliche Angelegenheiten. Neben der alten Frau steht eine weltberühmte Schauspielerin, deren Gesicht in ewige Ausdruckslosigkeit gebotoxt wurde. An ihrer Seite erkenne ich einen anderen berühmten Schauspieler, der anscheinend die ausgezeichnete Idee hatte, in fortgeschrittener Betrunkenheit an der Beerdigung teilzunehmen. Er schwankt buchstäblich wie eine Pappel im Herbst. Ich beneide ihn sofort.
„Ich will da nicht hin?“, erklärt Angélique plötzlich und packt uns am Arm. „Mir kommt vor, ich gehör da nicht dazu?“
„Um Himmels willen – reiß dich zusammen!“, schnappt Raphaëlle. Sie senkt ihre Stimme, bevor sie fortfährt. „Überlass Mutter die Skandale, ja, sei ein Schatz. Jetzt lasst uns die Regierung begrüßen. Kommt schon!“
Sie schleppt uns zur Kirche rüber. Während wir mit dem Premierminister und seiner Frau die angemessenen Blödsinnigkeiten austauschen, habe ich Zeit, die anderen Minister zu betrachten. Einige unterhalten sich und erzählen Witze; der Justizminister liest eifrig seine SMS; der Innenminister kratzt sich die Fingernägel sauber; die Außenministerin gähnt und schaut nicht allzu diskret auf die Uhr. Als die Politiker uns weiterziehen lassen, werden wir von den Fotografen in die Enge getrieben. Sie bestehen auf einer Fotosession, für die wir schein-traurige Grimassen zeigen müssen. Das Ganze dauert und ist furchtbar langweilig, ich habe nur einen Wunsch: dass dieser Albtraum so schnell wie möglich zu Ende geht.
Schließlich dürfen wir uns an den Rand der Menschenmenge zurückziehen, wo wir auf den Beginn der Folter warten. Jeder von uns hat eine Sonnenbrille auf und runzelt angewidert die Stirn, was man für Trauer halten könnte. Der Unterschied ist minimal.
Dann bleibt eine riesige, schwarze Limousine nur einen Meter von uns entfernt stehen. Ein Chauffeur in Livree steigt aus, geht um das Auto herum und öffnet die Hintertür.
Ein schlankes Bein in schwarzen Strumpfhosen kommt zum Vorschein, ein glänzender schwarzer Schuh mit hohem Bleistiftabsatz wird auf das Kopfsteinpflaster gesetzt.
Dann wird das zweite Bein ordentlich neben dem ersten positioniert.
Beine und Inszenierung lassen keinen Zweifel zu.
Mutter.
Die Diva schält sich langsam aus dem Auto und genießt es, dass alle sie angaffen.
Und – ach, Mutter! Als ich ihre Klamotten entdecke, bin ich zwischen Bewunderung, Heiterkeit und Zorn hin- und hergerissen.
Mutter trägt ein enges, schwarzes Fetzchen, das ihren immer noch fabelhaften Körper hervorhebt. Es ist bloß zu kurz, viel zu kurz für ihr Alter und für den Anlass. Ein schwarzer Schal von Hermès ist um ihren Hals gewickelt und enthüllt ihren gebräunten Busen, anstatt ihn zu verdecken. Sie trägt dazu lange schwarze Seidenhandschuhe und einen riesigen schwarzen Hut mit – ohmeingott! – einem dramatischen Schleier.
Ihre persönliche Vorstellung, wie eine fotogene Witwe aussehen soll.
So entsetzt ich auch bin, ich muss zugeben, dass sie das Outfit und den Zeitpunkt ihrer Ankunft mit Bedacht gewählt hat. Die Fotografen rennen auf sie zu, drängeln und schieben sich gegenseitig zur Seite und schreien: „Madame Forgeron! Madame Forgeron!“ Einige brüllen sogar dumm: „Monie! Monie!“
Mehr braucht sie nicht. Sie dreht sich hin und her und posiert, als würde sie an den Filmfestspielen in Cannes teilnehmen und nicht an der Beerdigung ihres verstorbenen Mannes. Das Bzzt-Bzzt-Blitz-Blitz der Kameras und Mutter, die hungrig die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zieht, erwecken in mir den insgeheimen Wunsch, mich in der milden Frühlingsluft auflösen zu können.
„Das geht zu weit“, murmle ich in Raphaëlles Ohr. „Geht ihr zwei in die Kirche. Ich kann nicht.“
„Aber…“
„Nach dem Gottesdienst bin ich wieder da, keine Sorge. Die Presse wird großartige Fotos von der ganzen Familie bekommen. Aber das hier geht zu weit.“
Raphaëlle nickt schweigend und kämpft gegen Tränen an. Ob es Tränen der Traurigkeit, der Trauer oder der Wut sind, kann ich nicht sagen. Ohne zu überlegen drücke ich einen Kuss auf ihre Wange und tätschle sanft Angéliques Schulter.
Dann mache ich mich aus dem Staub.
—98—
Ich eile eine schmale Gasse hinunter. Als ich die Markthalle erreiche, verlangsame ich meine Schritte. Vor dem Eingang stehen zwei alte Frauen mit Weidenkörben und Plastiktüten zu ihren Füßen. Ich höre, wie die eine zur anderen sagt: „Unglaublich, oder? Was für ein Zirkus! Journalisten und Kameras und Politiker und, und, und! Fast wie bei der Beerdigung von einem Filmstar!“
„Verrückt, gell?“ Die andere Frau nickt. „Wie sie vor einem Monat Annie Girardot begraben haben, war weniger Affentheater. Wissen Sie was? Es würd‘ mich nicht wundern, wenn man uns eines Tages sagen würde, dass wir den ganzen Heckmeck mit unseren Steuergeldern bezahlt haben!“
„Na hoffentlich nicht!“, antwortet die erste Frau erregt. Dann bekreuzigt sie sich. „Man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber ehrlich gesagt hab ich diesen glitschigen Aal nie gemocht. Auf keinen Fall will ich da für seine Beerdigung bezahlen, wissen Sie, jetzt, wo er nimmer da ist!“
„Ihm hätt‘ das sicher gefallen. Gab sich als Sozialist aus, aber der war doch schon immer ein ziemlicher Zastermann, was man so hört.“
Sie sehen mich näherkommen, glotzen meine Trauerbekleidung an und halten augenblicklich die Klappe, schnappen sich ihre Körbe und Einkaufstüten und schlurfen fast verärgert davon.
Einer plötzlichen Eingebung folgend betrete ich die Markthalle, finde einen Stand, an dem Alkohol verkauft wird, und zeige nach dem Zufallsprinzip auf die erste Flasche Rotwein, die ich sehe.
Sie kostet fünf Euro.
—97—
In der Mitte der Seine liegt die Olive-Insel, die ich über zwei Brücken erreiche. Ich schlendere eine Weile mit der Flasche Wein unterm Arm herum und genieße es, dass sonst niemand da ist. Schließlich setze ich mich unter eine Trauerweide. Tausend junge Blätter flüstern in ihren Zweigen, die hinter mir den Rasen streifen, vor mir ins Wasser sinken und einen heimeligen Vorhang, einen gemütlichen Sicherheitskokon bilden.
Irgendwie schaffe ich es, die Flasche zu öffnen, einen Schluck Wein zu trinken und nachzudenken. Eine Aktivität, bei der ich mich immer ungeschickt anstelle, wie ein Jungvogel, immer im Bereich des Ungefähren bleibend. Die Seine rauscht laut um die Insel herum, aber das stört mich nicht. Der Fluss hat bereits den gleichen Lärm gemacht, das gleiche Rauschen verursacht und ist in die gleiche Richtung geflossen, als König Heinrich IV. heimlich seine Geliebte im berühmten Renaissance-Pavillon unweit von hier am Ufer besuchte. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich wenig geändert hat, was den Fluss betrifft.
Das Wasser wirbelt, der Wind flüstert in den Blättern, Vögel zwitschern. In der Ferne läuten die Kirchenglocken. Ich fühle mich wie ein Zuschauer, der hört, selbst aber schweigt, der sieht, selbst aber unsichtbar bleibt, der fühlt, ohne selbst Gefühle zu wecken.
Ich weiß nicht, warum, aber plötzlich muss ich an meinen Psychotherapeuten denken. Den habe ich aufgesucht, weil eine Therapie der einzige Modetrend war, der mir in meiner Sammlung fehlte. Ein Dutzend Mal, und ich habe die Therapie sowieso wieder abgebrochen.
Ich erinnere mich an das Büro des Therapeuten: geräumig, aber so vollgestopft mit Büchern, Lampen, Statuetten, afrikanischen Masken und Kram aller Art, dass ich mich immer erdrückt fühlte. Ein imposanter Schreibtisch stand neben der Couch, auf die ich mich legen sollte. Ich weigerte mich natürlich und bestand darauf, auf dem Stuhl zu sitzen, weil ich meinen Gesprächspartner sehen wollte. Es war mir ein Bedürfnis, seine Reaktionen abzuwägen, die Emotionen zu entdecken, die er hinter seiner sanften Stimme und der ernsthaften, kontemplativen Miene zu verbergen suchte. Er wand sich fast unmerklich auf seinem Stuhl hin und her. Mein Blick behagte ihm anscheinend überhaupt nicht; er war außerstande, mich anzusehen, und blätterte stattdessen in seinen Notizen herum.
Als ich ihn das letzte Mal sah, wollte er meine Beziehung zu Vater untersuchen. Wieder einmal. Das Thema schien ihn wirklich zu faszinieren, viel mehr, als es mich jemals interessiert hätte. So sehr, dass ich mich immer gefragt habe, ob er nicht selbst ein Problem mit seinem Papa hatte.
„Was werfen Sie Ihrem Vater vor, Marc?“, fragte er mich.
„Nicht viel“, zuckte ich die Achseln.
„Kommen Sie, Marc. Ich denke, das hier könnte uns weiterbringen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Sie wirklich tiefer graben wollen. Diese Therapie funktioniert nicht, wenn Sie sich weigern, aufrichtig zu sein. Mich bestrafen Sie ja nicht, wenn Sie bestimmte Dinge unterschlagen.“
Ich erwiderte darauf nichts, also änderte er seine Stoßrichtung. „Apropos Strafe: Glauben Sie nicht, dass Sie versuchen, Ihren Vater für etwas zu bestrafen?“
„Bestrafen?“ Ich lachte. „Was meinen Sie mit ‚bestrafen‘?“
„Nun ja… Schauen Sie sich Ihren Lebensstil an. Glauben Sie, dass er damit einverstanden ist?“
„Was meinen Sie mit meinem ‚Lebensstil‘? Ich nehme an, Sie spielen auf meinen Job an. Tja, ich verdiene eine Menge Geld. Ich begegne mächtigen und reichen Leuten. Mein Vater hat Geld und Macht immer geschätzt. Je mehr, desto besser. Deshalb sollte er eigentlich ziemlich stolz auf mich sein. Nehmen Sie ihm bloß sein soziales Gehabe nicht ab – das Gehabe eines Politikers, sonst nichts.“
Er sah nicht überzeugt aus.
Ich seufzte. Über meine Familie zu sprechen ist immer schwierig: Die Leute glauben irgendwie, dass sie alles über sie wissen.
„Also glauben Sie, dass er stolz darauf ist, wie Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen?“, erkundigte er sich höflich.
„Mein Gott – es ist ihm egal! Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen?“
Der Therapeut versuchte einen anderen Ansatz. „Bestrafen Sie sich vielleicht selbst?“
„Machen Sie sich nicht lächerlich.“ Ich schnaubte. „Das ist beschissenes Psychogeschwurbel. Ich zahle Ihnen doch nicht Ihr sauteures Honorar, damit ich mir so einen Schrott anhören muss.“
„Warum sind Sie dann mir gegenüber so aggressiv? Liegt es daran, dass Sie tief im tiefsten Inneren wissen, dass Ihr… moralisch zweifelhafter ‚Job‘ nur eine Art verschleierte Selbstbestrafung ist? Dass Sie Ihren Lebensstil hegen, damit Sie sich selbst verachten können? Quasi eine Reaktion, bei der Sie versuchen, das widerzuspiegeln, was Ihr Vater für Sie empfindet?“
Das war der Moment, wo ich aufstand. „Ich muss mir Ihre Moralpredigten nun wirklich nicht länger anhören, okay? Und die Antwort lautet ‚Nein‘. Ich verachte mich nicht. Mein Vater tut es ebenso wenig. Mich zu verachten würde bedeuten, dass er sich für mich interessiert. Aber das tut er, verdammt noch mal, eben nicht. Wenn Sie diese einfache Realität nicht verstehen können, sehe ich keinen triftigen Grund, warum ich jede Woche hierherkommen sollte.“
Ich ging dann, um nie wieder zurückzukehren. Es hat keinen Sinn, mit einer Wand zu sprechen, oder? Außerdem, Wände habe ich zu Hause haufenweise. Die kann ich für viel weniger Geld volllabern, und sie würden mir genauso helfen wie dieser Gauner. Im Ernst – warum sollte ich mich von jemandem beraten lassen, der offensichtlich in seine Vorurteile verliebt ist? Mein Psychotherapeut lebt, wie so viele Menschen mit der Utopie im Hinterkopf, dass nur eine harmonische Familie jemandem ermöglicht, sich auf die Art und Weise zu konstruieren, die als „gesund“ bezeichnet werden kann. Das Konzept, dass zwischen einem Vater oder einer Mutter und ihren Nachkommen keinerlei emotionale Bindung entsteht, passt einfach nicht in diese Sicht der Welt, in der alles dufte ist, solange Mama und Papa einen liebhaben.
Nun, meine Mama und mein Papa haben mich eben nicht lieb. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Meine Familie ist bloß eine ganz normale, moderne Familie.
Jetzt bin ich wieder therapeutenlos. Und dadurch sogar ein bisschen reicher.
Ich wache aus meinen Gedankenspinnereien auf und bemerke, wie eine Entenmutter und ihre Küken an mir vorbeischwimmen. Sie sehen unschuldig, ahnungslos und daher glücklich aus.
Ein seltsames Gefühl drückt plötzlich auf meine Brust. Es fühlt sich an wie Nostalgie. Bin ich nostalgisch auf etwas, das ich nie hatte, etwas, das mir mein ganzes Leben lang verweigert wurde? Oder kommt das nur vom billigen Wein?
Ohne nachzudenken, schütte ich den Rest der Flasche in den Fluss. Die rote Flüssigkeit bildet einen blutigen Fleck auf der wirbelnden Oberfläche, bevor die Seine ihn verdünnt und davonträgt.
—96—
Nachdem ich zum Kirchplatz zurückgekehrt bin, stehe ich unter einem Kastanienbaum, kaue an einen Pfefferminz-Kaugummi herum und warte auf das Ende des Gottesdienstes.
Der Bürgermeister schreitet als erster aus der Kirche. Er erkennt mich, kommt herüber und schüttelt mir eifrig die Hand. „Mein aufrichtiges Beileid“, sagt er mit einer Friedhofsstimme.
Ich murmle etwas, das ich selbst nicht verstehe.
Der Rest der Trauerstars, die Medienmenge und andere Monster strömen in langsamen, feierlichen Wellen aus dem alten Gebäude.
Meine beiden Schwestern rahmen unsere Mutter ein und geleiten sie vorsichtig heraus. Sie bleiben ein paar Meter von mir entfernt stehen.
„Mein Sohn! Wo ist mein Sohn? Ich brauche meinen Sohn!“, jammert Mutter plötzlich. Ihr blöder Schleier bebt. „Wo ist mein Sohn?“
Schade, dass Mutter kein Talent hat. Sie klingt bis über die Ohren zugedröhnt. Tabletten? Alkohol? Gras? Alle drei? Sie ist wie immer einfach erbärmlich.
Ich beschließe, sie zu ignorieren. Gott weiß, was ich sagen würde, wenn ich jetzt auf ihre Rufe antwortete.
Aber der Bürgermeister stupst mich an. „Sollten Sie nicht Ihrer Mutter beistehen?“, fragt er.
Warum kann er sich nicht um seinen eigenen Scheiß kümmern?
Ich schnappe: „Sie hat bloß beschlossen, heute allen auf den Geist zu gehen, sonst nichts!“
Der Bürgermeister starrt mich verblüfft an. „Ich denke, Ihre Mutter braucht Sie – das muss ein sehr schmerzhafter Moment für sie sein“, betont er, und seine stählerne Stimme verrät, was er von mir hält.
„Darauf können Sie Gift nehmen“, murmle ich. Trotzdem gehe ich zu meiner Mutter rüber.
Erleichtert ließen meine Schwestern sie los.
Sobald die Frau in Schwarz meine Anwesenheit bemerkt, klammert sie sich an meinen Arm, ohne genau hinzusehen, wer ich bin, und schreit noch einmal: „Mein Sohn! Da ist er ja!“ Dann dreht sie sich zu mir um und schaut mich unkonzentriert an. „Mein Sohn!“, wiederholt sie, obwohl sie anscheinend etwas stört. Sie starrt mich an, als würde sie mich nicht erkennen. „Mein Sohn?“, murmelt sie erneut, und es klingt wie eine Frage.
Vielleicht macht sie so viel Aufhebens, weil ihr mein Vorname nicht einfällt? Ich bin mir jetzt sicher: zu viele Pillen, zu viel Whisky. Und wahrscheinlich ein paar Joints, um die Dinge zu glätten.
„Ja, ich bin’s“, sage ich. „Lass uns gehen.“
Der Trauerzug verlässt langsam den Platz, das schwarze Auto fährt voran, dann kommt die Familie, dann der VIP-Pöbel.
Die Frau an meiner Seite stolpert eine Weile vor sich hin. Als es mir zu viel wird, fauche ich zwischen zusammengebissenen Zähnen: „Verdammt noch mal, kannst du dich nicht zusammenreißen?“
Sie bleibt sofort stehen. Mit weit aufgerissenen Augen, was selbst der dicke Schleier nicht verbergen kann, fragt sie mich höflich: „Wer sind Sie?“
„Die Person, nach der du so verzweifelt gejault hast“, erwidere ich. „Dein Sohn. Marc, falls du es vergessen hast. Und geh weiter, um Himmels willen!“
„Seien Sie nicht albern. Wie könnte ich den Namen meines Sohnes vergessen? Aber kenne ich Sie?“
Gott im Himmel, sie jagt mir direkt Angst ein! Selbst in ihrem benebelten Zustand kommt sie mir beinahe klarsichtig vor. Sie merkt wahrscheinlich, dass sie mich überhaupt nicht kennt, obwohl ich ihr Sohn bin.
„Halt die Klappe und geh weiter“, zische ich. „Die Leute starren schon. Spiel deine Rolle; zeig den Fotografen, dass du eine trauernde Witwe bist. Und lass uns das alles hinter uns bringen.“
Insgeheim denke ich, dass sie Recht hat; sie weiß wirklich nicht, wer ich bin. Ich denke, dass sogar ich das nicht weiß.
Unsere langsamen Schritte folgen dem Rhythmus von Chopins Trauermarsch – links, rechts, links, rechts, links, rechts –, während wir hinter dem Sarg zum Friedhof marschieren.
—95—
Am nächsten Morgen bringt mich Raphaëlle zum Bahnhof. Während wir auf den Zug warten, steht eine unangenehme Stille zwischen uns wie eine Hecke. Ein sanfter Wind fegt mit ungewöhnlicher Hitze über die leere Plattform.
Schließlich breche ich das Schweigen. „Wie lange wirst du hierbleiben?“
„Nicht länger als unbedingt nötig“, antwortet meine Schwester. Sie klingt nicht wie sie selbst; eher gedämpft; vielleicht müde? „Ich nehme an, Maître Chambard will uns nächste Woche sehen, um Vaters Testament zu besprechen.“
„Vater hat immer noch mit diesem alten Wiesel zu tun gehabt? Dann werde ich das eigentliche Fest verpassen. Schade.“
„Ich könnte auch darauf verzichten, glaub es mir.“
„Ich hab alle Papiere unterschrieben, oder? Vollmacht und so? Oder brauchst du sonst noch etwas?“
„Nein, wir haben alles überprüft.“
„Und Angie? Wird sie bei dir bleiben?“
„Ich denke schon.“
„Versuch, nett zu ihr zu sein, okay?“
„Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meine guten Manieren erinnern.“
Ich entdecke eine Spur des alten Sarkasmus meiner Schwester. „Gute Manieren könnten diesmal nicht genug sein, und das weißt du auch. Immerhin ist sie unsere Schwester.“ Ich lächle. „Ich meine das wirklich. Ihr zwei seid meine einzige Familie. Wir sollten versuchen, uns umeinander zu kümmern.“
Meine Schwester kaut eine Weile daran herum, bevor sie murmelt: „Ich kümmere mich schon um sie. Es ist nicht immer leicht, das zu erkennen, aber auf meine Weise tu ich es. Mehr kann man unter den gegebenen Umständen nicht verlangen.“
„Ich weiß.“ Ich umarme sie kurz, und die plötzliche Bewegung – oder die Emotionen, die sich dahinter verbergen – lässt sie zusammenzucken. Sie weicht zurück, und wir starren uns verlegen an.
Raphaëlles Hand streift über mein schwarzes Hemd. „Lass uns in Kontakt bleiben?“ Ihr Angebot klingt wie eine Frage.
„Tun wir das nicht ohnehin?“, frage ich zurück.
„Doch. Aber versuchen wir einfach noch stärker. Ich weiß auch nicht.“
„Okay. Versuchen wir‘s. Ich rufe dich an.“
Der Zug erscheint in der Ferne. Die Bremsen quietschen, ein durchdringender, metallischer Schmerzensschrei.
„Was wirst du jetzt machen?“, fragt Raphaëlle.
Ich könnte nachhaken, was sie meint, aber ich tue es dann doch nicht. Ich glaube, ich weiß, was sie meint. Also zucke ich nur die Achseln. „Das gleiche wie immer. Mein Leben weiterleben. Meinen Job weitermachen. Nächste Woche bin ich in Tunesien.“
„Du willst also nichts ändern?“
„Nein. Ich sehe keinen Grund dafür.“
Der Zug hält mit einem erschöpften Keuchen an.
Raphaëlle begleitet mich zu einer der Türen. „Du musst nichts beweisen“, sagt sie. „Jetzt nicht mehr. Er ist tot, weißt du.“
„Bist du dir sicher?“, frage ich.
Sie wirft mir einen verwirrten Blick zu.
„Kommt dir nicht vor, dass er irgendwie noch immer lebt?“, frage ich. „Er scheint immer noch da zu sein, weißt du? In jedem von uns, nicht wahr?“
Raphaëlle starrt mich nur an.
Ich küsse sie auf die Wange. „Kopf hoch, großes Kind“, sage ich leise. Diesen Spitznamen habe ich vor Jahren erfunden. Ich hole ihn hervor wie eine schöne Erinnerung, und er bringt ihre Augen zum Glänzen.
Das ist das Letzte, was ich sehe, bevor die Tür zufällt.
Zweiter Teil | Ein ganz normales Meeting
—94—
„Dieses Meeting ist äußerst wichtig“, sagt Alessandra. Sie zieht an ihrer dünnen Davidoff Light, ohne den Blick von sich abzuwenden.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie mit mir spricht. Aber sonst ist niemand da, also nicke ich zustimmend.
Sie starrt auf ihr Spiegelbild. Dann dreht sie sich zu mir um. „Was meinst du, Marcuzzo? Wie sehe ich aus?“
„Fabelhaft!“, sage ich und halte ihr den Kristallaschenbecher entgegen.
Sie achtet nicht darauf, und ich bin leicht irritiert, als Asche auf den Teppich fällt. Ich nehme mir vor, später jemanden vom Reinigungspersonal kommen zu lassen.
Alessandra sieht wirklich fabelhaft aus. Ihre natürliche Nachlässigkeit und Frivolität kann einem manchmal auf die Nerven gehen, okay. Aber was ihr Aussehen betrifft, muss ich tatsächlich nicht lügen. Sie ist immer noch schön, und ihr wahres Alter würde man nie erraten. Niemand kann italienische Haute Couture-Kleider und riesige Juwelen mit größerer Lässigkeit tragen. Andere Frauen würden wie ein überladener Weihnachtsbaum von Tiffany‘s aussehen, ganz zu schweigen davon, dass die meisten gar nicht in der Lage wären, ihre zusätzlichen Kilos in diese Klamotten zu zwängen. Alessandra ist jedoch immer sie selbst: schlank und nobel, sogar in Armanis letztem Schrei. Vielleicht ein bisschen affektiert, snobistisch, und das Make-up ist zu auffällig. Aber Perfektion findet man auf dieser Welt nirgendwo, oder?
Endlich bemerkt sie den Aschenbecher, den ich ihr noch immer entgegenhalte. „Danke, tesoro“, schnurrt sie, bevor sie ihre halb gerauchte Zigarette ausdämpft. Sie wendet sich wieder ihrem Spiegelbild zu, wischt einen unsichtbaren Aschefleck weg, seufzt und greift nach ihrer silbernen Zigarettenschachtel.
Als sie eine neue Zigarette an ihren karminroten Mund hebt, spreche ich aus, was offensichtlich ist. „Du scheinst nervös zu sein, Sandra. Was ist los?“
Alessandra zündet sich die Zigarette an, wirft ihr langes schwarzes Haar zurück und bläst eine dicke, graue Wolke an die Decke. „Ich hab‘s dir doch schon gesagt“, meint sie gereizt, die Vokale sind langgezogen, die Rs krachen. „Dieses Meeting ist wichtig. Es muss ein voller Erfolg sein, sonst…“ Gebannt von ihrem eigenen Spiegelbild spricht sie den Satz nicht zu Ende.
„Das wird es auch“, bestätige ich. „Unglaublich, dass du noch daran zweifelst.“
Ich kenne meine Rolle auswendig. Genau das muss ich sagen, weil sie genau das hören will. Seit ich für sie arbeite, gehen wir oft den gleichen Ablauf durch.
„Du warst gestern großartig, Sandra. Ich meine, schau bloß, was du erreicht hast! Ghrabouzi hat deinen ganzen Geschäftsbedingungen zugestimmt…“
„Das heutige Meeting ist was anderes.“ Alessandra geht zur Balkontür und lehnt sich gegen den Türrahmen.
Ich folge ihr, den Aschenbecher immer noch in der Hand.
Wir blicken in den hellen, flachen Morgen hinaus. Unter uns, wo das tiefblaue Meer auf den glitzernden Sandstrand trifft, bilden sich komplizierte Schaumstrukturen. Sie lassen mich an momentane Baisers denken, die verschwinden, sobald sich die Wellen zurückziehen, um sich einen Moment später neu zu formen. Der Klang ihres unerbittlichen Ssssswasch-Ssssswasch-Ssssswasch hat etwas Faszinierendes.
Nach einer Schweigeminute sage ich: „Du hast ihn einfach um den Finger gewickelt. Ghrabouzi hat nicht besonders viel Widerstand an den Tag gelegt.“
„Es war fast zu einfach“, räumt Alessandra ein. „Er braucht uns dringend. Wusstest du, dass dieses Hotel seit der Eröffnung keinen einzigen Kunden gehabt hat? Seit mehr als zwei Monaten steht es leer, völlig leer.“
„Ja, das hast du mir gesagt. Wie blöd, dass er genau an dem Tag eröffnet hat, an dem die Revolution ausgebrochen ist“, sage ich und beobachte immer noch, wie die Wellen über den unberührten Sand tanzen. Sie springen hungrig heran, lecken hartnäckig über den Strand, gewinnen ihren Kampf nie, sind immer gezwungen, sich zurückzuziehen, geben aber auch nie auf. „Wer hätte gedacht, dass nach all den Jahren so etwas passiert.“
„So spielt das Leben. Traurig für einige, ausgezeichnet für andere.“ Alessandra lacht trocken und ironisch auf. „Ich hab noch nie eine bessere Situation gesehen. Ich meine, ein brandneues Hotel, unschlagbare Preise, kein Personal, das man entlassen muss, keine langen Erklärungen – was hätte ich mir Besseres wünschen können? So einfach. ‚Hier sehen Sie, was wir wollen, und hier dürfen Sie unterschreiben.‘ Das nenne ich Freiheit, was?“
„Ich glaube nicht, dass sie für die Art von Freiheit gekämpft haben“, murmle ich, während ich in meine Gedanken und die ständige Bewegung vor meinen Augen vertieft bleibe.
Alessandra hört mich nicht. „Wie viel Zeit bleibt uns noch?“, fragt sie.
Ich blicke auf die Rolex, die sie mir gestern geschenkt hat. „Eine halbe Stunde“, sage ich
Sie tritt in den Raum zurück und schaut wieder in den Spiegel. „Sei so lieb und ruf die Rezeption an!“, sagt sie. „Ich würde gerne noch eine Tasse Kaffee trinken.“
„Certo, cara mia.“ Ich gehe zum Telefon und gebe die Bestellung auf.
Nachdem der Room Service den Kaffee gebracht hat, hebe ich die Krawatte vom Nachttisch auf, auf den ich sie vor dem Frühstück geworfen habe. „Machen wir uns fertig“, sage ich.
„Komm her, bello, ich helfe dir.“ Sie tritt näher und fängt an, den Knoten zu binden.
Ich bin durchaus in der Lage, das selbst zu tun, aber Alessandra zahlt, also schafft Alessandra auch an.
„Sei meraviglioso, amore“, sagt sie und kratzt mit einem langen Fingernagel, der so dunkel lackiert ist, dass er fast schwarz aussieht, über meine Wange. „Du bist atemberaubend! Ich denke, die Damen werden dich lieben. Einige der Herren auch.“ Sie zwinkert mir zu, und zum ersten Mal zeigen sich die Linien eines haardünnen Lächelns um ihren Mund. Ihre Stirn und ihre Augen bleiben dank einer kürzlich erfolgten Botoxspritze faltenlos.
Das Telefon läutet.
„Kannst du abheben, Marcuzzo?“ Alessandra dreht sich um und starrt wieder auf ihr Spiegelbild.
„Signora Di Forzones Zimmer“, sage ich ins Telefon. „Ihr, ähm, ihr Assistent am Apparat.“
Es ist ihr Sohn Michele. „Ciao Marco“, zischt er. „Schaltet den Fernseher ein. Die Scheiße ist am Dampfen. In Marokko hat es einen Bombenanschlag gegeben.“
„Fuck“, fluche ich, während ich nach der Fernbedienung fummle. „Das Timing ist aber verdammt schlecht.“
—93—
Wir stehen am Ende der kreisförmigen Auffahrt, die Palmen um uns herum wiegen sich unschlüssig in der warmen Brise. Dicke, weiße Büschel Jasmin hängen von den rauen Steinmauern herunter, die zum Empfangsbereich des Hotels führen. Ihr widerlich süßer Geruch schwebt in der Luft. Der Himmel wölbt sich über unseren Köpfen, sein Wahnsinnsblau so unverändert und unveränderlich, dass es sich bedrohlich anfühlt.
Als unsere Gäste ankommen, sieht Alessandra gefasst aus; ihr professionelles Lächeln strahlt so heftig wie die Sonne. Sie begrüßt alle herzlich, eine Umarmung hier, ein Luftkuss dort, und zwitschert: „Ich bin ja so froh, dass Sie kommen konnten!“ und „Wie lange ist das jetzt her, cara?“ und „Mein Gott, Sie sehen so jung aus – was ist Ihr Geheimnis, tesoro?“
Niemand hätte ahnen können, dass sie vor wenigen Minuten ein viel weniger harmloses Bild abgegeben hat. Sie hat getobt und gejammert, hat auf Italienisch geflucht, dass alles im Arsch ist, und die marokkanischen Behörden beschimpft, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um uns das Meeting zu versauen. Während sie hier mit kalkulierter Effizienz diese Ansammlung eitler, alternder Adabeis angurrt, ist wahrscheinlich gerade eine Reinigungskraft dabei, in der Suite staubzusaugen und die Ergebnisse ihrer Wut zu beseitigen. Zumindest hoffe ich das. Als ich sie nach unten gebracht habe, haben die Überreste des Kristallaschenbechers unter meinen Mokassins geknirscht, und ich habe bemerkt, dass sie es geschafft hat, eine Zigarette auf dem Teppich auszutreten. Als ich die Tür zugezogen habe, war da ein schwarzes Loch vor dem Fernseher.
Ich nutze die allgemeine Begrüßung, um Michele zur Seite zu ziehen.
„Wie geht es ihr?“, zischt er.
„Wieder im Arbeitsmodus. Aber du kannst dir sicher ihre Reaktion vorstellen. Immerhin ist sie deine Mutter. Sie ist immer noch verärgert, aber entschlossen“, erwidere ich. „Sag: was wissen die Leute?“
„Zum Glück nichts. Ich bin über die Nachricht gestolpert, als ich mir am Flughafen meine E-Mails angesehen hab. Hab dich sofort angerufen und sie seither abgelenkt.“ Michele lächelt schwach. Er sieht aus, als ob er in seinem braunen Anzug geschlafen hätte, der zerknittert und wie ein Leinensack von seinem schmalen Körper hängt. Mit seinem Dreitagebart und der riesigen Sonnenbrille sieht er viel älter aus, als er ist. Viel älter als ich, obwohl wir mindestens zwei Internate zusammen besucht haben. Aber er ist gut in all den Dingen, die seine Mutter von ihm verlangt.
„Ich brauche eine Dusche“, jammert er, „und was zum Munterwerden.“ Unwillkürlich reibt er sich die Nase und bestätigt die vagen Gerüchte, die ich über seine Sucht gehört habe.
„Dann solltest du dich beeilen. Du hast genau zehn Minuten Zeit, bevor sie deine Abwesenheit bemerkt.“ Ich tätschle seine Schulter. „Es gibt einen Cocktail, bevor die Leute auf ihr Zimmer gebracht werden.“
„Sag ihr, dass ich aufs Klo gegangen bin“, bittet er und eilt ins Hotel.
—92—
„… Der Prinz ist so ein Engel gewesen! Nicht wahr, Rodolfo?“
„Bitte, nicht der Rede wert, Baronin! Es war mir ein Vergnügen.“
„Sie sind einfach viel zu bescheiden, Boris, verdad…“
„… jetzt hör zu! Nour hat geschrien: ‚Eire fik! Du bist so eine schmutzige Lügnerin!‘ Und Aïsha hat zurückgeschrien: ‚Yena‘an kusha ommak!‘ Mitten im Le Gabriel! Im Le Gabriel! Kannst du dir das vorstellen! Und die ganzen Leute rundherum, die die Szene mitbekommen haben! Ich wäre auf der Stelle tot umgefallen! Die Kellner haben dann Claude holen müssen, der die beiden schließlich getrennt hat. Sonst hätten sie angefangen, sich gegenseitig die Gesichter zu zerkratzen!“
„Ich kann’s gar nicht fassen! Ich bin total schockiert!“
„Ich auch. Ist das nicht einfach wunderbar? …“
„… er möchte den neuen Sesto Elemento kaufen, sobald er auf den Markt kommt, aber ich finde ihn ein bisschen zu auffällig …“
High-Society-Smalltalk summt durch die Lounge. Das aufgeregte, halb beschwipste, selbstzufriedene und leere Geschwätz der Mächtigen und Reichen. Ich höre arabische, französische, italienische, spanische und russische Wortfetzen. Aber meistens handelt es sich um stark akzentbehaftetes Englisch, versnobtes Britisch und zerkaute US-Jargons.
Ich wandere von einer kleinen Gruppe zur nächsten, lächle, nicke, tätschle zerbrechliche, von teuren Stoffen umhüllte Schultern, küsse Hände, und meine Nase schwebt über unzähligen unbezahlbaren Diamanten. „Tout va comme vous voulez?“, frage ich ohne Unterlass; „Soll ich Ihnen noch einen Cosmo besorgen?“; „Wo waren Sie denn die ganze Zeit, Contessa?“
Gesichter strahlen mir entgegen an, einige zerknittert und mit Altersflecken bedeckt, andere auf dem Operationstisch verjüngt, mit im eisigen Käfig kürzlich verabreichter Injektionen eingesperrten Augen.
Die Baronin de Jiménez y Rodrigo hält meine Hand etwas zu lang in der ihren und beäugt mich hungrig, während sie sich erkundigt: „Glauben Sie, la chère Alessandra könnte später auf Sie verzichten, Marc? Ich würde Sie heute Nachmittag gerne sehen!“ Sie zwinkert mir zu, und ich erfinde taktvoll ein paar dringende Pflichten, die ich zu meinem Leidwesen nicht aufschieben kann. Sie akzeptiert es mit Würde und greift nach einem frischen Glas Roederer, das ein hübscher marokkanischer Kellner auf einem Tablett herumreicht. Ich habe den Kerl gestern angestellt. Die Augen der Baronin glitzern, während sie auf seinen Hintern starrt, als er sich entfernt.
Alessandra steht in der Nähe der riesigen Schiebetüren, die auf die Terrasse hinausgehen. Sie raucht eine ihrer dürren Davidoffs, während sie sich mit dem Generaldirektor eines angesehenen südafrikanischen Weinguts und der quirligen Erbin einer internationalen Hotelkette unterhält. Sie winkt mich herüber.