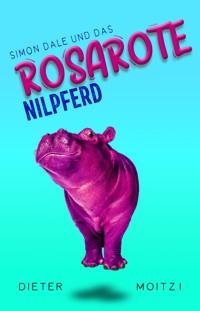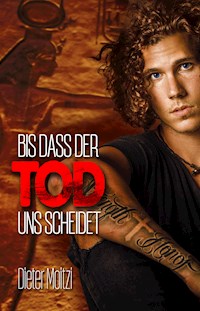3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man nehme einen mageren Französischstudenten und einen gut-aussehenden Haushälter, stecke beide in eine schicke Sommervilla, füge ein rosarotes Auto namens Sean und einen markig-hübschen Paketzusteller hinzu – und schon ist man mitten in einer sonnig-lustigen Sommerromanze. Der zwanzigjährige Trevor ist selig. Ein australischer Millionär hat ihm den Sommerjob seiner Träume angeboten: er soll die Bibliothek der Sommervilla in Saint-Jean-Cap-Ferrat erfassen, einem der edelsten und exklusivsten Orte der Côte d’Azur. Was ihn jedoch verunsichert, ist der junge Haushälter, der sich nicht nur als umwerfend gutaussehend entpuppt, sondern auch als unaus-stehlich arroganter und unverbesserlicher Hetero. Natürlich sorgen Trevors skurrile Frechheit und sein unbeschwertes Geplänkel bald für knisternde Spannung zwischen den beiden Männern. Was wäre, wenn der Haushälter nicht ganz so hetero ist, wie Trevor glaubt? Was wäre, wenn Trevor genau die Person ist, nach der der Haushälter sein ganzes Leben lang gesucht hat? Und was wäre, wenn der Schein sogar noch mehr trügt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zusammenfassung
Man nehme einen mageren Französischstudenten und einen gutaussehenden Haushälter, stecke beide in eine schicke Sommervilla, füge ein rosarotes Auto namens Sean und einen markig-hübschen Paketzusteller hinzu – und schon ist man mitten in einer sonnig-lustigen Sommerromanze.
Der zwanzigjährige Trevor ist selig. Ein australischer Millionär hat ihm den Sommerjob seiner Träume angeboten: er soll die Bibliothek der Sommervilla in Saint-Jean-Cap-Ferrat erfassen, einem der edelsten und exklusivsten Orte der Côte d’Azur.
Was ihn jedoch verunsichert, ist der junge Haushälter, der sich nicht nur als umwerfend gutaussehend entpuppt, sondern auch als unausstehlich arroganter und unverbesserlicher Hetero. Natürlich sorgen Trevors skurrile Frechheit und sein unbeschwertes Geplänkel bald für knisternde Spannung zwischen den beiden Männern.
Was wäre, wenn der Haushälter nicht ganz so hetero ist, wie Trevor glaubt? Was wäre, wenn Trevor genau die Person ist, nach der der Haushälter sein ganzes Leben lang gesucht hat? Und was wäre, wenn der Schein sogar noch mehr trügt?
Das Vorstellungsgespräch dauert nicht lange
Das Vorstellungsgespräch dauert nicht lange. Ich hatte Angst vor einem stundenlangen Kreuzverhör, aber nein. Der Spuk ist im Handumdrehen vorbei.
Fun Fact: das Gespräch währt länger als der Typ, den Dirk gestern Abend aufgerissen hat. Zumindest hat er heute morgen am Telefon so was in der Richtung angedeutet. Der Typ kam anscheinend so schnell, dass Dirk nicht einmal Zeit hatte, seinen Schwanz zu begutachten. „Der hat ihn ausgepackt, und kaum konnte ich ‚Piep’ sagen, hatte er mir schon über die ganze Brust gespritzt und war weg“, stöhnte Dirk. „Mir nix, dir nix. Speedy Gonzales ist ein Dreck dagegen.“
Ich war froh, dass mir eine weitere Schwanzbeschreibung erspart blieb, aber Dirk war am Boden zerstört. Er erstattet mir immer mit stolzgeschwellter Brust detailgetreu Bericht, damit ich wenigstens virtuell am Spaß teilhabe, der mir sonst entgeht. Irgendwie glaubt er, dass ich nie Sex habe, was überhaupt nicht stimmt. Ich laufe bloß dem nächsten Fick nicht ganz so verbissen hinterher wie er.
Pünktlich trudle ich zum Vorstellungsgespräch ein und drücke um genau zehn Uhr auf die Klingel.
Der Métro verdanke ich meine Pünktlichkeit allerdings nicht. Meine Linie war wegen „unvorhergesehener technischer Probleme“ geschlossen. Unser U-Bahn-System wurde ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut, und wie’s ausschaut hat man es seither kaum erneuert oder repariert. Man könnte also davon ausgehen, dass die RATP, unser Pariser Verkehrsbetrieb, nach all der Zeit mit Problemen rechnet. Tut sie aber nicht. Intern steckt man bei denen lieber den Kopf in den Sand. Ich sah mich daher gezwungen, die nächstgelegene Station einer anderen Linie anzupeilen und mich dort dann in einen Waggon zu quetschen. Ich kam mir buchstäblich vor wie eine Sardine in ihrer Büchse. Klar war ich nämlich nicht der Einzige, der in den zweifelhaften Genuss der RATP-internen Vogel-Strauß-Politik kam.
Immerhin spuckte mich die Métro sogar fünf Minuten zu früh im 16. Arrondissement aus. Ich hatte meine winzige Wohnung nämlich zeitig verlassen – dass technische Probleme auftreten könnten, hatte ich von vornherein mit einberechnet. Seht ihr, so geht’s. Die RATP staunt, der Fachmann lächelt.
Als ich die Adresse erreiche, die Dirk mir angegeben hat, entdecke ich eine sehr, sehr noble Stadtvilla. Die von Bäumen gesäumte, ruhige Allee stinkt ja schon nach Zaster, aber dieses Haus mit seinem goldverbrämten, schmiedeeisernen Tor macht mich doch ein bisschen nervös. So auffälligen Prunk bin ich nicht gewohnt. Normalerweise treibe ich mich in diesem Pariser Viertel auch nur selten herum, was erklärt, warum ich mich so eingeschüchtert fühle. Die hochmoderne Kamera, die sich lautlos herumdreht und mich ins Visier nimmt, als ich mich dem Torgatter nähere, könnte auch dran schuld sein.
Ein asiatisches Dienstmädchen in schwarzem Kleid und weißer Rüschenschürze öffnet die Tür. Sie mustert mich blasiert, bevor sie die verdächtig nach weißem Marmor aussehenden fünf Stufen zu mir runterkommt.
„You are?“, fragt sie, ohne das Gatter zu öffnen. „Sie sind?“ Ich bin überrascht, dass sie so einwandfrei Englisch spricht. Vor allem, weil sie’s mal mit Französisch versuchen könnte – spricht man immerhin mehrheitlich in diesem Land. Aber nein.
„Trevor Raven“, antworte ich.
Sie schüttelt den Kopf, als wollte sie sagen: „Oh nein, das kann nicht sein.“ Dann will sie einen Ausweis sehen.
Ich zeige ihr meinen Reisepass.
„Oh – Raven“, sagt sie. RAY-ven.
„Raven“, korrigiere ich langsam. „Ra-VENN.“ Hallo? Frankreich? Französische Aussprache? Ein Ra ist ein Ra und kein Ray, und man betont den Namen bitte auf der zweiten Silbe? Der hat nämlich nichts mit den diebischen schwarzen Vögeln zu tun, wenn’s euch nichts ausmacht.
Das Dienstmädchen starrt mich an, ohne mit der Wimper zu zucken. „Man erwartet Sie“, sagt sie schließlich. Dann schaut sie auf ihre Armbanduhr. „Und Sie sind zwei Minuten zu spät dran.“
Natürlich bin ich das mittlerweile. Ich war urpünktlich, bevor man mich dieser bekloppten Identitätsprüfung à la KGB unterzog.
Das behalte ich aber für mich.
Das Dienstmädchen öffnet das Torgatter, bedeutet mir einzutreten und geleitet mich durch eine Halle, die so groß ist wie der Bahnhof einer französischen Kleinstadt. Sie zieht die Tür zu einer riesigen Bibliothek auf, die auch nicht von schlechten Eltern ist.
„Warten Sie hier“, werde ich angewiesen. „Und fassen Sie nichts an.“
Charmant.
Als sie lautlos die Bibliothek verlassen hat, sehe ich mir meine Umgebung an.
Der Raum, nein, der Saal lässt meinen Atem stocken. Der Steinboden ist so glänzend poliert, dass er die langen, mit Büchern angefüllten Holzregale widerspiegelt, die an den Wänden rechts und links von mir vom Boden bis zur domhohen Stuckdecke hochragen. Beides, also Regale und Bücher, sind allem Anschein nach Antiquitäten. In einer Ecke stehen ein filigraner Schreibtisch und zwei Stühle, von denen ich annehme, dass sie echte Louis XV-Möbel sind. In den Ecken protzen fette Vasen, wahrscheinlich aus China. Mir gegenüber bieten drei Fenstertüren einen herrlichen Ausblick auf den saftig grünen Rasen, die Büsche und Bäume eines Parks, der anscheinend zur Villa gehört.
Heiliger Bimbam, ein Privatpark! In Paris! So viel Luxus habe ich noch nie zu Gesicht bekommen.
Was mich aber wirklich vom Sessel reißt, sind die Bücher. Ich bin ein Bücherwurm, deswegen stehe ich ja auch hier. Und diese Bibliothek ist ein wahr gewordener Traum. Mein Blick schweift über abertausende Buchrücken, von denen die meisten so alt und dennoch so gut in Schuss sind, dass ich mein Glück kaum fassen kann. Schätze sind das, regelrechte Schätze! Und an denen werde ich über die Sommermonate herumhantieren, falls das Gespräch gut verläuft!
Tack, Tack, Tack. Stöckelschuhschritte nähern sich im Flur.
Die Tür geht auf, ich drehe mich um.
Eine Frau in einem teuren marineblauen Hosenanzug und einer weißen Bluse tack-tack-tackt auf mich zu. Auf den ersten Blick würde ich sagen: Schühchen von Louboutin. Ihr dunkles Haar ist zu einem Dutt zusammengebunden, der so streng aussieht wie ihr flüchtiges Lächeln. Auch sie mustert mich, ohne zu verhehlen, dass sie von meiner schlanken Statur, meiner schwarzen Jeans, dem schwarzen T-Shirt und den weißen Turnschuhen nur bedingt beeindruckt ist. Sie streckt mir jedoch die Hand entgegen, und ich schüttle sie eifrig.
„Sie müssen Herr Raven sein“, sagt sie. Wieder auf Englisch. Zumindest spricht sie meinen Nachnamen korrekt aus.
„Frau Destrelle?“, frage ich. Dirk hat mir ihren Namen verraten und gesagt, dass sie die persönliche Assistentin meines zukünftigen Arbeitgebers sei. Oder die Haushälterin. Oder die Sekretärin. Irgend so was halt, er blieb recht vage. Details langweilen ihn, außer sie betreffen einen Mann.
„Fräulein“, verbessert sie mich. „Setzen wir uns doch.“
Geschäftig schreitet sie zum Tischchen hinüber, Tack, Tack, Tack, und macht eine elegante Handbewegung, die mich anweist, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Ich betrachte das Ding argwöhnisch, da es sogar für mein Fliegengewicht zu filigran ausschaut. Zu meiner Überraschung und Erleichterung zerbirst es jedoch nicht spontan in seine antiken, hölzernen Einzelteile, als ich einen Teil meines Hinterns darauf niederlasse.
„Ich weiß es zu schätzen, Herr Raven, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Keine Sorge, ich werde Sie nicht lange aufhalten“, sagt Fräulein Destrelle. Womit sie meint, dass sie Wichtigeres zu tun hat. „Ich nehme an, Herr Bormann hat Sie bereits ins Bild gesetzt.“
Herr Bormann – damit meint sie Dirk. Und ja, hat er.
Ich nicke also brav und sage: „Ja, hat er.“
Ich könnte und sollte hinzufügen: „Äußerst oberflächlich“, was ich jedoch unterlasse.
Fräulein Destrelle fasst meinen zukünftigen Job ohnehin noch einmal zusammen. Bloß nichts dem Zufall überlassen, scheint ihr Motto zu sein. Sie ist eine brüske, herbe Dame, die mich an eine moderne Version von Mrs. Danvers erinnert. Ihr wisst schon, die aus „Rebecca“. Ich kann mir also gut vorstellen, wie sie sich heimlich ins Schlafzimmer ihrer verstorbenen Herrin stiehlt, um dort zart-sinnlich über Pelzmäntel und Kleider zu streichen.
Während sie redet, höre ich zu und nicke – verbale Antworten sind weder erforderlich noch erwünscht.
Nach einem zehnminütigen Monolog sagt sie: „Normalerweise hätten wir einen gründlichen Hintergrundcheck gemacht. Aber da Herr Bormann und Professor Dulieu Sie wärmstens empfohlen haben…“
Dulieu? Der weiß, dass ich existiere? Wer hätte das gedacht. Der ist einer meiner Universitätslehrer und hat mir bisher noch nicht einmal zugenickt. Natürlich kennt er Dirk. Und zwar im biblischen Sinne. Laut Dirks Beschreibung zeichnet Professor Dulieu sich dadurch aus, dass er „fett ist, dicke Venen hat und einen wunderbar ausfüllt“. Damit ist ein ganz bestimmtes Körperteil gemeint, Zwinker, Zwinker.
„Das wäre also alles. Wann können Sie anfangen?“, erkundigt sich Fräulein Destrelle.
„Wann es Ihnen passt.“
„Mal sehen. Heute ist Dienstag. Wie wäre es mit Donnerstag?“
„In Ordnung.“
„Und was haben Sie transportmäßig vorgesehen?“
Ich starre sie verblüfft an. „Warum? Öffentliche Verkehrsmittel, natürlich…“
„Aha. Zug also“, sagt sie und steht auf. „Behalten Sie das Zugticket und die Quittung des Taxis auf, damit wir Ihnen die Kosten zurückerstatten können.“
„Zug? Und Taxi? Warum soll ich einen Zug und ein Taxi hierher nehmen?“
Fräulein Destrelle starrt jetzt mich verblüfft an. Ich fühle mich, als ob mir plötzlich ein riesiger, hässlicher Pickel mitten auf der Stirn aufgeschossen wäre. „Hier arbeiten Sie selbstverständlich nicht“, meint sie fassungslos. Der bloße Gedanke, dass ich die kostbaren Antiquitäten in diesem Raum berühren könnte, lässt sie erschaudern.
„Selbstverständlich“, murmle ich.
Fräulein Destrelle seufzt. „Hat Herr Bormann Ihnen nicht gesagt, dass Sie in Herrn Kinners Sommervilla arbeiten werden?“ Armistead Kinner – so heißt ihr Chef. Ein amerikanischer Geschäftsmann, vermute ich. Verfügt über ein Riesenvermögen.
„Äh, nein“, gebe ich zu.
Mit aufgesetzter Geduld erklärt sie: „Es handelt sich um die Sommerbibliothek. In der Sommervilla. Herr Kinner möchte, dass Sie dort die Bücher katalogisieren, das heißt Titel, Autoren, Herausgeber, Erscheinungsdaten und den Platz in den Regalen auflisten.“
„Ach. Okay.“
„Stellt das für Sie ein Problem dar, Herr Raven?“
„Überhaupt nicht. Wo befindet sich die Sommervilla denn?“
„In Saint-Jean natürlich.“
Natürlich. Wie kann ich bloß so dumm fragen.
„Saint-Jean-de-Luz?“, erkundige ich mich, in der Annahme, dass sie die berühmte Küstenstadt im französischen Baskenland meint.
„Aber nein doch, nein! Saint-Jean-Cap-Ferrat.“ Ihr Gesicht verrät, dass sie gerade „Wo denn sonst!“ denkt, aber sich zu fein ist, das auszusprechen.
„Ach, so. Okay.“
„Sind Sie immer noch an der Stelle interessiert?“
„Au ja.“ Juli und August an einem der elegantesten und exklusivsten Orte der Côte d’Azur zu verbringen, ist noch besser als das Baskenland. Ich hüpfe fast auf meinem Stuhl auf und ab, erinnere mich aber rechtzeitig daran, dass ich dem zarten Louis XV-Ding damit wahrscheinlich doch noch den Garaus machen würde. „Aber ich fahre mit dem Auto runter, wenn es Ihnen nichts ausmacht“, füge ich hinzu.
Tut es nicht. Ihre Miene lässt die Schlussfolgerung zu, dass es ihr piepegal ist. „Wie Sie wollen. Das wäre dann also erledigt. Heute Nachmittag sende ich Ihnen die Details sowie den Vertrag per E-Mail zu. Sie händigen bitte der Haushälterin in der Sommervilla ein unterschriebenes Exemplar aus.“
Ohne viel Federlesens werde ich bedankt – mit der Wärme eines Iglus – und dann hinausbegleitet.
Das Ganze hat zwanzig Minuten gedauert.
Während ich zur Métrostation latsche, fühle ich mich noch immer leicht benommen. So kann es einem schon mal gehen, wenn man eine unerwartet gute Nachricht erhält und unglaublichen Reichtum unter die Nase gerieben bekommt.
Plötzlich fällt mir ein, dass ich nicht einmal nach dem Gehalt gefragt habe.
Noch so ein kleines Detail, das Dirk vergessen hat zu erwähnen.
Also, es ist so: Dirk ist ein Flittchen
Also, es ist so: Dirk ist ein Flittchen.
Nein, das ist falsch formuliert. Dirk ist das Oberflittchen.
Versteht mich nicht falsch, ich meine das liebevoll. Aber Fakt ist Fakt, und er steht auch offen dazu. Wenn ihr ihn fragt, was „Monogamie“ ist, wird er sagen, ein Brettspiel.
Wir hatten da vor zwei Jahren mal was miteinander. So kam ich auch dahinter, dass Dirk ein Flittchen ist. Will heißen, auf die harte, aber eindeutige Art und Weise. Unsere Romanze als kurz zu beschreiben wäre eine Untertreibung. Eine weitere Untertreibung wäre zu sagen, dass ich am Boden zerstört war, als alles aus und vorbei war, bevor es überhaupt angefangen hatte. Das liegt daran, dass ich hoffnungslos romantisch bin. Was wiederum bedeutet, dass ich nach unserem ersten Fick – der übrigens auch unser letzter sein sollte – drauf und dran war, Hochzeitseinladungen zu verschicken.
Dirk nicht unbedingt.
Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, er gibt zu, dass er ein Flittchen ist. Spielt sogar mit offenen Karten und warnt einen vor.
Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir beide unseren Höhepunkt erreicht und wischten gerade die dementsprechenden Spuren von unseren Körpern, als er beiläufig meinte: „Wow – das war großartig, Tyler!“
„Trevor.“
„Ach. Stimmt. Trevor. Übrigens: Verlieb dich bloß nicht in mich.“
Meine Reaktion bestand aus… Schnappatmung. Ich war sprachlos. Wahrscheinlich, weil ich genau das vorhatte: mich zu verlieben.
Ohne auf meine emotionale Aufgewühltheit einzugehen, meinte er fröhlich: „Ich steh nicht auf langfristige Beziehungen. Eigentlich steh ich nicht einmal auf kurzfristige Beziehungen. Normalerweise geht’s mir bloß ums Ficken, weißt du. Zwanglos und ohne Folgen.“
Ich nickte wie ein Roboter.
„Aber ich glaube, ich mag dich. Wir könnten doch Freunde bleiben, was meinst du?“
Wir schüttelten uns dieselben Hände, die vor wenigen Minuten noch ganz andere Körperteile geschüttelt hatten, und ich setzte ein Pokerface auf, als wir voneinander Abschiede nahmen. Erst in meiner kleinen Wohnung brach ich in Tränen aus.
Irgendwann war der Schmerz dann vorbei. Nach einer Woche, um genau zu sein. Nicht weil ich ein steinernes Herz habe, sondern weil Dirk dafür sorgte, dass ich nicht länger leide. Seine Therapie bestand darin, mich in den folgenden Tagen mehrmals anzurufen, um mich bis ins kleinste Detail über seine neuesten Eroberungen zu informieren.
Nach einer Woche sagte ich: „Du bist so ein Flittchen, Dirk.“
„Wie süß von dir!“, erwiderte er und klang aufrichtig geschmeichelt.
Er therapierte mir im Handumdrehen meine romantische Ader weg. Ich suche immer noch nach meinem Mr. Darcy, okay. Man verwandelt sich nicht radikal nach einer Woche, oder besser gesagt nach einem Fick, in eine ganz andere Person. Aber ich habe aufgehört, mich jedes Mal, wenn ich flachgelegt werde, zu verlieben. Obwohl Dirk das Gegenteil behauptet, passiert das gelegentlich. Selbst ein blindes Huhn findet hin und wieder ein Korn, wie man sagt.
Dirk ist übrigens Deutscher. Noch dazu so ein nervig attraktiver Deutscher, der aussieht wie der süße, knackige Nachbar, von dem wir alle träumen. Ihr wisst schon, dichtes blondes Haar, blaue Augen, hohe Wangenknochen, verschmitztes Lächeln. Er ist groß und gut gebaut, mit prallen Muskeln und ohne nennenswertes Körperfett. Er geht nicht einmal ins Fitnessstudio – ich meine, wie ungerecht ist das denn? Oh, er ist auch unter der Gürtellinie sehr gut ausgestattet, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt.
Mit anderen Worten, er ist ein Prachtkerl mit einem Prachtschwanz. Der Typ, der alles hat, was man so braucht, und das in vollen Zügen genießt, was ich ganz normal finde.
Was ist mit mir, wollt ihr wissen? Gute Frage. Ich bin purer Durchschnitt. Niemand würde mich als gutaussehend beschreiben. Ich bin eher schlank gebaut. Nein, macht da mal „dünn“ draus. Keine Muskeln motzen meinen Körper auf, keine breiten Schultern, nur Magerkeit, wohin man schaut. Ich sag’s noch mal, ich werde trotzdem öfters flachgelegt.
Manche Typen stehen auf magere Kerle, und was soll ich dazu groß sagen? Danke, sehr lieb.
Meine besten Merkmale? Lasst mich nachdenken. Meine Augen vielleicht. Die sind smaragdgrün und stechen hervor, denn meine Haare sind dunkel und mein Teint auch. Cappuccinofarbig. Amerikaner mit ihrer Vorliebe für Binäres und klare Abgrenzungen würden mich als Farbigen ansehen. Meine Mutter ist Amerikanerin und dunkelhäutiger als ich, also sollte ich es wissen. Vor allem, weil sie mich einen Farbigen nennt, aber hey, das ist Mama.
Hier in Europa würde ich als Mittelmeertyp durchgehen, wären da nicht die dicken Lippen – „Perfekte Lutsch-mich-Lippen“ laut Dirk – und die sehr markanten, krausen Haare. Die Lippen sind in Ordnung. Ob sie sich gut fürs Blasen eignen oder Dirk wieder mal einen seiner rassistischen Momente hatte, kann ich nicht sagen. Hatte nie Beschwerden im Oralbereich, falls ihr die Wahrheit wissen wollt.
Und mein Haar, na ja, ich mag es. Lass es nur selten schneiden und bevorzuge den guten, alten Afro-Stil. Man kann so viele coole Dinge mit einem netten Afro machen, besonders jetzt, wo Mann draufgekommen ist, dass ein Männerdutt ein hippes Modestatement ist.
Oh, da ich gerade von Merkmalen rede, die ich an mir mag – vergessen wir meinen Hintern nicht. Das Beste, was ich von den weit entfernten afrikanischen Vorfahren meiner Mutter geerbt habe. Er ist fest und knackig. Kann bei Schwulen mit Arschfixierung durchaus zu feuchten Träumen führen. Das wird euch jetzt überraschen, aber die sind in unseren Bataillons nicht unbedingt Mangelware.
Zurück zu Dirk, wenn’s euch nichts ausmacht. Er ist eigentlich ein dufter Freund: zickig, lebhaft, komplett sorglos und unbeschwert. Außerdem ist er seinen Freunden gegenüber sehr loyal. Auf gewisse Weise. Seine Weise. Deshalb hat er mich als Ersatzkandidat für seinen Job bei den Kinners vorgeschlagen, sobald er beschlossen hatte, dass er seine Sommermonate doch lieber bei seiner Tante in Griechenland verbringen möchte. Diese freakige Frau hat gerade ihre neueste Erbschaft in ein Häuschen an der Peloponnes-Küste investiert und ihn dorthin eingeladen.
„Ich kann nicht nein sagen“, meinte er am Telefon. „Denk bloß mal an die schönen Landschaften. Und das Meer. Und das Essen.“
„Denk an die schönen Griechen“, murmelte ich.
„Genau“, pflichtete er mir bei. „Also, kannst du an meiner Stelle das Vorstellungsgespräch machen? Bitte?“
„In Ordnung. Ist gebongt.“
Ich weiß nicht, welche schwindlige Lüge er Fräulein Destrelle erzählt hat, und wahrscheinlich will ich es auch gar nicht wissen. Ich bin erleichtert, dass sie das Thema nicht angeschnitten hat, denn die Möglichkeit ist groß, dass Dirks Mutter schon wieder mit einem Fuß im Grab steht. Bisher hat sie sich mindestens ein Dutzend Mal von so gefährlichen Krankheiten wie Jugularfieber und akuter Furzinose erholt. Kein Scherz. Versucht mal, ein ernstes Gesicht zu bewahren, wenn so was in einem Vorstellungsgespräch auftaucht!
Wisst ihr was? Irgendwie bin ich Dirk dankbar, dass er seine Sommerpläne umgeschmissen hat. Ich brauche den Zaster. Deshalb habe ich nicht lange überlegt, bevor ich mich für seine Stelle beworben habe.
Ich studiere Französisch an der Sorbonne. Ab und zu helfe ich in einer Buchhandlung aus, aber wenn man sich das Gehalt anschaut, ist das mehr ein Wohltätigkeitsding als ein gut bezahlter Job. Reicht nicht wirklich für die Sachen, die ich kaufen muss, Bücher und so Zeugs. Es wäre da auch das Essensproblem. Meine Mutter gibt mir jedes Mal Tupperware-Boxen mit, wenn ich meine Eltern besuche, aber die gehen mir nach einer Weile natürlich aus. Ich muss auch die Miete für meine Wohnung bezahlen. Okay, die ist so klein und vollgestopft, dass ein Hund senkrecht mit dem Schwanz wedeln müsste, aber trotzdem. Für diejenigen, die es nicht wissen: die Mieten in dieser Stadt sind der glatte Wahnsinn.
Meine Eltern, ihre Großzügigkeit sei gepriesen, geben mir etwas Geld. Was sie sich halt leisten können. Mama ist eigentlich nur Hausfrau und Mutter. In den USA war sie Französischlehrerin, aber als sie Papa heiratete und die beiden sich in Frankreich niederließen, hörte sie auf zu unterrichten. Jetzt nimmt sie gelegentlich einen Übersetzungsjob an, der sie nicht unbedingt reich macht, aber wenigstens beschäftigt.
Papa ist übrigens Englischlehrer. Praktisch, was die Arbeitsplatzsicherheit betrifft, aber auch nicht unbedingt ein Masterplan, wenn man schnell reich werden will.
Und nein, ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber der Beruf meiner Eltern hat nichts mit meiner Studienwahl zu tun. Fragt mich nicht, was ich machen möchte, wenn ich fertig studiert habe, aber eins ist sicher: Ich lasse mir lieber den Schwanz abhacken, als Lehrer zu werden. Das ist kein Job, sondern eine Berufung. Ein Lebensopfer.
Was ich euch damit sagen will, ist, dass wir nicht wirklich im Geld schwimmen. Meine Eltern kommen über die Runden, aber meine kleine Schwester Judy lebt noch zu Hause. Sie ist sechzehn, und sechzehnjährige Mädchen scheinen heutzutage ganz schön viel Geld zu kosten. Ihr wisst schon, Klamotten und Make-up und Sachen, die wir Jungs nicht brauchen. Judy ist ein Engel, auch wenn sie manchmal nervig sein kann. Nichts macht ihr mehr Freude, als mich auf den Arm zu nehmen. Da sie diejenige ist, die den Grips abbekommen hat, fallen mir oft zu ihren Sticheleien keine passenden Antworten ein.
Entschuldigung, ich quassle und quassle. Aber ich bin so erleichtert. Und so aufgeregt. Ich meine, ich habe einen Sommerjob, Jungs! In einem noblen Badeort an der noblen Côte d’Azur.
Ich glaube, Dirk wusste gar nicht, dass es sich um eine Stelle an der Côte d’Azur handelt. Sonst hätte er den Job nicht vorschnell in den Wind geschlagen. Denkt bloß an die schönen Landschaften. Und das Meer. Und das Essen.
Und die tollen Männer, von denen es in der Gegend sicher nur so wimmelt.
Vielleicht kann man da sogar den einen oder anderen Millionär einfangen. Sag ich jetzt mal so.
Nicht, dass ich geldgierig wäre, aber Dirk? Ô là là, der schon.
Vielleicht sollte ich ihm gegenüber die Côte d’Azur nicht erwähnen – was meint ihr?
War bloß ein Scherz.
Wenn er jetzt noch seine Meinung ändern möchte, ist er sowieso zu spät dran.
Ihr könnt also sicher sein, dass ich ihm das unter die Nase reiben werde, aber so was von!
„Papa – was ist jetzt mit Betty?“
„Papa – was ist jetzt mit Betty?“, jammere ich zum x-ten Mal. „Glaubst du wirklich, dass du heute noch fertig wirst?“
Papa liegt unter Betty und keucht. Er wedelt mit der Hand, was vieles bedeuten kann: „Aber klar“ oder „Abwarten und Tee trinken“ oder sogar „Mach dir mal keine allzu zu großen Hoffnungen“.
Hoppla. Tut mir leid. Einer der vorherigen Sätze kommt mir plötzlich sehr doppeldeutig vor. Sorry, war nicht absichtlich.
Um’s also deutlicher zu formulieren: Betty ist mein Auto. Ein ramponierter, alter Twingo, den ich gleich nach meinem achtzehnten Geburtstag für ein Butterbrot gekauft habe. Ich habe ihn Betty genannt, weil er sich anfangs wie eine nette, alte Dame mit einem ausgesprochenen Hang zu unvorhergesehenen Kapriolen verhielt. Genau wie meine Lieblingsschauspielerin, Betty White.
Betty ist jetzt weit weniger wert als ein Butterbrot – das Auto, nicht die Schauspielerin, die ist Gott sei Dank immer noch so scharfsinnig wie Sherlock Holmes –, weil ich sie so gut wie nie benutze. Also, das Auto. In Paris fährt man nicht Auto, wenn man’s vermeiden kann, also verstaubt und verrostet Betty seit anderthalb Jahren in der Garage meiner Eltern. Sie funktioniert immer noch, mehr oder minder, weil meine Mutter sie wahrscheinlich jeden Abend in ihr Gebet einschließt. Und mein Vater hat ein Händchen für Notreparaturen. Das heißt, er bildet sich das ein und versucht deshalb immer, kleinere Schäden selbst zu beheben. Mal erfolgreich, mal vergebens. Aber selbst das ist weitaus besser, als mich zu bitten, einen Blick auf eine Panne zu werfen; ich bin landläufig als technische Komplettnull bekannt.
Das Problem ist, ich habe gestern angerufen, um meinen Eltern von meinem Sommerjob zu erzählen. Und um ihnen mitzuteilen, dass ich heute vorbeikomme, bei ihnen übernachte und morgen dann mit meinem Auto abrausche. Papa ist in Sommerferien und langweilt sich wie ein Biber in der Sahara. Er hat mir also freudig angeboten, mein Auto zu waschen.
Als ich heute Morgen ankam, begrüßte er mich mit einem traurigen Lächeln. Er war allein, weil Mama Judy in den Supermarkt abgeschleppt hatte, zum wöchentlichen Einkauf.
„Ich hab’ eine gute und eine schlechte Nachricht, Sohnemann“, sagte Papa, nachdem er mich wie zum Trost ausgiebig umarmt hatte.
Mir schwante sofort Schlimmstes. „Erzähl mir zuerst die gute Nachricht.“
„Dein Auto steht da drüben und sieht so flott aus wie Roger Moore im Smoking.“
„Okay. Und die schlechte Nachricht?“
„Na ja, Betty könnte ein Problem haben.“
„Ein kleines oder ein großes?“
„Das musst du entscheiden, Sohnemann.“
„Papa!“
„Also… äh… wir mussten Betty aus der Garage schieben, weil sie nicht anspringen wollte.“
Ich schlug mir die Hände vors Gesicht und stöhnte: „Das ist nicht einmal mehr ein großes Problem, Papa! Das ist ein Desaster!“
Papa klopfte mir auf die Schulter und sagte fröhlich: „Sohnemann, erspar dir den Drama-Queen-Auftritt. Wir werden sie reparieren.“
„Heute noch?“
„Geh davon aus, dass sie schon so gut wie startbereit ist.“
„Und mit ‚wir’ meinst du…“
„Ich repariere sie. Und du leistest mir Gesellschaft. Okay?“
„Okay. Ich reiche dir sogar… Schraubenzieher und so, wenn du das Zeugs ausführlich beschreibst.“ Wie gesagt, alles Technische ist für mich Terra Incognita.
So kommt es, dass Papa unter Betty liegt und ich auf dem Rasen sitze und ihm dabei zusehe, wie er keucht und verschiedene Teile abmontiert und von Minute zu Minute schmutziger und verschwitzter wird. Nicht verärgert, weil mein Vater als unheilbarer Optimist nicht einmal weiß, wie man das Wort schreibt.
Seit zwei Stunden gibt er sein Allerbestes. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob er wirklich weiß, was er tut; ich habe inzwischen sogar den untrüglichen Eindruck, dass er keine Ahnung hat, was das Auto hat. Deswegen gehe ich ihm ja auch die ganze Zeit mit meinen Fragen auf die Nerven. Und deswegen wedelt Papa so vage mit der Hand, was, davon bin ich mehr und mehr überzeugt, bedeutet: „Der Vogel ist tot.“
Wobei der Vogel in diesem Fall Betty ist. Das Auto, nicht die Schauspielerin. Die verehre ich.
Eine halbe Stunde später sind die Würfel gefallen. Wir sitzen beide auf dem Rasen, schlürfen Bier und starren mürrisch auf Betty. Um uns herum liegen zahllose Motorteile, vermutlich welche, die Papa ausgebaut hat und von denen er nicht weiß, wo er sie wieder einbauen soll. Er würde es nie zugeben, aber manchmal glaube ich, dass er technisch genauso begabt ist wie ich.
„Dann werd‘ ich wohl den Zug nehmen müssen“, meine ich düster.
Papa seufzt. „Ich fürchte, das ist die beste Lösung.“
Jetzt, wo Betty einige Teile fehlen, auch die einzige Lösung, füge ich innerlich hinzu.
In dem Moment hören wir Mamas Auto den Kiesweg herunterrollen.
Um euch einen kurzen geografischen Überblick zu geben: meine Eltern leben in Sainte-Gudule. Ihr habt den Namen wahrscheinlich noch nie davon gehört, was nicht weiter schlimm ist. Niemand kennt den Ort – nicht einmal das GPS, und das meine ich ernst. Wenn wir wen einladen, versuchten die Leute immer, uns mit dem Gerät zu lokalisieren. Am Ende rufen sie uns jedes Mal an, damit wir ihnen ansagen, wie man hierherkommt. Sainte-Gudule ist ein kleines Dorf am periphersten Rand von Paris, so peripher, dass man hier das Gefühl hat, die Hauptstadt wäre nur eine Legende. Im Dorf leben gerade einmal fünfhundert Seelen. Wir haben eine Hauptstraße, eine Kirche, das Rathaus, Gott sei Dank auch eine Bäckerei. Der Rest besteht aus Wäldern, Feldern und Bauernhöfen.
Ich kenne das Dorf auswendig, weil ich hier aufgewachsen bin. Es ist… idyllisch, wenn man großzügig sein will. Und wenn man lieber ehrlich sein will, dann ein gottverlassenes Kaff. Unser Haus steht am periphersten Rand dieses peripheren Kaffs, so dass uns nur ein Kiesweg mit dem verbindet, was im Zentrum von Sainte-Gudule als Zivilisation durchgeht.
Hat auch seine Vorteile. Vertreter oder Zeugen Jehovas belästigen uns hier draußen eher selten.
Mamas Cabrio bleibt in der Einfahrt stehen. Meine Mutter besitzt den wahrscheinlich einzigen pinkfarbenen Fiat 500 dieser Erde. Ich nehme an, dass er für eine farbenblinde Person maßangefertigt wurde, die sich’s schließlich doch anders überlegt und das Auto nie abgeholt hat. Dann kam Mama, sah es im Schaufenster des Fiat-Händlers stehen und verliebte sich auf den ersten Blick.
Mama springt aus dem Auto und winkt uns zu. „Was für eine Augenweide!“, ruft sie. „Meine beiden Lieblingsmänner, Seite an Seite!“
Meine Schwester Judy steigt auch aus und streckt sich. In ihren engen, kurzen Jeans-Shorts und dem weißen Top sieht sie aus, als würde sie für eine sexy All-American Streetwear-Marke posieren. Sie hat nicht nur den Grips, sondern auch das Aussehen abbekommen. Stellt euch eine sehr junge und schlanke Beyoncé vor.
Aufreibend, ich hab’s euch schon gesagt.
Judy gähnt. Dann blinzelt sie mich an und meint: „Mein Gott, Trevor. Wie oft muss ich‘s dir noch sagen: Leg dir ein paar Muskeln zu.“
Ich erwidere: „Hey, Hummelhirn.“
„Hey, Furzgesicht.“
Wir lächeln uns an, während ich zu Mamas Auto rüberlatsche. Ich umarme Mama, dann Judy, die das Gesicht verzieht und schnieft. „Bäh! Du stinkst!“
„Wir haben an Betty herumhantiert“, protestiere ich.
Judy schnaubt nur. „Sagt der Typ, der nicht einmal weiß, was der Unterschied zwischen einem Nagel und einer Schraube ist. Wahrscheinlich hast du Papa bloß zugesehen und gemeckert.“
Was… total korrekt ist. Trotzdem strecke ich ihr die Zunge heraus.
Mama schleppt schon Einkaufstüten ins Haus. „Kinder, hört auf, euch zu zanken, und helft mir mal lieber, ja?“
Judy und ich gehorchen. Papa auch. Mama ist der Auffassung, dass wir im Haus gemeinsam anpacken müssen, und Papa hat gelernt, dass jegliche Widerrede sinnlos ist.
Als wir alles verstaut haben, essen wir auf der Terrasse zu Mittag, und Papa lässt die Katze namens Betty aus dem Sack.
Mama sagt sofort: „Na, dann bleibt nur noch eine Lösung.“
Judy versucht, sich ein Grinsen zu verkneifen; sie hat wahrscheinlich gerafft, worauf Mama hinauswill.
„Was für eine denn?“, frage ich.
„Ich borge dir Sean, was sonst“, sagt Mama trocken.
Sie und Papa sind beide James-Bond-Fans. Mama hat eine Vorliebe für Sean Connery, Papa für Roger Moore. Deshalb heißt Mamas Auto Sean.
Ja, wir geben unseren Autos Namen. Fragt mich nicht, warum. Ist so ein Familiending.
Ich versuche, nicht zusammenzuzucken. „Sean?“, hake ich nach. „Aber du brauchst dein Auto doch.“
„Unsinn. Es ist Sommer. Wir können Roger nehmen.“
Papas Auto. Nichts zu danken.
Judys Grinsen wird immer breiter. Wir sind uns beide einig, dass Mamas Auto eine Schnepfenkarre ist. Weil hallo? Ein Fiat 500? Ein rosaroter Fiat 500? Wir würden nicht einmal im Traum daran denken, Mama zu verraten, was wir von Sean halten; aber seit sie ihn gekauft hat, kichern wir hinter ihrem Rücken.
„Versprich mir, dass du vorsichtig fährst, Trevor. Du weißt, wie sehr ich an Sean hänge“, sagt Mama und tätschelt meine Hand.
Kacke. Jeglicher Versuch, sie von der Schnapsidee abzubringen, ist nutzlos. Mama ist stur wie ein Esel, also bleibt mir nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und mich morgen in der rosa Monstrosität Richtung Côte d’Azur aufzumachen.
Wenn ich dann mal vor Ort bin, werde ich halt öffentliche Verkehrsmittel nehmen, sollte ich mal wo hinfahren wollen.
Denn nichts schreit lauter „Achtung, Schwuchtel!“ als ein schwuchteliger Typ in einer pinkfarbenen Schnepfenkarre.
Ich hätte mit dem Zug fahren sollen
Ich hätte mit dem Zug fahren sollen. Jeder vernünftige Mensch – das heißt, jeder Mensch über fünfundzwanzig – hätte das auch getan, ohne lange zu überlegen. Aber. Ich bin zwanzig. Und Judy sagt immer, dass mein gesunder Menschenverstand so gut entwickelt ist wie meine Muskeln.
Den Sager würde ich, ha ha, ha, furchtbar lustig finden, wenn sie damit nicht furchtbar recht hätte.
Mein nicht vorhandener gesunder Menschenverstand muss der Grund sein, warum ich keine Sekunde zögere, die 1.000 Kilometer lange Reise am Steuer von Sean anzutreten. Noch dazu in Bombenstimmung, was euch zeigt, wie wenig Ahnung ich davon habe, was mir bevorsteht.
Am Vorabend nehme ich mir noch vor, meine Reise zu planen, aber seltsamerweise läuft mir die Zeit davon. Die Sache ist nämlich die: Ich habe vergessen, einen Koffer oder eine Reisetasche mitzubringen. In ihrer üblichen, uneigennützigen Art meint Judy, ich könne mir ja ihren alten Barbie-Koffer ausborgen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie keck sie grinst, als sie mir das Angebot unterbreitet. Und wie prompt ich dieses ablehne.
Mama sagt dann, sie könne ebenfalls nachschauen, ob sie ihren eigenen Koffer schnell noch findet. Erneut erwidere ich, das sei bitte nicht der Mühe wert. Denn mir schwant dunkel, dass ihr Gepäckstück Judys Koffer in nichts nachsteht. Obwohl Mama nicht farbenblind ist, hat sie ein Faible für ausgefallene Farben und Muster.
Als alle schlafen gegangen sind, stopfe ich einfach in aller Hast zwei Jeans, zwei Shorts, Flipflops, ein paar T-Shirts und einen Stapel Unterwäsche plus meine Toilettenartikel in zwei Plastiktüten mit Supermarktlogo, die ich dann klammheimlich in Seans Kofferraum werfe.
Diese Vorbereitungen in letzter Minute hindern mich daran, Google Maps zu konsultieren. Deshalb mache ich das erst im letzten Augenblick, sprich am nächsten Morgen während des Frühstücks.
Die App warnt mich, dass ich achteinhalb Stunden nach Saint-Jean brauchen werde. Das heißt, wenn ich durchfahre und keinen einzigen Zwischenstopp einlege. Okay, Google Maps warnt mich nicht wirklich, sondern teilt mir das auf nüchterne Art und Weise mit. Trotzdem, warnen hätte mich schon jemand können. Sagen wir mal, meine Eltern? In einer Familie sollten die Eltern ja eigentlich die sein, die überlegt handeln.
Aber in meiner Familie? Da könnt ihr euch das aufs Brot schmieren.
Alles, was Mama zu meiner Reise einfällt, ist, zwei riesige Kühltaschen anzuschleppen. Weiße mit roten Tupfen, weil Mama. Beide sind proppenvoll mit belegten Brötchen und Tupperware-Boxen. Vielleicht hat sie was von einer akuten Nahrungsmittelknappheit im Süden gelesen, und mir hat das wieder mal niemand gesagt?
Papa strahlt mich an und faselt abstrus von Abenteuergeist und wie diese Reise mich als Person reifen lassen wird. Ich fühle mich wie Indiana Jones auf der Suche nach dem Heiligen Gral.
Judy ist die Einzige, die davon überzeugt ist, dass die Autofahrt eine Schnapsidee ist. Sie spricht’s jedenfalls als Einzige deutlich aus. Am Frühstückstisch sagt sie: „Du bist total durchgeknallt, Trevor. Ich hoffe, das weißt du auch.“
„Du wirst mir auch abgehen, Schwesterherz“, erwidere ich und muss gerührt schlucken, weil: sie vermisst mich schon jetzt.
Sie schnaubt und murmelt: „Ihr Spinner seid ein unverantwortlicher Haufen. Ich wasche meine Hände in Unschuld…“
Es ist halb fünf Uhr morgens, als ich zum Abschied Winke-Winke mache und meine Eltern und Judy im Rückspiegel verschwinden sehe.
Nachdem ich unser gutes, altes, kaffiges Sainte-Gudule hinter mir gelassen habe, fahre ich die Bundesstraße entlang, die in der Nähe des berühmten Schlosses Vaulx-le-Vicomte in die Autobahn A5 mündet. Ich fühle mich abenteuerlustig. Danke, Papa, dass du mir den Kopf mit diesem Unsinn vollgestopft hast.
Das Wetter ist herrlich, die Sonne gerade hinter dem Horizont aufgegangen. Ich durchquere verschlafene, aber schnuckelig aussehende Käffer, Weiler und Dörfer, während ich mir einen Mix auf SoundCloud anhöre. Meine Stimmung ist so wolkenlos wie der blaue Himmel über mir.
Sean, stellt sich heraus, ist ein tolles Auto. Er macht reibungslos, was ich ihm abverlange. Mama liebt Papa, aber sie ist eine bodenständige und schlaue Frau. Das heißt, sie lässt ihr Auto einmal im Jahr von einem Fachmann checken. Was man an der Fahrtauglichkeit des Autos deutlich merkt – tut mir leid, Papa, aber das muss gesagt werden.
Auf der Autobahn stelle ich jedoch fest, dass Sean kein Raser ist. Mit anderen Worten, er ist furchtbar träge. Seine zögerliche Beschleunigung macht er jedoch durch stetigen Motorenlärm wett, der meine Musik komplett übertönt.
Die Situation verbessert sich, als wir unsere Reisegeschwindigkeit von 130 km/h erreichen. Nicht lärmmäßig, aber zumindest rasselt und zittert und spuckt und hustet Sean nicht. Betty macht das nämlich schon, und zwar ab 80 km/h.
Ich atme erleichtert auf – offenbar ist es ein Segen, dass Papa mein Auto so gekonnt außer Betrieb gesetzt hat. Die 1.000 Kilometer hätte die alte Dame nie und nimmer überlebt. Sean ist pink und laut, aber wenigstens habe ich nicht den Eindruck, dass er kurz davor ist, in seine Einzelteile zu zerfallen. Ich schalte einfach die Musik aus und summe vor mich hin, träume von den schönen Landschaften, dem Meer, dem Essen und den knackigen Südmännern. Ich rufe mir auch das Geld in Erinnerung, das mein Konto bald bereichern wird. Wie versprochen hat mir Fräulein Destrelle nach unserem Vorstellungsgespräch den Vertrag zugeschickt. Ich habe festgestellt, dass mein Gehalt ziemlich üppig ausfällt.
Ich zische an einem Schild vorbei, das die Ausfahrt Sens ankündigt. Wunderbar, die ersten hundert Kilometer hätten wir geschafft!
Dann schaue ich auf die Uhr. Es ist…
Scheiße.
7h30.
Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich schon zwei Stunden unterwegs bin. Und mir wird bewusst, dass mir noch neunhundert Kilometer bevorstehen.
Zum ersten Mal frage ich mich, ob ich einen Dachschaden habe. Anstatt hinter dem Lenkrad dieser kleinen rosa Lärmbox könnte ich nämlich momentan in einem französischen Hochgeschwindigkeitszug sitzen. Der transportiert einen recht bequem von Paris an die französische Riviera.
In sechs Stunden und vierzig Minuten.
Lebensweisheit Nr. 1
Ein Fiat 500 ist für Fernreisen nicht die beste Wahl.
Als ich in Nizza ankomme, fühle ich mich wie ein zerkautes Fruchtgummi
Als ich in Nizza ankomme, fühle ich mich wie ein zerkautes Fruchtgummi.
Die längere Version wäre, dass Arm- und Beinbereich völlig verkrampft sind. Mein Rücken schmerzt, mein Kopf droht zu explodieren, ich bin erschöpft, und mir ist furchtbar heiß. Denn stellt euch vor: Sean hat keine Klimaanlage.
Unglaublich, nicht? Keine! Verdammte! Klimaanlage! Ich weiß nicht, was sich Mama dachte, als sie das Auto gekauft hat. Nicht nur wegen der Farbe, über die wir noch stundenlang diskutieren könnten, sondern weil die Karre nicht einmal über diese Basisausstattung verfügt. Ach, und kommt mir jetzt nicht mit Umweltschutz! Nach 1.000 Scheißkilometern im Scheißjuli in einem Auto ohne Scheißklimaanlage gebe ich ungeniert zu: Mir ist Umweltschutz scheißegal.
Auf der langen, langen Fahrt zur Côte d’Azur runter habe ich viermal an Autobahnraststätten Halt gemacht, um mir die Beine zu vertreten, dem Ruf der Natur zu folgen – also pissen zu gehen – und ein Brötchen zu mampfen. Auf der letzten Teilstrecke hätte ich mich an den herrlichen Landschaften erfreuen können, aber die nahm ich nicht einmal wahr. Wahrscheinlich, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, mir den Schweiß aus den Augen zu wischen. Und weil ich nur noch wollte, dass die grauenhafte Fahrt zu Ende geht und die Scheißcôte d’Azur endlich am Horizont auftaucht.
Ich seufze erleichtert auf, als ich um zehn nach sechs in der Nähe des Flughafens von Nizza die Autobahn verlasse und auf den Boulevard René Cassin abfahre.
Meine erste Reaktion besteht darin, den Knopf für das Schiebedach über meinem Kopf zu bedienen, und selbiges öffnet sich lautlos. Halleluja – frische Luft weht herein! Habe ich schon erwähnt, dass ich so verschwitzt wäre, als ob ich zu Fuß zur Côte d’Azur gelatscht wäre? Oder auf allen Vieren runtergekrochen?
Der Verkehr entpuppt sich als zähflüssig – no na, ich sage bloß mal „Stichwort Abendstoßverkehr“ –, aber ich bin zu erschöpft, um mich drüber groß aufzuregen. Ich fahre einfach beharrlich weiter, bleibe stehen, wenn eine Ampel auf rot schaltet, trete auf die Bremse, wenn ein Idiot plötzlich langsamer wird, bediene die Gangschaltung wie ein Roboter und folge den Anweisungen auf Google Maps.
Nach geraumer Zeit erhasche ich meinen ersten Blick auf die schöne, weite Bucht von Villefranche-sur-Mer, auf deren anderer Seite die Halbinsel Saint-Jean-Cap-Ferrat wie ein langer, knorriger Finger ins Mittelmeer ragt. Unzählige Prominente haben hier schon geurlaubt, frage nicht – von gekrönten Häuptern über Winston Churchill, Charlie Chaplin, David Niven oder Liz Taylor bis hin zu Keith Richards und Bono Vox. Der Ort ist also mittlerweile zum Inbegriff für Glanz und Glitter geworden. Und für unverschämt hohe Quadratmeterpreise.
Unter mir glitzert das Wasser in verführerischen Blau- und Türkistönen. Obwohl Seans Motor weiter vor sich hin lärmt, kann ich sogar das berühmte „Abendkonzert für Wellen und Zikaden“ hören, das einen sofort an Südfrankreich denken lässt.
Schließlich gelange ich an meinem Ziel an, sprich ich erreiche die Adresse, die mir Fräulein Destrelle gegeben hat. Vor einem hochmodernen Tor bleibe ich stehen. Die wundervollen Pinien, Palmen, Zypressen und Rhododendren um mich herum würdige ich keines Blickes; sie sind übrigens alles, was es hier zu sehen gibt, weil die mondänen Villen sich alle hinter hohen Mauern verstecken.
Egal. Ich bin endlich am Ziel.
Nachdem ich aus dem rosa Auto ausgestiegen bin, strecke ich erst einmal Rücken und Beine durch. Das ein oder andere Stöhnen entkommt mir vielleicht auch.
Dann fällt mein Blick auf die Gegensprechanlage neben dem Tor. Ich trete näher und drücke auf die Klingel.
Wie erwartet drehen sich zwei deutlich erkennbare, auf der Mauer montierte Kameras zu mir herum und filmen in Stereo und hoher Auflösung den zerzausten, mageren jungen Mann mit zerzauster Afrofrisur im schweißnassen T-Shirt.
Keine Antwort.
Ich starre auf die Gegensprechanlage, dann in die Kameras. Bitte sagt mir, dass ich träume. Bitte sagt mir nicht, dass niemand zu Hause ist.
Ich drücke erneut auf die Klingel. Bzz. Bzz.
Und noch einmal. Bzzzzzzzzzzzz. Wenn ich den Finger auf der Klingel lasse, wird das vielleicht doch noch jemanden aufscheuchen.
Ich bin ein Zauberer – die Strategie funktioniert.
„Was soll der Scheiß?!“, bellt jemand in der Sprechanlage. Männlich und sehr verärgert. Noch dazu auf Englisch, bitte schön, mit einem seltsamen, undefinierbaren Akzent.
„Das ist ein Privatgrundstück! Verpiss dich, du Landstreicher, oder ich rufe die Polizei!“
Eine Sekunde lang fällt mir keine passende Antwort ein.
Dann spüre ich jedoch, wie die seit zwölf Stunden angehäufte Anspannung und Erschöpfung nach einem Ventil suchen. Und diesem Drang gebe ich nur allzu gerne nach.
„Ich arbeite hier, du Kacker!“, schreie ich in die Gegensprechanlage. Um meiner Aussage mehr Nachdruck zu verleihen, drücke ich noch einmal auf den Klingelknopf, bzzz, bzzzz, bzzzzzzzzz. „Auf deine Beleidigungen hab’ ich momentan genau gar keinen Bock, und darauf, hier noch länger in der Gegend herumzustehen, auch nicht. Ich rate dir also, das Scheißtor aufzumachen, und zwar dalli, oder ich fackle die ganze Scheißhalbinsel mitsamt ihren Scheißschicki-Mickis ab, okay!“
Statik würde in der Leitung knistern, wenn die Gegensprechanlage nicht das allerneueste Modell wäre. Da sie das aber ist, höre ich nur fassungsloses Schweigen.
„Was soll der Scheiß?“, fragt die männliche Stimme dann erneut. Sie klingt jetzt nicht mehr verärgert, sondern verblüfft. „Wer zum Teufel bist du?“
„Meine Güte!“, seufze ich. „Ich heiße Trevor Raven und bin im Auftrag von Herrn Kinner hier, um in der Sommerbibliothek zu arbeiten.“
„Was?“
„Hör zu, ich bin gerade direkt mit dem Auto von Paris hier runtergefahren, ich bin verschwitzt und müde, also mach sofort auf, oder ich kann wirklich für nichts mehr garantieren!“ Am Ende wird meine Stimme wieder lauter.
„Äh…“
Ich lehne mich an die Mauer. „Bitte?“
„Gehört der… rosa Joghurtbecher, den ich da hinten stehen sehe, dir?“
Auf die Frage war ich nicht gefasst. „Wie bitte?“
Überraschend kichert der Mann. „Ach, was soll’s. Das könnte witzig werden.“
Ich verstehe nicht ganz, was hier witzig sein könnte, aber egal.
Das Tor beginnt zu summen, bevor es lautlos aufschwingt.
„Na siehst du, wo ein Wille ist“, sage ich trocken.
„Steh nicht da wie eine ausgestopfte Giraffe“, sagt der Mann. „Komm’ schon rein. Und vergiss’ dein dämliches Auto nicht. Ich hab’ nicht den ganzen Tag Zeit.“
Ich wirble herum und strecke meine Mittelfinger hoch. Gott sei Dank habe ich ja zwei davon – einen für jede Kamera.
Die Einfahrt ist eine Allee aus prachtvollen Bäumen und Büschen in voller Blüte
Die Einfahrt ist eine Allee aus prachtvollen Bäumen und Büschen in voller Blüte, alles angenehm kühl und schattig. Es duftet nach Rosen, Eukalyptus, reifen Feigen und Limetten. Hin und wieder erhasche ich einen Blick auf den üppigen, perfekt gemähten Rasen hinter der Vegetation. Es könnte sein, dass ich auch einen Tennisplatz und kleine Dependancen sehe, aber ich achte nicht wirklich darauf.
Schließlich erreiche ich den Vorplatz einer langgestreckten, einstöckigen Villa, die ganz aus schimmernden Fenstertüren besteht. Spiegelglas, wie’s aussieht. Das leicht geneigte graue Dach scheint auf dem riesigen, schimmernden Rechteck zu schweben.
Ich lasse das Auto unter einen knorrigen Olivenbaum ausrollen und bleibe neben einem nagelneuen Lamborghini stehen – übrigens das einzige andere Auto. Das Personal wird wahrscheinlich gebeten, woanders zu parken – soll heißen, außer Sichtweite –, aber das ist mir momentan egal. Ich stelle den Motor ab und steige aus dem Auto.
Nachdem ich den Kofferraum aufgezogen habe, stelle ich die beiden gepunkteten Kühltaschen auf den Kies.
Eine Glastür geht auf, und…
Ein scharfer Max tritt heraus. Ja, echt: ein scharfer Max. Kein anderes Wort könnte ihn besser beschreiben.
Warum er barfuß herumläuft, weiß ich nicht. Er hat jedoch schöne Füße – nicht, dass ich einen Fußfetisch habe, aber ich habe Augen. Seine weiße Leinenhose und das halboffene Hemd schmiegen sich an einen hoch gewachsenen, wohlproportionierten Körper. Ich kann muskulöse Beine, einen Waschbrettbauch und eine breite, unbehaarte Brust ausmachen.
Mein Mund wird trocken. Schluck.
Ich lasse meinen Blick nach oben gleiten und beäuge das gemeißelte Gesicht des Mannes mit seinen klaren, markanten asiatischen Zügen. Eine breite, aber gerade Nase, üppige Lippen, die wie zum Küssen geschaffen scheinen – wie komme ich, bitte, auf den Gedanken? –, leicht schräg gestellte Augen, V-förmige schwarze Augenbrauen, für die so manche Frau über Leichen gehen würde, und schwarzes, sehr kurz geschnittenes Haar.
Sogar seine Ohren sind sexy. Seine Ohren!
Und seine Haut sieht trotz der strengen Züge kühl, glatt und weich aus. Er hat, wie ich spontan vermute, so eine Haut, die nie von Pusteln oder Pickeln verunstaltet wurde, nicht einmal während der schwierigen Jugendjahre, wenn die Gesichter vieler Teenies wegen der ersten Hormonwallungen ziemlich trist aussehen.
Ich nehme an, der scharfe Max ist der berühmte Haushälter, den Fräulein Destrelle vorgestern erwähnt hat.
Ich muss sagen, mir gefällt, was ich sehe. Ziemlich. Sehr. Boah-ist-der-geil-mäßig
Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Grinsen, das er aufsetzt, während er mich eingehend mustert.
Der Typ deutet auf den Lamborghini, dann auf Sean. „Ich versuche gerade herauszufinden, was hier nicht wirklich ins Gesamtbild passt…“
„Ist gut jetzt!“, schnappe ich, erneut in die Defensive gedrängt. „Das Auto ist rosa – kriegst du dich irgendwann wieder ein?“
Der scharfe Max, der auch ein ziemlich unausstehlicher Max sein dürfte, lehnt sich an die Glastür. Er verschränkt seine muskulösen Arme vor der Brust und starrt mich immer noch grinsend an. „Du bist also Trevor Raven…“
RAY-ven.
Falsch. Ausgesprochen.
„Ra-VENN“, fauche ich. „Das ist ein französischer Name, okay?“
„Ist es im Bereich des Möglichen, dass ich da eine gewisse Aggressivität spüre?“
Ich hebe meine rechte Hand. „Mach dich nützlich, anstatt einfach nur dazustehen und … dir einen abzugrinsen.“
Seine schwarzen Augen funkeln. „Deine Attitüde hat was ausgesprochen galliges, Mann.“
„Beschwer dich bei meinen Eltern. Oder bei Herrn Kinner.“
Ich drehe mich um und ziehe die beiden Plastiktüten mit meinen Klamotten und Toilettenartikeln aus dem Kofferraum, bevor ich diesen mit einem lauten Knall zuwerfe. Dann fische ich mir meinen kleinen Rucksack vom Beifahrersitz.
Der unausstehliche Max hebt eine Augenbraue, ohne sich vom Fleck zu rühren. „Ähm… was, bitte, ist das denn?“ Er zeigt auf die Plastiktüten.
Ich befürchte, dass ich darauf rot anlaufe. Mit einem Schlag wird mir nämlich bewusst, wie unangebracht die Plastiktüten sind. Aber okay, mit einem neugierigen Empfangskomitee hatte ich nicht gerechnet. Geschweige denn mit so einem gutaussehenden.
„Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß“, sage ich und versuche, cool zu bleiben. „Zeig mir mein Zimmer. Und dann kannst du von mir aus gerne weiterarbeiten. Auch wenn dein Job nicht besonders anstrengend aussieht…“
Sein Grinsen verschwindet endlich; sein Gesicht wird zu einer Steinmaske. Mit stählerner Stimme sagt er: „Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast…?“
„Nein. Ist mir auch ziemlich egal.“ Ich hebe eine Kühltasche sowie eine der Plastiktüten auf. „Hör mal, ich bin wirklich kaputt. Also hilf mir bitte, die beiden Taschen in die Küche zu bringen, dann zeig mir meine Unterkunft, und ich verspreche dir, du wirst mich nicht mehr hören, nicht mehr sehen, du wirst nicht einmal merken, dass ich da bin.“
Er starrt mich an. Dann tänzelt er vorsichtig über den Kies, hebt die andere Kühltasche und die zweite Plastiktüte auf und bittet mich mit einer Kopfbewegung in die Villa.
Schweigend durchqueren wir ein riesiges Wohnzimmer, das das gesamte Erdgeschoss einzunehmen scheint. Ich bin jedoch zu müde, um mir das genauer anzuschauen. Mir fällt bloß auf, dass auf der anderen Seite eine Terrasse liegt.
Der unausstehliche Max öffnet rechts eine Tür, und dahinter erwartet uns… ein Aufzug.
Ich verkneife mir eine abfällige Bemerkung über Treppen und Beine, die wir eigentlich zum Gehen haben.
Der oberste Knopf – „GF“ für Ground Floor oder Erdgeschoss – benötigt keinerlei Erklärung. Die anderen Knöpfe sind etwas rätselhafter: „PD“, „VD“, „SD“ und „B“.
Der Haushälter drückt auf den zweiten Knopf, „PD“, und wir gleiten lautlos ein Stockwerk tiefer. Als die Aufzugstür unten wieder aufgewuscht ist, betreten wir eine riesige, makellos saubere Küche mit glänzenden Metalloberflächen. Durch eine weitere Reihe Fenstertüren entdecke ich ein großes Sonnendeck mit einem langen Tisch und mindestens einem Dutzend Stühlen. Dahinter glitzert türkis ein gigantischer Swimmingpool, umgeben von noch mehr Sonnendecks und den beiden Seitenflügeln des Hauses, die so aussehen, als ob sie direkt in den Felsen gehauen wurden. Okay; „PD“ bedeutet wahrscheinlich Pool Deck.
Wir stellen die Kühltaschen auf die zentrale Küchentheke, und mit einer weiteren Kopfbewegung lädt mich der unausstehliche Max ein, ihm zu folgen.
„In den Taschen sind Sachen, die so schnell wie möglich in den Kühlschrank müssen“, sage ich. Aber er ist schon durch eine Tür rechts verschwunden.
Ich folge dem diskreten Klatsch, Klatsch, Klatsch, das seine nackten Füße auf dem Fußboden machen, und betrete einen fensterlosen Gang mit rauen Steinwänden.
Nach ein paar Metern biegt der Korridor nach links ab. Auf der linken Seite befinden sich mehrere geschlossene Türen. Der Gang endet in einer Fensterflucht, die aufs weit unten glitzernde Meer hinausgeht; das hereinfallende Tageslicht färbt Wände, Türen und Fußboden in goldene Spätnachmittagsfarben ein.
Am Ende des Korridors stoße ich auf eine offene Tür.
Vorsichtig luge ich ins Zimmer hinein.
Es sieht geräumig aus, in zwei verschiedenen Blautönen gehalten, mit einem Kingsize-Bett. Direkt gegenüber der Zimmertür führen zwei Fenstertüren auf den Poolbereich hinaus. Zu meiner Rechten bietet eine weitere Fensterflucht einen herrlichen Ausblick aufs Mittelmeer. Davor stehen zwei weiße Plüschsofas und ein kleiner Tisch. Links von mir ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Fernseher in der Ecke und zwei Türen.
Der Raum ist… leer. Eine der Fenstertüren steht jedoch offen. Und die Plastiktüte, die der Haushälter gnädiger Weise mitgebracht hat, liegt auf dem Bett. Wo der unausstehliche Max sie wahrscheinlich hingeworfen hat, bevor er wieder verduftet ist.
Aha. Anscheinend hat ihn mein Charme bereits unwiderstehlich angezogen.
Was auch immer. Das hier, nehme ich an, ist mein Zimmer. Mehr muss ich momentan nicht wissen.
Ich stelle meine Tüte ab und setze mich aufs Bett.
Mein Gott, ich bin fix und fertig.
Ich starre durch die offene Fenstertür. Und stelle fest, dass der unausstehliche Max mir nicht einmal gesagt hat, wie er heißt.
Auch das muss ich momentan nicht wissen. Aber nach einer kalten Dusche und einer Verschnaufpause hoffe ich, wieder ich selbst zu sein: nett und brav und höflich.
Falls ich dann den Haushälter mal anreden muss, wäre es nicht ganz unnütz, seinen Namen zu kennen, oder?
Lebensweisheit Nr. 2
Reg dich nicht auf und sei nicht nachtragend. (Im Zweifelsfall darfst du jedoch beides tun.)
Ich gehöre nicht zu den Leuten
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die tagein, tagaus immer nur murren und knurren und motzen und ätzen. Okay, ich weiß, alles weist momentan aufs Gegenteil hin. Aber normalerweise bin ich ein rechtschaffener Mensch, der weiß, wie man sich korrekt ausdrückt. Wenn ich nicht gerade in einem lärmenden, aufgeheizten Auto quer durch ganz Frankreich gefahren bin, um bei meiner Ankunft die sarkastischen Bemerkungen eines arroganten (wenn auch zugegebener Maßen furchtbar gutaussehenden) Arschlochs über mich ergehen zu lassen.
Ich möchte das unterstreichen: Ich bin ein höflicher Kerl. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, meine Eltern hätten mich zu einem ungestümen Menschen erzogen, der alles und jeden beschimpft. Nein, ich habe gelernt, „Bitte“ und „Danke“ zu sagen und anderen gegenüber nett und rücksichtsvoll zu sein.
Papa ist eher der „Laissez-faire“-Typ, stimmt. Aber Mama hat uns die Grundprinzipien guten Benehmens so lange eingetrichtert, bis ein bisschen was davon hängen blieb.
Was ich damit sagen will: Ich habe gelernt, wie man Dinge ordnungsgemäß ausführt. Auch hier dürfte euch der erste Eindruck in die Irre geführt haben – ich sage nur „Plastiktüten“. Den Grund dafür kennt ihr ja – Barbie-Koffer und Mamas eigentümlicher Geschmack und so.
Normalerweise neige ich also dazu, normal zu agieren. Glaube ich jedenfalls. Deshalb verstaue ich, nachdem ich meine Turnschuhe und Socken ausgezogen habe, zuerst mal meine Siebensachen. Ich nehme den Laptop aus dem Rucksack und stelle ihn auf den Schreibtisch. Ich lege den Rucksack selbst auf eines der Sofas. Dann leere ich meine Plastiktüten auf dem Bett aus.
Suchend schaue ich mich dann um. Gibt’s hier einen Kleiderschrank? Vielleicht versteckt er sich ja hinter einer der beiden Türen links?
Ich öffne die erste Tür.
Nö. Badezimmer. Luxuriös und mindestens doppelt so groß wie meine Wohnung in Paris. Tageslicht fällt durch ein großes Milchglasfenster herein. Links hinter einer Trennwand die Toilette. Rechts ein Bidet – benutzt das heute noch jemand? – plus eine übergroße Badewanne und eine begehbare Dusche, in der man so manche Orgien veranstalten könnte.
Nicht, dass ich vorhabe, Orgien zu schmeißen. Aber hey, besser, man weiß im Vorhinein über etwaige Möglichkeiten Bescheid.
Ich hole meine Toilettenartikel und stelle sie in die weiß geflieste Nische über dem Waschbecken. Mein Zeug liegt dort ein bisschen verloren herum, aber mehr habe ich leider nicht.
Dann lasse ich das Badezimmer Badezimmer sein und öffne die zweite Tür.
Japs.
Ich stehe nicht vor einem einfachen Kleiderschrank, sondern einem begehbaren Kleiderschrank! Auch er ist um vieles größer als meine Wohnung.
Wie benommen trage ich meine wenigen, billigen Klamotten rein und lege sie in ein Regal. Sie sehen wie traurige Waisenkinder aus.
Langsam ziehe ich mein durchnässtes T-Shirt und meine Jeans aus und stecke sie zusammen mit meinen Socken in den Rattankorb, der in einer Ecke steht. Ich schlüpfe in meine blaue Turnhose. Frisches T-Shirt brauche ich keines; die Temperaturen liegen immer noch weit über dreißig Grad.
Als ich auf der Suche nach meinen Flipflops ins Zimmer zurücktapse, höre ich draußen eine Stimme.
Auf Zehenspitzen schleiche ich zur Fenstertür, die immer noch weit offensteht.
Oh. Der Haushälter, mein unausstehlicher Max. Mit dem Rücken zu mir sitzt er auf einem Rattan-Liegestuhl auf der anderen Seite des Swimmingpools. Und telefoniert. Das heißt, eigentlich schimpft er auf Englisch in sein Handy, und zwar mit diesem Akzent, den ich immer noch nicht zuordnen kann. Zeitweise klingt er amerikanisch, dann wieder so versnobt, dass es sich fast wie das Englisch der Royals anhört.
Ich habe eigentlich nicht vor, sein Gespräch zu belauschen, aber er redet furchtbar laut – was kann ich also tun? Mir die Ohren zuhalten?
Bitte. Bleiben wir ernst.
„… sind Sie völlig übergeschnappt, Bérénice?“, höre ich. Dann: „Nein, das ist mir piepegal… – Bestätigen Sie mir wenigstens, dass Sie sein Vorleben sorgfältig abgecheckt haben… – Wollen Sie mich verarschen? … – Das ist mir egal, Bérénice, hören Sie? Scheißegal! Warum hatten Sie’s überhaupt so eilig… – Nein, Sie hören jetzt mir zu! Woher soll ich wissen, dass Sie mir keinen Irren oder Serienmörder hierhergeschickt haben? Er sah ganz danach aus… – Oh, großartig, jetzt vertrauen wir Ihren Gefühlen! Bérénice, darf ich Ihnen einen Knüller anvertrauen: Sie haben keine Gefühle! – Okay, wir machen das jetzt so. Sie werden dafür bezahlt, dass Sie Ihren Job erledigen, also erledigen Sie ihn auch. Ich will, dass Sie… – Nein, das kann nicht warten. Ich möchte Ihren Bericht so schnell wie möglich. So ungefähr vorgestern, ist das klar?“
Er klickt auf „Gespräch beenden“ und wirft sein Handy auf einen kleinen Rattantisch. Was eine ganz schlechte Idee ist. Denn auf dem Tisch liegt ein Kissen. Das Telefon prallt also vom Kissen ab, fliegt in einem großen Bogen weiter, dreht sich auch ganz hübsch ein paar mal um sich selbst, wie in einer Slapstick-Komödie, bevor es… Platsch! … im Swimmingpool landet.
Ich kann nicht anders, ich kichere verhalten in mich hinein.
Der Haushälter fährt von seinem Liegestuhl hoch, wirbelt herum und sieht gerade noch, wie sein Handy im türkisfarbenen Wasser untergeht, Blub, Blub, Blub.
Ich kann ihn ausdrucksvoll fluchen hören: „Oh fuck, fuck, FUCK!“
Dann schaut er auf…
… und ertappt mich dabei, wie ich in meiner Fenstertür stehe und ihn anglotze.
Betreten glotzt er zurück. Offensichtlich dämmert ihm, dass ich jedes einzelne Wort mitangehört habe.
Dann verfinstert sich seine Miene. Ich kann seinem Gesicht direkt seine Gedanken ablesen: Der Typ ist nicht nur ein irrer Serienmörder, sondern spioniert mir auch noch hinterher.
Ich starre finster zurück. Eine innere Stimme raunt mir zu, dass ich am besten die Klappe halte. Aber bevor ich darüber nachdenken kann, habe ich schon meinen trockenen Kommentar abgegeben: „Ein IPhone ins Schwimmbecken tunken – spannende Initiative. Sauber ist es jetzt sicher, aber ob’s besser funktioniert? Das wage ich zu bezweifeln.“
Er funkelt mich noch finsterer an.
Mittlerweile ist mir das jedoch echt pups.
Ein Irrer. Ein Serienmörder.
Für wen hält sich dieser arrogante Arsch eigentlich?
Ich glaube, ich muss jetzt mal eiskalt duschen. So ungefähr sofort.
Sonst könnte es passieren, dass ich anfange, ihn anzubrüllen.
Und seien wir ehrlich – das würde zweifellos seinen ersten Eindruck verstärken. Nämlich dass ich ein gemeingefährlicher Spinner bin.
Zum Thema Schimpfwörter
Zum Thema Schimpfwörter. Ja, ich benutze sie regelmäßig. Ja, anscheinend fällt es mir schwer, sie durch harmlosere Ausdrücke zu ersetzen. Und nein, ich leide nicht am Tourette-Syndrom, falls ihr gerade an so was gedacht haben solltet.
Zu meiner Verteidigung, ich bin halb Franzose. Wir Franzosen fluchen nun mal gern. „Merde“ und „Putain“ und „Fait chier“ fühlen sich nicht einmal mehr wie Schimpfwörter an. Sie gehören zu unserem Alltagsvokabular, fast schon wie „Salut“ oder „Baguette“ oder „Allons enfants…“ Natürlich singen wir die Nationalhymne nicht andauernd – so chauvinistisch sind wir auch wieder nicht –, aber ihr versteht schon, was ich meine.
Eine launische Anekdote: als ich zehn war und Judy sechs, hat Mama eines Tages ein ernstes Gespräch mit uns geführt. Sie wollte mit uns darüber reden, wie man Schimpfwörter angemessen verwendet. Na ja, es ging nicht unbedingt darum, sie zu verwenden; Mama wollte nur, dass wir sie kennen, damit wir wissen, was sie bedeuten, falls sie uns mal jemand an den Kopf wirft.
Die Grundidee war also, dass sie sie auflistet und erklärt. Sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. Diesen zweiten Teil schien sie in vollen Zügen zu genießen. Erstens, weil einem Schimpfwörter in einer Fremdsprache immer weniger schockierend vorkommen, selbst wenn man schon Jahre in dem Land verbracht hat, in dem diese Sprache gesprochen wird. Und zweitens, weil sie auf Französisch besonders hübsch und fantasievoll daherkommen.
Ihr werdet jetzt einwenden, dass eine umfangreiche Liste von Schimpfwörtern nicht unbedingt was ist, das man einem Zehn- und einer Sechsjährigen anvertrauen sollte. Ihr habt vollkommen recht. Denn natürlich kam, was kommen musste. Wir haben uns bedankt. Und wollten Mama beweisen, dass wir aufmerksam zugehört hatten, so dass wir danach jedes Gespräch mit Schimpfwörtern ausschmückten.
„Reich mir doch bitte mal die Scheißbutter, du Arschloch.“
Die höfliche Note fällt euch hoffentlich auf.
„Da hast du sie, du Mistkerl.”
„Vielen Dank, Dünnscheißer.”
Es wird euch nicht überraschen, dass Mama drei Tage später noch mal mit uns reden wollte. Um uns über den sparsamen Gebrauch von Schimpfwörtern aufzuklären. Weniger ist besser, sagte sie.
Wie auch immer. Zurück zu meiner Haushälter-mit-iPhone-im-Pool-Situation.
Er starrt mich an, ich starre zurück, wir starren uns also gegenseitig an.
Dann stampfe ich in mein Zimmer, und was murmle ich in meinen Bart? Ja, genau: Schimpfwörter. Handverlesene, weil hallo? Verrückt? Serienmörder?
Nach einer kalten, zehnminütigen Dusche besprühe ich mich mit wohlriechendem Parfüm und schmiere mir Deodorant unter die Achseln. Danach fühle ich mich ein wenig besser. Auf Unterwäsche oder T-Shirt verzichte ich und ziehe nur wieder die blaue Turnhose an.
Dann lasse ich mich auf mein Bett fallen und zücke mein Handy – welches einwandfrei funktioniert, Ätsch; besser als das Handy einer anderen Person, die ich nicht namentlich nennen will. Ich mache ein Selfie mit der Fensterflucht und der herrlichen Aussicht im Hintergrund. Mit einem kurzen Text versehen schicke ich es per WhatsApp an die Familiengruppe. Aus Gründen, die ich hier nicht erläutern kann, weil das zu lange dauern würde, gehören nicht nur Mama, Papa und Judy zu dieser Gruppe, sondern auch Dirk.
Der ist jetzt hoffentlich vor Neid giftgrün angelaufen.
Wenn ich’s mir recht überlege… hoffentlich schickt er nicht schon wieder ein Schwanzfoto an die ganze Gruppe zurück. Das hat er schon öfters getan. Seht ihr, er schildert mir seine Eroberungen nicht nur in aller Ausführlichkeit; manchmal zeigt er sie mir sogar – das heißt, bestimmte Körperteile. Wenn diese Körperteile per Foto mit der Familiengruppe geteilt werden, kommen wir alle in den visuellen Genuss von Dirks letztem Fick.