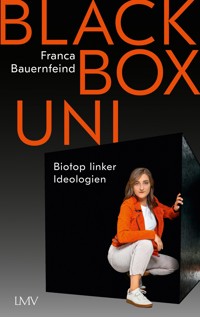
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf dem Campus wurde Franca Bauernfeind als "Nazi-Schlampe" beschimpft und ihre Wahlplakate wurden beschmiert. Aber trotz oder gerade aufgrund ihrer liberal-konservativen Positionen gewann sie die Wahl zum Studierendenrat der Universität Erfurt. Anhand von ihren Erfahrungen gibt sie einen tiefen Einblick in die (gesellschafts-)politischen Mechanismen des Hochschulbetriebs: Wer sich an der Universität nicht im linken und oftmals linksextremen Meinungskorridor bewegt, wird diffamiert und ausgegrenzt. Während früher linke und linksextreme Ideen tendenziell nicht den Campus verließen, prägen sie heute zunehmend die Gesellschaft, denn aus den Studenten von heute werden die Lehrer, Politiker, Journalisten und Vorgesetzte von morgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Franca Bauernfeind
black Box Uni
Biotop linker Ideologien
Für meine liebe Mutter Martina
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.“
© 2024 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Sabine Schröder
Umschlagfotos: Daniel Beck
Innengestaltung: Sibylle Schug
Satz: Langen Müller Verlag, Ralf Paucke
E Book Konvervierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-7844-8481-5
www.langenmueller.de
Inhalt
Einleitung: Das moralisierende Damoklesschwert
1 – Erste Schritte auf dem Campus
2 – Sind Studenten wirklich links?
3 – Ein Blick ins Innere der Black Box
4 – Kämpfe und Schlachten in der Hochschulpolitik
5 – Mitten in der Politik
6 – »Das muss an die Öffentlichkeit!« – Die Fallsammlung
7 – Die Frau des 21. Jahrhunderts
8 – Der Fall Kemmerich(s)
Nachwort: Zuhause
Das moralisierende Damoklesschwert
»Halt die Fresse, Franca!« – Eine ehemals gute Freundin und Kommilitonin schrieb mir diese Nachricht auf Instagram. Grund dafür war meine Haltung zur Frauenquote in Parteivorständen. Ich bin dagegen. Ihr passte mein Standpunkt anscheinend nicht. Sie meinte, ich würde den Akteuren, die für Gleichstellung kämpfen, in den Rücken fallen.
»Nazischlampe« – Das tönte mir an anderer Stelle entgegen. Auf dem Campus hatte ich gerade meinen Infostand für die Hochschulwahlen aufgebaut, und jemand aus der vorbeilaufenden Menge hatte etwas gegen meine politische Einstellung. Jemand, der offenbar nicht in der Lage ist, mit einer Christdemokratin zu sprechen bzw. differenziert zu denken. Kurzum: jemand, der die inhaltliche Auseinandersetzung verweigert und scheut.
»Wie ist es eigentlich möglich, so dermaßen zu bullshitten?« – Auf einen Social-Media-Beitrag, in dem ich mich gegen einen Genderzwang in Prüfungsleistungen an Hochschulen aussprach, sah sich eine Kommilitonin veranlasst, mir – sagen wir einmal, in der Wortwahl eher simpel – solcherart zu widersprechen. Die junge Frau kennt mich seit mehr als fünf Jahren, vermied es aber bislang, persönlich auf mich zuzugehen. Es scheint für sie aber dennoch im Rahmen des Machbaren, einen ausführlichen Facebook-Kommentar zu formulieren. Wie es möglich wäre, einen so wissenschaftsfernen und inhaltlich falschen Beitrag zu präsentieren. Sie kenne sehr viele Sprachwissenschaftler*innen, die mir Gegenteiliges erzählen würden, brachte sie in die »Debatte« auf meinem Facebook-Profil ein. Nun, wenn man natürlich nur Personen anführt, deren Thesen einem selbst genehm sind, kann man sich auf vollkommen sinnbefreite Assoziationsstudien berufen. Dass ich außerdem keinen wissenschaftlichen Beitrag lieferte, sondern meine politische Meinung äußerte, war ihr offensichtlich entgangen.
»Sie sollten solche Aussagen besser nicht treffen. Das grenzt an Verschwörung.« – Auf dem Höhepunkt der Coronapandemie, der Zeit der Verschwörungstheoretiker, saßen wir Studenten in unseren kleinen Wohnheimzimmern und lauschten den Online-Veranstaltungen. Das Seminar, welches ich zu dieser Zeit besuchte, beinhaltete die empirische Analyse der Wahlergebnisse der US-Wahlen 2020. So geschah es, dass wir just in der Woche des Sturms auf das US-Kapitol zu Beginn des Seminars über dieses Ereignis diskutierten. Ein Kommilitone äußerte laut denkend, es sei etwas merkwürdig, dass ein hoch gesichertes Staatsgebäude derart leicht erobert werden könne. Er hielt es für vorstellbar, dass einige Personen des Sicherheitspersonals eingeweiht gewesen sein mussten, anders sei der Sturm auf das Kapitol für ihn nicht erklärbar. Allein aufgrund dieser Aussage wurde mein Kommilitone vom Professor (!) in eine Ecke mit Verschwörungstheoretikern gestellt. Wegen eines spekulativen, aber nachvollziehbaren Gedankengangs. Das war wenige Tage nach dem 6. Januar 2021.
»Diese Sätze könnten wir nie vor den anderen Studenten sagen.« – Mit diesen Worten lachten wir einander zu. Ein Kommilitone und ich (er ist politisch links eingestellt) saßen in meiner Wohnheimküche und aßen Kartoffeln mit Butter und Salz. Ein schnelles, günstiges und leckeres Studentengericht und – neben Nudeln mit Pesto – bis heute mein Lieblingsessen. Wir redeten offen, diskutierten die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung unter Angela Merkel und sprachen auch über gesellschaftliche Folgen. Eines kam zum anderen, und wir landeten bei der Klimakrise. An der Atomkraft als recht klimafreundliche Energiegewinnung sollte festgehalten werden, waren wir uns einig. Wir rissen viele Themen an, hatten unterschiedliche Ansichten und Meinungen, überzeugten den jeweils anderen mit Argumenten oder scheiterten damit. Aber wir debattierten. Und das ohne moralisierendes Damoklesschwert über uns. Dabei ertappten wir uns gegenseitig bei Aussagen, die vollkommen legitim sind, jedoch auf dem Campus unerwünscht. Hier öffentlich für Kernkraftwerke zu plädieren, würde einem den Ruf einbringen, »rechts« zu sein. Wir machten aus dem Anreißen von angeblichen »No-Go-Themen« ein Spiel – das war zwar unterhaltsam, aber im Grunde alles andere als witzig. Denn wir beide litten darunter, in Gesprächen mit Kommilitonen gegen den ständigen Impuls zur Selbstzensur ankämpfen zu müssen.
Egal, welche politische Einstellung man hat: Atomkraft und Klimaschutz in einem Satz zu nennen, hat sich zu einem Kamikazeunternehmen in Bezug auf sachliche Argumente entwickelt. Ebenso die ganze Flüchtlingsproblematik. Dass einem Flüchtling nur bedingt damit geholfen ist, wenn er zwar Asyl bekommt, die Bedingungen für Integration aber nicht funktionieren, müsste man doch ansprechen und diskutieren können. Auch dass Segregation entsteht und es wenig mit humanitärer Verantwortung zu tun hat, wenn Menschen jahrelang in Containern ohne Ausbildungsperspektiven leben, liegt auf der Hand.
Bis zu diesem Diskussionspunkt dringt man am Campus jedoch gar nicht erst vor. Denn schon der Begriff »Flüchtling« bereitet Probleme. Wenn man dann auch noch auf sachlicher Grundlage und faktenbasiert unkontrollierte Massenmigration infrage stellt, um damit den Diskurs zu öffnen, bekommt man den Rücken der anderen zugewandt. Denn die Political Correctness hat auf dem Campus längst Einzug gehalten und ist dabei, sich auszubreiten. Sie durchdringt die Seminare, meinungsbildende Instanzen wie Medienhäuser und Parteien und hat auch schon die Schulen erreicht.
Wie konnte es so weit kommen? Wieso werden Menschen beschimpft, verunglimpft, ausgeschlossen und als moralisch schlecht herabgewürdigt, deren Meinungen vom breiten Mainstream abweichen? Wie kann es sein, dass ausgerechnet der Ort des freien Denkens – die Universität – erkennbar zu einer Quelle dieses Trends mutiert ist?
***
Ich bin Studentin der Staatswissenschaften an der Universität Erfurt. Ich liebe den Sommer auf dem Campus und die Gespräche mit meinen Kommilitonen bei kalten Getränken im Campuscafé. Die große Wiese in der Mitte, auf der jedes Jahr das Campus-Festival stattfindet. Ringsherum Bäume und Lehrgebäude. An richtig warmen Tagen aber ist der einzige Ort, an dem man sich aufhalten kann, die kühle Bibliothek. Heiß war auch der Sommer 2023. In dieser Zeit entstand mein Buch – zu großen Teilen in der Universitätsbibliothek Erfurt.
Ich möchte einen Einblick geben in meinen Alltag an der Universität, in Themen, die diskutiert oder gerade nicht diskutiert werden, und in universitäre Strukturen; ich möchte zu Problemen des Hochschulbetriebes und den schwierigen Facetten des Campus-Umfelds Stellung beziehen. Dass ich dieses Buch schreibe, habe ich Menschen zu verdanken, die mich unterstützen. Aber auch meiner Arbeit als Studentenpolitikerin in Berlin. Vielleicht auch ein Stück weit meinem Selbstbewusstsein, selbst bei »Gegenwind« Probleme anzusprechen und unpopuläre Positionen zu beziehen: wenngleich damit nicht die Sicherheit des gefälligen Beifalls verbunden ist und es aussichtlos erscheint, dadurch in einer Debatte im studentischen Umfeld zu punkten.
»Black Box Uni«: Ein Ort, für den sich die breite Öffentlichkeit nicht wirklich interessiert. Der aber mehr ist als nur eine Bildungseinrichtung. Hochschulen sind Räume, in denen sich wie in keinen anderen die Zukunft abspielt. Hier werden die Lehrer, Journalisten, Führungskräfte, Mediziner, Juristen und auch Politiker von morgen ausgebildet. Hier knüpfen sich Seilschaften und Netzwerke, die manchmal für ein ganzes Leben halten. Hier entstehen Innovation und Technologie, werden geistige Errungenschaften zu Papier gebracht. Hier spielt buchstäblich Zukunftsmusik. An der Universität können aber auch Bewegungen und Kulturen entstehen, die später großen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Der Blick in die Geschichte beweist das:
Es waren Studenten aus elf Universitäten, die 1817 mit dem Wartburgfest der Idee eines geeinten deutschen Staates, Forderungen nach einer liberalen Verfassung, Freiheitsrechten des Einzelnen und Mitwirkung des Volkes am politischen Geschehen Ausdruck verliehen. Die später vom Paulskirchenparlament in Frankfurt erarbeitete Verfassung mit ihrem eindrucksvollen Grundrechtskatalog fußte auf diesen Forderungen. Wenngleich sie nie in Kraft trat, waren parlamentarische Debattenkultur, der Ruf der Frauen nach Emanzipation und vieles mehr in der Welt; was 1848 erdacht wurde, ließ sich nicht mehr aus den Köpfen der Menschen löschen. In einem starken Bekenntnis zu diesen Werten bezieht sich unsere Bundesflagge in Schwarz – Rot – Gold auf diese Farben der studentischen Einheitsbewegung.
»Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren« skandierten später die 1968er ausgehend von Universitäten und Hochschulen und gingen gegen überkommene Autoritäten und Strukturen in den Clinch. Ihr Protest löste politisch wie gesellschaftlich Prozesse aus, die sowohl dauerhafte Veränderungen brachten als auch bekanntermaßen bis heute nachwirken.
»Black Box Uni«: Der innere Aufbau und die innere Funktionsweise der Universitäten sind für die meisten Menschen weitgehend unbekannt oder werden im gesellschaftlichen Gesamtkontext als irrelevant erachtet. Die Metapher von der »Black Box« bringt zum Ausdruck, dass der Alltag, die Themen und Veränderungen an Universitäten von der Öffentlichkeit unerkannt bleiben. Gesellschaftliches Desinteresse oder vermeintlich elitäres Nischendasein könnten Gründe dafür sein.
Damit möchte ich mich kritisch auseinandersetzen. Was auf dem Campus passiert, ist Teil unserer Gesellschaft und von enormer Bedeutung für die Zukunft. Wir erleben in Deutschland einen Umbruch der Debattenkultur, einen moralisierenden Zeitgeist und die Entstehung politisch korrekter Meinungsvorgaben. Kurz: den Aufbau eines Mainstreams, der alles erfasst. Dies ist mitnichten nur ein Frame, den sich die AfD ausgedacht hat oder gar Sahra Wagenknecht. Weder der ehemalige SPD-Kulturreferent der Stadt München, Julian Nida-Rümelin, noch FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sind in ihren Reihen Einzelkämpfer gegen die grassierende Cancel Culture. Dieser Zeitgeist existiert auch nicht erst, seitdem ein Audi-Mitarbeiter vor zwei Jahren gegen seinen Arbeitgeber klagte, weil er nicht gendern möchte.
Nein, als Startrampe dieser neuen moralisierenden Diskussionskultur fungierten der Campus und sein Umfeld. Vor rund zehn Jahren, noch bevor ich selbst dort hingelangt war. In diesem Buch beschreibe ich meine persönlichen Erfahrungen, greife Debatten aus vielen Gesprächen auf, erzähle von meiner Arbeit als Studentenpolitikerin, von den Meinungen einer liberal-konservativen jungen Christdemokratin und der Berliner Politikblase – ohne Garantie auf Vollständigkeit. Die Bestandsaufnahme beginnt im Jahr 2016.
1 – Erste Schritte auf dem Campus
Als ich mit 18 Jahren auf dem Campus der Universität Erfurt stand, konnte ich mein Glück kaum fassen. Endlich anfangen zu studieren, grenzenlos Vorlesungen und Seminare besuchen und sich »finden«, wie der persönliche Reifeprozess gerne auch salopp umschrieben wird. Die Stadt kennenlernen, mit neuen Freunden die Kneipenszene auskundschaften, neues Wissen erwerben und sich weiterbilden.
Und endlich aus dem Elternhaus ausziehen! Ich verstehe mich zwar sehr gut mit meiner Familie, aber wie viele Gleichaltrige wollte ich einfach raus, weg von zu Hause und so richtig auf eigenen Beinen stehen. Die Freiheiten des Lebens spüren und austesten.
Meine Eltern hatten immer von ihrer Studentenzeit geschwärmt. In den letzten Jahrzehnten hat sich aber einiges geändert. Während man im Magisterstudium gefühlt »ewig« studieren und fachfremde Vorlesungen besuchen konnte, ohne den eigenen Stundenplan völlig umwerfen zu müssen, herrschen seit »Bologna« straffe Zeitvorgaben. »Bologna-Prozess«, damit meint man die 1999 gestartete Europäische Studienreform, die die Studienstrukturen europaweit vergleichbarer machen soll. Bachelor- und Masterabschlüsse wurden flächendeckend eingeführt, für Studiengänge herrschen gemeinsame Standards, Benotungen und Richtlinien, um ein möglichst homogenes und somit europaweit durchlässiges Studiensystem zu erreichen.
Die Kehrseite ist ein fast schon verschultes Studium mit vor allem einer Prämisse: schnell fertig werden. Als ich in meinem Bachelorstudium am Ende des letzten Regelstudiensemesters ankam, fischte ich aus dem Briefkasten ein Schreiben meiner Universität. Der Betreff lautete: »Nichterfüllung der Studienauflagen zum Ende der Qualifizierungsphase.« Weiter unten stand der Satz: »Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie die Bachelorprüfung in einem Bereich nicht bestanden haben« – damit war gemeint, dass ich bis zum Ende der Regelstudienzeit noch nicht alle meine Leistungspunkte für mein Nebenfach erfüllt hatte. Das war mir bewusst – genau wie die Tatsache, dass ich die Regelstudienzeit durchaus überschreiten darf. Ich solle im Dezernat vorsprechen und könne gegen diesen Bescheid Einspruch erheben.
Ich war verwirrt und besorgt zugleich, hatte ich etwas in der Prüfungsordnung übersehen? Ich fragte erst einmal bei einer Kollegin aus der Hochschulpolitik nach: »Das ist nur eine Formalie, den Brief erhält jeder. Mach dir keinen Kopf, Franca«, antwortete sie mir. Trotzdem, es war ein Schockmoment. Der Brief sollte Druck ausüben.
Es hat sich also einiges geändert, was die zelebrierten Freiheiten des Studiums betrifft. Meinen Entschluss zu studieren tangierte dieser Umstand aber in keiner Weise. Schließlich wollte ich auf zu neuen Ufern und etwas erleben. Ich komme aus Nürnberg, wo ich 2016 mein Abitur ablegte. Schon länger stand im Raum, Staatswissenschaften zu studieren. Das ist mittlerweile ein ziemlich einzigartiger Studiengang in Deutschland. Er kombiniert mehrere Disziplinen mit Bezug auf die Themen Gesellschaft, Demokratie und eben den »Staat«, Jura und Wirtschaft, Soziologie und Politik.
An meiner alten Schule mussten wir im Rahmen des »Berufs- und Studienbasars« drei Vorträge zu Studiengängen oder Ausbildungsberufen besuchen. Etwas, das pubertierende Schüler überhaupt nicht gern machen. Da mich Politik aber seit Jahren interessierte, tat ich mir die (wie sich herausstellte, durchaus interessante) Vorstellung des Studiengangs Staatswissenschaften der Universität Passau an. Nachdem ich den Teilnahme-Stempel für meinen Schulzettel abgeholt hatte, suchte ich zu Hause mit unserem – gerade neu an das Internet angeschlossenen – Computer nach Universitäten. Leider war die Suche nicht ganz so ergiebig, wie ich sie mir vorgestellt hatte, denn neben Passau hatte lediglich Erfurt den Studiengang im Portfolio.
Liberale Erziehung
Meine Schwester und ich wurden liberal erzogen. Natürlich mit festen Regeln im Handeln, im Denken aber grenzenlos. Mit fünfzehn fing ich an, mich für Politik zu interessieren. Ich löcherte meine Eltern mit Fragen und wollte wissen, wie Politik funktioniert. Was ist eine Partei? Was ist die Finanzkrise? Wer ist dafür verantwortlich? Wieso spricht die Nachrichtenmoderatorin von der Griechenlandrettung? Wie soll man denn überhaupt einen Staat retten können? Staaten können bankrottgehen?!
Zu vielen Themen hatten auch meine Eltern unterschiedliche Meinungen. Beide würde ich der Gruppe der Wechselwähler zuordnen. Jedenfalls entstanden seit dieser Zeit immer rege Diskussionen am Esstisch, jede Meinung war willkommen, keine wurde missbilligt, geschweige denn verurteilt!
Später war auch meine drei Jahre jüngere Schwester alt genug, um bei unseren Diskussionen mitzureden. Teilweise flogen die Fetzen, daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Es prallen manchmal Überzeugungen aufeinander, die schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Das müssen sie auch nicht, denn in der politischen Auseinandersetzung darüber, wie die vielfältigen Problemstellungen auf unserem Planeten gelöst werden können, geht es nach meiner Überzeugung nie um einen Konsens. Das würde auch gar nicht funktionieren, wie man allein schon an meiner vierköpfigen Familie sieht. Politik ist niemals ein Konsens, sondern immer ein Kompromiss.
Noch zu Schulzeiten trat ich dann auch einer politischen Jugendorganisation bei. Zu Beginn meines Studiums war ich bereits Mitglied der Jungen Union (JU), der Jugendorganisation der beiden Schwesterparteien Christlich Demokratische Union (CDU) und Christlich Soziale Union (CSU). In Bayern ist eine Mitgliedschaft keine große Sache, eher erwartbar. Mit 16 Jahren bin ich aus einem einfachen Grund eingetreten: Meine Mutter war genervt von meinen Fragen. Sie sagte, ich solle mich doch direkt informieren, in welchen Strukturen und Logiken eine Partei agiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir niemanden (mehr) in unserer Familie, der sich mit Parteien und deren Jugendorganisationen auskannte bzw. sich aktiv in einer Partei engagierte.
Lediglich mein schon lange vor meiner Geburt verstorbener Urgroßvater war bis zu ihrem Parteiverbot Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Der oberfränkische Korbmacher aus höchst bescheidenen Verhältnissen trat in ihrem Gründungsjahr nach dem Ersten Weltkrieg ein. Zufällig fiel uns sein Mitgliedsausweis samt dem Parteibuch vor ein paar Jahren in die Hände. Meine Mutter und ich mussten schmunzeln, denn kurz bevor wir den KPD-Ausweis in einer Schublade im Haus meines Großvaters fanden, war ich über ein paar Ecken und eher zufällig bei der JU in Nürnberg gelandet.
Der Vorsitzende des dortigen JU-Kreisverbandes war sehr aufgeschlossen. Er hatte mir trotz meiner Jugend damals eine Chance gegeben, mitzuarbeiten. Ehrlich gesagt habe ich in dieser Zeit die Organisationsstruktur des Parteigefüges nie gänzlich durchdrungen. »Vorstand«, das klang für mich damals nach DAX-Konzern, aber nicht nach Parteijugendorganisation. Gleichwohl wurde ich freundlich aufgenommen und eingebunden. Schließlich gehörte ich selbst dem Kreisvorstand der JU Nürnberg-Süd an. Zwei Jahre lang war ich dann Mitglied in Bayern.
Umzug in ein neues Leben
Für mich war klar – und andere Franken werden mich in dieser Haltung womöglich unterstützen: Als Fränkin geht man nicht nach Niederbayern! So entschied ich mich gegen Passau als Studienort und zog in die thüringische Landeshauptstadt, um dort Staatswissenschaften zu studieren.
Der Freistaat Thüringen ist noch jung. Die Wiedervereinigung war 2016 nicht einmal drei Jahrzehnte her. Mir wurde erst später so richtig klar, dass dreißig Jahre eine echt kurze Zeit sind. Was mich an Thüringen aber sofort faszinierte, war die politische Gemengelage. Eine rot-rot-grüne Landesregierung mit einem Linken-Politiker als Ministerpräsident. Das fand ich damals extrem spannend.
So kam es, dass ich am 30. September 2016 meinen Wohnheimschlüssel vom Studentenwerk abholte. Dort lernte ich auch meine erste neue Freundin Maja auf dem Gang kennen. Umgezogen bin ich mit einem Koffer voller Schuhe und Klamotten sowie zwei Umzugskartons: Mehr besaß und brauchte ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
Da waren sie: Meine eigenen zwölf Quadratmeter in der Donaustraße! Flur, Küche und Bad hatten kein Tageslicht, die Dreier-WG lag im Erdgeschoss, alle Zimmer umrissen zwischen acht und zwölf Quadratmeter. Ich hatte also für meine 150 Euro monatlich noch das größte abgestaubt.
Die komplette Wohnung war mit welligem Laminatboden verlegt, Bett, Schrank und Tisch wurden gestellt: Klassische Wohnheimausstattung eben. Man muss sich das ein bisschen so wie in einer Jugendherberge vorstellen: klobige Holzmöbel mit abwischbarem und funktionalem Bodenbelag. Immerhin hatte jeder sein eigenes Zimmer, das ist in anderen Ländern in Studentenwohnheimen nach wie vor eher die Ausnahme. Und ehrlich gesagt störte mich das alles überhaupt nicht. Ich bezahlte nicht viel und hatte meine eigenen vier Wände. Das war für den Start in einen neuen Lebensabschnitt genau das Richtige!
»Dachte nicht, dass du so ´ne Konservative bist!«
In der sogenannten Ersti-Woche traf ich dann das erste Mal auf meine Kommilitonen. Die Woche vor Vorlesungsbeginn richtet sich an die Neuankömmlinge auf dem Campus, also die Erstsemester. In dieser Woche werden ihnen die Hochschule, ihre Einrichtungen wie Mensa oder Bibliothek gezeigt, und man hat die Möglichkeit, bereits vor Vorlesungsbeginn ein paar Leuten aus seinem Jahrgang zu begegnen.
Die meisten kommen allein in eine neue Stadt, Kommilitonen kennenzulernen ist daher unentbehrlich, aber auch anregend. Alle Erstsemester werden in Grüppchen nach Studienfach eingeteilt. Nach einer allgemeinen Einführung wird die Bibliothek besucht, die studentischen Selbstverwaltungsgremien stellen sich vor, und gemeinsam wird ein Stundenplan erstellt. Wie es der Zufall wollte, war auch Maja in meiner Ersti-Gruppe. Wir kamen sofort ins Gespräch, unterhielten uns über die neuen Mitbewohner in unseren WGs. Maja hatte ein sehr schönes Zimmer in einem der neuen Wohnheime direkt auf dem Campus bekommen. In den folgenden zwei Jahren haben wir dort viele Partys gefeiert, zusammen zu Abend gegessen und gelernt.
Aber auch die anderen Kommilitonen aus der zusammengewürfelten Runde schlossen sich dem Gespräch bald an. In meiner Ersti-Gruppe wurde viel politisiert.
Nach ein bisschen Small Talk wurden die Fronten abgesteckt. »Ach, ihr seid auch politisch aktiv? Wo denn?« Tristan und Fabian waren bei den »Jusos«, also den Jungsozialisten, der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Die Mutter von einem engen Schulfreund von Tristan war zu diesem Zeitpunkt auch SPD-Landtagsabgeordnete in Niedersachsen. Philipp und Charlotte waren beide schon Mitglied bei »Linksjugend Solid«, einem politischen Jugendverband in Deutschland, der der Partei Die Linke nahesteht. Gemeinsam mit Leo war Charlotte zwischendurch auch bei der linken satirischen Hochschulgruppe von »Die Partei« aktiv. Jasmin engagierte sich unter anderem intensiv bei »Amnesty International«, wo auch Maja zeitweise mitmachte. Sie interessierte sich später auch für »Campus Grün«: Der Bundesverband grün-alternativer Hochschulgruppen ist ein bundesweiter studentischer Zusammenschluss in Deutschland, der der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahesteht. Annalena war überzeugtes Gewerkschaftsmitglied bei Verdi. Sie brach später ihr Studium ab, denn früher als gedacht hatte sie dort eine feste Stelle in Aussicht gestellt bekommen, die sie direkt annahm.
»Und du, Franca?« – »Ich bin bei der JU, Junge Union, kennt ihr das?«, antwortete ich freundlich lachend in die Gruppe. »JU, ernsthaft jetzt?!«, kam es mir von mehreren Seiten verachtend entgegen. »Dachte nicht, dass du so ´ne Konservative bist!«»Wessi und JU, das passt ja.«»Und dann aus Bayern, CSU, das ist ja noch schlimmer!«
Die Stimmung war mir gegenüber auf einmal sehr verhalten. Mich irritierte das, hatte ich meinerseits deren Mitgliedschaft in einschlägigen Jugendorganisationen doch auch nicht abwertend kommentiert. Das hätte ich mir auch niemals angemaßt. Noch dazu bei Leuten, die ich erst seit wenigen Stunden kannte. Darüber hinaus war ich auch noch nicht so bewandert im parteipolitischen Spektrum, als dass ich über die anderen Organisationen überhaupt hätte urteilen können. Außerdem – das macht Demokratie ja aus – kann sich jeder doch so positionieren, wie er mag. Wieso also ist Sozialismus etwas moralisch »Besseres« als liberale, christlich-soziale oder konservative Politik? Wieso war ausgerechnet mein Unionsbackground fragwürdig oder ungewöhnlich, in jedem Falle aber verpönt?
In der ersten Woche an der Universität Erfurt bekam mein Erfahrungsfundament Risse. Die Werte und Gesetzmäßigkeiten einer Debatte über Politik oder Gesellschaft, wie ich sie bislang kannte, galten hier nicht. Irgendetwas war anders. Ich fühlte mich abgestempelt und fragte mich: »Aber wieso ist christdemokratisch sein etwas Negatives?« Das war doch in Nürnberg – übrigens eine Stadt mit langer sozialdemokratischer Tradition und über Jahrzehnte hinweg als »rote Hochburg« apostrophiert – auch kein Verdikt? Noch bemerkenswerter fand ich, dass mir nur aufgrund einer Mitgliedschaft (ich bin auch in anderen Vereinen Mitglied) solch großes Misstrauen entgegengebracht wird und Menschen zudem denken, mich aufgrund dieser spezifischen Mitgliedschaft genau einschätzen zu können und zu kennen. Ja, auf dieser Grundlage ihr Urteil über mich praktisch schon gebildet haben.
Ich weiß noch ganz genau, wo diese Unterhaltung damals stattfand. Wir sind mit unseren Tutoren über den Campus der Universität zur Bibliothek gelaufen. Ein Weg, den ich heute beinahe noch jeden Tag gehe. Das war mein erster Tag an der Universität und eine große persönliche Zäsur.
Schwarz-Weiß-Malerei
Das Bedenkliche war, dass ich zuerst bei mir den Fehler suchte. Schon immer war ich meinungsfreudig und an verschiedenen Themen interessiert. Ich vertrete Meinung und Argumente nach außen nachdrücklich, bin aber auch zugänglich, wenn andere Argumentationen klüger, vernünftiger oder logischer erscheinen. Und natürlich – nur so funktioniert demokratisches Zusammenleben – lasse ich mich von besseren Ideen überzeugen. Ich würde mich als selbstbewusst beschreiben, aber auch als fair und überlegt.
Im Oktober 2016, zu Beginn meines Studiums, war die Flüchtlingskrise in vollem Gange. Sie war das politische Leitthema, welches alle anderen überwog. Die Flüchtlingskrise war auch die erste große Debatte, die ich als junger Mensch vollkommen bewusst wahrnahm und erlebte. Angefangen mit den Bildern vom Münchner Hauptbahnhof im Herbst 2015, der deutschen »Willkommenskultur«, die zunächst überall in den deutschen Medien zelebriert wurde. Später dann die Videos von Pegida-Demonstrationen und Anschlägen auf Asylheime.
Die sozialen Netzwerke spielten zu diesem Zeitpunkt bereits eine große Rolle bei der Berichterstattung. Man wurde tagtäglich mit neuem Bild- und Videomaterial über die verschiedenen Kanäle versorgt und mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert. Nachrichten und Äußerungen fesselten also nicht nur aufgrund ihrer Inhalte, sondern entfalteten auch eine ganz neue Art der moralischen und emotionalisierenden Informationsvermittlung: Durch die Bilder und Videos toter Kinder oder von Brandanschlägen entstand – gerade in meiner Generation, die soziale Medien mehr nutzten als ältere Jahrgänge – eine enorme emotionale Fesselung.
Im Jahr 2016 war die Frage der (weiteren) Flüchtlingsaufnahme zu der zentralen Debatte im Alltag geworden. So auch bei uns am Campus. Meine ersten Tage waren daher immer eng verknüpft mit den Gesprächen rund um die Flüchtlingskrise. Alles drehte sich um diese eine Frage: Aufnahme aller Migranten, ja oder nein? Etwas dazwischen gab es nicht. Ist man Befürworter einer gesteuerten Migration – also keiner ungeordneten Einwanderung, wie sie 2015 und in den Folgejahren stattfand –, landet man in einer Schublade. In diesem Fall in der Schublade der Rechten und Ausländerfeinde. Dort hineingesteckt werden möchte niemand.
Das studentische Umfeld ist ein sehr polarisiertes Milieu. Eindeutig überwiegt in der Außenwahrnehmung die linke, antikapitalistische Szene, die Grenzen jeglicher Art ablehnt. In diesem Umfeld sind wir, die Aufnahmegesellschaft, die Bösen, die aufgrund von Kolonialgeschichte und Ressourcenraub in heute ärmeren Ländern dafür gesorgt haben, dass es uns sehr gut geht und andere Menschen hungern müssen.
Hinzu kommt der Klimawandel, der durch die Industrieländer verursacht wurde und Menschen beispielsweise in Afrika ein Leben mehr und mehr unmöglich macht. Auch diese Menschen kommen als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge zu uns. Folgt man der Meinung der weit überwiegenden Zahl meiner Kommilitonen, sollten wir aufgrund unserer »Schuld« für diese Gruppen pauschal die Grenzen öffnen. Das ist das Mindset, das die Auseinandersetzung mit der Flüchtlingsdebatte im Jahr 2016 vorgab und in dem ich die Diskussionen um Migration erstmals mitverfolgte.
Von meinem Leben als Studentin erwartete ich eigentlich eine breite und differenzierte, faktengestützte Debatte, in der sich Argumente nicht nur plakativ und eindimensional »für« oder »gegen« – in diesem Fall – Migration aussprechen. Gerade in diesem studentischen Umfeld, so dachte ich, werden komplexe Sachverhalte nicht herunterskaliert, wie vielleicht an irgendwelchen Stammtischen.
Als ich erfuhr, dass meine Kommilitonen anderen Parteiorganisationen angehörten und daher vermutlich eine andere politische Einstellung vertraten, war ich umso gespannter. Den Seitenhieb vom Vortag bezüglich meiner JU-Mitgliedschaft hatte ich mittlerweile verkraftet. Das war sicher nicht so gemeint. Vielleicht hatte ich es auch falsch wahrgenommen? »Nein«, so dachte ich, »mit meinen Kommilitonen kann ich die Fragen, die mir unter den Nägeln brennen, richtig diskutieren.« Gerne ambitioniert und laut, aber eben auch differenziert.
Ich wollte darüber sprechen, dass die Behörden und Kommunen 2015 bereits nach wenigen Wochen überfordert waren, dass erst einmal Strukturen aufgebaut werden müssten, bevor man wieder Menschen aufnehmen könnte. Stattdessen wussten die Kommunen nicht mehr, welche Turnhalle noch als Flüchtlingsunterkunft aktiviert werden könnte. Wie also sollte diesbezüglich eine funktionierende Organisation aussehen? Wie könnte z. B. der Bund die Kommunen entlasten?
Menschen Asyl zu gewähren ist richtig, das hat mir nicht zuletzt auch meine von einem christlichen Menschenbild ausgehende Sozialisierung vermittelt. Aber sollte man nicht erst humane Voraussetzungen, einen echten Integrationsrahmen für Kinder und Erwachsene schaffen, Schul-, Ausbildungs- und Studienplätze verlässlich bereitstellen und auf diese Weise einer humanitären Verantwortung annähernd gerecht werden? Kann man überhaupt grenzenlos Menschen aufnehmen oder ist das für eine Gesellschaft überfordernd? Letzteres meint weniger die »kulturelle Überforderung« als vielmehr die tatsächliche Überforderung an Ressourcen wie Wohnungen oder Kindergartenplätzen (diese Liste könnte nahezu endlos fortgeführt werden). Ist Menschen geholfen, wenn sie nach vielen Jahren immer noch in Containern als ursprüngliche Übergangslösung leben? Wie könnte man Terroranschläge verhindern, die durch Attentäter verübt werden, welche über die Flüchtlingsroute zu uns gekommen sind? Wieso haben Menschen hierzulande Angst um ihre Existenz, auch wenn die Flüchtlingswelle erst einmal keine reale »Bedrohung« darstellt, die Angst aber eine gefühlte ist?
Diese Fragen interessierten mich brennend, und sie sind zudem noch zentrale Fragen der Staatswissenschaften, also der Disziplinen, mit denen wir uns ab jetzt intensiv beschäftigen sollten. Natürlich würden unsere Gespräche keine Berge versetzen, wir sind keine Entscheidungsträger. Aber diese Dinge müssen klar angesprochen und diskutiert werden.
Das hätte ich nur allzu gern mit meinen Kommilitonen erörtert. Leider kam es gar nicht dazu, dass wir Argumente auf Augenhöhe austauschten. Meine Fragen wurden mit der Unterstellung diffamiert, sie seien gegen Menschen gerichtet. »Wie kannst du es in Zweifel ziehen, dass Menschen in dieser absoluten Notsituation geholfen werden muss. Egal wie!«, hieß es.
Das tat ich doch gar nicht! Ich hatte dies doch mit keiner einzigen Silbe in Zweifel gezogen. Oder doch?!
Schon wieder war es da, dieses Gefühl, ich wäre realitätsfern oder das, was ich sagte, wäre Irrsinn und verachtenswert. Mein Versuch, eine sachbezogene Diskussion einzuleiten, zu einem Thema, das zu diesem Zeitpunkt ganz Deutschland, die Medienlandschaft, die Wirtschaft, die sozialen Träger, die Kirchen, die Vereine, die Schulen und Kindergärten und auch das akademische Umfeld bewegte, scheiterte kläglich mit der Unterstellung, ich wäre gegen Flüchtlinge, gegen Menschenrechte und gegen Humanität.
Soweit ich mich erinnere, habe ich erst viel später meine erste konstruktive Diskussion zur Flüchtlingskrise geführt. Im Jahr 2016 war die Stimmung so aufgeheizt, dass man allein das Wort »Flüchtling« nicht mehr aussprechen konnte, ohne beargwöhnt zu werden. Wenn man im nächsten Satz nicht hinterherschob »und natürlich bin ich nicht ausländerfeindlich«, war man bereits als solches stigmatisiert.
Die Schwarz-Weiß-Malerei war in dieser Zeit en vogue. Und sie wird es bleiben. In den sozialen Netzwerken verbreiteten pöbelnde Nutzer Kommentare unter Posts von Politikern, in denen sie diese beleidigten und aufgrund des Migrationsstroms des Volksverrats bezichtigten. Am Campus gab es diese radikale Vereinfachung der Flüchtlingsthematik ebenfalls. Auch hier zählte nicht das sachliche Argument, dafür aber ein anderes: das moralisch rechtmäßige Argument. War man für die unbegrenzte Aufnahme von Migranten, gehörte man zu den »Guten«, war man z. B. aus Gründen der Sicherheit für eine Überprüfung von Menschen und ihrem tatsächlichen Fluchtgrund und war man bereit, Menschen, die keine Bedrohung im Heimatland nachweisen können, kein Asyl zu gewähren, galt man als »schlecht«.
Das als »moralisch gut« definierte ist also das richtige Argument. Auf irgendeine Weise hatte sich auch schon etabliert, was dazugehört: Man könnte es als Mainstream oder Zeitgeist bezeichnen. Vor allem aber sind es immer politisch linke Forderungen, die entlang der Maximen der Gesinnungsethik verlaufen; die Grünen sind in dieser Richtung Vorreiter. Das ist dann politisch korrekt. Moralisch schlechte Äußerungen gipfeln nach dieser Logik meistens in einem Vergleich mit Nationalsozialisten oder anderen rechtsradikalen Gruppierungen.
Der Schutz seiner Bürger ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates. Man hätte wenigstens einmal darüber reflektieren können, welches positive oder eben negative Potenzial in einem nicht hinreichend kanalisierten Migrationszustrom steckt. Aber ich wurde eines Schlechteren belehrt. Statt Gegenposition zu beziehen, weshalb man Menschen eben doch bedingungslos, schnellstmöglich und ohne polizeiliche Erkennung aufnehmen sollte, selbst mit dem Risiko, dass Personen in Deutschland untertauchen, wurden meine Beiträge einfach nur abgebügelt. Und zwar nicht mit sachlichen Gegenargumenten, sondern mithilfe der moralischen Instanz: Es war einfach politisch nicht korrekt, was ich mich selbst und die Runde gerade fragte.
Und langsam dämmerte mir, was es mit meiner JU-Mitgliedschaft auf sich hatte. Der damalige Ministerpräsident des Freistaats Bayern und CSU-Chef Horst Seehofer hatte eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Da war ich als Mitglied in der Unionsfamilie und auch noch gebürtig aus Bayern stammend natürlich mit im »Obergrenzen-Boot«. Plötzlich verstand ich die Denklogik meiner Kommilitonen, denn sie unterstellten, dass ich aufgrund meiner vermeintlich offensichtlichen politischen Einstellung als Mitglied der JU gegen Migration und damit gegen Menschen und derer nach ihrer Ansicht in Deutschland bedingungslosen Rechte sei. Sie steckten mich also in eine Schublade. Aber nicht in die »böse CSU«-Schublade, sondern direkt in die der Ausländerfeinde. Dort war die gesamte CSU ohnehin schon drin. »Wahnsinn, die Welt kann so einfach sein«, dachte ich ernüchtert.
Die Flüchtlingsdebatte wurde also fast ausschließlich moralisierend diskutiert. Aber die Unterkomplexität der Debattenkultur auf dem Campus blieb nicht nur ein Schock der ersten Woche. Sie grundierte mein gesamtes Studium. Sie war nicht nur geknüpft an die Flüchtlingskrise, auch wenn diese die Schwarz-Weiß-Malerei vielleicht befeuert hatte. Und die sozialen Netzwerke hatten sicher auch einen Anteil daran. Aber es lag auch an einer schleichenden Veränderung der Debattenkultur, mit der ich bereits an meinem ersten Tag als Studentin konfrontiert wurde und die auch weiterhin völlig unabhängig von der Migrationsdebatte verläuft.
Debatten(un)kultur
Allein der Begriff Debattenkultur passt nicht mehr zur Situation. Diskursive Standards hatten ihre Gültigkeit schon lange verloren bzw. wurden über den Haufen geworfen. Probleme wurden nicht mehr als solche benannt. Stattdessen bestanden die Gespräche nur noch aus einem Austausch ähnlicher Meinungen und – im Sinne ihrer Vertreter – korrekter Einschätzungen. Heute weiß ich, dass es Political Correctness war, die mich unerwartet erreichte. Für mich fühlte es sich vom einen auf den anderen Tag wie eine andere Welt an.
Es war Nonsens: Ich bezichtigte meine Kommilitonen, die heute unter anderem in Landesvorständen der Partei Die Linke sitzen, doch auch nicht der Mittäterschaft mit den Aussagen einer Sahra Wagenknecht. Die ist nach deren Ansicht mehr oder weniger rechtsradikal geworden, die Unterstellung einer inhaltlichen Übereinstimmung mit ihr käme einer immensen Provokation gleich.
Konnte ich also nicht einfach ich sein, Franca Bauernfeind, 18 Jahre alt und aus politischem Interesse JU-Mitglied? Mit meinen eigenen Meinungen und Erfahrungen, die inhaltlich nicht einmal mit der Union gänzlich übereinstimmten? Und selbst wenn: In einer Zeit, in der der Individualismus seinen Höhepunkt erreicht, sollte jedem Einzelnen doch eine individuelle Meinungs- und Willensbildung zugestanden werden. Dass Political Correctness jedoch rein gar nichts mit Individualismus zu tun hat, sondern vielmehr mit Grüppchenbildung und Schubladendenken (also eher die sozialistische Denkschule anstrebt) agiert, wurde mir erst sehr viel später bewusst.
Man lernt irgendwann, was erwünscht ist und was nicht. Ganze Themenfelder werden ausgeklammert. Atomkraft und Klimapolitik in einem Satz zu nennen ist in diesem Umfeld nicht erwünscht. Es hört sich immer so einfach an, zu sagen: »Halte doch dagegen und lass dir deinen Mund nicht verbieten.« Sich den Mund verbieten zu lassen, kam für mich nie infrage. Andere dazu ebenfalls aufzumuntern, war mir stets wichtig. Viele verfallen aber in Selbstzensur. Es ist wahnsinnig unangenehm, dem moralischen Zeitgeist zu widersprechen, dieser vermeintlichen Korrektheit entgegenzutreten und sich davon nicht beirren zu lassen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte dazugehören. Jeder will Teil einer Gruppe sein, niemand möchte ausgeschlossen oder ignoriert werden. Dieser Wunsch führt zu solchen Äußerungen wie dem in der Einleitung schon zitierten »Diese Sätze könnten wir nie vor den anderen Studenten sagen« zwischen einem Kommilitonen und mir in meiner Wohnheimküche.
In die rechte Ecke gestellt zu werden, ist nie schön. Das kann schnell die Konsequenz sein, wenn man ab und an auch einmal Gedanken jenseits des vorgegebenen Meinungskorridors ausspricht. Oder aufgrund einer Mitgliedschaft bei der JU. In die Ecke gestellt zu werden, das passierte mir in den kommenden Jahren noch sehr oft. Es funktioniert als Mechanismus, andere mundtot zu machen. Denn wer will schon als »Nazi« bezeichnet werden?
Bereits in dieser ersten Woche, an den ersten beiden Tagen dachte ich mir: »Das kann doch gar nicht sein, das muss doch irgendjemand mitbekommen!« Ich hielt es für ziemlich ausgeschlossen, dass so eine Debatten(un)kultur überhaupt jemand für gut befinden könnte. Wenn es nicht meine Kommilitonen waren, dann vielleicht die Gesellschaft, die politische Öffentlichkeit »außerhalb« des Campus. Ein Trugschluss, wie sich im Nachhinein herausstellte. FUNK, der Online-Kanal der öffentlich-rechtlichen Sender, verglich Ende Juni 2023 in einer Instagram-Story mit dem Video »Was ist rechts?« die Union mit der AfD. Politiker beider Fraktionen wurden gleichermaßen als »rechts« bezeichnet.
Die Entschuldigung ließ zwar nicht lange auf sich warten, der Beitrag entspreche nicht journalistischen Standards. Allein aber der Satz des FUNK-Programmgeschäftsführers in seiner Erklärung ist ein Affront: »Wir von Funk verstehen, dass diese Darstellung problematisch ist, weil sie konservative demokratische Parteien mit extremistischen Haltungen auf eine Ebene stellt.« Nein, die Darstellung ist nicht nur problematisch, sie ist falsch! Christdemokratisch ist eben nicht rechtsextrem und keinesfalls nur rechts. Und die Union als Volkspartei beheimatet nicht nur Wertkonservative, sondern auch Liberalkonservative, Christen wie Personen anderer Glaubensrichtungen – eben eine große gesellschaftliche Bandbreite. Im politischen Spektrum lässt sich die Union Mitte-rechts einordnen, aber nicht »rechts«. Sie vereint gleichermaßen die liberale, christlich-soziale und konservative Strömung.
Die Entschuldigung war eine Farce, die Aussagen der Verantwortlichen stehen für sich und zeigen ein eindeutiges Mindset. Die »fehlerhafte« Instagram-Story ist auch nicht auf eine Unachtsamkeit im journalistischen Gewerbe zurückzuführen. Dort arbeiten offensichtlich Personen, die der Überzeugung sind, dass Politiker der Union rechts im Sinne von rechtsextremistisch sind. Diese Position wird ohne Scheu auf einem Kanal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks präsentiert. Und da wundere ich mich noch, weshalb ich als Mitglied einer demokratischen Partei am Campus als rechtsaußen klassifiziert werde.
Die Legitimation solcher Sichtweisen nahm aber genau dort ihren Anfang: an der Universität. Im akademischen Umfeld, das diesen Zeitgeist forcierte. Auf dem Campus sind die Führungskräfte von morgen. Das sind die angehenden Lehrer, die ihren Schülern später einmal eine politisch »korrekte« Gendersprache beibringen werden, wie ich es bereits im Jahr 2020 bei meiner Schwester in der Oberstufe mitbekommen habe. Es sind die Richter und Anwälte, die Abteilungsleiter in den Behörden dieses Landes, die informierenden und meinungsmachenden Journalisten (die ersten Anzeichen lassen sich bei FUNK ablesen), und es sind die vielen Teamleiter, die in mittelständischen Unternehmen einmal angestellt sein werden.
In die Öffentlichkeit wurde dieser Zeitgeist also erst in jüngster Zeit getragen. Aber so richtig interessiert das scheinbar niemanden. Ich selbst gehöre nicht der antikapitalistischen Studenten-Szene an. Ich lehne Grenzen nicht ab. Aber ich strebe nach Pluralität und Vielfalt, die sich eben nicht diesem Mainstream anpasst.
An der Universität gehöre ich damit neben einigen anderen zu einer Minderheit. Jedenfalls unter denjenigen, die ihre eigene Position aktiv bekennen. Und plötzlich legt sich die Kultur einer Political Correctness wie Mehltau über die Szenerie. Man hängt in einer Schublade fest und fragt sich: »Wie bin ich denn hier gelandet?« Dieser Prozess ist nicht greifbar und dringt gleichwohl in die Breite der Gesellschaft vor.
»Ich hätte links werden können!«
»Ich hätte links werden können!«, das kommt mir immer in den Sinn, wenn ich über meine erste Woche an der Universität nachdenke. Ich war politisch unvoreingenommen, offen für Neues, für Perspektiven, die ich noch nicht von zu Hause oder der Schule kannte. Logisch, das hatte ich mir ja auch von Erfurt und meinem Umzug erhofft. Mir war auch klar, dass ich mit 18 Jahren noch viele Erfahrungen sammeln musste. Dinge kennenlernen, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gibt. Oder Sichtweisen, die ich als Nürnbergerin meines Alters einfach nicht haben kann; weil ich z. B. nicht im diktatorischen System der DDR aufgewachsen bin.
Zwar hatten mich trotz meiner »westdeutschen«, besser gesagt süddeutschen Herkunft familiäre Gespräche mit meiner Tante Rita sehr geprägt. Sie wurde noch zu Kriegszeiten geboren, wuchs in der DDR auf und hatte sich trotz einer systemkritischen Haltung mit dem Leben und den politischen Gegebenheiten so gut es ging arrangiert. Tätig war sie in der Handelsorganisation, dem staatlichen Einzelhandel der DDR; später konnte sie sogar ein Wirtschaftsstudium absolvieren, das nach dem Zerfall des Unrechtsstaats allerdings nichts mehr wert war: Denn Studieninhalte waren insbesondere Lenin, Marx und Planwirtschaft.
Sie berichtete mir von den scheußlich schmeckenden »Zitrusfrüchten« aus Kuba und den genau abgezählten Schokonikoläusen. Je nachdem, wie viele Kinder in einem Bezirk lebten, so viele Nikoläuse wurden den einzelnen Filialen zugestanden. Pro Kind ein Nikolaus. Planwirtschaft eben, die mir durch die Debatten mit meiner Tante Rita sehr nahegebracht wurden. Die Schokonikoläuse bestanden übrigens nicht einmal aus Kakao, ebenso wie die Zitrusfrüchte keine saftigen Orangen waren.
Diese Gespräche prägten meine Perspektiven und sensibilisieren meine Wahrnehmungen noch heute. Dennoch habe ich nie selbst erlebt, wie unterschiedlich individuelle und vor allem auch kollektive Demokratieerfahrungen sein können. Und ich finde es auch nicht problematisch, dass nicht jeder die Sichtweisen von jedem auf Anhieb kennen, einnehmen oder verstehen kann und will. Aber ein Interesse zu haben und offen zu sein, das finde ich wichtig. Und daher auch die Lust an Erfurt und Thüringen.
Leider hatte ich seit Tag eins den JU-Stempel auf der Stirn. Davon unbeirrt ließ ich mich auf intensive Debatten mit meinen Kommilitonen aus der Ersti-Gruppe ein. Wir wurden tatsächlich zu einem engen Freundeskreis. Vielleicht lag es daran, dass ich eher der lockere Typ bin, man kann mit mir streiten, ich sage meine Meinung, aber ich denke mir auch manchmal: »Da rein, da raus.« Wir zofften uns hart in der Sache, danach aber konnten wir auch entspannt ein Bier trinken gehen.
Wochenlang hatten wir Positionen ausgetauscht. Zunehmend funktionierte es auch mit den »echten« Debatten, wobei der unsichtbare moralische Filter immer präsent blieb. Kein Mittagessen in der Mensa kam ohne politische Diskussion aus. Wir waren alle um die 20 Jahre alt, manche älter, manche – so wie ich – jünger. Und wir hatten alle einen unheimlichen Wissens- und Erfahrungsdrang. Jeder wollte seine Standpunkte klarmachen, und so führten wir teilweise heftige Auseinandersetzungen miteinander.
Nach einigen Wochen schworen wir uns auf dem Weg von der Vorlesung zur Mensa: »Heute wollen wir einfach nur gemeinsam essen und nicht wieder in politische Debatten abschweifen.« Keine fünf Minuten später saßen wir am Tisch und argumentierten zu allen möglichen Themen gegeneinander. Das waren die besten Erfahrungen, die ich zu dieser Zeit hätte machen können. Man lernt in solch impulsiven Debatten viele neue Ideen und Fakten kennen, verschiedene Perspektiven zu unterschiedlichen Themen, über die man vielleicht noch nie zuvor nachgedacht hat. Und man lernt die Argumentationsstrategien anderer. Jeder bringt ein anderes Beispiel, um seine These zu untermauern. Und man ist nicht von Jasagern umgeben. Man schwimmt nicht in seiner eigenen politischen Blase. Man ist auf sich, sein Wissen, seine Argumente angewiesen und muss sich behaupten. Meine Empfehlung: Jeder sollte sich solchen Auseinandersetzungen einmal stellen. Es schult das gegenseitige Verständnis, das Nachvollziehen anderer Positionen, verbessert und verfeinert das eigene Argumentieren.
Allmählich gelangte ich allerdings zu der Erkenntnis, dass mich die anderen nicht überzeugten. Sicher, wir wollten alle die Welt verbessern und gerechter machen, Benachteiligten helfen und nachhaltige Projekte vorantreiben. Was vielen jungen Menschen eben wichtig ist. Die Herangehensweisen und Lösungsvorschläge dafür aber klafften weit auseinander. Mein Standpunkt war z. B. immer, dass Geld endlich sei und man es pragmatisch ausgeben sollte. Es muss erst erwirtschaftet werden, bevor es an anderer Stelle für beispielsweise soziale Projekte eingesetzt werden kann.
Zudem gingen unsere Meinungen auch zu essenziellen Politikbereichen wie Sicherheit und Bildung diametral auseinander. Für mich war das vermeintliche Problem eines strukturellen (!) Rassismus in der deutschen Polizei nicht nachvollziehbar. Auch bin ich keine Befürworterin der Einheitsschule alias Gesamtschule, sondern halte ein durchlässiges, gegliedertes Schulsystem mit unterschiedlichen Schularten für die richtige bildungspolitische Herangehensweise. Nur so kann auf die verschiedenen Lerngeschwindigkeiten und Kompetenzverteilungen von Kindern adäquat eingegangen werden.





























