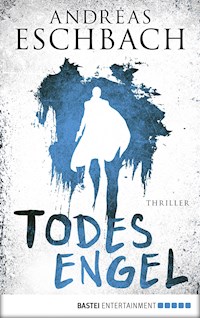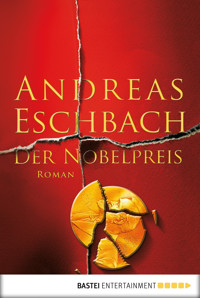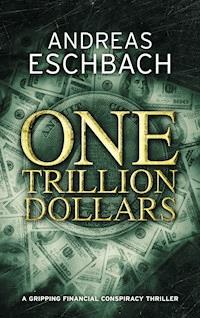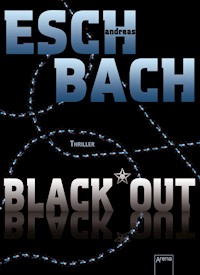
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Blackout - Hideout - Timeout
- Sprache: Deutsch
Christopher ist auf der Flucht. Gemeinsam mit der gleichaltrigen Serenity ist er unterwegs in der Wüste Nevadas. Irgendwo dort draußen muss Serenitys Vater leben, der Visionär und Vordenker Jeremiah Jones, der sämtlicher Technik abgeschworen hat, nachdem er erkennen musste, welche Gefahren die weltweite Vernetzung mit sich bringen kann. Doch eine Flucht vor der Technik - ist das heute überhaupt möglich? Serenity ahnt bald, auf was und vor allem auf wen sie sich eingelassen hat. Denn der schwer durchschaubare Christopher ist nicht irgendjemand. Christopher hat einst den berühmtesten Hack der Geschichte getätigt. Und nun ist er im Besitz eines Geheimnisses, das dramatischer nicht sein könnte: Die Tage der Menschheit, wie wir sie kennen, sind gezählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Titel
Andreas Eschbach
BLACK*OUT
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © 2010 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Einbandgestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80050-9www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.dewww.eschbach-lesen.de
Abfangmanöver
1
Alles sah tot und verlassen aus, so weit das Auge reichte, und auch die Tankstelle, an der sie angehalten hatten, wirkte, als hätte man sie vor langer Zeit aufgegeben.
Christopher beobachtete ein Insekt, das sich durch den Sand schleppte. Es sah aus wie ein Skorpion, und es war unterwegs in die Wüste.
»Ist hier überhaupt jemand?«, fragte er.
Kyle war damit beschäftigt, sein Bargeld durchzuzählen. Er steckte seiner Schwester zwei Scheine zu; Christopher konnte nicht erkennen, was für welche. Diese Dollarscheine sahen in seinen Augen alle gleich aus. »Bringt auch eine Zeitung mit«, sagte Kyle. »Den Nevada Herald, wenn sie den haben. Sonst eine andere.«
Christopher ließ sich tiefer in den Rücksitz sinken, der so weich war, dass einem irgendwann alles wehtat. »Es ist wahrscheinlich besser, ich bleibe im Wagen«, meinte er.
Jetzt drehte sich Kyle zu ihm um. Eine wulstige Narbe zierte seine Stirn, verlief von der Mitte seiner rechten Augenbraue fast senkrecht nach oben. Wenn er sich ärgerte, färbte sie sich an den Rändern rötlich. So wie jetzt.
»Blödsinn«, sagte er. »Ihr geht jetzt da beide rein, solange ich tanke, und du suchst dir was zum Essen und Trinken aus. Du wirst es brauchen, glaub mir. Es dauert noch verdammt lange, bis wir da sind.«
Christopher wollte etwas sagen, aber Kyle unterbrach ihn mit einer unwirschen Handbewegung. »Entspann dich, Chris, okay? Hier kennt dich niemand. Und selbst wenn, würde dich niemand verraten. Nicht hier.«
»Ich hab nicht Angst, dass mich jemand verrät«, sagte Christopher.
»Umso besser«, erwiderte Kyle und stieg aus, genauso wie Serenity. Zögernd öffnete Christopher die Tür auf seiner Seite und folgte ihr.
Es tat gut, sich ein bisschen zu bewegen. Das auf jeden Fall.
Der Boden bestand nur aus trockener, festgestampfter Erde. An den beiden Zapfsäulen war die meiste Farbe bereits abgeplatzt, von der Hitze und der Sonne vermutlich, aber das Metall darunter zeigte keine Spur von Rost: Dazu war es hier, mitten in der Wüste von Nevada, schlicht zu trocken.
In einiger Entfernung stand der Mast einer Mobilfunkantenne. Aber Überwachungskameras waren keine zu sehen.
Serenity stieß die Tür zum Drugstore auf, mit einer heftigeren Bewegung, als nötig gewesen wäre. Und sie wartete nicht auf ihn, ließ die Tür hinter sich einfach wieder zufallen, ohne sich darum zu kümmern, ob Christopher nachkam oder nicht.
Drinnen war alles eng, vollgestopft und staubig. Jedes Mal wenn man die Tür öffnete, drang etwas von dem feinen Wüstensand herein, und offenbar machte sich niemand die Mühe, ihn wieder hinauszubefördern. Auch aufzuräumen, hielt niemand für nötig; die Regale reichten in dem winzigen Raum bis zur Decke, und in ihnen stapelten sich Chips, Süßigkeiten und Autozubehörteile aller Art. Christopher griff nach einer Tüte bunter Kaubonbons in Form von Dinosauriern. Aus der Nähe betrachtet wirkten die Saurier seltsam klebrig. Er drehte die Tüte um. Haltbar bis September 2008.Abgelaufen war da gar kein Ausdruck mehr.
Angewidert legte er die Tüte zurück. Die Frau, die hinter der Kassentheke saß, würdigte sie keines Blickes. Sie verfolgte eine von ständigem, aufdringlich wirkendem Gelächter durchsetzte Show auf einem uralten kleinen Fernseher, und so lasch, wie sie dasaß, hätte Christopher jede Wette gehalten, dass sie bis eben einfach nur gedöst hatte. Es war fast Mittag, und die klapprige Klimaanlage kam gegen die Hitze kaum noch an. Er trat neben Serenity, die vor dem Kühlregal mit den Getränken und den Sandwiches stand, in einigermaßen angenehmer Kühle.
»Man kann sich auch zu wichtig nehmen, weißt du?«, sagte sie, ohne ihn anzusehen.
»Meinst du mich?«, fragte Christopher.
Sie machte eine knappe, ärgerlich wirkende Handbewegung. »Ja, ich geb’s zu. Ich fand das zuerst ziemlich cool, dieses ›Die ganze Welt ist hinter mir her‹-Ding. Aber ehrlich gesagt, auf die Dauer nervt es.«
Christopher blickte sich um. Vielleicht hatte sie ja recht. Das sah alles wirklich ziemlich aus wie der Arsch der Welt; man musste sich regelrecht wundern, dass es hier überhaupt elektrischen Strom gab. Was auch immer gerade an weltbewegenden Dingen geschehen mochte, an diesem Ort waren sie wahrscheinlich so weit davon entfernt wie nur irgend möglich.
»Tut mir leid«, sagte er.
Sie warf ihm einen versöhnlichen Blick aus ihren bernsteinfarbenen Augen zu. »Relax einfach. Wir sind bald da. Du machst dir entschieden zu viele Sorgen.«
Relaxen? Das war leichter gesagt als getan. Die Zeit, als er sich keine Sorgen gemacht hatte – seine Kindheit, sozusagen –, lag so lange zurück, dass er sich kaum noch daran erinnerte, wie sich das angefühlt hatte. Dagegen erinnerte er sich noch gut daran, wie sich der Tastendruck angefühlt hatte, mit dem er diese Zeit beendet hatte, schnell und unwiederbringlich. Wie sein Zeigefinger noch einen Moment über der Entertaste geschwebt war und er sich gefragt hatte, ob er das wirklich tun sollte, und wie es dann trocken Klick gemacht hatte, als er die Taste gedrückt und den Computervirus, der ihn berühmt machen sollte, auf die Reise geschickt hatte.
Oder besser gesagt: berüchtigt. Seither nannte man ihn Computer Kid, und diesen bescheuerten Namen würde er wohl nie wieder loswerden.
Und die, die ihn für den besten Hacker der Welt hielten, ahnten nicht, wie recht sie damit hatten.
Und was alles davon abhing.
»Ich hoffe, dass wenigstens die Sandwiches einigermaßen frisch sind«, raunte ihm Serenity zu, zwei in furchtbar viel Frischhaltefolie gewickelte belegte Brote in der Hand.
Das Etikett versprach es, aber was bewies ein Etikett schon?
Christopher wählte ein Brot mit Salami. Nicht, weil ihm Salami besonders schmeckte, sondern, weil man damit wahrscheinlich am wenigsten falsch machen konnte. Außerdem zog er eine große Flasche Limonade mit Cranberry-Geschmack aus dem Kühlfach.
»Ich hab Kekse gefunden, die erst ein Jahr abgelaufen sind«, sagte Serenity. »Bei Keksen wird das nicht so schlimm sein, oder? Die können höchstens weich werden.«
Christopher nickte. »Denk ich auch.«
Sie gingen zur Kasse. In die Frau kam Bewegung, aber eher unwillig, so, als wäre es ihr lieber gewesen, sie wären, ohne etwas zu kaufen, wieder gegangen. Das Piepen des Kassenscanners klang erkältet, und die Beträge, die auf dem kleinen Bildschirm erschienen, schienen schief zu stehen.
»Die Zeitung!«, fiel Serenity ein.
Christopher ging die Zeitungen durch, die direkt vor der Kasse aufgefächert auslagen. Eine Ausgabe des Nevada Herald war dabei: die Ausgabe vom Vortag.
»Das ist okay«, meinte Serenity, als Christopher auf das Datum zeigte. »Aktueller sind die hier nicht.«
Christopher hob die anderen Zeitungen ein Stück hoch, zog den Nevada Herald heraus. Darunter kam ein kleines Kästchen zum Vorschein, das einen hellen Ton wie von einer Glocke von sich gab, als Christophers Finger über die kleine gläserne Scheibe auf der Oberseite glitt, die im nächsten Moment rot aufleuchtete.
Ein heißer Schreck durchzuckte ihn. Ein Fingerabdruckscanner!
Er sah die Frau hinter der Kasse an, die ihn mit gefurchter Stirn musterte. »Ist der angeschlossen?«, rief er.
Sie schien nicht zu verstehen, was er meinte. »Angeschlossen?«
Er hob das Kästchen hoch. Die Signallampe leuchtete immer noch rot, was alles Mögliche bedeuten konnte. »Das hier. Ist das angeschlossen?«
»Chris!«, sagte Serenity. »Mach keinen Stress.«
Die Frau machte eine wegwerfende Handbewegung. »Hier hat noch nie jemand mit Fingerabdruck bezahlt. Das Ding ist bloß da, weil’s Vorschrift ist.«
Christopher spürte auf einmal einen dicken Kloß in seinem Magen. Seine Gedanken rasten, seine Hände folgten dem Anschlusskabel. Vielleicht war es nicht eingesteckt. Vielleicht hieß das rote Licht, dass es keine Verbindung ins Netz fand…
In diesem Moment wurde das Signallicht grün, der Betrag, den die Kasse anzeigte, sprang auf $ 0,00, und darunter erschien die Anzeige »Bezahlt«.
»Raus hier!«, schrie Chris und packte Serenity am Arm. »Weg!«
2
Kyle tankte noch. Der Zapfhahn steck chlich mit einem nassen Lappen über die staubigen Scheiben.
»Sag mal, bist du völlig übergeschnappt?«, schrie Serenity Chris an. Er zerrte sie über die Tankstelle. »Wir haben noch nicht einmal die Sachen mitgenommen!« Sie versuchte, sich loszureißen, aber er hielt sie eisern fest.
Kyle stutzte, als er sie kommen sah, warf den Lappen zurück in den grauen Plastikeimer und wartete dann, die Hände in die Hüften gestemmt, bis sie da waren.
»Wir müssen los!«, erklärte Christopher. »So schnell wie möglich. Da drin war ein Fingerabdruckscanner, den ich nicht gesehen habe; der hat mich erkannt!«
»So«, sagte Kyle gedehnt. »Hat er das?«
Christopher nickte, ließ Serenity los. »Sie haben mich. Tut mir leid. Am besten, wir fahren erst mal in eine andere Richtung und versuchen, sie abzuhängen.«
»Hier gibt’s keine andere Richtung«, sagte Kyle.
Christopher stutzte, sah sich um. Kyle hatte recht. Es gab nur diese eine Straße, die vom einen Horizont zum anderen führte.
Der Tank war voll, die Pumpe stoppte mit einem fetten Klacken.
»Dann müssen wir zurück«, sagte Christopher. »Auf jeden Fall dürfen wir nicht weiter in Richtung eurer Siedlung fahren.«
»Jetzt zerbrich dir mal nicht meinen Kopf, okay?«, sagte Kyle. Er setzte sich in Bewegung, hängte den Tankstutzen zurück, schloss den Tankdeckel und ging dann zahlen, mit langsamen, wiegenden Schritten, wie um ihnen zu zeigen, dass er alle Zeit der Welt hatte.
»Du spinnst«, erklärte Serenity wütend und rieb sich die Stelle am Arm, an der er sie gepackt hatte. »Du hast echt einen an der Waffel, wenn du’s genau wissen willst.«
Christopher wies auf den Drugstore, in dem Kyle gerade an der Kasse stand und mit der Frau ein Schwätzchen hielt. »Das Ding hat meinen Fingerabdruck erkannt! Es hat sogar diese lausigen Sandwiches damit bezahlt!«
»Aha. Und von welchem Konto bitte schön?«
Christopher sah sie an und hatte das Gefühl, dass seine Augen Funken sprühten. »Willst du einen Vortrag über die weltweite Vernetzung der verschiedenen Bezahlsysteme hören?«
Serenity funkelte zurück. »Nein, danke, Mister Superhacker.«
Kyle kam aus dem Laden. Er hatte ihre Sandwiches und Limoflaschen dabei und bewegte sich immer noch betont gemütlich. »Du kommst mir ein bisschen nervös vor, Chris«, sagte er grinsend und legte die Tüte mit den Einkäufen auf den Beifahrersitz.
»Bin ich nicht«, erwiderte Christopher. »Ich bin extrem nervös.«
»Dann eben extrem nervös«, meinte Kyle und verdrehte die Augen. »Also, los. Steigt ein, wir fahren.«
Das ließ sich Christopher nicht zweimal sagen. Serenity wollte eine Diskussion mit ihrem Bruder anfangen, ob sie nicht vorne sitzen könnte, was dieser strikt abbügelte; also stieg sie wieder hinten ein, blieb aber betont auf Abstand zu Christopher.
Kyle ließ den Wagen an, bog auf die Straße hinaus – und fuhr in ihrer ursprünglichen Richtung weiter.
Sofort hatte er Christopher im Nacken. »Was machst du da?«
»Na, wie sieht das denn aus, was ich mache?«
»Du glaubst mir nicht, oder? Dass sie uns jetzt verfolgen?«
Kyle seufzte abgrundtief. »Also, Kleiner, pass auf: Erst mal – ›die‹. Wer soll das sein? Hier lebt im Umkreis von fünfzig Meilen keine Menschenseele. Selbst wenn irgendjemandem irgendwo auffallen sollte, dass dein Fingerabdruck hier registriert worden ist, dann ist der frühestens morgen hier. Und weiter als bis zu der Tankstelle kommt er auch nicht. Soweit ich nämlich gesehen habe, hast du den Fingerabdruckscanner dortgelassen, oder?«
»Ja, aber –«
»Aber«, unterbrach ihn Kyle unnachgiebig, »in Wirklichkeit denke ich, dass du die amerikanische Polizei maßlos überschätzt. Glaub mir, ich kenn die Burschen besser als du.«
Christopher ließ sich zurück auf den Sitz sinken. »Ich rede doch nicht von der Polizei.«
Niemand ging darauf ein. Serenity angelte ihre Cola vom Beifahrersitz, öffnete sie zischend, trank einen tiefen Schluck und hielt sie ihm dann nach kurzem Zögern hin.
Christopher schüttelte automatisch den Kopf.
Was hatte Kyle noch über die Besiedelungsdichte dieses Teils von Nevada gesagt? Es stimmte, es gab nur diese eine Straße, und die nächste Stadt lag wenigstens zwei Stunden Fahrt entfernt. Die nächste richtige Stadt eine Tagesreise.
Er sank in sich zusammen. Er hatte sich alles so sorgfältig zurechtgelegt, und am Anfang schien es auch nach Plan zu laufen, aber jetzt gerade kam ihm das ganze Unternehmen völlig aussichtslos vor, ja, geradezu lächerlich angesichts der Übermacht, gegen die er antrat. Selbst wenn der Fehler, der ihm an der Tankstelle passiert war, ohne Folgen blieb und sie noch einmal davonkamen, war es doch nur eine Frage der Zeit, bis…
Ein dumpfes, wummerndes Geräusch, das ganz allmählich immer lauter wurde, ließ Christopher aufschrecken.
»Kyle!«, rief Serenity. »Ich glaube, der Motor spinnt wieder.«
»Das ist nicht der Motor«, rief Kyle zurück. »Das kommt von woanders. Von draußen.«
Christopher hatte sich schon umgedreht und blickte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Da, noch ganz weit weg, am Horizont: dunkle Punkte, zwei, drei, vier. Dunkle Punkte am Himmel, die rasch näher kamen und die die Quelle des Geräuschs waren.
»Hubschrauber«, sagte er.
3
Jeden Tag in den letzten Wochen hatte er mit einem Moment wie diesem gerechnet, hatte sich davor gefürchtet, hatte alles getan, um ihn zu vermeiden. Er hatte erwartet, dass ihn die Angst in dem Augenblick, in dem es geschah, überwältigen würde, aber zu seiner Verblüffung war genau das Gegenteil der Fall: Auf einmal, endlich, erfüllte ihn eine geradezu unwirkliche Ruhe. Als hätte es keinen Zweck mehr, noch länger Angst zu haben.
Und außerdem hatte er recht behalten! Auf eine seltsame Weise beruhigte ihn das, trotz der Gefahr, die auf sie zukam. Weil es hieß, dass er doch noch verstand, wie das alles funktionierte. Dass er besser wusste als die anderen, was sich hinter den Kulissen abspielte.
»Chris?«, rief Kyle nach hinten. »Ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst, die kommen wegen dir, hab ich recht?«
»Klar«, sagte Christopher.
»Yeah!« Kyle versetzte seinem Lenkrad einen Schlag. »Die Luftwaffe der Vereinigten Staaten von Amerika zieht in den Krieg gegen Christopher Kidd, den Milliardenhacker. Das hätte ich mir doch gleich denken können.«
Christopher musterte die flachen Erhebungen, die allmählich rechts und links der Straße auftauchten, noch keine richtigen Berge, eher Hügel. »Falls du hier irgendwo eine Stelle kennen solltest, wo man sich verstecken kann, eine Höhle oder so was…«
»Spinn dich aus, Mann. Bei Reno ist ein Stützpunkt der Nationalgarde; die machen hier regelmäßig ihre Übungen. Das ist ganz normal.«
»Über der einzigen Straße weit und breit?«, fragte Christopher zurück. »Ist das auch ganz normal?«
Darauf sagte Kyle nichts, sondern verdrehte den Kopf, um die Hubschrauber im Rückspiegel sehen zu können. Zum ersten Mal wirkte er irritiert.
Das Dröhnen wurde immer lauter. Die schwarzen, unheimlichen Flugmaschinen kamen schnell näher.
»Kyle!«, rief Serenity angstvoll. »Ich glaub nicht, dass das eine Übung ist.«
Sie waren gerade an einer Stelle, an der eine – kaum erkennbare – Schotterpiste quer zur asphaltierten Straße in das hügelige Wüstenland abging. Kyle riss das Steuer herum und gab Gas, jagte den Wagen mit voller Kraft über Geröll und Schlaglöcher quer zu ihrer bisherigen Richtung davon, auf die Hügel zu.
Keine Sekunde zu früh. Auf der Straße, an der Stelle, an der sie im nächsten Moment gewesen wären, spritzte Asphalt auf, und einen Sekundenbruchteil später hörten sie die Schüsse.
4
Die Hubschrauber donnerten hinter ihnen vorbei, große schwarze Maschinen, die aussahen wie riesige Insekten aus Stahl, wie Dinge aus einem schrecklichen Albtraum. Alles erzitterte von dem Lärm ihrer Triebwerke und Rotoren, dann waren sie vorüber und ließen nur eine Wolke aus Staub zurück, die das Auto einhüllte und ihnen gnädig die Sicht nahm.
»Fuck!«, stieß Kyle hervor, das wild bockende Lenkrad umklammernd. »Was zum Teufel war denn das?«
»Kyle!« Serenitys Stimme klang ungewohnt hell und hoch. »Tu doch was!«
»Ah, ja, und was?« Ihr Bruder betrachtete Christopher im Rückspiegel. »Wenn ich geahnt hätte, was für einen gefährlichen Passagier ich da befördere…«
»Ich hab’s euch die ganze Zeit gesagt«, erwiderte Christopher.
Wobei das jetzt auch keine Rolle mehr spielte. Er sah hektisch umher, suchte die Einöde ringsum ab, all das Geröll und Gestein und das karge, vertrocknete Gestrüpp hier und da, und das, so weit das Auge reichte. Doch es gab kein Entkommen. Nicht einmal eine Höhle würde ihnen jetzt noch Schutz bieten. Nun, da die Hubschrauber wussten, wo sie waren, würden sie darin nur zum Ziel von Raketen werden.
Die Maschinen flogen eine weite Kurve, formierten sich zum nächsten Angriff.
»Das gibt’s doch gar nicht«, stieß Kyle zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.
Und schon waren die Hubschrauber wieder hinter ihnen.
Wieder war dieses eklige Gewehrfeuer zu hören, dieses maschinenhafte Klack-Klack-Klack. Auf der Piste verfolgten sie Linien kleiner Explosionen, schneller als sie.
»Kyle!«, schrie Serenity.
Kyle riss das Steuer herum, doch diesmal konnte er nicht verhindern, dass sie getroffen wurden: Das Auto erzitterte unter mehreren Einschlägen, die eine Reihe grauer Krater hinterließen, die schräg über dem Kofferraum liefen.
Dann donnerten die Hubschrauber direkt über sie hinweg, so dicht und laut, dass man das Gefühl hatte, der Lärm zerbrösele einem die Zähne im Schädel.
»Verfluchte Scheiße!«, schrie Kyle. Jetzt hörte man, dass auch er Angst hatte. »Die wollen uns umbringen, verdammt noch mal!«
Christopher ließ sich tiefer in den Sitz sinken.
»Nein«, sagte er. »Mich. Nur mich.« Er hatte nicht den Eindruck, dass die beiden ihn hörten. Kyle fluchte noch immer vor sich hin, und seine Schwester wimmerte leise. Sie schienen beide völlig vergessen zu haben, dass er überhaupt da war.
Christopher hatte auch Angst. Er wusste nur nicht, wovor er mehr Angst hatte: Davor, dass die Hubschrauber erreichten, was sie sich unmissverständlich vorgenommen hatten, oder vor dem, was er dagegen tun konnte. Vor dem, was immer unausweichlicher wurde.
Die vier Maschinen flogen wieder einen großen Kreis, setzten sich erneut auf ihre Fährte für die nächste Runde dieses Katz-und-Maus-Spiels.
Kyle stieg auf die Bremse, riss das Steuer herum, wendete den Wagen in die Richtung, aus der sie gekommen waren. »Es hat keinen Zweck, denen davonfahren zu wollen«, rief er. »Die sind ja doch schneller. Vielleicht bringt es sie aus dem Konzept, wenn ich ihnen entgegenfahre.«
Damit gab er Gas, und der Wagen schoss ungestüm schaukelnd über die Piste, über Schlaglöcher und Felsbrocken, direkt auf die anfliegenden Hubschrauber zu.
Wieder Schüsse. Diesmal konnten sie das Mündungsfeuer sehen.
Wieder zwei Linien einschlagender Kugeln, die rasch näher kamen wie aufgereihte, winzige Vulkane, die einer nach dem anderen ausbrachen, Steinchen und Staub nach allen Richtungen spritzend…
Kyle riss das Steuer herum, im letzten Moment und wieder einen Augenblick zu spät: Ein paar Kugeln trafen mit einem ausgesprochen hässlichen Geräusch die Motorhaube, ließen den Wagen erbeben.
Und erneut brausten die Fluggeräte über sie hinweg, noch tiefer und lauter als das letzte Mal.
Schaukelnd kam der Wagen zum Stehen. Christopher begriff, dass die plötzliche Stille nicht bedeutete, dass er von dem Lärm taub geworden war: Der Motor lief nicht mehr.
»Das darf jetzt nicht wahr sein«, hörte er Kyle murmeln, der die Hand am Zündschlüssel hatte, den Anlasser betätigte, wieder und wieder und ohne dass der Motor auch nur den kleinsten Mucks tat. »Das darf jetzt einfach nicht wahr sein…«
Die Hubschrauber trennten sich, flogen jeder für sich große Kreise. Es sah aus, als beabsichtigten sie, das Auto nun aus allen vier Himmelsrichtungen in die Zange zu nehmen.
»Komm schon«, beschwor Kyle den Motor, doch man hörte nur, wie sich der Anlasser drehte und drehte, ein jammerndes, aussichtslos klingendes Geräusch.
Christopher nahm seine Armbanduhr ab, beugte sich zu Serenity hinüber und hielt sie ihr hin. »Ich will etwas versuchen«, sagte er. »Ich muss dazu die Augen zumachen, und du musst …«
»Was?«, versetzte sie, als habe er sie aus einem seltsamen Traum aufgeschreckt. Sie bebte am ganzen Leib und versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. »Was hast du vor?«
»Ich hab keine Zeit, dir das zu erklären«, sagte Christopher und drückte ihr seine Uhr in die Hand. »Schau auf den Sekundenzeiger, und weck mich in genau dreißig Sekunden wieder. Egal, was geschieht: Dreißig Sekunden! Keinen Augenblick später. Hast du das verstanden?«
Die Hubschrauber gingen auf Angriffskurs.
»Dreißig Sekunden«, wiederholte Serenity mit hohler Stimme.
»Genau«, sagte Christopher, ließ sich zurücksinken und schloss die Augen.
5
Es wurde dunkel und doch nicht dunkel. Licht, das kein Licht war, durchwogte die Dunkelheit, die keine Dunkelheit war. Blitze aus Informationen zuckten aus dem Irgendwo ins Anderswo, Wetterleuchten aus Daten erhellte den Raum jenseits aller Sinne.
Das Feld war da, genau, wie er es erwartet hatte. Er hatte nur nicht erwartet, dass es so stark sein würde. Es wuchs noch schneller, als er gedacht hatte.
Das Feld war da, und es bemerkte ihn. Er spürte Erschrecken, das sich ausbreitete wie eine Welle, bemerkte Identifikation – und kaum war er identifiziert, begann die Jagd.
Imaginäre Mauern wuchsen, um ihn zu umschließen; virtuelle Fallen stellten sich ihm in den virtuellen Weg; Abwehreinheiten kamen von allen Seiten wie Immunzellen eines Körpers, um sich auf ihn zu stürzen und ihn als feindlich zu vernichten.
Doch er bewegte sich so schnell wie ein Gedanke, übersprang die Mauern, wich den Fallen aus, entschlüpfte der Abwehr, umging alle Hindernisse, glitt an Kontrollposten vorbei, unbemerkt, unaufhaltsam, raste weiter und weiter.
Ein Kommunikationsknotenpunkt. Im Nu war er in den Steuereinheiten der Hubschrauber, legte sie lahm, schaltete sie aus, gab verheerende Kommandos. Ein peripherer Teil seiner Aufmerksamkeit registrierte, dass es sich bei einigen dieser Steuereinheiten um Menschen handelte, doch das spielte in diesem Moment keine Rolle: Die Maschinen stürzten vom Himmel. Zerstörung. Tod.
Und Stille.
Nun, da das Vorhaben verwirklicht war, hatte die Jagd auf ihn aufgehört, galt er nicht länger als Feind. Warum? Er wusste es nicht. Er hätte zurückkehren können, doch er begann zu vergessen, wohin eigentlich. Das, was sein Bewusstsein war, seine Identität, veränderte sich…
… franste an den Rändern aus…
… vergaß.
Zurückkehren? Wozu? Um wieder allein zu sein? Einsam? In einem sinnlosen, hoffnungslosen Leben gefangen?
Es gab keine Feindseligkeiten mehr gegen ihn. Eigentlich hatte es sie nie gegeben, er hatte das nur falsch verstanden. Da war nur Akzeptanz. Er gehörte zu ihnen, war willkommen. Er musste nicht länger flüchten. Alles war ihm verziehen. Er würde nicht mehr länger allein sein und unter seiner Einsamkeit leiden müssen. Es gab hunderttausend Arme, in die er sich werfen durfte, die ihn willkommen hießen, in denen er sich auflösen konnte…
Jemand schüttelte ihn, riss ihn roh von der Schwelle zum Paradies zum Nirvana zurück. So dicht vor der Erlösung war er gewesen, doch vergebens, vergebens, vergebens…!
Das Feld schrie, als er gezwungen war, es zu verlassen.
6
Ein Gesicht nahm vor seinen Augen Gestalt an, das sommersprossige Gesicht eines Mädchens mit einer löwenartigen sandfarbenen Lockenmähne. Der Name fiel ihm wieder ein. Serenity Jones.
Christopher hustete, sein Hals war trocken. »Das waren mehr als dreißig Sekunden«, stieß er hervor, immer noch erfüllt von bleischwerer Trauer und schmerzender Sehnsucht, die sich einerseits wie Gift in seinen Adern, in jeder Zelle seines Körpers anfühlten – andererseits auch wieder nicht…
»Was… was war das?«, flüsterte sie, die Augen vor Entsetzen weit geöffnet.
Er konnte einfach zurückkehren. Er musste nur die Augen schließen, sie einfach zumachen…
Christopher stemmte sich hoch, riss ihr die Armbanduhr aus der Hand. Natürlich. Er war mehr als eine volle Minute weg gewesen, vielleicht sogar noch länger! Hinter seiner Stirn pochte es, ein Schmerz, als renne eine Armee mit einem Rammbock gegen ein Burgtor an.
»Hat es wenigstens funktioniert?«, fragte er.
»Funktioniert?« Sie klang wie ein Echo.
Er hob den Kopf und spähte aus den Fenstern. In jeder Himmelsrichtung lag ein rauchender Trümmerhaufen zwischen Felsen und Geröll.
»Warst du das?«, wollte Kyle wissen.
Christopher nickte. »In gewisser Weise.«
»Sie sind von allen Seiten gekommen«, brach es aus Serenity heraus. »Ich dachte wirklich, jetzt ist es aus, jetzt bringen sie uns um… Und dann haben sie auf einmal alle abgedreht, angefangen zu taumeln und sind abgestürzt! Wie ist das möglich? Was hast du gemacht?«
Christopher sah die Angst in ihrem Blick und fragte sich auf einmal, ob die Hubschrauberpiloten wirklich vorgehabt hatten, sie zu töten. Ob das alles nicht vielmehr ein Manöver gewesen war, das ihn dazu hatte verleiten sollen, das Feld zu betreten. Es hätte ja beinahe geklappt: Noch ein wenig länger, und er wäre nicht mehr zurückgekommen, wäre der Verlockung erlegen.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Christopher.
Kyle musterte ihn skeptisch. »Die Frage ist, was uns das nützt. Wahrscheinlich dauert es nicht lange, bis die Nächsten auftauchen, oder? Und dann? Wie oft kannst du das machen, was immer du gemacht hast?«
Christopher dachte an den Weg, den er durch das Feld zurückgelegt hatte, an die ungeheure Fülle an Informationen, die er dabei durchquert hatte. Er erinnerte sich vage an etwas…
»Erst mal kommen keine mehr«, sagte er. »Heute jedenfalls nicht.«
»Bist du sicher?«
Eine vage, verblassende Erinnerung an Diagramme, Landkarten, Punkte, die sich bewegten. »Ziemlich.«
Kyle drehte sich herum, stieß die Wagentür auf. »Okay. Das nützt uns aber auch nichts, wenn das Auto nicht mehr fährt.«
Er stieg aus, öffnete die Motorhaube und machte sich darunter zu schaffen. Das Auto stand in Richtung der Sonne, sodass die Motorhaube einen Schatten warf. Die Einschusslöcher darin leuchteten wie dicke Sterne. Ein heißer Wind kam durch die offen stehende Tür. Ohne Klimaanlage fühlte sich das Innere des Wagens wie ein Backofen an.
Kyle kehrte zurück. Seine Schritte knirschten im Sand. »Mit viel Glück ist es nur ein Leck in der Benzinleitung«, sagte er, beugte sich zum Handschuhfach hinüber, holte eine Rolle Klebeband und ein Messer heraus und verschwand wieder hinter der Motorhaube.
»Du hast uns nicht alles erzählt«, sagte Serenity nach einer Weile.
»Nein«, sagte Christopher. »Ich hab euch nicht alles erzählt.«
»Dann solltest du das vielleicht allmählich nachholen.«
Kyle ließ die Motorhaube zuknallen, warf die Klebebandrolle und das Messer achtlos auf den Beifahrersitz und schwang sich wieder hinters Steuer.
»Wie gesagt«, meinte Christopher, »das ist eine sehr lange Geschichte.«
»Wir haben Zeit«, sagte Kyle. Er betätigte den Anlasser. Seine Reparatur schien erfolgreich gewesen zu sein, der Motor sprang an, spuckend und unrund, aber er lief. Das Auto setzte sich in Bewegung, rollte langsam und bedächtig in Richtung der Asphaltstraße, und es fühlte sich an, als würden sie auch so langsam und bedächtig weiterfahren müssen. »Viel Zeit, wie es aussieht«, setzte Kyle hinzu.
Christopher seufzte. »Also gut. Ich erzähl’s euch.«
7
»Mein Großvater – der Vater meiner Mutter – war Prothesenmacher«, begann Christopher zu erzählen.
Er spürte Traurigkeit in sich aufsteigen bei diesen Worten, nein, eigentlich eher bei den Erinnerungen, die sie in ihm auslösten. Es war erst ein Jahr her, dass seine Großeltern gestorben waren, und er hatte sich immer noch nicht daran gewöhnt, dass sie nicht mehr da waren.
Ihm kam es immer noch so vor, als könne er jederzeit wieder zu seinem Großvater in die Werkstatt gehen. Dort würden dann all die künstlichen Gliedmaßen in den verschiedensten Stadien der Herstellung hängen oder liegen – Arme, Beine, Hände, Teile von Gesichtern mit Glasaugen oder Ohren oder beidem.
Die Prothesen begannen ihre Existenz als Gerüste aus Metallröhren, Scharnieren und Anschlüssen, die nach und nach um weitere mechanische Elemente, um Hydraulikzylinder und Motoren ergänzt wurden, als ginge es darum, ein Teil eines Roboters zu bauen. Irgendwann wurde die Technik unter immer mehr Schichten verschiedener Kunststoffe verborgen, bis sie die genau richtige Form hatten, abgestimmt auf denjenigen, der die Prothese benötigte, und schließlich wurde sie mit dem letzten, dem teuersten und aufwendigsten Überzug versehen, der künstlichen Haut, die so gefärbt und mit Haaren aus Plastik versehen wurde, dass die Prothese aussah wie ein richtiger, bloß eben abnehmbarer Körperteil.
Erst dann, wenn die Prothesen fertig waren, fand Christopher ihren Anblick gruselig. Wie sie in großen, mit Stoff ausgelegten Schachteln lagen und aussahen, als könnten sie jeden Augenblick anfangen, sich zu bewegen. Als Kind hatte Christopher manchmal einfach dagestanden, reglos, mucksmäuschenstill, und gewartet: Vielleicht, so hatte er gedacht, würden sie seine Anwesenheit irgendwann vergessen und aufhören, sich tot zu stellen. Dann würden die Finger sich bewegen, die Zehenspitzen wippen, die Glasaugen umherblicken und die Münder – ja, sogar Münder hatte sein Großvater machen müssen, ganze Unterkiefer manchmal – anfangen, zu reden und ihr Leid zu klagen.
Auch wenn das nie geschehen war, hatte Christopher nie wirklich aufgehört, darauf gefasst zu sein.
An einer großen Pinnwand neben der Tür der Werkstatt hatten Fotos der Patienten gehangen, für die die Prothesen bestimmt waren – Menschen, denen ein Arm fehlte oder ein Bein, entweder das ganze Bein oder der Unterschenkel vom Knie abwärts, Menschen, deren Gesichter verstümmelt waren von schrecklichen Wunden.
Sein Großvater hatte Christopher nie die Schicksale dieser Leute verschwiegen. Manchmal waren Krankheiten schuld daran, dass Menschen Gliedmaßen oder andere Teile ihres Körpers einbüßten, meistens aber waren Unfälle die Ursache, und durchaus nicht irgendwelche. Es gab ein Wort dafür, das sich Christopher schon als kleines Kind tief eingeprägt hatte: Landminen.
»Wir Menschen«, hatte sein Großvater immer gesagt, und sein buschiger Oberlippenbart hatte dabei voller Empörung gewippt, »haben viele schreckliche Dinge erfunden, aber Landminen gehören bestimmt zu den allerschrecklichsten.«
Und dann hatte er von Splitterminen und Tellerminen erzählt, von Ländern wie Kambodscha und Afghanistan, in denen Millionen dieser Selbstschussanlagen irgendwo versteckt in der Erde lagen und nicht zwischen Krieg und Frieden, zwischen Freund und Feind unterschieden; zwischen spielendem Kind und bewaffnetem Soldat. Er berichtete von Millionen unschuldiger Opfer und den vergeblichen Bemühungen der UNO und zahlreicher Hilfsorganisationen, der Lage Herr zu werden.
Christophers Großvater war oft für die Bundeswehr in diesen Ländern unterwegs gewesen, es kam aber auch vor, dass Landminenopfer, die in Deutschland Asyl beantragt hatten, zu ihm in die Werkstatt gebracht wurden, um genau vermessen zu werden, und später noch einmal, damit er ihnen das neue, künstliche Körperteil anpasste. Das waren Menschen gewesen, die fremdartig ausgesehen und fremde Sprachen gesprochen hatten, so fremd, dass sie oft von einem Übersetzer begleitet werden mussten, obwohl Großvater viele Sprachen verstand.
Wenn Kinder kamen, die englisch sprachen, bat sein Großvater Christopher oft in die Werkstatt, um ihnen die Angst zu nehmen. Christopher war zweisprachig aufgewachsen, sein Vater war Engländer und hatte mit ihm zeit seines Lebens nur englisch gesprochen. Als Christopher noch sehr klein gewesen war, hatte er gemeint, jeder Mensch habe seine eigene Sprache; es war ihm lange seltsam vorgekommen, dass noch andere Leute die Sprache seiner Mutter verwendeten.
Nicht alle der Kinder, die von seinem Großvater ein neues Bein oder eine neue Hand angepasst bekamen, waren darüber unglücklich. Christopher erinnerte sich an einen Jungen aus Somalia namens Pali, der ungeheuer stolz auf seine künstliche linke Hand gewesen war. Er meinte, sie sei viel besser als eine normale. Er lud Christopher ein, ihn in dem Heim zu besuchen, in dem er zusammen mit anderen Kindern aus aller Welt wohnte, und dort übten sie gemeinsam, Bälle zu werfen, kleine und große.
Großvater ärgerte sich über Palis Begeisterung. »Eine künstliche Hand wird niemals auch nur genauso gut sein wie die echte, ganz zu schweigen davon, dass sie besser sein könnte«, erklärte er. Er war zwar stolz auf seine Arbeit und durchaus davon überzeugt, die besten Prothesen der Welt zu machen, aber zufrieden – zufrieden war er niemals. Er versuchte unentwegt, immer noch bessere künstliche Gliedmaßen herzustellen, experimentierte und bastelte an der Mechanik, erprobte neue Hydraulikzylinder, andere Motoren, flexiblere Gelenke und feilte unablässig an elektronischen Steuerungen, die in seinen Augen nie genug konnten und das, was sie konnten, nicht genau genug taten.
Geld verdiente Christophers Großvater mit seinem Beruf wenig, zumal er seine Experimente oft aus eigener Tasche finanzierte, immer in einem schier aussichtslosen Kampf gegen Krankenkassen und Behörden, die die notwendigen Mittel nicht aufbringen wollten, schon gar nicht für mittellose Flüchtlinge, deren Asyl noch nicht einmal genehmigt war. Nur zu oft vertraten sie den Standpunkt, dass einem Menschen, sobald er sich nur irgendwie wieder ohne Krücken fortbewegen konnte, bereits geholfen war.
Und so hatten Christophers Großeltern nie viel Geld. Ihr einziger wertvoller Besitz war das große Haus in einem der besten Viertel Frankfurts, doch dort fiel es dadurch unangenehm auf, dass es nach und nach verfiel, weil es am Geld für nötige Reparaturen mangelte.
Christophers Großmutter war Malerin. Oder besser gesagt: Sie malte, verkaufte aber so gut wie nie etwas, und wenn, dann nicht für nennenswert viel. Sie hatte ein weitläufiges, lichterfülltes Studio im Erdgeschoss gegenüber der Werkstatt, von dem aus es in den Garten ging. Sie malte ausschließlich Blumen und Vögel, und von beidem hatte der verwilderte Garten mehr als genug zu bieten.
Christopher hatte auch viel Zeit bei ihr und ihren riesigen, nach Farbe duftenden Leinwänden verbracht und ihr dabei zugesehen, wie sie mit sachten, hingebungsvollen Pinselstrichen malte. In diesen Momenten war sie ihm immer, trotz ihres farbverschmierten Kittels, wie eine feine Dame vorgekommen, und dass es sich nicht gehört hätte, sie zu stören oder auch nur mit einer Frage zu unterbrechen, war die selbstverständlichste Sache der Welt gewesen.
Einige Male hatte sie ihre Werke in Ausstellungen gezeigt, sich aber oft einfach nicht von Bildern trennen können. Es war ihr immer nur ums Malen gegangen, nicht darum, Geld zu verdienen.
Christophers Mutter war ganz anders als ihre Eltern. Vielleicht lag es an dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen war, aber für sie war Geld so wichtig, dass sie es zu ihrem Beruf machte. Sie absolvierte eine Banklehre, studierte später Finanzwirtschaft und war, als sie den Mann kennenlernte, der Christophers Vater werden sollte, eine der wenigen Frauen im Devisenhandel des großen Frankfurter Bankhauses, in dessen Computerabteilung er zu der Zeit arbeitete.
Deswegen blieb, sobald Christopher auf der Welt war, sein Vater zu Hause, um sich um ihn zu kümmern. Als Christopher etwas größer war, gründete sein Vater eine eigene kleine Softwarefirma, die er von zu Hause aus betreiben konnte, und wenn er einmal zu Kunden musste – was nicht allzu oft vorkam, denn so richtig gut lief seine Firma nie –, waren die Großeltern immer verfügbar, um auf ihn aufzupassen. Und ab und zu ließen sie sich auch das nötige Geld aufdrängen, um das Dach der alten Villa abdichten und den Zaun erneuern zu lassen. Nur der Garten blieb so wild, wie er geworden war.
Christopher wuchs mit Computern auf. Dass er das Programmieren sehr früh lernen würde, war absehbar gewesen. Dass er allerdings schon mit acht Jahren besser programmierte als sein Vater, dass er die Fehler in dessen Programmen zu finden und Routinen mit Zugriff auf das Betriebssystem zu schreiben imstande sein würde – Funktionen, die so komplex waren, dass James Kidd Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was sein Sohn da machte –, das war nicht unbedingt vorhersehbar gewesen. Aber es erwies sich bald als recht nützlich.
Und Spaß machte es auch. Großen Spaß sogar.
So hatten die ersten vierzehn Jahre von Christophers Leben ausgesehen: das reinste Paradies auf Erden.
Bis das Unglück über die Familie Raumeister-Kidd hereinbrach.
Es begann damit, dass Großmutter erblindete.
»Also, ehrlich gesagt«, meinte Kyle an dieser Stelle, »wenn mich jetzt jemand fragen würde, was das alles mit abstürzenden Hubschraubern zu tun hat, wüsste ich keine Antwort. Aber mal so richtig gar keine.«
»Das kommt gleich«, erwiderte Christopher. »Ich habe doch gesagt, es ist eine lange Geschichte.«
8
Die Blindheit von Christophers Großmutter kam nicht schlagartig; sie begann schleichend, beinahe unauffällig, verschlimmerte sich dann aber unaufhaltsam weiter in einer Weise, dass man das Gefühl bekam, den Zeitpunkt, an dem sie endgültig nichts mehr sehen würde, auf den Tag genau vorherberechnen zu können.
Die Krankheit hatte einen komplizierten lateinischen Namen, galt als sehr selten, und über Fälle von Heilung war nichts bekannt. Es begann mit blinden Flecken, Stellen in ihrem Gesichtsfeld, die wie ausgeblendet, wie verschwunden waren – nicht Flecken von Schwärze, sondern von Nichts, so, als würde an diesen Stellen die Welt nicht existieren –, und diese Flecken wurden immer zahlreicher und größer. Man versuchte allerhand Therapien und Operationen, aber nichts half.
Das deprimierte Christophers Großmutter maßlos und erbitterte seinen Großvater ebenso sehr. »Wenn sie ihre Hand verloren hätte«, erklärte er Christopher eines Tages, »dann könnte ich ihr wenigstens eine neue machen. Ich würde ihr die beste künstliche Hand aller Zeiten machen, das kannst du mir glauben; ein Wunderwerk würde ich bauen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Aber wenn sie ihr Augenlicht verliert… Was soll ich da machen? Mit einem Glasauge ist ihr ja nicht geholfen. Und mit einer Kamera auch nicht – wo sollte ich die anschließen? An ihre Sehnerven? Das übersteigt nicht nur meine Fähigkeiten; das kann niemand auf der Welt.«
Und weil das Unglück gern in Gesellschaft kommt, passierte bald darauf das mit Christophers Virus, der die ganze Welt für ein paar Tage in helle Aufregung versetzte. Weil Christopher dafür den Computer im Büro seiner Mutter verwendet hatte, wurde sie entlassen, und deswegen und um irgendwann wieder Ruhe vor den Journalisten zu haben, deren reißerische Artikel über »Computer Kid« kein Ende nahmen, zogen seine Eltern mit ihm nach England, in ein, wie Christopher fand, ungemütliches Haus in einer hässlichen Vorstadt von London.
So unumgänglich dieser Umzug auch gewesen sein mochte, er ließ Christophers Großmutter noch weiter in Schwermut versinken.
»Warum hast du das überhaupt gemacht?«, wollte Serenity wissen. »Das mit dem Virus, meine ich.«
Christopher sah sie an. »Das ist eine andere lange Geschichte.«
Sie winkte ab. »Okay. Erzähl weiter.«
Christophers Mutter bemühte sich erst einmal nicht um eine neue Stelle; nach allem, was passiert war, war es nötig, dass zumindest einiges Gras über die Sache wuchs, ehe sie hoffen konnte, irgendwo einigermaßen unbelastet neu anfangen zu können. Deswegen lehnten sie höflich, aber bestimmt ab, als ein gewisser Richard Bryson, ein bekannter Unternehmer und Filmproduzent, sie aufstöberte und Interesse bekundete, Christophers Geschichte zu verfilmen. Er bot auch viel Geld an, aber sie lehnten trotzdem ab.
Da Mutter nun zu Hause bleiben musste, sah Vater sich in der Pflicht, einen Job zu suchen. Als er nach einigen anfänglichen Misserfolgen auf eine obskure Anzeige antwortete, kam er mit einer ebenso obskuren kleinen Softwarefirma in Kontakt, die gerade einen Programmierer suchte, und zwar für ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät der Londoner Universität in Angriff genommen werden sollte und das, wie der Zufall so spielt, zum Ziel hatte, den Bau besserer Prothesen zu ermöglichen.
Geleitet wurde das Projekt von Stephen Connery, einem Neurologen und Hirnchirurgen. Dr. Connery war ein sympathischer Junggeselle, der nur zwei Leidenschaften kannte: die Arbeit im Labor – und die freie Natur. Sein Büro glich einem Wald, so viele Topfpflanzen hatte er darin stehen, und er unternahm fast jedes Wochenende eine Wandertour mit Zelt und Rucksack, selbst bei Regen und Sturm.
Dr. Connery hatte im Labor gerade zum ersten Mal erfolgreich Neuronen – Gehirnzellen also – mit elektronischen Schaltkreisen gekoppelt. Diese Technik wollte er dahin gehend weiterentwickeln, dass man solche sogenannten neuroelektronischen Schnittstellen künftig in Prothesen einbauen konnte, um etwa die Motoren eines künstlichen Armes über genau diejenigen Nerven zu steuern, die vor dem Verlust des echten Armes dessen Muskeln gesteuert hatten. Auch sollte es diese Technik ermöglichen, Sensoren in dem künstlichen Arm mit den Nerven des Tastsinns zu koppeln, sodass man den neuen Arm nicht nur steuern, sondern auch fühlen konnte. Auf diese Weise, so die Überlegung, würde sich eine Prothese irgendwann beinahe wie ein echter Körperteil anfühlen und so ein nahezu normales Leben ermöglichen.
Keine Frage, dass James Kidd, der Schwiegersohn des Frankfurter Prothesenbauers Heinz Raumeister, bei diesem Angebot keine Sekunde zögerte, ungeachtet des damit verbundenen, eher niedrigen Gehalts. Keine Frage auch, dass sie Christophers Großvater davon berichteten und über alle Entwicklungen auf dem Laufenden hielten.
Und keine Frage, dass sie alle wissen wollten, ob auf diesem Wege womöglich eine Schnittstelle geschaffen werden konnte, die es ermöglichen würde, Blinde wieder sehen zu lassen.
Das, sagte Dr. Connery, sei eine faszinierende Frage und eher eine Frage der Soft- als der Hardware. Einen elektrischen Impuls in einen Nervenimpuls umzuwandeln, oder umgekehrt, sei tatsächlich gar nicht so schwierig – das Schwierige sei zu wissen, was der Impuls jeweils bedeute. Wolle man eine solche Schnittstelle schaffen, so gelte es zuerst zu entschlüsseln, was im Sehnerv und im Sehzentrum eigentlich vor sich ging, wenn ein Mensch etwas sah. Doch wie man das anfangen sollte, wisse er, Dr. Connery, jedenfalls nicht.
Worauf ihm James Kidd geradeheraus erklärte, das habe nichts zu besagen, schließlich sei Dr. Connery ja Neurologe, kein Computerfreak. Er hingegen sei der Vater des berüchtigten Computer Kid, des besten Hackers der Welt. Wenn jemand imstande sei, so etwas herauszufinden, dann doch wohl Christopher und er.
Das, fand Dr. Connery nicht unbeeindruckt, sei zumindest den Versuch wert.
So machten sie sich an die Arbeit. Christopher begleitete seinen Vater an freien Nachmittagen in das Labor in London, und dort brüteten sie gemeinsam an ihren Computern über den Daten, die die Versuchsaufbauten von Dr. Connery lieferten. Als klar wurde, dass sie noch jemanden brauchen würden, der über eine gewisse Fertigkeit als Programmierer in Verbindung mit einem ausgeprägten Talent als Elektronikbastler verfügte, stieß ein Kollege aus der kleinen, obskuren Firma hinzu, ein uriger Typ namens Linus Meany.
Vom Aussehen her wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, in Linus jemanden zu vermuten, der mit Computern zu tun hatte. Er war ein stämmiger, breitschultriger Typ, der mehr Tätowierungen am Leib hatte als ein Rausschmeißer einer Nachtbar und Piercings jeder Art liebte. Entlang des linken Ohrs trug er nicht weniger als vierundzwanzig verschiedene Ringe – »einen für jede Freundin, die ich hatte«, erklärte er meistens, »aber jetzt muss ich entweder heiraten oder am rechten Ohr weitermachen« –, auf dem rechten Nasenflügel einen dicken Silberstern, einen Metallstift in der Zunge (»damit kann man so herrlich spielen, wenn man über eine knifflige Subroutine nachdenkt«) und einen eingefassten Rubin auf einem Schneidezahn.
»Und noch ein paar Stifte an Stellen, die ich dir nicht zeigen kann«, fügte er normalerweise mit diabolischem Grinsen hinzu.
Außerdem behängte er sich mit jedem elektronischen Spielzeug, das neu auf den Markt kam. Ob das neueste iPod-Modell oder der letzte Schrei unter den Mobiltelefonen, ob digitales Diktiergerät, GPS-Navigator oder Minikamera, in seinen Taschen fand sich immer alles. Seine Kollegen, die zwar auch alle ziemlich schräg drauf waren, aber nicht so aussahen, zogen ihn gern mit der Frage auf, ob seine vielen Piercings eigentlich nicht den Empfang seines Mobiltelefons störten?
Dieses Team also machte sich über das Rätsel des Sehens her. Es war nicht einfach wissenschaftliche Arbeit, es war ein Hack. Nur dass sie sich nicht in irgendeine verbotene Datenbank hackten, sondern direkt ins menschliche Gehirn – zumindest in einen wichtigen Teil davon, die Kunst des Sehens.
Die Ironie an der Geschichte war die, dass zu dem Zeitpunkt, an dem sie die ersten bahnbrechenden Erkenntnisse über die in den Hirn- und Nervenzellen vorzufindenden Codes gewannen, Christophers Großmutter längst ihren Frieden mit ihrer Krankheit gemacht hatte. Sie habe ihr Leben lang malen dürfen, erklärte sie, eigentlich reiche es jetzt auch.
Kurz darauf kam aus irgendeinem Grund eine Zeitung auf die Idee, über sie zu berichten, und die Geschichte von der erblindenden Malerin führte in Verbindung mit ihren abgedruckten Bildern dazu, dass Christophers Großmutter auf ihre alten Tage noch ein wenig berühmt wurde und ihre Kunstwerke auf einmal gefragt waren. Sie war nach wie vor traurig über den Verlust ihres Augenlichts, aber sie war nicht mehr deprimiert. Eine Prothese, erklärte sie, wolle sie auf keinen Fall.
Dessen ungeachtet machten Christopher, sein Dad, Linus und Dr. Connery weiter. Denn das Fieber herauszufinden, wie ihr Problem zu lösen war, hatte sie längst gepackt und ließ sie nicht mehr los.
»Wart mal«, unterbrach ihn Kyle und nahm den Fuß vom Gas. »Da vorn stimmt was nicht.«
Christopher sah auf. »Was denn?«
»Ein Unfall, wie es aussieht.«
Knapp eine viertel Meile vor ihnen stand ein Mann mitten auf der Straße und schwenkte die Arme. Am Straßenrand waren zwei Motorräder geparkt, daneben schien jemand auf dem Boden zu liegen.
»Sieht so aus«, wiederholte Christopher leise und mit einem unbehaglichen Gefühl.
Hoffentlich sah es nicht tatsächlich nur so aus.
9
Sie hielten. Es war kein Unfall, aber ein Notfall.
Der Mann in der Lederkluft der Motorradfahrer, der an das Fenster geeilt kam, das Kyle herunterkurbelte, war nicht mehr jung; er hatte graues, langes Haar, und seine Haut sah aus wie gegerbtes Leder. Er musste über sechzig sein, mindestens.
»Meiner Frau ist auf einmal schlecht geworden«, stieß er hervor. »Das Herz, fürchte ich. Und wie’s so geht, ist natürlich der Akku meines Mobiltelefons leer. Ich hoffe, Sie können uns helfen.«
»Ein Telefon haben wir leider nicht«, erwiderte Kyle, »aber helfen kann ich Ihnen trotzdem, hoffe ich. Ich bin ausgebildeter Sanitäter.« Er wandte sich zu Christopher und Serenity um, deutete in Richtung des Kofferraums. »Gib mal die Decke von hinten her, Chris.«
Christopher drehte sich um, zog das dicke, stinkende Ungetüm hervor und reichte es Kyle.
»Rollen Sie das zusammen, und legen Sie es Ihrer Frau unter die Knie, um einem eventuellen Schockzustand vorzubeugen. Kann es einfach Wassermangel sein? Wann hat sie das letzte Mal getrunken?«
»Wasser haben wir genug dabei. Das kann es nicht sein.«
»Gut. Dann machen Sie das mit der Decke, ich komme gleich.«
Der Mann zögerte, drehte die unansehnliche Decke unschlüssig hin und her. »Also, Sie haben wirklich kein Telefon?«, fragte er ungläubig. »Meiner Frau geht es wirklich sehr schlecht.«
»Ich komme gleich und schau sie mir an«, wiederholte Kyle mit jener Mischung aus Entschiedenheit und Zuversicht, die notwendig ist, um Notfälle jeder Art zu meistern.
Der Mann nickte, dann ging er gehorsam zu seiner Frau hinüber.
Kyle drehte sich zu Christopher herum. »Eine Frage«, sagte er und sah ihn scharf an. »Ich kann natürlich nur raten, worauf deine Geschichte hinausläuft. Aber nach dem, was du vorhin mit den Helikoptern abgezogen hast – kann es sein, dass du so eine Art Internetanschluss im Hirn hast?«
Christopher nickte. »Ungefähr, ja.«
»Okay. Und sorry, ich würde deiner Erzählung nicht vorgreifen, wenn wir diesen Notfall nicht hätten. Kannst du über dieses Ding einen Notruf absenden? Eine SMS? Eine E-Mail?«
»Theoretisch ja.«
»Und praktisch?«
Christopher holte tief Luft. »Praktisch ist gerade kein Netz verfügbar«, log er.
Kyle schluckte das anstandslos. Er musterte ihn einen Moment und sah dabei aus, als komme ihm jetzt erst zu Bewusstsein, von was für einer Monstrosität sie hier redeten. Dann seufzte er und meinte: »Ich glaube, mein Vater hat recht. Die moderne Informationstechnologie ist ein Albtraum. Und wehe, man verlässt sich drauf…«
Er stieß die Tür auf, umrundete den Wagen, holte den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Kofferraum und ging damit hinüber zu der Frau. Christopher beobachtete ihn mit schlechtem Gewissen.
Dann merkte er, dass Serenity ihrerseits ihn beobachtete. Befremdet.
»Echt?«, fragte sie, als er sie ansah.
Er nickte. »Ja.«
»Im Kopf?«
»Es ist ein winziger Chip, der hinter der Nasenhöhle sitzt und mit dem Riechnerv verbunden ist.« Er hob den kleinen Finger, deckte mit dem Daumen die Hälfte des Nagels darauf ab. »So groß ungefähr.«
»Mit dem Riechnerv? Wieso das denn?«
»Das Großhirn aller höheren Lebewesen, auch das menschliche, ist aus dem Riechnerv entstanden.« Es kam ihm wie gestern vor, als Dr. Connery ihnen das erklärt hatte. »Der Vorteil ist, dass man leicht herankommt – man kann den zugehörigen Applikator, eine lange, dünne Röhre, einfach durch die Nase einführen –, und die Anbindung an den Riechnerv bedeutet, dass man es sozusagen direkt mit dem Betriebssystem des Gehirns zu tun hat.«
»Und was heißt das?«, bohrte sie weiter, unübersehbar angewidert. »Riechst du dann alles, was über diese… Schnittstelle passiert, oder wie geht das? Ich kann mir das nicht vorstellen.«
Sei froh, dachte Christopher und sagte: »Mit Riechen hat das nichts zu tun. Es ist eher… Hmm.« Wie immer kam es ihm aussichtslos vor, beschreiben zu wollen, wie es war, mit dem Feld verbunden zu sein. »Es ist sehen und hören und fühlen zugleich, und doch nichts davon. Je nachdem. Eigentlich ist es wie ein zusätzlicher Sinn, ein sechster Sinn gewissermaßen…«
Sein Blick fiel auf den Mann in der rot-grauen Motorradkluft, der sich bis jetzt mit Kyle über die Frau am Boden gebeugt hatte. Nun richtete er sich auf und entfernte sich rückwärts von den beiden, ganz langsam, einen Schritt nach dem anderen. Irgendwie sah es seltsam aus, wie er sich benahm. Irgendwie hatte Christopher ein immer schlechteres Gefühl bei der Sache.
Aber wenigstens hatte er eine Idee, was er dagegen tun konnte.
Er erklärte Serenity hastig ihren Part bei seinem Plan, dann stieg er eilig aus dem Wagen und ging zu Kyle hinüber.
Die Frau lag neben dem Motorrad am Straßenrand. Sie schien fast so alt zu sein wie ihr Mann. Sie hatte die Augen geschlossen, ihr Atem ging gleichmäßig, und ihr Gesicht sah eher rot als blass aus.
Kyle hatte ihr den Lederanzug geöffnet, hielt die Fingerspitzen an ihre Halsschlagader. Ihre Lider flatterten.
»Und?«, fragte Christopher. »Wie sieht’s aus?«
Kyle hob die Schultern. »Kein Fieber, der Puls ist normal. Keine Ahnung, warum sie ohnmächtig ist.«
Christopher ging neben ihm und der Frau in die Hocke. Aus den Augenwinkeln sah er, dass Serenity inzwischen ebenfalls ausgestiegen war und langsam näher kam, und falls sie ihm zur Abwechslung mal geglaubt haben sollte, war alles gut.
»Ich vermute«, sagte Christopher, »die Frau ist gar nicht ohnmächtig. Die spielt das nur. Lass uns weiterfahren.«
Kyle sah ihn entgeistert an, aber noch ehe er auch nur irgendwas erwidern konnte, stieß die Frau einen gutturalen Schrei aus, schoss hoch, packte Christopher und umklammerte ihn mit der Kraft eines Schraubstocks.
Der Mann hatte auf einmal einen dicken Revolver in der Hand und richtete ihn auf Kyle.
Und mit gruseliger Gleichzeitigkeit – so, als hätten die beiden jahrelang einstudiert, derlei Dinge im Chor zu sagen, mit genau der gleichen Intonation, im gleichen Stimmfall und mit identischer Lautstärke – riefen der Mann und die Frau wie mit einer Stimme: »Keiner bewegt sich!«
Falschmeldungen
10
Für Serenity begann die ganze Geschichte an dem Morgen, als ihre Mutter sie in der Küche mit den Worten empfing: »Glaub nichts von dem, was sie über deinen Vater sagen. Nichts. Kein einziges Wort ist wahr.«
»Was?«, fragte Serenity zurück. »Wer?« Sie schlief noch halb und wäre am liebsten gar nicht aufgewacht. Sie hatte von einem Jungen aus ihrer Klasse geträumt, Brad Wheeler, für den alle Mädchen schwärmten und der im wirklichen Leben kaum wahrnahm, dass sie überhaupt existierte. Sie war nun mal beim besten Willen nicht das All American Girl, auf das die Brad Wheelers dieser Welt standen.
»Alle. Im Fernsehen, in den Zeitungen, im Internet…«
Allmählich kam Serenity zu sich. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Sie begriff, dass Mutter völlig außer sich war. So etwas merkte man ihr selten an; irgendwie schaffte sie es normalerweise, immer gleich zu wirken, egal, was in ihr vorging.
»Im Fernsehen?«, wiederholte Serenity. »Sie reden über Dad im Fernsehen?«
»Sie lügen über deinen Dad im Fernsehen.«
»Und was sagen sie?«
»Kein wahres Wort. Es ist alles Betrug. Miese Propaganda, weiter nichts.«
Serenity spürte den Impuls, mit den Füßen aufzustampfen und ihre Mutter zu packen und zu schütteln. Nichts davon tat sie, aber sie schrie: »Verdammt noch mal! Was ist eigentlich los?«
Mom erstarrte, ihr Gesicht eine ausdruckslose Maske. Dann fielen ihre Schultern herab, ein schmerzvoller Ausdruck erschien in ihren Augen. »Was soll’s«, seufzte sie. »Du erfährst es ja doch.« Sie drehte sich herum und schaltete den Fernseher ein.
Es war das Topthema auf ungefähr der Hälfte aller Kanäle.
Ein Bombenanschlag auf ein Rechenzentrum in North Carolina. Zerfetzte Wände, Menschen mit rußigen Gesichtern, die durch schwelende Trümmer irrten, verletzt, die Kleidung zerrissen. Feuerwehrleute, die löschten, mit entschiedenen Handzeichen Rettungsarbeiten dirigierten, Bahren trugen.
Das Rechenzentrum habe im Auftrag der Regierung wichtige Datenbanken geführt, sagte ein Sprecher. Natürlich gebe es Backups, nichts sei verloren, der Anschlag sinnlos.
Die Bombe habe den Firmenkindergarten zum Einsturz gebracht, erklärte eine Sprecherin, die Kinder seien verletzt, viele davon schwer.
Und dann ein Bild von Dad, eine Fotografie, auf der Serenity ihn kaum erkannte, weil er darauf aussah wie ein Verrückter.
»Jeremiah Jones«, sagte ein Moderator mit sonorer Stimme, »von seinen Anhängern auch ›der Prophet‹ genannt, wurde bekannt als Autor erfolgreicher Bücher, in denen er den modernen Lebensstil anprangerte und vor den Gefahren einer überhandnehmenden Technik warnte. Weniger bekannt ist, dass er schon in jungen Jahren an teilweise gewalttätig verlaufenden Protestaktionen teilgenommen hat und dabei auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Seine letzte öffentliche Äußerung war die Erklärung, sich als Selbstversorger aufs Land zurückzuziehen, danach wurde es still um ihn – bis heute. Der Mann, der lange Zeit vielen als kluger Denker und Mahner galt, hat offenbar jene Linie überschritten, die zwischen Außenseitertum und Extremismus verläuft.«
Es existiere ein Bekennerschreiben, schloss der Sprecher den Bericht ab. Das FBI habe Jeremiah Jones in die Liste der zehn meistgesuchten Personen aufgenommen.
Jeremiah Jones, Terrorist.
Serenity spürte, wie ihre Knie nachgaben. Sie musste sich am Küchenbord festhalten und auf einen der Hocker davor setzen.
»Terrorist!«, stieß sie hervor, fassungslos.
»Sie lügen«, sagte Mom.
»Und das Bekennerschreiben?«
»Gefälscht.«
Serenity hatte das Gefühl, verlernt zu haben, wie man atmete. Sie legte die Hand auf ihre Brust, spürte ihr Herz schlagen wie eine Trommel. »Woher willst du das wissen? Die können doch so etwas nicht einfach behaupten!«
»Doch. Können sie. Tun sie. Die ganze Zeit. Sie –«
»Mom!«
Serenity hatte die Hand hochgerissen, und ihre Mutter war mitten im Satz verstummt.
»Was«, fragte Serenity mühsam, während sie spürte, wie ihr die Tränen kamen, Tränen schieren Entsetzens, »wenn es stimmt?«
11
Die Erinnerungen rollten heran wie eine Woge, spülten sie fast weg. Das Haus, in dem sie gelebt hatten, als sie ein Kind gewesen war. Das Haus aus Holz, das nach Sägemehl, Holzasche und nach den Gewürzen gerochen hatte, die Mom in der Küche in dicken Bündeln unter die Decke gehängt hatte. In der dunklen, geheimnisvollen, immer nach gutem Essen duftenden Küche mit den zerkratzten Möbeln. Der Wald, der hinter dem Haus begonnen hatte, um nicht mehr zu enden, der See, zu dem man nur gelangte, wenn man den richtigen Pfad nahm. Die Tiere, die man beobachten konnte, wenn man lange genug still liegen blieb. Rehe. Eichhörnchen. Kragenhühner. Kaninchen. Seeadler.
»Liebes…«
Ihr Bruder Kyle und sie hatten oft im Wald gezeltet, an verborgenen Stellen. Dad hatte ihnen beigebracht, wie man ein Zelt aufstellte, ein altmodisches aus gewachstem Tuch, mit Zeltstangen und Heringen. Sie hatten geangelt und ihre selbst gefangenen Fische über dem Lagerfeuer gebraten. Sie waren im See schwimmen gegangen. Serenity hatte den Matsch und Schlick des Ufers zwischen ihren Zehen gespürt. Mücken hatten sie gestochen. Einmal hatte sie einen Wolf verjagt – zumindest war sie davon überzeugt, dass es ein Wolf gewesen war; niemand außer ihr hatte das Tier gesehen. Sie erinnerte sich an glutheiße Sonne und endlosen Schnee, an klirrende Kälte, geheimnisvollen Nebel und an erfrischenden Regen. Ihre Kindheit war ein einziges Abenteuer gewesen.
»Liebes… Man kann viel Schlechtes über deinen Vater sagen, und selbst wenn man übertreibt, würde das meiste davon stimmen – aber so etwas wie das würde er niemals tun. Er würde niemals jemanden töten.«
Serenity sah ihre Mutter an, die vor ihr in die Hocke gegangen war, sie an den Händen hielt und ihren Blick suchte.
Würde er nicht? Die Erinnerung kam wie ein Blitz, der für einen Sekundenbruchteil die undurchdringliche Dunkelheit zerriss: ihr Vater, wie er in einem Berg Müll stand, den irgendjemand achtlos in einen Wildbach gekippt hatte – verfaultes Zeug in Plastikverpackungen, geplatzte Batterien, rostige Dosen, Glasscherben. Wie er fluchte und schimpfte, mit bloßen Händen das Zeug aus dem Bachlauf schaufelte und sich an irgendetwas schnitt, dass er blutete. Wie er wütend sagte, manchen Leuten würd ich’s am liebsten mit dem Baseballschläger erklären.
»Meinst du?«, fragte Serenity.
Mom lächelte wehmütig. »Ich war mit deinem Vater zusammen, seit ich fünfzehn war. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn wahrscheinlich besser als sonst irgendjemand auf der Welt.«
Serenity hob den Kopf, sah umher. Die Erinnerungen flossen wieder davon, dorthin vermutlich, wo sie sich die letzten zehn Jahre versteckt gehalten hatten. Sie war wieder hier, in ihrem heutigen Leben, saß in dieser Küche voll moderner Technik, die ihre Mutter wie aus Trotz heraus gekauft hatte, aber nie benutzte. Eine Mikrowelle mit gefühlten dreihundert Programmen. Ein Dampfgarer. Ein Espressoautomat. Der Riesenkühlschrank mit eingebautem Lagercomputer. Diese Küche war nicht mehr dunkel und geheimnisvoll, sondern hell, klar, sauber und immer so aufgeräumt, als käme jeden Moment ein Fotograf, der Bilder für einen Werbeprospekt schießen sollte.
»Wenn ich danach gefragt werde, in der Schule oder so…«, begann Serenity leise, »muss ich dann zugeben, dass er mein Vater ist?«
Mom musterte sie, zögerte merklich. Sag die Wahrheit, war stets ihre Ermahnung gewesen, ihr Motto, ihr Leitspruch.