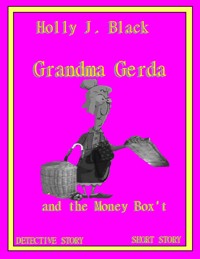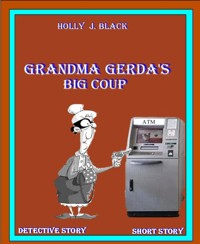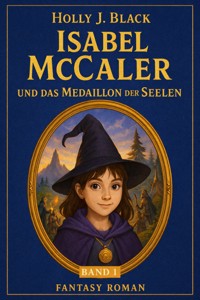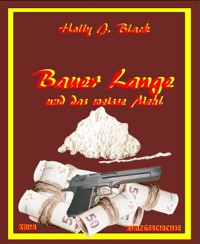4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Blood Days – Der Ring der Vampire
Ein übernatürlicher Thriller Holly J. Black
Vor Jahrhunderten kehrte ein Graf mit seiner Frau von einer geheimnisvollen Reise zurück – verändert, blutdürstig, unsterblich. Als die Dorfbewohner das Grauen erkannten, verbrannten sie die Vampire und verstreuten ihre Asche in alle Himmelsrichtungen. Das Schloss blieb verlassen – bis heute.
Vierhundert Jahre später wird das verlassene Anwesen in ein Abenteuercamp für Jugendliche umgewandelt. Auch Tommy und seine Schulklasse reisen dorthin – widerwillig. Doch was als harmloser Schulausflug beginnt, wird zum Albtraum: Tommy entdeckt einen alten Ring im Sand, der ihn sticht und in einen tiefen Schlaf versetzt. Von da an überschlagen sich die Ereignisse. Mitschüler verschwinden, Tiere werden tot aufgefunden, und ein uraltes Übel erwacht erneut.
Während Tommy und sein Freund Sklayt sich zunehmend verändern, beginnt eine neue Vampirplage das Land zu überziehen. Die Ermittlerinnen Inspector Sue McLean und Constable Molly Jonsen nehmen die Spur auf – doch sie stoßen auf Widerstand, Misstrauen und tödliche Gefahren. Als selbst die Polizei unterwandert wird, bleibt ihnen nur ein Ausweg: der direkte Kampf gegen die Dunkelheit.
„Blood Days – Der Ring der Vampire“ ist ein fesselnder Mix aus Mystery, Horror und Coming-of-Age, der die Leser in eine düstere Welt voller Geheimnisse, Verrat und übernatürlicher Bedrohungen entführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Blood Days – Der Ring der Vampire
Es begann alles nach der Rückkehr des Grafen von seiner großen Reise, die er zusammen mit seiner Gattin im Jahre 1570 unternommen hatte. Immer wieder fanden Dorfbewohner tote Tiere auf ihren Ländereien. Doch es sollte nicht nur bei den Tieren bleiben; es dauerte nicht lange, da fanden die Dorfbewohner auch junge Mädchen und Frauen tot auf. Hin und wieder waren auch junge Männer unter den Opfern. Ihre Körper waren bleich und aschgrau, und es sah so aus, als wären sie gequält worden. Immer wieder hörte man in der Nacht Schreie, die durch das Moor hallten, von den Frauen, die sie sich geholt hatten und an denen sie ihr Unwesen trieben. Die Dorfbewohner trauten sich nicht mehr, allein in der Nacht aus ihren Häusern zu gehen, geschweige denn, die Türen zu öffnen. Es ging das Gerücht um, dass aus dem Moor, welches das Dorf ringsum umgab, Monster und Ungeheuer kamen. Immer dann, wenn der Mond am höchsten stand und der Nebel sich über das Land legte, dann kamen sie. Doch irgendwann hatten die Dorfbewohner es herausgefunden: Wer für all diese grauenvollen Taten verantwortlich war. Es soll der Graf dieser Grafschaft gewesen sein, der die Frauen und jungen Mädchen getötet hatte. Man erzählte sich, dass dieser Graf die Mädchen und Frauen gequält und sich an ihnen vergangen hatte. Anschließend saugte er ihnen das Blut aus, bis sie schließlich tot waren. Wenn eine dabei war, die ihm gefiel und die willig war, ließ er sie am Leben und machte sie zu einer Untoten. Er nahm sie dann mit in sein Totenreich, und von dort aus konnten sie immer wieder auferstehen. Man erzählte sich auch, dass der Graf und sein Gefolge im Blut ihrer Opfer badeten und rauschende Feste feierten, bei denen immer mehr Opfer gebracht wurden.
Da die Morde jedoch immer häufiger und grausamer wurden, taten sich die Dorfbewohner zusammen und nahmen den Grafen mit seinem Gefolge gefangen. Anschließend führten sie einen Prozess gegen ihn und seine Anhänger und verurteilten alle zum Tode. Sie stellten ihn und seine Anhänger auf den Scheiterhaufen, den sie vor seinem Schloss aufgeschichtet hatten, und verbrannten einen nach dem anderen. Damals schwor der Graf den Dorfbewohnern Rache: Er und seine Anhänger würden wiederkehren, und dann sollte hier kein Haus verschont bleiben. Da die Dorfbewohner und die Kirchenoberhäupter jedoch Angst hatten, dass er und seine Anhänger zurückkehren könnten, verstreuten sie die Asche von ihnen im ganzen Land und auch auf dem Meer. So wollten sie verhindern, dass so etwas jemals wieder geschehen konnte. Das Schloss des Grafen zerfiel mit der Zeit immer mehr zu einer Ruine, da sich niemand traute, dort zu wohnen. Es sollte dort bei Vollmond der Tod umgehen, so erzählte man sich im Dorf. Im Schloss hörte man auch grauenhafte Schreie, wenn der Nebel am höchsten war und es in den Nächten ganz still draußen war. So blieb das Schloss über vierhundert Jahre leer und unbewohnt, bis es fast zusammengefallen war. Doch schließlich kam ein Geschäftsmann aus London, der dieses Schloss kaufte und es wieder instand setzen ließ. Heute dient das Schloss als Hotel, in dem Schulklassen oder auch Familien Urlaub machen können. Das Schloss war weit und breit als Geisterhotel bekannt, und aus diesem Grund kamen viele, um dort ihren Urlaub zu verbringen.
Vierhundert Jahre später
Es war wieder einmal ein regnerischer Sommermorgen, als Tommy zum Fenster hinübersah und beobachtete, wie die Regentropfen an der Scheibe hinabglitten. Seufzend zog er sich die Decke über den Kopf – er verspürte keinerlei Drang, aufzustehen.
Wenn er heute nicht unbedingt zur Schule gemusst hätte, wäre er einfach liegen geblieben. So aber stand er widerwillig auf und zog sich an. Tommy schlurfte ins kleine Badezimmer, das direkt neben seinem Zimmer lag, und blickte in den Spiegel, der an der Wand hing. Erst schnitt er ein paar Grimassen, dann riss er die Augen weit auf, kratzte sich am Kopf und trat näher heran.
Er öffnete den Mund, fuhr sich zweimal mit der Zunge über die Zähne und murmelte:
„Hm! Ihr seid ja noch sauber – das muss reichen.“ Anschließend nahm er seinen Kamm, fuhr zweimal durch sein kurzes, schwarzes Haar und meinte:
„Mann, siehst du wieder beschissen aus! Warum kannst du Blödmann nicht wie alle anderen früher ins Bett gehen? Selbst schuld!“ Dann wusch er sich das Gesicht, damit er etwas frischer aussah, und betrachtete sich erneut im Spiegel. Diesmal sagte er grinsend: „Na siehst du! Jetzt siehst du wieder richtig gut aus. Wenn dich die Mädchen so sehen, kann ich mich vor ihnen bestimmt nicht mehr retten.“
Als er das Bad verließ, suchte er seine alte, verlotterte Ledertasche, in der er seine Bücher und Hefte aufbewahrte. Nach längerem Suchen fand er sie schließlich, warf sie sich über die Schulter und lief die schmale, knarrende Holztreppe hinunter.
Unten rief er durch die Wohnung:
„Ma, bist du noch da? Hallo? Oder bist du schon weg?“ Keine Antwort.
Er seufzte – die letzte Frage hätte er sich auch sparen können. Wenn seine Mutter nicht da war, konnte sie ihm natürlich auch nicht antworten. Sie arbeitete im Hospital und musste immer pünktlich sein. Tommy ging in die Küche, schnappte sich das Brot vom Tisch und machte sich auf den Weg. Er war ohnehin schon spät dran. Draußen zog er die Kapuze seiner Jacke über den Kopf und stapfte los. Wie jeden Morgen lief er durch die engen Gassen seiner Heimatstadt, das Buch in der rechten Hand, in dem er las – er musste sich noch auf den Unterricht vorbereiten. So vertieft war er, dass er gar nicht bemerkte, wie ein Hund an sein Bein machte. Erst als die warme Flüssigkeit seine Haut erreichte, blickte er entsetzt hinunter und schrie:
„Du blöder Köter! Musstest du ausgerechnet mein Bein nehmen? Jetzt stink ich in der Schule nach Urin, du alte Sau!“
Seine Stimme hallte durch die schmalen Gassen. Mit zwei Fingern zog er die Hose vom Bein ab und schüttelte sie, in der Hoffnung, dass etwas Flüssigkeit herauslief.
Als er fand, dass es nun reichte, setzte er seinen Weg fort. „He, Tommy! Was ist los mit dir? Du siehst heute echt nicht gut aus!“, rief sein bester Freund Marc, als er ihn sah.
„Wieso, sieht man mir das an?“
„Na klar! Du hast bestimmt wieder die halbe Nacht gechattet, oder?“ „Naja“, grinste Tommy, „ich hab da eben eine Neue kennengelernt.“ „Ach ja? Wie heißt sie und wo wohnt sie?“
„Hm …“, machte Tommy und überlegte.
„Was ist los? Musst du etwa nachdenken?“
„Warum nicht? Ich kann mir ja nicht alles merken“, lachte Tommy. „Komm schon, wir müssen uns beeilen! Sonst verpassen wir den Bus und dürfen zur Schule laufen!“, mahnte Marc und lief schneller. Als er sah, dass Tommy trödelte, packte er ihn am Ärmel und zog ihn mit sich. Schon bald konnten sie die Haltestelle sehen.
Dort herrschte wie immer reges Treiben – viele Mitschüler warteten bereits auf den Bus.
Marc wurde sofort von seiner Freundin Susen entdeckt, die ihm lachend zurief:
„Na endlich! Ich dachte schon, du kommst heute gar nicht mehr!“ Marc antwortete erst, als er bei ihr war:
„Wie sollte ich das schaffen? Einen Tag ohne dich halte ich doch gar nicht aus.“
Er nahm sie in den Arm und küsste sie.
„Na gut“, lachte Susen, „aber man weiß ja nie – vielleicht wirst du mal krank.“
„He, he! Könnt ihr nicht mal warten, bis ihr zu Hause seid? Müsst ihr das schon hier auf der Straße machen?“, neckte Lena. „Seit wann stört dich das denn?“, konterte Tommy. „Neidisch?“ „Mag sein! Aber seit ich wieder solo bin, finde ich sowas einfach nur ekelhaft.“
„Aha – und wo ist dein Verflossener?“
„Lass mich bloß mit dem in Ruhe! Der kam doch nur, wenn er was wollte“, schimpfte sie und machte mit ihrem Kaugummi eine Blase, die laut platzte. Plötzlich fiel Meikel auf der anderen Straßenseite eine junge Frau auf – groß, rotblond, mit einem sehr kurzen Rock. Sie wollte ins Polizeirevier gehen, bückte sich aber, um einen heruntergefallenen Autoschlüssel aufzuheben.
Sofort begann ein lautes Pfeifen und Johlen – Meikel hatte die Jungs darauf aufmerksam gemacht. Nur Tommy hielt sich zurück und sah einfach nur hinüber.
Die Frau schaute unter ihrem Arm durch und zeigte den Jungs den Mittelfinger, bevor sie weiterging.
„He, was war das denn?“, rief Cliff.
„Das hast du jetzt davon!“, lachte Lena.
„Genau!“, fügte Susen hinzu. „Wenn man den Mund nicht halten kann!“ Cliff wollte noch etwas erwidern, doch da kam schon der Bus. Alle stiegen ein und suchten sich Plätze.
„Wann fährt die alte Kiste endlich los?“, rief Marc nach vorn. „Wenn’s euch zu langsam geht, könnt ihr ja laufen!“, brummte der Fahrer. „Da kommt übrigens noch einer von euren Kumpels.“
Alle blickten aus dem Fenster – es war Sklayt, der mal wieder zu spät kam. Kaum hatte er Platz genommen, fuhr der Bus los. „He, Lena! Schau mal, wer da gekommen ist!“, rief Sophie. „Na und? Interessiert mich nicht!“, fauchte Lena und drehte sich zum Fenster.
Lena wollte mit Sklayt nichts zu tun haben. Sie wusste, dass er hinter ihr her war, aber sie mochte ihn nicht. In ihren Augen war er ein Angeber, der Mädchen nur ausnutzte. Diese Meinung teilten viele – Freunde hatte Sklayt kaum.
Der Einzige, der wirklich zu ihm hielt, war Tommy. Er saß neben Lena, sah, dass sie genervt war, und sagte leise: „Lass dich nicht ärgern. Die meinen’s nicht böse – sie wissen, dass du ihn nicht leiden kannst.“
Lena sah ihn kurz an, lächelte schwach und wandte sich dann wieder dem Fenster zu. Den Rest der Fahrt schwiegen sie beide.
Der neue Chief Inspector stellt sich vor
Die junge Frau, die zuvor vor dem Polizeirevier gestanden hatte, war inzwischen hineingegangen. Nun stand sie vor einem langen Tresen und wartete auf einen Beamten. Immer wieder liefen Polizisten an ihr vorbei, doch keiner schenkte ihr Beachtung. Schließlich rief sie ungeduldig: „Hallo? Entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht einen kurzen Augenblick Zeit für mich?“
Doch niemand reagierte. Alle schienen viel zu beschäftigt zu sein. Da sie immer noch unbeachtet blieb, sah sich die junge Frau neugierig um. Irgendwo musste doch ein Durchgang im Tresen sein, durch den man auf die andere Seite gelangen konnte. Sie fand ihn schließlich, hob die Klappe an und ging hindurch.
Langsam schritt sie durch die Räume und betrachtete alles aufmerksam. Sie ging von Büro zu Büro, bis sie schließlich vor einer Glastür stand, auf der „Superintendent Roger Brodi“ geschrieben stand. Sie richtete kurz ihre Kleidung und ihr Haar, dann klopfte sie an. Keine Antwort.
Sie klopfte erneut – wieder nichts. Also öffnete sie vorsichtig die Tür und trat ein.
Sofort schlug ihr ein seltsamer Geruch entgegen – eine Mischung aus Rosenwasser und kaltem Zigarrenrauch. Die Frau verzog das Gesicht und öffnete das Fenster, um zu lüften. Wie kann man in so einem Gestank arbeiten?, dachte sie.
Noch ehe sie sich wieder umdrehen konnte, hörte sie eine tiefe Stimme hinter sich:
„Mein Fräulein, was tun Sie in meinem Büro? Und vor allem – wie sind Sie hier überhaupt hineingekommen?“
Sie drehte sich erschrocken um. Hinter ihr stand ein älterer Herr, eine dicke, selbstgedrehte Zigarre im Mund.
„Oh, entschuldigen Sie bitte, Sir! Das hier ist also Ihr Büro?“, stammelte sie verlegen.
„Ja – wenn Sie nichts dagegen haben“, knurrte er, ging zu seinem Schreibtisch hinüber und setzte sich.
„Nein, nein, natürlich nicht“, antwortete sie und trat einen Schritt zurück. Superintendent Brodi hob plötzlich den Kopf und schnupperte. Dann bemerkte er das geöffnete Fenster.
„Kein Wunder, dass ich nichts mehr von meinem Rosenwasser rieche – das Fenster steht ja offen!“, rief er mit lauter Stimme. Dann brüllte er noch lauter:
„Miss Robertson! Kommen Sie bitte sofort herein!“ Kurz darauf erschien eine junge Frau – sehr schlank, mit streng zurückgebundenem Haar und einer Nickelbrille auf der Nase. Sie trug einen roten Pullover, dazu passend leuchtend roten Lippenstift, der ihr Gesicht jedoch etwas zu hart wirken ließ.
„Was kann ich für Sie tun, Superintendent Brodi?“, fragte sie leise. „Miss Robertson, haben Sie das Fenster geöffnet, während ich drüben bei Ihrem Kollegen war?“
„Nein, Superintendent, das war ich nicht. Das würde ich mich gar nicht trauen.“
„Nun gut – aber würden Sie es bitte wieder schließen?“ Da trat die Fremde neben der Tür vor.
„Entschuldigen Sie bitte, Superintendent Brodi. Das war ich. Ich habe das Fenster geöffnet.“
„Wie bitte? Sie? Und wer sind Sie überhaupt? Miss Robertson, bringen Sie diese Dame bitte hinaus – am besten gleich ganz aus der Wache!“
„Ja, Superintendent Brodi, sofort“, sagte Miss Robertson und trat auf die Fremde zu.
„Kommen Sie, bitte – Sie können hier nicht einfach so durch die Räume laufen“, sagte sie streng und nahm die Frau am Arm. Doch diese entgegnete ruhig:
„Moment! Ich bin der neue Chief Inspector – mein Name ist Sue McLeane. Ich wurde hierher versetzt und soll mich heute vorstellen.“ Superintendent Brodi blinzelte verwirrt.
„Der neue Chief Inspector? Und niemand hat mir etwas davon gesagt?“ „Da bin ich jetzt auch überfragt, Sir“, murmelte Miss Robertson und ließ den Arm der Fremden los.
„Hm … Sie sind also unsere neue Inspektorin?“, sagte Brodi schließlich und kratzte sich an der Stirn. Dann stand er auf, musterte sie von Kopf bis Fuß und zog genüsslich an seiner Zigarre.
„Hören Sie, Miss McLeane – sollten Sie morgen hier zum Dienst erscheinen, bitte ich Sie, sich etwas angemessener zu kleiden. Ich habe nichts gegen Freizügigkeit, aber so werden Sie wohl kaum anfangen wollen, oder?“
Er ließ den Blick auf ihren kurzen Rock und ihre langen Beine sinken. „Nein, Sir! Ich besitze durchaus noch andere Kleidung. Außerdem wollte ich heute eigentlich noch gar nicht anfangen – wenn es Ihnen recht ist“, antwortete Sue ruhig.
„Und warum sind Sie dann schon hier, wenn Sie Ihren Dienst gar nicht antreten wollen?“
„Nun, Sir – ich habe meinen Jahresurlaub noch nicht genommen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne ein oder zwei Tage davon nutzen. Ich muss mir noch eine Wohnung suchen und ein paar Dinge erledigen. Momentan wohne ich noch im Hotel.“
„Sie haben also noch keine Wohnung?“
„Nein, Sir.“
„Gut, dann nehmen Sie sich die Zeit. Aber lassen Sie mich Sie gleich Ihren neuen Kollegen vorstellen.“
Er führte sie in einen Nebenraum. Dort saßen mehrere Polizisten an ihren Schreibtischen: der ältere Constable Wiljms, der kurz vor der Pension stand, der junge Jack O’Brein, der gerade erst seine Prüfung bestanden hatte, sowie Fränk Miller, Molly Jonsen und Ellen Hunter. Auch die Schreibkraft Katie Robertson war dort.
Superintendent Brodi räusperte sich laut:
„Darf ich mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten!“ Alle sahen auf.
„Ich möchte Ihnen unseren neuen Chief Inspector vorstellen – Miss Sue McLeane.“
Ein leises Murmeln ging durch den Raum. Niemand hatte damit gerechnet, dass der neue Chief Inspector eine Frau sein würde – und dazu noch eine so attraktive.
Nachdem Brodi sie vorgestellt hatte, wünschte er allen eine gute Zusammenarbeit, zog an seiner Zigarre und verschwand wieder in seinem Büro.
Constable Molly Jonsen bot der neuen Inspektorin einen Kaffee an, und bald entspann sich ein erstes Gespräch. Die männlichen Kollegen konnten den Blick kaum von ihr abwenden – so eine Kollegin hatte es hier noch nie gegeben. Erst als Molly sie tadelnd anstarrte, wandten sie sich wieder ihrer Arbeit zu.
Nach einer guten Stunde verabschiedete sich Sue McLeane von ihren neuen Kollegen. Auf dem Weg nach draußen hörte sie, wie einer der Männer leise flüsterte:
„Bei der wär ich auch gern der Rock“, und ein Pfeifen folgte. Draußen rief plötzlich eine Stimme hinter ihr:
„Erkennst du mich nicht mehr?“
Sue drehte sich um. Es war Constable Molly Jonsen. „Wieso sollte ich Sie kennen?“, fragte Sue überrascht. „Warum nicht? Ich hab dich doch sofort wiedererkannt! Du bist doch die kleine Sue, die immer bei ihrer Oma war! Ich bin Locken-Molly – die Nachbarin deiner Oma!“
Sue blinzelte – und dann lächelte sie.
„Natürlich! Jetzt, wo du’s sagst!“
Sie trat zu Molly, umarmte sie herzlich und lachte. „Wir haben uns ja ewig nicht gesehen! Wohin seid ihr damals eigentlich verschwunden?“
„Mein Vater hat in einer anderen Stadt ein Geschäft eröffnet. Wir mussten ganz plötzlich umziehen – ich konnte deiner Oma gar keine Nachricht mehr schicken.“
„Mann, ist das schön, dich wiederzusehen!“, sagte Sue und drückte sie noch einmal.
„Ich freu mich auch, Sue“, antwortete Molly.
„Bitte, bleib beim alten Namen – ich bin doch immer noch die Gleiche.“ „Wenn’s dir recht ist, gerne.“
Sue warf einen Blick auf ihre Uhr.
„Oh, schon so spät! Ich muss los. Hör zu – komm mich doch heute Abend im Hotel besuchen. Dann können wir in Ruhe weiterreden.“ Sie gab Molly die Adresse ihres Hotels und machte sich auf den Weg. Molly ging wieder hinein und nahm ihre Arbeit auf – ohne jemandem zu erzählen, dass sie und der neue Chief Inspector alte Freundinnen waren. Sue McLeane dagegen kehrte in ihr Hotel zurück, machte es sich bequem und begann, in der Zeitung nach einer Wohnung zu suchen.
In der Schule
Auch Tommy und seine Freunde waren inzwischen in der Schule angekommen. Sie saßen bereits in ihrem Klassenzimmer und warteten auf ihre Lehrerin, Miss Kellingen. Doch an diesem Morgen ließ sie ungewöhnlich lange auf sich warten.
Je mehr Zeit verging, desto lauter wurde die Klasse. Jeder tat, was ihm gerade einfiel, und das Stimmengewirr schwoll immer weiter an – bis plötzlich eine tiefe, scharfe Stimme durch den Raum hallte. „Aber hallo, hallo! Was geht hier denn vor sich?“ Im selben Augenblick saßen alle Schüler wie versteinert auf ihren Plätzen. Kein Laut war mehr zu hören. Sie wussten genau, was ihnen bevorstand, wenn sie jetzt noch ein Wort sagten – denn Mister Hobst war für seine Strenge bekannt.
„Einen schönen guten Morgen, Mister Hobst!“, riefen sie im Chor. „Auch ich wünsche euch einen guten Morgen“, erwiderte er kurz und knapp.
Er trat hinter das Lehrerpult, zog seine Brille aus der Jackentasche und setzte sie auf. Sein prüfender Blick glitt langsam durch den Raum, bevor er weitersprach:
„Ihr wundert euch sicher, warum ich hier bin und nicht Miss Kellingen.“ Niemand wagte zu antworten. Die Schüler wussten, dass man bei Mister Hobst nur sprechen durfte, wenn er es ausdrücklich erlaubte. „Nun gut“, fuhr er fort. „Ich will euch eure Fragen beantworten, bevor ihr sie überhaupt stellt. Eure Lehrerin, Miss Kellingen, ist heute Morgen auf den Stufen der Schule gestürzt. Sie befindet sich beim Arzt. Und bevor ihr fragt: Ja, wir fahren morgen früh wie geplant los – und allem Anschein nach wird auch Miss Kellingen mitkommen.“
Er sah noch einmal prüfend in die Runde. „So, und nun könnt ihr nach Hause gehen. Der Unterricht fällt heute aus.“
„Geil! Das nenne ich mal einen langen Tag!“, rief Cliff begeistert. Mister Hobst verzog keine Miene, verließ das Klassenzimmer und ließ die aufgeregte Schülerschar zurück. Kaum war er hinaus, erhob sich wieder ein munteres Durcheinander. Doch er kehrte noch einmal zurück, trat in die Tür und räusperte sich lautstark.
„Entschuldigt die Störung. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr morgen früh pünktlich am Bahnhof seid. Ich will nicht, dass einer von euch hierbleiben muss.“
„Ja, Mister Hobst, wir sind pünktlich!“, rief Lena. „Miss Gelien, wissen Sie überhaupt, wo wir uns treffen?“ „Ja, Mister Hobst – am Bahnhof, Gleis drei, um halb neun!“, antwortete sie flink, nahm ihre Schultasche und verbeugte sich leicht. „Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mister Hobst“, sagte sie höflich und verließ den Raum.
Nachdem Mister Hobst wieder gegangen war, machten sich auch die übrigen Schüler auf den Heimweg.
„He, Tommy! Was hast du jetzt vor?“, rief Marc ihm hinterher, denn Tommy war bereits ein Stück vorausgegangen. „Was wohl? Ich warte auf den Bus!“, erwiderte Tommy. „Wie wäre es, wenn wir noch eine Cola trinken gehen?“, schlug Marc vor. „Ich geb’ einen aus!“
Marc wusste, dass Tommy nicht viel Taschengeld bekam – seine Mutter musste allein für alles aufkommen, und die bevorstehende Klassenfahrt kostete ohnehin genug.
„Und was ist mit mir?“, fragte Susen schmollend. „Ach, du weißt doch, dass du immer was von mir bekommst“, sagte Marc lächelnd. „Also, was ist, Tommy? Kommst du mit?“ „Nein, lass mal. Ich mach mich lieber auf den Heimweg.“ „Wie, du willst zu Fuß gehen?“, fragte Cliff erstaunt. „Ja, warum nicht? Ich hab Zeit – und muss ohnehin über ein paar Dinge nachdenken.“ Er warf sich die Schultasche über die Schulter.
„Na schön, wenn du meinst“, sagte Marc achselzuckend, legte den Arm um Susen und ging mit den anderen los.
Sklayt, der bereits ein Stück voraus war, sah ungeduldig auf seine Uhr. „Kommt ihr endlich? Wenn er nicht will, dann lasst ihn doch!“ „Geht nur“, rief Tommy. „Vielleicht ein andermal.“ „Wie du willst, Alter!“, rief Marc zurück.
Da meldete sich Lena zu Wort: „Wisst ihr was? Ich gehe mit Tommy. Mir ist heute nicht nach Cola.“
„Wie du meinst“, brummte Marc.
Lena drehte sich um und rannte Tommy hinterher. „Warte, Tommy! Ich komme mit dir!“
Kaum waren sie verschwunden, zog Sklayt zwei zusammengerollte Joints aus der Jackentasche.
„Je weniger wir sind, desto besser. Dann müssen wir nicht teilen.“ „Weißt du was?“, sagte Susen und grinste. „Behalt sie. Heute bleibe ich lieber auf dem Boden – wir haben ja später noch was vor.“ „Wie, wir haben was vor?“, fragte Marc erstaunt. „Oh Mann, du bist manchmal wirklich begriffsstutzig!“ Sie lachte, beugte sich zu ihm und küsste ihn auf den Mund.
Unter lautem Gelächter der anderen flüsterte sie ihm ins Ohr, doch Marc rief nur: „Susen, du brauchst meine Ohren nicht sauber zu machen! Ich hab sie heute früh gewaschen!“
Alle prusteten los. „Marc Kelten, du bist ein unverbesserlicher Idiot!“, schrie Susen, schlug ihm leicht auf den Hinterkopf und stapfte beleidigt davon.
„He, Susen, komm schon! Ich hab’s doch nicht so gemeint!“, rief er ihr nach.
Doch sie blieb stur. Erst als Marc sie einholte und in den Arm nahm, beruhigte sie sich wieder ein wenig.
Lena und Tommy waren unterdessen bis zu Tommys Haus gegangen. „Tommy, soll ich noch ein bisschen bleiben? Ich habe ohnehin nichts vor“, fragte sie schüchtern.
„Nein, lass mal. Wenn meine Ma von der Arbeit kommt und ein Mädchen hier sieht, gibt’s Ärger. Du kennst sie ja.“
„Na schön, wenn du meinst“, sagte Lena enttäuscht. „Dann gehe ich eben.“ „Du bist doch nicht beleidigt, oder?“
„Nein, warum sollte ich? Ich muss sowieso heim – meine Mutter wartet bestimmt schon.“
„Dann bis morgen“, meinte Tommy kurz, schloss die Tür hinter sich und ließ sie draußen stehen.
Lena blickte ratlos auf die geschlossene Tür. Damit hatte sie nicht gerechnet.
„Hör zu, Tommy O’Brein! Komm morgen früh bloß nicht zu spät, sonst fährt der Zug ohne dich!“, rief sie laut, in der Hoffnung, er würde sie hören. Dann machte sie sich seufzend auf den Heimweg. Tommy hingegen ging in sein Zimmer, schaltete den Computer ein und machte sich in der Küche ein paar Brote, die er neben die Tastatur stellte. Für ihn gab es nichts Schöneres als seinen Rechner. Er bemerkte kaum, dass seine Mutter längst nach Hause gekommen war und es schon spät geworden war. Wie so oft blieb er zu lange auf – spielte, sah sich dann noch einen Horrorfilm an und schlief schließlich auf dem Stuhl ein.
Die Nacht war unruhig. Von einem Albtraum fiel er in den nächsten, Schweißperlen liefen ihm von der Stirn über das Gesicht, und er wälzte sich unruhig im Schlaf.
Am Morgen der Abfahrt
Erst am nächsten Morgen, als seine Ma ihn geweckt hatte, war es vorbei mit seinen Träumen.
„Tommy, wie oft soll ich dir noch sagen, dass solche Filme nichts für dich sind? Und du hast schon wieder auf deinem Stuhl geschlafen – ganz wie dein verstorbener Vater“, sagte seine Ma, als sie neben ihm stand. Sie wusste sofort, was Tommy wieder gemacht hatte. „Ma, das höre ich jedes Mal von dir.“
„Ja, was kann ich denn dafür, dass du ihm so ähnlich bist? Doch jetzt wird’s Zeit, dass du hochkommst. Hast du wohl schon vergessen, dass du heute verreisen tust?“
„Ach ja, das auch noch! Das hatte ich tatsächlich fast vergessen“, sagte Tommy und kratzte sich mal wieder am Hinterkopf. „Siehst du! Das meine ich – du bist ganz dein Vater“, sagte seine Ma noch einmal, als sie sah, was er tat. Sie bezog es auf das Kratzen am Kopf – das hatte sein Vater zu Lebzeiten auch immer zuerst gemacht. Tommys Ma lief hinüber zum Fenster, öffnete es und ging dann wieder zur Tür.
„Tommy, beeil dich ein bisschen! Du weißt, dass du noch bis zum Bahnhof laufen musst.“
„Ja, Ma, das weiß ich doch! Aber wenn ich zu spät komme, ist das doch auch nicht schlimm – dann bleibe ich eben hier“, meinte er und wollte sich gerade wieder in seinen Sessel setzen.
„Wag es ja nicht! Dann kannst du dich einpacken – dann ist Schluss mit deinem Computer. Du hast wohl vergessen, wie viele Pfund ich für die Reise bezahlt habe“, sagte seine Ma verärgert. „Sag mal, Ma, ich kann mich gar nicht erinnern, dass du hinter Jack so her warst wie hinter mir“, fragte er.
„Hinter Jack musste ich ja auch nicht ständig her sein. Du und dein Bruder seid so verschieden“, antwortete sie seufzend. „Doch seit er nun fort ist und alleine wohnt, fehlt er mir manchmal. Man bekommt ihn ja nur noch selten zu Gesicht.“
Tommy konnte sehen, dass sie das ein wenig traurig machte. „Siehst du – und aus diesem Grund ist es doch besser, wenn ich bei dir bleibe“, meinte Tommy.
„Wenn du in zwei Minuten nicht unten bist, dann komme ich wieder zu dir – und wehe, du bist dann nicht fertig!“
Weiter musste seine Ma nichts sagen, denn er wusste genau, was ihn dann erwarten würde.
„Ja, Ma, ich beeile mich schon. Du brauchst nicht wieder hochzukommen“, beruhigte er sie.
„Dann ist ja gut! Dann verstehen wir uns ja doch noch“, meinte sie und lief die alte Holztreppe nach unten.
Tommy ging ins Badezimmer und machte sich ein wenig zurecht. Es dauerte höchstens drei Minuten, da war er schon wieder in seinem Zimmer. Er nahm seinen Rucksack von der Schulter, griff in den Schrank und stopfte das, was er gerade in der Hand hielt, hinein – ohne nachzusehen, was es war. Dann schaute er sich noch einmal im Zimmer um, verließ es und ging hinunter in die Küche.
„Tommy, nun setz dich doch erst einmal hin und steh da nicht so herum. Iss dein Brot nicht im Stehen – du weißt, das kann ich nicht leiden.“
„Ma, du weißt doch, ich muss gleich los.“
„Ja, da bist du selber schuld! Wenn du gleich gekommen wärst, hättest du in Ruhe frühstücken können.“
„Ja, ich weiß – aber jetzt ist es zu spät“, meinte Tommy nur und stopfte sich die Brotreste in den Mund.
Dann ging er zur anderen Tischseite, wo seine Ma saß, gab ihr einen Kuss auf die Wange und sagte mit vollem Mund:
„Bis bald, Ma.“
„Tommy, du weißt, mit vollem Mund spricht man nicht – aber trotzdem: bis bald, mein kleiner Tommy. Und mach mir keine Schande, hörst du?“ „Was glaubst du denn, Ma? Du kennst mich doch.“ „Ja, gerade deswegen sage ich es ja noch einmal.“ „Ach, Ma, was du immer hast“, sagte Tommy, schnappte sich noch eine Scheibe Brot, die seine Ma für ihn geschmiert hatte, und machte sich auf den Weg zur Tür.
„Tommy, wenn du willst, kann ich dich ja zum Bahnhof bringen“, schlug sie vor und folgte ihm.
„Nein, Ma, das brauchst du nicht! Das fehlt mir auch noch – ich bin doch kein Kleinkind mehr“, sagte er und ging hinaus. „Ab und zu glaube ich das aber doch“, murmelte sie leise. „Was glaubst du?“
„Na, dass du doch noch ein kleines Kind bist.“ „Ach, Ma!“, erwiderte Tommy nur und schaute zur anderen Straßenseite. Dort stand bereits Lena und wartete auf ihn. Sie hatte extra diesen Weg genommen, falls er verschlafen hatte, um ihn notfalls zu wecken. „Hallo Tommy, da bist du ja endlich!“, rief sie gleich über die Straße und winkte ihm mit der rechten Hand zu.
„Die hat mir auch noch gefehlt“, murmelte er leise vor sich hin, so dass Lena es nicht hören konnte.
„Wieso magst du sie denn nicht? Es ist doch nett von ihr, dass sie dich abholt“, meinte seine Ma, die gehört hatte, was Tommy gesagt hatte. „Wenn du meinst“, antwortete er nur.
„Ist das deine Freundin?“, fragte sie gleich hinterher. „Ma, jetzt hör mal auf! Die und meine Freundin? Ich brauche keine – und habe auch keine Zeit für Weiber“, gab Tommy zurück. „Wieso nicht? Die sieht doch ganz nett aus“, sagte seine Ma noch einmal und schaute genauer zu Lena hinüber. „Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ruckzuck bist du alt und klapprig – dann will dich keine mehr haben“, meinte sie und lächelte. Sie wollte ihn ein wenig aufziehen. „Weißt du was, Ma? Ich glaube, ich gehe jetzt lieber, bevor ich noch heiraten muss – das würde mir gerade noch fehlen“, sagte er und gab ihr noch einen Kuss auf die Wange.
„Tschüss, Tommy, und viel Spaß!“, rief sie ihrem Sohn noch nach. Sie schaute ihm noch eine Weile nach, doch schließlich ging auch sie wieder zurück ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Tommy drehte sich nicht mehr um – er war sich sicher, dass seine Ma sonst noch einen ihrer Sprüche losgelassen hätte.
„Du, Tommy, freust du dich auch schon auf die Klassenfahrt?“, fragte Lena. „Lena, tust du mir mal einen Gefallen?“
„Ja, klar! Was soll ich denn für dich tun?“, fragte sie sofort. Für Tommy hätte sie alles getan – er musste es nur sagen.
„Würdest du mich bitte nicht immer nerven? Am besten, du lässt mich ganz in Ruhe.“
„Wie bitte? Ich hab dir doch gar nichts getan! Und wieso nerve ich?“, fragte sie enttäuscht.
„Ja eben! Wenn du still bist, ist alles gut. Ich komme ja nur mit, weil meine Ma es so wollte – nicht, weil ich Spaß daran habe“, fuhr Tommy sie an und lief nun etwas schneller.
„Weißt du was, Tommy O’Brein? Du bist ein eingebildeter Schnösel, das will ich dir nur mal gesagt haben! Du kannst lange warten, bevor ich noch einmal ein Wort mit dir rede!“, schrie sie ihn an und rannte mit kleinen, schnellen Schritten an ihm vorbei.
„Dann ist ja gut!“, rief Tommy ihr nach und folgte mit ein paar Metern Abstand in Richtung Bahnhof.
Am Bahnhof war schon ordentlich was los. Fast alle Mitschüler waren bereits da und konnten es kaum erwarten, dass es endlich losging. „Schaut mal, wer da kommt!“, rief Sklayt, als er die beiden sah. „Tommy, da bist du ja! Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr!“, rief Marc.
„Warum sollte ich nicht kommen?“, rief Tommy zurück. „Hey Tommy, kommst du jetzt doch mit? Ich dachte, du wolltest gar nicht – das hattest du doch gesagt!“, fragte auch Susen, als sie ihn entdeckte. „Wisst ihr was? Ihr könnt einem richtig auf die Nerven gehen!“, antwortete Tommy genervt.
„Aber wo…?“, sagte Susen nur und stutzte – Tommy hatte nämlich gar keinen Koffer dabei.
„Wo sind denn deine Sachen? Willst du doch nicht mit?“, fragte Marc. „Doch, warum nicht? Ich hab meine Sachen immer bei mir“, sagte Tommy und zeigte auf seinen kleinen Rucksack.
„Was, da drin sind all deine Sachen? Mehr willst du nicht mitnehmen?“, fragte Susen ungläubig. „Na ja, das musst du ja selber wissen“, meinte sie dann und wandte sich ab.
Susen lief hinüber zu Lena, die zusammen mit Sophie unter der großen Bahnhofsuhr stand.
„Hey Marc! Weißt du, was ich in meiner Hosentasche habe?“, rief Sklayt. „Nein, woher denn? Aber so wie ich dich kenne, wirst du’s mir gleich erzählen“, grinste Marc.
„Marc, du weißt doch eh, was er hat – da braucht man nicht lange zu überlegen“, mischte sich Cliff ein.
„Ja, das weiß ich schon“, sagte Marc und fragte Sklayt: „Na, und wann wollen wir’s uns zu Gemüte führen?“
Sklayt wollte gerade antworten, doch da rief Mister Hobst: „Aufpassen! Der Zug fährt ein – und seid vorsichtig beim Einsteigen, habt ihr gehört?“
„Mister Hobst, was glauben Sie denn, was wir sind? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr!“, meinte Sklayt.
„Ja, gerade deshalb sage ich es euch ja. Ich weiß, wie ihr seid“, erwiderte der Lehrer mit einem Blick, der Bände sprach. Als der Zug eingefahren war und zum Stehen kam, stiegen alle nach und nach ein. Jeder suchte sich einen Platz und verstaute sein Gepäck – so auch Tommy. Doch er musste sich neben Mister Hobst auf die Sitzbank setzen, weil kein anderer Platz mehr frei war. Seine Mitschüler waren alle schneller gewesen.
Tommy stellte sich zunächst ans Fenster und starrte hinaus. Er war am Überlegen, ob er nicht doch wieder aussteigen sollte. Plötzlich klatschte eine Hand gegen die Scheibe – Tommy fuhr erschrocken zusammen. Draußen stand Constable Jack O’Brein, sein Bruder, der zufällig am Bahnhof vorbeigekommen war. Er hatte gesehen, dass Tommy in den Zug gestiegen war, und wollte sich noch schnell verabschieden. „Hey Tommy! Ich wünsche dir eine gute Reise! Wo geht’s denn überhaupt hin? Na ja, egal – komm nur gesund wieder. Ach ja, und benehm dich!
Nicht, dass ich später noch Klagen höre, verstanden?“, rief er durch das geschlossene Fenster.
Tommy öffnete das Fenster halb und rief zurück: „Du brauchst mir nicht zu erzählen, wie ich mich benehmen soll! Du, von allen Leuten! Besuchst ja nicht mal unsere Ma – also komm mir nicht mit Benehmen!“
„Tommy, ich hab doch nicht so viel Zeit, das hab ich dir schon so oft gesagt!“, rief Jack noch, doch der Zug setzte sich in Bewegung. Die Brüder konnten nichts mehr sagen.
Nachdem der Bahnhof außer Sicht war, schloss Tommy das Fenster wieder, setzte sich und starrte verärgert hinaus. Er hätte seinem Bruder noch einiges an den Kopf werfen wollen – vor allem, was ihre Ma betraf –, aber nun war es zu spät.
„Na, Tommy! So wie ich sehe, haben Sie nicht gerade viel Gepäck dabei“, sprach Mister Hobst ihn an.
Tommy zuckte mit den Schultern. „Was soll ich mich mit so viel Kram abschleppen? Wird schon reichen. Ich will mich ja nicht jeden Tag umziehen – bin doch kein Mädchen.“
„Na ja, das müssen Sie selbst wissen. Sie sind schließlich alt genug“, sagte Mister Hobst trocken, schlug seine Zeitung auf und las weiter. „Mister Hobst, wann sind wir eigentlich da? Und wie lange fahren wir noch?“, fragte Sophie, die gegenüber saß.
Mister Hobst senkte kurz seine Zeitung, blickte über sie hinweg und antwortete:
„Soviel ich weiß, sollen wir gegen vierzehn Uhr dreißig dort sein. Also haben wir noch ein paar Stunden vor uns. Aber jetzt störe mich bitte nicht weiter – ich möchte erst meine Zeitung zu Ende lesen.“ Ab und zu lugte er über den Rand seiner Zeitung, um nach dem Rechten zu sehen.
Die Fahrt war lang und anstrengend, und einige der Jugendlichen waren auf ihren Sitzen eingeschlafen. Sie wurden erst durch das Quietschen der Bremsen wieder wach – und durch den Lärm der anderen, die schon damit beschäftigt waren, ihre Sachen zusammenzusuchen. „Hört bitte mal zu!“, rief Miss Kellingen durch den Waggon. „Ihr könnt euch gegenseitig beim Aussteigen helfen – nicht, dass noch was passiert und jemand sich verletzt! Die Koffer sind ja für manche von euch etwas schwer.“
Nach und nach stiegen alle aus und standen mit ihren Koffern und Taschen auf dem Bahnsteig. Bevor sie losliefen, zählte Mister Hobst noch einmal durch, ob auch wirklich alle da waren. Da niemand fehlte, machten sie sich auf den Weg und verließen den kleinen Bahnhof. Draußen blieb Mister Hobst stehen und schaute sich um. Eigentlich sollte hier ein Bus warten, der sie zum Schloss bringen würde – doch weit und breit war keiner zu sehen.
„Miss Kellingen, das verstehe ich jetzt gar nicht! Sie hatten doch einen Bus bestellt, der uns zum Schloss fahren sollte. Wir hatten doch noch darüber gesprochen, wissen Sie noch?“, fragte er seine Kollegin. Mister Hobst konnte einfach nicht begreifen, dass kein Bus bereitstand, um sie abzuholen.
„Dass man immer auf den Bus warten muss – das ist doch ärgerlich! Ich glaube, ich muss mich mal beschweren“, meinte Mister Hobst noch, doch da sagte seine Kollegin zögernd:
„Oh, Mister Hobst… ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Bus bestellen sollte. Was machen wir nun?“ Sie war über und über rot im Gesicht.
„Wie bitte? Was haben Sie?“, fragte er ungläubig, denn er dachte, er hätte sich verhört.
„Es tut mir wirklich leid!“, entschuldigte sie sich noch einmal kleinlaut. „Und was machen wir jetzt?“
„Was sollen wir denn schon machen? Dann müssen wir eben laufen. Aber sagen Sie bitte, dass das nicht wahr ist – ich muss träumen“, seufzte er und nahm seinen Koffer auf.
„Wie bitte? Wir sollen laufen? Auf gar keinen Fall!“, rief Tommy, als er das hörte. „Bevor ich laufe, fahre ich lieber mit dem nächsten Zug zurück!“ „Jetzt reicht’s mir aber! Wissen Sie was, Mister O’Brein? Sie können tun und lassen, was Sie wollen! Sie können mitkommen oder auch nicht. Setzen Sie sich ruhig in den nächsten Zug – das ist mir völlig egal! Hauptsache, Sie hören endlich mit diesem ewigen Gemecker auf! Das geht einem ja auf den Senkel. Sie sind doch schlimmer als ein Baby! Ihre ständige Lustlosigkeit kann ich nicht mehr hören!“, fuhr Mister Hobst ihn laut und verärgert an. Als Miss Kellingen das mitbekam, ging sie dazwischen. „Mister Hobst, nun lassen Sie den Jungen doch – so ist eben die Jugend von heute“, mischte sie sich ein. „Außerdem ist es ja meine Schuld, dass wir jetzt laufen müssen. Ich kann gut verstehen, dass er keine Lust hat.“
„Miss Kellingen, ich weiß nicht, ob wir damals auch so waren“, brummte er verärgert.
„Ist doch jetzt egal! Kommen Sie, wir sollten mit den Schülern losgehen. Und wegen des Busses – es tut mir wirklich leid“, sagte sie nochmals entschuldigend und nahm ihren Koffer.
Obwohl die Schüler ebenfalls keine große Lust hatten zu laufen, schnappten sie sich ihre Koffer und machten sich bereit. Nachdem sich auch Mister Hobst wieder etwas beruhigt hatte, setzten sie sich schließlich in Bewegung – in Richtung Schloss.
Nur Tommy blieb am Bahnhof zurück, so wie er es angekündigt hatte. Er wollte tatsächlich mit dem nächsten Zug zurückfahren. Da half auch alles Zureden von Miss Kellingen nichts – er blieb stur, setzte sich auf seinen Rucksack und sah den anderen nach. Schließlich zogen sie ohne ihn los, in der Hoffnung, dass Tommy es sich vielleicht doch noch anders überlegen und hinterherkommen würde.
Sie waren eine ganze Weile unterwegs und hatten schon einen langen Weg hinter sich – das Schloss lag weiter entfernt, als sie gedacht hatten. Obwohl sie zwischendurch immer wieder Pausen machten, hörte man doch den einen oder anderen murmeln, dass er lieber zu Hause geblieben wäre, wenn er das geahnt hätte.
Ankunft am Schloss
Als sie das Schloss in der Ferne erblickten, waren alle erleichtert; jeder dachte nur noch an sein Bett, auf das er sich legen konnte. Als sie schließlich vor dem Schloss standen, waren sie jedoch verwundert: Es sah gar nicht wie ein Hotel aus, geschweige denn wie eine Herberge. Weit und breit war niemand vom Personal zu sehen; es wirkte beinahe so, als wäre hier niemand mehr zuhause. Mister Hobst trat an die große Eingangstür heran und suchte nach einem Klingelknopf, doch er konnte keinen entdecken.
„Mister Hobst, Sie müssen mit dem großen Ring gegen die Tür schlagen“, wies Lena ihn darauf hin. Sie hatte so etwas schon in Filmen gesehen. „Oh — ja — stimmt! Darauf hätte ich auch selbst kommen können“, erwiderte er.
Er hob den eisernen Türklopfer und schlug ihn zweimal gegen die Holztür. Da nicht sofort jemand kam, schlug er nach einer kurzen Zeit noch einmal — dieses Mal etwas lauter. Er hatte so kräftig geschlagen, dass der Ton durch das ganze Schloss hallte.
„Mister Hobst, meinen Sie, dass wir hier richtig sind?“, fragte Miss Kellingen.
„Da bin ich mir ganz sicher. Wir sind genau nach der Wegbeschreibung gelaufen. Aber hätten Sie einen Bus gemietet…“, begann er, doch Miss Kellingen fiel ihm ins Wort.
Gerade als Mister Hobst etwas sagen wollte, öffnete sich die große Eingangstür mit einem lauten Quietschen. Vor ihnen stand eine alte Dame. „Entschuldigen Sie bitte — können Sie uns sagen, ob wir hier richtig sind?“, fragte Mister Hobst etwas erschrocken. „Ich weiß ja nicht, wohin Sie wollen. Wollen Sie ins Hotel der Lebenden und Toten, dann sind Sie hier richtig, Sir“, antwortete die alte Frau. „Was für ein abgefahrener Name für ein Hotel“, murmelte Marc, als er das hörte.
„Na, ich weiß doch, in welche Richtung man gehen muss, um hierher zu kommen“, sagte Mister Hobst und drehte sich mit hochgezogener Brust zu seinen Schülern.
„Ja, das haben Sie fein gemacht“, lobte Sklayt. „Was hätten wir nur ohne Sie gemacht?“, fügte er hinzu.
„Ich komme mir vor, als wäre ich in einer Pfadfindergruppe gelandet — so etwas Kindliches“, sagte Marc.
„Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte jetzt erst einmal in mein Zimmer, wenn’s irgendwie geht“, jammerte Sophie, die etwas abseits stand und sich den Knöchel rieb.
„Oh ja, natürlich. Kommt, lasst uns reingehen — das hätte ich fast vergessen“, meinte Mister Hobst. „Gute Frau! Ich dachte, das hier sei ein Hotel?“, fragte er.
„Ist es ja auch“, antwortete die Verwalterin und trat einen Schritt zur Seite, sodass die Schüler, Mister Hobst und Miss Kellingen eintreten konnten. „Ja, aber wo ist das Personal? Und die anderen Gäste?“, fragte Miss Kellingen und schaute über die Frau hinweg ins Innere des Schlosses. „Wo sollen die schon sein? Gäste gibt es zurzeit hier kaum, und Personal erst recht nicht. Das einzige Personal, das es hier gibt, bin ich“, erklärte die alte Dame.
„Sie allein wollen uns bedienen?“, fragte Miss Kellingen ungläubig. „Nein, nein — so meinen Sie das falsch. Ich bin nur die Verwalterin. Wenn ich Sie und Ihre Schüler eingewiesen habe, verschwinde ich wieder. Oder glauben Sie, ich bliebe länger, als nötig? O nein!“, sagte sie und zog sich bereits den Mantel wieder zurecht.
„Gute Frau, so geht das aber nicht — wir haben doch ein Hotel gemietet“, meinte Mister Hobst und hielt ihr die Reservierung entgegen. „Was? Sie haben dieses Hotel doch selbst ausgesucht und wollten einen Abenteuerurlaub. Da gehört es dazu, dass man im Schloss vieles selbst macht. Haben Sie das denn nicht in der Broschüre gelesen?“ „Nein — das habe ich offenbar nicht!“, antwortete Mister Hobst ärgerlich und setzte sich vor Schreck.
„Das kann ja lustig werden! Hätte ich das geahnt, wäre ich bei Tommy am Bahnhof geblieben — so eine Scheiße“, fluchte Sklayt. „Nicht nur du, auch ich — das ist doch voll krass. Zu Hause muss ich ja nichts machen“, klagte Susen.
„Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es ist doch cool hier! Wir können tun und lassen, was wir wollen — uns gehört das Schloss. Ich fühle mich jetzt schon wie eine Prinzessin“, sagte Lena.
„Oh Mann, jetzt dreht Lena völlig durch. Mister Hobst, können wir nicht erst einmal unsere Zimmer sehen und uns etwas ausruhen?“, fragte Marc. „Marc, warte noch einen Augenblick — uns müssen erst einmal die Zimmer zugewiesen werden.“
„Wie so denn das?“, hakte Marc nach. „Wir können uns die Zimmer doch selbst aussuchen — die sind sowieso nicht belegt und fast alle gleich“, meinte die Verwalterin.
„Dann können wir jetzt doch?“, fragte Marc noch einmal. „Ja, ihr könnt gehen — aber bitte keinen Streit“, warnte die Verwalterin. „Nein, nein — Streit wird es nicht geben“, sagte Lena. „Hört mal zu: Wir treffen uns in einer Stunde wieder hier unten, dann teilen wir die Zimmer ein. Jeder von euch bekommt eine kleine Aufgabe“, sagte Mister Hobst.
„Aber welches Zimmer bekommt wer — und wo sind die überhaupt?“, wollte Susen wissen und lief weiter durch den großen Saal. „Bevor es Ärger gibt, zeige ich euch die Zimmer“, meinte die Verwalterin und erwartete schon, dass sonst Unruhe ausbrechen würde. Die alte Dame führte jeden Schüler herum und zeigte ihnen, welche Zimmer sie nehmen konnten. Anschließend führte sie Miss Kellingen und Mister Hobst durch den Rest des Schlosses und überreichte ihnen eine Telefonnummer: Falls etwas sein sollte, könnten sie dort anrufen — aber nur tagsüber, nicht spätabends und schon gar nicht nachts. Dann würde sie nicht mehr kommen, sagte sie, bevor sie verschwand. „Na ja — es hätte auch noch schlimmer kommen können“, meinte Mister Hobst und ging zum Fenster, um hinauszuschauen. Als er hinaussah, rief er plötzlich:
„Miss Kellingen, kommen Sie schnell! Schauen Sie mal, wer dort draußen ist.“
„Wer soll das sein?“, fragte sie und lief zum Fenster. „Schauen Sie doch selbst!“, forderte er sie auf. Draußen sah Miss Kellingen, wen Mister Hobst meinte: Es war Tommy. Er saß etwas weiter entfernt auf dem Rasen. Offenbar war er ihnen doch gefolgt und hatte sich dort hingesetzt.
„Na, Miss Kellingen — sehen Sie? Man muss nicht alles durchgehen lassen.“
„Ja, ich sehe es. Wollen Sie ihn nicht hereinholen?“, fragte sie Mister Hobst.
„Nein, warum? Der kommt von selbst. Lassen Sie es erst einmal kühler werden, und wenn er Hunger bekommt, ist er schnell hier“, antwortete Mister Hobst und zog sie wieder vom Fenster weg. „Wenn Sie meinen“, sagte Miss Kellingen und ging in die Küche, um sich dort umzusehen. Mister Hobst blieb noch einen Moment am Fenster, steckte sich seine Pfeife in den Mund und zündete sie an. Dann setzte er sich in einen alten Sessel in einer Ecke des Saals, schlug seine Zeitung wieder auf — die er seit dem Aussteigen aus dem Zug zusammengefaltet in der Jackentasche getragen hatte — und begann zu lesen. „Mister Hobst, wissen Sie was? Ich werde mich erst einmal um meine Mädchen kümmern“, rief Miss Kellingen aus der Küche, bevor sie den großen Saal verließ.
„Tun Sie das“, murmelte er und las weiter.
„Wollen Sie sich denn nicht erst einmal um Ihre Jungs kümmern?“, rief sie ihm noch fragend hinterher.
„Später — Miss — Kellingen — später!“, antwortete er und vertiefte sich wieder in die Zeitung.
Tommy allerdings war es nach einer Weile auf dem Bahnhof ziemlich langweilig geworden, und so überlegte er, ob er seinen Mitschülern nicht doch folgen sollte. Er konnte jetzt nichts mehr daran ändern, dass er hier war, und es wurde ihm langsam kalt, wie Mister Hobst vorausgesagt hatte. Tommy kratzte mit dem Fuß im Boden herum und dachte nach. Gerade als er aufstehen wollte, sah er etwas Glänzendes im Sand zum Vorschein kommen. Es funkelte in seinen Augen. Zuerst dachte er, er hätte eine alte Münze gefunden. Er beugte sich vor, kniete nieder und kratzte mit dem Zeigefinger den losen Sand zur Seite. Zum Vorschein kam ein goldener Ring mit einem ovalen roten Stein.
Der Ring war übersät mit fremden Schriftzeichen, die Tommy nicht lesen oder entziffern konnte. Auch auf dem roten Stein waren Zeichen eingraviert. Es war kaum zu glauben, dass der Ring schon lange in der Erde gelegen hatte — er sah aus wie neu. Tommy beugte sich noch weiter vor, staunte und schaute rasch nach links und rechts, bevor er den Ring schnell aufhob. Er hoffte, dass niemand aus dem Schloss es bemerkt hatte; er wollte den Ring nicht gleich wieder hergeben und steckte ihn hastig in die Hosentasche. Dann verwischte er das Loch mit dem Fuß, nahm seinen Rucksack und lief zur Tür zurück. Als er ankam, griff er nach dem eisernen Türklopfer und schlug so fest er konnte gegen die Tür — ein Geräusch, das er wiederholte, weil ihm nicht sofort jemand öffnete. Mister Hobst, der immer noch im Saal saß, fluchte laut und war verärgert, denn er wusste genau, wer draußen vor der Tür stand. „Tommy O’Brein! Hören Sie endlich auf, ich komme ja schon!“, rief er durch den großen Saal in Richtung Tür und stand schließlich aus seinem Sessel auf.
Obwohl Tommy das gehört hatte, machte er weiter und legte sogar noch einen drauf: Er schlug den Türklopfer im Takt gegen die Tür. „Dem Bengel fehlt doch was! Den sollte man…!“, schimpfte Mister Hobst und verschluckte das, was er eigentlich noch sagen wollte. „Ich bin ja schon unterwegs Tommy!“, rief Mister Hobst, bevor er die Tür erreichte.
Als er die Tür öffnete und Tommy sah, sagte Mister Hobst erstaunt: „Mister O’Brein! Womit haben wir das verdient? Sie haben es sich also noch einmal überlegt und bleiben?“
Tommy zuckte kurz mit den Schultern und antwortete: „Mister Hobst, wenn es Ihnen lieber ist, kann ich auch wieder gehen. Ich finde bestimmt irgendwo anders eine Unterkunft.“ „Was wollen Sie? Bloß nicht! Bleiben Sie hier und kommen Sie hinein! Wir sind froh, dass Sie es sich doch anders überlegt haben. Wissen Sie was, O’Brein? Sie sind jetzt in einem ganz schwierigen Alter. Aber nun kommen Sie endlich rein — oder wollen Sie die Nacht vor der Tür verbringen?“ Tommy schmunzelte nur und trat ein. Als er im großen Saal stand, staunte er nicht schlecht. So etwas hatte er ja noch nie gesehen — er war zuvor noch nie in einem Schloss gewesen.
„Wollen Sie nicht ablegen, O’Brein?“, fragte Mister Hobst höflich, denn Tommy trug immer noch seinen Rucksack über der Schulter. Gerade wollte Tommy antworten, da rief hinter ihm eine andere Stimme: „He, Tommy! Da bist du ja — ich dachte schon, du würdest zurückfahren!“ Tommy drehte sich um und sah, wer die lange Treppe herunterkam: Sklayt. Er war bereits fertig mit seinen Sachen und hatte sich im Schloss schon ein wenig umgesehen.
„Wie soll ich denn hier wegkommen? Der nächste Zug fährt doch erst morgen früh. Außerdem wollte ich mir das Schloss mal ansehen“, meinte Tommy.
„Sklayt, du kannst Mister O’Brein mit in dein Zimmer nehmen und es mit ihm teilen“, schlug Mister Hobst vor.
„Von mir aus! Dann komm erst einmal mit, ich zeige dir unser Schlafgemach“, sagte Sklayt zu Tommy, verbeugte sich leicht und fügte hinzu: „My Lord, folgen Sie mir!“ und begann herumzukaspern. „Nun fängst du auch noch an zu spinnen“, sagte Tommy und lief hinter Sklayt her.
„Vergesst nicht, wiederzukommen! Wir wollen doch auch gleich Abendbrot essen“, rief Mister Hobst den beiden hinterher. „Nein, nein, Mister Hobst — das vergessen wir nicht!“, rief Sklayt zurück. Auf dem Weg zum Zimmer begegneten ihnen bereits einige Mitschüler, die ebenfalls fertig waren. Miss Kellingen lief ebenfalls vorbei. Als sie Tommy sah, freute sie sich, dass er doch noch gekommen war, und sagte: „Tommy, es ist schön, dass du es dir noch einmal anders überlegt hast. Bring erst einmal deine Sachen in dein Zimmer. Wir sehen uns gleich noch, dann können wir uns unterhalten, wenn du magst.“ „He, Tommy! Schön, dass du hier bist!“, rief auch Marc, als er an ihm vorbeilief.
„Ja, finde ich auch“, meinte Lena und berührte Tommy kurz an der Schulter, als sie an ihm vorbeilief.
Als Sklayt und Tommy nun dort oben auf den langen Korridor liefen, fragte Tommy seinen Freund:
„Sklayt, sag mal, was ist eigentlich mit Mister Hobst los? Wieso sagt der jetzt immer Mister O´Brein und Sie zu mir? Das hat er doch sonst nicht gemacht.“
„Ach, der! Da musst du dir nichts bei denken. Der hat bestimmt die Zugfahrt und jetzt die Luftveränderung nicht vertragen. Vielleicht ist er ja auch in einer schwierigen Phase. So, und hier ist unser Reich!“, sagte Sklayt und riss die Tür zu ihrem Zimmer auf. „Ta-ta-ra! Was hältst du davon?“, rief er, als er die Tür ganz geöffnet hatte.
„Wow, was soll das denn sein? Ach du Scheiße, wer soll denn in dem alten Bett schlafen?“, fragte Tommy entsetzt, als er im Zimmer stand und sich umsah. „Wer soll denn in dieser alten Bretterbude wohnen?“ „Na, wer schon? Wir beide, mein Alter, wir beide! Ich hoffe, du willst nicht gleich fummeln, wenn wir zusammen im Bett liegen?“ „Wie, wir beide?“, fragte Tommy noch einmal nach, denn er dachte, er hätte sich verhört.
„Na, wir! Hast du etwas mit deinen Ohren, Tommy O´Brein? Wir müssen uns das Bett teilen – aber nur, wenn du nichts dagegen hast.“ „Nein, vielen Dank. Ich schlafe lieber allein – und schon gar nicht mit einem Jungen. Nein danke!“, meinte Tommy und sah sich weiter im Zimmer um.
„Du brauchst keine Angst haben, ich küsse dich nicht gleich. Wir haben ja noch viel Zeit dafür“, machte Sklayt sich nun lustig und lachte. „Nee, auf keinen Fall! Weißt du was? Ich schlafe auf der Couch dort drüben“, schlug Tommy vor und zeigte auf eine grüne Couch, die vor einem ovalen Tisch stand.
„Hast du dich hier schon mal umgesehen? Egal, wo man hinsieht – überall starren uns diese komischen Fratzen an. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt schlafen kann. Das sieht ja aus wie in einem meiner Gruselfilme“, meinte Tommy noch und setzte sich auf die Couch. „Wie auch immer, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach unten. Mann, habe ich vielleicht einen Hunger – ich könnte jetzt eine ganze Kuh auffressen! Tommy, kommst du wieder mit runter?“, fragte Sklayt. „Nein, geh schon vor. Ich komme gleich nach, ich will mich noch ein wenig ausruhen“, meinte Tommy und legte sich auf der Couch zurück. „Na schön, dann gehe ich schon mal vor. Aber vergiss nicht – die Küche ist nachher geschlossen.“
„Ja, ja, ist gut!“, antwortete Tommy noch.
Nachdem Tommy allein im Zimmer war, stand er wieder von der Couch auf und lief umher. Er schaute sich die hängenden Bilder noch einmal genauer an – sie machten ihm ein wenig Angst. Als er sich weiter umsah, zuckte er plötzlich zusammen, denn draußen auf dem Flur hörte er eine Frau laut aufschreien. Es klang so gruselig, dass es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Nachdem er sich etwas gefangen hatte, ging er zur Tür und öffnete sie.
Zuerst öffnete er sie nur einen Spalt weit und sah nach rechts den langen Korridor entlang, dann in die entgegengesetzte Richtung. Doch im ersten Augenblick war niemand zu sehen oder zu hören. Tommy wollte gerade wieder ins Zimmer zurück und die Tür schließen, da sah er Sophie zusammen mit Elli lachend und kreischend aus ihrem Zimmer kommen. Sie hatten kurz zuvor Rebecca einen Schrecken eingejagt und freuten sich nun darüber. Als Tommy das mitbekam, dachte er nicht weiter an den Schrei, den er gehört hatte, und schloss wieder die Tür. Er wollte sich gerade wieder auf die Couch setzen, da hörte er erneut einen Aufschrei. Dieses Mal klang es, als hätten gleich mehrere Frauen geschrien. Wieder lief es Tommy eiskalt den Rücken hinunter, und er fluchte: „Blöde Weiber! Können die sich denn nicht einmal wie ganz normale Mädchen benehmen? Müssen sie denn immer so kreischen?“ Er setzte sich wieder auf die Couch.
Tommy lehnte sich bequem zurück und sah sich im Zimmer um. Da fiel ihm ein, dass er ja noch den Ring in seiner Hosentasche hatte. Er holte ihn heraus und betrachtete ihn von allen Seiten. Er nahm ihn in die linke Hand und hielt ihn zwischen Zeigefinger und Daumen. Tommy streckte die Hand mit dem Ring zur Lampe, um zu sehen, wie er funkelte. „Hm! Du siehst ja nicht gerade sauber aus – aber das werde ich gleich ändern“, sagte Tommy zu seinem neuen Ring. Er holte mit der anderen Hand ein Taschentuch aus der Hosentasche und legte es neben sich auf die Couch. Dann griff er noch einmal in die Tasche, holte ein Kaugummi heraus, packte es aus und steckte es sich in den Mund. Anschließend nahm er das Taschentuch wieder auf und begann, den Ring zu polieren. Ab und zu hielt Tommy den Ring ins Licht, um zu sehen, wie er funkelte.
„Hm! Es ist zu schade, dass ich nicht lesen kann, was auf dir draufsteht. Ich hätte es zu gern gewusst. Ich werde dich wohl gut verstecken müssen, sonst bin ich dich gleich wieder los, wenn Mister Hobst dich bei mir findet“, sagte er zu dem Ring in seiner Hand.
Da Tommy auf dem Korridor einige Stimmen und Schritte hörte, dachte er, dass jemand zu ihm kam, um ihn zu holen. Deshalb steckte er den Ring wieder in die Hosentasche. Anschließend nahm er das Taschentuch, mit dem er eben den Ring geputzt hatte, putzte sich die Nase und steckte es ebenfalls zurück. Und tatsächlich – die Stimmen und Schritte kamen zu ihm. Es dauerte nicht lange, da klopfte es an der Tür. „Ja, kommt rein!“, rief er von der Couch aus.
Er hatte es noch nicht ganz ausgesprochen, da öffnete sich schon die große Tür, und vor ihm standen Lena und Rebecca.
„Hallo, Tommy!“, riefen beide Mädchen gleichzeitig. „Hallo! Was wollt ihr denn?“, fragte Tommy die beiden, während er seine Füße lässig auf den Tisch legte, der vor der Couch stand. „Tommy, wir sollten dich für Mister Hobst holen. Wir sind doch schon fast fertig mit dem Abendbrot“, erzählte Rebecca.
„Genau – und aus diesem Grund hat er uns zu dir geschickt“, meinte Lena. „Und dann gleich zu zweit?“
„Ja, Mister Hobst und Miss Kellingen haben Angst, dass wir uns hier im Schloss verlaufen könnten“, meinte Rebecca.
„So groß ist das Schloss nun auch wieder nicht“, meinte Tommy. „Das mag sein – aber du kennst die beiden doch“, erwiderte Rebecca. Da Tommy aber nicht gleich aufstand und ihnen auch keine Antwort gab, fragte Lena:
„He, O´Brein, was ist nun? Kommst du jetzt oder nicht?“, fragte sie giftig. „Oh, oh – da ist jemand aber ganz schön bissig“, meinte Tommy, der bemerkte, dass Lena langsam sauer wurde.
„Ist ja gut, ich komme ja schon mit“, sagte Tommy, raffte sich auf und verließ zusammen mit den beiden Mädchen das Zimmer. Was Tommy und die Mädchen nicht bemerkten: Nachdem sie die Tür geschlossen hatten, öffnete sich das Fenster von selbst, und ein kalter Wind fegte durch das Zimmer. Alle Fackeln, die dort an den Wänden hingen und nur zur Zierde angebracht waren, begannen für einen kurzen Augenblick zu brennen – der Wind hatte sie entzündet. Doch nach wenigen Sekunden erloschen sie wieder von selbst, genau so plötzlich, wie sie aufgeflammt waren. Auch das Fenster schloss sich wieder von allein. Zurück blieben nur die umgestürzte Vase mit den Blumen auf dem Tisch und ein paar Blätter aus einer Lesemappe, die nun auf dem Boden lagen. Als Tommy mit den Mädchen auf dem Weg nach unten war, sagte er: „Ich habe mal eine Frage.“
„Na und, was willst du wissen?“, fragte Rebecca. „Müsst ihr euch immer wie alberne Gänse benehmen?“ „Wieso alberne Gänse? Wir sind doch nicht albern – wie kommst du denn darauf?“, fragte Lena und begann zu kichern.
„Wenn ihr schon rumalbern müsst, dann macht es wenigstens so, dass anderen nicht die Haare zu Berge stehen!“
„Wie zu Berge stehen? Wir haben doch gar nichts gemacht“, antwortete Rebecca.
„Und was war das mit den Schreien, die ich von euch gehört habe?“, wollte Tommy wissen.
„Was für Geschrei? Wir haben doch nur bu gemacht! Und Rebecca hat sich so erschrocken, dass sie vom Stuhl gerutscht ist“, erzählte Lena. „Genau – und dann haben Lena und Sophie gelacht, und mehr war da nicht“, sagte auch Rebecca. „Oh doch! Da ist noch was: Seitdem kann ich nicht mehr richtig laufen und habe einen blauen Fleck an meinem Bein“, erzählte Rebecca und kicherte erneut.
„Kommt, gebt’s doch zu – ihr habt geschrien, als wäre der Teufel hinter euch her gewesen!“, wollte Tommy sie necken. Hör endlich auf! Du und dein Geschrei – es ist doch egal, wer dort geschrien hat. Wir waren es nicht, basta!“, sagte Lena verärgert. Sie war wütend, weil Tommy ihr nicht glauben wollte. Aus welchem Grund sollte sie denn lügen? Wenn sie es gewesen wären, hätten sie es ihm ja auch zugeben können, dachte sie, ließ Tommy und Rebecca zurück und lief allein voraus.
„Tommy! Vielleicht hast du ja die Schreie einer toten Seele gehört?“, flüsterte Rebecca ihm ins Ohr.
Dafür war sie extra näher an ihn herangetreten, damit es niemand sonst hören konnte.
„Nun fängst du auch noch an zu spinnen!“, sagte Tommy nun verärgert, denn er dachte, sie wolle ihn auf den Arm nehmen. „Warum spinne ich? Es könnte doch sein! Wenn keiner von uns geschrien hat – wer soll es dann gewesen sein? Oder hast du es dir etwa eingebildet?“
„Das weiß ich noch nicht, aber ich werde es herausfinden“, meinte Tommy nur und lief mit ihr die Treppe hinunter.
Als sie den großen Saal erreichten, saßen Tommys Mitschüler bereits alle am Tisch und aßen – oder besser gesagt: sie hatten gegessen, denn Tommy war viel zu spät dran.
„Mister O’Brien, es ist schön, dass Sie doch noch zu uns gefunden haben“, begrüßte ihn sein Lehrer Mister Hobst, als er ihn erblickte. „Es tut mir leid, dass ich zu spät komme“, entschuldigte sich Tommy und setzte sich ans Tischende.
„Soll ich euch mal etwas erzählen?“, rief Rebecca durch den Saal. „Na, was hast du denn, das du loswerden willst?“, rief Marc zurück. „Mach es nicht so spannend, erzähl schon!“, forderte Sophie sie auf. „Tommy hat gesagt, dass er Stimmen gehört hat, und er glaubt, dass es hier Gespenster gibt! Oder Seelen von Toten, die hier herumgeistern und ihr Unwesen treiben.“
Als Tommy hörte, was Rebecca da über ihn erzählte, blieb ihm das Stück Brot, das er gerade abgebissen hatte, im Hals stecken. Er sprang auf und schrie sie an: