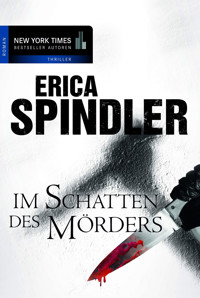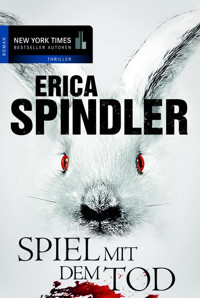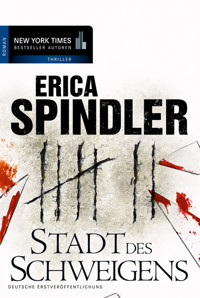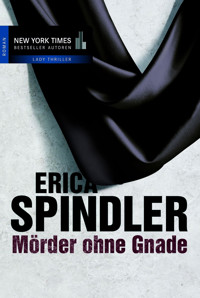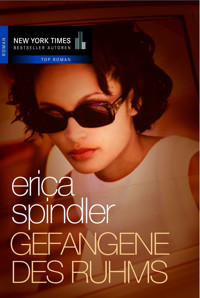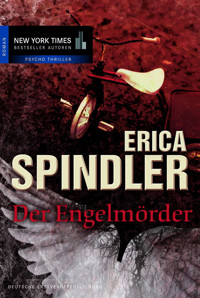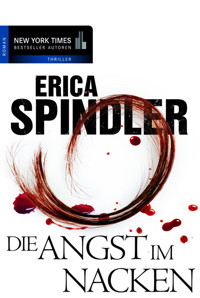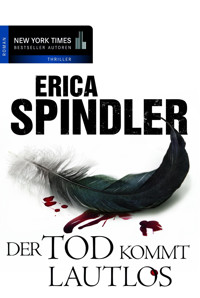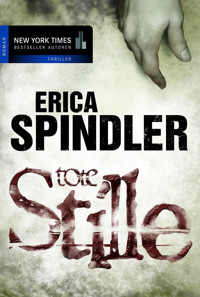7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Paradise Christian Church" - so heißt die Kirche, in der die Pfarrerin Rachel Howard sich besonders engagiert um Jugendliche kümmert. Aber dann verschwindet sie spurlos.
Zusammen mit dem Ex-Cop Rick Wells, der auf Key West eine Bar betreibt, versucht Liz etwas über den Verbleib ihrer Schwester harauszufinden. Vergeblich. Stattdessen entdecken sie Entsetzliches: Der düstere Satanskult "Gehörnte Blume" begeht offensichtlich Ritualmorde an Jugendlichen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Blume des Satans
Das Zeichen der „Gehörnten Blume“ führt Liz auf die Spur ihrer verschwundenen Schwester. Noch weiß sie nicht, wie die grauenhaften Ritualmorde an Teenagern, der Selbstmord des angesehenen Bankdirektors Larry Bernhardt und Rachels Verschwinden auf Key West zusammenhäh Hinweisen sucht, desto deutlicher erkennt sie, dass die Spur zur „Paradise Christian Church“ führt. Die Kirche, in der Rachel als Pfarrerin gearbeitet hat ...
Dieses Buch ist den zahlreichen Opfern des Terroranschlags auf die Vereinigten Staaten von Amerika am 11. September 2001 gewidmet; den Menschen, die mit den Folgen dieses Anschlags fertig werden müssen, und den Helden jenes Tages: den Feuerwehrleuten, den Polizisten, den Notärzten und den Rettungssanitätern, den hilfsbereiten Bürgern und den Passagieren des United-Airlines-Fluges 93. Euch allen vielen Dank. Gott segne euch.
Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
1 Petrus 5,8
Die Handlung und Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
Erica Spindler
Blume des Satans
Roman
Aus dem Amerikanischen von Reiner Nolden
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH, Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2011 by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgaben: Dead Run Copyright © 2002 by Erica Spindler erschienen bei: Mira Books, Toronto
Published by arrangement with Harlequin Enterprises II B.V./S.á.r.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln Titelabbildung: Harlequin Enterprises S.A., Schweiz Redaktion: Thorben Buttke
ISBN 978-3-86278-368-7
www.mira-taschenbuch.de Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden.
PROLOG
Key West, Florida Freitag, 13. Juli 2001, 23 Uhr
Pastorin Rachel Howard schaute aus ihrem Schlafzimmerfenster. Sie musste sich anstrengen, um durch die Sturzbäche von Regen etwas erkennen zu können. Ein Donnerschlag erschütterte das 120 Jahre alte Pfarrhaus. Sekunden später wurde sie von einem grellen Blitz geblendet.
Sie trat einen Schritt vom Fenster zurück, das bis auf den Boden reichte, um Schutz in der Dunkelheit des Raumes zu suchen. Wer immer diejenigen sein mochten, die sie beobachteten: Sie sollten nicht das Geringste von ihren Absichten ahnen. Sie waren gekommen, um sie zu holen. Wer sie waren, wusste sie zwar nicht, aber es waren viele, dessen war sie sich sicher.
Er war mächtiger, als sie gedacht hatte. Listiger. Und bösartiger.
Sie hatte seinen Einfluss unterschätzt. Das war ein Irrtum gewesen. Ein tödlicher Irrtum, wie sie mittlerweile befürchtete.
Rachel kniff die Augen zusammen, während ihr die tröstenden Worte des dreiundzwanzigsten Psalms durch den Kopf gingen, die das Gewirr der anderen Stimmen übertönten – Stimmen, die außer ihr niemand hören konnte.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir.
Noch in dieser Nacht wollte sie ihnen entkommen und aufs Festland fliehen. War sie erst einmal in Sicherheit, wollte sie sich den nächsten Schritt überlegen. Wenn sie es schaffen würde.
Unvermittelt überkam sie ein Gefühl der Beruhigung, und ihre Nervosität ließ ein wenig nach. Gleichgültig, wie diese Nacht enden mochte – die Dunkelheit würde ihr jetzt keine Angst mehr einjagen.
Rachel öffnete die Augen und trat langsam wieder zum Fenster, den Briefumschlag in der Hand noch fester umklammert als zuvor. Ihr Verbündeter würde trotz des Unwetters kommen. Er würde sie nicht im Stich lassen.
Hoffentlich täuschte sie sich nicht. Sie schickte ein Stoßgebet zum Himmel.
Rachel machte sich Sorgen, dass sein Leben in Gefahr sein könnte, weil sie ihn um Hilfe gebeten hatte.
Im Geiste hörte sie das Gelächter der anderen und ihre spöttischen Bemerkungen. Sie machten sich lustig über sie, kein Zweifel
– und sie verspotteten ihren Gott.
Wieder krachte ein Donnerschlag, und sie zitterte am ganzen Körper. Als der Blitz aufzuckte, sah sie ihren Verbündeten durch den Park eilen – eine unförmige Gestalt in einem regenglänzenden Poncho.
Sekunden später stand er vor ihrem Fenster. Vor Dankbarkeit und Zuneigung traten ihr Tränen in die Augen. Schnell öffnete sie das Fenster und reichte ihm den Briefumschlag.
„Hier. Sorge dafür, dass meine Schwester ihn bekommt.“ Er nickte stumm. „Geh jetzt, beeil dich.“
Er zögerte einen Moment. Dann drehte er sich um und verschwand im strömenden Regen.
Rachel verlor keine Zeit. Sie griff nach Regenmantel, Schirm, Handtasche und Autoschlüsseln und trat hinaus in die Nacht. Wind und Regen hatten das Laub von den Bäumen gerissen und über die Wege verstreut. Wie ein blutgetränkter Teppich lagen die zerdrückten roten Blütenblätter vor ihr.
Den Toyota hatte sie hinter dem Pfarrhaus geparkt. Sie ging ohne übertriebene Hast, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Niemand sollte bemerken, was sie vorhatte.
Der Regen trommelte auf ihren Schirm, und kleine Sturzbäche
liefen über den Rand auf ihre Füße. Ihre Lippen bewegten sich, als sie lautlos das Glaubensbekenntnis sprach: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, ich glaube an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, ich glaube an ...
Plötzlich hörte sie hinter sich ein Geräusch. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie stehen blieb und sich umdrehte. „Stephen?“ flüsterte sie mit zitternder Stimme. „Bist du das?“
Der Wind legte sich, und der Regen ließ nach. Mit einem Mal stieg ihr der Geruch des Todes in die Nase und wehte ihr ins Gesicht. Es stank faulig wie aus einem Grab.
Rachel stieß einen Schrei aus und begann zu laufen. Den Parkplatz vor Augen, stolperte sie über einen losen Pflasterstein. Die Autoschlüssel glitten ihr aus den Fingern und fielen klirrend zu Boden. Sie bückte sich, um sie wieder aufzuheben.
Krampfhaft umklammerte sie die Schlüssel. In den Büschen raschelte es, und sie vernahm ein leises Lachen. Als sie sich umdrehte, zerschnitt ein Blitz den nachtschwarzen Himmel, und sie sah etwas Metallenes in der Dunkelheit schimmern.
„Nein!“ Sie rannte, wäre fast hingefallen, fand aber sofort ihr Gleichgewicht wieder.
Endlich hatte sie den Wagen erreicht. Heftig zerrte sie am Griff, und die Tür sprang auf. Man verfolgte sie, das konnte sie deutlich hören. Ohne sich noch einmal umzuschauen, kletterte sie hinter das Steuer, zog die Autotür zu und drückte auf die Verriegelung. Ihre Hände zitterten so stark, dass es ihr erst beim dritten Mal gelang, den Schlüssel in das Zündschloss zu stecken.
Endlich erwachte der Motor zum Leben und sprang an. Schluchzend vor Erleichterung legte sie den Rückwärtsgang ein und startete durch. Das Fahrzeug schoss nach hinten und geriet auf dem nassen Boden ins Schleudern.
Rachel schaltete auf „Drive“ und gab Gas. Als der Wagen einen Satz vorwärts machte, wisperte sie ein Dankgebet. Sie war ihnen entkommen. Nun würde sie auch den Rest schaffen.
Jetzt riskierte Rachel einen Blick zurück, um nach ihren Verfolgern zu sehen, aber in der Dunkelheit konnte sie kaum etwas erkennen. Sie konzentrierte sich wieder auf die Straße vor ihr. Die Autoscheinwerfer streiften ein Hindernis auf dem Weg. Mitten auf der Fahrbahn stand eine Gestalt.
Mit einem Schrei riss Rachel das Steuer nach rechts und trat gleichzeitig auf die Bremse. Der Wagen scherte zur Seite aus, geriet auf dem nassen Asphalt ins Schlingern und drehte sich einmal um die eigene Achse. Rachel bemühte sich, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten, und betete, dass ein Wunder geschehen möge. Doch sie wusste, dass es zu spät war.
Der Wagen schlitterte über die Straße. Ein Baum tauchte aus der Dunkelheit vor ihr auf. Schutzsuchend warf Rachel die Arme vors Gesicht. Dann wurde sie durch den Aufprall nach vorne geschleudert.
1. KAPITEL
St. Louis, Missouri Montag, 16. Juli, 8.40 Uhr
Liz Ames sah zu, wie der Kaffee aus dem Filter in die Glaskanne tropfte. Sie gähnte, während sie ihren Nachtflug und die Kaffeemaschine, die im Schneckentempo arbeitete, verfluchte. Jetzt sofort brauchte sie die belebende Wirkung des Kaffees und nicht erst in fünf Minuten.
An diesem Morgen war sie tatsächlich sehr spät dran. Wie hatte das nur passieren können? Normalerweise war sie doch so pünktlich. Und immer sofort hellwach – gleichgültig, wie wenig sie in der Nacht zuvor geschlafen hatte.
Heute allerdings hatte sie es kaum geschafft, aus dem Bett zu steigen.
Das lag zweifellos an Jared, ihrem hintertriebenen Ex-Mann. An ihn musste sie denken, als sie in das Licht blinzelte, das durch die Lamellen und an den Rändern der Jalousien vorbei ins Zimmer drang. Nur seinetwegen hatte sie ihr Privat- und Berufsleben grundlegend geändert und war spontan in einen südlicheren Bundesstaat gezogen – eine Veränderung, die sehr kräftezehrend gewesen war.
Aber Rachel ist ja auch in den Süden gezogen, überlegte Liz – ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Krise. Sie dachte an ihre ältere Schwester, die den Ruf an eine kleine, nicht konfessionsgebundene christliche Kirche auf Key West angenommen hatte. Ihr Blick fiel auf den Anrufbeantworter und das hektisch blinkende Lämpchen, das eine Nachricht ankündigte.
Sie sollte sich wirklich einmal bei ihr melden. Fast einen ganzen Monat hatten sie nicht miteinander telefoniert, und ihr letztes Gespräch war aus mehreren Gründen ziemlich unangenehm gewesen – nicht zuletzt deswegen, weil sie sich gestritten hatten.
Jetzt begann die Maschine gurgelnde Geräusche von sich zu geben; der Kaffee würde bald fertig sein. In diesem Moment klingelte das Telefon. Mit einer Hand griff Liz nach ihrem Becher, mit der anderen nach dem Hörer. „Hallo?“
„Elizabeth Ames?“
Die Stimme am anderen Ende der Leitung war die eines Mannes. Er sprach in dem offiziellen Tonfall, den Liz als Sozialarbeiterin und Familientherapeutin schon unzählige Male gehört hatte.
„Ja“, antwortete sie. „Können Sie bitte einen Moment dranbleiben?“
Ohne die Antwort abzuwarten, legte sie den Hörer zur Seite, füllte ihren Kaffeebecher und goss ein wenig Sahne hinzu. Sie öffnete den Schrank über der Spüle und holte das Röhrchen mit den Antidepressiva heraus, die ihr der Arzt verschrieben hatte. Die praktische Lösung der modernen Medizin für einen wolkenverhangenen Tag. Hastig schüttelte sie eine Tablette auf die Handfläche und spülte sie mit einem heißen Schluck Kaffee hinunter.
Mit einem leisen Seufzer presste sie den Hörer ans Ohr. „Da bin ich wieder. Was kann ich für Sie tun?“
„Hier spricht Lieutenant Detective Valentine Lopez vom Polizeirevier in Key West. Sind Sie die Schwester von Rachel Ho-ward?“
Liz erstarrte. Schließlich zog sie einen Küchenstuhl unter dem Tisch hervor und ließ sich schwer darauf fallen.
„Miss Ames?“ meldete sich der Detective wieder. „Sie sind doch die Schwester von Pastorin Rachel Howard, oder? Pastorin Howard von der Paradise Christian Church auf Key West. Sie hat Sie als nächste Verwandte angegeben.“
Nächste Verwandte. Um Himmels willen, nein. „Ja“, brachte Liz endlich hervor. „Was ist denn ... Ist mit Rachel alles in Ordnung?“
„Ich rufe Sie an, weil wir uns Sorgen machen um Ihre Schwester. Haben Sie sie in letzter Zeit gesehen?“
Ihr Herz setzte einen Schlag lang aus. „Nicht seitdem sie ... seitdem sie nach Key West gezogen ist.“
„Und das war vor etwa sechs Monaten?“
„Ja.“
„Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen?“
Liz schloss die Augen, als sie sich daran erinnerte. Rachel war bedrückt und ausweichend gewesen. Auf ihre bohrenden Fragen hin hatte sie abgestritten, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Stattdessen hatte sie behauptet, in ihrer neuen Stelle so viel zu tun zu haben, dass es ihr nicht möglich gewesen sei, sich bei ihr zu melden. „Das ist schon eine Weile her. Etwa einen Monat. Wir haben uns gestritten. Ich war ziemlich wütend.“
„Darf ich fragen, warum?“
„Eine persönliche Angelegenheit, Detective.“
„Es ist wichtig, Miss Ames.“
„Ich habe gerade ... ich hatte gerade eine Scheidung hinter mir. Und eine meiner Patientinnen ... ich brauchte meine Schwester, und sie war nicht da. Deshalb war ich sauer.“ Ihre eigenen Worte kamen ihr auf einmal kindisch vor, und sie spürte, dass sie rot wurde. „Was ist denn passiert? Ist Rachel ...“
„Es war das letzte Mal, dass Sie mit ihr gesprochen haben?“
„Ja, aber ich verstehe nicht ...“
„Also haben Sie in den vergangenen zweiundsiebzig Stunden nichts von ihr gehört? Kein Telefongespräch, keine E-Mail, kein Brief?“
„Nein ...“ Sie legte die Hand auf ihr hämmerndes Herz und schaute wieder auf das blinkende Lämpchen des Anrufbeantworters. „Seit vergangenen Donnerstag bin ich nicht zu Hause gewesen. Ich wollte gerade meinen Anrufbeantworter abhören.“
„Sie müssen mich unbedingt verständigen, wenn Sie das getan haben.“
Das Blut stieg Liz in den Kopf. Sie umklammerte den Hörer noch fester. Plötzlich hatte sie schreckliche Angst. „Ich denke nicht daran, Lieutenant. Nicht, bevor Sie mir gesagt haben, was eigentlich los ist. Ist Rachel irgendetwas zugestoßen?“
„Ihre Schwester ist spurlos verschwunden, Miss Ames. Wir hatten gehofft, dass Sie uns einen Hinweis auf ihren Verbleib geben könnten.“
2. KAPITEL
Key West, Florida Mittwoch, 31. Oktober, 1.30 Uhr
Liz stand vor dem alten Stadthaus, das sie als Büro und Wohnung angemietet hatte, und sah zu, wie der Hausmeister ihr Praxisschild an der Tür befestigte.
Elizabeth Ames. Staatlich geprüfte Sozialarbeiterin und Familientherapeutin
Sie holte tief Luft und versuchte, den plötzlichen Anfall von Nervosität zu unterdrücken. Ausgerechnet auf der Duval Street! Was, um Himmels willen, hatte sie sich nur dabei gedacht, gerade dieses Haus zu mieten? Die Gegend war absolut unpassend für eine Sozialarbeiterin, und die Miete war unverschämt hoch.
Die Duval Street, die größte touristische Attraktion auf Key West, wurde oft die längste Straße Amerikas genannt, weil sie sich vom Atlantik bis zum Golf von Mexiko erstreckte. Liz schaute nach rechts, dann nach links. Menschen liefen an ihr vorbei. Die meisten trugen Shorts und Sandalen, und ihre Haut, die sie ungeschützt der Sonne aussetzten, war rosa wie eine gekochte Krabbe. Sonnenbrillen, Baseballkappen und Gürteltaschen waren hier offenbar ebenso unerlässlich wie Fahrräder oder Motorroller als Fortbewegungsmittel.
Unaufhörlich strömte auf der Fahrbahn der Verkehr vorbei, wie ein endloser Schwarm glänzender Fische – eine bunte Mischung aus Fahrrädern, Motorrollern, Autos und gelegentlich einer Harley Davidson. Deren Besitzer waren gekommen, um das Paradies zu genießen und in die aufregende Atmosphäre der Geschäfte, Bars, Restaurants und Kunstgalerien auf der Duval Street einzutauchen.
Ironischerweise war die Duval Street auch die Adresse der ältesten Kirche auf Key West, der Paradise Christian Church. Rachels Kirche. Der letzte Ort, an dem sie lebend gesehen worden war.
Zu ihrer Rechten konnte Liz die strahlend weißen Glockentürme der Kirche sehen, die über die Spitzen der Banyanbäume und Kohlpalmen ragten. Eine Bar namens Ricks Island Hideaway lag zwischen ihrem Haus und der Kirche.
Plötzlich hatte sie einen Kloß im Hals. So nahe war sie Rachel fast ein Jahr lang nicht gewesen. Sie vermisste sie so sehr, dass es wehtat.
„Ist das in Ordnung so?“
Es dauerte ein paar Sekunden, bis ihr klar wurde, dass der Hausmeister sie gemeint hatte. Sie schaute hoch, und er grinste von der Leiter auf sie hinunter. Seine weißen Zähne strahlten in dem dunklen, wettergegerbten Gesicht. Sie vermutete, dass er aus Kuba stammte. Dazu bedurfte es allerdings keiner großen detektivischen Fähigkeiten, denn schließlich lag Key West näher an Havanna als an Miami.
„Ja“, erwiderte sie und zwang sich zu einem Lächeln. „Perfekt.“
Er kletterte die Leiter hinunter. „Key West ist wie eine geheimnisvolle Frau. Sie fährt Ihnen ins Blut, und Sie werden sie nie mehr los.“ Wieder setzte er sein strahlendes Lächeln auf. „Oder für Sie wie ein stattlicher Mann. Sie werden hier bestimmt glücklich sein.“
Liz’ Atem ging unregelmäßig, während sie etwas Zustimmendes murmelte. Sie kam sich wie eine Heuchlerin vor, denn sie hasste Key West jetzt schon. Es hatte ihr die Schwester weggenommen.
Der Mann klappte die Trittleiter zusammen und stemmte sie auf seine breite Schulter. „Einen wunderschönen Tag noch!“
Liz sah ihm nach, als er davonging. Dann betrat sie ihr Büro und begann, Bücher und Arbeitsutensilien auszupacken und sie in Schubladen und Regale zu füllen, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Keine einfache Aufgabe angesichts der Tatsache, dass ihre Gefühle in einem größeren Durcheinander waren als der Inhalt ihrer Umzugskisten. Mitunter wäre sie fast in Tränen ausgebrochen; dann wieder wurde sie von wilder Entschlossenheit angetrieben.
Ihr Therapeut hatte sie vor dieser emotionalen Achterbahn gewarnt und ihr von dem Umzug nach Key West abgeraten. Sie sei noch nicht dazu in der Lage, hatte er behauptet. Schließlich hätte sie gerade einen Nervenzusammenbruch hinter sich und sei immer noch äußerst labil. Zu labil, um Nachforschungen über Rachels letzte Tage anzustellen und herauszufinden, was mit ihr geschehen war.
Liz fühlte sich schuldig. Wäre sie doch bloß nicht zu diesem Kongress gefahren! Rachel hatte tatsächlich angerufen und in heller Panik eine vollkommen verrückt klingende Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Es ging um kriminelle Machenschaften auf der Insel, denen sie auf die Spur gekommen war. Ein Teenager aus ihrer Pfarrei schien ebenfalls darin verwickelt zu sein. Sie selbst sei bedroht worden; außerdem würde sie ständig beobachtet. Aber wer und wie viele es waren, wüsste sie nicht. Sie würde wegfahren, um Hilfe zu holen, und sich so bald wie möglich wieder melden. Zum Schluss hatte sie Liz noch angefleht, für sie zu beten – und auf keinen Fall nach Key West zu kommen.
Sie kämpfte gegen ihr schlechtes Gewissen und bemühte sich krampfhaft darum, nicht die Nerven zu verlieren. Um eine Lizenz als Sozialarbeiterin in Florida zu bekommen, hatte sie alle möglichen Bewerbungsformulare ausfüllen müssen. Das Büro in St. Louis hatte sie geschlossen, das Haus vermietet und – bis auf die wichtigsten Dinge, von denen sie sich nicht trennen wollte – ihren Besitz eingelagert. Egal, ob sie nervlich schon dazu in der Lage war oder nicht – sie hatte einfach hierher kommen müssen.
Liz ging durch ihr Büro und blieb vor dem Fenster zur Straße stehen. Versonnen starrte sie hinaus, während sie an Rachel dachte.
Wo bist du, Schwesterherz? Was ist mit dir passiert?
Und wo war ich, als du mich gebraucht hast?
Dieser letzte Gedanke traf sie bis ins Mark, und sie musste schlucken. Angestrengt versuchte sie, sich auf die ihr bekannten Tatsachen zu konzentrieren. Am Sonntag – es war der 15. Juli gewesen – war Rachel nicht zum Gottesdienst erschienen. Besorgt waren einige Mitglieder ihrer Gemeinde zum Pfarrhaus gegangen, um nach ihr zu sehen. Sie hatten die Tür unverschlossen und das Haus leer vorgefunden.
Die Polizei war verständigt worden, aber die Beamten hatten keinerlei Hinweise auf eine Straftat entdeckt. Es gab keine Leiche, keine Blutspuren, weder umgekippte Stühle noch andere Hinweise auf einen Kampf. Ihr Wagen stand nicht an seinem Platz, doch ihre Kleider, Toilettenartikel und andere persönliche Dinge waren alle noch da.
Wegen der fehlenden Beweise glaubte man, Rachel sei das Opfer eines unerklärlichen Unfalls geworden oder sie habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, der sie dazu veranlasst hatte, wegzulaufen.
Die Polizei neigte zu der letztgenannten Erklärung. Denn wenn Rachel tatsächlich in einen Unfall verwickelt gewesen wäre, warum war dieser dann nicht gemeldet worden? Wo war ihr Wagen? Ihr Kennzeichen war an sämtliche Polizeidienststellen des Landes gefaxt worden. In jedem Krankenhaus und jeder Leichenhalle in Süd-Florida lag ihr Foto. Nichts war dabei herausgekommen.
Man sagte, dass sie sich zuletzt merkwürdig benommen habe. Gläubige aus ihrer Kirchengemeinde hatten ausgesagt, der Ton ihrer Predigten habe sich von einem Tag auf den anderen geändert. Nicht mehr freundlich und versöhnlich waren ihre Worte gewesen, sondern schonungslos und unnachgiebig. Sie habe nur noch von Sünde gesprochen und nicht mehr von Erlösung. Ihre Aussagen waren so Furcht einflößend geworden, dass Familien mit kleinen Kindern nicht mehr gekommen waren, da sie befürchteten, ihre Jungen und Mädchen würden Albträume bekommen.
Liz konnte das nicht glauben. Von allen Menschen, die sie kannte, war Rachel diejenige mit der stabilsten Persönlichkeit. Selbst als Kind hatte ihre Schwester sich – im Gegensatz zu ihr selbst – von den Wechselfällen des Lebens nicht aus der Bahn werfen lassen. Rachel hatte immer in sich geruht, gleichgültig, mit welchen Problemen sie fertig werden musste: eine neue Schule, eine zerbrochene Beziehung, eine nicht bestandene Prüfung, die ständigen Streitereien ihrer Eltern.
Rachel hatte nicht nur aus allem stets das Beste gemacht; sie war auch ständig für Liz da. Sie unterstützte und ermutigte sie. Immer, wenn sie von Angst oder Unsicherheit überwältigt wurde, hatte die Schwester sie wieder aufgebaut.
Einmal hatte Liz sie gefragt, wie sie das schaffte. Sie hatte geantwortet, dass ihr unbeirrbarer Glaube an Gott sie schützte. Sie glaubte an die göttliche Vorsehung. Und durch den Glauben und das Vertrauen fand sie ihren Frieden.
Was also war mit ihrer Schwester geschehen, dass sie sich von einer nachsichtigen Pastorin, deren Lebensinhalt darin bestand, die Geschichte von Gottes Liebe und Vergebung zu verkünden, zu jener Person gewandelt hatte, wie sie im Polizeibericht beschrieben wurde?
Die Antwort glaubte Liz zu kennen. Es waren die kriminellen Machenschaften, die Rachel in ihrer Nachricht erwähnt hatte. Sie hatte Angst gehabt und die Schwester gewarnt, dass „sie“ möglicherweise mithörten. Und ihr etwas Böses antun wollten. Deshalb wollte sie sich jetzt um Hilfe bemühen.
Liz befürchtete, dass diese Unbekannten, von denen Rachel gesprochen hatte, ihre Schwester getötet hatten.
Sie ballte die Hände zu Fäusten. Der Polizei hatte sie von den Mitteilungen ihrer Schwester und von ihrem Verdacht erzählt. Aber das hatte die Beamten nicht dazu bewegen können, den Fall wieder aufzurollen. Im Gegenteil: Die Informationen bestärkten sie lediglich in ihrer Annahme, dass Rachel einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte.
Ein lautes Lachen schreckte Liz aus ihren Gedanken auf. Eine Gruppe von Teenagern hatte sich vor ihrem Fenster versammelt. Die Jungen und Mädchen schienen zwischen dreizehn und neunzehn Jahre alt zu sein; einer von ihnen hatte ein Baby in einer Trage auf dem Rücken. Ungepflegt, mit zerrissenen Jeans und T-Shirts mit Batikdruck sahen sie aus wie Straßenkinder oder späte Nachfahren der Hippies aus den sechziger Jahren.
Die Kinder des Regenbogenlandes. Liz erinnerte sich, dass ihre Schwester ihr von ihnen erzählt hatte. Im Gegensatz zu den Hippies der Sechzigerjahre waren die Kinder des Regenbogenlandes allerdings eine straff durchorganisierte, internationale Vereinigung, die sogar über eine eigene Website verfügte. Sie reisten von einem warmen Land zum nächsten und erbettelten sich ihren Lebensunterhalt. Auf den Key-Inseln hatten sie Christmas Tree Island in Beschlag genommen – ein unbewohntes Stück Land, auf dem nur Nadelhölzer wuchsen. Rachel hatte sich um sie kümmern wollen und sich vorgenommen, ihnen das Wort Gottes zu verkünden. Schließlich gehörte das zu ihren Aufgaben.
Hat Rachel ihr Versprechen gehalten? überlegte Liz, während sie die Gruppe nachdenklich betrachtete. Ihr Blick blieb auf dem Rücken eines Jungen hängen. Er war der größte und hatte die breitesten Schultern. Oder war Rachels Karriere auf Key West bereits zu Ende gewesen, ehe sie begonnen hatte?
Als ob der junge Mann ihren durchdringenden Blick spürte, drehte er sich um und schaute ihr geradewegs ins Gesicht. Seine dunklen Augen verursachten in ihr ein unbehagliches Gefühl. Langsam zog ein Lächeln über sein Gesicht, das ebenso amüsiert wie heimtückisch wirkte.
Liz wollte lachen oder frech zurückgrinsen, aber es gelang ihr nicht. Stattdessen stand sie wie erstarrt da, während ihr Herz so heftig gegen den Brustkorb hämmerte, dass es fast schmerzte.
Sekunden später wandte er den Blick ab, drehte sich um und ging mit seinen Freunden davon.
Liz atmete schnell ein und aus, während sie sich die Arme rieb. Plötzlich war ihr kühl geworden. Warum hatte er sie so angesehen? Wieso hatte er sie seine Verachtung spüren lassen?
Aufmerksam betrachtete sie ihr Spiegelbild in der Glasscheibe. Dünne Gestalt, blasser Teint. Mittelbraunes Haar, grüne Augen, der Mund ein wenig zu groß für ihr Gesicht.
Es gab Zeiten, da war sie attraktiv gewesen. Sie hatte dieses aufmunternde Lächeln gehabt, das Vertrauen erweckte und in anderen ein angenehmes Gefühl verursachte. Die Menschen fühlten sich zu ihr hingezogen. Man hatte sie gemocht.
Wo ist nur dieses zuversichtliche Lächeln geblieben? überlegte sie. Diese Selbstsicherheit, die manchmal an Vorwitzigkeit grenzte? Wann war sie so ängstlich geworden?
Nein. Trotzig streckte Liz das Kinn vor und betrachtete erneut ihr Spiegelbild. Sie hatte keine Angst. Wegen Rachel war sie nach Key West gekommen, und sie würde herausfinden, was mit ihr geschehen war, mit oder ohne die Hilfe der Polizei.
Sie würde nach ihr suchen – egal, welchen Preis sie dafür zahlen musste.
3. KAPITEL
Donnerstag, 1. November
23.35 Uhr
Larry Bernhardt stöhnte vor Vergnügen, während die Mädchen mit ihm Sex hatten. Zwei Mädchen. Beide waren jung und gelenkig, ihre Haut war samtweich und nicht von den Jahren gezeichnet.
Im Gegenteil: Beide waren so jung, dass es schon fast ein Verbrechen war, es mit ihnen zu treiben.
Larry krümmte sich und keuchte, als er den nahenden Orgasmus spürte. Die Mädchen waren kühn und hemmungslos. Sie rieben sich an ihm, umschlangen seinen Körper, und ihre Bewegungen waren flink und geschickt. Lippenpaare saugten an ihm, Hände streichelten und liebkosten ihn. Wie aus weiter Ferne nahm er die schmatzenden Geräusche der Lust wahr, und das scharfe Aroma von Sex stieg ihm in die Nase. Die Satinbettwäsche raschelte und schmiegte sich an ihre feuchten Körper.
Larry Bernhardt war ein Glückspilz. Der König der Welt.
Als ranghöchster Vizepräsident der Darlehensabteilung in der Island National Bank führte er ein fürstliches Leben. Es gab keinen Wunsch, den er sich nicht erfüllen konnte. Sein großzügiges Haus auf Sunset Key lag direkt am Meer auf einer Halbinsel, aus der die Erschließungsgesellschaften vor kurzem die teuerste und eleganteste Wohngegend von Key West gemacht hatten. Vom Balkon seines Schlafzimmers aus konnte er allabendlich die Sonne wie einen gewaltigen Feuerball im Meer versinken sehen.
Seine Sonne. Sein Meerblick. So etwas konnte man nur mit Geld erwerben. Mit einer geradezu unanständigen Menge Geld. Mehr als sogar ein König wie er selbst auf legale Weise zu verdienen im Stande war.
Er war kurz vor dem Höhepunkt und wurde fast wahnsinnig vor Lust. Die Zeit blieb stehen, die Erde hörte auf, sich um ihre Achse zu drehen, und einen Moment lang gehörten die Sonne, der Mond und die Sterne nur ihm allein.
Er kam mit einem lauten Schrei, während er am ganzen Körper zitterte. Blitze zuckten durch seinen Kopf, dann herrschte vollkommene Dunkelheit. Aber in dieser Finsternis wartete das Monster, dieses unvorstellbar böse Wesen. Es war gekommen, um ihn ganz und gar zu verschlingen.
Larry schrie auf. Mit einem Satz fuhr er im Bett hoch, und das Echo seines Schreis hallte von den Schlafzimmerwänden wider. Die Furcht erstickte ihn fast, und voller Panik schaute er sich im Zimmer um. Er war allein. Keine Mädchen. Keine Party. Er zerrte am Bettlaken, das sich wie eine Fessel aus Satin um seine Beine geschlungen hatte.
Als er sich von dem Stoff befreit hatte, griff er nach der halb geleerten Champagnerflasche, die auf dem Nachttisch stand, und stürzte ins Badezimmer. Er riss eine Schublade auf und suchte voller Hast nach einer bestimmten Medizin. Endlich fand er das Fläschchen, schüttete ein paar Beruhigungstabletten in die Hand und spülte sie mit dem Alkohol hinunter.
Sofort fühlte er sich besser. Er verließ das Badezimmer und ging hinüber zum Balkon. Die Champagnerflasche unter den Arm geklemmt, riss er die Balkontüren auf. Vom Ozean her wehte eine angenehme Brise herüber. Gierig sog er die feuchte, salzige Luft ein. Sie machte ihm den Kopf frei, vertrieb die Dunkelheit und das Monster, das auf ihn wartete. Zwei Etagen tiefer schimmerte der Swimmingpool im Mondlicht. Auf der anderen Seite der hohen Mauer, die sein Grundstück umschloss, lag das Meer. Larrys Blick fiel auf den gefliesten Innenhof.
Er steckte zu tief drin. Nichts hatte er dagegen unternommen, dass seine Sucht ins Unersättliche gewachsen war. Sie war ein unbezähmbares Monster mit einem unerbittlichen, unstillbaren Appetit geworden. Und er war zu schwach, sich zur Wehr zu setzen. Alle moralischen Bedenken hatte er in den Wind geschlagen, um dieses Monster zu füttern, hatte jede erdenkliche Sünde begangen, zu der ein Mensch fähig war.
Er hatte ihnen erlaubt, seine Sucht zu dem Ungeheuer zu machen, als das er es mittlerweile empfand. Den Klauen dieses Monsters würde er nie wieder entkommen können.
Abgesehen davon würden sie ihm ohnehin nicht gestatten, sich davon zu befreien.
Tränen traten ihm in die Augen und liefen über sein Gesicht. Tränen des Selbstmitleids. Tränen einer jämmerlichen, verlorenen Seele. Tränen eines Mannes, der niemanden mehr um Hilfe bitten konnte und der genau wusste, dass nur noch die Hölle auf ihn wartete.
Die Hölle wäre allerdings immer noch besser als dieses Gefängnis, das er sich selbst errichtet hatte. Besser eine Marionette in der Hölle als ein Schwächling auf der Erde.
Seine Tränen versiegten. Ein Gefühl von Stärke und Entschlossenheit bemächtigte sich seiner. Es reichte. All dem hätte er schon längst ein Ende setzen sollen. Gewollt hatte er es zwar schon lange, aber er hatte sich immer wieder verführen lassen.
Denn er war schwach. Ein kleiner, wankelmütiger, lächerlicher Mann.
Es reicht, dachte Larry erneut. Er öffnete das Medizinfläschchen, schüttete sich die restlichen Tabletten in den Mund und schleuderte es über die Balkonbrüstung. Dann setzte er die Champagnerflasche an die Lippen und leerte sie mit gierigen Zügen.
Verdammt. Er liebte guten Champagner. Den würde er wirklich vermissen.
Er stellte die Flasche neben sich und kletterte unbeholfen auf das Balkongeländer. Seine Handflächen waren feucht, und sein Puls raste. Er hockte sich hin und umklammerte das Metall mit festem Griff, während er versuchte, das Gleichgewicht zu halten.
Wenigstens dieses Mal würde er nicht klein beigeben. Zumindest dieses eine Mal wollte er stark sein.
Sollten sie doch ohne ihn weitermachen. Sollten sie doch zusehen, wie sie mit dem Chaos fertig wurden. Hoffentlich würden sie alle auf dem elektrischen Stuhl landen.
Das entsetzliche Monster sprach aus der Dunkelheit zu ihm, besänftigend und einschmeichelnd. Larry konnte allerdings auch den verzweifelten Unterton in seinem Flehen hören. Tu es nicht. Besiege deine Feinde. Du bist der König der Welt. Du kannst es schaffen.
Unwillkürlich musste Larry kichern. Es klang schrill, wie das Lachen eines Mädchens. Das Monster hatte Recht – er konnte tatsächlich alles schaffen.
Er konnte auch das hier schaffen.
Larry ließ das Geländer los und richtete sich zu voller Größe auf. Er hob die Arme und ließ sich nach vorne fallen. Für den Bruchteil einer Sekunde stellte er sich vor, zu fliegen. Aus seinen Armen wurden Flügel, unter denen sich der Wind vom Ozean fing und ihn davontrug. Weit weg von diesem Augenblick und von ihm selbst, von seiner Krankheit und dem Monster, das sie genährt hatte.
Eine Sekunde später stellte Larry Bernhardt sich gar nichts mehr vor.
4. KAPITEL
Samstag, 3. November
9.30 Uhr Ricks Island Hideaway war die Bar auf Key West. Aus den Lautsprechern klangen Songs von Jimmy Buffet, dazu gab es eiskalte Margaritas für die gut gelaunten Gäste, die selten etwas anderes als Shorts und farbenfrohe Hawaiihemden trugen. An den Wänden hing Fischereizubehör, darunter ein ausgestopfter Seglerfisch und ein signiertes Foto des einstmals berühmtesten Einwohners auf Key West: Ernest Hemingway. Es war übrigens das gleiche Foto, das in neunzig Prozent aller Kneipen auf der Duval Street hing.
Und schließlich gab es noch einen Barkeeper, der mit seinem Charme einen Drachen hätte bezaubern können.
In dieser Beziehung war Rick Wells ein Naturtalent; liebenswürdig zu sein war für ihn genauso selbstverständlich wie Atmen. Es war eine Begabung oder eher ein Gottesgeschenk, auf das Rick baute, ohne sich dessen besonders zu rühmen. Er wusste, dass es viele Möglichkeiten gab, sich vor dem Leben zu verstecken. Auf einem Barhocker zu sitzen war eine davon. Ein gewinnendes Lächeln eine andere.
„Was kann ich Ihnen bringen?“ fragte Rick den Mann, der auf den Hocker vor ihm rutschte. Seinem frisch gebügelten Hemd und seinem offensichtlichen Kater nach zu urteilen war er ein Tourist. Und sicherlich keiner, der wegen einer Tasse Kaffee gekommen war.
„Onkel Jack, schwarz und ohne alles.“
Jack Daniels, Black Label. Um halb zehn morgens wäre ein Kaffee sicher die bessere Wahl, dachte Rick. Aber schließlich war er weder die Mutter, Ehefrau noch der Beichtvater dieses Typen.
Rick füllte ein Glas und schob es über den Tresen. „Muss ja eine tolle Nacht gewesen sein.“
Der Mann nickte, während ein kaum merkliches Lächeln seinen Mund umspielte. „Diese Stadt ist einfach klasse.“ Er setzte das Glas an die Lippen. „Haben Sie zufällig die heutige Ausgabe der New York Times?“
„Es ist nicht leicht, eine aktuelle Times hier zu kriegen. Die gehen schnell weg und kosten ein Heidengeld. Das ist eine Frage der Geografie, mein Freund.“
Der Tourist fluchte. „Na prima. Dann wird meine Frau noch wütender auf mich sein, als sie es ohnehin schon ist.“ Er schüttelte den Kopf. „Je älter die Weiber werden, umso weniger Humor haben sie.“
„Kann ich nicht beurteilen. Auf dem Gebiet kenne ich mich nicht aus.“
Der Mann warf ihm einen neidischen Blick zu. „Sie sind wohl nicht verheiratet, wie?“
„Nicht mehr“, antwortete Rick. Er bemühte sich um einen beiläufigen Tonfall, während er das beklemmende Gefühl in seiner Brust verfluchte, das ihn wie aus heiterem Himmel überfiel.
„Na ja, Sie können mir glauben, wenn ich es Ihnen sage.“ Der Mann leerte sein Glas und schob es zu Rick hin, damit er nachgießen konnte. „Keine Times. Kaum zu glauben.“ Halb zweifelnd und halb geistesabwesend schüttelte er den Kopf. „Sie sehen trotzdem aus wie jemand, der ganz zufrieden ist. Wie schaffen Sie das bloß?“
„Für ein Leben im Paradies kann ich gut und gern auf ein paar Annehmlichkeiten verzichten.“ Mit einem amüsierten Lächeln füllte Rick das Glas erneut. „Außerdem ändert sich nichts an den Nachrichten, auch wenn ich sie heute nicht lesen kann. Morgen sind sie genauso beschissen. Oder übermorgen.“
„Da haben Sie Recht, Mann. Der 11. September macht uns allen ganz schön zu schaffen.“
„Wenn Sie das Neueste vom Tage wissen wollen, dann lesen Sie doch den Miami Herald.“
Der Tourist leerte das zweite Glas. „Sie haben nicht zufällig ein Exemplar, oder?“
„Aber klar.“ Rick griff unter den Tresen und holte die Zeitung hervor, die er bereits von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hatte. Er legte sie auf die Bar. „Viel Vergnügen.“
„Danke, ich ...“
„Marty!“ rief eine Frau. Sie stand am Eingang und klang ziemlich missgelaunt. „Ich dachte, du wolltest mir eine Zeitung besorgen?“
Der Mann verdrehte die Augen und erhob sich. „Hab ich auch, Darling.“ Er warf eine Zehn-Dollar-Note auf die Theke, griff nach der Zeitung und eilte zur Tür.
„War nett, mit Ihnen zu plaudern“, rief Rick ihm hinterher. Dann lächelte er breit, als Valentine Lopez die Bar betrat. Valentine, der von allen nur Val genannt wurde – abgesehen von seiner Mutter und dem Priester, der ihn getauft hatte –, war Ricks ältester Freund.
„Welch eine Ehre für mich, den Sherlock Holmes von Key West persönlich begrüßen zu dürfen.“
„Das meine ich auch, Freundchen“, entgegnete Val, als er zu Rick hinüberschlenderte. „Wie ich sehe, verplemperst du deine Zeit immer noch in Margaritaville.“
„Jeder so, wie er’s am besten kann.“ Rick grinste und zeigte auf den Barhocker, der vor dem Tresen stand. „Erzähl mir, was du auf dem Herzen hast.“
Die beiden Männer waren „Conchs“, wie die aus Key West gebürtigen Amerikaner spöttisch genannt wurden, aber beide kamen aus Gesellschaftsschichten, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Ricks Familie hatte sich auf Key West niedergelassen; sein Vater war Arzt, seine Mutter eine High-Society-Schönheit aus West Palm Beach. Während eines Urlaubs waren seine Eltern vom „Key-West-Bazillus“ befallen worden, wie die Einheimischen es nannten. Noch ehe ihr einwöchiger Aufenthalt zu Ende gewesen war, hatten sie beschlossen, nie wieder fortzugehen. Sein Vater hatte seine Praxis in Tampa verkauft und eine neue auf der Insel eröffnet.
Vals Familie dagegen stammte von den ältesten kubanischen Einwanderern ab, die auf der Insel Fuß gefasst hatten. Seine Vorfahren hatten in den Zigarrenfabriken und in der Schwammindustrie gearbeitet. Vals verstorbener Vater war Garnelenfischer gewesen. Ein anständiger Beruf, wenn auch kein besonders lukrativer.
Die beiden Jungen hätten sich vermutlich nie getroffen und erst recht kein so enges, fast brüderliches Verhältnis zueinander entwickelt, wenn sie woanders aufgewachsen wären. Doch trotz der unterschiedlichen finanziellen Mittel und ihrer Herkunft waren Rick und Val die besten Freunde geworden. Ein einziges Mal nur war ihre Kameradschaft auf eine Bewährungsprobe gestellt worden: als Rick das Mädchen geheiratet hatte, für das Val schwärmte.
Val rutschte auf den Barhocker. „Hast du noch einen Kaffee?“
„Den besten café con leche auf der ganzen Insel.“
„Meine Mutter wäre bestimmt anderer Meinung.“
„Okay, den zweitbesten. Ich werde den Teufel tun und mich mit dieser Frau anlegen. So knallhart, wie diese kleine Person ist.“
Rick kümmerte sich um den kubanischen Espresso und machte Milch heiß. „Wie läuft es denn so im Revier?“ fragte er mit lauter Stimme, um das Zischen des Kaffee-Automaten zu übertönen.
„Sagen wir mal so: Wenn du dich entschieden hast, erwachsen zu werden, lass es mich sofort wissen. Ich könnte dich gebrauchen.“
Im Polizeirevier von Key West arbeiteten einundachtzig vereidigte Officers und zweiundzwanzig Zivilangestellte. Val war der ranghöchste Detective der Mannschaft und einer von den fünf Officers, die unmittelbar dem Polizeichef unterstellt waren.
„Mich gebrauchen? Oh je, dann muss es wirklich schlimm sein.“
Val wurde ernst. „Ehrlich, Rick. Du bist ein Cop. Einer der besten, die ich jemals ...“
„Ich war ein Cop“, verbesserte Rick ihn. Er stellte den café con leche vor seinen Freund. „Und das ist schon lange her.“
„Du bist ein Cop“, entgegnete Val. „Das liegt dir im Blut. Es ist genau das, was ...“
„Vergiss es“, murmelte Rick. „Lass uns lieber das Thema wechseln.“
„Es ist jetzt schon mehr als drei Jahre her. Du musst endlich mal vergessen.“
Rick hatte das Gefühl, ersticken zu müssen. „Sag mir nicht, was ich tun muss. Du hast überhaupt kein Recht dazu. Ich werde sie nie vergessen. Niemals.“
Zwischen den beiden Männern entstand ein unbehagliches Schweigen. Bis vor drei Jahren war Rick ebenfalls Detective bei der Polizei von Key West gewesen; davor hatte er in Dade County bei Miami als Cop gearbeitet. Er war ein fähiger und furchtloser Polizist gewesen, ein kampferprobtes As mit einem Killerinstinkt, der niemals schlief.
Eine persönliche Tragödie hatte Rick veranlasst, aus Miami fortzugehen. Bei seiner Frau war Unterleibskrebs diagnostiziert worden. Ein paar Monate später war er bereits Witwer und allein erziehender Vater eines am Boden zerstörten, fünfjährigen Sohnes. Voller Verzweiflung war er nach Key West zurückgekehrt, denn er brauchte seine alten Freunde, seine Familie und einen besseren Ort, um Sam großzuziehen.
Ganz unbürokratisch hatte Val ihm einen Job bei der Polizei von Key West verschafft. Obwohl es ihm nicht leicht gefallen war, sich mit der Tatsache zu arrangieren, dass er nicht länger als leitender Detective bei komplizierten Mordfällen ermittelte, sondern nur noch bewaffnete und unbewaffnete Einbrüche und Überfälle bearbeitete, hatte Rick die Chance dankbar ergriffen. Und er genoss das geruhsamere Tempo einer Kleinstadt.
Doch nur wenige Monate später geriet sein mühsam erkämpfter Seelenfrieden erneut aus dem Lot: Zwei bewaffnete Männer waren nachts in Ricks Haus eingebrochen. Schüsse fielen, und Sam, der von dem Lärm aufgeweckt wurde, war bei dem Schusswechsel ums Leben gekommen.
Die ballistischen Untersuchungen hatten ergeben, dass eine von Ricks Kugeln ihn getötet hatte.
Val schob seinen Kaffee beiseite und erhob sich. „Ich glaube, ich habe meinen Schönwetter-Bonus für heute Morgen bis an die Grenzen ausgeschöpft.“
„Sei kein Idiot“, fuhr Rick seinen Freund an. „Trink deinen Kaffee, oder du kriegst von mir einen Tritt in den Arsch.“
Fast unmerklich lächelte Val und setzte sich wieder hin. „Du trittst mir in den Arsch? Das ist wohl Wunschdenken. Du bist doch überhaupt nicht mehr in Form, mein Freund.“
Tatsächlich waren die beiden Männer nicht nur von ihrer Herkunft, sondern auch vom Aussehen vollkommen unterschiedlich. Val war klein, hatte einen drahtigen Körper und die dunkle Hautfarbe seiner kubanischen Vorfahren. Rick dagegen maß einen Meter neunzig, hatte blaue Augen und blondes Haar.
„Meinst du?“ Rick schaute an sich hinunter. „Ich sehe kein Gramm Fett zu viel.“
„Es ist eine Frage des Trainings. Mein Körper ist eine tödliche Waffe, während deiner ...“
Rick brach in schallendes Gelächter aus. „Ist das vielleicht deine neue Masche bei den Frauen? Denk dir lieber was anderes aus. Mit der Methode kannst du heutzutage keinen Blumentopf mehr gewinnen.“
Val, der immer noch ledig und nach eigener Einschätzung ein echter Playboy war, musste grinsen. „Du vielleicht nicht. Aber was mich betrifft – in meinem Schlafzimmer stapeln sich die Blumentöpfe.“
„Mir dreht sich der Magen um, wenn ich das höre.“
„Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, das zu akzeptieren, doch es ist die reine Wahrheit. Die Frauen fliegen auf mich. Wenn du willst, überlasse ich dir gern die eine oder andere.“ Mit unverschämtem Grinsen sah er Rick an. „Ich könnte ein Doppeldate arrangieren, wie wir es in der Schule immer gemacht haben.“
„Vergiss es, alter Junge. Trotzdem vielen Dank.“
„Immerhin ist Jill jetzt schon fast vier Jahre tot“, sagte Val leise.
Rick wandte den Blick ab. Er starrte auf die geöffnete Tür, durch die man einen rechteckigen Ausschnitt der sonnenüberfluteten Straße sehen konnte. „Der Typ, der rausging, als du gekommen bist, hat sich über seine Frau beklagt. Er hat mich um mein Single-Dasein beneidet. Aber ich konnte nur an eines denken: dass kein Tag vergeht, an dem ich mir nicht wünsche, sie hätte lange genug gelebt, um mir das Leben zur Hölle zu machen.“
Val unterdrückte einen Fluch. „Tut mir Leid, alter Knabe. So habe ich es nicht gemeint ...“
„Vergiss es. Das ist schließlich mein Problem.“
Ein paar Sekunden herrschte angespanntes Schweigen. Val leerte seine Tasse. „Ich muss los. Das Verbrechen ruft.“
„Etwas Interessantes?“
„Eine vermisste Person.“
„Einfach so abgehauen?“
„Ich bin mir nicht sicher.“ Val erhob sich. „Die Abteilungsleiterin der Datenverarbeitung bei der Island National Bank ist gestern nicht zur Arbeit erschienen. Eine Kollegin, die mit ihr befreundet ist, hatte versucht, sie zu erreichen. Als sie heute Morgen auch nicht zum Joggen aufgetaucht war, hat sie uns benachrichtigt.“
Rick runzelte die Stirn. „Es ist Naomi Pearson, stimmt’s?“
„Ja. Du kennst sie?“
„Ich bin Barkeeper. Ich kenne fast jeden auf der Insel.“ Er überlegte, wie und wann er sie kennen gelernt hatte. „Für das Hideaway habe ich einen Kredit bei der Island National aufgenommen. Ich glaube, ich habe sie mal getroffen, als ich dort war. Hoffentlich ist ihr nichts zugestoßen.“
„Ach, bestimmt nicht. Sie hat wahrscheinlich nur einen Typen kennen gelernt und ist mit ihm für eine Weile abgetaucht.“ Val salutierte. „Lass mal von dir hören. Ich stehe immer noch im Telefonbuch.“
5. KAPITEL
Samstag, 3. November,
16.30 Uhr
„Hallo, Boss“, rief Mack Morgan, als er Ricks Island Hideaway betrat. „Was gibt’s Neues?“
Rick saß mit dem Rücken zur Tür und hatte den Blick auf den Fernseher geheftet, der hinter der Bar an der Decke hing. Der lokale TV-Sender brachte gerade die Fünf-Uhr-Nachrichten.
Er warf seinem Helfer einen Blick über die Schulter zu und lächelte. „Nicht viel. Oben in Homestead hat es einen Anthrax-Alarm gegeben. Ein eifersüchtiger Ehemann hat seiner künftigen Ex-Frau einen Brief geschickt, in dem weißes Pulver war.“
„Und was war es wirklich?“ wollte Mark wissen.
„Stärkemehl. Aber wegen der Sache haben sie das gesamte Bürogebäude geschlossen, in dem die Frau arbeitet. Was geht bloß in solchen Leuten vor?“
„Die finden das wohl witzig. Tatsächlich sind sie krank.“
Rick konzentrierte sich wieder auf den Bildschirm. „Jetzt ist es auch amtlich. Beim Fantasy-Fest waren in diesem Jahr deutlich weniger Leute. Das überrascht mich aber nicht.“
Das Fantasy-Fest, eine neuntägige Halloween-Feier, die in einer gigantischen Kostümparty auf der Duval Street gipfelte, war die ausgelassenste Party, die Mark jemals erlebt hatte. „Wenn das in diesem Jahr wenig Leute waren, dann möchte ich nicht dabei sein, wenn es wirklich voll ist.“
Rick schaltete den Apparat aus. „Libby hat angerufen. Sie kommt später.“
„Kein Problem. Ich springe für sie ein.“
Libby, eine der Kellnerinnen, die abends arbeiteten, kam ständig zu spät. Sie war ein echtes Partygirl, blieb die ganze Nacht auf und verschlief den halben Tag. Vorsichtshalber bestellte Rick sie deshalb eine Stunde früher, als er sie tatsächlich brauchte.
Grinsend ging Mark zur Stechuhr und stempelte seine Karte ab. So war Rick nun mal. Von seinen Leuten forderte er ganzen Einsatz, aber dafür war er auch sehr entgegenkommend; ein Perfektionist, der stets gelassen blieb, wenn es so etwas überhaupt gab. Er wusste genau, was er wollte, war allerdings auch immer bereit, jeden erdenklichen Umweg zu gehen, um sein Ziel zu erreichen.
Genau das gefiel Mark an seinem Boss. Er arbeitete gern für ihn. Gott, so glaubte er, habe ihm etwas Gutes tun wollen, als er dafür sorgte, dass er Rick Wells über den Weg gelaufen war.
Wie viele Menschen auf der Insel lebte auch Mark erst seit relativ kurzer Zeit hier. Vor zwei Jahren hatte er die Abschlussprüfung an der Highschool in Humble, Texas, gemacht und danach, sehr zum Kummer seiner Familie, entschieden, dass er vorläufig genug von der Schule hatte und ein wenig von der Welt sehen wollte. Nachdem er eine Weile ziellos durch den Südwesten Amerikas gezogen war, landete er schließlich in South Florida und dann auf Key West.
Durch einen Zufall war er auf Ricks Island Hideaway gestoßen. Ein Schild am Fenster, „Hilfe gesucht“, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Rick hatte ihn sofort eingestellt. Mark war nicht sicher, ob er den Job bekommen hatte, weil sie auf Anhieb prächtig miteinander auskamen, oder weil Mark keinen Tropfen Alkohol trank, was auf dieser Insel eine Seltenheit war.
„Wie war denn dein Tag?“ fragte Rick, während er zur Tür ging.
Mark dachte an seine Freundin Tara, die er seit drei Monaten kannte. Im Laufe des Tages hatte er ihr fast ein halbes Dutzend SMS geschickt, sie hatte jedoch nicht eine beantwortet.
Hatte sie etwa schon die Nase voll von ihm?
Beiläufig zuckte er mit den Schultern. „Ganz okay. Und Ihrer?“
„Auch nicht schlecht. Das Geschäft lief ganz gut, wenn auch nicht atemberaubend. Val war hier.“
„Schön.“ Mark band sich eine Schürze um und ging zum Tresen. Die Gesetze in Florida schrieben vor, dass man einundzwanzig Jahre alt sein musste, ehe man Alkohol ausschenken durfte; und da er erst zwanzig war, kümmerte er sich um alles andere im Hideaway, vom Gläserspülen bis zum Auffüllen der Vorräte; er putzte den Fußboden und fegte die Straße vor der Bar. Es war keine besonders anspruchsvolle Arbeit, aber fürs Anspruchsvolle schien Mark ohnehin nicht geschaffen.
„Gibt es irgendwas, das zuerst gemacht werden muss?“ fragte er Rick, der ihm nach draußen gefolgt war.
„Fang mit den Gläsern an, dann mach den Rest sauber, bevor die durstige Meute kommt. Wisch mal über Tische und Stühle, und dann kannst du den Fußboden putzen.“
„Wird gemacht, Boss.“
Schweigend ging Mark seiner Arbeit nach, während seine Gedanken wieder zu Tara schweiften. Sie hatten sich kennen gelernt, kurz nachdem er den Job bei Rick bekommen hatte. Er war mit seiner Arbeit beschäftigt gewesen, während sie sich mit ihren Freunden vergnügte. Ihre Blicke hatten sich getroffen, und sofort hatte es bei ihnen gefunkt. Es kam wie aus heiterem Himmel und wirkte wie ein Stromschlag.
Liebe auf den ersten Blick.
Das Problem war nur, dass sie erst siebzehn und noch in der Highschool war. Aber sie ging in die letzte Klasse und würde kommenden Mai ihren Abschluss machen. Schlimmer als ihr jugendliches Alter waren allerdings ihre Bekannten. Sie gehörte zu einer Gruppe, die fest zusammenhielt und mehr ein Club war als eine Freundesclique. Ständig veranstalteten sie ausgelassene Partys, nahmen Drogen und schliefen kreuz und quer miteinander. Außerdem vertraten sie Ansichten, die Mark vollkommen widerstrebten. Alles, woran sie glaubten, war eine Existenz im Hier und Jetzt; sie lebten ausschließlich in der Gegenwart und nicht für die Zukunft, und sie genossen jeden Moment in vollen Zügen.
Als er erfahren hatte, mit welchen Leuten sie verkehrte, hatte er ihr gesagt, dass es aus sei zwischen ihnen. Aber sie hatte ihn gebeten, ihr Freund zu bleiben. Da sie ihn liebte, wollte sie sich von ihren Freunden trennen und von deren Lebensweise Abstand nehmen.
Bis jetzt war es ihr noch nicht geglückt. Allerdings hatte er auch nicht das Gefühl, dass sie sich ernsthaft darum bemühte.
Ob sie wohl wieder den ganzen Tag mit ihnen verbracht hat? überlegte er, während er ein Tablett mit sauberen Gläsern auf die Schultern stemmte und zur Bar ging. War sie mit ihren Freunden durch die Gegend gezogen? Hat andere Jungs getroffen? Und ihr gewohntes Partyleben fortgesetzt?
Heiße Wut stieg in ihm hoch. Er bemühte sich, dagegen anzukämpfen. Zorn war eine mächtige, zerstörerische Kraft. Eine der sieben Todsünden, gegen die er oft anzukämpfen hatte. Und die ihn schon einmal in Schwierigkeiten gebracht hatte – in große Schwierigkeiten.
Tara hat sich doch geändert, versuchte er sich einzureden. Er musste einfach an sie glauben und ihr vertrauen. Schließlich liebte er sie.
Mark seufzte. Tara hatte keine Verständnis für seine religiösen Überzeugungen, und ihm war es unbegreiflich, dass sie gar keine hatte. Er war in einer strengen Baptistenfamilie in den Südstaaten aufgewachsen, und in seiner Kindheit hatte die Kirche eine wichtige Rolle gespielt. Tatsächlich hatte er in der ersten Klasse aller Welt verkündet, dass er Prediger werden wollte. Von diesem Vorsatz war er erst kurz vor seinem Highschool-Abschluss abgekommen.
Plötzlich hatte er das Gefühl gehabt, eine andere Richtung einschlagen zu müssen.
Über seinen Sinneswandel war seine Familie entsetzt und betrübt gewesen. Sie hatte ihn angefleht, seinen Entschluss noch einmal zu überdenken, und ihren Pastor gebeten, ein Machtwort zu sprechen. Aber Mark hatte sich in seiner Entscheidung nicht beirren lassen. Er hatte damit argumentiert, dass er die Sünde zunächst einmal aus erster Hand kennen lernen musste, ehe er gegen sie predigen konnte. Wie hätte er andere Menschen dazu bringen können, standhaft zu sein, wenn er nicht selbst in Versuchung geführt worden war?
Mark stellte die Gläser in die Regale hinter der Theke. Er hörte, wie Rick am anderen Ende der Bar mit zwei Touristen darüber redete, wo die besten Angelplätze für Knochenfische waren und wo man einen Führer mieten konnte. Als ihm die Ironie seiner Situation bewusst wurde, musste er schwer schlucken. Jetzt steckte er bis zum Hals in der Sünde, musste jeden Tag in seine persönliche Schlacht ziehen. Meistens kehrte er aus diesem Krieg nicht als Sieger heim.
Nachdem er die Gläser sortiert hatte, widmete Mark sich den Tischen und Stühlen. Er merkte, wie die Zeit verging. Zuerst kamen nur vereinzelt Gäste in die Bar; bald jedoch würden sie das Lokal in Scharen stürmen. Libby war inzwischen auch eingetroffen und flirtete mit zwei Männern, die Schnaps und Bier tranken. Mark kannte sie; es waren Stammkunden. Sie kamen mehrmals die Woche, waren immer zusammen und trugen beide Baseballkappen der Miami Dolphins.
Wo steckte Tara nur den ganzen Tag? Warum hatte sie auf seine Nachrichten nicht reagiert?
In letzter Zeit hatte sie sich ohnehin recht merkwürdig verhalten – sie war nervös und zerstreut gewesen und hatte oft geweint. Dünn war sie geworden, hatte immer müde gewirkt und dunkle Ringe unter den Augen gehabt.
Vielleicht liebte sie ihn ja in Wirklichkeit gar nicht. Vielleicht bevorzugte sie ihre Freunde und deren wildes Leben.
Inzwischen ging es hoch her in der Bar, und Mark gelang es, jeden Gedanken an sie zu verdrängen, bis er in einer etwas ruhigeren Phase die Möglichkeit fand, sie anzurufen.
Er wählte ihre Nummer von Ricks Geschäftstelefon aus. Als er ihre Stimme hörte, war er erleichtert und verärgert zugleich. „Wo bist du gewesen?“
„Nirgendwo“, antwortete sie sofort. Sie klang abwehrend.
„Ich habe dir heute fünf SMS geschickt. Du hast nicht geantwortet.“
„Der Akku ist leer. Mist!“
Er empfand ein bohrendes Schuldgefühl, konnte es aber überspielen, indem er empört tat. Sie hätte ihn doch wirklich anrufen können! „Hast du es heute getan? Wie du versprochen hast? Hast du deinen Freunden gesagt, dass du nichts mehr mit ihnen zu tun haben willst?“
„Was ist denn los mit dir?“ rief sie. „Ich habe nichts Falsches getan. Meine Freunde habe ich heute nicht einmal gesehen!“
Er atmete schwer. Nicht zum ersten Mal wünschte er, mit ihr Schluss gemacht zu haben, als er entdeckte, wer ihre Freunde waren. „Du hast mir dein Versprechen gegeben, Tara. Doch du hast es nicht gehalten.“
„So einfach ist das nicht. Das kannst du nicht verstehen.“
„Oder bin ich es, mit dem du nicht mehr zusammen sein willst, Tara? Willst du mir das damit sagen?“
„Nein. Ich liebe dich, und du weißt es.“ Ihre Stimme zitterte. „Aber heute bin ich ...“
Sie schluckte die restlichen Worte hinunter, und er spürte, wie etwas in seiner Brust wuchs – ein Gefühl der Enttäuschung und Verzweiflung. Wieder so eine von ihren fadenscheinigen Entschuldigungen. Warum musste er sich auch von allen Mädchen auf dieser Welt ausgerechnet in dieses verlieben?
„Ich bin diese Gespräche so leid, Tara. Ich habe es satt, dass du mir sagst, du liebst mich, und dann drehst du dich um und ...“
„Ich muss Schluss machen.“
„Tu mir das nicht an. Den ganzen Tag habe ich mir Sorgen um dich gemacht, und jetzt ...“
Rick steckte seinen Kopf durch die Bürotür. „Ich brauch dich draußen. Mach Schluss.“
Mark nickte und hielt einen Finger hoch, um ihm zu verstehen zu geben, dass er nur noch eine Minute brauchte.
Als Rick das Büro verlassen hatte, konzentrierte er sich wieder auf Tara. „Bitte, Baby, sprich mit mir.“
„Wir sehen uns später.“ Durchs Telefon konnte er hören, wie ihre Eltern nach ihr riefen. „Unser üblicher Treffpunkt.“
Er schluckte seine Enttäuschung hinunter. „Bist du sicher, dass du dich loseisen kannst? Das letzte Mal bist du nicht gekommen.“
„Ich werde da sein. Ich ...“ Ihr versagte die Stimme. „... ich liebe dich, Mark.“
Ehe er etwas erwidern konnte, hatte sie aufgelegt. Ein paar Sekunden lang hielt Mark den Hörer noch ans Ohr, während die unterschiedlichsten Gefühle in ihm kämpften. Schließlich legte er auf und lief zurück in die Bar. Rick musterte ihn mit sorgenvoll gerunzelter Stirn. „Alles in Ordnung?“ fragte er.
Mark zögerte. Der Barkeeper war sein Freund. Zudem war er ein kluger Mann. Er würde ihm helfen können, seinen Rat und seine Unterstützung anbieten.
Er öffnete den Mund, um ihm zu antworten und die ganze Geschichte zu erzählen – wie er Tara kennen gelernt hatte und ihre ausgelassenen Freunde, dass er an ihr zweifelte. All das lag ihm auf der Zunge. Aus den Augenwinkeln nahm er Libby wahr, die offensichtlich die Ohren spitzte.
Dann dachte Mark daran, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn er sich Rick offenbarte. Tara war noch nicht volljährig. Er glaubte zwar nicht, dass Rick ihre Eltern verständigen würde, aber falls er es doch tat ... dann konnte alles Mögliche geschehen. Man könnte ihn festnehmen, weil er sich mit einer Minderjährigen eingelassen hatte.
Ihre Eltern würden sie auseinander bringen.
Mark hatte sie noch nicht einmal kennen gelernt. Tara hatte jedes Mal beinahe einen Tobsuchtsanfall bekommen, wenn er das Thema zur Sprache brachte. Sie seien sehr streng, hatte sie ihm erzählt, und würden es nicht dulden, wenn sie sich mit einem Jungen traf, der nicht aus der Gegend und dazu noch älter war. Sie würden sich wer weiß was ausmalen. Deshalb hatte Tara darauf bestanden, dass sie zu niemandem, nicht einmal zu ihren Freunden, ein Wort darüber verloren, wie ernst ihre Beziehung war.
Also schluckte Mark die Worte, die ihm auf der Zunge lagen, hinunter und antwortete: „Alles ist bestens, Boss. Danke der Nachfrage.“
Der lauschige, hinter hohen Mauern verborgene Park der Paradise Christian Church war Marks und Taras heimlicher Garten Eden geworden. Das Tor wurde zwar bei Einbruch der Dämmerung verschlossen, aber Tara hatte einen eigenen Schlüssel, da sie zu den Freiwilligen gehörte, die Besuchergruppen durch die Kirche führten.
In dem Park hatten sie zum ersten Mal miteinander geschlafen. Auf dem weichen Gras, eingehüllt von den Düften der Nacht, einer Mischung aus Jasmin, Oliven und Ingwer. Dieses Erlebnis war so vollkommen gewesen und von einer so unglaublichen Süße, dass Mark sogar fast vergessen hatte, dass dies eine Sünde gewesen war.
Sie waren nicht verheiratet. Und Tara noch minderjährig. Absichtlich drangen sie in Gottes Garten ein. Unter seinen Blicken hatten sie gesündigt.
War es denn eine Sünde, wenn sie einander liebten? Wenn sie sich geschworen hatten, für immer zusammenzubleiben?
Mark kämpfte gegen seine Schuldgefühle an, als er auf das Parktor zuging. Es war gegen drei Uhr morgens. Kein Laut war zu hören, und die nächtlichen Straßen lagen verlassen da. Das Tor war offen. Als er davor stand, warf er einen prüfenden Blick über die Schulter, ehe er hineinschlüpfte.
„Tara!“ rief er leise, während er das Tor hinter sich zuzog. Etwas raschelte im Unterholz. Ein Vogel, der sich auf einem der Bäume häuslich eingerichtet hatte, protestierte krächzend gegen die nächtliche Ruhestörung.
Das Geräusch ließ Mark zusammenfahren. Schließlich beruhigte er sich wieder und drang weiter in den Park vor. „Tara!“ wiederholte er. „Ich habe heute Nacht keine Lust auf dieses Spiel.“
Die Sekunden schienen endlos lang zu sein. Plötzlich empfand er eine unerklärliche Beklommenheit. Gerade wollte er noch einmal ihren Namen rufen, als sie unvermittelt hinter einem der Banyanbäume hervortrat, die am anderen Ende des Parks wuchsen – eine zierliche, weiß gekleidete Figur, die sich gegen die Dunkelheit abzeichnete.
Die Freude, sie zu sehen, vermischte sich mit seinem Zorn. Er hatte den Eindruck, dass sie mit ihm und seinen Gefühlen spielte. „Was soll denn das?“ fragte er unwirsch, als er vor ihr stand. „Einen Moment lang habe ich geglaubt, dir sei etwas passiert. Oder dass du überhaupt nicht hier bist.“
Sie hatte geweint. Er legte eine Hand auf ihre feuchte Wange. „Was ist denn los?“
Tara vergrub das Gesicht in den Händen und ließ den Kopf hängen. Ihr langes, dunkles Haar fiel wie ein Vorhang über ihre Finger.
„Sprich mit mir, Liebling.“ Er nahm ihre Hände und zog sie von ihrem Gesicht fort. „Sag mir, was passiert ist.“
Ihre großen dunklen Augen füllten sich mit Tränen. „Ich bin schwanger!“ rief sie. „Heute war ich beim Arzt, und er ... er ...“
Sie begann zu schluchzen. Die Wut und die Eifersucht, gegen die er den ganzen Tag angekämpft hatte, lösten sich mit einem Schlag in nichts auf. Er bemühte sich, seine Stimme wiederzufinden. Als es ihm endlich gelungen war, klang sie belegt. „Ich habe gedacht, dass wir ... haben wir denn nicht aufgepasst?“
Ihr Weinen wurde heftiger, und er schalt sich wegen seines mangelnden Einfühlungsvermögens. Offenbar waren sie doch nicht vorsichtig genug gewesen.
„Es tut mir Leid, Tara. Bitte weine nicht. Ich liebe dich. Es wird alles gut.“
„Wie denn? Was sollen wir denn tun? Eine Abtreibung kostet ...“
„Niemals“, entgegnete er erhitzt. Wieder griff er nach ihren Händen und drückte sie fest. „Ich liebe dich. Du liebst mich. Das ist unser Baby, unser Kind.“ Plötzlich war er sich seiner Sache ganz sicher, und seine Furcht verschwand. „Wir werden heiraten und eine Familie sein.“
„Aber ... wie? Wir sind ... ich habe Angst, Mark“, sagte sie hilflos.
„Ich passe auf dich auf, Tara. Das verspreche ich dir.“
„Und wir werden glücklich sein“, murmelte sie mit brüchiger Stimme. „Wirklich glücklich, nicht wahr?“
Sie klang verängstigt wie ein kleines Kind. Viel zu jung, um Ehefrau und Mutter zu werden.
Beide waren sie zu jung und längst noch nicht so weit, um die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Gefühlsmäßig nicht und erst recht nicht, was ihre finanziellen Mittel anbetraf.
Unvermittelt wurde er von Panik erfasst. Was tat er da eigentlich? Tara hatte sich auf Sachen eingelassen, die vollkommen gegen seine Überzeugung waren. Konnte sie überhaupt die Frau an der Seite eines Geistlichen werden? Wie würde sie sich verhalten? Wäre sie in der Lage, ihren Kindern ein Vorbild zu sein?
Jetzt war es zu spät, sich darüber Sorgen zu machen.
Sie würden bald ein Baby haben. Er würde Vater werden.
Ihretwegen musste er stark bleiben. Jetzt durfte er keine Schwäche zeigen und nicht an seinen Gefühlen zweifeln. Wenn er ihr den rechten Weg zeigte, würde sie ihm folgen. Denn sie glaubte an ihn. Sie liebte ihn.
Und er liebte sie.
Er schloss sie in die Arme. „Liebes, erinnerst du dich noch daran, was ich dir erzählt habe? Ich hatte das Gefühl gehabt, eine Stimme würde mich nach Key West rufen. Ich war der Meinung, von Gott hierher geführt worden zu sein, ohne den Grund dafür zu kennen. Und ich hatte geglaubt, dass er mit mir etwas Besonderes vorhat?“
„Ja“, antwortete sie schwach. „Aber was ...“
„Ich glaube, das ist es, Tara. Gott hat mich zu dir geführt. Er hat gewollt, dass wir dieses Baby bekommen und eine Familie werden.“
Sie legte den Kopf zurück und sah ihm in die Augen. „Meinst du wirklich?“ Die Hoffnung in ihrer Stimme schmerzte ihn zutiefst.
„Ganz gewiss“, versicherte er ihr. Auf einmal klang seine Stimme fest und überzeugt. „Lass dich von ihm führen, Tara. Wenn du das tust, wenn wir das tun, wird alles gut werden. Es war alles so vorherbestimmt. Wir sind füreinander bestimmt.“
6. KAPITEL
Montag, 5. November
8.45 Uhr