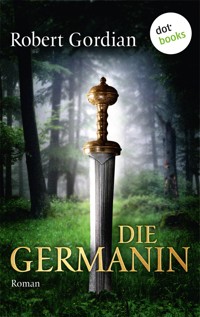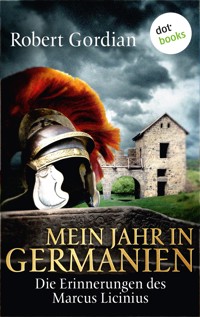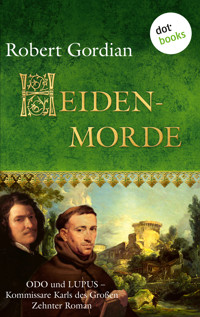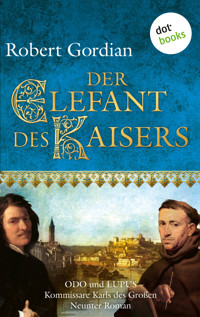9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Schwertkämpfer und ein Mönch auf Mörderjagd: Vier historische Krimis von Robert Gordian im Sammelband »Blut und Sünde« als eBook bei dotbooks. Heimtückische Morde, unschuldige Verdächtige und Intrigen der durchtriebensten Art: Ende des 8. Jahrhunderts ist das Reich der Franken ein gefährlicher Ort, zumal sich die Sachsen und Thüringer immer noch an ihre alten Sitten und Gesetze klammern. Kaiser Karl weiß, dass hier mehr als die Kraft eines Schwertes gebraucht wird – und entsendet zwei Kommissare, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der Adlige Odo ist tapfer bis zur Tollkühnheit, der Mönch Lupus dagegen ein Rechtsgelehrter, der sich auf die Kunst der Diplomatie versteht. Doch während der eine sich allzu leicht von den Reizen schöner Damen ablenken lässt, kann der andere einfach nie »Nein« sagen zu einem weiteren Krug Bier … und so geraten die beiden immer wieder in brenzlige Situationen! »Ein buntes, spannendes Bild aus frühmittelalterlicher Zeit – und zwei Detektive, die mit Humor und Spürsinn selbst die dunkelsten Fälle lösen. Wer meint, nur die Angelsachsen verstünden es, aufregende Thriller aus mittelalterlichen Tagen in Szene zu setzen, der wird durch Robert Gordian eines Besseren belehrt.« NDR Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Blut und Sünde« vereint die ersten vier Kriminalromane der Mittelalter-Saga rund um Odo und Lupus, die Kommissare Karls des Großen – »Demetrias Rache«, »Saxnot stirbt nie«, »Pater Diabolus« und »Die Witwe«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Heimtückische Morde, unschuldige Verdächtige und Intrigen der durchtriebensten Art: Ende des 8. Jahrhunderts ist das Reich der Franken ein gefährlicher Ort, zumal sich die Sachsen und Thüringer immer noch an ihre alten Sitten und Gesetze klammern. Kaiser Karl weiß, dass hier mehr als die Kraft eines Schwertes gebraucht wird – und entsendet zwei Kommissare, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der Adlige Odo ist tapfer bis zur Tollkühnheit, der Mönch Lupus dagegen ein Rechtsgelehrter, der sich auf die Kunst der Diplomatie versteht. Doch während der eine sich allzu leicht von den Reizen schöner Damen ablenken lässt, kann der andere einfach nie »Nein« sagen zu einem weiteren Krug Bier … und so geraten die beiden immer wieder in brenzlige Situationen!
»Ein buntes, spannendes Bild aus frühmittelalterlicher Zeit – und zwei Detektive, die mit Humor und Spürsinn selbst die dunkelsten Fälle lösen. Wer meint, nur die Angelsachsen verstünden es, aufregende Thriller aus mittelalterlichen Tagen in Szene zu setzen, der wird durch Robert Gordian eines Besseren belehrt.« NDR
Über den Autor:
Robert Gordian (1938–2017), geboren in Oebisfelde, studierte Journalistik und Geschichte und arbeitete als Fernsehredakteur, Theaterdramaturg, Hörspiel- und TV-Autor, vorwiegend mit historischen Themen. Seit den neunziger Jahren verfasste er historische Romane und Erzählungen.
Robert Gordian veröffentlichte bei dotbooks bereits die Romane ABGRÜNDE DER MACHT, MEIN JAHR IN GERMANIEN, NOCH EINMAL NACH OLYMPIA, XANTHIPPE – DIE FRAU DES SOKRATES, DIE EHRLOSE HERZOGIN und DIE GERMANIN sowie drei historische Romanserien:
ODO UND LUPUS, KOMMISSARE KARLS DES GROSSEN
Erster Roman: Demetrias Rache; Zweiter Roman: Saxnot stirbt nie; Dritter Roman: Pater Diabolus; Vierter Roman: Die Witwe; Fünfter Roman: Pilger und Mörder; Sechster Roman: Tödliche Brautnacht; Siebter Roman: Giftpilze; Achter Roman: Familienfehde
DIE MEROWINGER
Erster Roman: Letzte Säule des Imperiums; Zweiter Roman: Schwerter der Barbaren; Dritter Roman: Familiengruft; Vierter Roman: Zorn der Götter; Fünfter Roman: Chlodwigs Vermächtnis; Sechster Roman: Tödliches Erbe; Siebter Roman: Dritte Flucht; Achter Roman: Mörderpaar; Neunter Roman: Zwei Todfeindinnen; Zehnter Roman: Die Liebenden von Rouen; Elfter Roman: Der Heimatlose; Zwölfter Roman: Rebellion der Nonnen; Dreizehnter Roman: Die Treulosen; diese Serie gibt es auch als Sammelband mit über 2.100 Seiten unter dem Titel DAS DUNKLE LIED VON MACHT UND BLUT.
ROSAMUNDE, KÖNIGIN DER LANGOBARDENErster Roman: Der Waffensohn; Zweiter Roman: Der Pokal des Alboin; Dritter Roman: Die Verschwörung; Vierter Roman: Die Tragödie von Ravenna; diese Serie gibt es auch als Sammelband unter dem Titel DAS HERZ EINER KÖNIGIN.
Ebenfalls erschien bei dotbooks die beiden Kurzgeschichtenbände EINE MORDNACHT IM TEMPEL und DAS MÄDCHEN MIT DEM SCHLANGENOHRRING sowie die Reihe WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN mit kontrafaktischen Erzählungen über berühmte historische Persönlichkeiten:
WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN: Caesar, Chlodwig, Otto I., Elisabeth I., Lincoln, Hitler
WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN: Napoleon, Paulus, Themistokles, Dschingis Khan, Bolívar, Chruschtschow
WÄREN SIE FRÜHER GESTORBEN: Karl der Große, Arminius, Gregor VII., Mark Aurel, Peter I., Friedrich II.
***
Sammelband-Originalausgabe Dezember 2021
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe »Demetrias Rache« 1995 Bleicher Verlag, Gerlingen
Copyright © der Originalausgabe »Saxnot stirbt nie« 1995 Bleicher Verlag, Gerlingen
Copyright © der Originalausgabe »Pater Diabolus« 1996 Bleicher Verlag, Gerlingen
Copyright © der Originalausgabe »Die Witwe« 1996 Bleicher Verlag, Gerlingen
Copyright © der Neuausgaben 2012, 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung verschiedener Bildmotive von shutterstock/Everett-Art, Nongnuch_L, lightmood, Kuemyus
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-187-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Blut und Sünde« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Gordian
Blut und Sünde
Odo und Lupus ermitteln – Vier Romane in einem Band
dotbooks.
Am Ende jedes Romans finden Sie ein Personenverzeichnis und am Ende dieses eBooks in einem Glossar zahlreiche Wort- und Sacherklärungen.
Demetrias Rache
Das Frankenreich, Ende des 8. Jahrhunderts. Im Auftrag Karls des Großen bereisen zwei Männer das Land, die unterschiedlicher nicht sein können: Der Adlige Odo ist tapfer bis zur Tollkühnheit und stets bereit, sich von den Reizen der Damenwelt den Kopf verdrehen zu lassen; Lupus hingegen ist ein Mönch und hochgebildeter Rechtsgelehrter, auch wenn er nie etwas gegen einen weiteren Krug Bier einzuwenden hat. Ihre Mission: Für Recht und Ordnung sorgen. So auch, als der Dichter Siegram angeklagt wird, eine junge Edeldame ermordet zu haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn – bis zu dem Moment, als ein unerwarteter Zeuge hoch zu Ross in die Gerichtsverhandlung sprengt …
Kapitel 1
Dem teuren Volbertus, Prior des Klosters N., entbietet sein Vetter Lupus Grüße und Heil.
Gewiss wartest Du schon mit Spannung auf neue Nachrichten von mir, doch lange Zeit passierte nicht viel und so schwieg ich lieber.
Die meiste Zeit saß ich in der Kanzlei und kopierte Akten des Hofgerichts. Manchmal setzte ich auch selbst irgendwelche Urkunden auf. Gelegentlich berief mich der Herr Pfalzgraf als Beisitzer zu Verhandlungen, bei denen es aber immer nur um langweilige Dinge wie Vormundschafts- und Erbangelegenheiten ging. Ich fürchtete schon, ich würde hier als Schreiber verkümmern und alle meine Studien des römischen, salischen, ripuarischen, alemannischen, bayrischen und sächsischen Rechts wären umsonst gewesen.
Aber ich beklage mich nicht, heißt es doch in der Heiligen Schrift: »Strebe nicht nach höherem Stande. Denn es gehört sich nicht, dass du nach dem gaffst, was dir nicht befohlen ist.«
Doch plötzlich hat sich alles geändert. Ich habe ein Amt und ich bin unterwegs!
Die Reise ist lang und beschwerlich und das Ziel ist noch nicht erreicht, doch schon nach wenigen Tagen hatte ich ein Erlebnis, von dem ich Dir gleich berichten will.
Es handelt sich um die höchst seltsame Geschichte zweier Morde, an deren Aufklärung ich einigen Anteil habe.
Ich erinnere mich, dass Du gelegentlich die Absicht geäußert hast, ungewöhnliche Geschichten zu sammeln, um sie, mit frommen, belehrenden Kommentaren versehen, der Nachwelt zu überliefern. Vielleicht lohnt es sich, diese in deine Sammlung aufzunehmen.
Du fragst Dich natürlich, woher ich unterwegs die Zeit für die Niederschrift dieser Abhandlung nehme. Durch Umstände, von denen Du im Laufe der Erzählung erfahren wirst, hat sich für uns ein längerer Aufenthalt bei einem Grafen Hrotbert ergeben. Im Augenblick kann ich nichts weiter tun als warten. So werde ich mir das Vergnügen machen, beim Schreiben noch einmal alles nachzuerleben. Dass auch Du Dich beim Lesen gut unterhältst, sei Dir gegönnt, denn Dein gottgefälliges Dasein ist sonst ja recht eintönig. Ich habe auch nichts dagegen, dass Du diese Blätter an einige Brüder Deines Vertrauens weitergibst. Doch Vorsicht! Die Darstellung eines Kriminalfalles ist mit den Lektürevorschriften der Regel des heiligen Benedikt kaum vereinbar und also nicht etwa, wenn Du die scherzhafte Übertreibung erlaubst, dazu geeignet, als Ersatz für den erbaulichen Text bei den Mahlzeiten im Refektorium zu dienen.
Ob es aber nun Sünde ist, dies zu lesen, musst Du selbst beurteilen. Notfalls kannst Du die Verfehlung ja beichten, wobei ich freilich davon überzeugt bin, dass der Bischof, Dein Beichtvater, nachdem er dich absolviert hat, begierig sein wird, sie selbst zu begehen.
Zunächst erfahre, mein lieber Volbertus, wie es zu meiner Reise gekommen ist und um was für ein Amt es sich handelt.
Du wirst staunen.
Sicher weißt Du, dass sich diesmal, im Jahr 788 nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, die Großen des Frankenreichs zu ihrer jährlichen Generalversammlung in der Ingelheimer Pfalz einfanden. Auch Teile des Heers waren aufgeboten, um, wie es hieß, gegen die Awaren zu ziehen. Über das Hauptereignis, den Prozess gegen den Bayernherzog Tassilo, bist du wohl ebenfalls unterrichtet, denn zweifellos war auch Euer ehrwürdiger Abt anwesend. Ich habe ihn zwar nicht bemerkt, doch was besagt das schon? Sonst hatten wir in der Pfalz viel Platz, aber nun herrschte fürchterliches Gedränge. Auf Schritt und Tritt begegnete man hohen Persönlichkeiten – Heerführern, Kriegshelden, Kirchenfürsten und berühmten Streitern für die Sache unseres Glaubens. Das Auge konnte sich nicht satt sehen und dabei entging ihm wohl dieser und jener.
Für uns in der Kanzlei waren das natürlich Wochen der angestrengtesten Arbeit. Fast jeder, der anreiste, brachte ja irgendeine unerledigte Angelegenheit mit, die am Hofe entschieden werden musste. Bereits in aller Frühe, während er sich noch ankleidete, empfing der König die ersten Besucher zum Vortrag. Kaum hatte er seine Hosen an, sprach er schon Recht. Das Hofgericht tagte ununterbrochen. Berge von Akten stapelten sich auf unseren Tischen, und manchmal hörten wir stundenlang nichts als eine einzige monotone Musik: das Kratzen von fünfzehn, zwanzig Federn auf Pergament.
An diesem Morgen nun war ich gerade an mein Schreibpult getreten, um mich niederzulassen und mein Tagewerk zu beginnen, als der Herr Kanzler, mein Vorgesetzter, eintrat und mich zu sich rief.
»Höre, Lupus«, sagte er »du bist zu unserm Herrn König befohlen. Es werden dort Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Grafen und andere hohe Herren anwesend sein. Der König wird eine wichtige Neuerung im Reiche bekanntgeben, an der auch du teilhaben sollst.«
»Um was handelt es sich?«, fragte ich verwundert. »Und was hätte ich, ein einfacher Diakon, in einem so vornehmen Kreis zu suchen?«
»Warte nur ab, das wird sich finden. Dein Fuldaer Abt, Herr Baugulf, hat dich als Kenner des Rechts empfohlen. Das ist ja der Grund, weshalb du hier bist. Noch konnten wir dich nicht angemessen beschäftigen. Ich vermute aber, das wird sich ändern. Übrigens werden nicht nur hohe Amtsinhaber und Würdenträger anwesend sein, sondern auch andere verdiente Männer, für die unser König neue Aufgaben hat. Geh nun also und lege die schäbige Kutte ab, die Ärmel sind ja vom Schreibpult ganz durchgescheuert. Du hast doch hoffentlich eine bessere?«
Glücklicherweise habe ich eine, die ich zu Festgottesdiensten oder anderen besonderen Anlässen trage. Nachdem ich am Brunnen Hals und Füße gewaschen und mich sorgfältig rasiert hatte, legte ich sie an und fand mich pünktlich zur befohlenen Stunde in der großen Palasthalle ein.
Der Herr Kanzler hatte nicht übertrieben. Unter denen, die nach und nach eintraten, waren hohe Herren aus den edelsten Geschlechtern des Reiches. Ich bemerkte den Herrn Erzkaplan, den Kämmerer, den Seneschalk und meinen Herren Kanzler selbst. In der Mitte der Halle sah man die farbenprächtigen Gewänder der hohen Geistlichkeit, daneben die schlichtere Tracht der weltlichen Machthaber, die sich mit silbernem Gürtelschmuck und goldenen Fibeln für ihre Mäntel begnügten. Wir weniger wichtigen Männer, Geistliche niederen Ranges wie ich und einfache Königsvasallen ohne Benefiz, standen seitlich unter den Säulen.
Schließlich verstummten alle Gespräche, denn zur Tür herein trat der Herr Karl, unser ruhmreicher, gottesfürchtiger König.
Ich brauche Dir nicht den Eindruck zu schildern, den sein Erscheinen immer wieder hervorruft. Du selbst hast ihn mir einmal beschrieben, nachdem der Herr Karl Euer Kloster besucht hatte. Seine hohe Gestalt, die Haltung, die Gesichtszüge – alles verriet den bedeutenden Herrscher. Auch diesmal bewunderte ich wieder seine Geringschätzung gegenüber äußerlichem Prunk, womit er ja schon manchen Fremden in Erstaunen gesetzt hat, der sich einen König, welcher von den Pyrenäen bis zur Elbe gebietet, nicht anders vorstellen konnte als in Samt und Seide, goldstarrend und mit Diamanten beladen. Ganz wie ein biederer Landedelmann trug der Herr Karl sein ledernes Wams mit dem alten blauen Wollmantel darüber, an dem sogar Zweige und Stroh hingen. Er kümmerte sich ja um alles. Vielleicht hatte er gerade die Pferdeställe und die königlichen Obstgärten inspiziert.
Nun aber ließ er sich auf seinem Thronsessel nieder und seine Miene, die gewöhnlich zwar respekteinflößend, doch gütig und mild ist, zeigte mit Ernst und Strenge an, dass es tatsächlich um eine hochwichtige Sache ging. Nachdem er sich kurz mit seinen Räten verständigt hatte, wandte er sich an die Versammlung.
»Meine Herren«, sprach er, »ich bin in tiefer Sorge. Aus allen Teilen des Reiches wird mir gemeldet, dass die Unordnung jedes Maß übersteigt. Kaum eine Straße ist noch sicher, in jedem Wald lauert Räubergesindel. Die adeligen Herren gebieten mit Willkür, die Rechtshüter kennen die Gesetze nicht, unter dem Volk verfallen die Sitten. In den Klöstern lebt man nicht nach der Regel und es gibt Priester, die nicht einmal das Vaterunser beherrschen!«
Der König machte eine Pause und ein allgemeines Gemurmel erhob sich. Viele sahen sich an und nickten bekümmert. Es hielt ihn nicht mehr in seinem Sessel, er sprang auf und ging mit weit ausladenden Schritten, vorbei an den zurückweichenden Herren, die ihm eine Gasse bildeten, von einer Seite der Halle zur anderen.
»Aber das ist ja nicht alles!«, rief er. »Ich höre von Äbten, die die Immunität ihrer Klöster dazu missbrauchen, Übeltäter unserer Justiz zu entziehen. Ich höre von Grafen, die lieber Hirsche und Auerochsen jagen als das Verbrechergesindel in ihren Gauen. Andere nehmen Geschenke an und beugen das Recht zum eigenen Vorteil und dem ihrer Freunde und Verwandten. Ein Sumpf von Bestechlichkeit, Habsucht und Unmoral! Da soll es Bischöfe geben, die in betrunkenem Zustand die Messe lesen. Priester betreiben Zinswucher. Mönche prassen in Wirtshäusern und stellen verheirateten Frauen nach. An den Altären lagern Hunde und mancher geht nur in die Kirche, um dort zu schwatzen und Geschäfte zu machen. Hat unser Herr Jesus Christus nicht die Händler zum Tempel hinausgetrieben? Statt Gottesfurcht, Bildung und Zucht, wie wir es wünschen, finden wir Rohheit und Verwahrlosung. Ohne Hemmungen wird gemordet … aus Rache, aus Eifersucht, aus Gier nach Besitz. Schamlos wird gegen die Natur gesündigt, sogar unter den nächsten Verwandten. Man vergeht sich gegen die Witwen und Waisen und zieht den Ärmsten der Armen das Fell über die Ohren. Das dumme Volk kann sich auch von den heidnischen Bräuchen nicht trennen, es beschwört die Geister der Toten und betet immer noch Felsen, Bäume und Quellen an. Wettermacher und Wahrsager treiben ihr Unwesen. Neulich soll sogar ein Buch vom Himmel gefallen sein, das die haarsträubendsten Irrlehren enthält. Damit muss es ein Ende haben! Wir müssen handeln, meine Herren! Es genügt nicht mehr, mit den Qualen der Hölle zu drohen. Die Übeltäter und Rechtsbeuger kümmern sich nicht um das Jüngste Gericht. Deshalb müssen sie ihre Strafe auf Erden erhalten!«
So etwa sprach der Herr Karl und ließ einen langen, strengen Blick über unsere Reihen gleiten, als wollte er über uns alle als Mitschuldige den Königsbann verhängen. Aber dann tat er etwas ganz anderes und nun wurde mir endlich klar, warum ich die Ehre hatte, zu dieser Versammlung befohlen zu sein.
Schon sein Vater, der selige Herr Pippin, fuhr er fort, habe missi dominici ausgesandt. Diese Königsboten, als Kommissare des Herrschers seine Stellvertreter ad hoc oder mit Generalmandat, seien in die Lande des damals noch wesentlich kleineren Reiches gegangen, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen. Zu mehreren seien sie immer gereist, gewöhnlich zu zweit, ein Adeliger und ein Mann der Kirche, um die zwei stärksten Säulen zu repräsentieren, auf denen der Staat ruhe. Diese nützliche Einrichtung habe zu Zeiten seines Vorgängers viel dazu beigetragen, die Rechtssicherheit im Reich zu erhöhen, und so sei er entschlossen, sie wieder einzuführen.
Wir, die wir um ihn versammelt waren, sollten allesamt per verbum nostrum, ex nostri nominis auctoritate in wenigen Tagen, nach einer kurzen juristischen Vorbereitung und einer Eidleistung in der Pfalzkapelle als Königsboten hinaus ins Reich gehen!
Kannst Du Dir vorstellen, lieber Volbertus, wie mir zumute war? Dass mir der Schweiß ausbrach und das Herz bis zum Halse klopfte? Ich, ein einfacher Diakon, bis dahin nicht mehr als ein Wasserträger des Hofgerichts – und nun Königsbote!
Natürlich fragte ich mich gleich, wohin und mit wem ich reisen würde. Ich blickte mich vorsichtig um und versuchte, in den Gesichtern zu lesen. In meiner Nähe standen nur königliche Vasallen, aus deren Mienen Selbstbewusstsein und Genugtuung strahlten. Sie schienen das hohe Amt, das ihnen der Herrscher verlieh, als etwas zu nehmen, das ihnen zustand. Ich beneidete sie in diesem Augenblick. Das waren Krieger, kampferprobte Leute, Männer der Tat. Sie brauchten wahrhaftig nicht an sich zu zweifeln. Ich dagegen? Würde ich, ein Federfuchser und Büchermensch, einer solchen Bestimmung gewachsen sein?
Der König nahm wieder Platz und nun trat der Herr Pfalzgraf mit einer Liste neben den Thronsessel. Er las die Namen derjenigen vor, die gemeinsam in bestimmte Mandatsgebiete, sogenannte missatica, reisen sollten. In der Mehrzahl der Fälle war das schon festgelegt. Es stellte sich auch heraus, dass die meisten der Anwesenden, darunter alle Höhergestellten, vorher Bescheid gewusst hatten, denn sie zeigten auch jetzt keine Verwunderung oder Freude oder Enttäuschung. Einige große Herren hatten sich Mandate im sonnigen Burgund, im lieblichen Aquitanien und in den freundlichen, nahen, bequem erreichbaren Gauen der Alamannen gesichert.
Einer der jüngeren Königsvasallen, der neben mir stand, ereiferte sich darüber recht unverhohlen.
»Sie haben den Braten schon zerlegt«, bemerkte er mit bösem Spott, sodass alle ringsum es hören konnten. »Die fettesten Happen fressen sie selber!«
Diesen Mann muss ich Dir gleich ausführlicher beschreiben, denn er wird in meiner Erzählung die Hauptperson sein. Du ahnst schon warum!
Stelle ihn Dir hochgewachsen und schwarzhaarig vor, mit flinken braunen Augen und einer starken, kühn geschwungenen, an der Spitze leicht aufgebogenen Nase, unter der sich der gewaltigste Schnurrbart sträubt, den je ein Franke getragen hat. Wie alt er ist, weiß ich bis heute nicht, er macht ein Geheimnis daraus. Vermutlich ist er jünger als ich, also unter fünfunddreißig, was er jedoch nicht zugeben will. Sein Aufzug verriet auch an jenem Tag das Dilemma, in dem er steckt: zwischen dem Anspruch eines standesgemäßen Auftretens und seinen eher bescheidenen Mitteln. Betrachtete man ihn von Kopf bis Fuß, sah man den Glanz allmählich in Elend übergehen. Dem prächtigen, golddurchwirkten Stirnband und der mit einem Rubin geschmückten Fibel, die den seidenen Mantel hielt, folgten über der schäbigen Tunika ein einfacher Gürtel, darunter abgetragenen Hosen und unter den kreuzweise geschnürten Lederstrümpfen als kläglicher Abschluss ein Paar löchrige Stiefel, die längst ihren Abschied verdient hätten. Der Mann war ein wandelnder Widerspruch, aber auch ein witziger Kopf. Schon während der Rede des Herrn Karl hatte er halblaut in seinem romanischen Dialekt respektlose Bemerkungen gemacht. Natürlich hatte ich mich gehütet, ihm beizustimmen, mich aber im Stillen darüber belustigt.
Als jetzt die Mandatsgebiete im Nordwesten, in der Francia occidentalis, vergeben wurden, gebärdete sich mein Nachbar besonders lebhaft. Er grollte und brummte, wenn ihm wieder ein »fetter Happen« entgangen war. Auch er gehörte also zu denen, die wie ich noch nicht wussten, wohin man sie schicken würde.
Für das Gebiet um Paris, die berühmte Stadt in Neustrien, die mit den Regionen um Chartres und Evreux ein einheitliches missaticum bildete, war erst einer der Königsboten bestimmt, ein Bischof. Der weltliche Partner wurde noch gesucht, da der vorgesehene Kandidat für das Amt ein Kommando im Heer übernehmen sollte. Der König erkundigte sich, ob sich jemand bewerbe. Mein Nachbar drängte sich so heftig nach vorn, dass er mich beinahe umstieß.
»Ich, Herr! Sendet mich nach Paris!«
Der Herr Karl blickte skeptisch zu ihm herüber.
»Und warum glaubst gerade du, Odo, für diese Mission geeignet zu sein?«
»Weil Paris die Stadt der Könige ist. Meiner Vorfahren!«
»Deine Vorfahren waren dort Könige?«
»So ist es. Ich bin ein Nachkomme Chlodwigs.«
»Sieh einmal an, das wusste ich gar nicht. War denn ein Kebsweib des letzten Merowingers deine Großmutter?«
Da erhob sich dröhnendes Gelächter. Mein Nachbar, verlegen und wütend zugleich, fasste unwillkürlich nach seinem Gürtel. Aber dort steckte kein Schwert. Denn natürlich war es nur wenigen Großen gestattet, in der Nähe des Herrschers Waffen zu tragen.
Als endlich wieder Ruhe eintrat, setzte der Herr Karl, der ausgiebig mitgelacht hatte, seine Befragung fort.
»Über deine Herkunft wissen wir nun also Bescheid. Kannst du aber noch andere Gründe dafür anführen, dass du dich für Paris bewirbst?«
»Das kann ich!«, sagte mein Nachbar dreist. Er hob seine Faust und schüttelte sie. »Dort wird eine starke Hand gebraucht – so eine wie diese! Ich war oft genug in Paris, Herr König, ich kenne mich aus, das könnt Ihr mir glauben. Es gibt dort mehr Diebe und Räuber als Fliegen und Mücken, an jeder Straßenecke liegt ein Ermordeter. Das Blut läuft in Bächen die Gassen hinunter. Von den Witwen und Waisen schweige ich … sie werden von allen betrogen und ins Elend gestoßen. Dringend brauchen sie einen Beschützer. Erlaubt bitte, dass ich mich ihrer annehme!«
»Ja, vor allem der Witwen!«, rief einer der Herren.
»Und der Waisen, sofern sie Jungfrauen sind!«, tönte es aus einer anderen Ecke.
Wieder erhob sich ein großes Gelächter. Der König sprach kurz mit seinen Räten. Dann deutete er auf einen anderen Vasallen.
»Vizegraf Rollo! Mach du dich bereit für Paris und Chartres!«
Herr Odo, wie ihn der König genannt hatte, drehte sich heftig um und trat zurück in die Reihe. Ich allein hörte wohl den Fluch, den er zwischen zusammengebissenen Zähnen ausstieß. Es war der unanständigste, den ich je vernommen hatte.
Dennoch tat mein Nachbar mir leid. Er war verspottet und gedemütigt worden und ich hätte ihm gern etwas Tröstendes gesagt. Doch seine Miene war so finster und starr, dass ich es lieber unterließ.
Es wurden nun weitere missatica vergeben und obwohl auch manchmal der geistliche Amtsträger noch zu bestimmen war, wagte ich nicht, mich zu melden. Es waren auch immer einige schneller als ich und ich fürchtete schon, dass ich am Ende als Einziger übrig bleiben und gar nichts mehr abbekommen würde. Als ich doch einmal zaghaft einen halben Schritt vortrat und mich bemerkbar machen wollte, gab der Herr Kanzler mir ein Zeichen der Missbilligung, sodass ich mich rasch wieder zwischen die Säulen zurückzog.
Die Mandatsvergabe erfolgte von Westen nach Osten und so kam die Reihe schließlich an das wilde, gottlose Sachsen, das sich so lange gewunden und immer wieder aufgebäumt hatte wie der Lindwurm gegen die Lanze des heiligen Georg. Wir alle erinnern uns ja daran, wie der König Jahr um Jahr an der Spitze seiner Armee in ihre wüsten Wälder hinein drang. Nun hatte er die Sachsen endlich niedergeworfen. Die meisten wurden getauft, sogar ihr rebellischer Herzog Widukind. Viele sind aber noch immer verstockt, brechen ihre Schwüre, überfallen die fränkischen Grafen, brennen Kirchen nieder, schlagen Priester tot und wollen den Zehnten nicht zahlen.
So ist es bei ihnen besonders nötig, doch leider auch besonders gefährlich, im Namen Gottes und des Königs für Recht und Ordnung zu sorgen. Wie Du Dir denken kannst, gab es für diese Aufgabe keine Begeisterung. Schon als der Name der Sachsen genannt wurde, bekreuzigten sich viele in der Halle. Immerhin gelang es, für die sächsischen Westgebiete in der Nähe des Rheins, unserer alten Reichsgrenze, ein paar Mandate zu vergeben. Für die fast unbekannte Landschaft nahe der alten Thinkstätte Markloh in der Gegend der Weser und Aller hatte sich niemand vormerken lassen und fand sich auch jetzt niemand.
Vergebens sprach der Herr Karl ermunternde Worte. Er wies darauf hin, dass er befehlen könnte, jedoch in diesem Ausnahmefall der erhöhten Gefahr möglichst nach dem Prinzip der Freiwilligkeit verfahren wollte. Wir, die wir noch kein Mandat hatten, senkten die Köpfe und schwiegen hartnäckig. Herr Odo neben mir hatte sich abgewandt und verrenkte sich fast den Hals, um ein Wandgemälde zu betrachten, auf dem Kyros, Alexander, Romulus und Remus abgebildet waren.
Da trat unser Herr Erzkaplan vor und bat den König, ein Wort an die Versammlung richten zu dürfen. Mit gerötetem Gesicht und großer Beredsamkeit erinnerte er an unsere heiligen Märtyrer, die sich nicht vor den barbarischen Gefolgschaften Wodans und Saxnots gefürchtet hatten. Stellvertretend für alle nannte er den Namen Theofrieds, eines irischen Mönchs, der ein leuchtendes Beispiel gab, als er vor Jahren in das wüste Sachsen ging, um das Missionswerk fortzusetzen. Kein Lebenszeichen habe man seitdem erhalten. Verschollen sei der heilige Mann.
»Ist es nicht unsere Christenpflicht«, rief der Herr Erzkaplan, »uns dieses Unerschrockenen würdig zu zeigen? Müssen wir nicht seine Spur verfolgen und – falls ein Verbrechen an ihm verübt worden ist – die Täter finden und bestrafen?«
Nun war es totenstill in der Halle. Wenn Du dies liest, mein lieber Volbertus, denkst Du gewiss dasselbe wie ich in jenem Augenblick. Alle empfanden, dass es Christenpflicht war, doch niemand meldete sich. Viele hatten ja Theofried gekannt, auch ich erinnerte mich sehr gut an ihn. Er war ein willkommener, wenn auch aufgrund seiner frommen Streitsucht manchmal etwas anstrengender Gast in den Gemeinschaften unserer Klöster gewesen. Wie viele aufregende Stunden haben wir in Fulda mit ihm verbracht, wie viele nützliche Gespräche geführt. Von dort aus war er zu seiner gefährlichen Missionsreise aufgebrochen. Beim letzten Abschied hatten uns allen Tränen in den Augen gestanden.
Plötzlich war ich entschlossen.
Ich trat zwei Schritte vor und rief: »Erlaubt, Herr König, dass ich … dass ich unseren Bruder Theofried suche! Lasst mich dorthin reisen, zu den Sachsen. Bitte erweist mir die Gunst und gebt mir das Mandat!«
Durch die Halle ging ein Raunen der Erleichterung. Wohin ich in meiner Verlegenheit sah, begegnete ich freundlichen, anerkennenden Blicken. Nur Herr Odo grinste spöttisch, musterte mich wie einen Esel, der das Te deum laudamus singen wollte, und wandte sich wieder den Wandbildern zu.
Inzwischen hatte mein Herr Kanzler das Wort genommen. Er stellte mich vor, denn kaum jemand kannte mich. Er lobte mich sehr und strich meine Fähigkeiten heraus, besonders meine Kenntnis der alten Volksrechte. Eigentlich, sagte er, hätte er vorschlagen wollen, mich zu den Thüringern zu schicken, die auch noch auf der Liste des Pfalzgrafen stünden. Wenn aber der Herr König meine Bewerbung annehme, würde er das für eine weise Entscheidung halten.
Der Herr Karl nickte gnädig und sagte: »Deinem Antrag wird stattgegeben, Diakon Lupus! Ich hätte mich auch gewundert, wenn sich nicht ein einziger Franke für dieses Amt gemeldet hätte. Sind wir nicht mehr das alte Heldenvolk? Es soll sich jeder an Lupus ein Beispiel nehmen!«
Da empfing ich herzlichen Beifall und freundliche Zurufe. Vor Verlegenheit brannte mir der Kopf und meine Knie wurden weich wie Wachs. Wahrhaftig, ich fühlte mich wie eine Altarkerze!
Nun musste aber ein zweiter Königsbote für dieses Mandat bestimmt werden. Da sich noch immer niemand freiwillig meldete, befahl der Herr Karl den weltlichen Herren, die bisher kein Mandat hatten, vorzutreten. Es waren fünf.
»Ich will deinen Mut belohnen, Lupus«, sagte der König, »indem ich dir das Vorrecht einräume, deinen Amtsgefährten selbst zu benennen. Wähle unter diesen fünfen einen aus!«
Ich warf einen. Blick auf die Kandidaten. Ich hatte sie alle schon einmal gesehen, sie waren kleine Vasallen aus dem ständigen Gefolge des Herrschers. Vier von ihnen starrten mich an wie der Hase den Jäger. Der Fünfte kehrte mir den Rücken zu.
»Ich wähle diesen!«, sagte ich, auf den Rücken deutend, ohne Besinnen.
»Eine vortreffliche Wahl!«, rief der König. »Ich hätte dir Odo selbst empfohlen!«
Da fuhr Herr Odo herum, als hätte ein Keiler ihn mit seinen Hauern gekitzelt, und rief: »Was? mich? Ich soll …?«
»Ich kenne niemanden unter meinen Vasallen, der besser geeignet wäre«, fuhr der Herr Karl fort. »Deine edle Herkunft wird dir bei den Sachsen Respekt verschaffen. Von deiner Kühnheit hast du mir manche Probe gegeben. Deine starke Hand, mein lieber Odo, wird an der Weser gebraucht, nicht an der Seine. Ich hoffe, du enttäuscht mich dort nicht.«
Dies sprach der König in freundlichem, doch auch etwas ironischem Tonfall und gleich erhob sich wieder Gelächter. Vielen Herren sah man an, dass sie dem Odo gönnten, statt ins kurzweilige Paris ins barbarische Sachsen geschickt zu werden.
Er selbst brachte kein Wort mehr hervor und sandte nur einen Seufzer zum Himmel, der einen Felsblock rühren konnte.
Auf einmal bedauerte ich ihn wieder und gleich machte ich mir Vorwürfe. Ich hatte, die Erlaubnis des Königs missbrauchend, einen Fremden, der mir nichts getan hatte, zu etwas genötigt, was ihm zuwider war. Ich warf mir vor, aus Bosheit und Eitelkeit gehandelt zu haben, um ihm sein spöttisches, abweisendes Benehmen heimzuzahlen. Am liebsten hätte ich den König gebeten, ihm das Mandat wieder abzunehmen. Aber das war natürlich nicht möglich.
Steif und sprachlos standen wir nebeneinander. Die letzten missatica wurden verteilt. Alle freuten sich auf das angekündigte Festmahl und es herrschte schon allgemeine Unruhe. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und sprach Herrn Odo leise an.
»Ich habe den Eindruck, dass meine Wahl Euch verdrießt. Das war keineswegs meine Absicht. Wenn es so ist, dann bitte ich Euch um Verzeihung. Ich wünsche mir sehr, mit Euch in gutes Einvernehmen zu kommen.«
»Du blöder Pfaffe!«, zischte er. »Was hast du mir da eingebrockt! Warum hast du dir ausgerechnet mich ausgesucht? Hab ich dir nicht den Rücken zugekehrt?«
»Ich gestehe, das hat mir nicht gefallen. Deshalb wollte ich, dass Ihr mir Euer Gesicht zuwendet.«
»Nun, und was hast du davon?«
»Wir haben Bekanntschaft geschlossen. Ihr gefallt mir.«
»Darauf gebe ich einen Hundeschiss.«
»Das ist immerhin mehr als nichts.«
»Wart’s ab, du wirst es schon noch bereuen! Vor dem Alten hier großtun ist nicht schwer. Aber wie sich ein kleiner, schwächlicher Bierwanst im sächsischen Urwald zurechtfinden will, ist etwas anderes. Ich war schon dort, hab meine Erfahrungen. Willst du auch ein Märtyrer werden? Meinetwegen. Sollen sie dich fressen. Ich werde ihnen gute Verdauung wünschen!«
So sprach er zu mir, ließ mich stehen und ging fort. Die Versammlung war nämlich gerade beendet.
Um mich kümmerte sich niemand. Ich stand herum und haderte mit den heftigen Worten meines künftigen Amtsgefährten.
Mich klein und schwächlich und einen Bierwanst zu nennen! Was dem einfiel! Gewiss, mit meinen Körpermaßen kann ich nicht gerade mit den marmornen Säulen wetteifern, die der Herr Karl zur Ausschmückung seiner Pfalzen aus Italien herbeischaffen lässt. Aber bin ich nicht fest im Fleische und kräftig? Erinnerst Du Dich an unsere gemeinsame Fuldaer Zeit und an die beiden alten Chorherrn, deren Ochse im Schlamm stecken geblieben war? Bin nicht ich es gewesen, der ihn ausspannte, um ins Joch zu treten und der den Wagen mit den Chorherren zog … bis vor das Gästehaus?
Es gab nun viel Trubel und der Herr Seneschalk und der Herr Mundschenk rannten hinaus. Im nächsten Augenblick kamen sie wieder, gefolgt von Dienern, Köchen und Bäckern. Man trug Tische und Bänke herbei und Fässer mit Wein und Bier, ganze gebratene Ochsen und Wildschweine, Schüsseln mit Würsten, Körbe mit Backwerk und andere Herrlichkeiten. Musikanten spielten auf und die Lieblingshunde des Königs wuselten umher und schnappten sich Brocken, die man ihnen bereitwillig zuwarf.
Ach, und die Damen nicht zu vergessen! Unsere stolze Königin Fastrade rauschte herein. Sie ist sehr schön, doch macht sie stets ein Gesicht, als hätte sie gerade eine Kröte verschluckt. Und leichtfüßig hüpften die lieblichen Töchter des Herrn Karl in die Halle. Sie liefen zu ihrem Vater, der sie herzte und küsste und sie an seiner Seite Platz nehmen ließ.
Ich war ganz verwirrt von all dem Getümmel. Obwohl ich ja schon eine Weile bei Hofe war, hatte ich noch nie an einem so festlichen Schmaus teilgenommen. Ich empfing Rippenstöße und Nasenstüber. Ein Diener, der mich anrempelte, begoss mich mit heißer Brühe. Jemand, dem ich im Wege stand, stieß mich beiseite und im Fallen landete ich auf einer Bank an einem der Tische. Ringsum schmatzte schon alles und da stand auch schon eine Schüssel vor mir und ich brauchte nur hineinzugreifen. Der Wein dazu war nicht so ein saures Gesöff, wie wir es als Messwein verwenden, sondern herrlicher, sonnengereifter Burgunder. Ich leerte den Becher, den eine Magd vor mich hinstellte, in einem Zuge.
Plötzlich war Herr Odo neben mir. Er nötigte mich und meinen Tischnachbarn, etwas beiseite zu rücken und zwängte sich in die Lücke. Er hatte einen ganzen Krug Wein erbeutet, aus dem er mir und sich einschenkte. Mit Erleichterung bemerkte ich, dass mir mein neuer Amtsgefährte nicht mehr böse zu sein schien und dass seine Heiterkeit und Spottlust zurückgekehrt waren.
»Ich sehe, du lässt es dir noch einmal wohl sein«, sagte er, »bevor wir beide gemeinsam zur Hölle fahren.«
»Warum sollten wir?«, erwiderte ich ebenfalls heiter »Da ist nicht die geringste Gefahr, denn wir werden ja gottgefällige Werke tun.«
»Meinst du? Aber ich hoffe, du bist nicht kleinlich, wenn auch mal ein paar Sünden dabei sind. Die sächsischen Weiber …«
Er kniff ein Auge zusammen und lachte lauthals. Ich fiel mit Gekicher ein, weil ich ihn nicht wieder verärgern wollte. So kam zwischen uns eine Unterhaltung in Gang. Dabei sprachen wir dem Braten und den anderen Köstlichkeiten zu, unter deren Last die Tische fast brachen. Ein ernstes Gespräch war bei dem Lärm der fröhlichen Esser und Zecher ringsum natürlich nicht möglich. So redete jeder von dem, was ihm in den Sinn kam: Odo von Frauen, Pferden und Waffen, ich von Büchern, Reliquien und einer römischen Pilgerfahrt. Vom Essen verstanden wir beide etwas und so konnten wir alle Gerichte, die aufgetragen wurden, sachkundig beurteilen. Nach kurzer Zeit fühlten wir uns wie alte Bekannte, und Odo zog mich in sein Vertrauen.
»Nimm es mir nicht übel, dass ich dich vorhin beschimpft habe«, sagte er, indem er den Arm um meine Schultern legte. »Nicht du bist schuld daran, dass ich in diese Einöde muss. Der König kann mich nämlich nicht leiden. Er hätte mich auch dorthin geschickt, wenn du nicht gewesen wärst.«
»Aber was sollte er gegen dich haben?«
»Ich bin Merowinger – das reicht! Ein Spross vom alten fränkischen Königsgeschlecht. Zwar von einer Nebenlinie, aber ein echter, kein Bastard. Das weiß er genau, auch wenn er immer so tut, als sei es neu für ihn. Soll ich dir etwas verraten?« Jetzt kitzelte mich sein Schnurrbart am Ohr. »Ich hätte mehr Anspruch auf den Thron als er selbst! Seine Sippe, die Karolinger … die waren ja, wie jeder weiß, nur Hausmeier. Auch noch Pippin, sein Vater. Der hat den Thron usurpiert und den letzten rechtmäßigen König, meinen Onkel, den schickte er ins Kloster und …«
»Und ich bin überzeugt, dass dich trotzdem eine große Zukunft erwartet!«, unterbrach ich ihn, um das heikle Thema zu wechseln.
»Eine große Zukunft? Das will ich meinen!«, sagte er ernst. »Siehst du die junge Prinzessin dort an seiner Seite? Die Hübsche mit den hellblonden Locken und dem goldenen Stirnreif? Sie heißt Rotrud und sie liebt mich.«
»Sie liebt dich?«, fragte ich verblüfft.
»Erst kürzlich hat sie es mir gestanden. Wir haben auch schon Küsse getauscht, heimlich natürlich, während eines Jagdausflugs. Aber einer dieser widerlichen Ohrenbläser, von denen es hier wimmelt, muss es gesehen und dem Alten hinterbracht haben. Auch das ist ein Grund für ihn, mich zu entfernen, und zwar möglichst weit. Vielleicht hofft er sogar, dass mir etwas zustößt. Vergebens natürlich! In ein paar Monaten, wenn wir zurück sind, werde ich um sie anhalten.«
»Aber ist sie nicht noch ein Kind? Erst dreizehn Jahre alt?«
»Alt genug, um zu heiraten. Ihre Mutter, die selige Hildegard, war dreizehn, als sie zum ersten Mal niederkam. Was der König kann, kann ich auch! Zum Glück ist Rotrud nun wieder frei. Sie war schon einmal verlobt, mit dem byzantinischen Thronfolger. Der Alte hat die Verlobung platzen lassen … aus purem Eigennutz, weil er seine Töchter nicht hergeben will. Aber er hat nicht mit Odo von Reims gerechnet. Was ist? Du siehst mich so seltsam an. Glaubst du mir etwa nicht?«
»Ich wünsche dir Glück und Gottes Segen.«
»Sehr gut, das können wir beide brauchen. Auch du! Jetzt werden wir erst einmal große Taten vollbringen. Wir werden in diesem wüsten Sachsen eine mustergültige fränkische Rechtsordnung einführen. Und wenn wir ruhmbedeckt zurückkehren, muss mir der Alte endlich ein Benefiz geben. Oder besser gleich eine Grafschaft. Das wird er seinem künftigen Schwiegersohn schuldig sein. Und du … du bekommst auch deinen Anteil. Du wirst mindestens Bischof.«
Er lachte wieder und ich stimmte ein. Trotz unserer kurzen Bekanntschaft glaubte ich, ihn schon so weit zu durchschauen, dass ich ungefähr unterscheiden konnte, was der Wahrheit entsprach und was nur Geflunker war. An der Behauptung, er sei ein Nachkomme der Merowinger, mochte vielleicht etwas dran sein. Genaueres weiß ich bis heute nicht. Dass ihn aber die Tochter des Königs liebte, hielt ich für eitle Prahlerei, mit der er sich wichtig machen wollte. Die feixenden Mienen einiger Tischgenossen, die an dieser Stelle unseres Gesprächs ein paar Brocken aufgeschnappt hatten, bestärkten mich in dieser Ansicht.
Wie ernst es ihm aber damit war, sollte ich gleich darauf erfahren.
Zur Tür herein trat ein Sänger, ein bemerkenswert großer und schöner Mann mit auf die Schultern wallendem Blondhaar, im prächtigen, golddurchwirkten Gewand, die Harfe im Arm. Lächelnd, mit raschen, wiegenden Schritten durchmaß er die Halle. Sein seidener Umhang wehte ihm anmutig nach. Er neigte sich vor dem König und bedachte auch die königliche Familie und die wichtigsten Würdenträger mit vollendeten Reverenzen.
Der Lärm in der Halle ebbte rasch ab. Jeder wusste, wie sehr der König den Skops, den weit gereisten Dichtern und Sängern, zugetan war, wie aufmerksam er ihnen zu lauschen und wie missfällig er Störungen aufzunehmen pflegte. So beeilten sich alle, ihr Mahl zu beenden oder wenigstens zu unterbrechen. Da und dort wurden noch hastig ein paar Bissen verschlungen, Handrücken fuhren über Bärte und Münder, um das Fett abzuwischen. Odo füllte uns nochmals die Becher.
Ich war voller Vorfreude. Wann hat unsereiner schon mal Gelegenheit, andere Lieder zu hören statt, Gott verzeihe es mir, immer dieselben, die man in der Kirche singt?
Der Herr Karl richtete freundliche Begrüßungsworte an den Sänger und stellte ihm einige Fragen. Weil ich recht entfernt saß, verstand ich nicht alles. Nur soviel bekam ich mit, dass der Mann Siegram hieß und einem edlen angelsächsischen Geschlecht entstammte. Fast alle Gegenden des Frankenreichs und auch andere Länder habe er bereist, so erklärte er, weshalb er in der Lage sei, neben seinen eigenen Dichtungen manches vorzutragen, was man im Norden und Süden, Osten und Westen singe. Und er begann auch gleich mit einem Heldenlied, das sich der König ausdrücklich wünschte und dessen Vortrag wohl zuvor schon vereinbart war.
Das Lied stammte aus dem Langobardischen und war die Geschichte zweier Kämpfer, Vater und Sohn, die sich infolge eines widrigen Schicksals auf Leben und Tod gegenüberstanden, wobei der Vater den Sohn schließlich tötete.
Der Sänger verstand seine Sache, er wusste die Zuhörer zu fesseln. Seine hohe, doch kräftige Stimme drang bis in den letzten Winkel der Halle. Seine mimische und gestische Ausdruckskraft waren bewundernswert. Je nachdem, ob er den Vater oder den Sohn darstellte, wechselte er die Position. Mal war er mit verdüsterter Miene und herzergreifendem Sprechgesang der tragisch zerrissene, von der Last seines Schicksals gebeugte Hildebrand, dann wieder der kühne junge Hadubrand, der mit blitzendem Auge strahlende Töne schmetterte, die an Schlachttrompeten erinnerten. Seine wohl einstudierten Gebärden gefielen, anmutig hielt er die Harfe und ließ seine schlanken Finger flink über die Saiten hinweg gleiten.
Er erhielt kräftigen Beifall. Der König, von dem man weiß, dass er recht unwirsch sein kann, wenn ihm ein Vortrag nicht gefällt, rief:
»Großartig! Wunderbar!«
Auch ich war begeistert. Odo dagegen saß mit saurer Miene da und seufzte. Im ersten Augenblick dachte ich, dass er wie die meisten unserer biederen Franken wenig Sinn für Poesie und Sangeskunst hatte. Doch schnell begriff ich, was ihn störte. Nicht entgangen war ihm die hingebungsvolle Aufmerksamkeit, die Prinzessin Rotrud dem Künstler widmete.
Als Siegram nun ein zweites Lied vortrug, musste dies jedem in der Halle auffallen. Das Lied handelte von der Liebe eines edlen, aus seiner Heimat vertriebenen Schutzflehenden zu der schönen Tochter seines Gastgebers, eines mächtigen Fürsten. Der Sänger schwelgte in der Beschreibung der Vorzüge dieser jungen Dame, wobei er kein Auge von Rotrud ließ, die ihn ihrerseits mit schmachtenden Blicken verschlang. Das Versmaß holperte an diesen Stellen ein wenig, was zweifellos daher kam, dass Herr Siegram kräftig improvisierte, um mit seiner Dichtung der vor ihm sitzenden Schönen zu huldigen. Er verglich Rotruds Haar mit dem Strahlenkranz der Sonne, ihr Mündchen mit einer Rosenknospe und vergaß auch alles andere nicht. Der König nahm es heiter, doch die Königin, die ja selbst noch sehr jung ist und vielleicht nur gekränkt war, weil in ihrer Gegenwart die Vorzüge ihrer Stieftochter gerühmt wurden, zog ein noch saureres Gesicht als gewöhnlich und wandte sich ab. Viele Gäste tauschten Blicke und grinsten unverhohlen. Ich vermied es, Odo anzusehen, hörte ihn aber mehrmals entrüstet schnaufen.
Dann kam es noch besser. Nachdem der Sänger in jubelnden Tönen den Sieg der Liebe und die Vereinigung des edlen Schutzflehenden mit der Prinzessin verkündet hatte, sprang Fräulein Rotrud von ihrer Bank auf, trat ohne Scheu auf ihn zu, reckte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Alles blickte auf den König, der aber nur wohlwollend lachte und einem Diener winkte. Dieser brachte dem Sänger einen Silberpokal, den Lohn für seine Kunst. Siegram lächelte strahlend, schwenkte den Pokal wie eine Trophäe und dann beugte er sich zu Rotrud herab und küsste sie seinerseits. Sie spielte ein wenig die Empörte, fuhr mit der Hand in sein Lockenhaar und zauste es, lachte aber gleich wieder und eilte leichtfüßig an ihren Platz zurück.
»Was sagst du dazu, Odo? Er hat deine Braut geküsst«, stichelte einer am Tisch.
»Das durfte er«, bemerkte sein Nachbar. »Der Herr Karl hatte nichts dagegen.«
»Warum soll er denn seinen Töchtern nicht eine Liebschaft erlauben?«, sagte der Erste. »Das ist besser, als wenn sie heiraten und ihn verlassen.«
Im selben Augenblick purzelten Krüge, Kannen und Becher durcheinander und ihr Inhalt, Wein und Bier, floss über den Tisch. Mit einer heftigen Geste war Odo aufgesprungen.
»Was hast du? Wo willst du hin?«, rief ich.
Er antwortete nicht. Mit Riesenschritten, gefolgt vom Gelächter unserer Tischgenossen, stürmte er zur Tür und hinaus.
Odos jäher Abgang war nur von den in der Nähe Sitzenden bemerkt worden. Da der Vortrag beendet war, stürzte sich alles wieder auf Speisen und Getränke. Lautstark ergossen sich die zurückgehaltenen Maulströme in die Halle.
Der schöne Herr Siegram machte die Runde bei den Großen des Reiches. Man beehrte ihn mit einem Lob, einem freundlichen Abschiedswort, einer Einladung oder sogar – wenn man schon betrunken und großzügig war – einem Goldstück. Er lächelte auch noch einmal zu Fräulein Rotrud hinüber, die ihn aber bereits vergessen hatte und sich mit ihren jüngeren Geschwistern zankte. Nach einer letzten Verbeugung gegen den König, der ihn ebenfalls nicht mehr beachtete, wandte er sich zum Ausgang.
Ich hatte kein Auge von ihm gelassen und da Odo nicht zurückgekommen war, zweifelte ich nicht, dass den Sänger draußen ein unangenehmer Empfang erwartete. Mich packte die Sorge, mein neuer Freund und Amtsgefährte könnte sich eine Torheit leisten und damit alles verderben, was gerade so gut begann. Ich sprang auf und lief dem Sänger nach. Draußen geschah tatsächlich, was ich befürchtet hatte.
Der Sänger ging über den Hof auf eines der Gästehäuser zu. Odo trat von der Seite an ihn heran, sein Schwert am Gürtel. Das schien den Sänger jedoch nicht sehr zu beeindrucken.
Ein Ochsengespann, das auf dem belebten Hof vorüber getrieben wurde, hinderte mich einen Augenblick daran, mich den beiden zuzugesellen. Als ich bei ihnen ankam, standen sie sich gegenüber – ein wütender Odo und ein hochmütig lächelnder Siegram.
»Euer Betragen war unverschämt!«, schnauzte Odo. »Nicht einmal die höchsten Würdenträger dürfen sich solche Freiheiten herausnehmen. Ihr werdet noch heute die Pfalz verlassen!«
»Ach, und wie käme ich dazu?«, entgegnete der Sänger. »Ist Euch entgangen, wie erfolgreich ich war? Man wird mich noch öfter zur Tafel rufen.«
»Da täuscht Ihr Euch aber sehr. Man wünscht nur eines: dass Ihr so schnell wie möglich abreist!«
»Und wer befiehlt das?«
»Hier hat nur einer zu befehlen.«
»Der eine hat mir gerade diesen Pokal geschenkt.«
»Weil er mit Euerm Gesang zufrieden war. Mit Euerm Betragen ganz und gar nicht.«
»Aber was habe ich denn verbrochen?«
»Da fragt Ihr noch?«
»Ich bitte Euch, klärt mich auf.«
»Man küsst nicht in aller Öffentlichkeit eine königliche Jungfrau, die einem Edelmann bestimmt ist!«
»Zuerst hat die Jungfrau mich geküsst.«
»Damit hättet Ihr Euch begnügen müssen.«
»War denn der Edelmann, dem sie bestimmt ist, anwesend?«
»Er war es.«
»Seid Ihr es etwa?«
»Und wenn ich es wäre?«
Herr Siegram lächelte nachsichtig wie über einen misslungenen Scherz und ließ herausfordernd langsam seinen Blick an Odo hinab gleiten. Ich erwähnte bereits, dass der äußere Eindruck, den mein neuer Gefährte machte, von oben nach unten zunehmend ungünstiger wurde. Bei den zerrissenen Stiefeln angekommen, verweilte der Blick des Sängers mit genüsslicher Ruhe.
»Ich gratuliere Euch!«, sagte Herr Siegram. »Zweifellos werdet Ihr Eure Braut sehr glücklich machen. Aber wollt Ihr etwa in diesen Stiefeln auf Eurer königlichen Hochzeit tanzen?«
Der elegante Sänger ließ ein kurzes verächtliches Lachen hören, warf die Lockenmähne zurück und ging mit wehendem Mantel weiter. Odos Hand fuhr nach dem Schwertgriff. Doch nun sah ich den Augenblick zum Eingreifen gekommen.
»Bei allen Heiligen! Lass das Schwert stecken!«
»Hast du gehört, wie mich der Laffe beleidigt hat? Ich werde ihn zum Zweikampf fordern!«
»Das wirst du nicht tun. Du bist nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich. Vergiss nicht, ab heute hast du ein Amt. Du bist ein Stellvertreter des Königs!«
»Also hat er den König beleidigt. In mir, seinem Stellvertreter!«
»Wenn schon. Von einer solchen Höhe aus lässt man sich nicht auf Zweikämpfe ein.«
»Und was soll ich deiner Meinung nach tun?«
»Ich würde mir ein paar neue Stiefel anmessen lassen.«
Einen Augenblick starrte er mich an. Dann blickte er auf seine Füße und plötzlich begann er zu lachen. Er schlug mir die Hand auf die Schulter und rief: »Recht hast du! Ich gehe sofort in die Schusterwerkstatt. Zwar hab ich kein Geld im Beutel, aber dafür gehört mir ja jetzt die Staatskasse!«
Odos Lachen schallte über den weiten Hof. Herr Siegram, der gerade das Gästehaus betreten wollte, sah sich noch einmal verwundert um.
Odo bemerkte es, lächelte gallig und murmelte: »Und dich erwische ich noch, mein Goldkehlchen. Irgendwann sehen wir beide uns wieder!«
Wie recht er hatte. Keine drei Wochen sollten vergehen, bis sie sich wiedersahen.
Kapitel 2
Die nächsten Tage waren mit Reisevorbereitungen angefüllt. Natürlich war ich ab sofort von meinen Aufgaben in der Kanzlei entbunden. Schnell wies ich noch meinen Nachfolger ein, ein blasses Mönchlein, das sich eifrig über das Pult beugte und zu schreiben begann, während ich mitleidig seinen gekrümmten Rücken betrachtete. Dabei hörte ich auf das Gezwitscher der Schwalben, die über dem kleinen Fenster unter dem Dach nisteten. Wie oft hatte ich sie beneidet, weil sie einfach davon flattern konnten, hinaus in die Welt. Es ist wohl noch zu früh für mich, an ein besinnliches Leben in einer Klosterzelle zu denken. Jetzt würde ich meine Flügel breiten!
Ich traf mich mit Odo und wir einigten uns darauf, was jeder tun sollte. Odo stellte die Schutztruppe zusammen, besorgte die Reittiere und einen Planwagen. Er kümmerte sich auch um Zelte, Decken und Mundvorräte für den Fall, dass wir unterwegs einmal keine Herberge finden sollten. Mir als dem Schriftkundigen oblag es, uns mit allem zu versorgen, was wir in unserer Eigenschaft als Gerichtsherren, Ankläger, Anwälte, Ordnungshüter und Ermittler von Straftaten benötigen würden. Da die Kanzlei hoffnungslos überlastet war, musste ich dieses oder jenes wichtige Schriftstück, eine königliche Verordnung oder einen Auszug aus der Lex Salica, der allgemein anwendbare Bestimmungen enthielt, am Tisch einer Schänke kopieren.
Vom sächsischen Volksrecht gibt es ja leider noch keine vollständige Sammlung. Deshalb suchte ich meine Kenntnisse zu ergänzen, indem ich sächsische Edelinge, die zur Reichsversammlung erschienen waren, ansprach und ausfragte. Dabei machte ich mir Notizen auf Wachstäfelchen. An die hundert lagen schließlich in einem Korb, den ich mitnehmen wollte, um sie irgendwann zu ordnen und unter Hinzufügung dessen, was ich auf der Reise erfahren würde, zu einer Lex Saxonum zusammenzustellen.
Dann gab es noch einen feierlichen Augenblick. In der Pfalzkapelle erneuerten wir dem König den Treueid und erhielten unsere Ernennungsurkunden als missi dominici. Mir zitterten die Hände, als ich das kostbare Pergament mit dem Titelmonogramm und dem eigenhändigen Vollziehungsstrich des Herrn Karl in Empfang nahm. Ich legte es in eine eiserne Schatulle, zu der Odo und ich je einen Schlüssel besitzen. In der Schatulle bewahren wir auch unsere flüssigen, leider nicht sehr üppigen Geldmittel auf. Der Herr Kämmerer ist ein Knauser. Wir müssen uns bemühen, am Abend eines Reisetags immer ein Königsgut, ein Kloster oder das Anwesen eines Grafen, Zentgrafen oder königlichen Vasallen zu erreichen, wo wir unentgeltlich versorgt werden. Bis jetzt ist es uns fast immer gelungen, aber noch sind wir nicht weit gekommen und befinden uns im alten Reichsgebiet, wo ein Königsgut neben dem anderen liegt. Hinter Fulda wird sich das ändern.
Unsere Gesandtschaft besteht aus sieben Männern: Odo und mir, einem Diener, der auch gleichzeitig Schreiber ist, und einer vierköpfigen Schutztruppe. Deren Anführer ist ein gewisser Fulk, ein Graukopf mit finsteren, kantigen Zügen und einer Narbe quer über der Stirn. Auf den ersten Blick flößt er wenig Vertrauen ein. Odo kennt ihn aber von früher, von Gefechten mit sächsischen Widerständlern, und hält ihn für einen von der Sorte, die es mit Satan persönlich aufnehmen würden. Fulk redet wenig und wenn er den Mund auftut, flucht und schimpft er. Zu lieben scheint er nur seine Waffen und ein altertümliches Trinkhorn, das ihm am Gürtel hängt und aus dem er sich Unmengen Bier einflößt. Seine drei Leute sind brave Burschen, die auch nicht zimperlich sind. Wann immer wir rasten, üben sie sich im Schwertkampf oder im Bogenschießen, wobei sie auch Hunde und Katzen nicht schonen. Ihre Bärte sind schmutzig, ihre Kleider schäbig, doch ihre Waffen blinken und blitzen.
»Eine bessere Räuberbande«, fand Odo. »Raubeine, aber zuverlässig.«
Den Diener und Schreiber habe ich selbst ausgesucht. Er hört auf den Namen Rouhfaz und sieht auch aus wie einer, der bei der Messe das Weihrauchfass schwenkt. Seinen richtigen Namen hat er mir einmal genannt, doch ich habe ihn vergessen. Rouhfaz ist dünn wie ein Zaunpfahl und trotz seiner noch jungen Jahre (sein genaues Alter kennt er nicht) fast kahl. Er kann leidlich lesen und hat eine sehr schöne Handschrift, jeder Buchstabe ist ein kleines Kunstwerk. Das ist der Grund, weshalb ich mich für ihn entschieden habe. Ich war ihm schon auf meiner Wanderung von Fulda nach Ingelheim begegnet, wo er sich mir unterwegs anschloss. Er hatte als Novize in mehreren Klöstern gelebt, es aber nirgendwo ausgehalten. Vielleicht hatte man ihn auch hinausgeworfen. Er ist nämlich rechthaberisch und zänkisch und man muss sich daran gewöhnen, dass er fast immer eine beleidigte Miene zur Schau trägt. In der Pfalz Ingelheim konnte er nur als Gärtner unterkommen und sie waren dort froh, dass sie ihn wieder loswurden. Immerhin ist er sehr fromm und scheint nicht zu stehlen. Ich komme ganz gut mit ihm aus.
Am Tag unserer Abreise regnete es. Odos Laune entsprach dem Wetter. Das hatte gleich mehrere Gründe. In den vergangenen Tagen hatte er sich vergebens bemüht, seine angebetete Rotrud zu treffen und irgendein Zeichen oder Abschiedswort von ihr zu erhalten. Wo immer sie erscheinen konnte, hatte er gelauert. Aber wenn er sie mal zu Gesicht bekommen hatte, dann stets nur inmitten eines Schwarms von Erziehern, Geistlichen, Hofdamen oder Geschwistern.
»Sie wird bewacht!«, erklärte er finster. »Meinetwegen, das wird nichts nützen. Und wenn der Alte das ganze Heer dazu aufbietet. Ich komme zurück und dann werden wir sehen. Sie wird doch meine Frau!«
Der zweite Grund für Odos Verstimmung war die Himmelsrichtung, in die wir aufbrachen. Eine Gesandtschaft nach der anderen verließ die Pfalz in Richtung Westen – nach Soissons, Paris, Autun, Tours. Nun packte ihn doch wieder der Ärger über die Zurücksetzung und er beneidete diese Glücklichen. Hinzu kam, dass fast alle Gesandtschaften in die westlichen Reichsgebiete glänzender und aufwendiger waren als die unsrige. Da flatterten Fahnen, schimmerten Brünnen, tänzelten rassige Pferde, an deren Geschirr Gold und Silber glänzten. Und an der Spitze von zwanzig, dreißig Mann ritten Grafen und Bischöfe.
Dagegen waren wir ein recht trauriger Haufen. Zwar war Odo außer beim Schuster auch beim Hofschneider gewesen und trug nun neue Stiefel und eine hübsch bestickte Tunika. Doch konnte damit das Gesamtbild, das wir boten, nicht wesentlich verschönert werden. Der Herr Kämmerer hatte, wie schon bemerkt, bei uns geknausert.
Nun, auch wir setzten uns in Bewegung. Odo brüllte herum, damit niemand darüber im Unklaren blieb, wer die Befehlsgewalt hatte. Ich überließ sie ihm gern, obwohl wir ja ranggleich sind. Auch Fulk ertrug alles gleichmütig. Mit stumpfem, glasigem Blick hing er krumm im Sattel, er hatte die Nacht durch nach Kriegerart den Aufbruch in den Kampf gefeiert. Wir drei ritten voran, Odo und Fulk zu Pferde, ich auf meinem flinken Eselshengst Grisel. Dann folgte der von zwei kleinen Fuchsstuten gezogene, hoch beladene Wagen, auf dessen Kutscherbank Rouhfaz hockte. Den Abschluss bildeten die drei »Raubeine«, auch sie zu Pferde.
Ich übergehe die Einzelheiten der Reise. Am ersten Tag kamen wir mit Mühe bis Mainz, weil wir auf der schmalen Straße immer wieder von entgegenkommenden Kaufmannstrecks, die zur Pfalz wollten, aufgehalten wurden. Als es dunkelte, hatten wir gerade den Rand der Vorstadt erreicht. So mussten wir schon zur ersten Übernachtung auf eigene Kosten in einer Herberge absteigen.
Am nächsten Morgen brachen wir zeitig auf, fanden im Hafen eine Fähre und setzten über den Rhein. Auf der alten römischen Heerstraße zogen wir weiter. Wir übernachteten zweimal auf Krongütern und kamen am vierten Tag an einen Ort, dessen Namen ich nicht nennen kann. Ich darf die Namen von Orten und von Personen, mit denen ich bei der Ausübung meines Amtes in Berührung komme, nur in meinen Berichten an den Herrn Pfalzgrafen aufführen. Ich bitte Dich daher um Verständnis, lieber Volbertus, dass alle Orte, von denen die Rede sein wird, anonym bleiben müssen. Dasselbe betrifft die Personen, die aber natürlich Namen bekommen werden, wenn auch erfundene.
Am vierten Reisetag also, vormittags und bei wieder angenehmem Frühlingswetter, gerieten wir an dem oben erwähnten Ort in ein Marktgetümmel, was uns eine Weile aufhielt.
Dieser Aufenthalt sollte Folgen haben.
Während der verschiedenen Unterweisungen, die uns höhere Hofbeamte in den Tagen der Vorbereitung auf unsere Mission erteilt hatten, waren wir auch wiederholt und nachdrücklich dazu verpflichtet worden, unterwegs, wo immer es sich ergab, zu prüfen, ob Gesetze und Bestimmungen eingehalten wurden. Hier wurden wir tätig. Begleitet von Rouhfaz und zwei Männern unseres Trupps ging ich auf diesem Markt mit einer Waage von einem Stand zum anderen, um die Münzgewichte zu überprüfen. Dabei konnte ich einen Händler überführen, der große Warenposten mit Falschgeld bezahlte. Seine Denare hatten nur wenig mehr als die Hälfte des vorgeschriebenen Gewichts. Ich verurteilte ihn an Ort und Stelle, natürlich in Gegenwart der verschämten Marktaufseher, bei denen ich mich vorher ausgewiesen hatte. Da uns Strenge anbefohlen war, musste er fünfzehn Solidi oder 180 Denare zahlen, was dem Gegenwert von fünf Kühen und acht Schweinen entsprach. Er schickte gleich einen seiner Diener zu seinem Teilhaber nach Mainz, damit dieser das Geld herbeischaffte. Vorerst musste er in Haft bleiben. Das alles ging natürlich unter Aufregung und Geschrei vor sich. Der Händler behauptete, selber betrogen worden zu sein, doch hatte er als Zeugen nur Gott und alle Heiligen, die ich (sie mögen es mir verzeihen) natürlich nicht anerkennen konnte. Ich ließ mich überhaupt auf nichts ein und war, offen gesagt, ein wenig stolz darauf, mich auf diesem für mich neuen Gebiet so unerschrocken behauptet zu haben.
Inzwischen hatte sich Odo zum Pferdemarkt begeben. Ich folgte ihm dorthin und fand auch ihn als Mittelpunkt eines Auflaufs. Unterstützt von Fulk, war er gerade dabei, einem prächtigen Grauschimmel, der sich sträubte und ausschlug, das Maul zu öffnen. Als es endlich gelang, starrten vier, fünf Männer hinein und Odo rief triumphierend, er habe es gleich gewusst. Der Hengst sei keine fünf Jahre alt und der Händler habe den Verkäufer geprellt, indem er das Tier für zwei Jahre älter erklärte. Der Händler schwor aber, sich nicht in betrügerischer Absicht geirrt zu haben. Es sei ihm nicht gelungen, der Bestie die Zähne auseinander zu bringen, und so habe er das Alter nach dem äußeren Eindruck schätzen müssen. Gern sei er bereit, den Hengst nebst Sattelzeug für die 360 Denare, die der Verkäufer empfangen habe, zurückzugeben.
»Und ich bitte den edlen Herrn um Verzeihung«, fügte er mit einer Verbeugung hinzu.
Der edle Herr, der Verkäufer des Pferdes, war noch anwesend, er stand zwischen Odo und dem Händler. Es war ein dicker, etwa vierzigjähriger Mann mit eng beieinander stehenden, schlau blickenden Augen, rötlichem Schnurrbart und einem runden Schädel, den nur noch ein Haarkranz umgab. Seine Kleidung war in der Tat die eines Herrn: ledernes Wams, silberbeschlagener Gürtel, mit einer Fibel am Hals zusammengehaltener Mantel. Er hatte den Beutel mit Geld gerade an seinem Gürtel befestigt und es war ihm sichtlich nicht recht, dass der Handel so viel Aufmerksamkeit erregte.
»Schon gut, du brauchst dich nicht zu entschuldigen«, sagte er mit einer beschwichtigenden Geste. »Ich wusste ja selbst nicht mehr, wie alt das Pferd ist. Deshalb war ich mit dem Preis zufrieden. Es war nicht nötig, dass Ihr Euch einmischtet«, wandte er sich vorwurfsvoll an Odo.
»Es tut mir leid, aber ich konnte nicht ahnen, dass Ihr so wenig auf Euern Vorteil bedacht seid«, sagte Odo. »Hätte ich gewusst, dass Ihr dieses herrliche Pferd verschenken wollt, wäre ich stumm geblieben. Und ich hätte Euch verschwiegen, dass ich selbst Euch 420 Denare zahlen würde.«
»Fünfunddreißig Solidi?«, sagte der Dicke nicht unbeeindruckt.
»So seid Ihr ein Käufer!«, rief der Pferdehändler. »Und ich dachte, Ihr seid eine Amtsperson!«
»Eine Amtsperson bin ich auch«, entgegnete Odo. »Aber im Augenblick bin ich Käufer.«
»Dann muss ich Euch sagen, dass Ihr zu spät kommt«, sagte der Händler frech. »Der edle Herr hier war mit dem Preis zufrieden, Ihr habt es von ihm selbst gehört. Das Pferd ist mein Eigentum. Wenn Ihr es also erwerben wollt, müsst Ihr die 420 Denare an mich zahlen!«
Odo blickte ihn wütend an. Er trat einen Schritt auf ihn zu. Seine Nasenspitze schien zustechen zu wollen.
»Damit du fünf Solidi Gewinn machst, du Gauner! Zwischen zwei Fürzen! Wenn das so ist, dann bin ich jetzt wieder Amtsperson. Nimm den Kerl fest!«, rief er Fulk zu.
Der zog augenblicklich sein Schwert und trat auf den Pferdehändler zu.
»Komm mit, du Auswurf! Du stinkender, madenzerfressener Schafskäse!«
Unter den Männern, die die Gruppe umstanden und von denen die meisten wohl hörige arme Schlucker waren, wurde beifälliges Gemurmel laut. Der Pferdehändler schrie, er habe nichts getan und gehe nur friedfertig seinen Geschäften nach. Der Dicke, der heftig schwitzte und ein paar Mal unruhig nach links und rechts blickte, wandte sich zu seinen Gunsten an Odo.
»Lasst ihn gehen! Wir werden auch so einig. Wozu der Lärm. Wer seid Ihr überhaupt?«
»Ich bin Odo von Reims. Im Dienste unseres erhabenen Herrschers. Als Königsbote unterwegs.«
»Als Königsbote?«, rief der Dicke erschrocken. »Ah, das ist natürlich etwas anderes! Hat man Euch aus einem bestimmten Grunde hierher gesandt?«
»Ich bin auf der Durchreise und möchte ein Pferd kaufen. Doch, wie ich sehe, gibt es Schwierigkeiten.«
Die Erwähnung des Amtstitels wirkte Wunder und jeder war jetzt beflissen, Odos Wunsch zu erfüllen. Der Pferdehändler küsste ihm die Hand und übergab ihm unter Verbeugungen die Zügel des Grauschimmels. Dafür wollte er nun auf keinen Fall mehr haben als den Betrag, den er vorher bezahlt hatte. Er erhielt ihn. Als Odo darauf dem früheren Besitzer des Pferdes die zusätzlich versprochenen sechzig Silberdenare geben wollte, wehrte dieser erschrocken ab. Er stammelte, dass es ihm eine Ehre und das Pferd für einen so hohen Herrn nicht gut genug sei.
Plötzlich hatte er es sehr eilig. Er deutete mit der Hand einen Gruß an, schob ein paar Männer beiseite, die ihm im Wege standen, und machte sich hastig davon. Jetzt sah man, dass er auf einem Fuß auffällig hinkte.
»Wartet doch!«, rief Odo ihm nach. »Ihr habt mir nicht einmal Euren Namen genannt! Ich hätte gern gewusst, wem das Pferd …«
Doch der Mann war schon in der Menge verschwunden.
»Ist er hier bekannt? Wie heißt er?«, fragte Odo den Pferdehändler.
»Ich weiß es nicht, Herr. Hab ihn zum ersten Mal gesehen. Obwohl sein Gesicht mir nicht unbekannt vorkam.«
»Was soll das heißen … nicht unbekannt?«
»Nun, so ein Kopf war schon einmal hier. Aber auf zwei gesunden Beinen. Und eigentlich war es auch nicht derselbe Kopf …«
»Lasst doch den Narren, er schwatzt Unsinn!«, sagte Fulk.