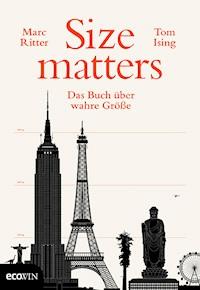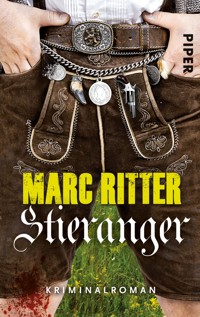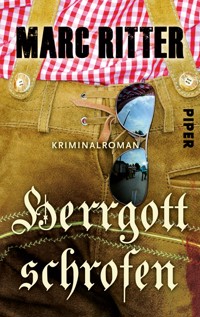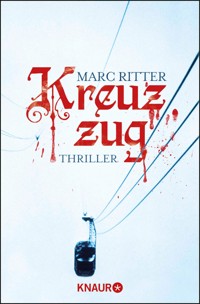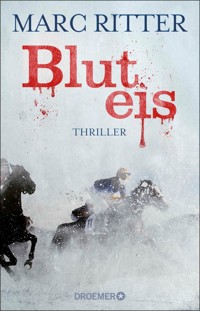
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Engadin, ein strahlender Wintertag. Über 1000 internationale Wirtschaftsgrößen auf dem zugefrorenen St. Moritzer See beim legendären Pferderennen. Mitten unter ihnen die schwangere Sandra, Freundin des weltbekannten Sportfotografen Thien Baumgartner. Plötzlich explodiert die Eisdecke, Hunderte von Wasserfontänen schießen in die Höhe, geborstenes Eis splittert und färbt sich blutrot. Terroristen haben die Seedecke gesprengt. Sofort kreisen Helikopter, versuchen, Überlebende aus dem bitterkalten Wasser zu retten, und fliegen dann Richtung Krankenhaus. Nur ein Helikopter konzentriert sich auf die Super-VIPs, nimmt auch Sandra auf, verschwindet dann knatternd hinter einem Bergkamm – und taucht nicht wieder auf. Thien, der fassungslos vom Ufer aus das Geschehen beobachtet hat, weiß: will er Sandra retten, muss er auf eigene Faust ermitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Marc Ritter
Bluteis
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Engadin, ein strahlender Wintertag. Über 1000 internationale Wirtschaftsgrößen auf dem zugefrorenen St. Moritzersee beim Pferderennen. Das Unfassbare geschieht: Terroristen sprengen die Seedecke, das geborstene Eis färbt sich blutrot. Sofort kreisen die Helikopter und versuchen, die Überlebenden aus dem kalten Wasser zu retten, und fliegen dann Richtung Krankenhaus. Nur ein Helikopter konzentriert sich auf die Super-VIPs, verschwindet dann knatternd hinter einem Bergkamm – und taucht nicht wieder auf …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motti
Prolog
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Epilog
Appendix
Verzeichnis verwendeter Quellen
Literatur
Beiträge aus Zeitungen und Zeitschriften
Internetquellen
TV-Quellen
Korrespondenz
Dank …
Für meine Kinder Michelle, Finn, Marcel, Henri und Mila, in deren Lebenszeit sich die Weltbevölkerung auf 14 Milliarden Menschen verdoppeln könnte. Lernt gärtnern und schießen!
»Denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen – auf Infiltration statt Invasion; auf Unterwanderung statt Wahlen; auf Einschüchterung statt offenem Kampf; auf nächtliche Guerillaangriffe statt auf Armeen bei Tag.
Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine eng verbundene, komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern sind geheim, ihre Fehlschläge werden verschleiert, nicht publiziert, Andersdenkende werden nicht gehört, sondern zum Schweigen gebracht, keine Ausgabe wird infrage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt.«
John F. Kennedy (1917–1963) am 27. April 1961 im Walldorf Astoria Hotel, New York City, vor amerikanischen Zeitungsverlegern.
»Es gibt bekanntes Bekanntes, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es bekanntes Unbekanntes gibt, das heißt, wir wissen, es gibt einige Dinge, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch unbekanntes Unbekanntes – es gibt Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.«
Donald Rumsfeld, zweimaliger Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika (1975–1977 und 2001–2006), ehemaliger Vorstandsvorsitzender des amerikanischen Pharma- und Agrarchemiekonzerns G. D. Searle & Company (heute: Monsanto), ehemaliger Vorstand des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (dem Kernkraftwerks-Lieferanten Nordkoreas) und Namenspatron des Schwammkugelkäfers Agathidium rumsfeldi, der sich bevorzugt von Schleimpilzen ernährt.
»Es ist viel sicherer, zu wenig als zu viel zu wissen.«
Samuel Butler, englischer Schriftsteller (1835–1902)
Prolog
Flurin Da Silva sah sich um. Er konnte es kaum glauben. Doch, es hatte einen ganz einfachen Grund, warum kein Fahrer vor ihm war: Er lag in Führung. Konnte Dreamstar das Tempo über die Strecke halten? Würden seine eigenen Oberschenkel die Strapaze überstehen? 2700 Meter auf Ski mit fünfzig Stundenkilometern hinter einem Pferd über einen zugefrorenen See gezogen zu werden war schlicht Wahnsinn. Und er wollte diesen Wahnsinn als »König des Engadin« beenden. Er schrie seinem Pferd ein lautes »Go! Go!« zu. Los, Dreamstar, renn! Renn sie alle in Grund und Boden! Die Millionärssöhne und die bezahlten Fahrer. Die fit gespritzten Galopper. Zeig’s ihnen!
Hinter ihm donnerten die Hufe der Pferde in den Schnee, der das Eis bedeckte. Er konnte sich nicht andauernd umdrehen, um nachzusehen, ob sein Vorsprung wuchs oder schmolz. Er musste sich konzentrieren. Auf Dreamstar. Und auf die beiden Ski an seinen Füßen. Das war die besondere Schwierigkeit beim Skijöring: Nicht nur das Pferd musste auf eigenen Beinen die Strecke bewältigen, auch der Mensch, der an einer Leine vom Tier gezogen wurde. Er musste sicher auf den beiden Latten stehen. Sonst würde er das Spezialgeschirr nicht bedienen können, mit dem er das Pferd lenkte. Drei Meter hinter dem Tier war das wesentlich schwieriger als auf dem Tier. Die Skijöring-Spezialisten sagten, dass sie im Vergleich zu einem Reiter höchstens ein Zehntel des Einflusses auf ihren vierbeinigen Partner hatten. Darum war es so schwierig, eine Renntaktik aufzustellen und einzuhalten. Das Pferd musste die neunzig Prozent Hirnleistung, die sonst der Jockey erledigte, selbst erbringen. Weil Pferde das nicht konnten, war meist das ausdauerndste Team als erstes im Ziel. Oder dasjenige, das als erstes in die Kurve nach der Startgeraden ging.
An diesem Tag war das Dreamstar gewesen. Wieder. Wie beim ersten und beim zweiten Skijöring-Rennen des »White Turf«, der großen Pferdesportveranstaltung, die den ganzen Februar über an den Wochenenden auf dem St. Moritzersee stattfand. Beim ersten Wettbewerb vor zwei Wochen hatte der Vorsprung nicht bis ins Ziel gereicht. Der Vollblüter des arabischen Prinzen hatte ihn um eine halbe Länge geschlagen. Letzte Woche hatte Dreamstar es dann geschafft. Da war er um eine Nasenlänge vorn gewesen. Photofinish. Wenn er diesen Sieg nun wiederholen könnte, würde der Titel »König des Engadin« endlich wieder an einen Einheimischen gehen. Einen, der sein Pferd selbst gezogen und trainiert hatte.
Er ließ die Leinen des Geschirrs auf Dreamstars Rücken klatschen, um ihn weiter voranzutreiben. Das war die einzig erlaubte Form der Einflussnahme des Lenkers auf sein Pferd. Peitschen und Gerten waren beim Skijöring untersagt. Und man hätte auch gar keine Hand dafür frei gehabt. Die Hände umkrallten den Holzstab, der an den Enden der Leinen befestigt war. Zwischen diesen flatterte das bunte Tuch, das verhindern sollte, dass andere Pferde in das Geschirr hineinliefen, wenn der Fahrer in den Kurven oder wegen eines Fahrfehlers nicht hinter, sondern neben dem Pferd fuhr.
Dieses Rennen hatten Dreamstar und er bisher fehlerfrei absolviert. Sie waren wie ein Pfeil aus der Startbox geschossen, als sich die Eisentür geöffnet hatte. Dreamstar war an den weiter innen gestarteten Galoppern vorbeigefegt, und Flurin Da Silva hatte sein Pferd schon wenige Meter, nachdem sie die Haupttribüne hinter sich gelassen hatten, hart an der Grenze des Erlaubten scharf nach innen gezogen, damit sie als Erste in die Kurve gingen.
Ein, zwei Längen mochten sie mittlerweile zwischen sich und dem Feld haben. Jetzt zählte nur noch die Kondition. Und dass weder Pferd noch Fahrer fielen. Für die Kondition hatten die beiden den ganzen Sommer über trainiert. Ob einer von ihnen strauchelte oder nicht, entschieden höhere Mächte und die Streckenpräparatoren, die die Trittlöcher im Geläuf des Rundkurses nach jedem Rennen mit Pistenraupen planierten. Eine halbe Stunde vor dem Skijöring-Rennen war ein Flachrennen angestanden. Die Galopper hatten die Schneedecke ordentlich umgepflügt.
Sie rasten wieder auf die Haupttribüne zu. Das Geschrei der zehntausend, die bei diesem klirrend kalten, aber strahlenden Februartag an die Strecke gekommen waren, nahm er nicht bewusst war. Erst recht nicht das Gejohle der Super-VIPs, die in einem eigenen Zelt mit separater Tribüne das Rennen verfolgten. Die meisten von ihnen hatten hohe Wetten laufen, denn die Mehrzahl der Fahrer gehörte zu ihnen, zu den sehr Reichen und den unendlich Reichen, zu den Mächtigen und den unglaublich Mächtigen dieser Welt. Im Super-VIP-Zelt hielt sich an diesem dritten und letzten Rennwochenende ein Großteil derer auf, für die die Welt geschaffen wurde und die über sie bestimmten. Die Verankerung des Zeltes war in die sechzig Zentimeter starke Eisschicht gebohrt worden. So wie alle auf Englisch und Russisch ausgezeichneten VIP- und Cateringzelte, die Zelte, die die Stallungen beherbergten, die Toilettenzelte und die Kinderverwahrstation des japanischen Spielekonsolenherstellers.
Plötzlich passierte es doch. Dreamstar strauchelte. Das durfte nicht sein. Flurin Da Silva riss an den Leinen. Doch er parierte damit nicht sein Pferd durch. Im Gegenteil, Dreamstar brach regelrecht in den Schnee ein. In den Sekundenbruchteilen, bis Dreamstar zu Boden ging, dachte Flurin Da Silva nach, was das Pferd zum Sturz gebracht haben könnte. Die Gedanken wischten nur so durch seinen Kopf. Ein Loch im Schnee? Ein Gegenstand, von einem Zuschauer auf die Bahn geworfen? Seine Gedanken brachen ab. Denn er spürte, wie der Schnee unter ihm weicher wurde. Wie er in die hart gefrorene Schicht mit beiden Ski versank. Sein Gehirn verarbeitete diese Information zunächst nicht. Denn es war vollkommen ausgeschlossen, dass das Eis brach. Darum kam er überhaupt nicht auf die Idee, dass genau das gerade unter ihm passierte. Erst dann registrierte er, dass zwei Meter neben ihm eine kleine Fontäne aus dem Eis nach oben spritzte. Und zwei Meter weiter die nächste. Und auch vor Dreamstar spritzten Eisbröckchen und Wasser nach oben. Überall diese kleinen Fontänen. Er sah sich in der gleichen Sekunde um. Auf dem ganzen See stob das Eis auf, wie er mit einem Blick erfasste. Er sah auch, dass die Pferde hinter ihm wie Dreamstar gestrauchelt waren. Nein, falsch, er sah, dass alle Pferde ins Eis einbrachen. Dann spürte er die Kälte. Ja, es war tatsächlich wahr, er fiel ins Wasser. Das Eis war weg. Die Ski verhinderten, dass er sich mit einem Sprung auf eine Eisscholle in Sicherheit bringen konnte. Und die Schollen waren auch viel zu klein. Gerade als er das vergegenwärtigte, zog ihn das Geschirr, dessen Griff er immer noch mit zehn Fingern umklammerte, nach unten.
Er blickte mit weit aufgerissenen Augen nach vorn auf sein Pferd. Dreamstar versank im Eiswasser, doch sein Gehirn war immer noch nicht fähig, einen logischen Schluss daraus zu ziehen. Es gab den Händen nicht den Befehl, den Griff zu lösen. Die Leinen fest umklammernd sank er bis auf vier, fünf Meter Tiefe seinem Pferd hinterher, als dieses nach unten sank, gelähmt durch die Kälte des Wassers. Erst da verstand er, dass er loslassen und nach oben schwimmen musste. Dort oben war es hell. Dort musste er hin. Nach oben. Dort war Luft. Er musste schwimmen. Strampeln, sich nach oben kämpfen.
Er kämpfte um sein Leben. Das eiskalte Wasser machte jede Bewegung zur Tortur. Doch er würde es schaffen. Er musste es schaffen. Er war der König vom Engadin. Doch das war er oben, auf dem Eis. Nicht hier. Nicht unter Wasser. Er hatte immer noch die Ski an den Füßen, die Skibekleidung war mit Wasser vollgesogen und gab ihm das Gewicht einer Schweizer Pendeluhr. Langsam, aber unaufhaltsam wurde er nach unten auf den Grund des Sees gezogen.
Kisi liegt unter der dichten Krone des alten Karitébaums und tut, was sie in ihren freien Stunden am liebsten tut: Sie sieht den Nüssen beim Wachsen zu. Das zumindest wird ihr Großvater wieder sagen, wenn sie ins Dorf zurückkehren wird. Wie immer wird sie nur zurücklachen und sagen: »Ja, Ebo, von dir habe ich gelernt, was wir von den Bäumen lernen können: Geduld.« Und dann wird Ebo stolz sein auf seine Enkelin, denn ein so kluges vierzehnjähriges Mädchen hat es noch nie in Awisam gegeben. Als Chief des Dorfes gehört es zu seinem Job, klug zu sein, manchmal weise, und er ist froh, dass er in Kisi eine würdige Nachfolgerin haben wird. Ihm ist dann für einen Moment weniger bang um die Zukunft seiner Heimat. In seinen Träumen hat er schlimme Vorahnungen. Sie fingen an dem Tag vor zwölf Jahren an, als sein Sohn Ekwo aufgebrochen war, um sein Glück in der Hauptstadt zu versuchen. Er kam nie zurück. In der Nacht zuvor war Kisis Mutter Akua gestorben. Niemand hatte je zu fragen gewagt, woran Akua gestorben ist. Und dass Ekwo mit dem Tod Akuas etwas zu tun haben könnte, ja, sie sogar umgebracht hätte, daran wagt niemand im Dorf auch nur zu denken. Dort spricht man über solche Dinge nicht. Schon gar nicht, wenn es den Sohn des Chiefs betrifft. Hat Ekwo etwas Böses getan, dann hätten ihn die Dämonen vertrieben. Und die Dämonen hätten ihn gefunden. An jedem Ort der Welt. Im Dorf muss man sich darüber keine Sorgen machen. Und wenn er nichts Böses getan hat, dann ist er eben weg und wird das einfachere Leben in der Stadt dem harten Auskommen im Dorf vorziehen. Das haben vor ihm schon viele getan. Und nach ihm werden es sicherlich noch mehr tun.
Kisi wurde von ihrem Großvater Ebo aufgezogen. Niemand hat jemals den Namen ihrer Mutter oder ihres Vaters erwähnt. So ist es das Beste für alle. Zu leicht kann man die Dämonen auf sich aufmerksam machen, indem man zu oft die Namen der Toten oder der Verschwundenen im Munde führt.
Kisi beschäftigt sich tatsächlich mit den Kariténüssen, wenn sie den halben Nachmittag unter dem Baum liegt. Heute ist auch noch Sonntag. Sonntag ist ihr Tag. Wie allen Angehörigen der Akan-Völker, die noch traditionell leben, ist sie nach dem Tag ihrer Geburt benannt worden. Kisi heißt Sonntag. An Sonntagen träumt sie sich den Weg entlang, den die Nüsse, die noch am Baum hängen, bald nehmen werden, um in die Welt hinauszugehen.
Bald werden sie sie ernten. Dann werden sie die Mädchen und Frauen des Dorfes in großen Bottichen waschen und anschließend zerstampfen. Sie werden Wasser in den Kesseln aufsetzen und die zerstampften Nüsse so lange darin kochen, bis sich das Fett der Samen an der Oberfläche absetzt. Als Sheaöl wird es abgeschöpft. Wenn es abgekühlt ist, wird es fest und als reinste Sheabutter in Plastiktüten verpackt. Wenn die Regenfälle es zulassen, fährt Chief Ebo sie mit seinem Toyota über die löchrige Piste zum Markt nach Foso. Hier wird die Butter gewogen, und Ebo bekommt den Gegenwert ausbezahlt.
Bis zum Umschlagplatz in Foso ist Kisi schon gekommen. Ebo hat sie schon drei Mal dorthin mitgenommen. Den weiteren Weg, den die Sheabutter von Foso aus nimmt, hat sie sich von Ebo erzählen lassen. Er hat ihr vom Lastwagentransport ihrer Butter nach Cape Coast berichtet. Von dort wird das Pflanzenfett in die Hauptstadt Accra reisen. Und dort wird der Stoff, der heute noch in den kleinen Nüssen enthalten ist, auf ein großes Schiff verladen. Und dieses legt erst irgendwo an der Südküste Europas wieder an. Vielleicht auch an der Nordküste, da war sich Ebo nicht so sicher. Jedenfalls wird ihre Sheabutter nach Europa reisen. Um dort zusammen mit vielen anderen allerfeinsten Zutaten aus Afrika, aus Indien, aus Asien zu einer Creme verarbeitet zu werden, die sich nur die allerreichsten und allerschönsten Prinzessinnen leisten können. Und die werden sie auf ihre Haut auftragen, weil die Sheabutter aus dem Dorf Awisam in der Ashanti-Region von Ghana die allerbeste Sheabutter auf der ganzen Welt ist und ihre Prinzessinnenhaut davon ewig jung und frisch bleibt. Dank Kisis Hände Arbeit, die die Früchte ihres Baumes, unter dem sie die Sonntage verbringt, in Butter verwandeln konnte, wird eine echte Prinzessin noch schöner werden. Damit sie ihren Prinzen bekommt. Ihn heiraten kann. Königin wird. Selbst Prinzen und Prinzessinnen auf die Welt bringt.
Die Stationen dieser Reise malt sich Kisi an jedem freien Tag unter dem großen alten Baum in den schönsten Farben aus. Und nicht nur das. Sie nimmt sich jedes Mal fest vor, diese Reise selbst anzutreten. Sobald Ebo sie mit einem Mann aus dem Nachbardorf verheiratet – und das kann nicht mehr lange dauern –, wird sie diesen überreden, mit ihr der Sheabutter hinterherzufahren. Nur ein einziges Mal. Sie werden wiederkommen. Was sonst? Aber einmal muss sie die Prinzessinnen sehen, die sie aus dem TV-Apparat kennt, den es am Warenumschlagplatz in Faso gibt.
Es wird Zeit für Kisi, nach Hause ins Dorf zurückzukehren. Es ist ein Fußmarsch von einer halben Stunde hinab von dem Hügel, auf dem ihr Baum steht. Der Weg führt vorbei an den anderen Karitébäumen, aber keiner ist so stark und so groß wie ihrer. Er hat wohl schon vor zwei Jahrzehnten ein Buschfeuer überstanden, wie sie von Ebo weiß. Viele der jüngeren Bäume sind erst danach gewachsen.
Kisi ist zweihundert Meter von ihrem Baum entfernt, da hört sie ein Brummen auf sich zukommen. Direkt von vorn. Ebos Toyota hört sich anders an. Sie blickt in den Himmel. Ein niedrig fliegendes Flugzeug? Aber dort ist nichts zu sehen. Sie geht einfach weiter. Was ist das? Träumt sie noch? Der Wald vor ihr scheint auf sie zuzukommen. Ja, die Bäume bewegen sich. Sie werden von einer mächtigen Hand angehoben und fallen dann in ihre Richtung um. Ein Dämon? Am Boden liegend bewegen sie sich weiter. Kisi weicht zurück. Dann sieht sie die gelben Monster, als sie hinter den Bäumen auftauchen und diese mit ihren großen Eisenschilden nach rechts und links wegdrücken, um weiterzufahren. Direkt auf Kisi zu. Vier, fünf solcher gelben Monster nebeneinander. Hinter ihnen eine zweite Reihe, und diese Monster fressen die Bäume. Die reißen sie in ihren Schlündern in Stücke und speien die Überreste nach hinten aus. Das alles macht einen ohrenbetäubenden Lärm.
Kisi reißt die Augen auf, weil sie das, was sie sieht, nicht begreifen kann. Dann nimmt sie die Beine in die Hand und rennt wie von Hexen verfolgt zurück zu ihrem Baum. Als sie ihn beinahe erreicht, wird er von einem Monster, das sich von der Seite an ihn herangemacht hatte, umgedrückt.
Kisi schreit vor Entsetzen auf. Rechts, nach rechts müsste sie laufen. Von dort kommen keine Monster. Hofft sie. Sie muss ins Dorf. Hilfe holen. Sie müssen die Monster verjagen, bevor sie ihr ganzes Land verwüsten. Sie umläuft die Monster, die sich jetzt von zwei Seiten auf sie zubewegen.
Atemlos kommt sie im Dorf an. Sie will gerade losbrüllen, sie alle alarmieren. Doch da sieht sie in der Mitte zwischen den Hütten drei dunkelgrüne Landrover-Geländewagen mit orangefarbenen Lichtern auf den Dächern stehen. Fremde. Mitten im Dorf. Eine Handvoll weißer Männer steht vor Großvater Ebo. Ansonsten scheint das Dorf verlassen. Viele der Männer sind noch bei der Arbeit, alle anderen müssen geflüchtet sein.
Kisi versteckt sich hinter einer Tonne, in der sie den Abfall sammeln. Von dort sieht sie zu, wie ein Mann Ebo immer wieder mit einem Bündel Geld und einem Blatt Papier vor der Nase herumfuchtelt. Er schreit etwas, was sie nicht versteht. Ebo steht ruhig da, hat die Arme vor der Brust verschränkt und schüttelt den Kopf. Der Mann redet wieder auf Ebo ein. Ebo verändert seine Haltung nicht. Der Mann schreit wieder. Dann wirft er das Geld und das Papier Ebo vor die Füße, geht zu einem der Landrover, öffnet die Heckklappe und holt einen Kanister von der Ladefläche. Er geht zu einer Hütte – es ist die von Abenaa und Kweku, die nirgends zu sehen sind –, schüttet den Kanister über den Außenwänden und dem unteren Rand des Daches aus, zieht sein Feuerzeug aus der Hosentasche und schnippt es an. Er hält es in die Luft und ruft noch einmal etwas zu Chief Ebo hinüber. Als der nicht reagiert, hält der Mann das Feuerzeug an das Stroh. Die Hütte geht in Flammen auf.
Der Mann geht zurück zu Ebo. Er deutet auf das Geld und das Papier, das zu Füßen von Kisis Großvater im Staub liegt. Kisi glaubt zu sehen, dass Ebo die Augen geschlossen hält. Als wüsste er, was kommt, und als könne er sich durch Gedankenkraft aus der Mitte dieser Männer entfernen. Die fünf Weißen in ihren Khaki-Hosen und ihren einheitlichen hellblauen Hemden stehen jetzt im Kreis um ihn herum. Der Wortführer packt Ebo am Kragen des alten T-Shirts, das einmal grün gewesen ist und auf dessen Brust die Aufschrift Heineken die Herkunft aus einer europäischen Kleiderspende nachweist. Der weiße Mann schreit Ebo aus nächster Nähe an. Einen Satz glaubt Kisi zu verstehen. »Du bist ein Idiot!«, schreit der Mann ihrem Großvater ins Gesicht. Und dann zerreißt er das T-Shirt. »Du bist nicht wert, etwas aus meiner Heimat auf deinem scheißschwarzen Körper herumzutragen«, schreit der Mann.
Ebo erwidert nichts und hält die Augen fest geschlossen. Der Schreihals sagt etwas zu einem seiner Männer. In einer Sprache, die Kisi nicht versteht. Von hinten stiefelt der Angesprochene Ebo in die Kniekehlen, worauf er nach vorn zusammenbricht und auf dem Bauch zu liegen kommt. Sofort geht der Mann, der links von Ebo stand, in die Hocke und presst ihm sein Knie zwischen die Schulterblätter. Der Mann hinter ihm spreizt ihm die Beine und holt mit dem Fuß aus. Dann tritt er von hinten zu. Ebo zuckt nur und lässt keinen Ton hören. Der Mann links dreht Ebos Arm auf den Rücken. Kisi glaubt das Knacken des Schultergelenks zu hören. Sie will losrennen, sich auf die Männer stürzen. Aber die sind zu fünft. Und sie ein vierzehnjähriges Mädchen. Sie sind weiß. Und sie ist schwarz. Was kann sie ausrichten? Solange sie denken kann, hat nie irgendein Schwarzer gegen irgendeinen Weißen etwas ausrichten können. Darum haben sie sich immer von ihnen ferngehalten, so gut es ging.
Der Anführer schreit noch einmal etwas auf Ebo hinab. Dann holt er mit dem schweren Metallkanister aus und lässt ihn auf Ebos Schädel krachen. Kisi hofft für ihren Großvater, dass seine Seele die Reise aus seinem Körper hinaus bereits angetreten hat. Der Mann links lässt den Arm los. Ebo rührt sich nicht mehr. Jetzt nimmt der Mann, der rechts von dem reglos daliegenden Ebo steht, aus der Beintasche seiner Khaki ein Stempelkissen. Er nimmt Ebos rechten Arm und macht mit der Farbe die Fingerkuppen schwarz. Dann nimmt er das Blatt Papier, das immer noch zusammen mit dem Geld auf dem Boden liegt, und drückt die Fingerspitzen darauf. Er besieht sich sein Werk, nickt zufrieden, faltet das Papier zusammen und steckt es in die Brusttasche des Jeanshemdes.
Der Anführer gibt den anderen Befehl, weitere Kanister aus den Autos zu holen. Sie gehen damit ringsum durch das Dorf und zünden eine Hütte nach der anderen an. Zum Schluss schütten sie den Rest des Benzins über den toten Ebo. Den Leichnam in Flammen zu setzen, behält sich der Wortführer vor. Er ist ein großer Mann mit milchig weißer Haut und rotem Haar, dessen Gesicht sich Kisi für den Rest ihres Lebens merken wird. Er beugt sich zu Ebo hinunter und tätschelt ihm noch einmal die Schulter, bevor er sein Feuerzeug entzündet und an Ebos Kopf hält.
Kisi sitzt die ganze Zeit über versteinert hinter der Tonne und wagt kaum zu atmen. Doch das Bild ihres brennenden Großvaters raubt ihr beinahe den Verstand. Sie heult laut auf.
Mit zwei Sätzen ist einer der Kerle bei ihr. Er bleibt breitbeinig über ihr stehen. Was er sagt, kann sie nicht verstehen. Das Blut rauscht ihr in den Ohren. Sie ist beinahe ohnmächtig vor Wut, Trauer und Zorn. Dann kommt der zweite Mann zu ihr. Sie reißen sie an den Armen hoch. Sie wehrt sich mit aller Kraft.
Sie strampelt.
Sie tritt.
Sie beißt.
Sie spuckt.
Sie lachen nur. Sie sind groß und stark. Sie sind zu viert. Der fünfte steht immer noch neben Ebo und schaut den anderen zu.
Sie zerren sie zu ihm. Es riecht nach verbranntem Fleisch. Nach dem Fleisch ihres Großvaters.
Der Boss der Weißen grinst Kisi an. Sein Gesicht ist rot wie die Sonne, wenn sie am Abend über ihrem Baum untergeht. Ein Eckzahn fehlt. Seine Ohrläppchen sind angewachsen, daran kann sie sich später erinnern.
Nein, daran muss sie sich später erinnern.
Ihr ganzes Leben lang, jeden Tag und jede Nacht.
Der Anführer nickt mit dem Kinn in Richtung eines der Landrover. Sie schleppen sie dorthin und werfen sie auf die Ladefläche. Der Mann mit den angewachsenen Ohrläppchen steigt ihr hinterher, während die anderen sie festhalten. Sie reißen ihr die Shorts nach unten und ziehen ihr das T-Shirt über den Kopf.
Der Mann mit den angewachsenen Ohrläppchen hat schon die Hose heruntergelassen. Er umfasst mit seinen großen Händen ihre Oberschenkel, hebt das ganze Mädchen kurz in die Höhe und legt sie sich zurecht.
Dann stößt er zu. Es tut furchtbar weh.
Der Mann grunzt. Er stößt und grunzt und grunzt und stößt.
Es riecht nach verbranntem Fleisch. Es wird nass zwischen ihren Beinen.
Jetzt kommt der Nächste dran.
Er grunzt. Und stößt.
Jetzt der Dritte.
Er stößt. Er grunzt.
Dann der Vierte.
Er grunzt leise. Und stößt schnell.
Dann der Fünfte.
Er stößt. Kisi hört das Grunzen nicht mehr. Sie hat das Bewusstsein nach dem Vierten verloren.
Erst nach dem Vierten.
Als alle fünf mit ihr fertig sind, zerren sie sie von der Ladefläche und werfen sie nackt in den Staub. Der schwere Allradwagen, auf dessen Ladefläche sie gerade lag, fährt rückwärts.
Kisi kommt zu sich, sieht die Schrift auf der Heckklappe. PalmCorp steht da in großen, silbrig glänzenden Lettern. Der Schriftzug brennt sich in ihre Netzhaut ein. Der Wagen kommt näher, bis das rechte Hinterrad über ihren geschundenen nackten Körper rollt. Das Getriebe knirscht, als der Fahrer den ersten Gang einlegt. Er gibt Gas, und die zwei Tonnen Metall überrollen Kisi noch einmal.
Endlich nehmen ihr die Schmerzen erneut das Bewusstsein.
Die Fremden rauschen in ihren Geländewagen durch den Rauch und über die Sandpiste davon. Sie machen sich nicht einmal die Mühe nachzusehen, ob sie tot ist.
Die Hand in dem dick wattierten Arbeitshandschuh umfasst den Zünder und dreht ihn um neunzig Grad nach rechts. Zwei Sekunden lang geschieht nichts. Dann zerreißt ein Knall die Stille des Nachmittags über dem See. Es klingt mehr nach einem Peitschenknall als wie eine Explosion. Ein riesengroßer Peitschenknall.
Der Schall schlägt vom Berg auf der anderen Seite zurück. Entlang der Löcher, in denen sie die Dynamitstangen versenkt haben, spritzt das Eis auf.
Pause.
Nichts geschieht.
Das haben sie nicht erwartet. Shit. Ist der Versuch gescheitert?
Zehn Sekunden. Fünfzehn. Zwanzig.
Plötzlich hebt sich die Eisfläche in der Mitte des Sees. Tausend Risse laufen durch das Eis. Dann kommt die Welle. Wie ein Geysir brodelt das Wasser auf. Acht, zehn Meter hoch türmt es sich auf, bevor es sich über das Eis ergießt.
Schon steigen die Sprenggase durch die nächste Blase nach oben und heben das Wasser erneut an. Die gesamte Eisfläche auf dem See zerbröckelt. Langsam, aber schneller als der Tsunami auf diesen Amateurvideos aus Banda Aceh kommt die Welle am Ufer an. Klatscht in den Schnee. Wo vor einer Minute ein See seinen Winterschlaf gehalten hat, springt eine Brandung ans Ufer, die Erinnerungen an einen Badetag am Atlantik weckt. Nun gut, zumindest an einen Tag im Wellenbad.
Zwei Minuten später hat sich die Schockwelle über die gesamte Fläche ausgebreitet. Nirgends mehr ein Stückchen Eis, das größer ist als ein Teller.
Es funktioniert. Es ist möglich. Du glaubst es nicht, bevor du es nicht gesehen hast. Es funktioniert, verdammt noch eins! Gimme five!
Die dick gefütterten Arbeitshandschuhe paffen über den Köpfen aufeinander.
Was sagst du jetzt, Mann? Kranker Shit. Und es sieht auch noch toll aus. Und was sagst du dazu? Wir brauchen viel weniger Sprengstoff, als wir geglaubt haben. Das war ja hier schon der absolute Overkill. Der ganze See ein Cocktailshaker voll crushed ice. Wir wollen das ja steuern können. Das kriegen wir auch noch hin. Clive kriegt das hin. Clive kann das. Yo da man, man!
Sie umarmen sich, klopfen sich auf die Schultern.
Yo, is gut, M’am.
Schnell wieder Professionalität. Sie packen ihre Gerätschaften ein. Der Satellit kommt bald an dieser Stelle vorbei.
Die nächste Aufgabe lautet nun, die Wirkung des Sprengstoffes so zu dosieren, dass man die Eisfläche eines zugefrorenen Sees in planbaren Abschnitten in die Luft jagen kann. Sie haben noch drei Monate Zeit. Es muss klappen. Es wird klappen, verdammt.
Sie packen die Alukisten zu zweit an den Griffen und tragen sie zum Tragnetz des Hubschraubers. Der nächste unbenannte See liegt gleich hinter dem nächsten namenlosen Berg. Den See hier, der in Google Earth die Form des Kontinents Afrika hat, haben sie Lake Albert getauft. Großer Spaß.
Albert wird sich freuen, wenn wir ihm das sagen. Sagen wir es ihm? Mal sehen. Wir müssen ihm so viele Dinge erzählen. Sein See. Freuen wird er sich nicht. Aber wir. Kann auch sein, dass wir ihm wichtigere Dinge zuerst sagen müssen. Wahrscheinlich.
Das Wasser des frisch getauften Albertsees beruhigt sich wieder, während der Rotor des Helikopters anläuft. Zwischen den Millionen von Eisstückchen dümpeln Zigtausende von toten Fischen, deren Schwimmblasen die Sprengung zerrissen hat.
Kollateralschäden.
http://www.myvideo.de/watch/7975003/Zugefrorenen_See_sprengen
Teil 1
»Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?«
Bertolt Brecht, deutscher Dramatiker (1898–1956)
Das kannst du vergessen.« Sandra Thaler knallte das Messer auf den Küchentisch.
»Sandra, ein solcher Auftrag! Den ganzen Januar und Februar. Und für den American Mountaineer. Das Geld reicht wahrscheinlich für das ganze nächste Jahr. Abgesehen davon, dass ich denen noch was schulde. Die haben ihren Vorschuss nie zurückbekommen.«
»Aber das erste Interview mit dir, dem Zugspitzhelden, das haben sie bekommen. Damit haben die mehr Auflage und Kohle gemacht, als ihnen die hübschen Bergbilder gebracht hätten, die sie in Auftrag gegeben hatten. Jetzt tu das Scheiß-Handy weg. Ich red mit dir!«
»Wenn ich im Geschäft bleiben will, dann muss ich solche Megaaufträge annehmen. Da stehen Hunderte von Fotografen Schlange. Ach was, Tausende. Das würde jeder machen, der nur eine Kamera in der Hand halten kann.«
»Ja, ja, und der mit der anderen Hand an den russischen Püppchen herumfummelt.«
»Püppchen? Russische? Du meinst Matrjoschkas? Die zum Ineinanderstecken?«
»Jetzt stell dich nicht dümmer, als du bist, Thien. Ich mein kein Holzspielzeug. Aber Ineinanderstecken ist das Stichwort.« Sie klatschte die Aprikosenmarmelade aufs Brot. »Im Ernst: Ich lass dich doch nicht zwei Monate in der Hochsaison allein durch St. Moritz tingeln. Trau, schau, wem?«
»Ach, daher weht der Wind. Vorauseilende Eifersucht.«
»Von mir aus nenn es Eifersucht. Ich sage: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Jetzt hab ich dich endlich wieder. Und jetzt gebe ich dich auch nicht mehr her.«
»Dann komm halt einfach mit. Ich kann denen sicher verkaufen, dass wir als Duo die besseren Bilder liefern. Bei dem ganzen Rummel, da jagt ja ein Event das nächste. Das wird mir eh zu viel.«
»Ich bin da mitten in der Trainingsphase, mein Lieber. Im Februar ist Weltmeisterschaft!« Sie verstrich die Marmelade. »Wobei … Höhentraining ist sowieso großartig. Das Engadin liegt auf fast zweitausend Metern. Meinst du, die bezahlen, dass ich die ganzen zwei Monate dort …«
Thien schluckte. So hatte er es nicht gemeint. Aber es war ja klar, dass seine Sandra alles wollte: sich auf die Meisterschaften im Skibergsteigen vorbereiten und ihn begleiten. Ihn überwachen, da machte er sich nichts vor. »Ich muss mal fragen. Ich schreib denen heut Abend ’ne Mail. Muss ja nicht eines dieser Grandhotels sein. Auch im Engadin gibt’s Ferienwohnungen. Dann ziehen wir einfach für zwei Monate dorthin. Du trainierst am Tag, und an den Abenden ziehst du mit mir durch die VIP-Bereiche in den Hotels und bei den Veranstaltungen. Mal sehen, wie lange du das auf knapp zweitausend Metern Höhe aushältst.«
»Ich muss ja nicht immer und überall dabei sein. Nur wo die Dichte an russischen Püppchen zu hoch ist. Also bei den Pferderennen auf dem See zum Beispiel. Oder beim Cresta-Run. Oder bei den Weltcup-Skirennen …«
»… oder bei der WinterRAID oder beim Polo oder beim Ballonfestival oder beim … Was weiß ich, was da alles auf dem Programm steht.«
»Ganz genau. Es wird großartig. Ich habe mir das Programm schon runtergeladen und mit meinen Trainingsplänen abgeglichen. Das passt schon alles. Ich kann meine Erholungsphasen so legen, dass sie immer dann sind, wenn unsere Termine stattfinden.«
»Unsere Termine. Soso.« Thien überraschte nicht, dass Sandra alles von langer Hand geplant hatte. »Und du hast sicher schon die Ferienwohnung ausgeschaut, in die wir ziehen.«
»Klar. Casa di Piero in Maloja. Hab ich übers Internet gefunden. Gehört einem Fotografen-Kollegen. Der ist im Winter in Südafrika und vermietet seine Wohnung. Ist wie gemacht für uns.«
»Und was kostet der Spaß? Nur damit ich es den Amerikanern verklickern kann.«
»Zweitausend die Woche. Hochsaison.«
»Zweitausend? Das sind in acht Wochen 16000 Euro! Bist du verrückt?«
»Schweizer Franken, keine Euro. In Euro sind es nur gut 13000.«
»Und in Dollar?«
»Knapp 17000.« Sandra wurde kleinlaut wie selten. »Ich hab es schon gebucht. Fix. Mit fünfzig Prozent Anzahlung.«
Thien schaute seine Freundin mit zugekniffenen Augen an. »Woher hast du so viel Geld?«
»Ich bin sparsam, Thien. Ich hab von meinen Fotohonoraren der letzten Jahre wenig ausgegeben. Und von meinen Preisgeldern fast nichts. Und ich hab gesehen, wie schnell das Leben vorüber sein kann. Also gönn uns den Spaß. Ich will auch mal ein bisschen große weite Welt. Bevor ich alt und grau bin. Ich zahl auch den Rest, wenn die Amis nichts übernehmen.«
»Kommt überhaupt nicht in Frage! Ich zahl das schon selbst. Ich habe ja mittlerweile einiges verdient. Ich wollte es nur nicht gleich wieder auf den Kopf hauen. Aber die Amis zahlen schon etwas dazu, mach dir keine Sorgen.« Er machte eine Pause und stocherte mit dem Messer im fast leeren Marmeladeglas herum. »Ich freu mich drauf. Echt. Was für eine gute Idee von dir.«
»Wirklich? Das ist großartig. Ich dachte schon, du bist sauer.«
»Wie kann ein Mann sauer sein, dem zwei Monate in St. Moritz mit der schönsten Frau der Welt bevorstehen?« Thien lächelte seine Freundin an. Dann stand er vom Frühstückstisch auf. »Ich hab einen Termin mit jemandem vom Alpenverein. Die wollen mich im Sommer auf Vortragsreise schicken. Hab ich dir ja schon erzählt. Bis später.«
Thien ging zur Tür und schlüpfte in die Stiefel, die dort unter der Garderobe standen. Gerade als er das erste Schuhband zur Schleife gebunden hatte, klingelte es. Er riss die Tür eine halbe Sekunde später auf und sah einen verdutzten Postboten. »Das war schnell«, sagte der.
»Amazon?«
»Einschreiben.«
»Finanzamt?«
Der Postler sagte nichts, hielt Thien nur seinen Handheld-Computer zur Unterschrift unter die Nase. Nachdem Thien auf dem verkratzten grauen Display seinen unleserlichen Kringel hinterlassen hatte, wurde ihm das Schreiben ausgehändigt. Es war nicht vom Finanzamt. Das Finanzamt klebt keine bunten Marken und Luftpostaufkleber auf die Umschläge.
Thien griff nach dem Brief, aber der Postbote zog ihn wieder weg, als wollte er ihn ärgern. »Acht Euro zwanzig Nachgebühr. Lern mal deiner vietnamesischen Verwandtschaft, wie man ordentlich frankiert!«
Thien stand da wie vom Donner gerührt. Vietnam? Ein Brief aus Vietnam? Er kramte einen Zehner aus der Hosentasche und hielt ihn dem Postmann hin. Dann schnappte er sich den Brief mit einer schnellen Bewegung. »Passt«, sagte Thien, bevor er die Tür zuschlug.
Albert Sonndobler war unglücklich. Er saß zusammengesunken im überdimensionierten Chefsessel hinter seinem Schreibtisch und starrte durch die Fensterfront seines Büros über die Altstadt. Die schlechten Nachrichten, die sein wichtigster Konkurrent von der anderen Seite des Zürcher Paradeplatzes und der große deutsche Cousin aus Frankfurt im Minutentakt veröffentlichen mussten, hätten seine Stimmung aufhellen müssen. Doch es wollte sich einfach keine Champagnerlaune einstellen. Schlechte Nachrichten der anderen Branchengrößen waren auch schlechte Nachrichten für ihn. Längst war klar, dass das internationale Finanzwesen nicht ohne massive Imageverluste aus den Krisen der vergangenen zehn Jahre gekommen war. Keiner wollte mehr etwas mit Bankern zu tun haben. Teilweise zu Recht, wie Sonndobler insgeheim dachte. Aber auch nur teilweise. Doch seine private Meinung interessierte nicht. Der Aktienkurs seiner Caisse Suisse, des größten Instituts der Schweiz, kannte seit Monaten nur eine Richtung – abwärts. Er betrachtete die Statuette, die er als »Bankier des Jahres« im Sommer von dem Finanzmagazin aus London überreicht bekommen hatte. Eine Titelgeschichte hatten sie ihm gewidmet. Was würde das alles wert sein, wenn die Aktien der Bank bald nur noch ein Drittel dessen kosteten als zu dem Zeitpunkt, zu dem er sich auf dem Chefsessel niedergelassen hatte?
Passend zu seiner Stimmung graupelte es seit Tagen. Durch die Schauer hindurch ahnte er den See. Der Nebel, der über das Wasser strich, um zwischen die Bankzentralen und Unternehmensverwaltungen zu kriechen, verdichtete sich nach oben und ging nahtlos in eine graue Wolkendecke über. Diese schien nur wenige Meter über der Stadt zu hängen und sie einzuhüllen wie die Watte ein Schmuckstück in seiner Schatulle.
Dieser Gedanke, der ihm intuitiv gekommen war, machte ihn noch unglücklicher. Er dachte an das Geschenk. Morgen, am Samstag vor Weihnachten, musste er in die Bahnhofstraße zu Tiffany & Co., Beyer und in all die anderen Läden. Persönlich. Dafür konnte er nicht Winfried schicken. Das war keine Aufgabe für einen Chauffeur, auch wenn Winfried sie sicher mit Bravour erledigt hätte. Aber der President und CEO der größten schweizerischen Bank konnte nicht seinen Fahrer entsenden, um das Weihnachtsgeschenk für seine Gattin zu kaufen. Unmöglich. Man würde es Isabel innerhalb weniger Stunden zutragen. Und dann hinge an Weihnachten der Haussegen schief. Auch das noch.
Nein, er musste es selbst tun, sich dabei beobachten lassen, wie er, einer der meistbeschäftigten und mächtigsten Männer der Schweiz, an dessen Schaffen das finanzielle Schicksal von internationalen Multis und ganzen Staaten hing, sich die Zeit nahm, eine exklusive und elegante Preziose für seine geliebte Frau auszuwählen. Mindestens zwei Stunden müsste er entspannt und relativ gut gelaunt durch die Uhrmacher- und Juweliergeschäfte auf der Bahnhofstraße flanieren und sich hier und da das eine oder andere zeigen lassen. Es dürfte in diesem Jahr nicht schon wieder ein mechanischer Genfer Zeitmesser sein. Isabel hatte letztes Jahr schon die Brauen nach oben gezogen, zwar nur andeutungsweise, aber doch deutlich genug.
Nein, dieses Jahr musste das Weihnachtsgeschenk ein Statement sein. Sie wollte ein emotionales, ein bedeutungsvolles, ein einzigartiges Geschenk, das wusste er. Ja, in diesem Jahr müsste es einmal wieder ein großer blinkender Stein sein. Die Inhaber und Geschäftsführer von Beyer, Gübelin, Bucherer und Co. würden ihn im Kaffee ertränken und mit Petit Fours stopfen und ihm die Stücke zeigen, die nicht in den Auslagen zu sehen waren. Die für die besondere Klientel, für Leute wie ihn, reserviert waren. Einzelanfertigungen. Alles sehr elegant. Nie protzig. Immer sehr teuer. Und irgendwann musste er dann zuschlagen. Musste einen sechsstelligen Betrag auf den Tisch des von ihm in diesem Jahr auserkorenen Hauses legen. Und dann musste er … Ja, dann musste er nach Hause.
Ein Samstagnachmittag war zu überstehen, an dem das Haus einem Taubenschlag gleichen würde. Lieferanten würden sich die Klinke in die Hand geben, das Personal würde gar nicht nachkommen, die angelieferten Blumen, Dekorationen, Lebensmittel und Getränke in Empfang zu nehmen und zu verstauen. Bei dem Wetter konnte man nichts draußen stehen lassen. Die Kartons würden sich in der Küche und im Gang zu den Dienstbotenzimmern stapeln. Das wäre auszuhalten gewesen. Leider würde auch die Eingangshalle zugestellt werden, weil viele Fahrer heutzutage einfach nicht mehr wussten, dass ein ordentlich geführtes Haus einen Dienstboten- und Lieferanteneingang hatte. Sie würden ihre Sachen einfach abstellen und mit ihren weißen Kastenwägen wieder verschwinden.
Winfried würde mindestens drei Mal von der Villa in die verstopfte Stadt hinunterfahren müssen, um eines der Mädchen vor den Konsumtempeln abzuliefern, in denen noch das eine ganz besondere Stück des geschliffenen Kristallweihnachtsschmucks abzuholen war. Oder die vierundzwanzigste Dessertgabel des Festtagsbestecks war nicht auffindbar und musste eiligst neu beschafft werden, obwohl sie am Heiligen Abend und an den Feiertagen nur jeweils gut anderthalb Dutzend Gäste erwarteten. Er hatte sich diesmal ausbedungen, dass nur seine Mutter und Isabels Eltern sowie deren drei Brüder mit den zugehörigen Frauen und Kindern angereist kamen. Das war Folter genug, denn die Familie Schlüter war unerträglich fruchtbar, jedenfalls Isabels Brüder. Sie kamen jedes Jahr mitsamt ihrer ständig wachsenden Kinderschar aus der ganzen Welt eingeflogen.
An solchen Tagen wünschte sich Albert Sonndobler, die Swissair wäre damals dauerhaft am Boden geblieben und mit ihr der Flughafen in Kloten gleich mit zugesperrt worden. Doch er selbst hatte damals als Leiter der Umstrukturierungsabteilung von Freyfogl & Johnson einen erstklassigen Job gemacht und die Fluglinie so nachhaltig aufgestellt, dass die daraus entstandene Swiss einer der profitabelsten Air Carrier der Welt wurde. Den defizitären Flughafen hatte er gleich im selben Aufwasch saniert.
Diese betriebswirtschaftlichen Großtaten hatten ihm den Job an der Spitze der Caisse Suisse eingebracht, den höchstdotierten Bankiersjob des Kontinents. Das war der gerechte Lohn für die Achtzigstundenwochen und ungezählten Nachtsitzungen. Die ungerechte Strafe war die unausweichliche Landung der Familie seiner Frau zu jedem Weihnachtsfest.
Wenigstens hatte sich seine Sekretärin Annemarie Käppli in den letzten Wochen um die anderen Geschenke gekümmert. Für die weitläufige Verwandtschaft sowie die allerwichtigsten zweihundert Kunden hatte sie bebilderte Listen aus den Produktseiten von Architectural Digest, Vogue und GQ zusammengestellt und ihm so die Entscheidung vorbereitet, wer was bekommen sollte. Im Anschluss ging es an die Besorgung der schönen und in den meisten Fällen wertvollen Dinge: Kaschmirpullover, Hermès-Tücher, Zigarren und jede Menge ausgefallener Digitalspielzeuge. Viele der neu erschienenen Technik-Gadgets, die Albert für seine Neffen und Schwager ausgesucht hatte, gab es bisher nur in den Staaten oder in Asien. Annemarie besorgte sie über die Chefsekretärinnen der CS-Niederlassungsleiter in den entsprechenden Hauptstädten. Man konnte davon ausgehen, dass die Damen Himmel und Erde in Bewegung setzten, um jeden noch so ausgefallenen iPhone-gesteuerten Miniaturhubschrauber in Singapur oder New York zu beschaffen. Einen CEO wie Albert Sonndobler enttäuschte man nicht.
Auch um die Gaben für Sonndoblers Kinder Albert junior und Lucille kümmerte sich Annemarie Käppli. Hier musste alles genauestens stimmen. Würden die beiden pubertierenden Biester nicht exakt die Bestellungen unter dem Christbaum finden, die sie das ganze Jahr über in die Wunschzettel-App ihrer Mobiltelefone getippt hatten, war der Sonndoblersche Weihnachtsabend gelaufen.
Die Sonndoblers hatten die verwaisten Zwillinge Albert junior und Lucy vor knapp dreizehn Jahren adoptiert, nachdem klar war, dass Isabel zum seit Generationen florierenden Kinderreichtum der Schlüters nicht würde beitragen können. Sonndobler war der Ansicht gewesen, den Wunsch seiner jungen Frau nach zwei Kindern in einem Rutsch zu erfüllen wäre das Praktischste.
Zwei Wochen vor Weihnachten flatterten nur noch einzelne Last-Minute-Wünsche von Albert junior und Lucy auf Annemarie Käpplis Tisch. Albert Sonndobler wusste, dass er sich auch in diesen Dingen voll und ganz auf sie verlassen konnte. Sie war darauf erpicht, ihm reibungsarme Weihnachten zu bescheren, damit er sich wenigstens ein paar Tage entspannen könnte. Er würde sie danach wie in jedem Jahr mit auf die im Januar und Februar beinahe wöchentlich anstehenden Dienstreisen nach St. Moritz und Davos nehmen. Ohne sie wäre er auf den zahlreichen Events im Engadin, deren Hauptsponsor die Caisse Suisse war und bei denen er seine Bank repräsentieren musste, aufgeschmissen gewesen. Und auf dem Weltwirtschaftsgipfel erst. So viele Namen, so viele Gesichter. Ohne das PC-Programm Management of Important Persons, das MIP-System, wie sie es intern nannten, das auf Sonndoblers persönlichen Wunsch im Unternehmen etabliert worden war, wäre er auf diesen Anlässen und Partys glatt untergegangen. Die oberste Schaltzentrale des MIP-Systems war Annemarie Käppli. Nur sie wusste, wer für Sonndobler wichtig war, wen er mochte, wen er mögen musste, wen er grundsätzlich oder zurzeit mied.
Kurzum: Mit seiner Sekretärin verband Albert Sonndobler ein besonders starkes Vertrauensverhältnis. Freilich: Es war nicht ihr einziges.
Doch bevor diese schönen St.-Moritzer-Tage beginnen würden, müsste Sonndobler die Familienhölle überstehen. Er sank noch ein paar Zentimeter tiefer in seinem Ledersessel zusammen. Seine ansonsten eindrucksvolle Figur, die die meisten seiner Untergebenen und Kunden überragte (was dazu beitrug, dass er auf Zusammenkünften immer im Mittelpunkt stand), schnurrte auf die Maße eines verschrumpelten Buchhalters in einer der unteren Etagen der Bankzentrale zusammen.
Er richtete sich ein wenig auf, als es an der Tür klopfte. Er hörte aus dem leisen Pochen heraus, dass Annemarie gezögert hatte, ihn zu stören. Selbst das Klopfen seiner Sekretärin an seiner Bürotür kannte er aus dem Effeff.
»Bitte!«
»Herr Sonndobler, ein Kurier, der sich nicht abweisen lässt«, meldete Annemarie Käppli vorsichtig. »Er hat eine wichtige Weihnachtsbotschaft eines unserer besten Kunden, sagt er. Er darf sie nur Ihnen überbringen. Persönlich.« Im Büro und in der Öffentlichkeit siezten sich Annemarie Käppli und Albert Sonndobler.
»Welcher Kunde?«
»Will er auch nur Ihnen sagen.«
Sonndobler schnaubte. Dann wurde er chefmäßig. »Wie kommt der eigentlich hier rauf? Kann hier jeder Hinz und Kunz an unserer Pforte vorbei und schnurstracks in das Büro des CEO marschieren? Ich muss unserem Sicherheitsmann mal den Marsch blasen.« Er stand auf, straffte seinen Körper, den er in seiner Jugend mit Gewichtheben und Rudern trainiert hatte, und durchmaß mit langen Schritten das Vorstandsbüro. Er stürmte an Annemarie Käppli vorbei ins Vorzimmer.
Dort stand ein äußerst gepflegter Mann um die dreißig. Er trug einen hellgrau-blauen Fischgrätanzug, den Sonndobler mit geübtem Blick als Zegna Su Misura einordnete. Eine dezente Krawatte, mit großem italienischen Knoten gebunden, und ein weißes Einstecktuch perfektionierten den Dreiteiler. Mit beiden Händen hielt der Mann ein schwarzes Lederportefeuille vor dem Bauch.
Sonndobler umkurvte den Schreibtisch seiner Chefsekretärin. Um ein Haar hätte er das opulente Blumenbouquet mit dem rechten Ellbogen mitgenommen. Er stoppte einen Meter vor dem Mann. »Sonndobler. Was kann ich für Sie tun?«
Der Fremde nahm das Portefeuille in die Linke und reichte Sonndobler die Rechte zum Gruß. »Alexandre d’Annecy. Sehr erfreut, Herr Dr. Sonndobler. Es tut mir sehr leid, wenn ich Sie störe. Ich habe eine Botschaft der Luxor-Fondsgesellschaft für Sie.« Damit ließ er Sonndoblers Hand los und öffnete die schmale Aktentasche, um ihr einen weißen Umschlag zu entnehmen.
»Luxor Fondsgesellschaft …« Sonndobler wandte den Kopf und sah Annemarie Käppli an, die schon wieder hinter ihrem Computer saß. Sie hatte sofort, als der Mann den Namen seines Auftraggebers erwähnte, »Luxor« in die Suchmaske des MIP-Systems eingegeben.
»Luxor Finance and Investments limited. Sitz auf Zypern.« Annemarie Käppli klickte zweimal mit der Maus. »Hat vor einer Woche ein Konto bei unserer Niederlassung in Liechtenstein eröffnet.« Sie stutzte. »Einlage: ein US-Dollar.«
»Und wenn Ihr System gut wäre, würden Sie sehen, dass wir auch eine Stammaktie der Caisse Suisse erworben haben«, sagte d’Annecy mit gefrorenem Lächeln. »Ich vertrete also einen Kunden und Anteilseigner.«
»Nicht gerade den allergrößten Kunden und Anteilseigner, wenn Sie ehrlich sind«, sagte Sonndobler. Er überlegte, ob er nicht besser auf dem Absatz kehrtmachen und in sein Büro zurückkehren sollte. Doch irgendetwas war an dem Mann, was seine Neugier erregte.
»Nun, das ist lediglich ein temporärer Status. In diesem Umschlag befindet sich ein Papier, dessen Inhalt über Fortbestand oder Zerschlagung des Instituts entscheidet. Wollen Sie es sich ansehen?«
Sonndobler und seine Sekretärin starrten den Mann an. In ihren Blicken mischten sich Verärgerung mit Verwunderung und Ratlosigkeit. Was wollte dieser Mann? Wer war er? Wer hatte ihn geschickt?
»Fünf Minuten.« Sonndobler wunderte sich selbst am meisten. Wollte er diesem Verrückten wirklich eine Audienz gewähren? Annemarie Käppli verschluckte sich vor Schreck.
Sonndobler drehte sich um und ging dem seltsamen Besucher voraus in sein Büro. Alexandre d’Annecy – oder wer immer der Mann war – folgte wortlos. Annemarie Käppli schloss die Tür hinter den beiden und alarmierte den Sicherheitsdienst. Noch bevor die Uniformierten das Vorzimmer betraten, öffnete sich Sonndoblers Bürotür wieder. Alexandre d’Annecy hatte nur drei Minuten benötigt, um das Anliegen der Luxor-Fondsgesellschaft vorzubringen. Er verabschiedete sich mit einem eiskalten Lächeln und einem »Merci vielmals« von Annemarie Käppli.
Dass er noch ein »Auf ein baldiges Wiedersehen« anhängte, als er bereits auf den Gang vor ihrem Zimmer getreten war, machte ihr Angst.
Mein lieber und verehrter Cousin Thien!
Mein Name ist Nguyễn Minh Hải. Wenn du der richtige Thien Hung bist, dann wirst du dich fragen, woher ich dich kenne. Wenn du nicht der richtige bist, dann wirf den Brief einfach weg. Oder nein, es wäre sehr freundlich, wenn du mir auf jeden Fall eine E-Mail schicken würdest, damit ich erfahre, ob du der richtige bist oder nicht.
Also, woher kenne ich dich, lieber und verehrter Cousin Thien Hung? Aus den Nachrichten natürlich. Deine Geschichte ist um die Welt gegangen. Es hat ein wenig gedauert, bis sie zu uns nach Huế vordrang. Ich leite den Dive Shop in unserem Beach Ressort, und ein amerikanischer Tourist hat auf dem Tauchboot, das ich gesteuert habe, in einem Newsweek-Magazin gelesen. Er ist mitten auf dem Meer aufgesprungen und hat zu seiner Frau ganz aufgeregt gesagt: »Ein Vietnamese! Unser Mann in Garmisch!« Und dann ist er mit dem Magazin in der Hand zu seiner Frau gegangen, die auf dem anderen Ausleger meines Bootes saß, und hat ihr die Geschichte gezeigt. Und die Frau hat gerufen: »Unsere Frau aus dem Schnee!«
Ich habe nur deshalb zugehört, weil sie das Wort »Vietnamese« und »Schnee« dann noch ein paar Mal erwähnt haben. Sie waren immer noch sehr aufgeregt, haben aber leiser gesprochen. Ich habe nichts weiter verstanden, denn der Diesel des Boots war zu laut. Jedenfalls haben sie das Magazin nach dem Tauchgang an der Bar des Ressorts liegenlassen. Und ich habe es mir ausgeliehen. Darin stand eine Geschichte von einem Vietnamesen, der in Deutschland aufwuchs und der einen Terroranschlag auf einen hohen Berg vereitelt hat. Da war meine Neugierde natürlich erst recht geweckt. Besonders, weil in diesem Artikel ein Name mit Filzstift rot markiert war. Der Name Thien Hung Baumgartner. Und Thien Hung, das wusste ich, ist der Name meines Cousins, der als Baby mit einer meiner Tanten auf das Schiff gegangen ist. Die ganze Familie spricht immer wieder davon. Sie war die Einzige, die es gewagt hat, wegzugehen. Und wir haben von ihr und ihrem Baby nie wieder etwas gehört.
Ich jedenfalls habe mich mit Duyên, einer unserer Cousinen (in meinem Fall zweiten Grades, im deinem – falls du der richtige Thien Hung bist – dritten Grades) in Verbindung gesetzt. Sie arbeitet in Hanoi bei der Zeitung Ha Noi Moi. Sie kennt viele Leute, ein Freund von ihr arbeitet im Büro von UNHCR und führt die Listen der Boat People. Und du, lieber Thien Hung, bist mit deiner Mutter Tuyết auf eines dieser Schiffe gegangen. (Ich weiß nicht, ob du jemals herausgefunden hast, wie deine Mutter hieß. Ja, sie hieß Tuyết, was »Schnee« bedeutet. Falls du der richtige Thien Hung bist und dein Leben im Schnee verbringst, wäre das nicht eine wunderschöne Fügung?) Thien Hungs gab es auf den Listen des UNHCR nicht allzu viele. Das Jahr stimmt. Das Schiff, das dich dann schließlich aufgenommen und gerettet hat, die Cap Anamur, ist ein deutsches Schiff gewesen. Das alles passt zusammen, sagt Duyên.
Ich habe nun wochenlang darüber nachgedacht, ob ich dir schreiben soll. Denn es ist mir klar, dass du – wenn du der bist, für den ich dich halte – schon längst über UNHCR oder das Rote Kreuz nach deiner echten Familie hättest suchen können. Doch in dem Newsweek-Artikel stand, dass du am Rande der Alpen bei einer gütigen Familie aufgewachsen bist. Wahrscheinlich hast du deine echte Heimat nie vermisst.
Na ja, du hast dich nicht gemeldet, und warum, ist deine Sache. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass es uns gibt.
Damit du mich schneller erreichen kannst als ich dich per Brief, sende ich dir meine E-Mail-Adresse: [email protected]. Ich sehe jeden Tag deiner Post mit Sehnsucht und Freude entgegen.
Es grüßt dich von ganzem Herzen
Dein Cousin Minh Hải
PS: Das Lăng-Cô-Beach-Ressort, für das ich den Tauchladen manage, wäre mit und ohne Familie eine Reise wert: http://www.langcobeachresort.com.vn/. Craig und Barbara, die Amerikaner, die die Zeitschrift liegengelassen haben, kommen mindestens zwei Mal im Jahr hierher. Ich vermute, sie sind Freunde von dir.
Craig und Barbara? Thiens Puls beschleunigte wie ein Formel-1-Rennwagen. Die beiden Amerikaner aus der Zugspitzbahn. Die ihm vor einem Jahr gegenübersaßen. Die mit den Terroristen gemeinsame Sache gemacht hatten. Barbara hatte der Verhandlungsführerin der Bundesregierung, dieser smarten und toughen Kerstin Dembrowski, die Kehle durchgeschnitten. Er hatte es selbst gesehen. Bevor er sich aus dem Tunnelfenster abgeseilt hatte. Er hatte es zu Protokoll gegeben. Und nie erfahren, was aus ihnen geworden war. Ob sie mit den Geiseln aus dem Tunnel gekommen waren. Abgetaucht. Oder – und davon war er ausgegangen – ob sie verhaftet worden waren. Und seither in Guantanamo verrotteten. Craig und Barbara. Nein, es konnte keinen Zweifel geben. »Unser Mann in Garmisch …«
Sie mussten überlebt haben. Und sie mussten hinter ihm her sein. Er war der Einzige, der sie identifizieren konnte.
Er schwebte in Lebensgefahr.
Und auch Sandra schwebte in Lebensgefahr! »Unsere Frau im Schnee …« Was meinten sie denn damit? Thien wusste, welcher Newsweek-Artikel gemeint war. Er hatte ihn ausgeschnitten und abgeheftet. Schnell zog er den Leitz-Ordner aus dem Regal. Da, das war Sandra neben ihm. Sie waren beide als Power-Paar darin vorgestellt worden. Doch Sandra ohne Bezug auf die Zugspitz-Geschichte, einfach als eine der weltbesten Skibergsteigerinnen, die zufälligerweise mit dem Mann zusammen war, der in den Anschlag verwickelt worden war. Was meinten sie mit »Frau aus dem Schnee«? Wann hatten sie Sandra getroffen? Sie war doch an diesem Tag gar nicht dabei gewesen.
Oder doch?
Was verheimlichte ihm seine Freundin? Warum wollte sie unbedingt mit nach St. Moritz? Woher hatte sie das ganze Geld? Was wurde hier gespielt?
»Was ist los, mein Lieber? Du stehst da wie vom Donner gerührt. Willst du mir nicht deinen Brief vorlesen?«, fragte Sandra von der Couch her.
»Er ist auf Englisch.«
»Wo ist das Problem?«
»Er ist von einem Vietnamesen, der behauptet, mein Cousin zu sein. Er hat meine Daten über UNHCR.«
»Dazu ist das Flüchtlingshilfswerk der UN ja auch da – Familien zusammenzubringen.«
»Nach fast vierzig Jahren?«
»Hat er von dir in der Zeitung gelesen?«
»So ungefähr.« Thien musste sich setzen.
»Du hast sie verdrängt. Deine Vergangenheit. Deine Herkunft. Stimmt’s?«, forschte Sandra in seinem Unterbewusstsein.
»Wie könnte ich das? Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel blicke, sehe ich einen Mann, der ganz eindeutig nicht aus Garmisch-Partenkirchen stammt.«
»Was will dein angeblicher Cousin?«
»Dass ich Laut gebe, ob ich es bin oder nicht.«
»Und, tust du?«
»Na ja, er arbeitet in einem Beach Ressort. Vielleicht muss es ja nicht immer nur Schnee im Urlaub geben.«
Sandra lachte. »Thien Hung Baumgartner, du bist ein berechnender und ganz und gar durchtriebener Mensch.« Sie stand vom Sofa auf und setzte sich auf seinen Schoß. »Tauchen, Palmen, weißer Sand … Nach der Weltmeisterschaft und dem St.-Moritz-Stress? Gar nicht schlecht! In Vietnam kann man sich Urlaub noch leisten, hört man. Was tut dein Cousin dort genau?«
»Und ich bin berechnend und durchtrieben?« Thien nippte am Tee. Dann, nach einer kleinen Pause: »Er leitet den Tauchshop.«
»Tauchen lernen wollte ich schon immer! Was für ein Glück!« Sandra sprang auf und wollte Thien den Brief aus der Hand zupfen.
Thien war schneller und zog das Papier aus ihrer Reichweite. »Nichts da. Diesen Urlaub – falls es einer wird – planen wir mal gemeinsam. Nicht dass du dich an den Rechner klemmst und sofort Flüge bestellst. Ich muss das erst mal mit meinem Cousin klären. Immer schön langsam, bitte.«
Sandra zog eine Schnute.
»Ich schreibe ihm heute zurück, okay? Aber lass es mich erst einmal selbst verdauen. Ich habe gerade Familienzuwachs bekommen.«
Vor allem brauchte Thien Zeit, um seine Gedanken zu ordnen. Irgendetwas stimmte nicht. An dem angeblichen Minh Hải. Und auch nicht an Sandra.
»Was schaust du dich die ganze Zeit um? Was ist los?«
»Nichts.«
»Von wegen nichts. Wer ist da hinten? Du wirst doch keine Angst haben, dass dich jemand im Schlepplift überholt?«
»Wirklich nichts, Sandra.«
»Irgendeine Tussie, wahrscheinlich.«
»Geht das schon wieder los? Muss ich den ganzen Tag auf meine Skispitzen starren?«
»Das musst du nicht, Thien. Aber du drehst dich ständig um. Den ganzen Tag schon. Ist irgendwas? Geht es dir nicht gut? Hast du vor irgendetwas Angst? Die alte Geschichte?«
»Ach, woher.«
»Also doch.«
»Schmarrn.«
»Hm.«
»Hauen wir gleich morgen früh ab? Das gibt sicher einen irren Verkehr. Am besten, so um fünf in der Früh.«
»Wenn deine Eltern uns rechtzeitig ins Bett lassen, gern. Heute ist Weihnachten, du erinnerst dich.«
»Ich muss hier raus. Mir geht dieser Ort wirklich auf den Zeiger in dieser Zeit. Vollgestopft mit Touristen.«
»Dagegen wird in St. Moritz sicherlich die pure Beschaulichkeit herrschen.«
»Da kenne ich wenigstens keinen.«
Der Lift endete. Sie fuhren nach rechts aus der Ausstiegsstelle.
»Auf geht’s, Thien! Worauf wartest du?« Sandra stieß die Skistöcke entschlossen in den Schnee und stieß sich ab. So leere Pisten wie am Weihnachtsnachmittag gab es selten.
Thien blieb oben an der Abfahrt stehen. Er wollte sich das Paar, das vier Bügel hinter ihnen den Lift hinaufgefahren war, genauer ansehen, darum tat er so, als müsste er Beschlag von seiner Skibrille wischen.
Als die beiden Touristen ausstiegen und an ihm vorbeiglitten, beruhigte sich Thien. Amerikaner, das schon, da hatte er richtig getippt. Aber viel jünger als Craig und Barbara. Diese hier fuhren in überraschend schnittigem Stil die schwarze Piste hinab.
Entwarnung.
Schnell ein Tweet und dann runter, Sandra einholen.
Es sollte die letzte Fuchsjagd werden, die der Prominentenfriseur ausrichten würde. Das war seit dem letzten Jahr klar gewesen, als die Gemeinde St. Moritz beschlossen hatte, die beheizten Polostallungen neben dem See abzureißen. Für das Polo auf Schnee ließen sich entsprechende Neubauten errichten, doch der die Fuchsjagd veranstaltende Friseur konnte sich so etwas nicht leisten. Da sich die Jagd durch das ganze Tal zog und nicht in einem überschaubaren Rund auf dem See stattfand, gab es kaum Zuschauer und somit nur wenige Sponsoren. Nur aus Großherzigkeit – und weil die Tochter von Albert Sonndobler Pferde so toll fand – unterstützte die Caisse Suisse die Jagdveranstaltung mit einem vergleichsweise bescheidenen Betrag.
Umso exklusiver waren die Teilnehmer. Pferdefreunde aus ganz Europa, aber auch aus Kanada und Australien wollten an der letzten Engadiner Schneefuchsjagd teilnehmen. Weit über hundert Rotröcke stellten sich am Morgen auf dem zugefrorenen See auf und warteten auf das Startsignal aus den Jagdhörnern. Dann ging es durch das Gelände, auf zwei nebeneinander liegenden Parcours; der eine war der harmlose, der andere der mit den Sprüngen. Man jagte Böschungen hinauf und hinab, durchpflügte Bäche und Flüsse und ließ auf den von der Pistenraupe präparierten Schneeflächen die Pferde im gestreckten Galopp dem vorausreitenden Reiter folgen, der den Fuchs zu spielen hatte. Drei Tage dauerte das Event, jeden Tag mit anderen Zwischenstopps bei anderen Oberengadiner Spezialitätenrestaurants und einfacheren Gasthöfen, wo die Reiter ihre Stärkung im Sattel einnahmen.
Thien Hung Baumgartner hatte seine Hausaufgaben gemacht. Die Starterliste der Schneefuchsjagd hatte er sich zwei Tage vor der Veranstaltung besorgt. Und für jeden Teilnehmer mindestens fünf Minuten Google-Recherche investiert. Bei den bekannteren Namen hatte es nur wenige Augenblicke gedauert, bis er herausgefunden hatte, was er brauchte. Bei den No-Names, die ebenfalls antraten, hatte er tiefer bohren müssen. Und bei manchen Namen hatte er erst einmal gar nichts gefunden. Das waren entweder komplett unbedeutende Menschen oder Personen, die ein besonderes Sicherheitsbedürfnis dazu brachte, ihre Profile im Netz verschleiern zu lassen oder dafür zu sorgen, dass sie schlicht nicht vorhanden waren.
Wie bei dieser Prinzessin aus dem ihm unbekannten Inselstaat. Er musste ziemlich weit in die Tiefe des Netzes tauchen, um Brauchbares über Prinzessin Myulalami II. zu finden. Als Thronfolgerin würde sie einmal über Fitz’ Paradise herrschen. Spätestens dann wäre sie eine der besten Partien des Planeten. Der winzige Inselstaat war unbeschreiblich reich. Ihr Vater, König Managanumani VI., hatte entdeckt, dass sämtliche Seekabel, die die amerikanische Westküste mit Asien verbanden, durch sein Hoheitsgebiet verlegt worden waren. Teilweise lagen sie dort schon seit vielen Jahrzehnten, teilweise waren sie erst in letzter Zeit verlegt worden, um den beständig wachsenden Datenstrom zwischen den beiden Kontinenten zu kanalisieren. König Managanumani VI. hatte mit den Telefongesellschaften Amerikas wie auch Japans und Chinas Geheimverträge ausgehandelt, die ihm wenige Mikrocent pro Datenpaket, das durch sein Gebiet geschickt wurde, zusicherten. Jahr für Jahr ergaben das Hunderte von Millionen Dollar an Durchleitungsgebühren. Und es wurde mit jeder Facebookseite, die ein Jugendlicher in Los Angeles einrichtete und auf die ein Freund in Tokio zugriff, mehr. König Managanumani VI. und sein Kleinstaat Fitz’ Paradise waren Top-Gewinner des Internetbooms, ohne jemals dafür auch nur eine Zeile Software-Code produziert zu haben.
Das Königreich hatte nicht einmal eine eigene Webpräsenz. Das aus dem nie enden wollenden Geldstrom entspringende Kapital leitete Managanumani VI. direkt nach Afrika weiter, wo er große Landstriche zu Spottpreisen aufkaufte. Er plante, dort später Reis anzubauen. Seine Tochter Myulalami sollte nach ihrem Schulabschluss in der Schweiz Wirtschaftschemie an der Universität Zürich studieren. Die passenden Praktikumsplätze bei den schweizerischen Pharma- und Agrarchemiekonzernen hatte er schon besorgt. Dank der Weitsicht des pazifischen Herrschers sollte Afrika die Kornkammer der Welt werden. Auf diese Weise wollte der König in die Geschichtsbücher eingehen.
Hundertfünfzig Reiter und Reiterinnen hatten zum Schluss doch einen ganzen Tag Internet-Recherche bedeutet. Der komplette Donnerstag war dafür draufgegangen. Seine Liste mit Namen, Geschlecht, Alter des Reiters und Rasse, Farbgebung und Name des Pferdes speicherte er auf einer Website, deren Adresse nur er kannte. Dazu klippte er jeweils Fotos von Ross und Reiter. So würde er es bei allen Society-Events machen, die er in den kommenden Wochen in St. Moritz fotografieren würde. Mit seinem Smartphone hätte er dann Direktzugriff zu den Daten. Die Auftraggeber vom American Mountaineer hatten höchste professionelle Arbeit verdient, schließlich zahlten sie überdurchschnittlich.