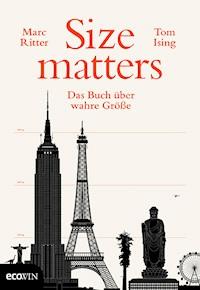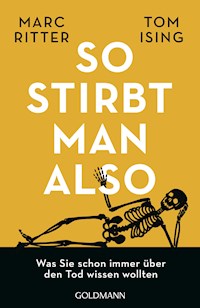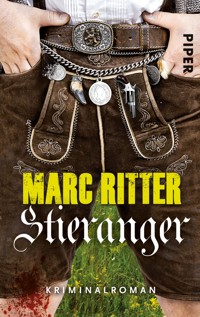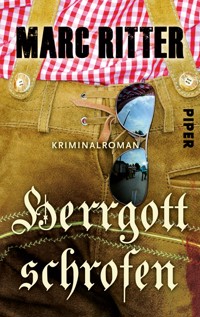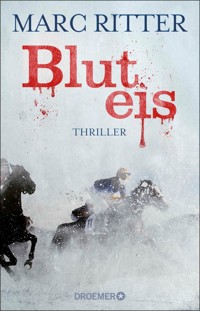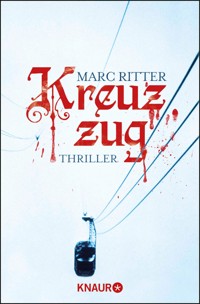
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Kreuzzug" von Marc Ritter ist ein speziell aufbereitetes eBook mit multimedialen Elementen: Es kommt mit Videos der Schauplätze und des Autoren im Interview. Orte wie auch wichtige Begriffe sind in ein Glossar und zur jeweiligen Kartenansicht verlinkt. Das Glossar enthält zudem umfassende weiterführende Web-Links. Ein irrer Plan geht auf. Attentäter sprengen auf der Zugspitze den Tunnel der Zahnradbahn. Die Seilbahn stürzt ab. 5 000 Menschen auf dem Gipfel sind Geiseln. BKA, Bundeswehr und CIA scheitern. Doch niemand hat mit Thien Baumgartner gerechnet, der die Zugspitze wie seine Westentasche kennt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Marc Ritter
Kreuzzug
Kreuzzug
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Der internationale Terrorismus ist im beschaulichen Oberbayern angekommen: Die gesamte Zugspitze wird gekidnappt, und sechstausend Zivilisten sind die Geiseln von hochausgerüsteten Terroristen. Die Zugspitzbahn wurde im Tunnel mit Sprengungen von der Außenwelt abgeschnitten. Die bayerische Polizei und die Gebirgsjäger müssen mit dem Verteidigungsminister und seinem Berliner Großkopferten-Tross zusammenarbeiten. Doch im Zug sitzt der Garmisch-Partenkirchner Alpinistenfotograf und Extremsportler Thien Baumgartner, mit dem die Terroristen nicht gerechnet haben.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Steckbrief Zugspitze
Prolog
Teil eins
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Teil zwei
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Kapitel vierundvierzig
Kapitel fünfundvierzig
Kapitel sechsundvierzig
Kapitel siebenundvierzig
Kapitel achtundvierzig
Kapitel neunundvierzig
Kapitel fünfzig
Kapitel einundfünfzig
Kapitel zweiundfünfzig
Kapitel dreiundfünfzig
Kapitel vierundfünfzig
Kapitel fünfundfünfzig
Kapitel sechsundfünfzig
Kapitel siebenundfünfzig
Kapitel achtundfünfzig
Kapitel neunundfünfzig
Kapitel sechzig
Kapitel einundsechzig
Kapitel zweiundsechzig
Kapitel dreiundsechzig
Kapitel vierundsechzig
Kapitel fünfundsechzig
Kapitel sechsundsechzig
Kapitel siebenundsechzig
Kapitel achtundsechzig
Kapitel neunundsechzig
Kapitel siebzig
Kapitel einundsiebzig
Kapitel zweiundsiebzig
Kapitel dreiundsiebzig
Kapitel vierundsiebzig
Kapitel fünfundsiebzig
Kapitel sechsundsiebzig
Kapitel siebenundsiebzig
Kapitel achtundsiebzig
Kapitel neunundsiebzig
Kapitel achtzig
Kapitel einundachtzig
Kapitel zweiundachtzig
Kapitel dreiundachtzig
Kapitel vierundachtzig
Kapitel fünfundachtzig
Kapitel sechsundachtzig
Kapitel siebenundachtzig
Kapitel achtundachtzig
Kapitel neunundachtzig
Kapitel neunzig
Teil drei
Kapitel einundneunzig
Kapitel zweiundneunzig
Kapitel dreiundneunzig
Kapitel vierundneunzig
Kapitel fünfundneunzig
Kapitel sechsundneunzig
Kapitel siebenundneunzig
Kapitel achtundneunzig
Kapitel neunundneunzig
Kapitel hundert
Kapitel hunderteins
Kapitel hundertzwei
Kapitel hundertdrei
Kapitel hundertvier
Kapitel hundertfünf
Kapitel hundertsechs
Kapitel hundertsieben
Kapitel hundertacht
Kapitel hundertneun
Kapitel hundertzehn
Kapitel hundertelf
Kapitel hundertzwölf
Kapitel hundertdreizehn
Kapitel hundertvierzehn
Kapitel hundertfünfzehn
Kapitel hundertsechzehn
Kapitel hundertsiebzehn
Kapitel hundertachtzehn
Kapitel hundertneunzehn
Kapitel hundertzwanzig
Kapitel hunderteinundzwanzig
Kapitel hundertzweiundzwanzig
Kapitel hundertdreiundzwanzig
Kapitel hundertvierundzwanzig
Kapitel hundertfünfundzwanzig
Kapitel hundertsechsundzwanzig
Kapitel hundertsiebenundzwanzig
Kapitel hundertachtundzwanzig
Kapitel hundertneunundzwanzig
Kapitel hundertdreißig
Kapitel hunderteinunddreißig
Kapitel hundertzweiunddreißig
Kapitel hundertdreiunddreißig
Kapitel hundertvierunddreißig
Kapitel hundertfünfunddreißig
Kapitel hundertsechsunddreißig
Kapitel hundertsiebenunddreißig
Kapitel hundertachtunddreißig
Kapitel hundertneununddreißig
Kapitel hundertvierzig
Kapitel hunderteinundvierzig
Kapitel hundertzweiundvierzig
Kapitel hundertdreiundvierzig
Kapitel hundertvierundvierzig
Kapitel hundertfünfundvierzig
Kapitel hundertsechsundvierzig
Kapitel hundertsiebenundvierzig
Epilog
Kapitel hundertachtundvierzig
Kapitel hundertneunundvierzig
Kapitel hundertfünfzig
Kapitel hunderteinundfünfzig
Appendix
Verwendete Literatur
Glossar
Dank …
Anmerkung
Für meine Kinder Michelle, Finn, Marcel, Henri und Mila.
Wenn ich die Verrückten alle in Bücher hineinschreibe, ob sie aus eurer Welt dann endgültig verschwinden?
Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
Perikles (490–429 v.Chr.)
Selbst wenn man eine rosarote Brille aufsetzt, werden Eisbären nicht zu Himbeeren.
Franz Josef Strauß (1915–1988 n.Chr.)
Name: Zugspitze – Wettersteingebirge
Wohnort: Nördliche Kalkalpen
Größe:2962 Meter
Alter:30 Millionen Jahre
Gewicht:198 Milliarden Tonnen
Geologie: Muschelkalk, Wettersteinkalk
Merkmale: Hufeisenförmiger Bergkamm
Prädikat:Am besten erschlossener Gipfel der Welt mit drei Seilbahnen, einer Zahnradbahn in einem viereinhalb Kilometer langen Tunnel, vier Großrestaurants, einer Kirche
Rekorde: Höchster Berg Deutschlands, bis zu 5800 Menschen an einem Wintertag, 10000 Menschen an einem Sommertag, schlimmstes Lawinenunglück Deutschlands im Mai 1965
Prolog
Pedro schaltete in den Vierten, drückte das Gaspedal bis zum Boden durch und beschleunigte den Land Cruiser auf einhundertdreißig Stundenkilometer. Um Pedro herum war nichts als die gleißende Weiße des Salzes.
Der See war trocken und die Piste eben wie ein Brett. Er hätte an diesem Tag auch mit einem Sportwagen und doppelt so schnell fahren können. Noch einmal richtig Gas geben auf seinem See, danach war ihm seit dem frühen Morgen gewesen. Das Schicksal hier, zu Hause, herausfordern. Gott versuchen. Einen Porsche 911 oder einen Mercedes SL hätte er gebraucht. Eines der schnellen Autos aus dem Land, in das er am Abend reisen würde mit zwölf der Seinen. Ein Sportwagen hätte für ein Gottesurteil getaugt. Wenn es ihn zerrissen hätte bei zweihundertsechzig, wäre es eben so gewesen. Wenn er aber ohne Unfall ans andere Ufer des Sees gekommen wäre, hätte er einen göttlichen Auftrag von Pachamama, die in allem steckte. In der Luft. Im Wasser. Im Salz.
Aber so musste er sich selbst entscheiden. Der Land Cruiser von Onkel Pepe schaffte auch auf dem brettebenen Salzsee nur hundertvierzig. Zu wenig für einen Gottesbeweis, der ihm zeigen würde, dass er im Begriff war, das Richtige, das Rechte, das Gerechte zu tun.
Er nahm die Sonnenbrille ab und warf sie auf den Beifahrersitz. Er wollte die Helligkeit, die Weite, seinen See noch einmal mit allen Sinnen erfassen. Mit den Augen in sich aufnehmen. Aufsaugen. Er wusste nicht, ob er den See und das Salz je wiedersehen würde.
Diesmal würden sie nicht lange reden. Zuhören würde sowieso niemand. Diesmal war die Zeit gekommen zu handeln.
Winzig klein waren die Sprengsätze. Hamids Tochter Khaleda hatte sie als süß bezeichnet. »Wie Twix«, hatte sie gesagt.
Ein paar hundert Gramm C4 pro Strang. Jeder Strang nicht länger oder schwerer als ein Twix. Auch die Farbe stimmte: mitteldunkles Braun. Khaleda hatte recht und Hamid mit ihrem Vergleich inspiriert. So hatte er seine kleinen Bomben in die Umhüllungen des Schokoriegels verpackt. Er hatte deutsche Verpackungen am Flughafen aus dem Müll der ankommenden Flugzeuge gesammelt. Hamid war Perfektionist. Ganz gleich, ob es um das Bauen oder um den Schmuggel seiner explosiven Kunstwerke ging.
Das C4, das er verwendete, war rein, ohne Metallstaub oder andere Marker. So waren die vier süßen Bomben mit Yemenia Air von Sanaa nach Hamburg im Gepäck einer deutschen Touristin gelangt. Von dort reisten sie mit dem Auto nach Kirchheim/Teck, wo im Frühjahr die Übergabe stattgefunden hatte. Seit dem späten Sommer klebten sie an den Innenseiten der vier Stahlstreben und harrten ihres Einsatzes. Der Tag, an dem die süßen Päckchen ihre todbringende Kraft entfalten durften, war gekommen.
Der Mann, der sich Abdallah nannte, nahm das Präzisionsglas an die Augen und fixierte die Stütze, die weit über ihm aus dem Fels zu wachsen schien. Die Fernbedienung hatte er bereitgelegt. Abdallah atmete tief durch. Nein, es musste sein. Es gab kein Zurück. Und danach erst recht nicht mehr.
Er drückte den Knopf. Es dauerte eine endlose Sekunde, bis er die vier kleinen Blitze und die zugehörigen Rauchwölkchen sah. Die Stütze erbebte. Sie blieb zunächst für einige Momente stehen, als wäre nichts weiter geschehen. Der Schall der Detonationen erreichte Abdallah. Dann, als ob die Stahlkonstruktion erst gewahr werden musste, dass sie die feste Verbindung mit ihrem Betonsockel verloren hatte, neigte sie sich unter dem Druck des Tragseiles und dem Gewicht der heranfahrenden Gondel langsam nach links. Sie fiel in einem Stück zur Seite, bevor die Tragseile ihr oberes Ende zurückhielten und sie in der Mitte abknickte. Ihre Spitze kam auf dem Betonsockel auf. Stütze II war exakt in der Mitte zusammengefaltet.
Zuerst hatte die fallende Stütze die voll besetzte Gondel nach links mitgerissen, sodass die gut hundert Frauen und Kinder in ihrem Inneren zu Boden gegangen waren. Dann riss das mit der Stütze niedergehende Tragseil die Gondel nach unten. Sie fiel fünfzig Meter in die Tiefe und schlug mit der vorderen linken Ecke auf dem Fels auf. Wegen der leichten Aluminiumkonstruktion wurde die Ecke zu einer kleinen Platte verformt. Darauf kam die Gondel zum Stehen, stabilisiert von dem Seil, das sich über ihr abgelegt hatte. Alle Insassen rutschten in die untere Ecke, und die Knochen, die nach dem Aufschlag noch ganz waren, brachen in der Masse der Leiber. Die ganz unten liegenden Mädchen, Jungen und Frauen wurden zerquetscht. Einige Plexiglasfenster hielten dem Druck stand, andere platzten nach außen. Ein paar Körper, kleine, große, wurden auf den Fels und in die Schlucht gespuckt.
Der artistisch anmutende Stand der Gondel währte nicht lange, sie kippte in den steilen Hang und überschlug sich. Das Tragseil riss unter der Gewalt ihrer Abwärtsbewegung. Obwohl die Gondel aus seinem Blickfeld verschwunden war, starrte Abdallah weiter durch das Fernglas. Er wusste, dass sie sich auf der Rückseite des Berges immer weiter überschlagen würde. Und dabei immer schneller wurde. Fast tausend Meter die Wand hinunter. Er zählte. 21–22–23 … 39–40. Zwanzig Sekunden. Jetzt würde der Klumpen aus Metall und Fleisch dort drüben im Tal zum Liegen kommen. Hamid hatte alle Daten aus dem Internet geholt und alles genau berechnet. Wer den Aufprall oben überlebt hatte, war jetzt tot.
Abdallah nahm das Glas von den Augen. Er ging zum Terminal und legte die Finger auf die Tastatur. Anders, als er es sich ausgemalt hatte, zitterten sie nicht. Seine Hände waren ganz ruhig. Er schrieb:
»100 + 1. DER ANFANG«.
Teil eins
Der Zug
Kapitel eins
Verdammt, wie kann man so verblödet sein!
Thien hatte vor zwei Minuten die Augen geöffnet. Er sah hinauf zum Dachfenster. Er sah Schnee. Viel Schnee. Wie in jeder Nacht seit Weihnachten hatte es auch in der vergangenen zwanzig Zentimeter geschneit. Der Neuschnee war auf der steilen Glasscheibe ein Stück hinuntergerutscht, weil er unten leicht getaut war wegen der Wärme seines Zimmers, die durch das schlecht isolierte Fenster nach außen strahlte. Auch die Wintersonne mochte ihren Beitrag dazu geleistet haben. Durch die Lücke am oberen Ende des Fensters schien sie Thien direkt ins Gesicht. Davon war er aufgewacht. Es musste etwa elf Uhr vormittags sein. Was für ein Winter. Wie seit seinen Kindertagen nicht mehr. Neuschnee nachts und Sonne tags. Der großartigste Winter seit fünfundzwanzig Jahren.
Der Schnee, die Wintersonne. Thien träumte sich durch die großartigen Motive, die er für den American Mountaineer in den vergangenen zwei Wochen geschossen hatte. Es war sein größter Auftrag seit langem. Sehr gut dotiert. In dem amerikanischen Alpinisten-Magazin schlechthin. Er war der Fotograf, den sie aus Hunderten ausgewählt hatten, um die Berge des Beinahe-Olympia-Orts zu fotografieren. Und das Beste: Er sollte es jedes Jahr tun. Die Idee der Magazin-Macher war es, die Bergwelt eines der bekanntesten Wintersportorte jährlich zu dokumentieren. Bis Garmisch-Partenkirchen vielleicht irgendwann endlich Olympische Spiele ausrichten dürfte. Da bis dahin mindestens zehn Jahre vergehen würden, hätte man ein einmaliges Archiv der Veränderungen eines solchen Orts in Erwartung der Spiele geschaffen. Thien verstand den kulturhistorischen Hintergrund dieses Auftrags. Er würde jedes Jahr die Gipfel, die Bergbahnen, die Landschaft, die Menschen, die Veränderungen, die ein herannahendes Olympia-Spektakel dem Werdenfelser Land und seinen Bergen bringen würde, im Bild festhalten. Mit diesem Auftrag war er in die top ten der internationalen Bergfotografen aufgestiegen. Er konnte berühmt werden. Move over, Ansel Adams!
Außer dem Ruhm spielte auch noch eine weitere wichtige Begleitmusik: Jedes Jahr – fünf Jahre lang! – würde es einen fetten Scheck geben, immer gleich im Januar. Die Amis zahlten gut. Und schnell. Der erste Scheck würde ihn bis in das Frühjahr hinein versorgen. Die Reise nach Kamtschatka im April war damit finanziert. Dort Heliskiing mit den dicken alten MI-8-Maschinen der Russen. Was für ein Leben. Was. Für. Ein. Spaß.
Das neue Jahr 2012, das erst sechs Tage alt war, fing gut an. Nein, es lief besser als gut. Für morgen waren die finale Abgabe der Bilder und die Schlussbesprechung mit Sue, der Art-Direktorin des Magazins, vereinbart. Über Skype würden sie seine Bilder noch einmal durchsprechen. Was sie bisher per Mail auf seine ersten Lieferungen kundgetan hatte, konnte man unter der Rubrik frenetischer Jubel einordnen. Die Art-Direktorin des American Mountaineer war von seiner Arbeit begeistert. Nach ihrem morgigen Gespräch würde Sue den Scheck anweisen.
Natürlich hatte er vom Kramer, der Garmisch-Partenkirchen wie ein riesiger Riegel nach Westen zu den Ammergauer Alpen hin abschloss, herrliche Schwarzweißaufnahmen geschossen, die sich auch für großformatige Abdrucke eigneten. Niemand sonst stieg im Winter auf den karstigen Gipfel, der sich zum Skifahren nicht eignete. Das war sein Ehrgeiz: nicht nur das Naheliegende abliefern, sondern Aufnahmen von Bergen machen, die man nicht ganz selbstverständlich auf der Liste hatte.
Natürlich hatte er sich auf Tourenski zur Partenkirchner Dreitorspitze aufgemacht und das Jagdschloss des Märchenkönigs Ludwig II. am Schachen besucht. Unter den knapp drei Metern Schnee, die dort oben lagen, war das untere Stockwerk des Holzchalets verschwunden. So ein Bild hatte er noch nirgends gesehen. Natürlich hatte er das Karwendel im Osten des Werdenfelser Landes fotografiert. Natürlich hatte er auch die neuen umstrittenen Anlagen abgelichtet, die in den letzten Jahren auf die Gipfel betoniert worden waren, um für ein paar Euros auch Flachlandtirolern den Kick der Höhe und des Ausgesetztseins zu bieten: das nutzlose Riesenfernrohr im Karwendelgebirge und den Metallbalkon des »AlpspiX« auf den Osterfeldern.
Und natürlich hatte er die Alpspitze, eine wahre Schönheit von einem Berg, von allen Seiten im Bild festgehalten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Zur Alpspitze hatte er beinahe ein erotisches Verhältnis entwickelt. Für sie nahm er sich die weich gezeichneten Mädchenmotive von David Hamilton zum Vorbild. Einen Berg, einen Fels von Millionen Tonnen, wie eine fünfzehnjährige halb nackte Balletttänzerin zu fotografieren, das hatte vor ihm noch niemand versucht. Er hatte sie sogar im Hochwinter bei diesem vielen Schnee bestiegen und war mit Ski an ihr abgefahren. Ein lebensgefährliches Unterfangen bei den Verhältnissen der letzten Wochen. Es waren schon genug Skibergsteiger bei wesentlich weniger Schnee die steile Nordflanke von Lawinen hinuntergespült worden. Er hatte es gewagt. Für ein atemberaubendes Bild seiner neuen Geliebten hatte Thien sein Leben riskiert.
Das tat er für spektakuläre Bilder oft. Eigentlich verdiente er seinen spärlichen Lebensunterhalt damit, sich in Todesgefahr zu begeben. Nicht umsonst war er einer der bekanntesten Steilwandfotografen der Welt. Er hatte in den letzten fünfzehn Jahren alle Verrückten, die auf immer kürzeren Ski immer steilere Hänge und Couloirs abgefahren waren, fotografiert. Dafür hatte er oft Positionen suchen müssen, die noch gefährlicher waren als die direkten Falllinien seiner Freunde, die er für die Webseiten und Magazine der kleinen Gemeinde der Extremskifahrer knipste. Oft hatten sie sich darüber unterhalten, dass er, der wahrscheinlich der Verrückteste von allen war, weil er sich mit zehn Kilo Fotoausrüstung auf Steigeisen in die Wand krallte und als Erster in lawinenträchtige Hänge einfuhr, um die irren Fahrten der anderen schießen zu können, dass ausgerechnet er nie auf den Bildern zu sehen war. Ihm genügte der kleine Fotovermerk »© Thien Hung Baumgartner, GaP«. Und ein Leben voller Spaß, Risiko und Abenteuer.
Und nun der Riesenauftrag aus den USA. Nicht mehr mit dem von den Spezialausrüstern zusammengeschnorrten Sponsoring-Geld an die hintersten Winkel der Erde fliegen, vier Wochen im Zelt bei zwanzig Grad unter null auf gutes Wetter warten und dann sein Leben für Bilder riskieren, die gerade einmal ein paar tausend Menschen auf der Welt interessierten. Jetzt hieß es: für ein Millionenpublikum die Berge seiner Heimat porträtieren. Der American Mountaineer würde nicht nur ganz Amerika seine Heimat Garmisch-Partenkirchen zeigen, sondern Thien Hung Baumgartners persönliche Sicht auf die Berge seines Heimatorts. Und man würde seine Bilder in die ganze Welt weiterverkaufen. Für Bücher. Für Webseiten. Wer wusste, welche Anschlussaufträge sich ergeben würden? Industrie. Werbung. Models. Warum sollte er nicht einmal das Genre wechseln? Warum nicht die Swimsuit Issue von Sports Illustrated schießen? Topmodels in der Karibik halb nackt? Für irre Kohle. Alles war möglich. Auch dass Sandra zu ihm zurückkäme.
Er erstarrte. Alles war möglich – oder nichts. Verdammt. So verblödet konnte nur er sein. Thien Hung Baumgartner, Riesentrottel aus Garmisch-Partenkirchen, vergisst den Berg. Diesen Berg! Der Gipfel der Unprofessionalität. Er hatte ihn nicht einmal auf die Liste geschrieben, die er Mitte Dezember an Sue in die Redaktion des American Mountaineer geschickt hatte.
Er hatte die Zugspitze schlicht und ergreifend vergessen.
Den höchsten Berg Deutschlands, den Berg, der wie kein zweiter in den Alpen für die Geschichte des Alpinismus sprach. Der alles erzählen konnte. Von den Anfängen der Kletterei im 19. Jahrhundert. Von der Erschließung der Gipfel als Bergsteigerziel. Von seiner Verkabelung mit drei Seilbahnen und Penetration durch einen Zahnradbahntunnel. Von zehntausend Menschen, die sich an einem Tag auf seinem Gipfel und seinem Platt, der großen Gletscherfläche, tummelten. Von Lawinenunglücken, Wetterstationen und Forschungsinstituten. Von Gipfelkreuzen und Bergkapellen. Von Hüttenromantik und Fast-Food-Fraß. Das alles gab es auf 2962 Metern über Normalnull. Und das alles musste noch in seine Fotoreportage über Garmisch-Partenkirchen hinein. Ohne aktuelle Bilder von der Zugspitze konnte er seine restlichen Bilder in die Tonne treten, mochte die Alpspitze noch so verführerisch fotografiert sein.
Thien tastete nach dem Mobiltelefon, das irgendwo neben dem Bett liegen musste. 10 Uhr 56. Er riss sich die Decke vom Körper und sprang in seine Skisachen. Er musste es bis Mittag auf den Gipfel schaffen. Die Tage waren kurz. Anfang Januar ging die Sonne um halb fünf nachmittags unter. Sein Fotorucksack stand neben dem Bett, die Ski standen draußen in der Garage. Er fuhr den Laptop hoch und checkte im Internet Staubericht und Wartezeiten der Zugspitzbahn. Alles voll. Klar, es war Freitag. 6. Januar. Dreikönigstag. Jeder, der irgendeinen Sinn für Winter und Sport hatte, war nach Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Es war der letzte Ferientag. Und zudem bot sich ein verlängertes Wochenende. Das mussten die Münchner, Nürnberger und Augsburger noch einmal für einen Trip in die Skigebiete nutzen. Auf der Autobahn A95 München–Garmisch ging schon lange nichts mehr. Das bedeutete, dass auch die Wege zu den Bergbahnen voll waren und die Parkplätze dort ebenso.
Also hieß es: mit der Zahnradbahn direkt vom Zugspitzbahnhof im Tal in Garmisch-Partenkirchen. Thien vertraute darauf, dass er schon irgendjemanden vom Personal kennen würde, der ihn an der Warteschlange vorbeilotste.
Er hatte es nicht weit zu Fuß von der Dachgeschosswohnung seiner Eltern zum Zugspitzbahnhof. Das Zimmer in dem alten Haus am Ufer der Partnach war seine Basisstation. Mit zweiunddreißig gehörte es sich ja eigentlich nicht mehr, dass man zu Hause wohnte. Aber er wohnte ja nicht wirklich hier. Er wohnte zehn von zwölf Monaten irgendwo auf der Welt zu Füßen der großen Wände. Hier war er immer nur kurz auf Zwischenstation. Und in diesem Winter sogar an Weihnachten und Silvester, was nicht immer klappte. Seine Mutter war überglücklich darüber. Aber allmählich ging ihm die Nähe auch auf die Nerven. Und er sicher seinen Eltern auch. Er war froh gewesen, den Garmisch-Job abschließen und sich auf Kamtschatka vorbereiten zu können. Thien liebte seine Eltern über alles, ohne sie hätte er nichts, das wusste er. Und bei Licht betrachtet, hatte er außer seinen Eltern auch kaum mehr als sein Talent für spektakuläre Bergfotos, die Fotoausrüstung mitsamt MacBook und seine verrückten steilwandskifahrenden Freunde, die zwischen Patagonien und Zermatt überall dort auf der Welt lebten, wo die Hänge am gefährlichsten waren.
Sieben Minuten nachdem er die Tür seiner Dachkammer hinter sich zugeworfen hatte, erreichte Thien den Zugspitzbahnhof. In einer langen Schlange warteten dort Hunderte von Wintersportlern und Tagesausflüglern geduldig auf den Erwerb eines Tickets für eine Berg- und Talfahrt. Thien drückte sich an den Wartenden vorbei in die Halle. Hinter der Kasse erblickte er einen ehemaligen Schulkameraden. Mit einem Anheben seines Fotorucksacks und einer Augenbewegung in Richtung des nächsten abfahrenden Zuges, der bereits hinter dem Bahnhofsgebäude wartete, bedeutete er seinem Spezl die Dringlichkeit, mit der er zum Gipfel musste. Die beiden Einheimischen verstanden sich ohne weitere Erklärungen. Hans Ostler ließ das japanische Paar, das gerade seine Tickets kaufen wollte, warten und lotste Thien durch den Seiteneingang zum wartenden Zug.
Es war 11 Uhr 16 auf der Standuhr neben den beiden Gleisen. Der Zug hätte laut Fahrplan um 11 Uhr 15 abfahren sollen. Er setzte sich in Bewegung, kaum dass Thien sich im hinteren der zwei Waggons auf den Sitzplatz quetschte, den er drei jugendlichen Snowboardern durch die Ermahnung, sie sollten ihre Rucksäcke gefälligst in den Gepäckablagen und nicht auf den Bänken deponieren, abgetrotzt hatte. Die einheimischen Burschen staunten nicht schlecht, als sie der vermeintliche Vietnamese im breitesten Partenkirchnerisch an die Verhaltensregeln in engen Zügen erinnerte: »Schaugts, dass enka Zuig gscheid varrammts und lassts mi eini.«
So weit hatte alles geklappt. Er saß im Zug. Um 12 Uhr 28 sollte er laut Fahrplan auf dem Zugspitzplatt ankommen. Fünf bis zehn Minuten später würde es wohl werden bei dem Andrang an diesem Tag. An jeder Talhaltestelle, am Hausberg und am Kreuzeck sowie später in Hammersbach und in Grainau, würden sicher weitere Touristen in den bereits vollen Zug einsteigen wollen. Das Gedränge würde dafür sorgen, dass man den Fahrplan nicht würde einhalten können. Aber das spielte keine Rolle mehr. Thien saß und würde diesen Platz erst knapp zweitausend Höhenmeter weiter oben wieder aufgeben.
Er ging in Gedanken schon die Motive durch, die er bei dem strahlenden Wetter fotografieren würde. Er kannte dort oben jeden Felsen und jede Bergdohle mit Vornamen. Thien konnte sein Glück kaum fassen, dass er diesen Zug erwischt hatte.
Eine gute Stunde später würde Thien aufgehen, welches Pech er gehabt hatte, dass dieser Zug ihn erwischt hatte.
Kapitel zwei
Pedro war als älterer der beiden Brüder nach San Miguel in die Jesuiten-Mission geschickt worden. Onkel Pepe, bei dem José und Pedro mit ihrer Mutter Maria aufwuchsen, nachdem sein Bruder Carlos, der Vater der beiden, bei einem Minenunglück ums Leben gekommen war, hatte früh erkannt, dass seine beiden Neffen schlauer waren als die anderen Buben in Uyuni. Pedro machte ihm dabei einen noch gewitzteren Eindruck als José. Wenigstes dem sollte das Schicksal seines Vaters erspart bleiben. Viele der Mineros, die immer noch tagtäglich auf eigene Faust in die weitgehend ausgebeutete Pulacayo-Mine einfuhren, um die Reste des Silbers aus ihr herauszukratzen, das die Spanier übrig gelassen hatten, wurden keine vierzig Jahre alt. Das war normal. Carlos war nur zweiunddreißig geworden. Dann hatte ihn die schlecht abgestützte Decke eines zwei Jahrhunderte alten Stollens unter sich begraben. Und sechs Kumpel mit ihm. Sieben Väter weniger. Das bedeutete sieben Familien ohne Ernährer mehr in Uyuni und den Dörfern ringsumher.
Pedro wurde der Anführer der ein Dutzend Söhne, die das Grubenunglück zu Halbwaisen machte. Er war zwölf, als es passierte. Obwohl die einzelnen Familien um die Mine verstreut wohnten und er über sechzig Kilometer zurücklegen musste, um sie alle zu besuchen, klapperte er sie an den Wochenenden ab, wann immer es die Pisten zuließen. Mit dem Fahrrad. Mit dem Bus, wenn er denn fuhr. Als Anhalter auf einem Salzlaster. Als ortskundiger Beifahrer auf dem Jeep eines Touristen.
Unter der Woche lernte er in San Miguel von den Jesuiten Spanisch, Mathematik, Physik, Klavierspielen und die Lehre von Jesus Christus. In ihren alten Büchern fand er noch viel mehr. Die Geschichte der Aymara, des uralten Volks, dem er und seine Freunde angehörten. Es hatte das Hochland eintausend Jahre vor der Geburt des Heilands der Christen auf der anderen Seite der Welt beherrscht. Und an den Abenden am Feuer erzählte ihm Maria alles, was sie von ihrer Mutter gelernt hatte und die zuvor von ihrer Mutter: über die Pachamama, die in allem steckte, über den guten Iqiqu und den bösen Awqa. Und wie Iqiqu von Awqa zerstückelt und weit über das Hochland verstreut worden war. Und dass die Aymara ihr altes Reich wiederbekämen, wenn der Iqiqu seine Einzelteile wiederfände und sich aus ihnen wieder zum guten Gott vereinigte.
Kapitel drei
John McFarland hatte den Anruf aus Langley gegen acht Uhr erhalten. »Operation Peak Performance angelaufen. Beobachtungsposten einnehmen.«
John McFarland wusste, was zu tun war. Er hatte sich seit sechs Uhr früh im Gym des »Edelweiss Lodge and Resort« die Zeit vertrieben. Er ging in sein Zimmer, duschte und zog die Bergsachen an. Dann schnappte er seinen Hartschalenkoffer mit dem restlichen Equipment und setzte sich in den geliehenen Ford. Er steuerte das Auto aus dem Edelweiss-Komplex und bog an der nächsten Ampel nach links ab. Auf der Bundesstraße fuhr er gemächlich ein paar Kilometer nach Süden am Fluss entlang. An der Abfahrt in Richtung Eibsee/Zugspitze fuhr er vorbei. Am nächsten Parkplatz hielt er an. Diese Stelle war wie geschaffen dafür, die Nummernschilder zu tauschen. Der Parkplatz lag nicht direkt an der Straße, sondern war durch eine Fichtenschonung vor Blicken Vorbeifahrender geschützt. Er holte die Dubletten aus dem Koffer. Die Originale der kopierten Nummernschilder hingen an einem silberfarbenen Ford im Westen der Republik. Er tauschte sie mit wenigen Handgriffen und steckte die abmontierten Nummernschilder in seinen großen Rucksack.
Anschließend fuhr er den Ford zurück auf die Bundesstraße und passierte keine fünf Minuten später die aufgelassene Grenzstation in Griesen. Damit befand er sich auf österreichischem Hoheitsgebiet. Sollte der Wagen von einer Kamera an der Staatsgrenze, an der seit Jahren keine Grenzkontrollen mehr stattfanden, aufgenommen und anschließend automatisch gescannt worden sein, würde für einen österreichischen Polizeicomputer der Ford eines Rentners aus Gummersbach über die Grenze gefahren sein. Etwas Normaleres konnte es an einem 6. Januar nicht geben. Er parkte das Auto am Ortseingang Ehrwald, wo sich die aus Garmisch kommende Straße gabelte. Der Gewerbebau dort stellte seine Freifläche an Feiertagen als Parkplatz zur Verfügung. Von dort aus würde er in vier Richtungen den Rückzug antreten können: zurück nach Garmisch oder über den Fernpass in Richtung Italien, die Schweiz und an den Bodensee. Er würde, wenn alles glattginge, das Mietauto unversehrt am Montag oder Dienstag wieder abgeben. Und sollte nicht alles glattgehen, würde der Wagen frühestens am Mittwoch in Deutschland als gestohlen gemeldet werden. In Österreich würde man erst nach Tagen, vielleicht Wochen bemerken, dass der Ford mit dem Gummersbacher Kennzeichen jener war, der in Deutschland von Avis vermisst wurde. Die Nachhut würde das Auto rückstandsfrei verschwinden lassen. Das wäre dann allerdings sein kleinstes Problem.
Er packte seinen Ausrüstungskoffer in den geräumigen Rucksack zu den Nummernschildern und ging zu Fuß die wenigen hundert Meter zur Talstation der Tiroler Zugspitzbahn. Auf dieser Seite des Berges warteten weit weniger Skifahrer auf die Auffahrt als auf der deutschen. Die Kapazität der modernen Bahn mit einhundert Plätzen und einer Fahrzeit von achteinhalb Minuten brachte die Masse der Bergfahrer zügig nach oben.
Gerade einmal fünfundzwanzig Minuten nachdem er sein Fahrticket gelöst hatte, stand er auf der österreichischen Seite des Gipfels. Er schritt durch die österreichische Gipfelstation und ging ins Freie. Der Skibetrieb auf dem Platt unter ihm lief wie immer. Er wusste, dass sich das sehr bald ändern würde. Er ging hinüber auf die deutsche Seite des Gipfels. Rechts neben dem Kiosk und dem Münchner Haus, der in der Hightech-Umgebung fremd wirkenden Alpenvereinshütte, stand das gelbe Grenzschild mit dem schwarzen Adler. In einer Plastikschachtel mit den Abmessungen zwei mal zwei mal zwei Meter hatte dort früher ein Grenzer gesessen, der auch bei den Skifahrern und Touristen Passkontrollen hatte durchführen müssen. Seit dem Schengener Abkommen gab es den Job nicht mehr. Die unverrottbare Plastikhütte hatte man stehen lassen, man wusste ja nicht, wie lange eine solche innereuropäische Vereinbarung hielt.
An der Seite der betonierten Gipfelplattform führte die Stahltreppe hinunter auf den Gipfelgrat. Im Winter war der Weg natürlich gesperrt, aber nur eine rot-weiße Plastikkette hielt die Besucher davon ab, die Treppe zu benutzen. John McFarland schwang ein Bein nach dem anderen darüber und ging unbehelligt die Stahltreppe nach unten. Nach wenigen Stufen musste er sich durch tiefen Schnee kämpfen. Auf der letzten angekommen, schnallte er die Steigeisen an die Stiefel. Er war von oben kaum noch zu sehen. Und die, die dort standen und gingen, hatten auch etwas anderes zu tun, als einem Bergsteiger dabei zuzusehen, wie er am Gipfelgrat herumkraxelte. Die einen wollten möglichst schnell gewalzten Schnee unter die Ski bekommen, die anderen ihre Blicke über die Hunderte von Alpengipfel schweifen lassen, die sich bei der hervorragenden Fernsicht, die an diesem Tag herrschte, zeigten. Über die verschneiten Felsen, die den Bergsteigern im Sommer einen stahlseilgesicherten Weg boten, stieg McFarland weiter nach rechts ab.
Am Grat war der Schnee vom Wind verblasen. Es lag hier so wenig, dass er sich nicht allzu sehr quälen musste. Schließlich stieg er durch die Scharte, die ihn auf die Rückseite des Bergs führte. Danach musste er rund fünfzig Meter die steile Flanke hinabsteigen. Das war der brenzligste Teil des Unterfangens, denn der windverpresste Schnee konnte sich jederzeit lösen und ihn eintausend Meter tief die senkrechte Wand hinunterreißen.
Er erreichte die Ruine des ehemaligen Kammhotels, das vor über fünfzig Jahren nach einem Großbrand aufgegeben worden war, verschaffte sich Zugang durch eines der vernagelten Fenster und schlüpfte in den kastenförmigen Bau, der wie ein Schwalbennest am Fels zu kleben schien. John McFarland hatte in den letzten Wochen bereits den Großteil seiner Ausrüstung hergeschafft. Und er trug auch die Schlüssel bei sich, um von hier aus in den alten Tunnel hinüber ins Schneefernerhaus gelangen zu können. Von dort wiederum könnte er in das Tunnelsystem der Zahnradbahn gelangen.
Seit dem missglückten Anschlag auf die Londoner U-Bahn war es für CIA und MI6 zur Regel geworden, bei Terroranschlägen, die von ihnen in die Wege geleitet wurden, mindestens einen ihrer kampferprobten Männer in der Nähe des Geschehens zu haben. Weniger, um im Fall der Fälle eingreifen zu können; die Gefahr einer Verwicklung war zu groß. Sinn und Zweck war die Übertragung und Aufzeichnung von Videomaterial, damit man in Echtzeit sah, was geschah, und die Aktionen später ausgewertet werden konnten. Natürlich nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur innerhalb der an das US-Heimatschutzministerium und an das britische Verteidigungsministerium angeschlossenen Dienste. Gegebenenfalls bekamen der US-Präsident und der britische Premier ein Best-of einer Aktion zu sehen. Ziviles Livepublikum wie bei der Bin-Laden-Erschießung 2011 ließen die Entscheider nicht mehr zu. Dafür hatte es damals zu viel Geschwätz aus dem Kreis der im Situation Room anwesenden Politiker gegeben.
John McFarland wusste nicht, ob weitere Männer seines oder eines befreundeten Dienstes außer ihm im Einsatzgebiet unterwegs waren. Bis die Skifahrer aus dem verschütteten Zug befreit wären, musste McFarland die Sache allein unter Kontrolle halten. Bisher lief alles nach Plan. Um 11 Uhr 30 Ortszeit fuhr er die Systeme seiner Überwachungszentrale im verfallenen Kammhotel hoch. Auf vier Bildschirmen hatte er einen Überblick über die Schlüsselstellen des Einsatzes. Eine Hochleistungskamera übertrug aus dem Gipfelkreuz der Zugspitze ein Panoramabild, das von der Gipfelstation über das gesamte Zugspitzplatt reichte. Schwenkte er sie in nördlicher Richtung, sah er Garmisch-Partenkirchen und die Dunstglocke Münchens in einhundert Kilometern Entfernung. Eine weitere Kamera war unten auf der ersten Stütze der Bayerischen Seilbahn angebracht. Sie funkte über den Satelliten Bilder, die den Bahnhof Eibsee zeigten, die Seilbahnstation und den Parkplatz samt Hotel und See. Eine dritte Kamera auf der untersten Stütze der Tiroler Zugspitzbahn diente der Überwachung der österreichischen Talstation und des Geländes um sie herum. Die vierte und fünfte – und auf ihre Installation war John McFarland besonders stolz – befanden sich direkt in dem bald entführten Zug.
Alle Kameras waren von seinem Arbeitsplatz aus schwenk- und zoombar. Er konnte sogar einzelne Gesichter von Skifahrern auf dem Platt oder von Menschen auf dem Parkplatz am Eibsee auf dem Bildschirm betrachten. Das galt natürlich ganz besonders für die Passagiere in dem Zug. Zudem konnte er deren Gesichter innerhalb von Sekunden über einen weiteren Satelliten an das Personenregister der NSA senden und bekam in den meisten Fällen umgehend Auskunft, welcher Name dazugehörte, welcher Nationalität und Ethnie die entsprechende Person war und ob es »nachrichtendienstlich interessante Top-Level-Informationen« über sie gab, also ob diese Person einem Geheimdienst angehörte, einer militärischen Einheit oder einer Nicht-Regierungsorganisation oder ob sie in ihrem Leben etwas Schlimmeres ausgefressen hatte, als bei Rot über die Ampel zu fahren.
Seit Anfang Dezember hatte McFarland diese Zentrale im Kammhotel Stück für Stück eingerichtet und die Kameras installiert. Er war sich sicher, dass ihn dabei niemand beobachtet hatte. An insgesamt zwanzig Tagen hatte er sich, als Tourist verkleidet, mit einer der drei Bahnen auf den Gipfel bringen lassen, war ein bisschen Ski gefahren oder hatte sich in einen Liegestuhl gelegt, je nach Art seiner Tarnung. Jeden Abend hatte er sich im kleinen Museum auf der österreichischen Seite der Gipfelstation hinter einer der wandfüllenden Schautafeln versteckt und einsperren lassen, und als die Station leer war, hatte er seinen Weg in die alten Fußgängertunnel erforscht, die den Gipfel durchzogen, hatte seine Route zum Kammhotel festgelegt und alle Strecken Schritt für Schritt vermessen, sodass er sie auch im Dunkeln würde gehen können. Er war hinüber zum vergoldeten Gipfelkreuz geklettert, um die Kamera und das winzige Sonnenpaneel, das deren Stromversorgung diente, auf einem der metallenen Strahlenkränze zu installieren. In den Nächten, in denen er nicht auf dem Gipfel war, hatte er die Kameras auf den Stützen der beiden Seilbahnen angebracht. Beide konnten mit einem Einhundertachtzig-Grad-Schwenk auch den Gipfel von den beiden Tälern aus zeigen. Somit konnte er das ganze riesige Massiv überwachen, live und in Farbe.
Die Kameras in der Zahnradbahn waren die eigentliche Herausforderung gewesen. Denn er konnte nicht wissen, welcher der Züge für die entsprechende Fahrt zum Einsatz kam. Also brach er in das Depot der Zugspitzbahn in Grainau ein und installierte in allen Bahnen seine elektronischen Augen. Bei den modernsten Wagen kam ihm entgegen, dass diese mit Sicherheitskameras an den Waggondecken ausgestattet waren. Diese musste er nur gegen seine Spezialkameras austauschen und mit einem Transponder versehen. An Weihnachten waren seine Vorbereitungen erledigt, und er konnte sich daranmachen, sich für den Einsatztag ein unauffälliges Fluchtauto zu beschaffen. Er mietete einen simplen Ford bei Avis.
An diesem Tag würde die Aktion genauso glatt verlaufen. Wenn die Ermittler der Deutschen in drei oder vier Tagen das Feld geräumt hatten, musste er nur noch seine Gerätschaften spurlos entsorgen. Das würde eine Woche dauern – danach hätte er sich den Tauchurlaub auf den Philippinen redlich verdient.
Die Jungs an der Front, in diesem Fall im Tunnel, hatten hoffentlich gut gearbeitet. Die Ausbilder im Jemen verstanden ihren Job, aber es blieb immer ein gewisses Restrisiko bei einem Trupp junger und williger Guerilleros, die eine Aktion im Ausland durchführen sollten. Besonders bei diesem Einsatz mit dem Codenamen »Peak Performance« betraten die Leute in Langley Neuland. Nachdem arabische Terrorkommandos mittlerweile auch von den europäischen Diensten, allen voran den deutschen BKA und BND, praktisch lückenlos überwacht wurden und es über jeden Menschen eine Akte gab, der in den letzten zehn Jahren in ein Land östlich der Türkei und südlich von Spanien ein- oder daraus ausgereist war, mussten neue Hilfstruppen angeheuert werden. John McFarland wusste nicht, wer darauf gekommen war, die Bolivianer zu benutzen, aber es musste ein gewiefter Stratege seines Dienstes gewesen sein. Das hier war ganz oben entwickelt worden. Sehr viele Fliegen wurden bei dieser Aktion mit einer Klappe erschlagen. Fast zu viele für seinen Geschmack. Doch das zu übersehen war nicht seine Aufgabe. Die beschränkte sich darauf, die Aktion zu dokumentieren. Deshalb hatte er überall die Kameras im und um den Berg angebracht.
John McFarland zählte die Minuten. Auf dem Bildschirm, der den Zugspitzbahnhof Eibsee zeigte, fuhr gerade der Zug ab. Sein Zug. Er ging die Strecke im Kopf durch. Gut zwanzig Minuten später würden die Sprengsätze gezündet. Bald darauf würde die Welt auf die Zugspitze schauen.
Er sah auf dem Bildschirm der Zugkamera die arglosen Fahrgäste. Er checkte die Kamera auf dem Gipfel und die auf der Ehrwalder Seite des Berges und sah die alte verfallene Hotelruine, in der er selbst saß. Alle Kameras funktionierten tadellos. Dann konzentrierte er sich wieder auf das Geschehen im Zug und scannte zum Zeitvertreib die Gesichter der gelangweilt dasitzenden Skifahrer. Ein Mann kam ihm bekannt vor. Er zoomte sich an das Gesicht heran. Ja, er kannte diesen Mann. Und die Frau, die ihn begleitete, auch. Er hatte nur keine Namen dazu. Hatte er diese Gesichter schon einmal im Dienst gesehen? Es war ihm, als seien sie wie er Angehörige der Firma. Er kratzte sich irritiert am Kopf. Was machten die in seinem Zug? Ein unglaublicher Zufall? Er klickte auf »Scan Face« und schickte die Konterfeis an den Zentralrechner.
Der Rechner meldete dreißig Sekunden später »Access denied«. Wenn der Zentralrechner nichts herausgab, bedeutete das meist, dass die betreffende Person einen herausragenden Status innerhalb der weitverzweigten amerikanischen Geheimdiensthierarchie hatte.
John McFarland ahnte, dass das Ärger geben würde.
Kapitel vier
Im Waggon stank es, und die Scheiben waren angelaufen. Um dem Ansturm der Wintersportler und Ausflügler auf Deutschlands Gipfel Herr zu werden, war die Zahnradbahn an diesem Tag mit allen verfügbaren Zügen unterwegs. Thien Baumgartner hatte einen der älteren Wagen erwischt. Er saß an der hinteren Rückwand des zweiten Triebwagens. Neben ihn war der dickleibige Snowboarder gequetscht, der schon zwei Tafeln Schokolade am Bahnhof in Hammersbach vertilgt hatte. Thien verfluchte sich, dass er in der Eile seinen iPod zu Hause gelassen hatte. Zwar hatte er die gleichen Titel auch auf seinem iPhone, nur hingen die Kopfhörer leider am anderen Gerät, das irgendwo zu Hause unter einem Stapel Wäsche lag. Er hätte die Musik als Schutz gegen das pubertäre Gelaber der ihn umgebenden pickeligen und rülpsenden Snowboarder-Gang dringend gebraucht. Durch Meditation versuchte er dem muffigen engen Wagen wenigstens geistig so lange zu entkommen, bis er mitsamt den rund zweihundert Mitreisenden eine Stunde später das Zugspitzplatt erreichen würde.
Der Zug hatte mittlerweile die Talhaltestelle Grainau-Badersee passiert und fuhr die Strecke zum Eibsee hinauf. Der dicke Snowboarder machte sich über eine Packung Kekse her. Thien fühlte ihn seitlich förmlich wachsen. Oben am See war der letzte Halt, an dem noch weitere Gäste zusteigen würden. Allmählich kam sich Thien vor wie in der Tokioter U-Bahn. Es hatte aber auch keinen Sinn, den Platz im engen und stickigen Zug aufzugeben und vom Bahnhof Eibsee aus mit der dort startenden Eibsee-Seilbahn weiterzufahren. Zwar würde die ihn in nicht einmal zehn Minuten reiner Fahrzeit auf den Zugspitzgipfel bringen, während der Zug von Eibsee aufs Platt durch den vier Kilometer langen steilen Tunnel immer noch eine Dreiviertelstunde brauchte, um die sechzehnhundert Höhenmeter zu überwinden. Aber um die Seilbahn zu nutzen, hätte er sich erneut anstellen müssen – und wer wusste, ob er hier das gleiche Glück haben würde wie zuvor in Garmisch mit der Zahnradbahn. Hier oben arbeiteten eher Grainauer, die er als Partenkirchner nicht so gut kannte. So vertiefte er sich in seine Meditation und gab seinem Körper die Möglichkeit, noch eine halbe Stunde länger den Restalkoholspiegel abzubauen. Die vorangegangene Nacht in der Boarder-Kneipe am Hausberg war lang gewesen. Oben musste er wieder fit sein.
Am Eibsee begann die eigentliche Bergfahrt des Zuges. Ab dort musste sich der Zug mit seinem Zahnrad in die in der Mitte zwischen den Gleisen montierte Zahnstange verhaken und sich daran nach oben ziehen, sonst konnte er die Steigung nicht bewältigen. Das galt für die modernen Wagen schweizerischer Herkunft ebenso wie für die AEG-Triebwagen, die in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als technische Wunder den höchsten Berg Deutschlands bezwangen und die heute in Museen auf dem Altenteil stehen.
Es ging zunächst steil die Westflanke des Bergs hinauf, die ersten fünfzehn Minuten noch im Freien bis zur Haltestelle Riffelriss. Dann verschwand der Zug für eine halbe Stunde im viereinhalb Kilometer langen Tunnel. In den späten 1920ern war der Stollen von Tausenden von Arbeitern in den Muschelkalk des Wettersteinblocks getrieben worden. Bis zu vierzig Prozent Steigung gab es im Tunnel. An das Geratter des Zahnrads in der Zahnstange hatten sich die Insassen bald gewöhnt. Einige nickten wegen des monotonen Geräuschs und der schlechten Luft im Innern der Waggons sogar ein. Vor den beschlagenen Fenstern war nur die Schwärze der Röhre zu sehen. Alle paar Sekunden wischte draußen ein Notlicht vorbei. So ging es Meter um Meter vorwärts und bergauf.
Thien kannte die Strecke im Tunnel so gut wie den Weg durch das elterliche Haus, in dem er sich auch nachts um drei nach einer Sauftour bei vollkommener Dunkelheit bewegen konnte, ohne einen Laut zu erzeugen. Er spürte das Aussetzen des Zahngestänges, als die Bahn auf den flacheren Streckenabschnitt fuhr, der von den Schildern draußen an der Tunnelwand als »Ausweiche 4« ausgewiesen wurde. Dort hatten die Tunnelbauer Platz für Gegenverkehr geschaffen, denn der Tunnel war 1928 eingleisig gebaut worden. Ausweiche 4 war die einzige Stelle in der Felsröhre, an der zwei Züge aneinander vorbeifahren konnten. Die anderen Ausweichen befanden sich weiter unten im Freien.
Der nach oben fahrende Zug hatte Vorfahrt und fuhr an dieser nicht allzu steilen Stelle an dem auf dem anderen Gleis wartenden Zug vorbei. Thien wusste, dass er nur noch eine knappe Viertelstunde in diesem die letzte Nacht und das Frühstück ausdünstenden Menschenhaufen verbringen musste. Er musterte die Mitfahrer. Oben würde er sehr schnell seine Ausrüstung packen und losrennen müssen, um vor der Menge ins Freie zu gelangen. Sie würden wie eine Herde Schafe über den Bahnsteig des Bahnhofs Zugspitzplatt schlurfen und ihn weitere wertvolle Minuten kosten. Thien fasste an seinen Beinen hinab zu seinen Skistiefeln und schnallte sie schon einmal ein wenig fester, damit sich seine Füße an die Enge gewöhnen könnten. Nach ein paar Metern auf Ski würde er diesen Vorgang wiederholen, so lange, bis seine Füße wie in zwei Schraubstöcke gezwängt waren.
Thien bückte sich im Sitzen nach vorn, um auch die vordersten Schnallen seiner Stiefel zu erreichen. In diesem Moment hielt der Zug abrupt an. Ein kurzes lautes Quietschen begleitete die Vollbremsung.
Thiens Kopf bohrte sich in den Schoß des Snowboarders auf der Bank gegenüber. Sofort stieß er sich wieder ab und murmelte: »Sorry.« Er blickte sich im Zug um und sah, dass fast überall die mit dem Rücken zum Tal Sitzenden auf ihre Mitreisenden auf die gegenüberliegenden Bänke geworfen worden waren. Es beruhigte ihn, dass er nicht der Einzige im Zug war, der in eine solche Situation geraten war. Einige Frauen hatten unmittelbar bei der Bremsung losgekreischt und zwei oder drei damit noch nicht aufgehört. Ihre Sitznachbarn redeten auf sie ein. Einem Mann im vorderen Teil des Waggons hatte die Stahlkante eines umfallenden Snowboards einen tiefen Längsschnitt mitten auf der Stirn verpasst, aus dem ihm wie einem Boxer das Blut übers Gesicht lief. Andere fluchten; sie hatten ihre Getränke über die eigenen Klamotten oder die der ihnen Gegenübersitzenden gekippt.
Der plötzliche Halt an der Ausweiche 4 war nicht im Fahrplan vorgesehen, das war Thien sofort klar. Der bergab fahrende Zug wartete ja ordnungsgemäß auf dem Nebengleis. Wieso also diese Vollbremsung? Hatte der Zugführer einen falschen Knopf gedrückt? Lag etwas auf den Schienen? Oder hatte jemand die Notbremse gezogen? Nach und nach wurde es wieder ruhiger im Wagen. Der blutende Skifahrer lehnte jedes Hilfsangebot ab, dennoch kramten ein paar wild Entschlossene Verbandszeug aus ihren Rucksäcken hervor. Über den Lautsprecher meldete sich der Zugführer: »Sehr geehrte Fahrgäste, Ladies and Gentleman, es tut uns sehr leid, dass wir anhalten mussten, aber es wurde offenbar eine Notbremsung ausgelöst, we are very sorry ssatt we had to stop, batt someone …«
Die Durchsage wurde von einem trommelfellzerreißenden Knall hinter dem Zug unterbrochen.
Die Geistesgegenwärtigen unter den Fahrgästen warfen sich auf den Boden der Waggons oder zogen zumindest die Köpfe ein. Andere blieben wie versteinert und mit weit aufgerissenen Augen sitzen. Dem Knall folgte ein Prasseln und Poltern, als würde ein Baustellenlaster eine Ladung Findlinge in den Tunnel kippen. Das Kreischen der Frauen füllte die Schallleere nach dem Knall und dem Prasseln. Als das Kreischen zu einem Wimmern erstarb, zerriss ein zweiter Knall – wieder gefolgt von Felsprasseln – den Tunnel. Diesmal kam der Lärm von vorn. Wieder kreischten Frauen. Und diesmal auch fast alle Männer. In den Augen der meisten Fahrgäste stand Panik.
Dann wurde es dunkel. Rauch und Felsstaub bedeckten die Fenster, die Waggonbeleuchtung fiel aus. Im Zug hörte Thien nur noch vereinzeltes Wimmern.
Kapitel fünf
Franz Hellweger stand an der Schalttafel in seinem Führungsstand am Bahnhof Eibsee und blickte den Berg hinauf. Das elektronische Notfallsystem hatte gemeldet, dass der aufwärtsfahrende Zug plötzlich mitten im Tunnel stehen geblieben war, auf Höhe der Ausweiche 4. Das war auf dem Fahrstandsanzeiger in der Mitte der großen grauen Schalttafel abzulesen. Eine rote Alarmleuchte meldete eine Notbremsung. Der abwärtsfahrende Zug stand ebenfalls, er hatte in Ausweiche 4 gewartet, um den von unten kommenden Zug durchzulassen.
Franz Hellweger griff zum Funkgerät. Über ein Schlitzkabel im Tunnel war der Betriebsfunk zwischen dem Zug und den Bahnhöfen auf der gesamten Strecke sichergestellt. Doch keiner der beiden Zugführer meldete sich zurück. Es gab auch noch das alte AEG-Telefon, dessen Signale über die Oberleitungen übertragen wurde. Achtzig Jahre lang hatte das funktioniert. Das Telefon war tot. Franz Hellweger nahm sein Handy vom Schaltpult und rief die Bergstation auf dem Platt an. Der diensthabende Betriebsleiter im Bahnhof Zugspitzplatt sah auf seinen Instrumenten die gleichen Informationen wie Hellweger unten am Eibsee. Auch er stand der Situation ratlos gegenüber.
Die beiden Männer beschlossen, von oben und von unten je einen Trupp in den Tunnel zu schicken. Für Franz Hellweger bedeutete dies, dass er die nächste aus dem Tal herauffahrende Bahn räumen lassen musste, um sie mit seinen Leuten zu besetzen. Das würde ein Spaß werden. Er wartete, bis der Zug den Bahnhof Eibsee erreicht hatte, und dann forderte er die Fahrgäste über die Lautsprecheranlage dazu auf, die Wagen zu verlassen. Als Begründung gab er an, eine Betriebsstörung liege vor. Anschließend ließ er den vorderen der beiden Triebwagen abkoppeln und schickte fünf seiner Mitarbeiter damit nach oben. Sein Kollege im Bahnhof Zugspitzplatt schickte drei Männer zu Fuß zum Tunnel, da ja kein weiterer Zug oben zur Verfügung stand.
Franz Hellweger wartete zehn Minuten, ohne eine Nachricht zu erhalten. Er blickte hinüber zum Bahnsteig, wo sich immer mehr Fahrgäste drängten. Zu den gut zweihundert Passagieren, die er hatte aussteigen lassen, kamen die, die mit dem Auto oder Bus zum Eibsee gefahren waren und von hier aus auf die Zugspitze wollten. Weitere zehn Minuten vergingen. Endlich meldete sich sein Trupp. »Leitstelle von Triebwagen fünf – kommen.«
»Hier Leitstelle – kommen.«
»Hier Triebwagen fünf – Meldung: Franz, da ist kein Durchkommen.«
»Was soll das heißen?«
»Felssturz. Tunnel vollkommen verschüttet. Riesige Brocken vom Boden bis zur Decke. Keine Ahnung, wie tief und ob das hält, wenn wir hier ein paar der Felsen entfernen.«
»Wo genau beginnt der Felssturz?«
»Ungefähr zwanzig Meter vor Ausweiche vier. Der Tunnel ist dort noch eng und eingleisig. Wir wissen natürlich nicht, wie weit der Sturz reicht.«
»Und wo steht euer Wagen?«, fragte Hellweger. Er wollte wissen, wie weit die Oberleitung, deren Stromkreis nach Streckenabschnitten unterteilt war, funktionierte. Bei einem Felssturz musste die Stromversorgung schon irgendwo weiter oben unterbrochen sein.
»Wir sind mit dem Zug bis auf dreihundert Meter an den Felssturz heran, danach gibt’s keinen Strom mehr.«
»Sicht- oder Hörkontakt mit dem Zug? Klopfzeichen?« »Nichts. Wir sehen die Hand vor den Augen nicht. Der Staub hängt in der Luft.«
»Befehl von Leitstelle: Lasst alles liegen, fangt nicht an zu graben! Wiederhole: Graben negativ! Wartets oben und schauts, obs was hörts.«
»Hier Triebwagen fünf – verstanden und over.«
»Leitstelle – over.« Franz Hellweger schob seine ölverschmierte Basecap in den Nacken und rieb sich über die Stirn. »Um Himmels willen. Felssturz. Tunnel eingebrochen. Das ist eigentlich vollkommen ausgeschlossen«, murmelte er vor sich hin. »Ich hoffe nur, dass da nicht die Bahn verschüttet ist. Ob wir da einen rausbekommen? Ich meine lebend?«
Franz Hellweger erwartete keine Antwort von seinem Mitarbeiter Matthias Meier, der schweigend neben ihm stand und zum Gipfel hinaufblickte. Er wagte sich in Gedanken nur langsam an ein Bild des Zugs, der von Gesteinsmassen verschüttet sein musste. Die Züge waren so konstruiert, dass sie bei optimaler Gewichtsersparnis möglichst stabil waren. Die Aluminiumkarossen waren robust genug für den täglichen harten Einsatz. Sie konnten Tausende von Ausflüglern über zweitausend Höhenmeter nach oben und wieder nach unten bringen, Tag für Tag. Jahr für Jahr. Aber dem Druck von Tausenden Tonnen Gestein würden sie nicht standhalten. Sie würden zusammengequetscht wie leere Zigarettenschachteln, die man in der Faust zerdrückte. Die Menschen darin wären nicht zu retten. Zum überwiegenden Teil zumindest. Wunder gab es immer wieder bei solchen Unglücken. Selbst beim Brand der Standseilbahn am Kitzsteinhorn vor einigen Jahren hatten einige wenige Menschen überlebt. Und auch bei Erdbeben fand man nach Tagen noch Lebende unter den Trümmern. Aber an die musste man erst einmal herankommen.
In dem Moment meldete sich der Betriebsleiter vom Bahnhof Zugspitzplatt per Handy. Sein Trupp, der von oben zu Fuß in den Tunnel eingedrungen war, gab einen praktisch gleichlautenden Bericht ab wie die Kollegen, die die Unglücksstelle von unten her begutachteten: kein Durchkommen zum Zug, Felssturz kurz hinter Ausweiche 4. Nichts zu sehen und nichts zu hören. Alles meterhoch voll Felsbrocken und ansonsten: Staub.
Hellwegers böse Vorahnung bewahrheitete sich. Der Tunnel musste über die komplette Länge der Ausweiche 4, knapp über zweihundert Meter lang, eingestürzt sein. Der vollbesetzte aufwärts- und der um diese Zeit fast leere abwärtsfahrende Zug waren verschüttet. Über zweihundert Menschen mussten das sein. Franz Hellweger musste eine Rettungsaktion einleiten, die so nicht in den Notfallplänen stand. Jegliches verfügbare technische Gerät und jede Menge Helfer mussten dorthin, sei es von unten aus per Schiene mit den verfügbaren Zügen oder von oben vom Platt, wohin die Gerätschaften und Helfer erst einmal per Hubschrauber oder mit der Seilbahn hingeschafft werden mussten.
Franz Hellweger wählte die Notrufnummer 112. Der Disponent der ILS Oberland, der »Integrierten Leitstelle Oberland«, im siebzig Kilometer entfernten Weilheim, stellte seine Standardfragen: was, wo, wann, wie viele Verletzte?
»Ich habe keine Ahnung, was da los ist! Die Züge scheinen verschüttet. Da sind über zweihundert Personen drin. Macht euch auf einen schwierigen Einsatz gefasst.«
Viel mehr Informationen konnte Hellweger dem Mann nicht geben. Der gab sie in seinen PC ein. Die im System hinterlegten Alarmierungspläne setzten automatisch die Feuerwehren der gesamten Umgebung, das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk in Bewegung. Keine dreißig Minuten später standen die ersten Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge und rund zwanzig Retter der Bergwacht auf dem völlig überfüllten Zugspitzparkplatz am Eibsee. Weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren, der Sanitätsdienste und des THW steckten auf der verstopften Eibseestraße fest. Die Polizei sperrte den Parkplatz der Zugspitzbahn ab und versuchte den nach oben strömenden Verkehr am Wendehammer am Ende der Straße wieder nach unten zu leiten.
Kapitel sechs
Lass dir doch ein bisschen Zeit, um die Aussicht zu genießen, Sandra!« Markus Denninger wollte nicht zugeben, dass seine neue Freundin im Begriff stand, ihn beim Aufstieg abzuhängen.
Und Sandra Thaler dachte überhaupt nicht daran, langsamer zu werden. Sie war in einer grandiosen körperlichen Verfassung. Den ganzen Sommer lang hatte sie – sofern sie nicht auf einer Expedition war – fast täglich einen Berglauf im Karwendel absolviert und an den Wochenenden mit Markus, wann immer er dienstfrei hatte, eine lange und anstrengende Mountainbiketour unternommen. Sie hatte im Herbst nicht wie sonst zwei Wochen erkältet zu Hause gelegen und konnte daher die ersten Schneefälle Anfang Dezember nutzen, um an ihrer Kondition – nun endlich auch auf Ski – weiterzuarbeiten. Jetzt, Anfang Januar, stand die Wettkampfsaison der Skibergsteiger unmittelbar bevor. Das erste Saisonrennen war der Dammkarwurm Mitte Januar, ihr Heimrennen in Mittenwald, dann folgten an jedem Wochenende bis in den April hinein die nationalen und internationalen Wettbewerbe und Meisterschaften. In diesem Jahr wollte sie in die Weltspitze dieser noch jungen Sportart laufen, um im nächsten Jahr bei den Weltmeisterschaften vorne mit dabei zu sein.
Für die Schönheit der Gegend hatte Sandra an diesem Feiertag keine Zeit. Obwohl sie einen Teil ihres Lebensunterhaltes damit bestritt, Fotos von steilen Bergen zu schießen. Aber das Karwendelgebirge betrachtete sie als totgeknipst. Sie würde sich nach der Skisaison wieder einer Himalaja-Expedition als Fotografin anschließen. Ihr Sponsor aus der Bekleidungsindustrie hatte ihr geholfen, aus dem Hobby einen Beruf zu machen. Er unterstützte auch professionelle Expeditionen und wollte von ihnen gute Fotos für seine Marketingaktionen. Sandra wurde fast jeden Sommer für einige Wochen auf eine Tour nach Asien oder Südamerika geschickt. Dass sie beides konnte – im Winter mit den Klamotten des Sponsors den Berg hinaufhetzen und im Sommer eindrucksvolle Fotos mit Menschen in diesen Klamotten aus eisigen Höhen nach Hause bringen –, war ein Glücksfall für beide Seiten.
An diesem Tag ging es nicht um Fotos. Es galt, ihre persönliche Bestzeit durch das Dammkar zu verbessern. Wenn ihr Markus, immerhin als Heeresbergführer des in Mittenwald stationierten Hochzugs der Gebirgsjäger, nicht folgen konnte oder wollte, würde sie im Karwendelhaus auf ihn warten. Das Dammkar war genauso Markus’ Hausstrecke wie ihre. Vielleicht musste er erst noch richtig wach werden. Der Tag hatte jedenfalls ganz anders angefangen, als sie geplant hatten. Sie hatten um sieben Uhr aufbrechen wollen, um unter den Ersten zu sein, die die Felle unter die Ski klebten und durch den frischen Schnee ihre Spur nach oben zogen. Doch wieder einmal hatten sie vergessen, den Wecker zu stellen. Als sie um zehn aufwachten, war ihnen klar, dass sich im Dammkar bereits Horden von Skitourengehern tummeln würden. Und bis sie in gut zwei Stunden oben im Karwendelhaus wären, hätte die Seilbahn jede Menge Freerider dorthin befördert, die die jungfräulichen Hänge zusammenfahren würden. Also hatten sie sich Zeit für ein ausgiebiges Spaß-Frühstück im Bett genommen. Um elf Uhr waren sie dann aufgestanden. Eine Stunde später hatten sie am Ausgangspunkt der Tour neben der Bundesstraße endlich die Felle auf die Ski gespannt und waren in die Bindung gestiegen, um den sieben Kilometer langen Aufstieg anzugehen.
Die Strecke hatte den Vorteil, dass sie seit einigen Jahren als sogenannte Freeride-Piste betrieben wurde. Das bedeutete, dass sie nicht wie normale Skipisten durch Pistenraupen präpariert wurde, sondern lediglich bei Lawinengefahr die Schneemassen gesprengt wurden. Man konnte hier also in einiger Sicherheit vor Lawinen Skitouren unternehmen und Tiefschnee fahren. Der Nachteil war, dass diese relative Sicherheit zusammen mit der Tradition der Strecke an einem sonnigen Hochwintertag wie diesem Hunderte von Skitourengehern und Freeridern anzog. Ein einsames Bergerlebnis würde das nicht werden.
Bereits nach den ersten paar hundert Metern stellte Sandra erfreut fest, dass sie im Sommer und Herbst tatsächlich so viel Kondition aufgebaut hatte, dass sie ihrem superfitten Elitesoldaten davonlaufen konnte. Das spornte sie noch mehr an. Sie legte Zahn um Zahn zu, und bald hatte sie zwei Minuten Abstand zwischen sich und ihren Freund gebracht, obwohl sie oft aus der Aufstiegsspur in den hohen Tiefschnee steigen musste, um langsamere Tourengeher zu überholen.
Markus Denninger lief ebenfalls in der eigenen Spur. Ihre Spur zu nehmen wäre unter seiner Würde gewesen. Es wäre doch gelacht, würde Sandra nicht spätestens in einer halben Stunde die Puste ausgehen und er sie einholen. Natürlich hatte sie neben ihrem Trainingsvorsprung deutliche Gewichtsvorteile; er wog mit seinen achtundsiebzig Kilo fast das Doppelte seiner zierlichen Freundin.
Es gelang ihm immerhin, sich bis auf Hörweite an sie heranzukämpfen, und er schrie ihr mit berstenden Lungen nach: »Wenn ich dich erwische, musst du mich heiraten!«
Er verstand Sandras Antwort nicht. Das Handy klingelte in der Deckeltasche seines Rucksacks. Es war der Klingelton, den er für die Nummer des Bataillonsstabes einprogrammiert hatte. Das Handy spielte »Hell’s Bells«.
Kapitel sieben
Pedro hatte begonnen, sich mit der Geschichte seines Volkes zu beschäftigen, mit den Fakten, aber auch mit seinen Legenden und Mythen. Er hatte beides in Zusammenhang gebracht und wusste nun auch all das, was sie ihm in der staatlichen Schule nicht beigebracht und die Jesuiten ihm verschwiegen hatten.
Vor allem wusste er eines: Der Salar de Uyuni gehörte seinem Volk. Seit Jahrhunderten. Sie hatten hier am Rande des größten Salzsees der Erde ein Leben gefristet, wie es niemand leben wollte. In dieser Höhe. Bei ständiger Wasserknappheit. Umgeben nur von Salz. Hier hatte sich sein Volk angesiedelt. Lange bevor die Inkas es unterworfen hatten und auf der Arbeit seines Volkes ihr Reich errichteten, das schließlich größer gewesen war als das der alten Römer. Lange bevor die Spanier kamen und die Inkas niedermetzelten. Lange bevor der Hirte Silber im Berg Potosí gefunden hatte und die Spanier den Berg durchlöcherten und ausweideten, um eine Brücke aus Silber zu bauen, die bis nach Madrid reichte, wie die Legende behauptete. Lange bevor Bolivar und Sucre die Spanier vertrieben, deren acht Millionen Sklaven sich zu Tode geschuftet hatten, um all das Silber aus dem Berg zu holen. Lange, bevor das Silber ausgebeutet war und die Minen aufgelassen wurden. Lange bevor aus einer Bergbaumetropole ein Zugfriedhof wurde. Lange bevor Che in Bolivien beenden wollte, was er auf Kuba angefangen hatte. Lange bevor sie ihn zwischen Feigenbäumen verhaftet und erschossen hatten. Lange bevor die Touristen kamen, um im Salzhotel auf dem See zu wohnen. Lange bevor sie das Lithium entdeckt hatten, das sie alle haben wollten: die Amerikaner, die Franzosen, die Koreaner, die Chinesen.
Kapitel acht
In Franz Hellwegers Steuerstand ging es mittlerweile zu wie in einem Bienenstock. Ständig schwirrten Einsatzleiter von Polizei, Rotem Kreuz, Bergwacht und THW ein und aus. Das Telefon klingelte ohne Unterbrechung. Er musste erst einmal für Ruhe sorgen.
»Jetzt ist aber Schluss hier. Sie bleiben da!«, wies er den Einsatzleiter der Polizei an. »Alle anderen: raus! Es gibt noch nichts zu retten. Wir haben keine Ahnung, was dort oben los ist. Schaut alle erst mal zu, dass ihr eure Gerätschaften irgendwo verräumt. Und du, Hias, machst mir den Telefonisten. Nur unser Chef und die Leute vom Gipfel stellst du durch, alle anderen wimmelst du ab, und zwar innerhalb von zwei Sekunden, damit die Leitung frei ist. Alles klar?«
Matthias Meier hatte verstanden. Er war zwar Maschinist bei der Bayerischen Zugspitzbahn, aber unangenehme Bittsteller unfreundlich abzubürsten hatte er am Fahrkartenschalter üben dürfen, wo jeder Kollege einspringen musste, wenn Not am Mann war. Der nächste Anrufer bekam ein »Naa, jetzat ned!« zu hören, dann legte Hias Meier sofort auf. Das tat er nun im Fünf-Sekunden-Takt.
»Und was machen wir mit den Leuten auf dem Platt und auf dem Gipfel?« Hauptkommissar Ronny Vierstetter von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen war der ranghöchste Polizist, der am Eibsee aufgetaucht war. Er vertrat den PI-Chef, der auf dem Weg ins Zillertal zum Skifahren war. Jetzt stand Vierstetter neben Hellweger im Leitstand. »Es sind jetzt mittags über fünftausend Menschen auf dem Gipfel. Die müssen wir evakuieren. Aber wie soll das gehen?« Vierstetter war noch nicht lange in Garmisch-Partenkirchen. Die Berge und alles, was damit zusammenhing, waren ihm immer noch ein Rätsel.
»Die Zahnradbahn ist weg. Die hätte die größte Kapazität. Wir bekommen die Leute jetzt nur noch mit den beiden Seilbahnen hierher zum Eibsee und nach Ehrwald herunter«, schaltete sich Hias Meier zwischen zwei Telefonaten ein.
Dagegen protestierte Hellweger energisch. »Hier kann ich die nicht brauchen. Ich will unsere Seilbahn für Materialtransport und für Verletzte aus dem Zug freihalten. Die Leute oben sollen mit der Tiroler Seilbahn nach Ehrwald.«
»Mit nur einer Seilbahn alle Leute runterbringen?«, regte sich Hauptkommissar Vierstetter auf. »Die schafft doch nicht mehr als drei- oder vierhundert Mann die Stunde. Das dauert ja über zehn Stunden, bis alle in Ehrwald sind.«
Wenigstens die Grundrechenarten beherrscht der Ossi, dachte Hellweger und schaute dem Polizisten in die Augen. »Ihr müsst die halt auch zum Teil oben verpflegen. Dazu haben wir das THW und das Rote Kreuz. Eines ist klar: Hier brauchen wir den ganzen Platz für die Rettung. Wir müssen schweres Gerät nach oben bringen. Kümmerts ihr euch um die Leute da draußen und machts die Straße frei. Schauts, wie viele oben in Schlafsäcken und unter Decken von der Bundeswehr in der Gipfelstation und im Schneefernerhaus übernachten können. Das Rote Kreuz soll direkt neben dem Gleis hier unten und oben im Restaurant SonnAlpin auf dem Platt je einen Not-OP aufbauen. Oder was weiß ich, was jetzt wer macht. Katastropheneinsätze regelt doch das Landratsamt. Ihr müssts wirklich nicht da herin umanandastehen. Machts ihr da draußen alles klar. Wir kümmern uns um den Zug im Tunnel.«
Vierstetter verstand, dass er hier am wenigsten gebraucht wurde, und verzog sich aus dem Leitstand.
Wenige Minuten später legte der als Aushilfstelefonist bestellte Hias Meier nicht sofort wieder auf, nachdem er einen weiteren Anruf entgegengenommen hatte, sondern nahm Haltung an. Dann deckte er die Sprechrillen mit der Hand ab und rief: »Du, Franz, das ist jetzt nicht unser direkter Chef, aber vielleicht gehst du trotzdem …«