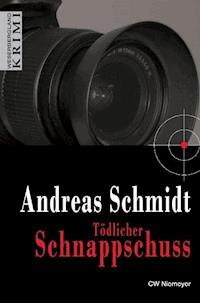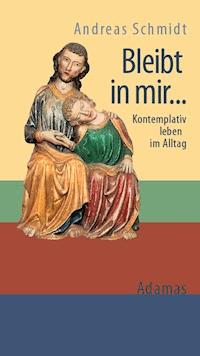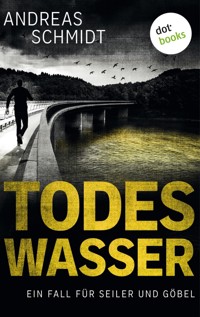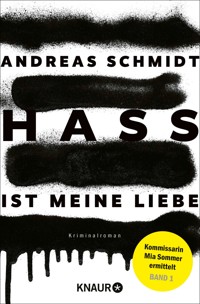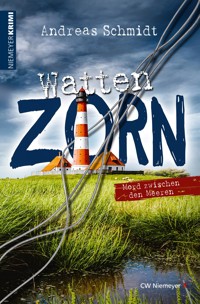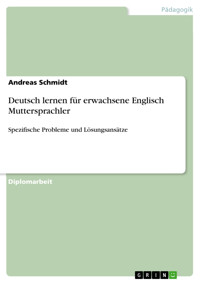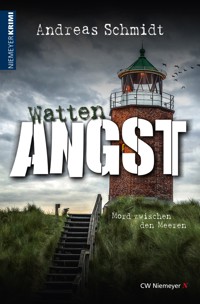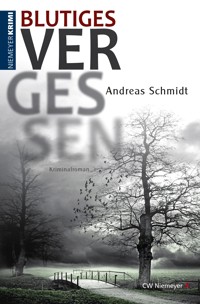
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wuppertal, im Jahr 2001: Eine Leiche am Ufer eines Tümpels. War es ein Unfall oder doch ein Verbrechen? Niemand vermisst die unbekannte Frau. Auch die Spur der Polizei führt ins Nichts, die Ermittlungen werden eingestellt. Fünfzehn Jahre später stolpert Zeitungsreporter Frank Dirzius über eine amtliche Mitteilung: Eine seit Jahren vermisste Frau soll von Amts wegen für tot erklärt werden. Dirzius wittert einen Skandal – haben die Behörden damals geschlafen oder gibt es einen Mord ohne Leiche? Der Reporter zieht Verbindungen, die ihn bis ins Weserbergland führen. In Zusammenarbeit mit Hauptkommissarin Sophie Stein gibt es bald erste Hinweise auf die Identität der namenlosen Toten von damals. Als eine weitere Frau verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über den Autor
Widmung
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Danksagung
Andreas Schmidt
Blutiges Vergessen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2016 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-9796-2
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing www.ansensopublishing.de
Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Über den Autor:
Geboren im Jahr der ersten Mondlandung, 1969 in Wuppertal, gab Andreas Schmidt 1999 mit „In Satans Namen" sein Krimidebüt. Drei Jahre später gelang dem Autor und Journalisten mit „Das Schwebebahn-Komplott" (KBV) der Durchbruch. Inzwischen sind zahlreiche Wuppertal-Krimis, sieben Anthologien sowie der Thriller „Gehasst“ (Digital Publishers) erschienen. Die Hauptfigur seiner Krimis, der stets schlecht gelaunte Kommissar Ulbricht, ermittelt seit Anfang 2011 auch erfolgreich im Weserbergland sowie an der Nordsee-Küste. In „WattenMord" (April 2012, Verlag CW Niemeyer) ermittelte Kommissar Ulbricht zum ersten Mal gemeinsam mit seiner Tochter Wiebke an der Küste … Ulbricht hat sich längst in die Herzen von Andreas Schmidts Lesern ermittelt und ist überregional sehr beliebt. Auch im aktuellen Krimi „Blutiges Vergessen“ spielt Ulbricht eine tragende Rolle.
Derzeit sind neue Kriminalfälle in Arbeit, es geht also weiter.
Mehr Infos und Kontakt auf der neuen Autorenwebsite
www.mordundtotschlag.com
Für meine Jungs
PROLOG
Freitag, 5. Januar 2001
Irgendwo in der Tiefe des Waldes schrie ein Käuzchen. Ein seichter Wind kam auf und erzeugte ein leises Rascheln in den tief hängenden Zweigen der alten Bäume. Es war, als wäre die Welt versunken, kein von einem Menschen erzeugtes Geräusch drang an seine Ohren. Der Mond bahnte sich einen Weg durch die tief hängenden Wolken und tauchte die Szenerie in ein unwirkliches, in ein bizarres Licht. Die runde Scheibe spiegelte sich auf der Wasseroberfläche des Tümpels. Irgendwo raschelte es im Unterholz. Er zuckte zusammen, wirbelte herum und versuchte vergeblich, die Dunkelheit mit seinen Blicken zu durchdringen. Wahrscheinlich war es ein Tier gewesen, das irgendwo im Unterholz auf der Suche nach Nahrung war.
Er war alleine und hätte das Geschehene am liebsten rückgängig gemacht. Doch das war ihm nicht vergönnt. Nun musste er mit der schweren Last zu leben lernen, die er auf sich genommen hatte.
Fassungslos stand er am Rande der Böschung, die zu einem der kleinen Teiche herabführte. Das Blut rauschte in seinen Ohren, schwer hob und senkte sich seine Brust. Er zitterte am ganzen Leib, schaute zu ihr herunter und wusste, dass sie tot war. Sie war die Böschung heruntergestürzt und von unzähligen Eisenstangen, die aus dem Boden ragten, aufgespießt und durchbohrt worden. Es war ein grausamer Anblick. Als der Mond weiter durch die Wolkendecke drang, sah er, dass sich unter ihrem zierlichen Körper eine dunkelrote Blutlache ausbreitete. Ihre Gliedmaßen standen in verrenkter Haltung vom Körper ab. Er hatte geglaubt, bei dem tödlichen Sturz ihre Knochen brechen zu hören. Der Mund stand einen Spalt breit offen. Ein feiner Blutfaden rann aus ihrem Mundwinkel und tropfte auf den gefrorenen Waldboden.
Es war eine kalte Winternacht, und trotzdem stand ihm der Schweiß auf der Stirn, während er dastand und sein grausiges Werk betrachtete.
Was hatte er getan?
Nun würde sie für immer schweigen. Das war für ihn von Vorteil, doch für welchen Preis hatte er sich ihr Schweigen erkaufen müssen?
Sie war tot, würde niemals etwas verraten können.
Und er war zum Mörder geworden.
Übelkeit stieg in ihm auf, als er sich dieser Tatsache bewusst wurde. Nein, verdammt, er war doch nicht einer dieser wahnsinnigen, kaltblütigen Mörder. Er war keiner dieser empathielosen Killer. Er fühlte sich, als würden die Gedanken wie eine zähe Masse durch sein gelähmtes Gehirn rinnen. Von Sekunde zu Sekunde wurde er sich klarer darüber, dass er sie umgebracht hatte. Sein Magen rebellierte.
Wie er es auch drehte und wendete, er konnte das Geschehene nicht rückgängig machen. Schwach sackte er auf die Knie, spürte den eisigen Boden des unbefestigten Waldweges durch den Stoff seiner Hose, barg das Gesicht sekundenlang in den Händen und sah Blitze, die vor seinen Augen tanzten. Schlagartig riss er die Augen auf und stemmte sich wie ein alter Mann in die Höhe, trat an die Böschung und sah sie an. Doch sie lag immer noch da, der Albtraum ging nicht vorbei.
Er mochte nicht länger hinsehen, konnte ihren bizarren Anblick nicht mehr ertragen und wandte sich ab. Höchste Zeit zu verschwinden, schrie alles in ihm. Mechanisch gab er dem Fluchtinstinkt nach und rannte davon.
Samstag, 6. Januar 2001
Die Sohlen der Laufschuhe erzeugten auf dem asphaltierten Teil des Weges ein monotones Trappeln. Sie verfluchte ihre schlechte Kondition. Ihre Lunge stand kurz vor dem Bersten, dennoch hatte sie nicht vor, aufzugeben.
Nicht so kurz vor dem Ziel.
Ihr Atem ging stoßweise. Er bildete winzige Wölkchen vor ihrem geröteten Gesicht. Die Luft war eiskalt und glasklar. Vor einigen Minuten war die Sonne durch die dicken Äste der Zweige gedrungen und zauberte ein warmes Licht in den verlassenen Winterwald.
Gleich war die Joggingrunde überstanden. Erschöpft würde sie mit weichen Knien in die Polster ihres Autos sinken, das sie auf dem Parkplatz beim Minigolf-Platz abgestellt hatte. Ein paar Meter musste sie noch durchhalten.
Claudia Petzokat kämpfte gegen die zusätzlichen Pfunde, die sie sich zwischen den Tagen angefuttert hatte. Es war der Tag der Heiligen Drei Könige, und sie joggte in den Morgenstunden durch das Zillertal. Um diese Jahreszeit wirkte die Idylle trostlos. Eine mystische Stille umfing sie. Für die Läuferin war es ein ganz normaler Samstag. Wie immer war sie früh aufgestanden, hatte einen Kaffee im Stehen getrunken, bevor sie in die Laufklamotten geschlüpft war, um mit dem Auto in die verschwiegene Talsenke zwischen Cronenberg und Ronsdorf zu fahren. Natürlich musste sie den inneren Schweinehund überwinden, um durch die Kälte zu laufen, aber es nutzte nichts: Wenn sie im Frühling wieder in ihre geliebten Kleider passen wollte, mussten die Pfunde verschwinden. Keiner Menschenseele war sie auf der Runde begegnet, nicht einmal Menschen mit Hunden waren ihr entgegengekommen.
Die Luft war trocken und eiskalt. In der Nacht hatte es wieder gefroren. Jetzt lag Raureif auf den Pflanzen, der in der Morgensonne glitzerte wie tausend winzige Kristalle.
Im Sommer tummelten sich hier an den Wochenenden die Spaziergänger, die Jogger und die Mountainbiker. In der kalten Jahreszeit herrschte an dieser Stelle die Einsamkeit.
Die 38-jährige Bürokauffrau versuchte, den Puls unter Kontrolle zu bringen. Nun ging es leicht bergab. Claudia genoss trotz der körperlichen Herausforderung die Ruhe des Waldes, während sie im Laufen über ihr Leben sinnierte. Nächste Woche hatte sie Geburtstag. Die Einladungskarten an die Freunde waren längst verschickt. Eigentlich konnte sich Claudia auf ihren Freundeskreis verlassen. Man würde ihr eine tolle Party bereiten, daran zweifelte sie nicht. Dennoch war ihr Herz von einer unbestimmten Leere erfüllt. Sie ging stark auf die Vierzig zu. Noch immer hatte sie ihren Mr. Right nicht gefunden. Claudia hatte es satt, sich die Wochenenden in den Clubs der Stadt um die Ohren zu schlagen, um endlich einen Mann fürs Leben zu finden. Es hatte sicherlich den einen oder anderen Kandidaten gegeben, der zeitlich befristet in ihr Leben treten durfte. Jedoch wirklich gepasst hatte es bisher nicht. Vielleicht war sie mit den Jahren reifer und wählerischer geworden, was ihre Anforderungen an Männer betraf.
Da war Dirk gewesen, ein wenig übergewichtig, aber ein offenes, herzerweichendes Lächeln, wunderschöne blaue Augen. Doch er war zu lieb, hatte bedingungslos zu allem Ja und Amen gesagt. Nichts, womit Claudia etwas anfangen konnte. Sie brauchte Gegenwind in ihrem Leben, jemanden, der sie jeden Tag aufs Neue hinterfragte und dennoch in jeder Situation hinter ihr stand, ihr eine starke Schulter zum Anlehnen bot, wenn ihr danach war. Kaum zwei Monate waren sie ein Paar gewesen, bis Claudia die Notbremse gezogen und ihn vor die Tür gesetzt hatte. „Es passt einfach nicht mit uns“, hatte sie Dirk gestanden. Der Start zu einer Verfolgungsjagd, denn Dirk hatte sich so leicht nicht abwimmeln lassen. Immer wieder hatte er sie angerufen, um ein Treffen gebeten, hatte mit einem Strauß Blumen und einer Flasche Sekt vor der Wohnungstür gestanden, viel zu oft hatte er auf der Straße vor ihrem Schlafzimmerfenster gelauert und darauf gehofft, dass sie ihn doch noch einmal hereinbitten würde. Erst, als sie gedroht hatte, ihn bei der Polizei anzuzeigen, war Dirk gänzlich aus ihrem Leben verschwunden.
Dann war da Peter gewesen. Groß, sportlich, fast drahtig, dazu äußerst attraktiv. Er hatte den Großteil seiner Freizeit im Fitnessstudio verbracht. Doch da hatte er sich in eine Mitarbeiterin verguckt und hatte Claudia mit dem jungen Ding betrogen. Von einem schönen Teller isst man nicht, hatte sie ihre Mutter immer gewarnt. Es lag auf der Hand, dass man einen schönen Mann nicht für sich alleine hat.
Aus und vorbei.
Die Liste der Männer, die ein kurzes Gastspiel in ihrem Leben gegeben hatten, war lang. Dabei sehnte sie sich schon seit Ewigkeiten nach dem Märchenprinzen, dem Mann, an dessen Seite sie alt werden wollte.
Nun feierte sie bald ihren 39. Geburtstag.
Inzwischen hatte Claudia den Teil des Weges erreicht, auf dem es steil bergab ging. Ihre Fesseln begannen zu schmerzen, doch sie verlangsamte ihre Schritte nicht. Erst als der erste der beiden Teiche in Sicht kam, wurde Claudia ein wenig langsamer. Sie mochte den verwunschenen Ort, fand, dass der Teich zu ihrer Linken etwas Geheimnisvolles ausstrahlte. Schilfhalme ragten aus dem Wasser, am Ufer hatte sich eine dünne Eisschicht gebildet. Auf einem vorspringenden Ast saß ein Reiher. Regungslos und stumm stierte er ins Wasser, die sichere Beute im Wasser direkt vor Augen. Der dolchartige Schnabel schwebte über der Wasseroberfläche, bereit, pfeilschnell zuzustoßen, wenn die anvisierte Mahlzeit sich der Oberfläche näherte.
Doch daraus wurde nichts.
Als sich Claudias Schritte näherten, breitete der große Vogel die Schwingen aus und erhob sich in die Luft. Claudia blickte dem Reiher nach, der majestätisch in den eisblauen Himmel aufstieg. Als der Reiher ihrem Sichtfeld entschwunden war, konzentrierte sich die Joggerin auf den Rest der Strecke. Weit war es nicht mehr. Ein paar hundert Meter noch, kein Grund, jetzt schlappzumachen.
Etwas am Ufer zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Claudia verlangsamte ihre Schritte. Sie wandte den Kopf nach links. Sie stockte, als sie eine Person am Abhang liegen sah. Auf dem ersten Blick erkannte sie, dass es sich um eine Frau handelte. Die Fremde trug eine auffällig gesteppte orangefarbene Jacke, dazu einen schwarzen Faltenrock, der eine Handbreit über dem Knie endete. An den Füßen geschnürte, braune Wildlederstiefel.
Ein Outfit, in dem man eigentlich nicht im Wald herumläuft, durchzuckte es Claudia. Schwer atmend war sie an der Böschung stehen geblieben und starrte entsetzt zu der leblosen Frau herab. Ihre Gliedmaßen zeigten verrenkt vom Körper weg, der Kopf war zur Seite gewandt.
„Scheiße“, stieß Claudia hervor, als sie an den Rand des Waldweges trat. Ihr Magen drehte sich um. Es bestand kein Zweifel daran, dass die Frau am Ufer des Teiches nicht mehr lebte. Claudias Blick haftete an den weit aufgerissenen Augen der Fremden. Ein Blutfaden war aus dem Mundwinkel der Toten geronnen. Das Alter der Frau konnte Claudia schlecht schätzen. Sie bekam weiche Knie und ging in die Hocke.
Da ragte etwas aus dem Rücken der Frau, etwa auf Höhe des rechten Schulterblattes. Erst bei näherem Hinsehen erkannte Claudia, dass es sich dabei um eine rostige Eisenspitze handelte. Der eiserne Pflock hatte den zierlichen Körper der Frau durchbohrt. Ein tiefroter Fleck hatte sich um die Wunde gebildet. Eine zweite Eisenspitze ragte oberhalb der Hüfte aus dem Körper der Frau. Sie war auf grausamste Weise gestorben. Aufgespießt von den unzähligen Eisenstangen, die am Rand der Böschung aus dem Unterholz ragten und eine tödliche Gefahr für Spaziergänger bedeuteten, die hier vom Weg abkamen.
Claudias Herz klopfte bis zum Hals, als sie an die unbefestigte Kante trat, die geradewegs zum Teich führte. Vor Jahren hatte man an dieser Stelle Eisenstangen in den Boden gerammt, womöglich, um den absackenden Hang zu befestigen. Die Spitzen der rostigen Stangen ragten gut dreißig Zentimeter aus dem Boden.
Vor Claudias geistigem Auge lief ein Film ab. Sie sah, wie die Frau die Böschung herabstürzte, am Hang ausrutschte, geradewegs auf die eisernen Spitzen stürzte und grauenvoll aufgespießt wurde. Fast hörte sie die Schreie der Unbekannten, spürte den tödlichen Schmerz, den die Frau durchlitt, bevor sie starb.
Claudias Knie wurden weich. Sie schluckte trocken, schüttelte ungläubig den Kopf.
Dunkle Flecken hatten sich rund um die Stellen gebildet, an denen sich das rostige Metall durch den Körper der fremden Frau bohrte. Dunkles, verkrustetes Blut.
Anklagend schien die Frau zu Claudia aufzublicken.
Wie drapiert, so lag die Frau in der Böschung.
Was hier auch immer geschehen war – es sah aus, als hätte die Fremde keine Chance gehabt, sich aus ihrer Lage zu befreien. Es musste ein schrecklicher Tod gewesen sein, den sie erlitten hatte. Ihre Hände waren schmutzig, Blut hatte sich unter den Nägeln gebildet. Wahrscheinlich hatte die Frau im Moment des Todes unter schrecklichen Schmerzen versucht, sich zu befreien.
Vergeblich.
Claudia wurde übel. Sie hockte sich hin und stützte die Hände rechts und links neben den Hüften am Boden ab. Ungläubig schüttelte sie den Kopf. Claudia schloss die Augen, aber es schien, als hätte sich der Anblick der aufgespießten Person in ihrem Gedächtnis festgebrannt. Sie atmete tief durch, sog die kalte Morgenluft tief in ihre Lungen ein, öffnete die Augen einen Spalt. Schüttelte erneut den Kopf, kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an, während sie vergeblich nach einem Lebenszeichen an der Frau suchte, ohne sie zu berühren. Es war hoffnungslos.
Regungslos und starr, wie in Wachs gegossen, lag die Fremde aufgespießt vor ihr.
Hier kam jede Hilfe zu spät.
Claudias Magen rebellierte, dann übergab sie sich.
EINS
Donnerstag, 11. November 2016
Als er spät abends die Türe seiner Wohnung aufschloss, schlug Frank Dirzius ein muffiger Geruch entgegen. Er rümpfte die Nase, trat sich auf dem Kokosabtreter im Türrahmen die Schuhe ab und setzte einen Fuß über die Schwelle. Seine Hand wischte im Dunkel über die Wand neben der Tür, suchte und fand den Lichtschalter, um ihn zu betätigen. Er seufzte, drückte die Tür zu und schob den Schlüssel von innen ins Schloss.
Da war sie wieder, diese verdammte Beklemmung, die ihn jedes Mal befiel, wenn er seine Behausung betrat. Obwohl Dirzius Mitte vierzig war, lebte er in einer Junggesellenwohnung. Seit zwei Monaten wohnte er in der 64-Quadratmeter-Mietwohnung unter dem Dach des Sechsparteienhauses an der Einfallstraße in die Stadt. Janine, seine Ehefrau, hatte ihn nach vielen gemeinsamen Jahren rausgeworfen. Wegen eines anderen Kerls, der sich in ihr Leben geschlichen hatte, als Dirzius sich mal wieder im Auftrag der Zeitung auf irgendeinem dieser späten Abendtermine herumgetrieben hatte.
Schnell war es gegangen. Ja, sie hatten sich in den letzten Jahren auseinandergelebt, aber sie hatten auch zahlreiche gute sowie schlechte Jahre zusammen gemeistert. Vielleicht nicht als Liebespaar, aber als Team.
Immerhin.
Dirzius war sich seiner Sache sicher gewesen. Er war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass er an ihrer Seite alt werden würde. Entsprechend wenig Mühe hatte er sich gegeben, seine Frau glücklich zu machen. Der Alltagstrott hatte sich in ihr Eheleben eingeschlichen, um das verliebte Herzklopfen, das sie füreinander empfunden hatten, ein für alle Mal auszulöschen.
„Es ist aus“, hatte sie ihm irgendwann verkündet und ihm ein Ultimatum für seinen Auszug gestellt. Und er hatte sich gefügt, war sich seiner Fehler bewusst gewesen, hatte eingesehen, dass ein weiterer Kampf um ihre gemeinsame Zukunft vergeblich war.
Nun hauste er in dieser düsteren Bude.
Allein, weit weg von allem, was ihn an seine Zeit mit Janine erinnerte. Die Chance für einen Neuanfang hatte er noch nicht ganz aufgegeben, aber sie war für ihn in weite Ferne gerückt. Seelisch und räumlich. An jedem Abend, den er aus der Redaktion der kleinen Lokalzeitung nach Hause kam, wurde er brutal von der Einsamkeit überrollt.
Lustlos und zu müde, sich nach einem langen Arbeitstag ins Nachtleben zu stürzen, um irgendwann einmal die Frau zu finden, mit der er wirklich alt werden konnte.
Dirzius streifte die Schuhe ab und beförderte sie mit einem eleganten Schwung in das Regal, das er zum Schuhschrank zweckentfremdet hatte. Mit einem Seufzen auf den Lippen zog er den Wintermantel aus und marschierte ins dunkle Schlafzimmer. Das Licht ließ er aus – der Schein des dreiflammigen Halogenspots im schlauchförmigen Flur warf einen Lichtkegel in das eiskalte Schlafzimmer. Das altmodische Cord-Sakko mit den ledernen Ellbogenschonern behielt er an. Dirzius warf den Mantel auf das französische Bett, machte kehrt, durchschritt den langen Flur in die entgegengesetzte Richtung und trat in die Küche. Geblendet vom Schein einer nackten Glühbirne unter der Decke ging er vor dem kleinen Kühlschrank in die Hocke, um sich ein Bier aus dem Gemüsefach zu nehmen. Er griff nach dem Öffner in der Besteckschublade, hebelte den Kronkorken ab und nahm einen großen Schluck aus der Flasche. Als er sich rücklings gegen die unbefestigte Arbeitsplatte lehnte, gab das massive Brett nach und landete mit einem lauten Krachen an dem weißen Fliesenspiegel. Dirzius fluchte ungehalten. Die Küche war noch lange nicht fertig. Im Internet hatte er die gebrauchte Einbauküche aus einer Haushaltsauflösung erstanden. Einzelteile. Unterschränke, eine Spüle, ein einfacher Kühlschrank, drei Hängeschränke und einen einfachen Herd. Alles zum Selbstaufbauen. Darauf hatte er bisher verzichtet. Schnell waren die Schränke aufgestellt worden, die Spüle angeschlossen und zwei der insgesamt drei Hängeschränke unter der Schräge montiert. Zu mehr war Dirzius nicht gekommen. Er hatte es nicht eilig, seine Küche zu komplettieren. Für wen auch?
Gelangweilt blickte er aus dem Fenster in den dunklen Garten. Eine Nachbarin aus dem Haus hatte LED-Spieße in den Boden gerammt, die einen mit schiefen Platten verlegten Weg ins Grün flankierten. Zu seiner Wohnung gehörte eine Parzelle des Gemeinschaftsgartens. Ein mächtiger Kastanienbaum auf der Wiese sorgte im Sommer für Schatten. Jetzt, im Herbst, sorgte der Baum für Massen von Laub.
Ihm war es egal, er hatte nicht vor, den Garten zu nutzen. Dirzius stemmte sich von der unbefestigten Arbeitsplatte ab und löschte das Licht in der Küche. Er betrat das dunkle Wohnzimmer. Die Straßenlaterne vor dem Haus warf einen Lichtstreifen auf die gegenüberliegende Wand. Die Helligkeit genügte Dirzius, den Weg zum Schreibtisch zu finden. Im Wohnzimmer gab es einen kleinen Arbeitsplatz am Fenster.
Ein einfacher Schreibtisch mit Computer, die Ladestation des Festnetz-Telefons sowie eine Schreibtischlampe. Dirzius fuhr mit der Hand die Schnur der Lampe entlang, um den Kippschalter zu betätigen. Nachdem er die Bierflasche auf den bereitliegenden Kork-Untersetzer gestellt hatte, beugte er sich vor und drehte am Ventil der Heizung. Die Leitung gluckerte vernehmlich, bevor sich eine angenehme Wärme unter dem Tisch ausbreitete. Dirzius sank auf den knarrenden Bürostuhl und fuhr den Rechner hoch.
Er stützte das Kinn in die Hände und stierte auf den Startbildschirm. Nachdem der Computer betriebsbereit war, wählte er sich ins Internet und rief die Redaktionsmails auf. Als Redakteur der Wuppertaler Woche, einer kleinen, anzeigenfinanzierten Stadtteilzeitung, war er so ziemlich für alles zuständig. Dirzius arbeitete viel vom Home Office aus. Hier fand er die nötige Ruhe zum Schreiben seiner Beiträge, in der Redaktion ein Unding. Ständig klingelte dort das Telefon, Kunden kamen in das Büro, um Anzeigen aufzugeben und ihn vom Denken abzuhalten. Morgen war Drucklegung, die Zeitung musste fertig werden, es durfte nicht schaden, sich schon mal um die Mails im Posteingang zu kümmern. Obwohl der Job mies bezahlt wurde, fühlte er sich als Vollblutjournalist und lebte für den Beruf. Bernd Lüders, der Herausgeber, spielte seinen Enthusiasmus gern herunter. Besonders, wenn Dirzius und er mal wieder stritten, hielt Lüders seinem Redakteur vor, dass jeder ersetzbar sei.
Lustlos scrollte Dirzius durch das Postfach. Unzählige Mails waren aufgelaufen in den letzten Stunden. Feuerwehr-Einsatzmeldungen, Stellungnahmen von Kommunalpolitikern, die sich zu jedem Geschehen in der Stadt zu Wort meldeten, ein paar Leserbriefe, die Beschwerde eines Lesers, der seit Wochen keine Zeitung im Briefkasten hatte. „Vertrieb“, brummte Dirzius. Er nahm sich vor, Hubert Klein, der die Boten unter sich hatte, morgen ein paar passende Worte zur Arbeitsmoral seiner Zusteller zu sagen. Unzählige Pressetexte von Unternehmen, die zu geizig waren, eine Annonce zu schalten, sich aber im redaktionellen Teil der Zeitung sehen wollten. Solche Mails löschte Dirzius ungesehen.
Er nahm einen Schluck aus der Bierflasche, unterdrückte einen Rülpser, bevor er über eine Mail des Wuppertaler Amtsgerichts stolperte. Schon die Worte im Betreff erregten seine Aufmerksamkeit. „Amtliche Mitteilung mit der Bitte zur Veröffentlichung“, las er halblaut und schüttelte den Kopf. Dirzius stellte die Flasche ab und öffnete die Mail.
Sabine Weber, seit Januar 2001 vermisst, soll sich bis zum 1. Dezember 2016 am Amtsgericht Wuppertal, Zimmer 306, melden. Wahlweise auch Personen, die über den Aufenthaltsort der Vermissten Auskunft geben können. Erscheint niemand, wird die Vermisste für tot erklärt.
Dirzius überflog den knappen Text drei Mal. Seine Müdigkeit war verflogen. Weber, hämmerte es in seinem Kopf. Woher kannte er den Namen Weber bloß?
Der Name kam oft vor, kurz war Dirzius versucht, zum Telefonbuch zu greifen, um die Anzahl der Einträge mit dem Namen Weber zu zählen.
Nullachtfuffzehn, dachte Dirzius grimmig. Dennoch: Sabine Weber, das hatte er schon einmal gehört. Sosehr er sich zu erinnern versuchte, er konnte den Namen der Vermissten nicht zuordnen. Seit fast genau fünfzehn Jahren wurde die Frau vermisst. Wer konnte so lange untertauchen? Dirzius dachte rationell, das hatte er sich in seinem Beruf angewöhnt. Sicher war Sabine Weber nicht untergetaucht – sondern tot. Aber warum sollte sie erst nach dieser langen Zeit von Amts wegen für tot erklärt werden? Er schielte auf den Kalender. Viel Zeit blieb Sabine Weber, sollte es sie noch geben, nicht mehr. Bis zum 1. Dezember waren es gut zwei Wochen.
Diese eigenartige Meldung berührte Frank Dirzius auf seltsame Weise. Wie konnte es sein, dass Menschen einfach so von der Bildfläche verschwinden? In Zeiten von Internet, NSA und der totalen Überwachung schien es nahezu ausgeschlossen zu sein, dass sich die Spur eines Menschen im Nichts verliert.
Andererseits war es 2001 mit dem Internet noch nicht so weit her, überlegte Dirzius, leerte die Bierflasche und erhob sich, um sich aus der Küche Nachschub zu besorgen.
*
„Sag, dass das nicht wahr ist“, murmelte Jan Rossmann schlaftrunken, als ihn das Klingeln des Telefons aus dem Schlaf riss. Er gähnte herzhaft und stupste Lisa, die in embryonaler Haltung neben ihm lag, sanft an. Seine Freundin hatte einen tiefen Schlaf.
„Was denn?“, brummte sie unwillig und zupfte an der heruntergerutschten Bettdecke herum. Wie immer hatte sie nackt geschlafen.
„Das Telefon klingelt.“ Jan Rossmann unterdrückte einen Fluch, dann rappelte er sich in die Höhe, um die kleine Nachttischlampe anzuknipsen.
„Mach das aus“, protestierte Lisa prompt. „Es blendet.“ Widerwillig richtete sie sich auf. Sie blinzelte auf das Display des Weckers an ihrem Bett. „Es ist fast ein Uhr nachts“, bemerkte sie kopfschüttelnd.
„Das musst du mir nicht sagen“, entgegnete Jan und angelte nach dem schnurlosen Telefon, um es seiner Freundin anzureichen. „Ist für dich.“
„Lass die Mailbox anspringen, wahrscheinlich hat sich jemand verwählt.“
„Nur wenige kennen deine Nummer, sie ist nirgendwo eingetragen“, erinnerte Jan sie, dem die Melodie des Telefons gewaltig auf die Nerven ging.
„Und du weißt warum“, erwiderte Lisa und nahm das Telefon an sich, um die grüne Taste zu drücken.
Er grinste. „Weil du eine Schisserin bist.“
Prompt erntete er einen Klaps, danach meldete sich Lisa mürrisch. „Dirzius?“
„Hier auch“, hörte sie eine sonore Stimme am anderen Ende der Leitung sprechen. „Entschuldige die Störung, aber ...“
„Paps?“ Lisa zog die Stirn in Falten und warf Jan einen verärgerten Blick zu. Manchmal hasste sie ihn. Warum hatte er sie nicht einfach schlafen lassen? „Weißt du, wie spät es ist, Papa?“
„Ja – und ich entschuldige mich auch ausdrücklich dafür. Ich hoffe, du hast noch nicht geschlafen, Kind.“
„Doch, mein Dienst beginnt in wenigen Stunden.“ Die ewigen Wechselschichten als Polizistin machten ihr das Leben zur Hölle. Obwohl sie ihren Beruf liebte, verteufelte sie die abwechselnden Dienste zu unmenschlichen Zeiten.
„Oh, Mist, das tut mir leid.“ Er klang wirklich betroffen. Seitdem Frank Dirzius von ihrer Mutter getrennt lebte, neigte er zu kauzigen Allüren. Die Einsamkeit bekam ihm offenbar nicht. Es war höchste Zeit, dass ihr Vater eine neue Frau fand.
„Wie ist das mit den vermissten Personen bei euch?“
Lisa warf Jan einen Blick zu, der nichts Gutes verheißen sollte. Sie brummte etwas Unverständliches, gähnte, bevor sie den Hörer fester ans Ohr presste. „Wovon sprichst du?“
Mit wenigen Sätzen berichtete Franz Dirzius seiner Tochter von der amtlichen Mitteilung. „Schaltet euer Verein bei der Suche nach Vermissten nicht immer die Öffentlichkeit ein?“
„Normalerweise schon. Dieser Fall liegt aber schon zu lange zurück, da weiß ich nicht, woran es liegt. Das Amtsgericht wird schon seine Gründe haben, Paps.“ Lisa hatte nicht vor, ihrem Vater um diese Zeit eine Rechtsberatung zu geben. Sie war Streifenpolizistin, keine Richterin. „Was soll ich tun?“
Ihr Vater druckste herum. „Vielleicht könntest du mal im Präsidium nachfragen, ob es eine alte Akte gibt?“
Lisa stöhnte auf. Sie hatte keine Lust, um diese Uhrzeit eine Diskussion mit ihrem Vater zu führen. Alle Vorgänge landeten irgendwann bei der Staatsanwaltschaft. Das nun ihrem Vater zu erklären, befand sie für müßig. „Name der Vermissten?“
„Weber, Sabine Weber“, erwiderte Frank Dirzius am anderen Ende der Leitung hastig. „Sie wird seit Januar 2001 vermisst. Mehr weiß ich leider nicht.“
„Super, Papa.“
„Du nimmst mich nicht für voll.“
„Und ob. Ich hör mich morgen mal um. Und jetzt würde ich gern schlafen, meine Frühschicht beginnt gleich.“ Bevor ihr Vater etwas erwidern konnte, drückte Lisa den roten Knopf und reichte ihrem geduldig wartenden Freund das Telefon. „Hier“, sagte sie. „Kannst du es bitte lautlos stellen?“
„Nichts lieber als das.“ Jan hantierte an dem Gerät herum, dann legte er es zurück auf den Nachtschrank. „Was war denn?“
„Ach ... es geht um eine Frau, die seit fünfzehn Jahren vermisst wird.“ Lisa rollte sich zusammen, wandte ihm den Rücken zu und gähnte.
Jan blickte sich suchend um und schaute unter das Bett. „Hier ist sie nicht.“
„Blödmann.“
Jan lachte, während er das Licht löschte und in die Kissen zurücksank. „Mal im Ernst: Vor fünfzehn Jahren warst du noch in der Schule.“
„Eben.“ Lisa schloss die Augen und betete, dass ihr Freund keine weiteren Fragen stellte. Innerhalb der nächsten zwei Minuten sank sie in einen tiefen Schlaf, der erst mit dem Klingeln des Weckers beendet wurde.
*
„Handy, Portemonnaie sowie Schlüssel bitte ins Kästchen legen.“ Der Sicherheitsbeamte an der Pforte des Amtsgerichts schob Dirzius eine kleine Kiste hin. Er lächelte distanziert und deutete auf den Kasten, der auf dem kleinen Förderband der Röntgenanlage lag.
Dirzius kam der Bitte nach. Diese Sicherheitskontrollen nervten ihn. Er schielte auf die Armbanduhr. Fünf Minuten zu spät. Um acht Uhr war er mit Anna Schwartz verabredet gewesen.
„Dann bitte einmal durch die Schleuse.“ Der Beamte wies auf den Durchgangsdetektor, während er Dirzius’ persönliche Gegenstände in der Röntgenanlage durchleuchtete.
Prompt piepste es, als Dirzius unter den Torbogen des Metalldetektors trat. „Der Gürtel und die Uhr“, brummte er, zupfte an seiner Gürtelschnalle herum und hielt den linken Arm in die Höhe.
Der Beamte nickte. „Okay, dann bitte weiter.“
Hinter der Sicherheitskontrolle nahm Dirzius seine Habe wieder an sich. Das Handy schaltete er aus. Auf Ärger hatte er keine Lust. Er bedankte sich bei dem uniformierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und steuerte zielstrebig die Kantine des Amtsgerichtes im Erdgeschoss an. Bereits im Übergang vom Neu- zum Altbau roch es verführerisch nach Kaffee und frischen Brötchen. Sein Magen knurrte. Dirzius wurde bewusst, dass er noch nicht gefrühstückt hatte. Bevor er die Auslage am Frühstücksbuffet in Augenschein nehmen konnte, erhob sich eine zierliche Frau, die ihn aufmerksam beobachtet hatte.
Zielstrebig kam sie auf ihn zu. „Guten Morgen, Herr Dirzius.“
„Frau Schwartz?“ Dirzius erwiderte den Gruß. „Wie haben Sie mich erkannt?“
Sie feixte amüsiert. „Ich habe Sie gegoogelt.“
„Ach so.“ Dirzius lachte. „Mache ich auch immer, wenn ich jemanden nicht kenne.“ Üblicherweise gab er den Namen seiner Interviewpartner auch immer ins Fenster einer Internet-Suchmaschine ein, bevor er sie traf. Das erleichterte ihm oft die Vorbereitung auf das eigentliche Gespräch.
„Anna Schwartz. Ich habe Ihnen die amtliche Mitteilung geschickt“, stellte sich die Frau jetzt vor.
Frank Dirzius musterte sie unauffällig. Er schätzte Anna Schwartz auf Ende dreißig. Langes, schwarzes Haar rahmte sich um ihr blasses Gesicht, das nur von einem dezenten Make-up farbige Akzente erhielt. Ihm persönlich war ihr Lippenstift ein wenig zu grell. Anna Schwartz trug einen dunklen, figurbetonten Rock, der eine Handbreit über dem Knie endete und zwei wohlgeformte Beine preisgab, die in dunklen Nylons steckten. Sie trug hohe Schuhe, die aber auch nichts daran änderten, dass sie fast zwei Köpfe kleiner war als Dirzius. Über der weißen Bluse trug sie eine dunkelblaue Jacke.
„Zufrieden?“, fragte sie mit einem frechen Lachen.
„Wie bitte?“ Dirzius’ Gesicht nahm eine tiefrote Färbung an.
„Ob ich Ihrer Vorstellung entspreche?“
„Ach so.“ Dirzius fühlte sich ertappt und überlegte, ob er sie vielleicht zu lüstern angeschaut hatte. „Absolut.“
„Schön.“ Sie reichte ihm die Hand. „Haben Sie schon gefrühstückt?“
„Jetzt haben Sie mich schon wieder erwischt.“ Dirzius grinste schief. „Nein, dazu war keine Zeit.“
„Dann wird es höchste Zeit, ich nämlich auch nicht.“ Sie traten an das Buffet und bestellten bei der Thekenkraft belegte Brötchen und Kaffee.
„Ich übernehme das“, sagte Dirzius schnell und zog sein Portemonnaie hervor.
„Ganz Gentleman“, bemerkte Anna Schwartz spitz, hatte aber keine Einwände, sich von ihrem Gast einladen zu lassen. Anna Schwartz stellte zwei Tassen mit dampfendem Inhalt auf ein Tablett, nahm es und ging voran zum Tisch in der hintersten Ecke. Dirzius bezahlte, dann folgte er der attraktiven Rechtspflegerin. Er kam nicht umhin, ihr auf den Hintern zu starren.
„Danke, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben“, bemerkte Dirzius, als sie am Tisch saßen.
„Danke für das Frühstück“, erwiderte Anna Schwartz. „Es ist im Sinne aller Beteiligten, dass der Fall nach so langer Zeit zum Abschluss gebracht wird. Also helfe ich, wo ich kann.“
Dirzius pustete in seinen Kaffee und trank in kleinen Schlucken. Sein Kopf schmerzte. Abends sollte er weniger trinken, mahnte er sich im Stillen. Seitdem er alleine lebte, war er dem Alkohol nicht abgeneigt. Er fühlte sich wie gerädert an diesem Morgen.
„Mögen Sie Milch im Kaffee?“, riss ihn eine Stimme aus den Gedanken. Dirzius schüttelte den Kopf. „Nein, danke. Ich trinke meinen Kaffee schwarz wie die Nacht.“
Wieder lachte sie. „Das sage ich auch immer, wenn es um meinen Namen geht. Schwarz, nur mit TZ, wie Tür zu.“
Dirzius lachte. Etwas Weltoffenes, Humorvolles ging von Anna Schwartz aus. Eigentlich passte sie gar nicht in diese trockene Welt der Juristen.
Auf den Mund gefallen ist sie jedenfalls nicht, dachte Dirzius zufrieden. Sein Blick huschte über die Anwesenden in der Cafeteria. Alles Juristen, Rechtsanwälte mit ihren Mandanten, Richter und Angestellte der Behörde, vermutete er. Ihm waren Gerichte ein Graus. Kurz dachte er an seine bevorstehende Scheidung von Janine. Sie würden sich in absehbarer Zeit vor dem Richter gegenüberstehen, um dann auch offiziell einen Schlussstrich unter ihre Ehe zu ziehen.
„Schießen Sie los. Was wollen Sie wissen?“, fragte Anna Schwartz, bevor sie in ihr Käsebrötchen biss und ihn aufmerksam betrachtete.
„Ich mache den Job schon fast zwanzig Jahre, habe schon für einige Redaktionen als Redakteur gearbeitet, aber eine derartige amtliche Mitteilung ist mir bisher nicht auf den Schreibtisch gekommen.“ Dirzius betrachtete sein Gegenüber neugierig. „Was ist so ungewöhnlich an diesem Fall?“, fragte er kauend.
„Nichts“, antwortete Anna Schwartz. „Das Verschollenheitsgesetz regelt klar, was im Falle eines derartigen Antrages zu tun ist. Dem müssen wir Folge leisten.“
„Was für ein Antrag?“, hakte Dirzius nach. Er langte nach seinem Schinkenbrötchen und biss herzhaft hinein.
„Es geht um einen Antrag auf Todeserklärung.“ Sie sprach das mit einer Selbstverständlichkeit aus, als würde sie mit Dirzius über das miese Herbstwetter reden. „Sabine Weber wird seit fünfzehn Jahren vermisst. Damals wurde eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben, die allerdings im Sande verlief. Jetzt wollen die Angehörigen Klarheit haben.“
„Klarheit?“ Dirzius verstand nicht. Er spülte das Brötchen mit einem Schluck Kaffee nach und verbrannte sich an der heißen Brühe prompt die Lippen.
„Ja. Niemand der Antragsteller geht davon aus, dass Sabine Weber noch lebt. Und sie wollen abschließen mit dem Fall, wollen Muße finden, um den Verlust zu trauern.“
„Ist das nicht ein wenig spät?“ Dirzius war sicher, dass er früher gehandelt hätte, wenn ihm jemand aus der Familie abhandengekommen wäre.
„Ich habe den Auftrag, sie für tot erklären zu lassen, wenn wir bis Anfang Dezember keinen konkreten Hinweis auf den Verbleib der Vermissten bekommen. Bestandteil dieser Todeserklärung ist der Aufruf in den örtlichen Medien.“
„Aber wie kommt so etwas zustande?“ Dirzius verbrannte sich erneut am Kaffee, zuckte zurück und unterdrückte einen Fluch. „Ich meine, jemand muss das Amtsgericht doch auf das Verschwinden von Sabine Weber aufmerksam gemacht haben.“
Anna Schwartz nickte. „Allerdings. Die Vermisstenmeldung lag damals bei der Polizei und staubt jetzt in den Archiven der Staatsanwaltschaft ein.“ Wieder biss sie ins Brötchen. In ihrem Mundwinkel hing etwas Butter. Schnell leckte sie die Butter mit der Zunge ab und tupfte vorsichtig mit der Serviette nach.
„Darf ich wissen ...?“
„Ihr Bruder“, erwiderte die Rechtspflegerin, als habe sie mit der Frage gerechnet. „Es war ihr Bruder, der sich gemeldet hat, um den Fall ,zum Abschluss zu bringen‘, wie er es nannte.“ Schwartz fixierte einen imaginären Punkt auf dem Tisch und dachte kurz nach. „Jakob Wallborn, so sein Name.“ Sie blickte zu Dirzius auf. „Er kann die Ungewissheit nicht mehr ertragen, will endlich einen Strich unter diese alte Sache ziehen.“
Dirzius überlegte, wie es bei ihm gewesen wäre. Geschwister hatte er nicht, bisher war Janine die Person gewesen, für die er alle Hebel in Bewegung gesetzt hätte. Oder Lisa, ihre erwachsene Tochter.
„Seit wann gilt Sabine Weber denn als vermisst?“
„Sie wurde am Neujahrstag 2001 von ihrem Mann Georg als vermisst gemeldet.“
Frank Dirzius verschluckte sich an seinem Brötchen. Er hustete, keuchte eine Entschuldigung und kippte sich den Kaffee in die Kehle. Tränen standen in seinen grauen Augen, als er sich langsam beruhigte. Die neugierigen, teils missbilligenden Blicke von den Nebentischen ignorierte er, so gut es ging.
Hameln, durchzuckte es Frank Dirzius. Ausgerechnet Hameln. Er war in der Rattenfängerstadt aufgewachsen. Sein Vater war Jurist gewesen, doch mit Gerichten wollte er nie etwas zu tun haben. Dirzius hatte der Journalismus immer schon gereizt. Trotzdem hatte sein Vater große Hoffnungen in ihn gesetzt, als er ein paar Semester Jura studiert hatte, bevor er seiner Liebe zum Journalismus nachgegeben hatte.
„Wenn du Journalismus studierst, hast du am Ende keinen Numerus clausus“, hatte Friedrich Dirzius ihn immer gewarnt.
„Aber nur, weil das Fach so anspruchsvoll ist, dass ausschließlich Genies dem Stoff folgen können“, hatte Frank immer gekontert und sich nicht um die Meinung seiner Eltern geschert. Friedrich war sicher gewesen, dass sein einziger Sohn irgendwann die gut laufende Kanzlei in der Osterstraße übernommen hätte.
Umso größer der Schock für seine Eltern, als er ein Volontariat bei der DEWEZET, der größten Zeitung im Weserbergland, begann. Es folgte der Besuch einer Journalistenschule, dann die Tätigkeit als freier Redakteur, bis er schließlich zum festen Stamm der Redaktion gehörte. Seine Eltern waren nie darüber hinweggekommen, dass er sich gegen die Übernahme der Kanzlei in der Hamelner Fußgängerzone entschieden hatte. Es war zum Streit gekommen, und irgendwann hatte Dirzius den Kontakt zu Vater und Mutter abgebrochen.
Friedrich Dirzius war mit 64 Jahren an Lungenkrebs gestorben, seine Mutter war ihm kurz darauf gefolgt. Die Ärzte im damaligen Kreiskrankenhaus Hameln-Pyrmont diagnostizierten einen plötzlichen Herzstillstand. Wahrscheinlich hatte es Margarete Dirzius nie verkraftet, dass sie nun alleine den Rest des Lebens verbringen sollte.
Am Grabe seiner Mutter hatte Dirzius bitterlich geweint und hinterfragt, ob er wirklich alles richtig gemacht hatte. Doch das war lange vorbei.
Längst schon war Frank Dirzius im Bergischen Land heimisch geworden, nichts trieb ihn nach dem Tod seiner Eltern mehr zurück nach Hameln.
„Herr Dirzius?“ Anna Schwartz rüttelte an Franks Unterarm. Sein Kopf ruckte hoch. Mit bewegungsloser Miene blickte er die Rechtspflegerin an und nickte.
„Es geht schon, danke.“ Das Brötchen schmeckte ihm plötzlich nicht mehr. Er legte den Rest auf den kleinen Teller. „Ich komme ursprünglich aus Hameln“, murmelte er leise, so, als müsse er seinen Einbruch entschuldigen.
„Ach so.“ Die Juristin nickte verstehend. „Alte Erinnerungen, was?“
Dirzius nickte und brachte ein mattes Lächeln zustande. „Aber das ist lange her.“ Er besann sich auf den Grund seines Besuches und wollte nicht unhöflich sein. „Aber wie ist es möglich, dass man jemanden, der weg ist, für tot erklären lässt? Was hat das mit dem Verschollenen ...“
„Verschollenheitsgesetz“, half die Rechtspflegerin ihm auf die Sprünge. „Solche Fälle sind im Verschollenheitsgesetz geregelt. Es berücksichtigt Fälle, bei denen Menschen verschollen oder vermisst sind. Darin sind die genauen Voraussetzungen für eine Todeserklärung der betroffenen Person geregelt. Wenn wir bedenken, dass die Person, um die es hier geht, seit fünfzehn Jahren wie vom Erdboden verschwunden ist, dann gehen wir von einer Todesvermutung aus.“
Dirzius zog seine abgewetzte Kladde aus der Sakkotasche und machte sich Notizen. Dieses Behördendeutsch hasste er wie die Pest. Er überflog seine Anmerkungen, legte die Stirn in Falten und blickte Anna Schwartz fragend an.
„Woran könnte Sabine Weber denn gestorben sein, gehen wir mal davon aus, dass sie wirklich nicht mehr lebt?“
„Ein Gewaltverbrechen scheidet aus – wir haben alle Unterlagen aus dem Zeitraum ihres Verschwindens bereits von den Kollegen der Polizei sichten lassen.“
„Also ist Sabine Weber gar nicht tot, sondern untergetaucht?“
„Das wissen wir nicht.“ Die Rechtspflegerin zuckte die Schultern.
„Nimmt die Polizei die Ermittlungen wieder auf?“, hakte Dirzius nach.
Schwartz schüttelte den Kopf. Sie drehte die Kaffeetasse in den Händen und schürzte die Lippen. „Davon gehe ich nicht aus. Das müsste die Staatsanwaltschaft veranlassen, es liegt nicht in meiner Macht ...“ Sie legte eine Pause ein und massierte die Schläfen, bevor sie fortfuhr. „Abgesehen davon – warum sollte man ermitteln, wenn, und danach sieht es aus, gar kein Gewaltverbrechen vorliegt?“ Sie kümmerte sich um den Rest ihres Brötchens und griff erneut zur Serviette.
„Machen es sich die Behörden nicht etwas einfach?“ Dirzius legte den Stift beiseite. „Was, wenn es sich bei ihrem Verschwinden um ein verstecktes Verbrechen handelt?“ Er betrachtete die Angestellte des Amtsgerichtes eindringlich.
„Gute Frage. Bei einem versteckten Verbrechen gibt es für die Polizei zunächst keinen Grund zu handeln. Man ermittelt erst, wenn es einen konkreten Anfangsverdacht gibt.“ Sie warf einen Blick auf die Armbanduhr. „Ich muss auch schon wieder los“, bemerkte sie und leerte ihren Kaffee. „Nur so viel zu Ihrem Verständnis: Wenn die Angehörigen einer vermissten Person den Antrag auf Todeserklärung stellen, muss vom Gericht zuvor ein Aufgebot in einer lokalen Zeitung veröffentlicht werden. Dem Amtsgericht obliegt es dabei, der vermissten Person oder Menschen, die etwas zum Verbleib des Menschen wissen, eine angemessene Frist festzulegen.“
Dirzius schlug die Kladde zu und verstaute sie in der Innentasche seines braunen Cord-Jacketts. „Und wenn sich niemand meldet?“
Anna Schwartz erhob sich. „Dann wird die Todeserklärung ausgesprochen, so einfach ist das.“ Sie griff in die Seitentasche ihres Jacketts und legte eine Visitenkarte auf den Tisch. „Hier“, sagte sie, während sie auf die Handynummer tippte. „Wenn Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen.“
Täuschte er sich, oder lag da ein seltsamer, nicht zu deutender Unterton in ihrer Stimme?
„Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.“ Dirzius nahm die Karte und studierte den Inhalt, dann ließ er das Kärtchen in der Tasche seines Sakkos verschwinden. Er hatte sich mehr von dem Treffen mit der Rechtspflegerin erhofft. Nun hatte er Informationen, die er auch im Internet hätte recherchieren können. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Auch der Anblick des Hinterns von Anna Schwartz, der sich zum Ausgang der Cafeteria schob, konnte nicht darüber hinwegtrösten, dass dieser Weg umsonst gewesen war. Er nahm sich vor, über den seltsamen Fall zu recherchieren. Wenn es gut lief, würde er der Polizei den konkreten Anfangsverdacht liefern.
*
Frank Dirzius hatte die amtliche Bekanntmachung an Katja aus der Grafik weitergeleitet. Der Aufruf war, ähnlich einer gestalteten Anzeige, in der neuen Ausgabe der Wuppertaler Woche erschienen. Damit hatte er seine Pflicht getan. Trotzdem ließ ihn der seltsame Fall nicht los. Es war ihm ein Rätsel, dass eine Person wie vom Erdboden verschwand.
Für ihn grenzte es an eine Ironie des Schicksals, dass die Vermisste ausgerechnet aus seiner alten Heimat kam. Was sie hier in Wuppertal getan hatte, war ihm völlig schleierhaft. War sie nur im Bergischen Land auf Stippvisite gewesen, oder hatte sie für einen längeren Zeitraum hier gelebt?
Es war Samstagabend, er saß mit einer Flasche Bier am Computer, um zu recherchieren. Der Fall der vermissten Sabine Weber ließ ihn auch am Samstagabend nicht los. Draußen pladderte der Herbstregen gegen die Fenster. Die Heizung verbreitete eine angenehme Wärme, und dennoch fröstelte Dirzius. Im Hintergrund lief der Fernseher. Das Programm interessierte ihn nicht. Die permanente Berieselung täuschte ihm vor, nicht alleine zu sein.