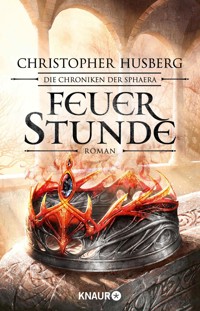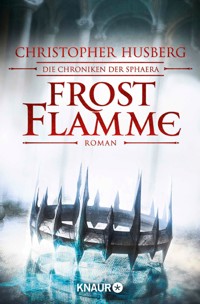6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeit der Dämonen
- Sprache: Deutsch
Der dritte Teil der epischen Fantasy-Saga »Chroniken der Sphaera« von Christopher Husberg: actiongeladene High Fantasy mit einer immer wieder überraschenden Story Endlich ist der Tiellanerin Winter die Flucht vor jenen gelungen, die ihre magischen Fähigkeiten für finstere Zwecke missbrauchen wollten. Doch als sie schließlich in ihre Heimatstadt zurückkehrt, erwartet sie dort nur neues Leid. Währenddessen stehen der ehemalige Assassine Noth und die Schwestern Jane und Cinzia vor der größten Herausforderung im Kampf für ihren neuen Glauben: Jenseits der Grenzen der Welt haben sich jene neun Dämonen erhoben, die die Kirche einst für tot erklärt hat. Ihre Macht wächst unaufhaltsam und sie verfolgen nur ein Ziel – die endgültige Vernichtung der Sphaera! »Ein eindringliches High-Fantasy Epos voller Magie und Abenteuer.« Buch-Magazin über Frostflamme In der Reihe »Zeit der Dämonen« bisher erschienen: Frostflamme: Die Chroniken der Sphaera Feuerstunde: Die Chroniken der Sphaera Blutkrone: Die Chroniken der Sphaera
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Christopher B. Husberg
Blutkrone
Die Chroniken der SphaeraRoman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Fricke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Endlich ist der Tiellanerin Winter die Flucht vor jenen gelungen, die ihre magischen Fähigkeiten für finstere Zwecke missbrauchen wollten. Doch als sie schließlich in ihre Heimatstadt zurückkehrt, erwartet sie dort nur neues Leid.
Währenddessen stehen der ehemalige Assassine Noth und die Schwestern Jane und Cinzia vor der größten Herausforderung im Kampf für ihren neuen Glauben: Jenseits der Grenzen der Welt haben sich jene neun Dämonen erhoben, die die Kirche einst für tot erklärt hat. Ihre Macht wächst unaufhaltsam, und sie verfolgen nur ein Ziel – die endgültige Vernichtung der Sphaera!
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil II
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Intermezzo
Teil III
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Teil IV
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Epilog
Dank
Für Jason
Prolog
Astrid huschte lautlos von einem Schatten eines Turmhauses zum nächsten. Es war Mitternacht, und in den Fingern – den fünf Hauptstraßen Turandels – herrschten Dunkelheit und Stille. Ihre Augen loderten, und das nicht nur im üblichen vampirischen Grün. Sie war auf Rache aus.
Trave wartete in einer Gasse in der Nähe von Olin Cabrals Turmhaus auf sie. Eines seiner Augen leuchtete rot, vor dem anderen trug er eine einfache graue Augenklappe. Astrid näherte sich dem Vampir vorsichtig. Seit er ihr einige Monate zuvor bei der Flucht vor Cabral geholfen hatte, waren sie einander nicht mehr begegnet, und sie traute ihm trotz seines damaligen Beistandes nicht. Nicht nach allem, was er früher getan hatte.
Aber sein Vorschlag, sich an Cabral zu rächen, seine Fänge zu vernichten und seine Sklaven zu befreien, war zu verlockend, als dass sie nicht darauf eingehen konnte. Sie war ohnehin an der Seite der Odeniten – der neuen Kirche Cantas, wie sie sich nun nannten – gen Süden gereist und zu dem Entschluss gekommen, dass es sich lohnte herauszufinden, ob Trave es ernst meinte.
Als sie ihn in der Gasse erblickte, mit grimmigem Gesicht, das Auge zornig rot glühend, wusste sie, dass dem so war. In seinem Auge las sie diese seltsame Emotion, die ihr bereits Monate zuvor aufgefallen war. Furcht und … noch etwas anderes. Sie wusste es nicht zu deuten.
»Ziehen wir das wirklich durch?«, fragte sie ohne Einleitung.
»Cabral ist nicht da. Ein Kinderspiel.«
Astrid stutzte. »Was soll das heißen? Was bringt dieser Angriff, wenn wir ihn nicht vernichten?« Sie konnte nicht fassen, dass er ihr das verschwiegen hatte. Zugegeben, es war nicht leicht, eine solche Nachricht über einen Boten zu übermitteln, und Astrid hatte sich in den letzten Monaten auch nie länger an einem Ort aufgehalten, aber trotzdem …
»Glaubst du wirklich, wir könnten es mit Cabral aufnehmen? Noch dazu mit all seinen Fängen?«
»Vielleicht«, erwiderte sie, obwohl sie wusste, dass das nicht stimmte, und tänzelte vor Ungeduld auf dem Kopfsteinpflaster herum. Cabral war schon länger Vampir als Astrid und Trave zusammen und bestimmt kein einfacher Gegner.
Trave knurrte: »Ich bringe uns da rein. Die Fänge sind inzwischen bestimmt halb betrunken.«
Astrid folgte ihm.
Er führte sie zu Cabrals Turmhaus und schloss die gewaltige Doppeltür mit einem zackigen Eisenschlüssel auf.
»Karg wie immer«, flüsterte Astrid und musterte die schlichten Steinwände und -böden. Nirgendwo war ein Teppich, ein Gemälde oder ein Gobelin zu sehen.
»Ist wahrscheinlich am billigsten«, meinte Trave.
Cabral hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, Kunstwerke anzuhäufen, nur um sie zu zerstören, und behauptete, dadurch mächtiger zu werden – eine Art Vampirismus in anderer Form.
»Er gibt sich mehr Mühe mit dem Beschaffen und Zerstören der Kunstwerke, als er es mit deren Erhalt hätte«, entgegnete Astrid. Sie wollte gerade weitersprechen, als sie Schritte hörte, die sich näherten.
Ein Dienstmädchen, höchstens fünfzehn Sommer alt, kam um die Ecke. Sie sah die beiden an, verharrte vor Trave und knickste.
»Meister Trave«, sagte das Mädchen. »Ich hoffe, Euch war das Glück auf Euren Reisen hold.«
Astrid hätte am liebsten die Hand ausgestreckt und das Mädchen dazu gebracht, den Kopf zu heben, damit sie ihr in die Augen sehen und sie trösten konnte. Aber Astrid war noch immer Vampirin, und das Mädchen würde nichts als Schmerz und Leid in ihren Augen sehen.
Astrid erkannte das Mädchen als jenes, das sie vor Monaten bei ihrem Treffen mit Cabral empfangen hatte. Das tief ausgeschnittene Kleid überließ wenig der Fantasie, sowohl was ihre Haut als auch was ihre Narben betraf. Frische Bissspuren und Risswunden überlagerten Schorf, unter dem sich wiederum diverse Narben abzeichneten, einige neu und rosa, andere älter. Sie zogen sich kreuz und quer über Hals und Brust des Mädchens.
Unerwartet wurde Astrid vor Scham ganz heiß. Nun bedauerte sie Cabrals Abwesenheit nicht länger, denn so konnte sie diesmal wenigstens helfen.
»Keine Angst«, sagte Astrid. Sie konnte ihre Freude kaum noch im Zaum halten, dieses ungeheure Gefühl, gegen Cabral und ihre eigene Vergangenheit zurückzuschlagen. »Ruf die anderen Dienstboten zusammen, und begebt euch an einen sicheren Ort. Dies wird die letzte Nacht eurer Knechtschaft sein.«
Das Mädchen starrte sie mit großen Augen an und schüttelte dann den Kopf. »Ich kann Euch gern in die große Halle bringen, wenn Ihr wollt.«
Sie musste Astrids Worte für einen Trick halten. Astrid konnte ihr das nicht verdenken. Sie hatte früher Ähnliches durchmachen müssen und wäre ebenso argwöhnisch gewesen. Daher wandte sie sich an Trave.
»Sie muss es von dir hören.«
Trave schaute zwischen Astrid und dem Dienstmädchen hin und her und seufzte leise. »Ich befehle es dir. Ruf die Dienstboten zusammen, und geht in eure Quartiere. Wartet dort auf uns.«
Das Mädchen knickste. »Wie Ihr wünscht.« Sie machte einen Schritt nach hinten, zögerte dann aber.
»Geh schon«, forderte Trave.
Schon eilte die Kleine den Flur entlang.
Astrid und Trave erklommen die Treppe und fanden sich im selben dunklen Gang wieder, an den sich Astrid von ihrem letzten Besuch erinnerte. Die schwarz getünchten Steinwände und der Boden verschluckten das Licht der vereinzelten Fackeln.
In dem Augenblick, in dem Astrid die große Halle von Cabrals Turmhaus betrat und in fünf leuchtend rote Augenpaare starrte, wusste sie, dass etwas nicht stimmte.
Hatte Trave sie wider Erwarten verraten? War all das hier – dass er sie befreit und hierher zurückgelockt hatte – nur ein ausgeklügeltes Spiel? Als sie Monate zuvor hier gewesen war, hatten gerade mal zwei von Cabrals Fängen den Fluch vollständig durchlaufen, aber nun hielten sich fünf Vampire und vier weitere, deren Verwandlung noch nicht abgeschlossen war, hier auf, wobei Letztere gelbe Augen und blasse, klamme Haut hatten. Cabral war augenscheinlich fleißig gewesen, und seine Anhängerschar wuchs. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
»Was hat das Mädchen hier zu suchen, Trave?«
Astrid erkannte die Frau, die das gefragt hatte, als Grendine wieder, eine derjenigen, die bei Astrids letztem Aufenthalt in Turandel noch mitten in der Verwandlung gesteckt hatten. Damit war es jetzt vorbei. Ihre Augen waren die einer ausgewachsenen Vampirin und leuchteten rot in der schwach erhellten Halle.
»Ich habe sie zurückgeholt«, erklärte Trave heiser und starrte die Fänge an.
»Trave«, flüsterte Astrid und umklammerte sein Handgelenk. Sie war bereit, es mit einer ruckartigen Bewegung zu brechen oder es wenigstens zu versuchen und dann loszurennen.
Trave sah auf sie hinab. Astrid konnte sein Mienenspiel nicht deuten.
»Das wird Cabral sehr freuen«, stellte einer der anderen Vampire fest.
»Er hat sich Sorgen um sie gemacht.«
»Das muss er jetzt nicht mehr«, antwortete Trave. Als Astrid gerade die Flucht ergreifen wollte, rannte Trave plötzlich los und stürzte sich auf den Vampir, der eben gesprochen hatte.
»Verdammt«, murmelte Astrid, um dann ebenfalls loszuschlagen und Grendine anzugreifen. Die Frau riss überrascht die leuchtend roten Augen auf, reagierte jedoch sofort und versuchte, zur Seite auszuweichen. Astrid drehte sich in der Luft und bohrte die Krallen in Grendines Schulter.
»Trave«, brüllte einer der Vampire, »was um alles in der Unterwelt …«
Es folgte ein lauter Knall, und der Mann verstummte.
»Hast du das gewusst, Trave?«, überschrie Astrid Grendines Schrei. Die Frau drehte sich kampfbereit um, war jedoch erst seit kurzer Zeit Vampirin und hatte ihre Blutrauschphase glücklicherweise bereits hinter sich. Neue Vampire machten häufig den Fehler, sich auf ihre neu gewonnene Kraft zu verlassen, und vergaßen, wie schnell sie sich tatsächlich bewegen konnten. Grendine schlug so heftig nach Astrid, dass sie ein Loch in eine Steinwand hätte hauen können, aber die Angegriffene nutzte ihre Krallen, die noch in Grendines anderem Arm steckten, um an der Wand entlangzurennen und sich auf Grendines andere Seite zu bewegen. Dabei drehte sie Grendines Kopf so heftig, dass sich die Frau fast einmal im Kreis bewegte.
»Was?«, rief Trave vom anderen Ende der Halle zurück.
»Dass wir es mit fünfen zu tun bekommen!« Ein gebrochenes Genick reichte nicht aus, um einen Vampir aufzuhalten. Grendine kam bereits wieder zu Bewusstsein und drehte den Kopf langsam wieder so, wie er gehörte.
»Mit fünfen werden wir fertig«, erklärte Trave, und als Astrid zu ihm hinübersah und feststellte, dass er es mit drei Vampiren gleichzeitig aufnahm, begriff sie, dass er vermutlich recht hatte. In den über dreihundert Jahren, die sie nun schon existierte, hatte Astrid eine ganze Menge über den Kampf gegen Vampire gelernt, doch das war nichts im Vergleich zu Traves Wissen.
Er hielt in jeder Hand einen Holzpflock.
Angespitztes Holz war gegen Vampire eine viel effektivere Waffe als Klauen. Zwar konnte man einen Vampir auch damit nicht vernichten, aber immerhin lange genug festnageln, um ihm auf andere Weise den Garaus zu machen. Die drei Vampire hatten Trave umzingelt, doch er bewegte sich zu schnell für sie, und schon bald hatte er einem Gegner einen Pflock in den Hals gebohrt. Der Vampir schnaubte und wurde augenblicklich langsamer.
Astrid erbebte. Zwar war Trave nicht mehr das Monster, das sie einst gequält hatte, aber nach wie vor ein furchterregender Kämpfer.
Sie wandte sich wieder Grendine zu, die plötzlich aufkeuchte und sich hinsetzte.
Der fünfte Vampir schlich hinter Astrid an der Wand entlang. Sie beobachtete ihn aus dem Augenwinkel, seit Grendine am Boden war. Auch für ihn war das alles augenscheinlich neu. Er schlich sich gekonnt an, doch war das eine furchtbare menschliche Taktik. Geschwindigkeit – jedenfalls die Art von Geschwindigkeit, über die ein Vampir verfügte – war weitaus effektiver.
Als sich Astrid zu dem Vampir umdrehte und ihm die langen Klauen in den Hals rammte, starrte er sie verblüfft an.
Sie fuhr die Klauen der anderen Hand aus, legte beide um den Hals des Vampirs und rammte ihm die rasiermesserscharfen Spitzen ins Fleisch. Die Haut eines Vampirs war hart, nachts sogar steinhart, doch die Krallen eines anderen Vampirs konnten sie jederzeit durchdringen.
Nun drückte sie zu, zerriss den Hals des Vampirs, bis sie sein Rückgrat berührte. Astrid packte den Knochen mit beiden Händen und zerquetschte ihn. Als sie die Arme zurückzog, die bis zu den Ellbogen voller Blut waren, fiel der Schädel des Vampirs zu Boden.
Wurde ein Vampir tagsüber verwundet, heilte er schnell. Holzpflöcke konnten Vampire bewegungsunfähig machen, aber nicht vernichten. Sonne und Feuer verbrannten einen Vampir zu einer gefühllosen, nervenlosen Hülle, die jedoch im Laufe der Zeit ihr Bewusstsein zurückgewinnen konnte. Das Einzige, womit sich ein Vampir wirklich vernichten ließ, war die Enthauptung.
Grendine stand schwankend auf. Astrid ließ ihr keine Zeit, sich zu erholen. Sie sprang vom Tisch aus auf die Schultern der Frau und schlang ihr die Beine um den Hals. Dann legte sie Grendine beide Hände an den Kopf, packte ihren Unterkiefer und zog daran. Es dauerte einen Augenblick und erforderte etwas Mühe, doch dann hatte sie Grendines Kopf vom Körper getrennt. Astrid und der Schädel fielen zu Boden.
Trave hatte einen zweiten Vampir gepfählt und stand nun dem gegenüber, der ihn angesprochen hatte. Bei ihm handelte es sich eindeutig um einen Veteranen. Sie umkreisten einander rasch, schlugen schnell zu und zogen sich wieder zurück, während sie nach Schwachstellen ihres Gegenübers Ausschau hielten.
Astrid war versucht, sich herauszuhalten. Sie konnte den Dingen ihren Lauf lassen und dann denjenigen vernichten, der sich als siegreich erwies. Auch Trave hatte den endgültigen Tod verdient. Er hatte Hunderte, wenn nicht gar mehr ermordet und Astrid mit eigenen Händen unzählige Male gequält.
Dennoch tat er gerade etwas Gutes. Er half Astrid und, was noch viel wichtiger war, er half allen, die Cabral hier in seinem Turmhaus gefangen hielt. Traves Tat musste belohnt werden.
Daher warf sich Astrid auf den letzten Vampir und rammte ihn von der Seite. Er drehte sich knurrend zu ihr um, aber Astrid hatte sich rechtzeitig von ihm gelöst und den Rückzug angetreten, daher konnte sich Trave mit einem Pflock in jeder Hand auf den Mann stürzen. Einen stieß er ihm in die Schulter, den anderen ins Herz. Der Vampir zuckte noch einige Augenblicke auf dem Boden, bis Trave sich gnädig zeigte und ihn köpfte. Den anderen beiden, gegen die Trave gekämpft hatte, erwiesen sie dieselbe Gnade.
»Wir müssen die Diener hier rausschaffen«, sagte Trave.
Astrids Blick fiel auf das brennende Feuer im Kamin am Kopfende der großen Halle. Die Flammen faszinierten sie und erinnerten sie an eine längst vergangene Zeit und ein Versprechen, das noch eingelöst werden musste. Sie träumte, sie wäre auf einem Schiff, und sie träumte von Vergeltung.
König Gainil Destrinar-Kol ließ mit finsterer Miene den Blick über die immer größer werdende Menge an Bürgerlichen im Palast schweifen. Am heutigen Anhörungstag lud die Königsfamilie das gemeine Volk von Maven Kol ein, seinem Unmut Luft zu machen und ein Urteil oder einen Rat zu erhalten. Zwar fand der Anhörungstag dreimal im Jahr statt, doch bis vor Kurzem war der Zulauf eher bescheiden gewesen. Gainil hatte es sich genau deshalb zur Gewohnheit gemacht, möglichst undurchschaubare und wenig hilfreiche Ratschläge zu geben.
Heute stellte sich indes heraus, dass diese Mühe umsonst gewesen war.
Er stand auf, und augenblicklich erhoben sich alle Anwesenden – größtenteils Bürgerliche, die auf dem Boden gekauert hatten.
Er wandte sich an Barain Seco, seinen Freund und Berater. »Sag ihnen, dass wir uns zurückziehen, um über das Problem zu beraten, unter dem sie offensichtlich alle leiden. Komm zu mir in den Beschlussraum, wenn du sie beruhigt hast, und bring deine Gattin mit.«
»Ja, Majestät.« Barain verneigte sich. Während er sich an die Menge aus verwirrten Bürgerlichen wandte, schlüpfte Gainil hinaus.
Augenblicke später stand er im Beschlussraum am Kopfende des großen eckigen Tisches. Eine Karte Maven Kols war in die Tischplatte geschnitzt. Die Büsten ehemaliger Könige von Maven Kol blickten schweigend auf ihn herab. Trotz des munteren Feuers im Kamin und seines Pelzumhangs fröstelte Gainil. Es war sehr kalt für einen Frühlingstag in Mavenil.
Hauptmann Fedrick von Gainils Leibwache, den Skarabäen, stand in der Tür des Beschlussraums. Barain und seine Gattin Jaila kamen herein, dicht gefolgt von ihrer Tochter Taira. Das Mädchen war zu einer schönen jungen Frau herangewachsen, und wenn sie nicht bereits mit Gainils Sohn verlobt gewesen wäre, hätte er überlegt, selbst um sie zu freien.
Sein Sohn Alain kam wie immer zu spät. Alains Anwesenheit war eher eine Formalität. Gainil hatte längst jegliche Hoffnung aufgegeben, dass Alain irgendetwas anführen könne, geschweige denn eine ganze Nation. Der Junge war zu fahrig und eher ein Mann der leisen Töne. Trotz seiner neunzehn Jahre wirkte er noch wie ein Kind und schien vor allem Angst zu haben.
Gainil vermisste nur eine Person bei der Versammlung, und zwar Lailana, die Frau, der er seit einiger Zeit den Hof machte. Sie entstammte einem niederen Adelsgeschlecht vom Südrand Maven Kols und war eine ungemein schlaue und schöne Frau. Gainil sah keinen Grund, sie nicht noch dieses Jahr zu heiraten. Es bestand allerdings die Gefahr, dass Alain das als Affront gegen seine Mutter ansah, die schon seit sechzehn Jahren nicht mehr unter ihnen weilte.
Gainil wischte sich die Stirn ab. Schwitzte er? Wie konnte er schwitzen, wo er eben noch gefroren hatte? »Bei Cantas blutigen Knochen, tut das gut, nicht mehr in diesem Raum zu sein. Was um alles in der Unterwelt wollen wir wegen dieses Wahnsinns, über den alle reden, unternehmen? Das scheint eine regelrechte Seuche zu sein.«
»Die Berichte häufen sich, Euer Majestät«, sagte Jaila, »und wir erhalten zunehmend belegte Hinweise von Adelsfamilien. Wir können dies nicht länger als Phänomen betrachten, das nur Verwirrte niedrigen Standes betrifft, sondern müssen anerkennen, dass es auch unter unseresgleichen auftritt.«
Unter unseresgleichen. Normalerweise hätte Gainil die Verwendung eines solchen Begriffs in seiner Gegenwart kritisiert, aber er schwieg. Schließlich mussten sie der Sache auf den Grund gehen.
»Belegte Hinweise von Adelsfamilien? Ausführlicher, Lady Jaila!«
»Die Wastrider berichteten von ihrer Tochter. Sie … sie ist die Frau, die sich vor einem Jahr das Leben nehmen wollte, aber noch rechtzeitig gefunden wurde.«
»Bei der Göttin«, flüsterte Gainil. Das hatte er fast vergessen. Das Mädchen hatte versucht, sich am Baldachin seines Bettes zu erhängen, doch hatten Diener es davon abgehalten. »Das ist doch über ein Jahr her. Was hat das mit der augenblicklichen Situation zu tun?«
»Neben ihrer sich drastisch verschlimmernden Depression weist sie einige … einige interessante Nebeneffekte auf«, berichtete Jaila.
»Doch gewiss nicht wieder dieser Überflutungsunsinn?«
»Nein«, antwortete Jaila langsam. »Angeblich kann sie … kann sie Erde und Stein bewegen, Majestät.«
Gainil lachte laut. »Erde und Stein bewegen? Dann sollten wir sie im Sandsteinbruch einsetzen und mit der Irren Geld verdienen.«
Jaila rang sich ein halbherziges Grinsen über diesen Witz ab, und Barain lachte gequält. Einige Menschen erkannten Humor nicht mal, wenn er ihnen ins Gesicht sprang.
»Haus Wastrider ist eher unwichtig«, stellte Gainil fest und winkte ab. »War das der einzige Bericht, den Ihr erhalten habt?«
»Nein, Majestät, es gab noch andere, mit mehr oder weniger demselben Inhalt.«
Alain räusperte sich. Gainil empfand diese Angewohnheit als überaus lästig. Daher ignorierte er ihn. Diese alberne Unsicherheit konnte er nicht leiden.
Inzwischen schwitzte er eindeutig. Wäre er allein gewesen, hätte er sich seines Pelzumhangs entledigt. Warum war ihm so heiß? »Keiner weiß, was um alles in der Unterwelt dort vor sich geht? Was könnte die Ursache für diese Zwischenfälle sein?«
Barain zuckte die Achseln. »Ich halte die Theorie einer Massenhalluzination noch immer für wahrscheinlich«, sagte er. »Es gibt keine andere logische Erklärung.«
Alain räusperte sich erneut.
»Euer Gnaden«, schaltete sich Hauptmann Fedrick ein und trat vor.
»Ja?«
»Wir haben alle die seltsamen Geschichten über den rodenesischen Thron gehört. Aber es gibt noch … ominösere rätselhafte Gerüchte aus denselben Kreisen. Gerüchte über Dämonen.«
»Fedrick, wenn Ihr damit andeuten wollt, dass diese letzten Zwischenfälle auf einem Dämonenfluch beruhen, dann muss ich mir wohl einen neuen Hauptmann suchen.«
»Natürlich nicht, Euer Gnaden. Ich wollte nur … sicherstellen, dass Ihr darüber informiert seid.«
Gainil verdrehte die Augen. Gab es denn in seinem ganzen Königreich niemanden, der ihm etwas Nützliches zu sagen hatte?
Er sah über die Schulter. »Könnte jemand das verfluchte Feuer löschen? Hier ist es ja heiß wie im Schmelzofen.« Das Feuer sah nicht einmal ansatzweise groß genug aus, um so viel Hitze zu erzeugen.
»Vater.«
Gainil hob die Brauen hoch, als Alain vortrat. »Ja? Hast du etwas zu sagen?«
»Ich … ich …«
Natürlich bekam der Junge wieder einmal kein Wort über die Lippen. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Entweder du redest jetzt, oder du hältst den Mund und hörst dir an, was die Erwachsenen sagen.«
Alain räusperte sich. »Ich wollte anmerken, dass es sich lohnen könnte, sich einige dieser Geschichten genauer anzuhören und die Vorstellung zu erwägen, sie könnten der Wahrheit entsprechen.«
Gainil schlug mit der Faust auf die mit der Karte verzierte Tischplatte. Er stieß Alain von sich und grämte sich deswegen nicht einmal. Sollte er doch einen seiner angeblichen Nervositätsanfälle bekommen. »Alain, mein Junge, ich gebe dir eine Gelegenheit nach der anderen, mir deinen Wert zu beweisen, und du verschwendest jede einzelne. Glaubst du wirklich, diese Gerüchte über Personen, die den Lauf von Flüssen und Bächen verändern oder die kleine Sandtornados erschaffen, wären wahr? Bist du wirklich der Ansicht, jemand besäße eine solche Macht? Wir leben in der realen Welt, Junge, nicht in einem Märchen.«
»Aber Vater, ich …«
»Ich will so etwas nie wieder hören, Junge. Wenn du das nächste Mal den Mund aufmachst, sollte besser etwas Überzeugendes oder Aufschlussreiches herauskommen.« Alain schaute sich inzwischen nicht mehr panisch im Raum um oder sah von einem zum anderen, wie er es oft tat, wenn er nervös war, sondern sah zu Boden.
»Ja …«
»Alain!« Gainil hieb erneut mit der Faust auf den Tisch, und nun sah Alain ihn an. In seinen Augen blitzte Zorn. Das ist gut, dachte Gainil. Das wurde verdammt noch mal Zeit …
Er blinzelte. »Sind das Funken in der Luft?« Im gesamten Beschlussraum waberten schwelende, knisternde orangefarbene und gelbe Funken durch die Luft.
Plötzlich stöhnte Alain auf.
»Junge, was um alles in der Unterwelt hast du …«
Das Stöhnen wurde lauter und gipfelte in einem Schrei, und Gainil ging instinktiv hinter dem Tisch in Deckung. In diesem Augenblick entstand eine ohrenbetäubende Druckwelle aus Feuer und jagte durch den Raum. Der Tisch bebte und drohte, sich aus seiner Verankerung am Boden zu lösen. Alains Schreie begleiteten das Fauchen des Feuers.
Unverhofft war es wieder ganz still.
Aber nur für einen Moment. Vorsichtig spähte Gainil hinter dem Tisch hervor und sah seinen Sohn reglos am Boden liegen. Neben ihm standen Barain und Jaila, die lichterloh brannten und schreiend versuchten, die Flammen an ihren Körpern zu löschen. Ihre Tochter brannte ebenfalls und stieß ein schrilles Kreischen aus, aber Fedrick, der mehr oder weniger unversehrt aussah, erstickte die Flammen mit seinem Cape.
Bei der aufsteigenden Göttin, dachte Gainil. Vielleicht ist an den Gerüchten ja doch etwas dran.
In einer Zeit innerhalb der Zeit an einem Ort ohne Form schimmerten schweigend zwei Wesenheiten. Eine leuchtete in einem tiefen, lodernden Purpur in den miteinander verwobenen Farben von Feuer und Blut. Das Licht der anderen war grün, das Grün eines Kiefernwaldes im Winter und eines smaragdfarbenen, facettenreichen, sich drehenden Edelsteins. Schatten, dunkler als ein Firmament ohne Mond und Sterne, tanzten zwischen ihnen.
Samann starrte die tiefrote Flamme an, die einst sein ältester Bruder gewesen war. Er erinnerte sich nicht daran, wann er Mefistons Gesicht zum letzten Mal gesehen hatte. Seitdem mussten Jahrtausende vergangen sein. Das Haar seines Bruders war dunkel gewesen, sein Gesicht hart und kantig, aber an mehr erinnerte sich Samann nicht mehr. Doch das machte nichts. Er würde dieses Gesicht ohnehin niemals wiedersehen, ebenso wenig wie sein eigenes.
»Die anderen kommen zu spät«, sagte Samann, dessen Stimme durch die Zeit innerhalb der Zeit waberte.
Mefiston erwiderte nichts.
Die beiden Brüder waren nie gut miteinander ausgekommen, aber Mefiston hätte wenigstens etwas tun können, anstatt stumm zu brennen. Mefiston war ohnehin schon einer der mächtigeren der Neun. Angetrieben von Zorn, Groll und Krieg war er der körperlich beeindruckendste von ihnen. Samann hätte diese Macht nur zu gern anstelle seiner eigenen besessen. Dann hätte er seine Brüder ganz gewiss nicht derart unhöflich behandelt.
Während Samann und Mefiston warteten, nahm ihr feuriges Licht nach und nach unscharfe Konturen an. Selbst in dieser Gestalt war Mefiston groß, breit und imposant und stellte einen deutlichen Kontrast zum sehnigen Samann dar. Rings um sie befand sich nichts und doch gleichzeitig auch alles. Samann hatte gelernt, das kakofone Wirrwarr auszublenden und sich stattdessen auf den Raum unmittelbar um ihn herum zu konzentrieren. Ein Raum, in dem ein neues, gelbes Licht erschien, von denselben Schatten verunziert, die auch in Mefiston und Samann tanzten.
»Iblin«, begrüßte Samann seinen Bruder. »Wurde aber auch Zeit.«
Das gelbliche Licht wurde immer größer. Mefiston war riesig, aber selbst er konnte es mit Iblins Masse nicht aufnehmen. Doch während Mefiston aus Muskeln bestand, konnte sich Iblin vor allem einer monströsen Leibesfülle rühmen.
»Ist Azael noch nicht da?«, fragte Iblin.
»Er lässt uns warten. Wie immer«, entgegnete Mefiston.
Ein weiteres blaues Licht erschien. Luceraf.
Ehe sie den Neuankömmling begrüßen konnten, waren sie plötzlich von Schwärze umgeben. Samann holte tief Luft. So ungern er sich in Mefistons Nähe aufhielt, Azaels Gegenwart ertrug er kaum. Er war immun gegen den Einfluss seiner Geschwister, mit Ausnahme von Azaels. Wenn Azael in der Nähe war, konnte Samann einfach nicht anders, als sich zu fürchten.
»Was ist los, kleiner Bruder?«, lachte Mefiston, doch es klang gepresst.
Samann freute sich über Mefistons zitternde Stimme. Selbst der älteste von ihnen konnte Azaels Einfluss nicht widerstehen.
»Das hat aber gedauert«, klagte Iblin mit hoher, schriller Stimme.
Samann hörte Iblin wehklagen, konnte ob der Dunkelheit jedoch nichts sehen. Er erbebte. Was Iblin geritten hatte, so mit Azael zu reden, war ihm ein Rätsel.
Ganz langsam ließ die Schwärze nach, und dann stand Azael vor ihnen. Er gab nicht wie die anderen Licht ab, sondern verschluckte es, und die Schatten, die in Samanns grüner Gestalt zuckten und waberten, streckten sich langsam nach Azael aus und flossen zu ihm.
»Wo sind unsere Schwestern?«, fragte Mefiston, »und wo ist unser Bruder Hade?«
»Hade ist zu früh aktiv geworden«, sagte Azael. »Sein Avatar wurde in Alizia besiegt.«
Mefiston knurrte: »Ich habe dem Narren gesagt, er soll warten.«
Man sollte annehmen, dass die Verkörperung des Todes geduldiger wäre, dachte Samann. Doch er schwieg natürlich. Seine Brüder hätten Kritik an Hade niemals toleriert, selbst wenn sie gerechtfertigt war.
»Bist du sicher, dass es nur seinen Avatar erwischt hat?«, fragte Luceraf langsam.
»Ja«, bestätigte Azael kalt. »Hade lebt. Aber nun wissen zumindest einige der Kreaturen, die auf der Sphaera wandeln, dass unsere Avatare verletzlich sind. Wir müssen vorsichtig sein und unsere Inkarnationen von nun an sorgfältig planen.«
Dabei war es Azael und nicht Hade gewesen, der als Erster einen Avatar losgelassen hatte. Aber Samann schwieg auch jetzt und wusste, seine Geschwister würden es ebenso halten. Azael behauptete, die Niederlage wäre Teil seines Plans gewesen, hatte ihnen aber noch nicht mitgeteilt, wie genau sie davon profitierten.
»Wir sollten schnell handeln«, sagte Mefiston. »Nadir hat sich auch einen Avatar genommen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis man sie entdeckt.«
»Du kennst die Regeln, Mefiston«, antwortete Azael. »Hade kann sich keinen neuen Avatar suchen, solange er sich nicht regeneriert hat. Das wird dauern. Damit wir alle auf der Sphaera unsere wahre Gestalt annehmen können, müssen wir zuerst alle Avatare haben.«
Danach würden sie die Sphaera mittels ihrer Avatare betreten. Das Einzige, was sie dann noch aufhalten konnte, war der Tod eines ihrer Avatare.
»Aber Nadir …«
»Kann auf sich aufpassen. Sie ist schon immer vorsichtiger gewesen als Hade, und fähiger dazu.«
»Genug«, schaltete sich Luceraf ein, deren blaues Licht heller leuchtete. »Wir sind nicht gekommen, um uns zu streiten. Was ist mit Bazlamit und Estille?«
Luceraf hatte sich auch noch keinen Avatar gesichert, doch das wollte Samann lieber nicht nebenbei bemerken. Mit Iblin wurde er fertig, aber bei Luceraf sah die Sache anders aus.
»Estille setzt ihre Arbeit in Triah fort«, erklärte Azael. »Ihr Avatar kann ihre Anhänger wirklich beeinflussen. Ich werde sie nicht von dort wegholen. Bazlamit steht kurz davor, sich ihren Avatar zu besorgen. Sie hat jemanden von großer Bedeutung im Auge, und wir dürfen sie nicht von ihrem Ziel abbringen.«
»Was ist mit der Verräterin?«, fragte Mefiston.
In der Zeit innerhalb der Zeit herrschte Stille. Nur Mefiston war so tapfer – oder so dumm –, dieses Thema vor Azael anzusprechen.
»Die Verräterin bleibt gefesselt, hat jedoch weiterhin Einfluss. Wenn Bazlamit Erfolg hat, wird sie dort auch Macht besitzen. Du bist doch auch in diesem Gebiet aktiv, oder, Luceraf?«
»Ja«, bestätigte diese. »Es kann nicht mehr lange dauern.«
»Gut. Mefiston, du hast schon die Legion infiltriert. Wenn alles nach Plan läuft, wird sie bald aufbrechen. Du bist in Cornasa aktiv, Iblin?«
»Ja«, antwortete der Hüne. Sein Licht hatte sich zu der ungemein fetten Gestalt formiert, deren Anblick Samann inzwischen gewohnt war. Zwar konnte er sich vage an Mefistons Erscheinungsbild erinnern, aber wie Iblin vor dem Verrat ausgesehen hatte, wollte ihm beim besten Willen nicht einfallen.
»Ich bewege mich gen Süden. Bald werde ich wieder einen eigenen Avatar haben.«
»Wie lange wird es dauern, bis Hade seine Kraft zurückgewonnen hat?«, fragte Luceraf. »Wir brauchen alle einen Avatar, um die Sphaera betreten zu können.«
»Konzentrier dich auf deine Arbeit«, ermahnte Azael sie. »Hades Regeneration wird bald abgeschlossen sein. Dafür gibt es diesen Ort. In der Zwischenzeit sollten wir die Außenseiter wecken.«
Bei diesen Worten horchte Samann auf.
»Wir können sie nicht kontrollieren«, warnte Iblin.
»Sie werden verwüsten«, gab Mefiston zurück. »Das ist alles, was erforderlich ist.«
»Hast du ausreichend Anhänger?«, erkundigte sich Samann. Um Außenseiter auf die Sphaera zu bringen, benötigte man Akolythen. Das eine war ohne das andere unmöglich.
»Für den Anfang, ja«, sagte Azael.
Samann atmete beruhigt auf. Immerhin hatte Azael geantwortet. Als Jüngster wurde Samann viel zu oft ignoriert.
Er durfte nicht an Azael zweifeln. Der Fürst der Angst war der Einzige der Neun, der in den letzten Millennien Einfluss auf der Sphaera gehabt hatte. Alle anderen Geschwister, auch Samann, waren nach dem Verrat völlig ausgeschlossen gewesen, jedenfalls bis jetzt.
»Ich werde meine Gefolgsleute benachrichtigen«, fuhr Azael fort, »und ich weiß auch schon, wo wir anfangen werden.«
Samann sah Azaels Gesicht nicht, nur seinen dunklen Umriss, aber er hätte schwören können, dass sein Bruder lächelte.
Teil I
Nie die richtige Wahl
Kapitel 1
Als die Sonne auf der Backbordseite aufging, sah Winter endlich den großen Hügel von Pranna, der sich aus dem Golf erhob, und die vertrauten winzigen Umrisse der Gebäude, die sich vor dem heller werdenden Himmel abhoben. Der Hügel war grün – die Schneeschmelze und der Regen waren in diesem Jahr gütig gewesen – und erinnerte Winter an die vielen Sommer, in denen sie diesen Anblick genossen hatte, wenn sie vom Segeln zurückgekehrt war.
Mit der Hilfe ihrer Telesis-Kräfte drehte sie das Schiff nach Steuerbord. Die Strahlende Prinzessin hatte die ganze Nacht hart am Wind gelegen, aber es war Winter gelungen, sie hindurchzusteuern, und der Anblick ihrer alten, vertrauten Heimat am Horizont war die Erschöpfung, die ihr in den Knochen steckte, wert. Winter stand am Steuerrad des Schiffes, während ihre unsichtbaren Tendrae den Mast stabilisierten, die Segel einholten und bei Bedarf Taue festzurrten. Das gleichzeitige Brennen und Frösteln des Faltiras jagte durch ihre Adern. Die Droge, im Allgemeinen als Frostfeuer bekannt, erlaubte es Winter, auf ihre telenischen Tendrae zuzugreifen – die unsichtbaren Erweiterungen ihres Ichs, die es ihr erlaubten, mit jedem nicht lebendigen Objekt in ihrer Reichweite zu interagieren, was in diesem Fall so gut wie jedem Teil des Schiffes entsprach. Ihre Reisegefährten Urstadt und Galce packten mit an, wo sie konnten, aber Winter hatte festgestellt, dass sie selbst schwierige Manöver relativ problemlos allein bewerkstelligen konnte. Sie bedauerte nur, dass ihr Vater nicht mitansehen konnte, wie geschickt sie das Schiff lenkte.
Außerdem fühlte es sich gut an, die Psimantie zur Abwechslung gewaltfrei einzusetzen.
Schritte ließen das Deck hinter ihr knarren.
»Das ist deine Heimat?«, fragte Urstadt und trat neben Winter.
Am Bug lief Galce gerade noch rechtzeitig zur Reling, um seinen Mageninhalt in die Wellen zu erbrechen. Der Schneider hatte sich als nicht sonderlich seetauglich erwiesen, auch wenn er in Izet freiwillig an Bord gegangen war. Zwar gab er nach einigen Erklärungen durchaus einen passablen Seemann ab, doch brauchte er immer wieder Pausen, wenn ihn seine Seekrankheit einholte.
Im Gegensatz zu Galce hatte Urstadt die Reise wie jemand überstanden, der auf dem Wasser geboren und aufgewachsen war. Nur ihre Rüstung hatte Anlass zum Konflikt gegeben, da Winter strikt gegen den Kettenpanzer und die Brustplatte der ehemaligen Hauptfrau der kaiserlichen Wache von Izet gewesen war. Am Ende hatte sich Urstadt überzeugen lassen, doch Winter hatte sich an Urstadts Anblick in einer schlichten Hose und einer langen, weiten Tunika noch immer nicht gewöhnt. Der Wind fegte Urstadt das braune Haar ins Gesicht, und ihre Haut war viel gebräunter, als es Winter unter den vielen Rüstungsteilen für möglich gehalten hätte.
»Das war meine Heimat«, entgegnete Winter und sah nach Pranna hinüber. Sie war nicht sicher, ob sie noch immer hier zu Hause war. Doch dies war der letzte Ort, an dem sie sich wie eine Person und nicht wie eine Waffe gefühlt hatte. Nun war sie zurückgekehrt, um sich erneut so zu fühlen, falls das denn möglich war. Sie hoffte, dass ihr dieser Ort erneut wie ein Zuhause vorkommen würde, sobald sie die Schmiedestochter an den Docks erblickte und Gord, Darrin und Eranda sah.
Das Schiff ihres Vaters lag nicht im Hafen. Vielleicht waren Gord und die anderen damit unterwegs, aber in diesem Fall hätte sie sich gewünscht, es wenigstens auf dem Weg hierher zu sehen. Schließlich hatte sie aus genau diesem Grund die Route gewählt, die die Schmiedestochter morgens immer nahm.
Zusammen mit Urstadt und Galce überquerte sie den hölzernen Pier und hielt auf den Weg zu, der zum großen Hügel und in die Stadt führte. Urstadt hatte ihre Rüstung direkt nach Verlassen des Schiffes wieder angezogen, und ihre rot vergoldete Barbuta hing an ihrer Hüfte. Galce trug nun einen eleganten, gut sitzenden Anzug – Winter war immer wieder aufs Neue erstaunt, wie viele Kleidungsstücke sich in seinem Rucksack zu befinden schienen –, während Winter in ihr eng anliegendes schwarzes Leder gekleidet war. Sie besaß keine Siara und hatte schon gut ein Jahr keine mehr getragen. Bisher hatte sie geglaubt, sich an das Leben ohne dieses breite Stoffstück um den Hals gewöhnt zu haben, aber als sie sich ihrer alten Heimat näherte, fühlte sie sich auf einmal nackt.
Beklommenheit machte sich in ihr breit, und die Aufregung, die sie beim Gedanken daran, nach Hause zurückzukehren, verspürt hatte, wich kalter dunkler Furcht.
Da war auch noch etwas anderes. Etwas, woran sie die ganze Zeit nicht hatte denken wollen, das sich jetzt jedoch nicht länger vermeiden ließ.
Sie würde Lians Eltern sagen müssen, was ihm zugestoßen war.
Igriss und Huro waren ihr zwar stets freundlich begegnet, aber Winter hatte sich ihnen nie so nah gefühlt wie Darrin und Eranda, Gord oder Lian. Sie sprachen wenig, sonderten sich selbst unter Tiellanern ab, und Lian war ihr einziges Kind.
Winter hatte keine Ahnung, was sie ihnen sagen sollte.
»Das erinnert mich an einen Ort, den ich früher einmal kannte«, meinte Galce. »In Andrinar.«
»Welches Dorf war das?«, fragte Winter. Sie wusste nichts über Andrinar, und Galce hatte im Verlauf der Reise nicht viel von sich preisgegeben.
Dieses Schweigen gedachte er offenbar fortzusetzen. Winter beschloss, nicht nachzuhaken.
Sie erstiegen zusammen den großen Hügel, wobei Galce und Urstadt Winter in die Mitte nahmen. Die Stadt, die sie vor sich sahen, glich nicht dem Pranna, das sie kannte.
Zunächst einmal war sie deutlich größer. Solange Winter denken konnte, hatte sich die Ansiedlung stets um eine Hauptstraße geballt, aber nun führten zwei neue Straßen parallel zur alten durch den Ort. Zwei neue Straßen, an denen neue Gebäude standen, darunter auch eine cantische Kapelle, die einst am Westrand von Pranna zu finden gewesen war.
Winter griff in den Beutel an ihrem Gürtel und nahm einen Faltira-Kristall heraus. Cova – jetzt Kaiserin Cova – hatte ihr den restlichen Faltira-Vorrat des verstorbenen Kaisers Daval überlassen, der aus fast zweihundert Kristallen bestand. Ein Vermögen. Winter hatte versucht, sich einzuschränken und nur etwa jeden zweiten Tag einen zu nehmen, aber nun konnte sie nicht anders, obwohl das Hoch vom Schiff gerade erst abebbte. Sie schluckte einen Frostkristall, als sie sich gen Osten zum tiellanischen Viertel wandten. Zum Glück sah diese Gegend noch so aus wie früher: ein schmaler, ungepflasterter Weg, der zu mehreren Hütten führte. Winter konnte ihr Heim ausmachen, die Hütte, in der sie mit ihrem Vater gelebt hatte, und fragte sich, wer wohl heute dort wohnte.
»Kommt«, sagte sie und wies auf die Hütten. Sie erschauerte, da das Faltira-Feuer bereits in ihr loderte. »Dort entlang.«
Sie erkannte auf dem Weg durch die Stadt einige Gesichter, aber niemand begrüßte sie, obwohl auf den Straßen einiges los war. Schon früher hatte es in Pranna nur wenige Tiellaner gegeben, doch jetzt sah sie keinen einzigen. Der Schmied Grind wandte sich ab, als sie an seiner Werkstätte vorbeikam. Der Mann war ein Freund ihres Vaters gewesen, hatte den Kontakt aber Jahre zuvor abgebrochen. Einige Händler kamen ihr bekannt vor, aber sie drängten sich zusammen und schienen ins Gespräch vertieft. Ihr fiel sogar eine cantische Elevin ins Auge, die Frau, die während des Massakers bei Winters Hochzeit weggelaufen war. Nach dem Angriff hatte Winters frisch angetrauter Gatte Noth fliehen müssen, woraufhin es sich Winter zur Aufgabe gemacht hatte, ihn zu finden. Das alles schien so lange her zu sein. Winter sehnte sich danach, dass die Menschen in Pranna sie erkannten und sie begrüßten, doch bei der Elevin erging es ihr anders. In diesem Fall war Winter froh, dass sich die Frau abwandte und sich ihrem Geschäft mit dem Gerber widmete.
Als sie sich dem tiellanischen Viertel näherten, stellte Winter erschrocken fest, wie still es dort war. In Pranna herrschte reges Treiben, und die Luft war wie immer von Geräuschen erfüllt. Im tiellanischen Viertel sah die Sache anders aus. Hier war weder etwas zu hören noch jemand zu sehen. Alles war wie ausgestorben.
Urstadt und Galce liefen schweigsam neben ihr her, was Winters Beklemmung nur weiter steigerte. Sie wünschte sich, die beiden würden irgendetwas sagen, aber ausgerechnet jetzt hielten sie den Mund.
Da Darrins und Erandas Hütte am nächsten war, ging Winter zuerst dorthin. Efeu wand sich an der Seite des Gebäudes entlang, die Tür stand offen, und drinnen war es dunkel. Winter steckte trotzdem den Kopf hinein und klopfte an den Türrahmen, bekam aber keine Antwort.
»Hallo?«, rief sie. »Darrin? Eranda?«
Die Hütte war leer. Nicht nur die Bewohner waren verschwunden, auch alle Möbelstücke. Unkraut wucherte aus dem einst sorgsam gekehrten Boden. Winter erinnerte sich noch gut, wie sie auf dem nun nicht mehr vorhandenen Tisch ihren Rucksack gepackt hatte. Nachdem Noth gegangen war. Sie sah sich neben Lian vor der Feuerstelle sitzen, ehe sie Pranna gemeinsam verlassen hatten. Damals war Lian trotz ihrer Heirat vermutlich noch in sie verliebt gewesen. Doch heute weilten Lian wie Noth nicht mehr unter den Lebenden.
»Hier ist niemand.« Winter sprach das Offensichtliche aus, weil sie die Stille nicht länger ertrug.
»Das tut mir leid, meine garice«, antwortete Galce leise. »Es sieht so aus, als würde hier schon länger niemand mehr wohnen.«
Trotz ihrer Verwirrung und der Leere, die sich in ihrer Brust ausbreitete, war Winter froh, dass Galce etwas gesagt hatte. Die Stille machte ihr schwer zu schaffen.
Sie nickte. Seine Worte entsprachen der Wahrheit, aber sie war nicht den weiten Weg hergekommen, um nach nur einem Haus aufzugeben. »Ich muss auch in den anderen Hütten nachsehen. Nur, um sicherzugehen.«
Aber auch Gords, Dents und Lians Haus waren verlassen.
Zu guter Letzt fand sie sich vor der Hütte ihres Vaters wieder. Wände aus Treibholz, ein gedecktes Dach. Einfach, aber es hatte sie vor dem Schnee und der Sonne geschützt. Als Winter die Hand ausstreckte, um die Tür zu öffnen, schloss sie die Augen.
Sofort stellte sich das Chaos ein, rein und weiß wie frisch gefallener Schnee.
Winter schlug die Augen auf und keuchte. Was konnte es schaden, ihr altes Haus zu betreten? Vielleicht würde sie dann wenigstens irgendetwas empfinden. Sie war hergekommen, um ihre Heimat wiederzufinden und sich wieder wie früher zu fühlen. Um die Gewalt hinter sich zu lassen, die während des vergangenen Jahres ihre ständige Begleiterin gewesen war. Während der Frost noch immer in ihr brannte, überlegte sie, ob sie ihre Tendrae in die Hütte ausstrecken sollte.
Stattdessen zog sie die Hand zurück.
»Wir tun, was uns das Chaos gebietet«, flüsterte Galce.
Winter warf ihm einen durchdringenden Blick zu. Er hielt den Kopf gesenkt und sah ihr nicht in die Augen. Ehe Winter etwas erwidern konnte, sprach er weiter: »Ich spüre das Chaos hier, meine garice. Auch wenn ich nicht weiß, warum es zu dir kommt oder welche Entscheidungen du treffen musst, spüre ich seine Gegenwart.«
Urstadt verharrte auf Winters anderer Seite und hielt sich pflichtbewusst aus der Unterhaltung heraus. Sie hatte klar zu verstehen gegeben, dass sie Galces chaotische Religion – und somit auch Winters Verstrickung darin – nicht als ihre Angelegenheit ansah.
»Das ist ja schön und gut«, erklärte Winter nach einem Augenblick, »aber hier gibt es nichts für uns.« Sie wandte sich von der Hütte ab und machte sich auf den Rückweg nach Pranna.
Als sie durch die Stadt gingen, erkannte sie jemand.
»Ich weiß, wer du bist.«
Winter drehte sich beim Klang der Stimme um, doch ihr wurde bereits das Herz schwer, ehe sie den Sprecher erblickte. Der Akzent war menschlich, nicht tiellanisch, und sie kannte die Stimme nicht.
Ein Mann glotzte sie mit zusammengekniffenen Augen an.
»Du bist das tiellanische Mädchen, das früher hier gelebt hat«, sagte er. Er war groß, hatte noch keine dreißig Sommer gesehen, bekam aber schon schütteres Haar.
Ein weiterer Mann trat neben ihn. Dieser war kleiner und hatte einen dichten schwarzen Bart. Beide überragten Winter deutlich. Im Allgemeinen waren Menschen größer als Tiellaner. »Du bist die Kleine, die einen Menschen geheiratet und die Stadt verlassen hat«, meinte der andere Mann.
Die Männer musterten Galce und Urstadt, die rechts und links neben Winter standen.
»Arbeitet sie für euch?«, fragte einer der Männer.
»Im Gegenteil«, antwortete Galce lächelnd. »Wir sind ihre Untergebenen.«
Urstadt wollte sich zwischen Winter und die beiden Menschen stellen, aber Winter legte der Frau eine Hand auf die Schulter.
»Ich regle das schon, Urstadt.«
Mit einem Nicken blieb Urstadt an Winters Seite. Die beiden Männer sahen einander an. Einige andere waren auf der Straße stehen geblieben und beobachteten sie.
»Wo sind die anderen Tiellaner geblieben?«, wollte Winter wissen. Aber die Frage war überflüssig. Sie streckte bereits zwei acumantische Tendrae in den Geist dieser Männer aus.
Während ihre telenischen Tendrae nur nicht lebendige Objekte beeinflussen konnten, galt für ihre acumantischen das genaue Gegenteil: Damit war nur eine Interaktion mit einem Verstand möglich. Psimanten konnten normalerweise nur eine Form von Tendrae nutzen, aber aus irgendeinem Grund stellte Winter eine Ausnahme von dieser Regel dar. Es gab auch noch eine dritte Form der Psimantie, Hellsicht, mit der eine Person Einblick in die Zeit selbst erlangen konnte, aber diesen besonderen Bereich beherrschte Winter nicht.
»Sie sind gegangen«, entgegnete einer der Männer schließlich. »So, wie du es auch tun solltest.« Für wen hält sich diese Tiellanerin?, dachte der Mann.
»Für Tiellaner gibt es in Pranna keinen Platz mehr«, fügte der andere hinzu und musterte Winter von Kopf bis Fuß. Seine Gedanken bestanden weniger aus Worten, sondern aus einem Gefühl, das Winter an eine Gasse in Cineste und einen Augenblick aus einem anderen Leben erinnerte.
Diesmal aber besaß Winter Macht.
Sie tauchte mit ihren Tendrae in die beiden Männer ein, und schon überflutete ein Schwall aus Informationen Winters Bewusstsein. Wer die beiden waren (Harn Alasta hieß der Große und Breggan Dones der Kleine), woher sie stammten (Harn aus Cineste, Breggan aus Pranna – daher kam er Winter so bekannt vor), woher sie einander kannten (aus dem Spielhaus – Winter fragte sich, seit wann es in Pranna ein solches gab), wer ihre Familien waren, wo sie politisch standen, welche Fehler sie gemacht, wen sie geliebt hatten und vieles mehr.
Winter ging das alles nach den gesuchten Informationen durch. Schließlich entdeckte sie sie in Breggans Geist: Die Menschen hatten vor einigen Monaten die letzten Tiellaner aus Pranna vertrieben. Breggan wusste nicht, wohin sie gegangen waren, aber er hatte gehört, dass sich in letzter Zeit immer mehr Tiellaner in Cineste ansiedelten.
»Cineste«, flüsterte Winter.
Die beiden starrten sie an. Winters acumantische Recherche hatte nur Sekunden gedauert und war unbemerkt geblieben. Die beiden Männer hatten gar nicht gemerkt, was passiert war, und würden es nie erfahren. Es gab noch andere, drastischere Methoden der Acumantie, an denen sich Winter jedoch noch nicht versucht hatte. Der Geist dieser Männer war leicht zu lesen gewesen, und anders kannte sie es auch gar nicht.
Harn kam mit zusammengekniffenen Augen einen Schritt auf sie zu.
»Es wäre besser für dich, wenn du es genauso hältst, Elfe«, drohte er ihr leise.
Winter ballte eine Faust. Eine kleine Menschenmenge hatte sich um sie herum versammelt, um die Konfrontation zu beobachten. Keiner schritt ein, niemand kam ihr zu Hilfe.
»Sei vorsichtig«, sagte Urstadt.
An jedem anderen Tag hätte sich Winter vielleicht umgedreht und wäre einfach gegangen. In jeder anderen Stadt hätte sie die Sache möglicherweise auf sich beruhen lassen. Aber ihre Heimat gab es nicht mehr. Für sie gab es nichts mehr in Pranna. Ein Zuhause, in dem die Personen, die es dazu gemacht hatten, nicht mehr lebten, hatte diesen Namen nicht verdient.
Wertlose Menschen wie Harn hatten sie vertrieben. Harn, dessen Fehler für jeden Acumanten auf den ersten Blick erkennbar waren: Er war ein Mann, der seine Frau schlug, wenn er getrunken hatte, was er viel zu häufig tat. Harn hatte die Tiellaner schon immer als minderwertig angesehen. Jahre zuvor hatten noch ein Kreuz und ein Halbmond die Innenseite seines Handgelenks geziert.
Harn, der Kamit. Breggan gehörte auch dazu, hatte die Tätowierung jedoch erst vor Monaten erhalten.
Um zu zerstören, muss ich zuvor lieben.
Die Worte gingen ihr unerwartet und ungebeten durch den Kopf. Inzwischen galten sie für Winter nicht mehr. Sie hatte Daval Amok getötet, und nun, da seine Tochter auf dem Kaiserthron saß, war seine lächerliche Philosophie zusammen mit ihm in Roden gestorben, und dennoch … sie hatte den Geist dieser beiden Männer gelesen, ihr Leben und alles, was sie ausmachte, gesehen. War es nicht Liebe, wenn man die Fehler anderer kannte und akzeptierte?
Winter runzelte die Stirn. Sie konnte die Fehler dieser Männer nicht akzeptieren. Dazu wäre sie niemals in der Lage. Das überließ sie lieber einer höheren Macht. Sie schloss die Augen und suchte das Chaos, wie Galce es ihr beigebracht hatte, stellte sich eine perfekte Kugel vor. Die Kugel war schwarz. Das Chaos hatte entschieden.
Sie schlug die Augen wieder auf und schickte einen psionischen Impuls in den Geist beider Männer – eine Welle aus Energie, die an den beiden Tendrae, die Winter mit den Männern verband, entlangpulsierte und beide tötete. Harn und Breggan sackten leblos zu Boden.
Viele in der kleinen Gruppe, die sie umringte, keuchten auf. Einige liefen zu den Toten. Andere starrten Winter bestürzt an.
Sie wandte sich ab, und Urstadt und Galce folgten ihr widerstrebend, jedoch keiner der anderen.
»War das nötig?«, fragte Urstadt, als sie zum Schiff zurückgingen.
»Sie hat getan, was das Chaos verlangt«, erläuterte Galce. »Doch das Chaos ist ein unergründlicher Meister. Ich habe Jahre gebraucht, um seine Anweisungen zu begreifen. Wenn mir die Bemerkung gestattet ist, meine garice … ich würde raten, den Anweisungen des Chaos nicht blindlings zu folgen, wenn es sich vermeiden lässt. Es ist klüger zu verstehen …«
»Ich habe getan, was ich tun musste, und das ist alles, was zählt«, fiel Winter ihm ruhig ins Wort. Galces Einwand behagte ihr nicht. Zuerst überzeugte er sie, auf das Chaos zu vertrauen, und nun riet er zur Vorsicht?
Dafür hatte sie keine Zeit. Nicht jetzt.
»Wir fahren nach Cineste.«
Kapitel 2
Elevin Cinzia.«
Cinzia blinzelte, schaute zur Seite und stellte fest, dass Elessa neben ihr stand. Sie wusste nicht, wie oft die andere Elevin ihren Namen schon geflüstert hatte, aber dies war offensichtlich nicht der erste Versuch, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Elessa zog die Brauen zusammen.
»Ja«, flüsterte Cinzia und schämte sich ein wenig dafür, dass sie sich während Janes Magnifikal hatte ablenken lassen. Sie räusperte sich. »Ja?«, fragte sie und sah Elessa in die Augen.
Magnifikal war ein Wort, das Cinzia und Jane aus dem Kodex übersetzt hatten. Es bedeutete in etwa »Gläubigkeit«, soweit Cinzia es verstand, und Jane hatte sich angewöhnt, die täglichen Andachten, die sie für die stetig wachsende Zahl ihrer Anhänger, die Odeniten, abhielt, so zu nennen.
»Sie werden uns nicht durchlassen«, sagte Elessa.
Noth, der neben Cinzia stand, beugte sich zu ihr hinüber. »Wer?«
»Es wäre vermutlich besser, wenn du es dir selbst ansiehst, Cinzia.«
Cinzia und Noth folgten Elessa durch die Menge.
Sie waren am Vorabend eingetroffen und hatten ihr Lager in der Mitte eines riesigen, noch ungepflügten Feldes nördlich der Stadtmauern von Kirlan aufgeschlagen. Das Feld gehörte einem hiesigen Lord namens Alam Derard. Der Mann besaß in Kirlan große Macht, war jedoch mit seinen engsten Angehörigen in den Norden zum Familienanwesen der Odens in Harmoth gereist, als er von der Odenitenbewegung erfahren hatte. Er hatte sich der neuen Religion rasch angeschlossen und den Odeniten sein Feld sowie all seine Feldfrüchte und Ressourcen zur Verfügung gestellt. Cinzia war das sehr unangenehm, denn die Odeniten konnten Derard ruinieren, aber das schien Lord Derard nichts auszumachen, der Jane ebenso treu ergeben war wie all ihre anderen Anhänger.
Nun standen sie, Noth und Elessa zwischen den mehr als fünfzehnhundert Odeniten, auf die die Sonne herabbrannte. Der Großteil hatte sich um ein Podest in der Mitte des Feldes versammelt, auf dem Jane stand und zur Menge sprach. Eine auserkorene Gruppe trug die Plattform, wenn sie weiterreisten, und baute sie jeden Tag wieder zusammen, damit Jane darauf ihr Magnifikal abhalten konnte. Zum Glück bot Derards Land weitaus mehr Platz, als die Odeniten benötigten – vorerst jedenfalls, doch es wurden immer mehr. Als die Göttin Canta Jane aufgefordert hatte, mit den Odeniten gen Triah zu ziehen, waren es noch nicht einmal eintausend gewesen. Doch Jane und die Kirche Cantas hatten immer mehr Zulauf, und es war, als wüssten die Leute genau, wo die Prophetin zu finden war.
Sie kamen Triah täglich näher. Cinzia spürte gleichzeitig eine wachsende Furcht und Aufregung bei dem Gedanken, die Runde Stadt wiederzusehen. Ihre Heimatstadt Navone würde stets einen Platz in ihrem Herzen haben, aber Triah stand ihr noch viel näher – der Ort, an dem sie sich erstmals ganz dem Dienste Cantas verschrieben hatte, lange bevor sie nach Hause gekommen war, um die Ketzerei ihrer Schwester aufzudecken. Sie konnte nur hoffen, dass sich dieses Gefühl nicht veränderte, wenn sie als Elevin der Kirche Cantas statt als Priesterin der Denomination zurückkehrte.
»Lass dich nicht beirren«, sagte Elessa, der Cinzias Gesichtsausdruck nicht entging. »Unsere Reise ist bisher recht ereignislos verlaufen, doch früher oder später war eine Prüfung zu erwarten.«
Wirklich?, dachte Cinzia. Natürlich hatte Elessa recht. Sie hatten mehr als zwei Monate gebraucht, um so weit zu kommen. Abgesehen von Berichten ihrer Späher, denen zufolge die Splittergruppe der Hexe ihnen dicht auf den Fersen folgte, hatte es nur wenig Besorgniserregendes gegeben. Canta hatte für sie gesorgt – jedenfalls behauptete Jane das. Cinzia vermutete, dass es der Wahrheit entsprach, denn wann immer ihnen die Ressourcen ausgingen, fanden sie Nahrung, Wasser oder was auch immer sie noch benötigten. Nun, wo sie Kirlan erreicht hatten, war auf einmal Fürst Derard in Erscheinung getreten.
»Vermutlich hast du recht«, antwortete Cinzia schließlich und seufzte.
Sie schritten zu dritt durch die Reihen der Odeniten, die ihnen sofort Platz machten.
»Wäre es nicht besser, wenn wir deine … deine Tochter bei uns hätten, Noth?«, erkundigte sich Elessa.
Noth knurrte: »Woher soll ich das wissen? Du hast uns ja nicht verraten, wohin wir gehen oder was uns dort erwartet.«
Cinzia war froh, dass Elessa endlich wieder mit Noth redete. Er hatte sie bei einem seiner Anfälle auf dem Anwesen der Harmoths angegriffen. Zwar war es nicht Noth gewesen, aber immerhin sein Körper, und Elessa hatte den Unterschied zu jener Zeit noch nicht gekannt. Je mehr Cinzia über Noth erfuhr, desto größer wurde ihre Faszination für diesen Mann. Noth war vor über zwei Jahren in einer tiellanischen Stadt aufgewacht, ohne jegliche Erinnerung daran, wer er war oder woher er stammte, und hatte am Ende herausgefunden, dass er nicht wirklich das Gedächtnis verloren, sondern vielmehr auf irgendeine Art durch eine psimantische Verschmelzung von Sifts – den kondensierten Essenzen anderer Personen – entstanden war. Vor einigen Monaten hatten diese Sifts ein Eigenleben entwickelt und begonnen, die Kontrolle über Noths Körper zu übernehmen. Bei diesen Anfällen wäre Noth fast völlig vernichtet worden – und er hatte auch für sehr viel Ärger gesorgt, da einige der Sifts ausgesprochen gewalttätig waren –, aber seit der Heilung des Nazaniin-Psimanten Wyle ging es Noth glücklicherweise deutlich besser. Cinzia war sehr froh, dass Elessa etwas selbstbewusster geworden war und sich nicht mehr scheute, Noth anzusprechen. Noths »Tochter« – das Vampirmädchen Astrid – galt unter den Odeniten nahezu als Legende. Der Großteil wusste zwar nicht genau, was sie wirklich war, doch die Odeniten, die sich ihnen schon auf Harmoth angeschlossen hatten, ahnten es. Schließlich hatten sie Astrids Taten im Kampf gegen die Kamiten mit eigenen Augen gesehen.
Elessa hatte die wahre Natur des Mädchens akzeptiert. Alle Elevinnen wussten davon, weil Jane darauf bestand, dass es innerhalb ihrer kleinen Gruppe keine Geheimnisse geben durfte. Cinzia hielt ihre Schwester in dieser Hinsicht für eine Heuchlerin. Als Prophetin hatte Jane eine direkte Verbindung zu Canta, doch sie teilte den anderen die Worte der Göttin nur mit, wenn sie es für notwendig hielt.
»Ich wollte nicht aufdringlich sein, Noth, aber ich dachte …«
»Bei der aufsteigenden Göttin«, flüsterte Cinzia.
Das Feld, auf dem sich die Odeniten versammelt hatten, schmiegte sich an die Nordmauer Kirlans. Die Stadt lag auf einer Klippe, die über den Ozean hinausragte, und ihre Westmauern standen direkt am Rande des Abgrundes. Ein breiter Graben verlief vor der Ostmauer, auf dessen anderer Seite dichter Wald begann. Das große Stadttor direkt voraus war der einzige Zugang zum Ort, den Cinzia sehen konnte.
All dies war von jedem Ort auf Derards Feld deutlich zu erkennen, aber was sie aufkeuchen ließ, war der Anblick der Söhne Cantas, die mit glänzenden Rüstungen und rot-weißer Livree vor dem Tor aufmarschiert waren.
Angst stieg in Cinzia auf. »Wo sind die Prälaten?« Jane hatte die von Noth gegründete Wache – angeführt von ihrem Bruder Eward – einige Wochen zuvor zu Prälaten ernannt. Cinzia kannte den Grund dafür nicht. Sie hatten dieses Wort zwar in den Neun Schriften gelesen, doch keinen Hinweis auf seine Bedeutung gefunden. Jane schien sich ihrer Entscheidung allerdings sicher gewesen zu sein.
»Zwei Einheiten stehen direkt hinter uns. Es müssten etwa sechzig Soldaten sein«, entgegnete Noth. »Eine weitere befindet sich an jeder Flanke, und zwei bilden die Nachhut.«
Diese Worte beruhigten Cinzia etwas. Die Prälaten hatten ihre Ausbildung während der Reise fortgesetzt, wobei Noth und Eward sie anleiteten und Astrid sie gelegentlich unterstützte, daher war Cinzia hinsichtlich ihrer Fähigkeiten einigermaßen guter Dinge.
Doch die Söhne Cantas trainierten schon weitaus länger, und Cinzia beschlich der Verdacht, dass es sich bei den Soldaten, die sie dort vor sich sah, bei Weitem nicht um die einzigen handelte, die in Kirlan stationiert waren.
»Wir sollten mit ihnen reden«, beschloss Cinzia. »Aber mir wäre es lieber, wenn wir weitere Prälaten herriefen.«
»Bereits geschehen«, erwiderte Noth und gab den Prälaten in ihrer Nähe ein Signal. Fünf Krieger traten näher.
»Nur fünf?«, fragte Cinzia und wischte sich die feuchten Handflächen am Kleid ab. »Sollten uns nicht mehr begleiten?«
»Wir wollen nicht zu angriffslustig auftreten«, erläuterte Noth. »Außerdem sind sie nicht hier, um uns anzugreifen. Jedenfalls noch nicht. Sie verteidigen die Stadt.«
»Sie verteidigen die Stadt? Etwa gegen uns?«, fragte Elessa perplex.
»Davon gehe ich aus.«
»Na gut«, meinte Cinzia, die sich ihres Erscheinungsbildes auf einmal überdeutlich bewusst war. Seit sie über acht Jahre zuvor zum ersten Mal nach Triah gereist war, hatte sie keiner Gruppe von Söhnen ohne ihre cantischen Roben und die Trinacrya gegenübergestanden. Im Augenblick trug sie aber nur ein schlichtes, hellrot gefärbtes Wollkleid. »Wir werden schon herausfinden, was sie wollen. Überlasst das Reden mir.«
Cinzia machte sich auf den Weg zum Tor, Elessa und Noth an ihrer Seite. Die fünf Prälaten folgten ihnen in geringem Abstand. Als sie ein Stück vom Tor entfernt stehen blieben, ergriff einer der Söhne das Wort.
»Halt! Wer seid Ihr, und was führt Euch nach Kirlan?«
Daraufhin trat Cinzia einen Schritt vor und räusperte sich. »Mein Name ist Cinzia Oden. Ich bin …«, sie zögerte einen kurzen Augenblick, »eine Elevin der Kirche Cantas. Wir ersuchen um freies Geleit durch Kirlan, damit wir unsere Reise fortsetzen können.«
Der Mann sah ihr nicht in die Augen. »Wir haben den ausdrücklichen Befehl, Euch nicht durchzulassen, Herrin Cinzia. Tut mir leid.«
Herrin Cinzia. Nicht länger Priesterin Cinzia.
Wider Erwarten musste Cinzia schmunzeln. »Ihr wollt uns doch gewiss nicht den Zugang verwehren«, sagte sie und breitete die Arme aus. »Wir sind keine kleine Gruppe, wie Ihr seht, und überdies sehr effizient. Daher würden wir auch nicht länger als nötig in der Stadt verweilen.«
»Wir beschützen nicht die Stadt, Herrin.«
Nein, begriff Cinzia, sondern Triah, das Seminar und Cantas Tempel.
»Aber wir können Kirlan nicht umgehen«, gab Cinzia zu bedenken. »Im Westen versperren uns die Klippen den Weg, und eine so große Gruppe kann unmöglich durch den Forst im Osten reisen. Der einzige Weg in den Süden führt durch Kirlan.«
»Genau darum geht es, Herrin. Wir dürfen nicht zulassen, dass Ihr noch weiter nach Süden gelangt.«
»Seid Ihr der Befehlshaber dieser Kompanie?«, fragte Cinzia und deutete auf die anderen Söhne, die das Tor bewachten.
»Ich bin der Befehlshaber des Regiments, das in Kirlan stationiert ist.«
Sie mahlte mit dem Kiefer. Zuerst hatte die Denomination eine Hexenjägerin nach Navone geschickt, danach die Nazaniin-Attentäter nach Harmoth und jetzt das, die alltäglichste Gefahr, der sich Cinzia im Verlauf des letzten Jahres hatte stellen müssen, und sie war möglicherweise dazu in der Lage, die Odeniten aufzuhalten.
Zudem hatte die Denomination ein ganzes Regiment herbeordert. Wenigstens fünfhundert Söhne Cantas.
»Dann werden wir hier wohl oder übel unser Lager aufschlagen müssen«, teilte Cinzia dem Mann mit und deutete auf das Feld hinter sich, »bis sich Eure Befehle geändert haben.« Sie sprach das nur ungern aus, ohne Fürst Derard vorher um Erlaubnis gebeten zu haben, wusste aber auch genau, wie seine Antwort lauten würde. Er würde tun, was die Prophetin verlangte.
Der Soldat zuckte nur die Achseln. »Unsere Instruktionen verbieten das nicht. Tut, was Ihr für richtig haltet, Herrin. Allerdings vermag ich nicht zu sagen, was Kirlan davon halten wird, dass sich eine derart große Gruppe direkt vor dem Tor versammelt.«
Er starrte weiterhin ins Leere, obgleich sie versuchte, ihn dazu zu bringen, ihr in die Augen zu sehen. Darüber ärgerte sich Cinzia noch mehr als über seine Nonchalance oder die Tatsache, dass er sie nicht weiterreisen ließ. Sie kannte die Vorschriften, die die Söhne Cantas zu befolgen hatten: Sieh nie einem Ketzer in die Augen.
»Wie Ihr meint«, antwortete sie und blieb nur mit Mühe ruhig. »Ich vermute, wir sehen uns bald wieder.« Ohne auf seine Reaktion zu warten, drehte sie sich auf dem Absatz um und ging an den Prälaten vorbei, die hinter ihr Aufstellung bezogen hatten. Noth, Elessa und die Soldaten folgten ihr widerwillig.
»Wir müssen mit Jane sprechen«, sagte Elessa, die an Cinzias Seite geeilt war.
»Natürlich.« Cinzia sah zur Sonne hinauf. »Das Magnifikal müsste bald vorbei sein, danach sprechen wir sie an.«
Vielleicht würde Canta ihnen ja durch Jane irgendeine verrückte Lösung vorschlagen. Möglicherweise hatte Jane auch längst eine Offenbarung gehabt – das war schon häufiger vorgekommen. Doch sie würden ein Wunder brauchen, um ein ganzes Regiment der Söhne Cantas zu überwinden, das ihnen den Weg versperrte. Selbst wenn sie versuchten, durch den Wald weiterzureisen, würden sich die Söhne ihnen in den Weg stellen. Cinzia fragte sich, inwieweit die Denomination die Söhne zur Gewaltanwendung ermächtigt hatte, fürchtete jedoch angesichts der Tatsache, dass es die Kirche von Canta bereits mit Attentätern zu tun bekommen hatte, das Schlimmste.
Jane verließ das Podium, als sie bei ihr ankamen, und Cinzia beschleunigte ihre Schritte.
»Cinzia«, grüßte Jane sie lächelnd. »Ich wollte ohnehin mit dir sprechen …« Ihr Lächeln verblasste. »Was ist geschehen?«
»Die Denomination hat ein ganzes Regiment der Söhne Cantas nach Kirlan geschickt. Man lässt uns nicht durch.«
Jane sah über Cinzias Schulter zur Stadt hinüber. »Wird man uns angreifen?«, fragte sie.
»Das bezweifle ich«, entgegnete Cinzia und warf Noth einen Blick zu.
»Wollten sie uns angreifen, hätten sie das längst getan«, meinte er. »Dann hätten sie sich uns nicht gezeigt. Sie wollen eine Blockade errichten, keine Schlacht heraufbeschwören. Vorläufig zumindest.«
»Können wir Kirlan nicht umgehen?«, erkundigte sich Jane.
»Dazu müssten wir einen großen Umweg machen«, erläuterte Cinzia. »Der Forst auf der Ostseite ist zu dicht. Wir müssten bis nach Turandel zurückreisen und einen anderen Weg einschlagen.«
»Das würde unsere Reise um Monate verlängern«, gab Noth zu bedenken.