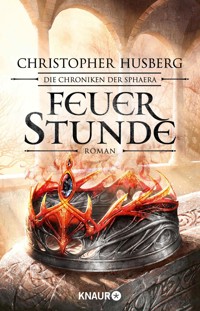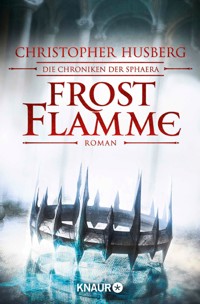
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeit der Dämonen
- Sprache: Deutsch
Ein eindringliches High-Fantasy-Epos voller Magie und Abenteuer An einem eisigen Morgen ziehen zwei Fischer einen schwerverletzten Mann aus dem Golf von Nahl. Noth, wie sie den Fremden nennen, leidet unter Erinnerungs-Verlust und weiß nicht, wer er ist. Winter ist eine junge Frau aus dem Volk der Tiellan, das gerade erst Jahrhunderten der Unterdrückung entkommen ist. Sie verliebt sich in den Fremden, aber auch sie verbirgt ein Geheimnis: Die Droge Frostflamme verleiht ihr magische Macht, die Magie zerstört sie langsam aber auch. Als die beiden am Tag ihrer Hochzeit von einem Dutzend Bewaffneter angegriffen werden, die die Tiellan töten und Noth entführen wollen, wird klar, dass er sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen muss – denn wenn er nicht herausfindet, wer er in Wirklichkeit ist, kann es für ihn keine Zukunft geben. »Spannend erzählt, der Leser ist sofort Teil dieser fantastischen Welt.« Ruhr-Nachrichten In der Reihe »Zeit der Dämonen« bisher erschienen: Frostflamme: Die Chroniken der Sphaera Feuerstunde: Die Chroniken der Sphaera Blutkrone: Die Chroniken der Sphaera
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christopher Husberg
Frostflamme
Die Chroniken der Sphaera. Roman
Aus dem Englischen von Kerstin Fricke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein düsteres Geheimnis bestimmt das Schicksal von Noth, der seine Vergangenheit enträtseln muss, damit er eine Zukunft haben kann. Winter, eine junge Frau aus dem Volk der Tiellan, verliebt sich in den Fremden, obwohl ihn ihr Volk als Feind betrachtet. Als sie durch einen brutalen Angriff getrennt werden, riskiert Winter alles, um ihn zu finden – sogar, sich durch ihre Magie selbst zu verlieren.
Gemeinsam mit der Priesterin Cinzia, die als Inquisitorin ihre eigene Schwester jagen soll, müssen Noth und Winter sich einer Verschwörung stellen, die bis in die höchsten Kreise hinaufreicht und die Welt in Finsternis zu stürzen droht.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil II
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Teil III
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Teil IV
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Epilog
Dank
Für Rachel
Prolog
Bahc stand am Bug seines Fischerbootes und hatte eine kleine Öllampe in der Hand. Ihr Licht drängte die Finsternis zurück und erhellte die dicken weißen Schneeflocken, die rings um ihn herum vom Himmel fielen. Der Schnee war über den Schein der Lampe hinaus bis in die unendliche Dunkelheit hinein zu erkennen. In der Ferne waren die Flocken nur noch zu erahnen, wie sie aus dem schwarzen Himmel in das noch schwärzere Meer herabsanken, wo sie sich in den ruhigen, kalten Wogen auflösten.
Bahc atmete tief ein und leckte sich das Salz von den Lippen. Er liebte den Geschmack des Meeres nach einem Sturm.
Nachdem er einen Handschuh ausgezogen hatte, strich er über die Reling der Schmiedestochter und spürte die kalte Maserung des Holzes unter seiner Handfläche. Bahc hatte das Boot vor Jahren mit der Hilfe der anderen Tiellaner in Pranna selbst entworfen und gebaut, damals, als die Zeiten noch andere gewesen waren.
Hinter ihm knarrte das Deck.
»Einfach so, was?«, fragte Gord.
Bahc sah über die Schulter. Gord hatte ebenfalls eine Laterne bei sich, und seine gewaltige Gestalt – für einen Tiellaner war er riesig – warf einen langen Schatten. Er trug Kleidung aus grober Wolle und dicken Fellen, und in seinem langen, dichten Bart hatten sich Eiskristalle verfangen.
»Aye«, erwiderte Bahc und schob seinen breitkrempigen Hut etwas nach oben, damit er das Wasser besser überblicken konnte. »Einfach so.«
»Wenigstens haben wir es jetzt überstanden.«
»Wir wissen nicht, wo wir sind, Gord. Noch ist gar nichts überstanden.«
Gord lehnte sich an die Reling. Sein Atem bildete in der Kälte weiße Wölkchen. »Ich hatte es befürchtet. Nun können wir nur darauf warten, dass die Sterne wieder hinter den Wolken hervorkommen, was?«
»Aye«, sagte Bahc. »Bis dahin lassen wir uns treiben. Und hoffen, dass wir nicht an einem Ort landen, an dem wir nichts zu suchen haben.«
Mit diesen Worten drehte sich Bahc um. Er wollte unter Deck gehen und mit seiner Mannschaft reden, doch etwas ließ ihn innehalten und sich erneut umdrehen. Er sah in die Finsternis hinaus. Nichts als dunkles Wasser und dunkler Himmel.
Aber da war nicht nur Dunkelheit.
In der Ferne flackerte ein helles blaues Licht auf dem Wasser. Bahcs Magen zog sich zusammen.
»Mach die Lampe aus, Gord«, murmelte er, während er seine eigene bereits löschte. Dunkelheit hüllte sie ein.
»Glaubst du, sie haben uns gesehen?« Gords Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Bahc und knirschte mit den Zähnen. »Sie sind noch recht weit weg, und unsere Lampen sind nicht sehr hell. Aber die Nacht klart auf.«
»Sie haben den Wind im Rücken«, sagte Gord.
Es stimmte. Bahcs Schiff stemmte sich gegen den Wind, und wenn das Boot mit dem schaurigen blauen Licht, das an Steuerbord aufgetaucht war, sie bemerkt hatte und verfolgen wollte, dann würde der Wind es direkt zur Schmiedestochter bringen.
»Dann sollten wir schnellstmöglich wenden«, sagte Bahc.
»Also machen wir los?« Gord ging bereits auf den Hauptmast zu.
»Aye. In die entgegengesetzte Richtung.« Bahc ging zur Kabine. »Ich wecke die anderen. Wir werden jeden Mann brauchen.«
»Käpt’n«, sagte Gord. Bahc sah zurück. Die Mannschaft nahm es auf seinem Schiff mit der Etikette nicht allzu genau und redete ihn selten mit dieser Bezeichnung an. Das war ihm nur recht.
In Momenten der Unsicherheit brachte es jedoch eine gewisse Beständigkeit.
»Hast du das gehört?« Gord stand ganz still am Bug und legte den Kopf schief.
Zuerst hörte Bahc gar nichts. Aber dann war da ein leises Geräusch, ein kaum wahrnehmbares, rhythmisches Pochen im Einklang mit den Wogen, die gegen den Rumpf schlugen.
Er ging mit finsterer Miene zurück zur Reling und sah hinab. Irgendetwas schlug sanft gegen den Schiffsrumpf.
Bahc kniff die Augen zusammen.
Und sah einen Körper im Wasser.
Bahc fluchte leise. »Mach die Winde klar und versuch, ihn an Bord zu ziehen. Ich hole die anderen.«
»Bist du sicher?«, hakte Gord nach. »In dieser Kälte kann niemand länger als ein paar Minuten im Wasser überleben. Das sieht nicht gut aus.«
»Hol ihn einfach an Bord. Das ist ein Befehl.«
Der Körper landete mit einem lauten Poltern auf Deck. Bahc starrte ihn an und spürte, dass die Augen der ganzen Mannschaft ebenfalls auf ihm ruhten.
Die blasse Haut, die in der Finsternis fast schon blau wirkte, bedeutete, dass die Kälte ihr Werk vermutlich bereits vollbracht hatte. Angesichts der beiden langen, dicken Pfeilschäfte, die aus dem Körper des Mannes ragten, war die Kälte allerdings die geringste seiner Sorgen.
Bahc musterte seine Tochter Winter, die den Fremden ebenfalls anstarrte. Auf einmal wünschte er sich, er hätte sie nicht mitgenommen. Obschon sie inzwischen zwanzig Sommer erlebt hatte, gefiel es ihm nicht, dass sie die leblose Gestalt sehen musste.
Da begriff er, dass er sich geirrt hatte. Der Mann war nicht leblos, er zitterte.
»Verdammt«, murmelte Gord, »ist er …«
Der Mann wurde von einem starken Husten geschüttelt und erbrach einen Schwall Wasser.
»Gord, übernimm das Ruder«, befahl Bahc. »Bring uns hier raus.« Er drehte sich zu dem Körper um. Dem Menschen. »Lian, hilf mir, ihn nach unten in die Kombüse zu schaffen.«
»Vater … Was tust du?«
Bahc schloss die Augen. Winter. Jetzt steckte sie wohl oder übel in der Sache mit drin. Wieder einmal dachte er an das flackernde blaue Licht in der Ferne. Er konnte den Mann auch über Bord werfen und verschwinden, der Kerl war ohnehin so gut wie tot.
Er schlug die Augen wieder auf und packte die Beine des Mannes, während Lian, das jüngste Mitglied seiner Mannschaft, dessen Oberkörper anhob.
Seine Tochter hatte schon genug Tote gesehen, heute würde kein weiterer hinzukommen.
»Wir retten ihm das Leben«, antwortete er entschlossen.
Nach einigen Stunden bekam die Haut des Mannes langsam wieder etwas Farbe. Das war gut. Bahc hatte schon schlimmere Fälle gesehen, aber die Wunden machten die Sache kompliziert. Er hatte die Pfeilschäfte mit Lians Hilfe entfernt und die Wunden mit Feuer gereinigt, der stechende Geruch nach verbranntem Fleisch hing noch immer in der Luft. Sie hatten sich ausgezogen und mit dem Mann unter mehrere dicke Wolldecken gelegt, um ihn aufzuwärmen. Anfangs hatte Lian sich nicht nackt neben einen unbekleideten Menschen legen wollen, aber Bahc kannte keinen besseren Weg, um jemandem zu helfen, der so unterkühlt war. Nach Jahrzehnten im Golf von Nahl wusste Bahc, was die Kälte anrichten konnte. Es wäre zwecklos, nur die Gliedmaßen des Mannes zu massieren und ihn mit heißem Wasser zu übergießen. Man musste auch sein Blut erwärmen. Und sein Herz. Bahc war sich nicht einmal sicher, ob all das den Mann noch retten konnte.
Oder sie selbst. Bahc musste immer wieder an das denken, was da hinter ihnen her sein könnte. Das blaue Licht in der Ferne. Seine Mannschaft hatte das Schiff schnell in Bewegung gesetzt, und Gord hatte bereits zwei Mal Bericht erstattet. Bisher machte es nicht den Anschein, als würde sie jemand verfolgen.
Dennoch war Bahc besorgt, vor allem wegen Winter.
Bahc legte eine Hand auf die Brust des Mannes, dessen Haut sich inzwischen wärmer anfühlte. Seine Gliedmaßen waren zwar noch kalt, aber nicht mehr eisig. Bahc schlug die Decke zurück und stand auf.
»Zieh dich an«, forderte er Lian auf und griff selbst nach seiner Hose. »Wir haben noch viel zu tun.«
Lian nickte, und nachdem sie sich angezogen hatten, hoben sie den Mann wieder auf den Tisch.
Hinter Bahc wurde die Tür geöffnet.
»Ich glaube, wir haben es geschafft, Käpt’n«, sagte Gord.
Bahc entspannte sich. »Konntet ihr unsere Position bestimmen?«
»Aye. Wir haben kurz ein paar Sterne gesehen, aber das war lange genug für Winter. Jetzt sollten wir in Richtung Süden unterwegs sein. Bald wird es hell, dann wissen wir es mit Sicherheit.«
Bahc nickte und drehte sich wieder zu dem Mann um. Dessen Haut war inzwischen blassweiß und nicht mehr bläulich, so dass man seine anderen Verletzungen besser erkennen konnte. Sein Körper war mit Schnitten, Prellungen und alten Narben übersät.
Gord blieb an der Tür stehen und starrte den Mann auf dem Tisch an.
»Wie geht es ihm?«
»So gut, wie unter diesen Umständen möglich. Er bekommt langsam wieder Farbe, aber das hat bei seinen ganzen Verletzungen nicht viel zu sagen.« Bahc runzelte die Stirn. Gord stand noch immer halb in der Tür. »Geh wieder raus und schließ die Tür, Gord. Du lässt die Kälte rein.«
Bahc wandte sich abermals zum Tisch um. Er wollte Lian bitten, den Eimer mit heißem Wasser aufzufüllen, als der Mann auf dem Tisch zu zucken begann. Dann sprang er auf, so schnell, dass Bahc seiner Bewegung kaum folgen konnte. Gerade hatte er noch von der Tür auf den Tisch zugehen wollen, jetzt schaute er erneut zur Tür und spürte das zackige Ende eines der zerbrochenen Pfeilschäfte an seinem Hals, während ihn ein starker Arm festhielt. Der Mann hatte sich unfassbar schnell bewegt. Die Metallpfanne, in der der andere Schaft und die Pfeilspitzen gelegen hatten, klapperte noch auf dem Boden.
Einige Sekunden lang regte sich niemand. Bahc blinzelte. Aus dem Augenwinkel konnte er Lians erschrockenes Gesicht erkennen. Gord, der noch immer in der Tür verharrte, machte langsam einen Schritt nach vorn, bewegte die rechte Hand unauffällig zu seinem Dolch und starrte den Mann an.
Der Pfeilschaft drückte kräftig gegen Bahcs Kehle.
»K… keine Bewegung«, stieß der Mann mit leiser, heiserer Stimme hervor. Bahc spürte seinen heißen Atem am linken Ohr. »Wer seid ihr?«
»Wir wollen dir nichts tun«, versicherte Bahc ihm und versuchte, ruhig zu bleiben. Er konnte spüren, dass der Mann hinter ihm zitterte.
»Ich … ich erinnere mich an gar nichts«, sagte der Mann, dessen Stimme kaum lauter war als ein Flüstern.
Die Tür fiel hinter Gord zu. Da sich niemand in der Nähe der Tür befand, fragte sich Bahc, ob Winter vielleicht hereingekommen war, und betete gleichzeitig, dass sie sich noch an Deck aufhielt. Was immer auch geschah, sie sollte da nicht mit reingezogen werden.
»Bei der Unterwelt …«, stieß Gord hervor und drehte sich um.
Ein Eimer flog durch die Luft und krachte knapp neben Gords Kopf gegen die Wand. Bahc dachte erst, jemand müsse ihn geworfen haben, doch in der Ecke, aus der er gekommen war, standen weder Lian noch der Mann.
Bahc spürte, wie der Griff des Mannes und der Druck des Pfeilschafts etwas nachließen. Dann brach um ihn herum Chaos aus.
Zinnbecher und Holzlöffel sausten wie von unsichtbarer Hand geworfen durch die Luft. Die Zange, mit der Bahc eben noch die Pfeilschäfte herausgezogen hatte, bohrte sich in die Decke. Eine Kiste mit verschmutzten Fischerhaken zerbarst, und Bahc schloss die Augen, als die Haken in alle Richtungen stoben. Der Tisch, auf dem der Mann gelegen hatte, zerrte an den Bolzen, mit denen er verankert war.
Bahc sah sich um. Gord hatte sich auf den Boden geworfen, als der Eimer durch die Luft geflogen war. Lian lag reglos auf der anderen Seite des Tisches.
Da spürte Bahc, wie ihn der Mann losließ. Er drehte sich langsam um. Der Mann schwankte und hatte die Hände an die Seiten sinken lassen. Mit einer Faust umklammerte er noch immer den Pfeilschaft. Bahc machte einen Schritt nach hinten, als er sah, wie der Mann die Augen verdrehte, bis nur noch das Weiße zu sehen war, das im Licht der Lampen glänzte. Der Mann verzog das Gesicht, in dem sich Verwirrung und Schmerz widerspiegelten.
Dann sank er zu Boden, und sein erstickter Schrei hallte in Bahcs Ohren wider. So plötzlich, wie er begonnen hatte, war der Tumult vorbei. Gegenstände, die eben noch durch die Luft geflogen waren, fielen mit lautem Klappern zu Boden.
Bahc stand schwer atmend da. Das war unmöglich. Oder zumindest sollte es unmöglich sein. Und doch hatte er so etwas schon einmal erlebt: an dem Tag, an dem seine Tochter geboren worden war.
In der Nacht, in der seine Frau gestorben war.
Gord stand langsam auf und murmelte etwas von Geistern. Lian stöhnte leise, bewegte sich jedoch nicht.
Der Fremde lag in sich zusammengesackt da, das Kinn auf der Brust und mit geschlossenen Augen. Er wirkte so friedlich, als wäre er eingeschlafen.
»Wir werden niemandem etwas davon erzählen«, flüsterte Bahc und sah sich das Durcheinander an. Überall lag Ausrüstung herum. In den Wänden steckten Haken, und Behälter waren umgeworfen worden. »Kein Sterbenswörtchen!«
Gord nickte langsam. »Was ist mit Lian?«
»Ich werde mit dem Jungen reden, aber mit niemandem sonst«, erwiderte Bahc. Sie mussten diesen Vorfall für sich behalten, alles andere wäre zu gefährlich. Keiner, weder Mensch noch Tiellaner, würde es verstehen.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte Gord und sah sich nervös um.
»Zuerst fesseln wir ihn«, antwortete Bahc und hob ein paar lange Lederriemen auf, die durch die Gegend geschleudert worden waren, um sie Gord zu reichen. »Und dann …«
Er sprach nicht weiter, da der Fremde aufstöhnte.
Bahc seufzte. Er hatte eine Entscheidung getroffen. »Dann bringen wir ihn zurück ins Dorf.«
Teil I
Schatten
Kapitel 1
Nachdem sie gebadet und sich angekleidet hatte, schlüpfte Winter leise aus dem Haus und trat in das blasse Morgenlicht hinaus. Sie war sich nicht sicher, ob ihr Vater bereits aufgestanden war, aber die cantische Tradition schrieb vor, dass die Braut vor der Zeremonie keinen Kontakt zu männlichen Familienangehörigen oder dem Bräutigam haben durfte.
»Die Braut«, flüsterte Winter. Manchmal musste sie es laut aussprechen, um es glauben zu können.
»Ich heirate«, versuchte sie es noch einmal. Sie hatte geglaubt, dies bis zu dem Tag der Hochzeit begriffen zu haben, aber das war offenbar nicht der Fall. Die Ehe kam ihr ebenso fremdartig vor, wie einem Fisch das Leben an Land erscheinen mochte.
Winter blickte auf das kleine Haus zurück, in dem ihre Familie lebte, und überlegte, ob sie ihren Vater nicht doch suchen sollte. Sie war noch nie sehr religiös gewesen, ebenso wenig wie Bahc selbst. Aber es wäre ihr dennoch seltsam vorgekommen, ihn zu sehen und eine Unterhaltung zu führen, bei der sie nicht wusste, ob sie dazu schon bereit war. Wie sollte sie ihm auch sagen, was in ihr vorging? Sie war sich ja nicht einmal sicher, ob sie es selbst überhaupt verstand.
Tief ein- und ausatmen, das war der Schlüssel – schon immer gewesen.
Sie fröstelte in der frischen Luft und ging weiter. Es war kalt, aber nicht so eisig, wie es in Pranna mitten im langen Winter sein konnte. Die Sonne versteckte sich hinter dicken grauen Wolken, und es sah aus, als würde es bald zu schneien beginnen.
Die cantischen Traditionen schrieben ebenfalls vor, dass die Braut am Morgen der Trauung Geschenke bekam von denen, die ihr nahestanden, die sogenannten Brautgaben. Da die meisten Tiellaner Pranna bereits verlassen hatten, hielten sich jedoch nur noch sehr wenige von ihrem Volk hier auf. Die Abdankung eines alten Königs und die Befreiung vor einhundertundeinundsiebzig Jahren hatten ein Jahrtausend der Sklaverei noch nicht auslöschen können. Die alten Vorurteile blieben weiterhin in den Köpfen verankert. Tiellaner waren kleiner als Menschen, hatten schmale, spitze Ohren, größere Augen und, abgesehen vom Haupthaar, nur selten Körperbehaarung. Nach Jahrhunderten der Inzucht gab es natürlich auch Ausnahmen, zu denen beispielsweise Gord mit seinem für Tiellaner ungewöhnlichen Körperbau und dem Vollbart gehörte.
Winter begriff noch immer nicht, wieso solche geringfügigen Unterschiede einen derart großen Konflikt hatten heraufbeschwören können. Das Ergebnis war jedoch offensichtlich: Gord, sein Bruder Dent, Lian und seine Familie sowie Darrin, Eranda und ihre Kinder waren die einzigen Tiellaner, die neben Winter und ihrem Vater in Pranna geblieben waren. Die Tatsache, dass so viele weggezogen waren, sprach Bände, da Tiellaner nur äußerst ungern ihr Heim verließen, und bei dem Gedanken daran wurde Winter das Herz schwer.
»Sie ziehen nur fort, wenn es nicht anders geht«, flüsterte Winter und blickte auf das Meer hinaus, das in der Ferne zu sehen war.
Sie sollte ihre Brautgaben in Darrins und Erandas Haus erhalten, aber Winter war an der kleinen Straßenkreuzung stehen geblieben. Zu ihrer Rechten, nicht weit die ungepflasterte Straße entlang, lag die Hütte von Darrin und Eranda, wo die wenigen Freunde, die sie auf der Welt hatte, auf sie warteten. Zu ihrer Linken erstreckte sich der Große Hügel bis hinunter zum Golf von Nahl. Sie sah das Dock und weiter hinten das Boot ihres Vaters. Der eine Weg führte zur Pflicht und jenen, die sie liebten, der andere in die Freiheit und die ebenso herrliche wie furchterregende Ungewissheit.
Winter verharrte noch eine Weile an der Stelle, auch wenn sie ihre Entscheidung längst getroffen hatte. Sie gestattete es sich, einem Tagtraum nachzuhängen und alles hinter sich zu lassen: In Pranna hatte sie nie das Gefühl gehabt, dazuzugehören. Sie hatte sich hier nie zu Hause gefühlt, kannte den Grund dafür aber selbst nicht genau. In der Gesellschaft ihrer Freunde und manchmal sogar bei ihrem Vater glaubte Winter stets, dass ihr irgendetwas fehlte. Ein Teil von ihr war nicht vorhanden, und es war ihr nie gelungen herauszufinden, was genau das war und wie sie es zurückbekommen konnte.
Sie malte sich aus, am Steuer eines eigenen Schiffes zu stehen. Eine kleine Mannschaft zu haben, die ihr unterstand. Vielleicht sogar einen Liebhaber. Vielleicht aber auch nicht.
Und sie dachte darüber nach, wie alles um sie herum zusammenbrechen würde. Schon jetzt gab es auf der Sphaera nicht mehr viel Platz für Tiellaner, und noch viel weniger für eine tiellanische Frau.
Wie kommst du auf die Idee, dass es dir auf einem Schiff und fern von Pranna bessergehen würde als jetzt? Winter schüttelte den Kopf. Es war ein sinnloser Tagtraum.
Mit einem Seufzen, das ein weißes Wölkchen in die kalte Luft schickte, zog Winter ihren Umhang enger um sich und ging nach rechts.
»Bist du bereit, dein Leben in die Hand eines Menschen zu geben?«, fragte Lian sie, als sie während der Brautgabe endlich einen Augenblick für sich hatten. Wie die meisten Tiellaner sprach auch Lian ruhig, mit leicht singendem Tonfall. Winter stellte dank ihres Vaters eine Ausnahme dar. »Die Sprache der Gefangenschaft«, hatte er es genannt und sie dazu angehalten, »zivilisiert zu reden«.
Darrin und Eranda waren vorübergehend abgelenkt gewesen durch ihre Unterhaltung über weitere Verfolgungen von Tiellanern in der nahe gelegenen Stadt Cineste, als sich Lian neben sie ans Feuer gesetzt hatte. Winter hatte dagesessen und den anderen zugehört. Sie liebte sie alle, aber sie wusste nicht, wie sie ihnen das zeigen sollte. Immer öfter stellte sie fest, dass sie sich wie eine Zuschauerin fühlte, die nicht wirklich dazugehörte, genauso wie jetzt. Sogar bei ihrer eigenen Brautgabe.
Als Winter sich zu Lian umdrehte, war sie sich nicht sicher, ob seine Frage spöttisch oder ernst gemeint war. Möglicherweise beides, denn er lächelte, wenngleich das Lächeln seine Augen nicht erreichte.
»Noth ist ein guter Mann«, erwiderte Winter, auch wenn sich diese Worte abgenutzt anfühlten, da sie sie schon viel zu oft gebraucht hatte. »Die Menschen sind nicht alle schlecht, wie du weißt.«
»Das stimmt. Und du heiratest ja nur einen von ihnen.«
»Ich traue den Menschen nicht, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich sie deswegen hasse. Das kannst du viel besser als ich.«
Lian hob die Augenbrauen. »Aber diesem traust du?«
Winter erwiderte nichts. Anderen zu vertrauen war ihr schon immer schwergefallen, ebenso wie allen Tiellanern, zumindest vermutete sie das. Menschen verrieten und betrogen sich gegenseitig und alle anderen und nahmen einem alles, was man besaß, wenn man sie gewähren ließ. Tatsächlich würden einige Tiellaner dasselbe tun. Wenn sie ehrlich zu sich war, dann musste sich Winter eingestehen, dass sie nur sehr wenigen Leuten vertraute: sich selbst und natürlich ihrem Vater. Gord, Darrin und Eranda und auch Lian. Noth … Noth kam dieser Liste schon sehr nahe, aber nicht nah genug, um bereits dazuzuzählen.
Sie saßen einen Moment lang schweigend da. Das Geplapper der anderen schien im Hintergrund zu verblassen.
Winter wusste, was jetzt kommen würde. »Bitte, frag mich nicht noch einmal«, flehte sie. Sie war sich nicht sicher, ob sie es ertragen konnte. Nicht heute.
»Du hast mir noch immer keine direkte Antwort gegeben«, erwiderte Lian. »Und solange du das nicht tust, werde ich dich immer wieder fragen.«
»Die Vorteile liegen doch auf der Hand. Jeder Tiellaner, der einen Menschen heiratet, ist hinterher besser dran, unabhängig von dem jeweiligen Menschen.«
»Selbst wenn der Mensch nicht die leiseste Ahnung hat, wer er ist oder woher er kommt?«
Winter runzelte die Stirn. Sie hasste diese Unterhaltung aus gutem Grund. Einerseits war sie mit Lian einer Meinung und wusste, dass ihr Tun nur schwer zu rechtfertigen war.
Andererseits war in ihr ein Hauch von Hoffnung aufgekeimt. Falls Noth sie aus Pranna wegbringen konnte, hatte Winter vielleicht doch noch die Chance, wirklich zu leben – und nicht nur in einem sterbenden Dorf dahinzuvegetieren. Selbst wenn Noth nicht der Mann ihrer Träume war, würde sie mit allem fertig, solange sie nur von hier verschwinden konnte. Sie war schließlich Tiellanerin und konnte einiges aushalten, wenn es sein musste.
Und vielleicht fand sie ja endlich einen Ort, an den sie wirklich gehörte.
»Erinnerst du dich daran, wie du beinahe ertrunken wärst?« Lian schien ihr Schweigen nicht länger ertragen zu können. »Im Sommer, als wir noch jung waren.«
Winter blinzelte, aber sie konnte nicht verhindern, dass ein leises Lächeln ihre Lippen umspielte. »Welchen meinst du?«, hakte sie nach.
Lian grinste. »Fast zu ertrinken war für uns damals wohl ziemlich normal.« Er sah ihr in die Augen. »Aber du weißt genau, wovon ich spreche.«
Natürlich wusste Winter das. Sie war erst acht oder neun Jahre alt gewesen und hatte mit einem Andenken von ihrer Mutter am Dock gespielt: einem Ohrring, den sie aus dem Zimmer ihres Vaters stibitzt hatte. Auf dem Dock war ihr das Schmuckstück aus den Fingern geglitten und durch die Bretter ins Wasser gefallen.
Winter erinnerte sich noch genau daran, dass sie nicht weiter nachgedacht hatte, sondern einfach ins Wasser gesprungen war, um nach dem Ohrring zu suchen.
Sie wusste noch immer, wie sie ins kalte Wasser getaucht, zum Luftschnappen an die Oberfläche gekommen und wieder hinuntergestoßen war. Es war schon dämmrig gewesen, aber das Wasser in der Nähe des Docks war ohnehin trüb, so dass Winter kaum etwas erkennen konnte. Immer, wenn sie hinuntertauchte, schob sie die Hände in den Schlamm am Meeresboden, fand jedoch nichts. Sie wusste nicht, wie lange sie so getaucht und nur zum Luftschnappen an die Wasseroberfläche gekommen war, aber sie erinnerte sich noch genau daran, wie sich ihre Brust schmerzhaft zusammengezogen hatte und wie sich ihre Tränen mit dem Meerwasser auf ihrem Gesicht vermischt hatten.
Die Sonne war untergegangen und das Wasser kälter geworden, aber sie hatte trotzdem weitergemacht, selbst dann noch, als sie Muskelkrämpfe bekommen hatte. Wenn sie daran zurückdachte, wusste Winter selbst nicht mehr, was damals über sie gekommen war. In diesem Augenblick hatte nichts anderes mehr gezählt, als dass sie den Ohrring wiederfand. Allein dieses Verlangen hatte ihren Verstand ausgefüllt.
Lian fand sie irgendwann, als sie zitternd und spuckend an die Oberfläche kam und sich bereitmachte, erneut unterzutauchen. Bis heute war er davon überzeugt, dass sie nie wieder aufgetaucht wäre. Er sprang ihr hinterher, als sie gerade erneut hinunterstieß und in den Schlamm griff, packte sie und zog sie nach oben.
Ihre Hand hatte den Ohrring ihrer Mutter umklammert.
Sie sah Lian an. »Soll ich mich etwa noch einmal bei dir bedanken?«
»Nein«, antwortete er lachend. »Ich wollte dich nur daran erinnern. Manchmal glaubt man, etwas zu brauchen, und man kann nur noch daran denken, so dass man nicht merkt, wann es genug ist. Dabei ist das oft das Beste, was man machen kann – eine Sache einfach aufgeben. Ich wünsche mir nur, dass du weißt, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist.«
»Ich auch«, flüsterte Winter.
Auf einmal streckte Lian eine Hand aus und strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Ihre Hand schnellte vor und hielt seine fest.
»Tu das nicht.« Winter ließ die Hand wieder sinken. Freundschaftliche Zuneigung war eine Sache, aber dies war ihre Brautgabe, um Cantas willen. Und die Berührung drohte, sie in eine Zeit zurückzubringen, an die sich Winter lieber nicht mehr erinnern wollte.
»Tut mir leid«, murmelte er.
»Mir auch«, sagte sie, doch sie meinte es nicht so.
Die Brautgabe verlief so gut, wie es sich Winter nur hätte wünschen können. Das kleine Häuschen duftete nach frischem Brot und Zimt, und diese Gerüche erinnerten sie immer an ihre Mutter. Es kam ihr töricht vor, dass etwas sie an eine Frau erinnern konnte, die sie nie gekannt hatte, aber es war dennoch so.
Die Geschenke waren einfach, aber voller Bedeutung. Eine traditionelle tiellanische Siara aus wunderschöner weißer Wolle, eine kleine Holzschnitzerei eines Mannes und einer Frau, die dicht beisammenstanden, eine Halskette mit schwarzen Steinen, die ihre dunklen Augen betonten, und ein Wickeltuch – auch wenn sie bei dem Gedanken an ein Kind innerlich zusammenzuckte.
Dann, viel zu früh, klopfte es an der Tür. Drei cantische Elevinnen in rot-weißen Roben standen davor. Die Frauen, alles Menschen, machten Winter nervös. Das ging ihr immer so bei Menschen, aber sie versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. Winter sah an sich herab: Sie trug ein Kleid aus grober Wolle, das ihre Arme bis zu den Handgelenken bedeckte und ihr bis zu den Fußknöcheln reichte, und sie hatte sich die graue Siara, eine lange Stoffbahn, in Falten um den Hals und die Schultern gelegt. Sie sah auffallend anders aus als die schlankeren Menschenfrauen mit ihren enganliegenden Kleidern mit den tiefen Ausschnitten.
Winter durchfuhr ein Stich der Enttäuschung, als sie sah, dass es nur drei waren. Die cantische Tradition erforderte, dass neun Elevinnen eine Braut zu ihrer Waschung begleiteten, da die Zahl neun für die ursprünglichen Elevinnen von Canta stand. Jetzt fragte sich Winter, ob es nur drei waren, weil die Dorfbevölkerung in den letzten Jahren derart stark abgenommen hatte oder weil sie Tiellanerin war und die Elevinnen fanden, dass sie keine vollständige Eskorte verdient hatte. Das Ausmaß ihrer Enttäuschung überraschte sie. Bisher hatte sie geglaubt, dass ihr solche Einzelheiten nicht viel bedeuten würden.
Auf einmal stieg Panik in Winter auf, und ein schweres Gewicht schien sich auf ihre Brust zu legen. So sollte das alles nicht sein. Sie hatte sich das anders gewünscht.
Doch das niederschmetternde Gefühl verflog wieder. Sie würde tun, was von ihr erwartet wurde.
Winter verabschiedete sich von ihren Freunden, denen sie zum letzten Mal als Danica Winter Cordier, Tochter von Bahc, dem Fischer, gegenüberstand. Ob sie es nun wollte oder nicht, ihr stand eine Veränderung bevor, und es wurde Zeit, dass sie sich dafür wappnete.
»Kann das wirklich sein? Mein kleines Mädchen will tatsächlich heiraten?«
Winter lächelte, als ihr Vater das Jungfernzimmer betrat. Väter waren die einzigen Männer, die hier Zutritt hatten, und das auch nur direkt vor der Zeremonie. Sie war allein, da sich die drei Elevinnen entschuldigt hatten, um die Kapelle für die Hochzeit vorzubereiten.
Trotz ihrer Sorgen bewunderte Winter, wie gut ihr Vater aussah. Er trug den einzigen formellen Anzug, den er besaß und der aus einer locker sitzenden, ausgeblichenen grauen Hose und einem dunkelblauen Überzieher bestand, die noch nach altem Schnitt gefertigt worden waren. Damit sah er so anders aus als in seiner üblichen Fischerkleidung aus Fellen und Wolle.
»Hallo, Papa.«
Sie spürte seine Arme um sich und seine gebräunte, glatte Wange an ihrer.
Als sie sich voneinander trennten, musterte er sie von oben bis unten. Ihr rabenschwarzes Haar war am Hinterkopf mit einer Schleife zusammengebunden worden, und die Elevinnen hatten ihr die Kette mit den schwarzen Steinen umgelegt, die sie geschenkt bekommen hatte und die zu ihren tiefschwarzen Augen passte.
Winter trug nun ein rotes Kleid, das einzige Kleidungsstück ihrer Mutter, das ihr Vater aufgehoben hatte. Es bestand aus einfacher gefärbter Wolle, aber der Stoff war sehr fein und umschmeichelte elegant Winters schlanke Gestalt. Auch die Ärmel dieses Kleides reichten ihr bis zu den Handgelenken, und der Stoff bedeckte sogar ihren Hals, aber es passte ihr sehr gut und lag eng an den Hüften und den Brüsten an. Im Großen und Ganzen entsprach es den tiellanischen Traditionen, aber insgeheim schien es Rebellion zu verkörpern. Winter stellte sich vor, wie ihre Mutter es Jahre zuvor getragen hatte und welchen Aufruhr sie unter den tiellanischen Ältesten und Matriarchinnen ausgelöst haben musste. Bei diesem Gedanken musste sie lächeln.
Sie wartete, dass ihr Vater etwas sagte, fragte sich aber gleichzeitig, ob er das tun würde. Er war kein Mann vieler Worte.
»Du hast die Augen deiner Mutter«, brachte er schließlich heraus. »So dunkel wie das Meer um Mitternacht.«
Sie lächelte und versuchte, sich ihre Schwermut nicht anmerken zu lassen. »Ich glaube, das hast du mir schon ein oder zwei Mal gesagt.«
»Sie wäre sehr stolz auf dich, Winter.«
Wäre sie das? Nach allem, was ihr Vater über sie erzählt hatte, war ihre Mutter immer eine starke, unabhängige Frau gewesen. Winter war sich nicht sicher, ob sie damit einverstanden gewesen wäre, dass ihre Tochter so leicht aufgab.
»Das hoffe ich«, flüsterte sie.
Ihr Vater seufzte und winkte mit einer Hand ab. »Es reicht, Winter. Ich weiß, dass du nicht glücklich darüber bist. Mir ist vollkommen klar, dass es nicht das ist, was du dir gewünscht hast.«
Winter starrte ihren Vater an. »Das weißt du?«
»Natürlich weiß ich das. Dachtest du, ich würde es nicht merken, wenn meine Tochter etwas in sich hineinfrisst und still vor sich hin leidet? Du bist in dieser Hinsicht genau wie deine Mutter. Ich weiß, dass du Bedenken hast. Aber Noth ist ein guter Mann. Er gehört nicht zu den Menschen, die … Er ist ein guter Mann, Winter. Er wird sich um dich kümmern. Und er kann dir ein Leben ermöglichen, wie ich es niemals könnte.«
Tief in ihrem Inneren wusste Winter, dass seine Worte der Wahrheit entsprachen. Selbst jemand wie Noth, der so wenig besaß, konnte ihr so viel geben. Wenn sie in die Stadt zogen, irgendwohin, wo sie einen neuen Anfang machen konnten …
»Was ist, wenn ich dieses Leben gar nicht will? Was ist, wenn ich genau das Leben will, das du mir geben kannst? Oder Lian? Was ist, wenn ich mein Leben selbst gestalten will, Vater?«
»Bei der aufsteigenden Göttin, du bist ihr so ähnlich, dass ich es selbst kaum glauben kann«, murmelte ihr Vater.
Winter setzte sich. Noch während sie die Worte ausgesprochen hatte, wusste sie, dass es unmöglich war. Sie konnte nicht selbst über ihr Leben bestimmen. Noth war tatsächlich ihre einzige Chance. Sie brauchte ihn.
»Es ist doch so, Winter«, sagte ihr Vater und nahm ihre Hände. »Du heiratest diesen Mann. Das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Aber das heißt noch lange nicht, dass du dein Leben aufgibst. Dein Leben ist, was du daraus machst. So war es schon immer, und so wird es immer sein. Möglicherweise überrascht uns Noth alle und entwickelt sich zu einem Tyrannen, und wenn das der Fall sein sollte, dann hast du meine Erlaubnis, ihn im Schlaf zu ermorden und zu fliehen, um dein Glück selbst zu suchen.«
Winter lächelte, auch wenn dieser Scherz einigen Vorfällen in der Stadt gefährlich nahekam, von denen sie gehört hatte.
»Aber ich bezweifle, dass es so sein wird«, fuhr ihr Vater fort. »Ich denke, er möchte, dass du glücklich bist, und ich gehe davon aus, dass er dir helfen und alles tun wird, damit du dieses Glück auch findest. Unterschätze dieses Band nicht, mein Schatz. Eine gut funktionierende Ehe macht dich freier, als du denkst. Ich bin davon überzeugt, dass ihr beide einander braucht.«
Winter wollte ihren Vater gerade fragen, was er damit meinte, als jemand an die Tür klopfte. »Die heilige Canta ruft ihre Jungferndienerin«, sagte eine Frauenstimme. »Wird sie antworten?«
Die Priesterin war bereit.
Winter musterte noch einmal ihr Spiegelbild. Das Mädchen, das sie anblickte, wirkte selbstsicher und ruhig. Das Mädchen im Spiegel hätte fast schon glücklich sein können. Sie konnte beinahe glauben, was ihr Vater ihr da sagte.
»Winter«, flüsterte Bahc. »Heute ist dein Tag. Nimm dein Glück an.«
Winter räusperte sich. »Sie wird antworten«, rief sie der Priesterin zu. Dann drehte sie sich um und ging zur Tür, blieb aber noch einmal stehen, um ihrem Vater einen Kuss auf die Wange zu geben.
»Ich liebe dich, Papa«, sagte sie, öffnete die Tür und betrat die Kapelle.
Sie zuckte nicht zusammen, als der kleine Dolch ihre Handfläche verletzte.
»Und du, Danica Winter Cordier, schwörst du bei deinem Blute und im Angesicht der heiligen Canta, dich jetzt und für immer Noth hinzugeben, durch Frost und durch Feuer, Sturm und Flaute, Licht und Dunkelheit, Abenddämmerung und Morgengrauen und durch den Wandel der Zeiten?«
»Ich schwöre es bei meinem Blute«, erwiderte Winter. Die Priesterin, eine rundliche Frau in der Blüte ihrer Jahre, blickte von ihrem großen Podest wohlwollend auf Winter herab. Sie nahm Winters Hand und legte sie in Noths, der zuvor eine ähnliche Wunde zugefügt bekommen hatte.
Winter sah Noth an. Er lächelte nicht, aber sie kannte ihn inzwischen gut genug, um auch nicht damit zu rechnen. Er wirkte zufrieden, und seine Augen waren hell und friedlich.
»Bei der Kraft der Neun, die Canta auserwählt hat«, fuhr die Priesterin fort, »und deren Macht in mir weiterlebt, gebe ich euch diese Segen.«
Die Worte schienen in Winters Kopf zu summen, und es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Sie war jetzt erneuert worden. Ob ihr neues Ich nun besser oder schlechter war, würde sich zeigen, aber ihr Leben würde sich für immer verändern.
»Dass ihr einander liebt«, sagte die Priesterin.
Winter sah sich in der kleinen Kapelle um. Fackellicht leuchtete bis hinauf zu den Dachbalken des langgestreckten Giebels, während die Seitenflügel des Gebäudes in dunkle Schatten getaucht waren. Sena, Darrins und Erandas Tochter, stand dicht neben Winter. Sie war das einzige tiellanische Mädchen, das ungefähr so alt war wie Winter und Brautjungfer sein konnte, wenngleich sie selbst fast noch ein Kind war.
»Dass ihr jenen um euch herum dient.«
Lian saß neben Eranda auf der vordersten der glattpolierten Holzbänke, und Gord und Dent einige Reihen dahinter. Winter konnte ihnen gar nicht genug danken, weil sie gekommen waren. Sie war zwar ein wenig enttäuscht, weil die anderen Bänke leer waren, gleichzeitig war sie sich aber auch bewusst, dass das dumm war. Bis zuletzt hatte sie selbst daran gezweifelt, ob sie die Zeremonie wirklich wollte, und doch grämte sie sich jetzt, dass es nicht mehr Zuschauer gab? Hätte die Zeremonie vor einigen Jahren stattgefunden, dann wäre die Kapelle am heutigen Tag bis auf den letzten Platz mit feiernden Tiellanern besetzt gewesen.
»Dass ihr vor den Dämonen dieser Welt und der jenseitigen beschützt werdet und dass eure Seelen nie in die Unterwelt eingehen werden.«
Als wären sie von Winters Gedanken heraufbeschworen worden, traten plötzlich mehrere Männer durch die hohen Türen im hinteren Teil der Kapelle.
Winter wusste sofort, dass dies keine Gäste waren, die sie bei ihrer Hochzeit sehen wollte. Aus dieser Entfernung konnte sie nur vermuten, dass es Menschen waren, da sie ebenso groß wie Lian und Gord oder sogar noch größer wirkten. Oder waren sie gar Kamiten? Sie schluckte schwer.
Alle sechs Männer trugen dunkelgrüne Roben mit Kapuzen, so dass ihre Gesichter im Schatten nicht zu erkennen waren. Und sie waren bewaffnet. Mit Schwertern und Dolchen, Schilden und Speeren.
Nur beiläufig bemerkte Winter, dass die Priesterin ihre Hand losließ. »Was hat diese Störung zu bedeuten?«, wollte die Frau wissen.
Die Männer standen einen Moment lang da, und das Fackellicht erhellte ihre vermummten Gestalten. Die Männer blickten zwischen der Priesterin und den Hochzeitsgästen hin und her.
Winters Befürchtung, dass es sich tatsächlich um Kamiten handelte, wurde zunehmend größer. Die Kamiten sprachen sich für die Wiedereinführung der tiellanischen Sklaverei aus oder gleich für den Tod aller Tiellaner. Sie waren nicht besonders beliebt und mieden meist die Öffentlichkeit, aber den Gerüchten zufolge gab es auch welche in Pranna.
Einer der Männer, der größte von ihnen, trat vor. »Wir wollen eigentlich niemanden stören«, sagte er mit einem abgehackten, rauhen Akzent. Er klang wie ein Rodeneser, war also kein Kamite, da sich der Orden der Kamiten nicht über die Grenzen von Khale hinweg ausgebreitet hatte. Winter seufzte, allerdings nicht vor Erleichterung. Die Rodeneser sprangen anders mit den Tiellanern um.
Der große Mann streifte seine Kapuze ab und trat in den vorderen Teil der Kapelle. Er war hässlich. Sein blondes Haar wurde bereits schütter, und er hatte eine viel zu lange Hakennase. Eine Seite seines Gesichts war von einer tiefen Narbe entstellt, die von der Stelle, an der sein Ohr hätte sein sollen, über die Wange verlief. »Man hätte uns einladen sollen«, fuhr er fort, als er neben Winter, Noth und der Priesterin stehen blieb. Er legte eine Hand auf Noths Schulter. »Wir sind schließlich alte Freunde von unserem guten Lathe hier.«
Winter sah Noth mit weit aufgerissenen Augen an. War das sein wahrer Name? Wussten diese Männer, wer Noth wirklich war?
Noth drückte Winters Finger.
Bahc erhob sich. »Noth, mein Sohn, wenn du diese Männer kennst …«
»Ich kenne sie nicht«, unterbrach Noth ihn mit sanfter Stimme. Er wandte den Blick nicht von dem Mann, der weiterhin eine Hand auf seiner Schulter liegen hatte. »Am besten geht Ihr jetzt wieder und verlasst die Kapelle, mein Herr.«
Die Autorität in Noths Stimme überraschte Winter. Sie hatte ihn so auf dem Boot sprechen hören, wenn er Bahcs Befehle weitergab, aber sonst redete er immer ruhig und leise.
»Ach, das wäre also das Beste … Wie war das doch gleich? Noth?« Der Mann kniff die Augen zusammen. »Du musst es ja wissen, was? Du schienst schon immer zu wissen, was für jeden das Beste ist. Tja, weißt du auch, was für all deine Freunde hier das Beste wäre, Noth? Weißt du, was das Beste für deine junge Braut hier wäre? Wenn du jetzt einfach mit uns mitkommst. Dann wird niemand verletzt.«
Winter blickte sich unruhig um. Was hatten diese Männer vor? Was würde Noth tun? Sie war wie erstarrt und sah alles um sich herum wie aus weiter Ferne, gebannt, aber nicht in der Lage, etwas zu unternehmen.
Der Priesterin ging es anscheinend nicht so. »Wie könnt Ihr es wagen, in eine Zeremonie der heiligen canti…«
Eine Bewegung – Winter glaubte, der große Mann hätte die Priesterin geschubst. Die rundliche Frau keuchte auf und taumelte nach hinten. Als Winter sich zu dem großen Mann umdrehte, der nun einen Arm über Noths Schulter gelegt hatte, sah sie, dass er mit der anderen Hand einen Dolch festhielt, von dem Blut tropfte.
Die Priesterin brach auf dem Boden zusammen.
»Schade drum«, murmelte der große Mann, der Noth noch immer anstarrte.
»Oh, Göttin«, flüsterte Winter.
Der Mann sah sie an, und sein Gesicht schien durch die Narbe und sein Grinsen in vier Teile geschnitten zu werden. »Ich bezweifle, dass sie heute hier ist. Vielleicht solltest du später noch mal wiederkommen.« Er reckte den Hals und sah seine Männer an. »Greift sie euch!«
In dem ausbrechenden Chaos wusste Winter nicht, was sie tun sollte. Ihr Vater starrte sie mit bleichem Gesicht an und rief Eranda und Sena zu, sie sollten weglaufen. Gord sprang mit gerötetem Gesicht von seiner Bank auf. Die Elevinnen liefen hin und her und riefen nach ihren Göttinnenwachen.
Noth zog Winter mit starken, sicheren Händen an sich. Einige der Fackeln mussten zu Boden gefallen sein, und es wurde dunkler im Raum, das flackernde orangefarbene Licht wirkte unheimlich. Das Einzige, was Winter wieder in die Gegenwart zurückholen konnte, war Noths Stimme, als er sie zu sich umdrehte. Er legte ihr die Hände auf die Wangen und sah ihr tief in die Augen. Sie spürte sein Blut auf ihrer Wange, das noch aus der Wunde an seiner Hand sickerte. In seinen Augen war ein Glanz, den sie noch nie zuvor gesehen hatte – er war kalt und scharf wie ein Lichtblitz auf dem Wasser bei einem dunklen Wintersturm.
»Ich lasse nicht zu, dass sie dir weh tun«, versicherte er ihr.
Winter erschauderte beim Klang seiner Stimme.
Hinter Noth sah sie einen Schatten und aufblitzenden Stahl, als einer der Fremden mit gezücktem Schwert auf sie losstürmte. Bevor sie auch nur aufschreien konnte, wirbelte Noth herum, packte das Handgelenk des Mannes und nutzte dessen Schwung, um sich einmal um sich selbst zu drehen und den Angreifer mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu schleudern. Noth drehte den Arm des Mannes nach hinten, und Winter hörte ein schreckliches Knacken. Ihr stockte der Atem, und sie machte einen Schritt zur Seite. Das alles hatte gerade mal einen Atemzug lang gedauert. Das Fackellicht flackerte, und Noths Gesicht lag halb im Schatten.
Vielleicht hatte das Licht Winters Augen ja einen Streich gespielt. Aber der Mann mit der Robe lag stöhnend auf dem Boden, und Noth starrte erstaunt seine Hände an.
»Noth«, begann sie, »wie …?«
Er blickte auf und sah sie mit weit aufgerissenen Augen an. Dann schüttelte er den Kopf. »Ich weiß es nicht.« Seine Stimme war kaum lauter als ein Flüstern. Plötzlich schrie jemand hinter ihm, und Noth wandte sich von Winter ab.
Der große Mann stand vor Noth. Er hielt eine der Elevinnen fest und drückte ihr einen Dolch an die Kehle. Hinter ihnen lag eine weitere Elevin auf dem Boden, die aus dem Mund oder der Nase blutete – das konnte Winter nicht genau erkennen. In ihren Ohren hallten Schreie wider, und auch die Elevin kreischte.
Dann hörte Winter ihren Vater.
Bahc lag auf dem Boden, stöhnte und hielt sich den Bauch. Zwar sah er sie an, aber mehr konnte Winter in dem schlechten Licht nicht erkennen, denn sein Gesicht lag im Schatten. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hervor, und einer der dunkel gekleideten Männer stand über ihm.
Winter schrie auf und wollte zu ihrem Vater laufen, als sie von irgendjemandem festgehalten wurde. Eine dreckige Hand legte sich auf ihren Mund, und ein Arm drückte gegen ihre Kehle. Sie spürte die Wärme ihres Atems, als sie dagegen anschrie, aber keinen Ton herausbrachte, und dann etwas Feuchtes auf ihrer Wange. Ob es Noths Blut war oder ihre Tränen, wusste sie nicht. Vergebens kämpfte sie gegen denjenigen an, der sie festhielt, aber sie konnte sich kaum bewegen. Der Druck auf ihren Hals verstärkte sich, und sie hatte das Gefühl, als müsse ihr Kopf explodieren, der sich gleichzeitig schwer und federleicht anfühlte. Winter blickte voller Angst um sich und entdeckte Noth. Zwei der Angreifer lagen in seiner Nähe auf dem Boden. Wieder leuchtete dieser kalte Glanz in seinen Augen auf, wie ein Blitz auf dunklem Wasser. Dann stürzte Noth vor und hieb seine Handfläche von unten gegen das Gesicht eines Vermummten. Der Kopf des Mannes flog nach hinten, und im nächsten Moment bewegte sich Noth so schnell, dass Winters Blick ihm kaum folgen konnte.
Vor vielen Jahren hatte Bahc Winter beigebracht, wie man Drachenmuränen mit einem Tiefseenetz fing. Sie erinnerte sich noch daran, wie er sie vorsichtig zu dem Bottich geleitet hatte, in den das Netz ausgeleert worden war. Er hatte hineingedeutet und ihr gesagt, dass sie jetzt ein echtes Raubtier sehen könne. »Wo ist es denn?«, hatte sie gefragt. In dem Bottich waren Hunderte von Tiefseefischen im flachen Wasser herumgehüpft, und ihre breiten, flachen Körper hatten geglitzert. Winter konnte keine Drachenmuräne sehen. Soweit sie wusste, existierten diese Tiere nicht einmal. Auf einmal sprang eine schlanke, sehnige Gestalt aus dem Wasser und zerfetzte einen Fisch mit rasiermesserscharfen Zähnen, so schnell, dass ihr Blick kaum folgen konnte. Die Muräne war erst in der einen Ecke und schon in einer anderen, dann wieder in der Mitte, sprang in die Luft und richtete unter den zappelnden Fischen ein wahres Gemetzel an. »Sie frisst sie nicht«, hatte Winter gesagt. »Warum frisst sie die anderen Fische nicht?« Ihr Vater hatte ihr erklärt, dass eine Drachenmuräne nicht tötet, um zu überleben, sondern weil sie Freude am Töten hat. Das Wasser hatte sich blutrot gefärbt, und Winter war langsam rückwärts gegangen und hatte sich gewünscht, in ihrem ganzen Leben keine Drachenmuräne mehr sehen zu müssen.
Als der Mann sie jetzt am Hals festhielt und ihr langsam schwarz vor Augen wurde, konnte sie nur noch an diese Drachenmuräne denken, während Noth durch den Raum voll hilfloser, zuckender Tiefseefische tobte.
Kapitel 2
Noth fürchtete sich.
Die Angst an sich war nicht weiter schlimm. Nein, dieses dunkle Ziehen, das von seiner Kehle bis hinab zur Magengrube reichte, daran hatte er sich gewöhnt. Ihn versetzte es vielmehr in Schrecken, dass er sich nicht vor den Männern fürchtete, die seine Hochzeitsgesellschaft angegriffen hatten, sondern dass er sie mit solcher Leichtigkeit hatte töten können.
Der eiskalte Wind, der vom Golf herüberwehte, peitschte durch Noths Umhang, als er sich den Weg zum Haus von Darrin und Eranda bahnte. Winter lag bewusstlos in seinen Armen, ein warmes Wesen, das der kalten Luft trotzte. Es hatte angefangen zu schneien, und die weißen Flocken legten sich auf Winters Gesicht und schmolzen dort. Der Schnee fiel friedlich, und das kam ihm grausam vor.
Noth hatte neun Leichen in der Kapelle zurückgelassen. Die Männer mit den Roben waren ihm nicht bekannt vorgekommen, und Noth hatte keine Ahnung, wie es ihm gelungen war, sie auszuschalten. Dennoch hatte er sofort gewusst, dass er sie besiegen konnte, als er gemerkt hatte, dass sie eine Gefahr darstellten. Dieses Wissen war tief in seinen Knochen verankert gewesen, weit tiefer, als sein Verstand reichte. Sein Körper hatte die Arbeit rasch und ohne größere Anstrengung erledigt.
Die Priesterin und zwei ihrer Elevinnen waren tot, ermordet von den Angreifern. Die letzte Elevin hatte in dem Tumult entkommen können. Noth hatte vier der Männer getötet, während Lian, Gord und Dent einen weiteren ausgeschaltet hatten. Dabei war auch Dent ums Leben gekommen. Dem großen, vernarbten Mann, der als Einziger etwas gesagt hatte, war die Flucht geglückt.
Und dann war da noch Bahc.
Noth wusste, dass es ein Fehler gewesen war, in Pranna zu bleiben. Aber er war dennoch geblieben, und nun setzten ihm die Schuldgefühle zu.
Er war geblieben, weil Bahc ihn freundlich behandelt hatte. Außerdem war Bahcs Tochter wunderschön, das ließ sich nicht leugnen. Er schämte sich, als er sich jetzt eingestand, dass sie einer seiner Gründe gewesen war, zu bleiben, aber so war es nun einmal. Er war auch geblieben, weil es keinen anderen Ort gab, an den er gehen konnte. Seine Erinnerungen an sein Leben vor dem Augenblick, in dem er in Bahcs Haus aufgewacht war, waren bestenfalls bruchstückhaft und bestanden aus einem Wirbel unmöglicher Bilder und Gesichter, die er nicht zuordnen konnte. Sie waren verschwommen und trüb.
Vor allem aber war er geblieben, weil er geglaubt hatte, sich ein Leben aufbauen zu können. Dies hier waren einfache Leute, und ihr schlichtes Leben zog Noth an. Tag für Tag von dem zu leben, was man im eisigen Golf fing, das mochte er. Die tiellanischen Traditionen in ihrer altmodischen, unwandelbaren Art gefielen ihm. Ob ihn die Kluft zwischen Menschen und Tiellanern früher gestört hatte, wusste Noth nicht, aber jetzt machte sie ihm nichts aus. Er mochte die sachliche Art, wie sie die Dinge sahen. Sie machten das Beste aus dem, was das Leben ihnen schenkte.
Darum hatte Noth auch niemandem erzählt, an was er sich wirklich erinnerte. Und jetzt gab es neun Leichen, die er zu verantworten hatte, nur weil er geblieben war und sich selbst über alle anderen gestellt hatte.
Es schneite jetzt stärker, und dicke weiße Flocken schwebten durch die Dunkelheit und bedeckten die Straße, die Dächer und die Felder. Pranna bestand aus kaum mehr als einer Hauptstraße, die gen Norden zum Großen Hügel führte, und dem Dock, an dem einige Schiffe in dem kleinen Hafen vor Anker lagen, darunter auch Bahcs Schmiedestochter. Das tiellanische Viertel befand sich weiter im Osten, fern der Hauptstraße und des Docks, und war nur über einen schmalen Fußweg zu erreichen. Die Häuser der Tiellaner waren kaum mehr als Hütten mit dünnen Wänden aus Treibholz und schiefen Dächern, die ständig ausgebessert werden mussten, und sie bildeten einen starken Kontrast zu den robusteren Häusern und Geschäften der Menschen, die teilweise sogar mehrstöckig waren und im Zentrum der Stadt lagen. Die cantische Kapelle, das größte Gebäude der Stadt, ragte im Westen auf. Noth würde die Hauptstraße überqueren müssen, wenn er Darrins Haus auf der Ostseite erreichen wollte.
Als Noth sich dem Stadtrand näherte, hörte er das Knirschen von Schritten und sah in der Ferne das Licht einer Laterne. Instinktiv kniete er sich hinter der Schmiede auf den Boden, wobei er Winter an sich drückte. Er stützte Winter kurz auf seinen Beinen ab und drehte den rechten Arm, da sich seine Schulter nach der Pfeilwunde, die er vor einem Jahr erlitten hatte, nie wieder richtig erholt hatte. Die Narbe schmerzte häufig, und jetzt, da er Winter trug, wurde es schlimmer.
»Glaubst du das, was die Elevin erzählt hat? Die Gute schien mir doch ein bisschen verwirrt zu sein«, sagte ein Mann. Noth konnte die beiden Männer jetzt deutlich im Lampenlicht erkennen. Sie trugen leichte Rüstungen und Speere und gehörten zur Stadtwache.
»Sie sagte, der Elfenfreund und die anderen Menschen wären für die Toten verantwortlich. Sie hätten die Tiellaner und die Elevinnen angegriffen und wären danach aufeinander losgegangen. Der Elfenfreund und einer der Fremden sind entkommen und haben die anderen zum Sterben zurückgelassen.«
Noth runzelte die Stirn. »Elfenfreund« war ein Begriff, den er im vergangenen Jahr sehr häufig zu hören bekommen hatte. Gaben sie ihm gerade die Schuld an dem ganzen Massaker?
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. Dann ergriff der zweite Wachmann wieder das Wort. »Ich bin ja ganz froh, dass wir die Elfen los sind. Inzwischen hätten sie alle längst weg sein müssen. Und mir ist es völlig gleich, ob sie fortgegangen oder tot sind. Aber das, was er mit den Elevinnen und erst recht mit der Priesterin gemacht hat, ist ein echtes Verbrechen.«
»Aye. Das ist auch der einzige Grund, warum ich hier draußen bin und die Schweinehunde suche. Wegen einem verdammten Elfen würde ich hier ganz bestimmt nicht herumlaufen.«
»Hoffentlich finden wir den Elfenfreund zuerst. Den Kerl wollte ich schon immer mal aufmischen.«
Der andere Wachmann knurrte zustimmend, und sie gingen an Noth vorbei in Richtung Stadtmitte. Wenn die Stadtwache bereits alarmiert worden war, dann wusste die Göttinnenwache ebenfalls Bescheid. Überdies wusste Noth – warum auch immer –, dass man bereits einen Boten nach Cineste geschickt hatte und dass innerhalb einer Woche ein Trupp Gardisten hier eintreffen würde. Neun geheimnisvolle Todesfälle, darunter drei Angehörige des Klerus, damit konnte die Kleinstadt Pranna nicht allein fertig werden. Die cantische Denomination würde vielleicht sogar eine Hexenjägerin ins Dorf schicken, um den Vorfall genau zu untersuchen.
Noth wunderte sich nicht wirklich, dass die Stadtwache ihn der Morde bezichtigte. Die Menschen in dieser Stadt hatten ihn nie gemocht. Ihrer Meinung nach war ein Mensch, der sich in eine Tiellanerin verliebte, auch nicht besser als das ganze Elfengesindel.
»Die anderen toten Menschen geben uns das eigentliche Rätsel auf«, erklärte der erste Wachmann. »Der Vorsteher glaubt, sie kämen aus Maven Kol, zumindest hat er dort schon einmal solche Roben gesehen.«
»Der Vorsteher war doch noch nie in Maven Kol«, erwiderte der andere und schnaufte. »Er weiß nicht, was er da überhaupt redet.«
»Sag du ihm das.«
Noth zuckte zusammen. Die Männer irrten sich. Die Angreifer stammten nicht aus Maven Kol, ihr Akzent war rodenesisch gewesen. Er kannte das Land nur dem Namen nach und erinnerte sich nicht, jemals dort gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz schien etwas am Rande seines Verstandes zu zupfen.
Die Unterhaltung der Wachmänner wurde leiser. Noth wartete, bis er das Licht ihrer Lampe nicht mehr sehen konnte, dann hob er Winter hoch und trat erneut auf die Straße. Wenn sie ihm all die Leichen anhängen wollten, war das umso besser. Es änderte nichts an seinem Plan.
»Es geht dir gut, Noth!« Eranda lief auf ihn zu und blickte ängstlich auf Winter herab. Noth war durch den frisch gefallenen Schnee, der mittlerweile fast eine Hand hoch lag, zu der kleinen Hütte gestapft.
»Oh, Göttin«, flüsterte Eranda und sah Noth ins Gesicht. »Ist sie …?«
»Bewusstlos. Aber sie wird überleben.«
Darrin, Erandas Mann, trat auf ihn zu. »Ich kann sie dir abnehmen«, bot er Noth an. »Du hast sie schon den ganzen Weg hierher getragen.«
»Nein«, erwiderte Noth und war selbst überrascht, dass er sie nicht loslassen wollte. »Ich … ich kann sie noch halten.«
Lian kam mit Tohn in den Armen herein, dem jüngsten Sohn von Darrin und Eranda, während ihm Sena und die jüngste Tochter Lelanda folgten. Er starrte Noth mit dunklen Augen an.
Noth stieß langsam die Luft aus. Lian musste nach den Ereignissen in der Kapelle direkt hierhergelaufen sein, um sich zu vergewissern, dass es Eranda und Sena gutging.
»Noth«, sagte Eranda, und ihre Stimme verriet ihre Anspannung. »Was im Namen der Unterwelt ist passiert? Lian weigert sich, darüber zu sprechen, wir wissen nicht, was …«
»Bitte«, unterbrach Noth sie. »Ich würde sie gern erst einmal hinlegen und nachsehen, ob sie unverletzt ist.«
Darrin sah zuerst Noth und dann Winter an. Der Mann war Noth gegenüber nie besonders freundlich gewesen, aber er hatte sich auch nie feindselig verhalten. Noth hatte Winter in sein Haus gebracht, weil er hoffte, dass er sich auch jetzt anständig verhielt.
»In Ordnung«, sagte Darrin und sah Eranda an. »Hol die Kinder aus dem Schlafzimmer und gib den beiden einen Augenblick allein.« Er schaute Noth streng an. »Danach erzählt uns Noth, was passiert ist.«
Noth legte Winter auf das Bett und deckte sie sanft mit allen Decken zu, die er finden konnte. Sie regte sich und zuckte in der Dunkelheit einmal kurz. Noth erstarrte. Ihre Verletzungen waren nicht schwer, und sie würde am nächsten Morgen geschwächt, angeschlagen und mit Kopfschmerzen aufwachen, aber ansonsten würde es ihr gutgehen. Er hoffte, dass sie nicht aufwachte, während er noch da war, aber sie blieb still liegen.
Er erinnerte sich, wie er ihr einmal von dem Drang, Pranna zu verlassen, erzählt hatte. Das war bei einer der seltenen Gelegenheiten gewesen, als sie mit dem Boot ihres Vaters rausgefahren waren. Es war auch einer der wenigen Tage gewesen, an denen er ihre volle Aufmerksamkeit gehabt hatte. Sie hatte sich ebenfalls schon immer danach gesehnt, alles hinter sich zu lassen. Die tiellanischen Traditionen hatten Winter offenbar nie wirklich am Herzen gelegen.
»Warum tust du es dann nicht?«, hatte sie gefragt und auf das graue Meer hinausgestarrt. Der Himmel war wolkenverhangen gewesen, und über dem Golf hatte sich ein dünner Nebelstreif gebildet.
»Weil ich Angst habe«, hatte er geantwortet. »Dieser Ort hier hält mich bei Verstand. Wenn ich weggehe … Ich habe Angst vor dem, was dann aus mir werden könnte.« Er hatte gelacht. »Was nicht heißt, dass ich mich nicht vor dem fürchte, was ich tun könnte, wenn ich hierbleibe.«
Sie hatte ihn mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen angesehen. In diesem Augenblick hätte er es ihr beinahe gesagt. Er hätte ihr fast alles erzählt, von seinen Alpträumen, den Gesichtern, die er sah, wenn er die Augen schloss. Er war kurz davor gewesen, hatte es dann aber doch nicht getan.
»Wenn ich bei dir bin, bei Bahc und den anderen«, hatte er stattdessen gesagt, »habe ich das Gefühl, als könnte ich es schaffen. Als könnte ich ein gutes Leben führen. Vielleicht sogar ein guter Mann sein.« Es war nicht wirklich eine Lüge gewesen. Er hatte es so empfunden. Aber er konnte nicht ständig in ihrer Nähe sein.
Er wusste noch genau, wie die Wellen sanft gegen das Boot geschlagen hatten. Wie Winters schwarze Augen die Schönheit der Welt, die so strahlend und funkelnd vor ihr lag, trotz ihrer Dunkelheit in sich aufzunehmen schienen.
»Wenn ich in deiner Nähe bin«, hatte er ihr gestanden, »dann möchte ich irgendwie … ein besserer Mensch sein.«
In diesem Moment hatte er gedacht, dass er dieses Mädchen lieben könnte. Aber er wusste, dass sie nicht dasselbe für ihn empfand, daher hatte er es dabei belassen. Dann war Bahc mit dem Heiratsangebot auf ihn zugekommen, und es hatte so ausgesehen, als würden sie beide davon profitieren … Also hatte Noth ja gesagt. Er hatte seine eigenen Wünsche über alle anderen gestellt, sich für wichtiger gehalten. Obwohl er gewusst hatte, was sie sich wirklich wünschte, hatte er beschlossen, sie zu heiraten – weil er jemanden haben wollte, der ihn erdete, und sie war dafür nun einmal die beste Wahl.
Und jetzt war ihr Vater tot. Seinetwegen.
Noth erschauderte. Die dünnen Treibholzwände des Hauses schützten einen nicht vor dem Wind und der Kälte. Er kniete sich hin und legte den Kopf auf Winters Brust. So verharrte er lange Zeit, spürte sie unter sich, und nach und nach wurde die Angst, die an seinem Magen zerrte, von Leere ersetzt, während er an das dachte, was er als Nächstes tun musste.
Dann stand er langsam auf und berührte ihr Gesicht mit den Fingerspitzen. Es war jetzt seine Pflicht, diese Frau zu beschützen. Er schuldete es ihr. Und das konnte er am besten tun, indem er so weit wie möglich fortging.
»Bahc ist tot«, berichtete Noth. »Ebenso wie Dent.« Er bedauerte die Grausamkeit seiner Worte, aber ihm blieb nicht viel Zeit. Eranda keuchte auf, aber er ignorierte es und sprach weiter. »Die Priesterin und zwei ihrer Elevinnen wurden ebenfalls getötet. Ich musste Gord bewusstlos zurücklassen.«
»Was ist mit Winter?«, wollte Lian wissen.
»Es geht ihr bald wieder gut«, versicherte Noth ihm, sah seinem Gegenüber jedoch nicht in die Augen. Tohn war inzwischen in Lians Armen eingeschlafen, und Lelanda klammerte sich an das rechte Bein des jungen Mannes. Lian würde eines Tages einen guten Vater abgeben. Wieder stiegen Schuldgefühle in Noth auf, weil Bahc ihn gebeten hatte, Winter zu heiraten, und er zugestimmt hatte. Ansonsten hätten sie und Lian vielleicht ein glückliches Leben führen können und Bahc wäre jetzt nicht tot.
Was geschehen ist, ist geschehen, sagte er sich.
»Wegen ihr bin ich zu euch gekommen«, erklärte er und sah erst Eranda, dann Darrin und schließlich Lian an. »Kümmert euch um sie. Sie wird erst morgen früh wieder aufwachen, dann sollte jemand bei ihr sein. Jemand muss über sie wachen.« Noth biss die Zähne zusammen. Es fiel ihm ungewöhnlich schwer, die richtigen Worte zu finden. »Einer der Angreifer ist entkommen. Der Mann, der die Priesterin getötet hat. Wenn ich gehe, wird er mir folgen.«
»Du willst gehen?«, fragte Eranda und starrte ihn mit leerem Blick an.
»Noch heute Nacht«, bestätigte Noth. »Ich gehöre hier nicht hin. Das habe ich nie. Die Stadtwache sucht schon seit dem Tag, an dem ich hergekommen bin, nach einem Grund, um mich aus der Stadt zu vertreiben. Jetzt wird man mir die Schuld für das Massaker in der Kapelle in die Schuhe schieben, man wird mir alles anlasten. Aber ich möchte, dass ihr euch um Winter kümmert. Ihr seid jetzt alles, was sie noch hat.«
»Du bist ihr Mann.« Lians Augen blitzten auf. Den jungen Tiellaner hatte die Hochzeit schwer getroffen, und jetzt, da Noth Winter im Stich ließ, würde das Misstrauen des Jungen nur noch größer werden.
Aber Noth hatte keine Zeit, um ihm zu erklären, dass es keinen anderen Weg gab.
»Sie wird hier bei euch sicherer sein als bei mir. Soweit es mich betrifft, hat die Zeremonie niemals stattgefunden.« Lians Augen funkelten vor Zorn, aber Noth konnte ihm ansehen, dass er seiner Meinung war. Sein fehlender Widerspruch bestätigte das. Es schien, als hätte Noth die richtige Entscheidung getroffen.
»Werdet ihr das für mich tun?«, fragte er.