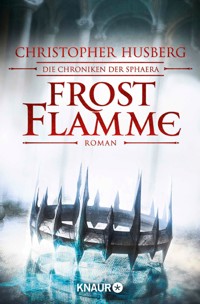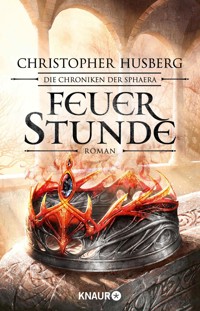
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeit der Dämonen
- Sprache: Deutsch
Eine Magierin verliert die Kontrolle über ihre Kräfte. Ein Krieger verliert sich im Ringen mit seiner Vergangenheit. Und einer ganzen Welt droht die Vernichtung. Mit »Feuerstunde« setzt Christopher Husberg seine epische Fantasy-Saga »Die Chroniken der Sphaera« fort: Auf der Sphaera erhebt sich ein neuer Glaube, angeführt von der Prophetin Jane und ihrer Schwester, der ehemaligen Priesterin Cinzia. Noth hat sich geschworen, die beiden Frauen zu beschützen, damit die Opfer, die sie alle gebracht haben, nicht umsonst gewesen sind. Doch Gefahr droht nicht nur von der mächtigen Kirche und vom Assassinenorden der Nazaniin: Noth wird schlimmer denn je von quälenden Erinnerungsfetzen heimgesucht. Zur gleichen Zeit findet jenseits des Bluttores in Roden eine junge Tiellanerin einen neuen Beschützer – der ihre einzigartige Begabung für seine eigenen finstern Zwecke einzusetzen gedenkt. Band 2 der großen High Fantasy-Reihe »Zeit der Dämonen«! »Christopher Husberg hat mit seinen Chroniken der Sphaera eine prächtige Fantasy-Welt erschaffen.« Denglers-buchkritik.de In der Reihe »Zeit der Dämonen« bisher erschienen: Frostflamme: Die Chroniken der Sphaera Feuerstunde: Die Chroniken der Sphaera Blutkrone: Die Chroniken der Sphaera
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christopher B. Husberg
Feuerstunde
Die Chroniken der Sphaera
Ins Deutsche übertragen von Kerstin Fricke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Auf der Sphaera erhebt sich ein neuer Glaube, angeführt von der Prophetin Jane und ihrer Schwester, der ehemaligen Priesterin Cinzia. Knoth hat sich geschworen, die beiden Frauen zu beschützen, damit die Opfer, die sie alle gebracht haben, nicht umsonst gewesen sind. Doch Gefahr droht nicht nur von der mächtigen Kirche und vom Assassinenorden der Nazaniin: Noth wird schlimmer denn je von quälenden Erinnerungsfetzen heimgesucht. Zur gleichen Zeit findet jenseits des Bluttores in Roden eine junge Tiellanerin einen neuen Beschützer – der ihre einzigartige Begabung für seine eigenen finsteren Zwecke einzusetzen gedenkt.
Inhaltsübersicht
Widmung
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil II
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Intermezzo
Teil III
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Teil IV
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Epilog
Dank
Für Rachel (wieder einmal),
weil wir miteinander verwoben sind
und dies ebenso das deine ist wie das meine.
Teil I
Jene, die zurückgelassen wurden
Kapitel 1
Eine Frau schläft. Eine Frau schläft, und sie träumt.
Ihre Träume winden sich umeinander und sind voller Löcher, und obwohl sie schläft, fragt sich die Frau, wer sie eigentlich ist. Die Frau ist eine Frau, vermutet sie. Außerdem ist sie Tiellanerin, und das scheint wichtig zu sein, aber es fällt der Frau im Moment schwer, sich einzuordnen. Wenn die Frau Tiellanerin ist, dann ist sie auch eine Tochter; eine Tochter, die gern jagt und fischt, die es liebt, sich zwischen den Bäumen und auf dem Wasser draußen aufzuhalten. Wenn die Frau Tiellanerin ist und eine Tochter, dann ist sie ebenfalls eine Ehefrau. Der Mann der Frau muss tot sein. Die Frau hat ihren Mann geliebt, aber wenn sie an sein Gesicht denkt, sieht sie es nur verschwommen vor sich. Wenn die Frau Tiellanerin ist, eine Tochter, eine Jägerin, eine Fischerin, eine Ehefrau, wenn sie all das ist, dann ist sie mindestens noch etwas anderes.
Die Frau ist eine Waffe.
Doch der Verstand der Frau scheut vor diesem Gedanken zurück. Die Frau weiß, dass sie nicht daran denken darf. Der Frau ist bewusst, dass solche Gedanken ihr nur Schmerz, Kummer und Traurigkeit bereiten.
Also lässt die Frau ihre Gedanken stattdessen wandern. Ihr Geist dehnt sich aus, und sie schwebt durch die Empfindungen jener, die um sie herum sind. Auch durch die des Wachmanns, der an ihrer Tür vorbeigeht. Der Verstand der Frau beobachtet ihn, folgt ihm, sieht, was er sieht, und weiß, was er weiß, bis sie zu ihm geworden ist.
Draußen ist der Himmel grau, und die Luft ist kalt, aber im Inneren ist die Luft auch nicht viel wärmer. Enri Crawn geht schnellen Schrittes durch den Kerker und dreht eine letzte Runde, bevor er nach Hause zu seiner Frau zurückkehrt.
Enri erschaudert, als er an einer der Zellen vorbeikommt, auch wenn er nicht weiß, ob der Grund dafür die Kälte oder das Mädchen in dieser Zelle ist. Das verdammte tiellanische Mädchen. Das Mädchen, das offenbar ein ganzes Imperium auf den Kopf gestellt hat. Den Gerüchten zufolge ist das Mädchen eine Assassine aus Khale, die man hergeschickt hat, um den Kaiser zu töten. Und jetzt ist der Kaiser tot. Doch dass das zarte Mädchen in dieser Zelle – nur eine Tiellanerin, um Cantas willen! – den mächtigsten Mann in ganz Roden ermordet haben soll, will Enri einfach nicht glauben. Fast wäre er geneigt, Fragen zu stellen. Aber Enri hat noch nie zuvor Fragen gestellt.
Eigentlich war ihm der Kaiser auch ziemlich egal. Enri Crawn wird als Gefängniswärter leben und sterben, ohne dass irgendein Kaiser überhaupt Notiz von ihm nimmt. Es überrascht ihn selbst ein bisschen, dass der Gedanke daran, dass sein Kaiser nun tot ist, nichts als Leere in ihm heraufbeschwört. Und der Tokal-Ceno ist auch nicht mehr. Enri erinnert sich noch an das, was er letztens in Wazels Schenke gehört hat: dass ein Mann wie der Kaiser nach seinem Tod eine Leere hinterlässt, ein großes Loch, das gefüllt werden muss. Derart philosophische Gedanken sind jedoch vergessen, sobald er die Steinmauern des schaurigen Kerkers hinter sich lässt und sich auf den Heimweg begibt.
Die Luft ist drinnen nicht viel wärmer als draußen. Seine Frau Lisala steht in der Küche, und bei ihr ist Keiten Gliss. Enri runzelt die Stirn. Der verfluchte Keiten Gliss. Gliss ist einer der Köche im Haus Amok, und es ist wichtig – erst recht in Zeiten wie diesen –, Verbindungen zu einem solchen Haus zu haben. Aber Enri Crawn fragt sich dennoch, warum dieser Mann so viel Zeit mit Enris Frau verbringt. Enri würde der Sache am liebsten auf den Grund gehen … aber nein. Nicht heute, sagt er sich. Heute will er nur zu Abend essen, die Füße hochlegen und seine Pfeifchen rauchen. Außerdem stellt Enri Crawn nie Fragen.
»Ich sollte lieber gehen«, meint Keiten schließlich.
Lisala lächelt ihn an. »Danke für den Besuch«, sagt sie. »Wir freuen uns immer über deine Gesellschaft.« Enri legt polternd die bestiefelten Füße auf den kleinen Tisch vor seinem Sessel und zieht seine Pfeife und den Tabak aus der Jackentasche.
Keiten Gliss tritt in den trostlosen Abend hinaus und verspürt schon jetzt eine leichte Traurigkeit, weil er Lisala verlassen muss. Natürlich bemitleidet er den armen Narren Enri, auch wenn dieser kein schlechter Mann ist – ein guter Mann ist er jedoch auch nicht, allerdings lässt sich das auch nicht von Keiten behaupten. Enri hat schlichtweg die falsche Frau geheiratet. Mit etwas Glück wird Keitens Plan, mit dem er diesen Zustand zu ändern gedenkt, bald ausgereift sein.
Es fängt an zu regnen, und Keiten flucht. Die winterlichen Schneefälle sind eine Sache – zwar furchtbar kalt, aber auch wunderschön, obwohl der Schnee überall haften bleibt. Regen kann Keiten jedoch nicht ausstehen. Dadurch wird die Umgebung nicht schöner, nur nass, glitschig und unerfreulich wie die ganze Unterwelt. Zu dieser Jahreszeit, dem Übergang vom Winter zum Frühling, kann sich das Wetter nie entscheiden, was es will. Keiten zieht die Jacke enger um sich zusammen, als der Regen zunimmt und ihn durch den Stoff bis auf die Haut durchnässt.
Er hastet durch die nassen Straßen, ärgert sich über den Regen und ist enttäuscht, weil er Lisala verlassen musste, bis er sein Ziel schließlich erreicht: Schloss Amok. Mit einem erleichterten Seufzer schlüpft Keiten durch das Tor und nickt dem Wachmann zu, bevor er den Hof überquert und sein Quartier betritt, um sich dort ans warme Feuer zu setzen.
Sergeant Desmon Durii, Torwächter im Schloss Amok, runzelt die Stirn, als der dämliche Koch an ihm vorbeieilt, nickt ihm aber dennoch zu. Höflichkeit hat noch niemandem geschadet, hat Desmons Großmutter immer gesagt. Es gibt diverse andere Dinge, mit denen man anderen wehtun kann, und Desmon weiß viel darüber, aber Höflichkeit gehört nicht dazu.
Der Regen plätschert auf Desmons Rüstung. Von seinem Posten am Tor kann er auf die Stadt blicken, und er fragt sich, was aus Haus Amok, aus Izet und aus ganz Roden werden wird. Der Kaiser ist tot, und Desmon weiß nicht, was er davon halten soll. Noch viel weniger kann er den Tod des Tokal-Ceno einordnen, des Oberhaupts einer Religion, die in Roden seit Jahrhunderten nicht existierte, in den letzten zehn Jahren jedoch einen neuen Aufschwung erlebt hat. Desmon würde eher um den Kaiser als um den Tokal trauern, doch sein Lord hatte großen Anteil am Wiederauftauchen des Ceno gehabt.
Lord Daval Amok hat Desmon immer gut behandelt, daher trauert Desmon ebenso wie sein Lord. Aber die Spannungen werden immer größer, da die Häuser den leerstehenden Thron umkreisen und Kaiser Grysole weder Kinder noch Erben hinterlassen hat. Den Gerüchten zufolge war er mit Andia von Haus Luce verlobt, und Haus Luce hat jetzt natürlich vor, das bekannt zu machen, um Andia auf den Thron zu setzen, was ohne jegliche Beweise allerdings schwierig werden könnte. Haus Amok verfügt zwar nicht über die größte Armee und ist auch nicht die wohlhabendste Adelsfamilie in Roden, aber trotz allem ein hohes Haus, sodass seine Mitglieder durchaus Ansprüche auf den Thron anmelden könnten. Ob sich sein Herr diese Last tatsächlich aufbürden möchte, weiß Desmon jedoch nicht. Er hat Daval Amok eigentlich immer als eher zurückhaltenden Mann eingeschätzt.
Desmon ist besorgt wegen der Dinge, die sich in den kommenden Wochen zutragen werden. Der Kampf um den Thron wird dazu führen, dass weitere Angehörige von Adelshäusern ihr Leben lassen. Aus diesem Grund muss Desmon Durii auch wachsam sein. Sein Lord schwebt in Gefahr, und es ist Desmons Aufgabe, ebenso wie die der anderen Soldaten, Daval Amok zu beschützen.
»Verzeiht, Sergeant Durii«, sagt jemand hinter ihm.
Desmon dreht sich um und steht einem Jungen gegenüber, den er auf vierzehn schätzt und der sehr nervös wirkt. Sofort stellt sich Desmon gerader hin und wischt sich geistesabwesend einige nicht vorhandene Fussel von der Rüstung, wobei er Regenwasser in alle Richtungen verspritzt.
»Was gibt es, Junge?«
»Eure Ablösung verspätet sich«, antwortet der Junge. »Weslin wollte, dass ich Euch das ausrichte.«
Desmon seufzt. »In Ordnung.« Bei Canta, das ist nicht das erste Mal, dass Weslin zu spät kommt. Desmon nimmt sich vor, ein ernstes Wort mit dem Mann zu reden. Er könnte Hauptmann Urstadt hinzuziehen, aber Desmon kümmert sich lieber selbst um solche Angelegenheiten. »Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, Junge. Und jetzt geh.«
Ich bin kein Junge, denkt Fil Parce und rennt zurück zur Feste von Schloss Amok, um wieder ins Trockene zu gelangen. Wenn Herrin Hamma der Ansicht ist, er würde auch nur einen Augenblick länger als notwendig im Freien verbringen, lässt sie ihn wieder eine Woche lang Schränke schrubben. Fil sieht zwei Dienstmägde, die die Feste durch die schmale, für Bedienstete gedachte Seitentür verlassen, läuft etwas schneller und kann gerade noch durch die Tür schlüpfen. Er grinst breit, als die Mägde draußen überrascht aufkreischen. Aber eigentlich sind sie ihm egal, da sie sein Spiel ohnehin nicht verstehen.
Fil hat sein Tagwerk bereits erledigt und trottet nachdenklich durch den Dienstbotenkorridor. Desmon ist bloß eine Hauswache. Wäre der Mann so gut, wie alle behaupten, dann würde er zur persönlichen Armee des Kaisers gehören oder gar zu den Schnittern. Doch stattdessen ist Desmon hier im Schloss Amok und hält Wache an einem Tor, für das sich niemand interessiert.
Fil erreicht die Tür zur großen Halle, die mit Wandteppichen, Gemälden und glänzenden Rüstungen geschmückt ist. Nein, ein guter Mann ist nicht nur ein guter Krieger, er macht auch etwas aus seinem Leben. Doch bei Desmon scheint nur Stillstand zu herrschen.
Aber Fil ist davon überzeugt, dass es bei ihm anders sein wird. Er hat mit dem Schwert trainiert, was ihm gewiss zugutekommt – na ja, vielmehr mit einem Stock, der seiner Meinung nach etwa die Ausmaße eines Schwertes hat. Weslin hat ihm geholfen. Fil mag Weslin nicht. Der Mann kann zwar einige hilfreiche Dinge über Schwertkämpfe erzählen, doch er sagt auch komische Sachen zu Fil, bei denen sich dieser sehr unwohl fühlt. Fil überlegt, ob er Desmon davon erzählen soll. Vielleicht will Desmon ja auch, dass Fil das Kämpfen lernt. Aber Weslin hat Fil ermahnt, dass er mit Desmon auf keinen Fall über ihr Training sprechen darf.
Die Tür, vor der er wartet, wird ein Stück geöffnet, und Meister Frenn blickt missbilligend auf Fil herab. Bevor der alte Mann jedoch etwas sagen kann, schlüpft Fil durch den Türspalt. Er grinst breit. Zweimal an einem Tag! Dies muss sein Glückstag sein!
Fil geht durch die große Halle. Die Wandbehänge und die Bilder sind ihm ziemlich egal, aber er bewundert die Rüstungen. Hin und wieder malt er sich aus, wie er eines Tages selbst eine solche Rüstung tragen und große Schlachten schlagen wird. Spaßeshalber nimmt er die Fechtstellung ein, die Weslin ihm beigebracht hat, und streckt einen Arm aus, als würde er ein Schwert in der Hand halten. Bevor er auch nur einen Schritt machen kann, hört er jedoch ein leises Lachen hinter seinem Rücken.
»Kämpfst du wieder gegen Geister, Fil?«
Er dreht sich um und steht Cova Amok gegenüber, Lord Davals jüngster Tochter, die ihn anlächelt. Fil wird augenblicklich rot, da Cova Amok seiner Meinung nach der schönste Mensch ist, den er je gesehen hat, und nun hat sie ihn bei seinem Schattenschwertkampf erwischt – wieder einmal. Bestimmt hält sie ihn ebenso wie Desmon für nichts weiter als einen kleinen Jungen. Cova ist fünf Jahre älter als er, benimmt sich jedoch manchmal so, als wäre sie seine Mutter.
»Ich habe nur geübt«, erwidert Fil und starrt zu Boden.
»Man übt auf dem Übungsplatz und nicht in der großen Halle«, erklärt Cova. Ihr hellblaues Kleid fällt ihr perfekt über die Hüften und reicht bis auf den Boden. Fil achtet darauf, weder Covas Kleid noch ihre Figur darunter zu lange anzusehen. Herrin Hamma hat ihn gewarnt, dass ein solches Verhalten ein schwerwiegender Affront gegen jemanden von hoher Geburt sei. Doch einen Blick muss Fil auf sie werfen. Schließlich hält er Cova nicht umsonst für das Schönste, was es auf der Sphaera gibt. Als er ihr in das schöne Gesicht blickt, das von Haar in der Farbe gesponnenen Goldes eingerahmt wird, lächelt Fil.
Cova Amok erwidert Fils Lächeln und wartet darauf, dass er etwas sagt, doch das tut er nicht. Sie findet das schade und befürchtet schon, ihre Worte wären zu barsch gewesen. Dabei ist es ihr einerlei, ob der Junge in der Halle »übt« oder nicht. Aber jetzt, wo er sie mit aufgerissenen Augen und diesem albernen Grinsen anstarrt, stößt sie einen Seufzer aus.
»Ich würde ja gern noch mit dir plaudern«, sagt sie, »aber es ist schon spät.«
Fil nickt beinahe unmerklich und hat die Augen noch immer weit aufgerissen. Kopfschüttelnd schreitet Cova durch die große Halle. Sie mag den Jungen, auch wenn er zuweilen geistesabwesend ist oder sie angafft. Cova kann es nicht ausstehen, von Männern angestarrt zu werden, und das gilt auch für Fil. Aber er ist noch ein Kind und weiß es nicht besser. Bei Männern sieht die Sache schon anders aus. Männer lügen und verändern sich. Sogar Covas Vater, den sie ihr ganzes Leben lang geliebt und respektiert hat, ist irgendwie anders geworden. Cova kann nicht genau sagen, was sich verändert hat, aber irgendetwas ist passiert. Die Art, wie er spricht und wie er sie ansieht, wenn er ihr ein Lächeln schenkt … Er ist noch immer ihr Vater, aber er ist nicht mehr derselbe. Cova weiß, dass ihr Vater dem Tokal-Ceno und dem Kaiser sehr nahegestanden hat, und ihr Tod hat sich auf jeden Adligen ausgewirkt. Bei Canta, selbst Cova spürt die Auswirkungen.
Vielleicht habe ich mich ja verändert, sinniert Cova. Möglicherweise bin ich diejenige, die nicht mehr so ist wie früher. Cova ist jetzt eine erwachsene Frau – das jüngste von vier Kindern, das jetzt kein Kind mehr ist. Die Sorgen der Welt betreffen nun auch sie, und der sich anbahnende Krieg bedroht ihre Familie und die Zukunft ihres Hauses. Cova streckt eine Hand aus und berührt einen der Wandteppiche. Wäre ihre Mutter noch am Leben gewesen, dann hätte sie jetzt mit ihr geschimpft. Cova war nie gut mit ihrer Mutter ausgekommen, aber jetzt vermisst sie sie doch.
Sie geht die Stufen am Ende der großen Halle hinauf, um zu den oberen Stockwerken der Feste und den Kammern ihrer Familie zu gelangen. Dabei kommt sie an den Zimmern vorbei, in denen ihre Brüder einst wohnten. Heute sind sie alle verheiratet und leben auf Anwesen außerhalb von Izet oder sind in andere Städte gezogen. Daher ist Cova jetzt so gut wie allein. Sie sieht, dass die Tür zur Kammer ihres Vaters offen steht und er reglos mitten im Raum verharrt. Dann dreht er sich um, als hätte er ihre Schritte gehört.
»Cova«, sagt er und lächelt, aber Cova ist wieder einmal erschüttert, als sie die Leere in seinen Augen erblickt.
»Hallo, Vater.« Cova erwidert sein Lächeln und knickst höflich.
»Komm herein«, bittet er sie. »Komm und setz dich zu mir, so wie du es als kleines Mädchen immer gemacht hast. Ich könnte Rolof heraufbitten, damit er uns einige von Tolokins Sagen vorliest, die du als Kind immer so gemocht hast.«
Zuerst ist Cova derart verblüfft über die plötzliche Nostalgie ihres Vaters, dass sie nicht weiß, was sie sagen soll. Sie haben seit Jahren nicht mehr über solche Dinge gesprochen. Einerseits würde sie sehr gern tun, was ihr Vater vorschlägt, um sich ihm erneut derart verbunden zu fühlen, andererseits hat sie das Gefühl, es wäre besser, nicht durch diese Tür zu gehen.
»Heute nicht, Vater«, lehnt sie ab, »aber vielleicht ein anderes Mal. Ich bin sehr müde und würde mich gern hinlegen.« Cova kann nicht genau sagen, warum das so ist, aber in diesem Augenblick vertraut sie ihrem Vater nicht. Sie weiß nicht, was er tun oder zu ihr sagen wird, sobald sie erst einmal allein in seiner Kammer sind.
»Natürlich, Tochter.« Lord Amok nickt. »Dann eben ein anderes Mal. Schlaf gut, meine Liebe.«
Lord Daval Amok lächelt, als seine Tochter weitergeht. Er liebt Cova und will nur das Beste für sie. Ebenso wie er seine ganze Familie und Roden liebt; ebenso wie er die Sphaera liebt und alles dafür tun würde, damit sich alles zum Besten wendet. Lord Daval Amok schreitet schweigend durch die Kammer zum großen Spiegel über dem Kaminsims. Er ist ein alter Mann, doch der Schmerz, der einst seine Gelenke plagte, und die Müdigkeit, die sich früher schon nach dem Erklimmen eines Treppenabsatzes einstellte, sind verflogen.
Er betrachtet sein Spiegelbild und hat nicht etwa den alten Mann mit der runzligen Haut, dem grauen, zurückweichenden Haar und den müden Augen unter schweren Lidern vor sich, an dessen Anblick er sich inzwischen gewöhnt hat. Nein, er sieht etwas ganz anderes in diesem Spiegel. Eine Dunkelheit. Einen Schädel, nackt und schwarz, als wäre er verkohlt und poliert worden, der von dunklen Flammen umgeben ist.
Winter wachte mit einem Ruck auf und drückte sich in eine Zellenecke, doch sie wusste sofort, dass sie nicht geschlafen hatte. Ihr Verstand schien in letzter Zeit irgendwie unstet zu sein; er wanderte umher und haftete sich an das nächstbeste Bewusstsein. Winter hatte sich fast schon daran gewöhnt. Es fühlte sich nicht unangenehm an, und alles, was sie aus dieser schrecklichen Zelle, aus der Realität und den Erinnerungen an das, was Vorher passiert war, herausholte, war ihr mehr als recht.
Aber dieses Mal war es anders. Es kam ihr falsch vor. Das Bewusstsein des Mannes, in das sie zuletzt eingedrungen war, glich keinem der anderen, die sie gespürt hatte. Und das, was sie sah, als der Mann in den Spiegel blickte …
Schwärze. Ein dunkler Schädel, der in finsteres Feuer gehüllt war.
Das Bild blitzte immer wieder vor Winters innerem Auge auf, wenn sie die Lider schloss. Es erinnerte sie an das, was Vorher passiert war, an die schrecklichen Dinge, die sie gesehen hatte, und mit diesen Bildern kehrten auch die Gefühle zurück, die wiederum das Wissen mit sich brachten.
Winter ballte die Fäuste und biss die Zähne zusammen. Sie atmete tief und langsam ein und wieder aus. Aber die Enge in ihrer Brust, diese Kraft, die ihr Herz zu umklammern schien, wich einfach nicht.
Mörderin, flüsterte eine Stimme in ihrem Verstand.
Sie schüttelte den Kopf und wiegte sich auf dem Boden ihrer Zelle vor und zurück. Sie war allein. Ihre Freunde waren fort. Ebenso ihre Kraft. Sie war ganz allein, und nichts als der Tod erwartete sie.
Kapitel 2
Es ist Zeit, mein Lord.« Urstadts Stimme drang leise, aber klar aus dem Gang herein.
»Ich brauche noch einen Augenblick«, erwiderte Daval, dessen Aufregung immer größer wurde. Urstadt erging es gewiss nicht besser, immerhin war es ihr Plan, der nun aufging.
Daval kleidete sich an. Die lange dunkelgrüne Robe mit der riesigen Kapuze rief eine ganz andere Art von Respekt hervor als seine verzierte Kleidung, die seine Position in einem bedeutenden Adelshaus mit sich brachte. Als Lord Amok besaß Daval sehr viel Macht, und ihm wurde Respekt erwiesen. Aber als neuer Tokal-Ceno gebührte ihm noch sehr viel mehr.
»Mein Herr«, begrüßte ihn Urstadt, als er aus seiner Kammer trat.
Daval nickte ihr lächelnd zu. Urstadt trug wie immer ihre Halbrüstung: ein stählerner Kürass mit Bauchreif, beides mit einer dünnen Schicht aus Rotgold besetzt, dazu passende Handschuhe und Beinschienen. Das Kettenhemd unter der Platte bestand aus winzigen Gliedern – eine neue Erfindung der kaiserlichen Schmiede, durch die man sowohl leichtere als auch robustere Teile fertigen konnte. In einem Arm hielt sie ihren Helm, eine Barbuta aus demselben rotvergoldeten Stahl, den man so graviert hatte, dass die Vorderfront wie ein Schädel aussah und die mit schwarzen Edelsteinen nahe den Augen geschmückt war. Das ergab einen seltsamen Kontrast, da Urstadt in ihrer Rüstung beinahe feminin aussah, der Schädel jedoch nicht zum ganzen Rotgold zu passen schien. Doch als sie zu Davals Wachhauptmann befördert worden war, hatte er ihr selbstverständlich die Rüstung schmieden lassen, die sie sich wünschte. Wenn Daval es sich recht überlegte, hatte er seinen Wachhauptmann seitdem kein einziges Mal mehr ohne diese Rüstung gesehen. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn sie sogar darin schlief.
An Urstadts Seite hing ein Kurzschwert, dessen Scheide und Griff gleichermaßen aus Rotgold bestanden; ihre Lieblingswaffe hielt sie jedoch in der anderen Hand: ihre Gleve, eine Stangenwaffe mit geschwungener Klinge an einem Ende. Es war ein krudes, hässliches Ding, größer als sie und mit einer eingedellten Klinge aus dunklem Stahl sowie einem Schaft aus verschrammter Schwarzbuche. Einige verspotteten Urstadts Rotgoldrüstung, aber ihre Gleve, mit der sie meisterhaft umgehen konnte, sorgte dafür, dass ihnen das Lachen rasch wieder verging.
»Verratet mir eins«, bat Daval sie, während sie durch den Korridor gingen. »Wie läuft unser kleines Exempel?«
»Recht gut«, antwortete Urstadt. »Haus Farady hat den Köder geschluckt.«
Daval nickte. Davon war er ausgegangen. Die Macht, die sie dadurch erlangen konnten, dass sie Davals Fischhandel untergruben, musste unwiderstehlich auf sie gewirkt haben. Haus Amok war aus vielerlei Gründen eines der hohen Häuser, aber der wichtigste Grund war der Handel. Sie waren seit mehreren Hundert Jahren auf Fisch und andere Meeresfrüchte spezialisiert, doch im Laufe der Zeit hatten sich die Amok-Lords noch andere Einkommensquellen gesucht, von den Marmorsteinbrüchen in der Nähe der Westküste bis hin zu den Tiermenschen am Gerissenen Horn, der Halbinsel am Nordostende Rodens. Indem es die Fischindustrie von Haus Amok ausschaltete, könnte es einem unbedeutenden Haus wie Farady gelingen, Amok bis in die Grundfesten zu erschüttern.
Allerdings war ein erschüttertes Fundament noch kein zerbrochenes, und aus diesem Grund hatten Daval und Urstadt die ganze Sache inszeniert.
Urstadt führte Daval in die Zellen unterhalb der Feste. Anders als im Kaiserpalast war der Kerker von Schloss Amok bescheiden und bestand aus wenigen unterirdischen Zellen, die in der Nähe der Weinkeller lagen und nicht besonders gut beschützt wurden.
Das war auch gar nicht nötig. Im Allgemeinen hielt man hier nur andere Adlige fest, die kurz darauf wieder freigelassen wurden, nachdem man sich auf entsprechende Bedingungen geeinigt hatte. Aus diesem Grund musste auch ein gewisser Komfort geboten werden. Daval war nicht überrascht, dass Darst Farady in einer der Zellen grinsend auf einer Liege ruhte. In den Zellen rechts und links von ihm wurde je ein anderer Mann festgehalten, doch es war offensichtlich, dass Darst der Anführer der drei war.
»Der große Lord Amok höchstpersönlich.« Darst grinste noch breiter, als er Daval erblickte. »Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich so bequem untergebracht wurde.«
Daval verbeugte sich vor Darst und betrachtete den jungen Mann durch die Eisengitterstäbe hindurch. Darst stand nicht von seiner Liege auf, ein Bein hatte er darauf gestützt, das andere hing herunter. Er hatte einen Arm hinter den Kopf gelegt, um sich ein behelfsmäßiges Kissen zu schaffen.
»Dann werdet Ihr also gut behandelt?«, erkundigte sich Daval. Obwohl Darst nur ein Grünschnabel war und einem weitaus unbedeutenderen Haus angehörte, konnte und wollte Daval nicht auf die Formalitäten verzichten. Schließlich durfte er nicht den Eindruck erwecken, dass er das Gesetz brechen wollte.
Der junge Mann, der aussah, als wäre er nicht viel älter als Davals Tochter, zuckte mit den Schultern. »Ja, das kann man so sagen. Wann lasst Ihr mich wieder gehen?«
Daval holte tief Luft. »Das weiß ich noch nicht genau, mein Lord. Ihr wurdet dabei erwischt, wie Ihr auf meinem Boden Feuer legen wolltet.«
Darst lachte auf. »Das könnt Ihr mir doch nicht verdenken. Bei all den Gerüchten über Euer Lagerhaus musstet Ihr doch damit rechnen, dass es Ärger geben würde.«
»Das haben wir durchaus.« Daval seufzte. »Aus genau diesem Grund wurdet Ihr ja auch erwischt.«
»Ich bezweifle, dass Ihr Zeugen habt, die uns tatsächlich bei dieser vermeintlichen Brandstiftung gesehen haben«, erklärte Darst. »Angesichts der Tatsache, dass kein Schaden entstanden ist, sollten ein oder zwei Tage in Euren Zellen doch Strafe genug sein, findet Ihr nicht?«
In Friedenszeiten wurden kleinere Streitigkeiten zwischen den Häusern häufiger auf diese Art bereinigt. Die beklagte Partei wurde für eine vereinbarte Zeitspanne im Kerker des betroffenen Hauses eingesperrt und dann ohne weitere Strafverfolgung wieder freigelassen. Bei schwereren Vergehen gab es hin und wieder einen formellen Prozess, doch so etwas geschah nur selten. Meist regelten die Vertreter der einzelnen Häuser die Dispute bei informellen Verhandlungen.
Doch momentan waren die Zeiten nicht friedlich, daher konnte Daval auch nicht so nachgiebig sein. Außerdem sah ihr Plan natürlich vor, dass er anders handelte.
»Es ist kein Schaden entstanden?«, wiederholte Daval ungläubig. »Ihr erwartet, dass ich Euch das abkaufe?«
Darst schnaubte. »Natürlich erwarte ich das. Seht Euch doch Euer Lagerhaus an, alter Mann. Es steht ja noch.«
Urstadt rammte ihre Gleve gegen die Gitterstäbe, dass es krachte. Daval zuckte bei dem Geräusch zusammen, und Darst wäre beinahe von seiner Liege gesprungen.
»Ihre werdet Lord Amok mit dem ihm gebührenden Respekt anreden«, knurrte Urstadt, deren Stimme so hart klang wie das Eisen, gegen das sie eben geschlagen hatte.
»Bei der aufsteigenden Canta«, murmelte Darst und setzte sich auf. »Ihr müsst deswegen ja nicht gleich aus der Haut fahren.«
»Beherzigt den Rat meines Hauptmannes lieber, mein Lord«, warnte Daval den jungen Mann leise. »Sie ist eine intelligente Frau.«
»Verratet Ihr uns endlich, wie Euer Urteil lautet? Zwei Tage? Drei? Ich bleibe auch vier, wenn Ihr darauf besteht, nur damit dieses Gespräch rasch ein Ende findet.« Darst rutschte auf der Liege herum, und Daval verkniff sich ein Grinsen. So langsam wurde dem Jungen mulmig. Gut.
»So einfach ist die Angelegenheit leider nicht, mein Lord.« Daval stieß erneut ein Seufzen aus. »Das Feuer, das Ihr gelegt habt, hat sich immer weiter ausgebreitet und ließ sich nicht mehr löschen, als endlich Hilfe vor Ort war. Wir mussten mit ansehen, wie das Lagerhaus abbrannte.«
Darst zog die Augenbrauen zusammen und blickte zu Daval auf. »Das kann nicht sein. Eure Männer haben uns erwischt, bevor wir den Brand überhaupt legen konnten.«
Daval zuckte mit den Schultern und hob die Hände. »Das behauptet Ihr, aber wie soll ich Euch das glauben? Ihr habt ja bereits zugegeben, dass Ihr in der Absicht, Feuer zu legen, dort hingekommen seid.«
»Wir … wir waren das nicht«, stammelte Darst. »Wir wollten Euch doch nur ein bisschen Angst einjagen und nicht wirklich Feuer legen. Eigentlich hatten wir nur vor, ein wenig auf Eurem Boden herumzuschleichen und uns dabei erwischen zu lassen. Das war alles.«
Daval schürzte die Lippen, trat näher an die Gitterstäbe heran und beäugte Darst. »Lügt mich nicht an, mein Lord. Mächtige Männer lügen nicht. Die Wahrheit ist unser bester Verbündeter.«
»Ich … ich lüge nicht. Wir haben kein Feuer gelegt, Lord Amok. Das schwöre ich.«
Inzwischen konnte Daval die Angst des jungen Mannes förmlich spüren, was er sehr genoss.
»Auch wenn Ihr Stein und Bein schwört, haben wir doch Zeugen, die Gegenteiliges behaupten«, entgegnete Urstadt. »Drei Personen können bestätigen, dass sie gesehen haben, wie Ihr, jeder von euch, das Feuer gelegt habt, durch das das Amok-Lagerhaus abgebrannt ist.«
»Aber …«
»Das ist eine Lüge.«
Daval runzelte die Stirn. Die letzten Worte waren nicht von Darst gekommen, sondern von einem seiner Begleiter. Zuerst war Daval versucht, den Idioten einfach zu ignorieren, aber diese Vermessenheit ärgerte ihn. Er spürte, dass von Darst Angst ausging wie Sonnenstrahlen an einem Sommertag, doch dieser andere, der gerade gesprochen hatte, wirkte bei Weitem nicht so verängstigt.
Daher machte Daval einige Schritte nach links und baute sich vor der Zelle des Mannes auf. »Ihr bezichtigt mich der Lüge?«, wollte Daval wissen.
»Es ist ein schweres Vergehen, einen Hohen Lord der Unehrlichkeit zu beschuldigen«, sagte Urstadt. »Darauf stehen harte Strafen.«
»Die Strafen interessieren mich nicht die Bohne«, entgegnete der junge Mann. Er unterschied sich sehr von Darst und schien eher Ende als Anfang zwanzig zu sein. Sein blasses, unrasiertes Gesicht war nicht das eines rodenesischen Edelmannes.
»Vielleicht sollten sie das aber«, erwiderte Daval. »Ich würde vermuten, dass sie für Euch noch härter ausfallen als für einen Eurer Freunde.« Wenn Daval richtig vermutete, handelte es sich bei diesem Mann nicht um einen Adligen, und dann wäre er auch nicht durch deren Traditionen geschützt. Hohe Lords hatten schon Männer für unbedeutendere Unverschämtheiten hinrichten lassen.
»Halt den Mund«, zischte Darst aus der Nachbarzelle. »Überlass mir das Reden.«
Der blasse, ungepflegt aussehende Mann starrte Daval weiterhin wütend an, sagte jedoch nichts mehr.
»Wir haben Euer Lagerhaus nicht abgebrannt.« Darsts Stimme klang gequält. »Aber … aber nehmen wir mal an, es wäre so gewesen. Auf welches Urteil würden wir uns dann einigen?«
Daval nickte langsam, damit der Junge glaubte, er würde tatsächlich über seine Antwort nachdenken. »Das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen«, meinte er dann. »Ein derart schwerwiegendes Vergehen wurde seit vielen Jahren nicht mehr gegen mein Haus verübt. Ich vermute … es müssten etwa sechs Monate Haft sein.«
Als er sah, wie Darst entsetzt die Augen aufriss, durchfuhr Daval ein wohliges Schaudern.
»Sechs Monate?« Der blasse Gewöhnliche ergriff erneut das Wort: »Ihr könnt uns hier keine sechs verdammten Monate festhalten!«
»Halt den Mund, Svol«, fauchte Darst. »Er kann, und er wird es tun.«
»Diese sechs Monate wären das, worauf wir uns einigen könnten, wenn Brandstiftung das Einzige wäre, das man Euch zur Last legt.« Daval beschloss, langsam zum Punkt zu kommen. »Dummerweise ist da noch mehr.«
Darst starrte Daval fassungslos an. Es war schon erstaunlich, wie sehr sich der Junge seit Beginn dieses Gesprächs verändert hatte. Seine lässige rebellische Haltung war in angespannte Panik umgeschlagen. Daval genoss den Anblick sehr.
»Was haben wir denn noch getan?«, fragte Darst, dessen Gesicht inzwischen beinahe so bleich war wie Svols.
Daval nickte Urstadt zu. Sie trat so weit vor, dass ihre Nasenspitze beinahe einen der Gitterstäbe berührte. »Darst Farady, Ihr und Eure Gefährten seid der böswilligen Brandstiftung angeklagt, durch die eines der produktivsten Lagerhäuser von Haus Amok abgebrannt ist.«
»Das wissen wir doch schon«, schaltete sich der dritte Gefangene ein. »Was werft Ihr uns noch vor?«
Interessant, dachte Daval und sah in die Zelle des Mannes, der gerade gesprochen hatte.
»Und«, fuhr Urstadt fort, »Ihr und Eure Gefährten werdet des Mordes an fünf Menschen beschuldigt, an den Arbeitern, die im Feuer umgekommen sind und die unter dem Schutz von Haus Amok standen.«
In der linken Zelle keuchte Svol auf. Darst machte einen Schritt nach hinten, und sein Gesicht war so kreidebleich wie die Zellenwände. Aber Daval ignorierte die beiden und sah dem dritten Mann fragend in die Augen. Ja, auch hier konnte er Furcht erkennen, ebenso wie Trotz. Doch da war auch noch etwas anderes.
»Die Strafe für eure Verbrechen ist der Tod«, verkündete Urstadt. »Ihr werdet übermorgen im Morgengrauen exekutiert. Gesteht eure Verbrechen, dann werden eure Familien über eure Verurteilung informiert.«
Svol keuchte immer lauter, und Daval hörte ein leises Schluchzen aus Darsts Zelle. Dieser dritte Mann sah Daval jedoch ruhig an.
»Habt Ihr etwas zu sagen, mein Lord?«, erkundigte sich Daval.
»Das habe ich in der Tat«, erwiderte der Mann. Er trat vor, sodass sie nur noch durch die Gitterstäbe getrennt waren.
»Ich kann gegen sie aussagen«, flüsterte er und nickte zu seinen beiden Mitgefangenen hinüber. »Ich habe gesehen, wie sie das Feuer gelegt haben. Sie wussten, dass sich noch jemand im Lagerhaus aufhält, doch das hat sie nicht von ihrem Vorhaben abgehalten. Ich habe alles gesehen.«
Daval musterte sein Gegenüber skeptisch. Er warf Urstadt einen Seitenblick zu, die kaum merklich den Kopf schüttelte. Dann war er also keiner von ihren Männern. Das kam unerwartet.
»Und was ist mit Euch?«, fragte Daval und drehte sich wieder zu dem Mann um. »Ihr wart bei ihnen und habt nichts unternommen, um diese Verbrechen zu verhindern, nicht wahr? Warum sollten wir Euch dann nicht auch verurteilen?«
»Ich gebe zu, dass ich sie begleitet habe«, gestand der Mann und senkte den Kopf. »Und ich werde mich bis in alle Ewigkeit dafür schämen. Aber ich möchte Abbitte leisten. Wenn Ihr mein Leben verschont, werde ich gegen sie aussagen und in Eurer Schuld stehen. Ich werde tun, was immer Ihr von mir verlangt.«
Daval kniff die Augen zusammen. Feiglinge gab es in allen Formen und Größen, wie es schien. Dieser Mann, dieser dritte Mann, war derjenige, der log. Urstadt hatte die Gerüchte über das verlassene Lagerhaus in die Welt gesetzt und jemanden angeheuert, der es in Brand steckte. Sie hatte die Leichen der ermordeten Amok-Arbeiter dort deponieren lassen. Wenn eines mit Sicherheit feststand, dann war das die Tatsache, dass Darst und seine Gefährten das Feuer nicht gelegt hatten. Somit waren sie auch nicht für die Todesfälle verantwortlich.
Und doch war dieser Mann bereit, zu lügen und zu behaupten, es wäre so gewesen, nur um sich zu retten. Er bot Daval im Gegenzug an, für immer in seiner Schuld zu stehen.
»Ihr würdet alles tun, was ich von Euch verlange?«
»Alles.«
»Wie heißt Ihr?«
»Urian, mein Lord.«
Daval betrachtete Urian kurz und nickte dann. »Ich werde über Euer Angebot nachdenken.«
Der Mann nickte, trat zurück und setzte sich ruhig auf seine Liege.
»Kommt, Urstadt.« Daval wandte sich zum Gehen. »Wir müssen ihre Familien informieren.«
»Damit werdet Ihr nicht durchkommen!«
Daraufhin drehte sich Daval noch einmal um. Darst schien seinen Mut wiedergefunden zu haben.
»Meine Familie wird es nicht zulassen! Sie wird kommen und uns retten.«
»Ja.« Daval lächelte, als er mit Urstadt hinausging. »Das will ich doch hoffen.«
Kapitel 3
Aufwachen, Nomade.«
Noth seufzte. »Ich schlafe nicht, sondern laufe neben dir her.«
»Du bist so langweilig. Außerdem sind wir bald da. Sieh nur.«
Noth hatte das Gefühl, als wäre er seit einer Ewigkeit gelaufen und hätte dabei den Boden angestarrt. Es schneite, und er marschierte weiter. Die Sonne schien, und er lief. Der verdammte Vampir neben ihm hatte es mit Witzen versucht, war ihm auf die Nerven gegangen und hatte ihn auf jede nur erdenkliche Weise geärgert, aber er hatte immer einen Fuß vor den anderen gesetzt. Er, Astrid, Cinzia und Jane waren jetzt schon seit Monaten unterwegs.
»Ich kann die Stadt ebenso gut sehen wie du.« Tinska war keine sehr große Stadt. Noth hatte diesen Namen schon einmal gehört, erinnerte sich jedoch nicht daran, jemals hier gewesen zu sein. Er hatte geglaubt, eine Stadt, die er nicht kannte, wäre eine willkommene Abwechslung, doch je näher sie ihr kamen, desto nervöser wurde er.
»Lass dir deine Freude nur nicht zu sehr anmerken«, stichelte Astrid. Sie hatte sich die Kapuze ihres großen grauen Umhangs tief ins Gesicht gezogen, obwohl die Sonne schien. Oder gerade deshalb. Noth hatte gesehen, was der direkte Kontakt mit dem Sonnenlicht bei dem Vampir bewirkte, und es war kein schöner Anblick gewesen.
»Ich freue mich doch«, murmelte Noth. »Ich lächle nur innerlich.«
Astrid schnaubte, sagte jedoch nichts weiter. Noth hätte zu gern wieder Wortgefechte mit ihr bestritten, wie sie es vor Roden getan hatten, doch die Dinge lagen jetzt anders. Und Noth hatte sich verändert, das ließ sich nicht leugnen.
Astrids Umhang verbarg ihre kleine, dünne Gestalt. Früher war es Noth schwergefallen, genau zu erkennen, wo das Monster endete und das Mädchen begann. Doch im Laufe der Zeit, die sie miteinander verbrachten, war ihm klar geworden, dass stets beide da waren. Irgendwie konnten das Monster und das Mädchen nebeneinander existieren. Noth hatte dafür Verständnis, schließlich war Astrid nicht die Einzige, der es so ging.
»Wo ist eure Familie doch gleich noch mal?«, fragte Astrid.
»Sie wird auf dem Anwesen unseres Onkels sein«, antwortete Cinzia. »Es liegt außerhalb der Stadt.«
»Ist euer Onkel so reich wie eure Eltern?«
Noth starrte Astrid zornig an. Die streitlustige Art, mit der sie der cantischen Priesterin begegnete, ging ihm langsam auf die Nerven.
Die beiden Schwestern Cinzia und Jane warfen sich einen schnellen Blick zu, sagten jedoch nichts weiter.
Astrid kicherte. »Er ist noch reicher?«, hakte sie staunend nach. »Bekomme ich dann einen eigenen Flügel im Herrenhaus? Oder nur eine eigene Etage?«
Sie schrie auf, als ein Kieselstein auf ihrer Kapuze landete. Noth drehte sich überrascht um und stellte fest, dass Jane einen weiteren kleinen Stein mehrmals mit einer Hand hochwarf und wieder auffing. Sie lächelte. »Unsere Familie ist wohlhabend«, stellte sie fest. »Finde dich damit ab.«
Noth kicherte leise. Als Astrid sich schnaufend abwandte, konnte er einen Blick unter ihre Kapuze werfen und erkannte, dass sie grinste. Zwar geriet Astrid immer wieder mit Cinzia aneinander, aber mit Jane schien sie gut auszukommen.
Cinzias Miene war nicht so leicht zu deuten. Es frustrierte Noth, dass sie ihre Gefühle so gut zu verbergen vermochte. Sie hatte ihr kastanienbraunes Haar im Nacken zusammengebunden, wodurch ihre großen haselnussbraunen Augen und ihre hohen Wangenknochen noch besser zur Geltung kamen. Aber Noth konnte nur Vermutungen über das anstellen, was sich unter ihrem ernsten Äußeren verbarg. Sie hatten beide jemanden in Roden verloren. Erst Wochen später waren Cinzia und Jane bereit gewesen, über das zu sprechen, was Kovac, Cinzias Göttinnenwache, zugestoßen war.
Noth hätte sie für verrückt erklärt, wenn er nicht mit eigenen Augen weitaus Schlimmeres gesehen hätte. Jedenfalls war Kovac nun tot, und Noth konnte deutlich erkennen, dass sein Tod Cinzia ebenso zu schaffen machte, wie ein weiterer Toter ihn belastete.
»Hoffentlich geht es ihnen gut«, flüsterte Jane und blickte auf die Stadt hinunter. Sie war die jüngere der beiden Schwestern und sah Cinzia zwar ähnlich, hatte jedoch blondes Haar und blaue Augen.
»Die Denomination wird keine weitere Hexenjägerin losgeschickt haben«, sagte Cinzia. »Noch nicht. Zuerst müssen sie sich neu formieren und einen Weg finden, wie sie erneut an uns herantreten können. Sie werden sich ihren nächsten Zug sehr gründlich überlegen.«
»Mit etwas Glück wissen sie noch nicht, wo wir uns aufhalten«, meinte Jane.
»Sie wissen genau, wo wir sind«, widersprach Cinzia ihr mit einem Kopfschütteln. »Oder zumindest, wohin unsere Familie von Navone aus gegangen ist. Sie überwachen uns.«
Noth nickte. Cinzias Worte deckten sich mit seinen bruchstückhaften Erinnerungen an die cantische Denomination. Diese Leute waren berechnend, gründlich und horteten Informationen aus allen Teilen der Sphaera.
»Du hast gesagt, die Denomination hätte noch keine neue Hexenjägerin losgeschickt«, merkte Noth an. »Aber wird sie es irgendwann tun?«
Cinzia zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich nicht. Aber sie werden eine derart unglaubliche Beleidigung nicht ungestraft lassen. Vielleicht versuchen sie es jedoch mit einem … anderen Ansatz, bevor sie uns eine weitere Hexenjägerin hinterherschicken.«
»Welchen anderen Ansatz könnten sie denn wählen?«, wollte Jane wissen.
Noth spürte, dass Cinzia ihn ansah. Sie wussten alle, wer er gewesen war, bevor er seine Erinnerung verloren hatte. Sie waren alle darüber informiert, für wen er gearbeitet und was er getan hatte.
»Oh«, sagte Jane leise.
Noth schürzte die Lippen. Er begleitete die beiden Frauen unter anderem, weil er sie beschützen wollte. Jedenfalls redete er sich das ein. Doch je mehr Zeit er mit Cinzia und Jane verbrachte, je mehr er über das erfuhr, was Kovac zugestoßen war und was sie aus den Neun Schriften übersetzten, desto mehr hatte er den Eindruck, einen neuen Sinn im Leben gefunden zu haben. Er hatte die Dunkelheit im Kaiserpalast gesehen. Er kannte die Angst und wusste, was die Dämonen in diese Welt bringen wollten. Es waren Opfer vonnöten gewesen, um die Sphaera zu schützen, und Noth wollte nicht zulassen, dass diese Opfer vergebens gewesen waren.
Daher schien es ihm am besten, bei Jane und Cinzia zu bleiben und so Winters Andenken zu ehren. Sie hatten wenigstens ein Ziel. Ganz im Gegensatz zu Noth.
Zu viert machten sie sich auf den Weg in die Stadt, und der Geruch des Meeres erinnerte Noth an Pranna. Pranna war ihm zu einer Heimat geworden, dieses Dorf, winzig im Vergleich zu Tinska, aber ebenso vom Geruch der See und dem Meereswind durchdrungen. All die Gerüche erinnerten Noth auch an andere Dinge – Dinge, die er nicht erlebt hatte, die aber dennoch in seinem Kopf waren. Er erinnerte sich an den Versuch, die ganze Sphaera zu umsegeln, wobei er vor der Küste von Andrinar beinahe sein Leben verloren hatte. Sie riefen ihm sein Leben als Pirat in den warmen Gewässern vor Alizia ins Gedächtnis, wo er nach Lust und Laune Gold, Schiffe und Leben genommen hatte. Und sie ließen ihn an Triah denken, die Stadt am Schlund der Welt, und an die finsteren Machenschaften, denen er dort gedient hatte.
Er konnte nicht behaupten, dass seine Erinnerungen klarer geworden wären, seitdem er in Izet erfahren hatte, wer – und was – er war. Vielmehr schienen sie verworrener denn je zu sein. Aber es machte auch den Anschein, als gäbe es nun mehr Bestandteile, als würden immer mehr kleine Teile hinzugefügt. Das Gefühl, schon einmal an einem Ort gewesen zu sein oder etwas Bestimmtes gesagt zu haben, stellte sich häufiger ein. Das gefiel Noth ganz und gar nicht. Schließlich hatten ihn die Erinnerungen schon einmal zu weit gebracht und sein wahres Ich untergraben. Damals war Jane da gewesen und hatte ihm helfen können, doch er wollte nicht, dass es ein weiteres Mal geschah.
Er musste sich an das erinnern, was echt war. Die Erinnerungen der anderen mochten sich zwar auch um tatsächliche Ereignisse drehen, doch für ihn waren sie nie real gewesen. Nicht so wie Pranna. Nicht so wie Winters Blick, den sie ihm auf dem Fischerboot ihres Vaters zugeworfen hatte.
Während sie durch Tinska gingen, ließ seine Nostalgie mehr und mehr nach. Pranna war kaum mehr als eine festgetretene Straße gewesen, an der sich einige Häuser und Geschäfte befanden, wohingegen Tinska mehrere Tausend Einwohner hatte. Rings um Pranna gab es nichts außer windgepeitschten Ebenen und Tundra, hin und wieder durchbrochen von kleinen Rotkiefernwäldern. Tinska war hingegen von grünen Bäumen umgeben und lag auf einer Art Schelf über dem Wasser, unter dem sich Sandstrände befanden, die nach dem kürzlich gefallenen Regen dunkel waren.
»Wo wohnt euer Onkel?«, erkundigte sich Astrid.
»Das Harmoth-Anwesen liegt gleich jenseits dieses Hügels«, erwiderte Jane und deutete auf die Anhöhe vor ihnen.
»Bei der aufsteigenden Canta«, murmelte Cinzia, als sie oben angekommen waren.
Ein gewaltiges Herrenhaus erhob sich vor ihnen, das auf einem großen, grasbewachsenen Felsvorsprung über dem felsigen Strand errichtet worden war. Zelte, Unterstände, Wagen und kleine Lagerfeuer waren auf den großen Feldern rings um das Haus zu sehen. Hier und da ragten einige hohe Bäume zwischen den Zelten auf, und Pferde, Ochsen und andere Nutztiere liefen zwischen den Dutzenden von Menschen herum, die hier ihr Lager aufgeschlagen hatten.
»Was bei der Unterwelt …« Astrid machte den Eindruck, als hätte es ihr die Sprache verschlagen.
Eine junge Frau, die etwa sechzehn oder siebzehn sein mochte, kam lächelnd auf sie zugelaufen und ging direkt auf Jane zu. »Du bist sie, nicht wahr?«
Noth musterte Jane, auf deren Miene sich Überraschung zeigte. »Ich … ich weiß nicht …«
»Du bist Jane«, sagte das Mädchen, das jetzt zuversichtlicher wirkte. »Du bist Jane. Du bist die Prophetin.«
Noth zog fragend eine Augenbraue hoch.
»Ich … ich schätze, die bin ich«, gestand Jane zögerlich.
Das Mädchen lachte erfreut auf. »Gesegnet sei Cantas Name. Du bist endlich hier.« Schon drehte sie sich um und lief den Hügel hinunter zu den dort Versammelten. »Sie ist hier«, rief sie. »Die Prophetin ist eingetroffen!«
Kapitel 4
Cinzia runzelte die Stirn. Das war nicht gut. »Die Prophetin?«, wiederholte sie und starrte ihre Schwester an.
Jane zuckte mit den Schultern. »Ich habe nie um einen derartigen Titel gebeten.«
Als sie den Ruf der jungen Frau hörten, drehten sich viele der Leute um und blickten zu Cinzia, Jane, Noth und Astrid hinauf.
»Aber du hast bestimmt auch nichts dagegen«, murmelte Cinzia.
Astrid stieß Cinzia an, zwinkerte ihr zu und meinte: »Sehr nett.«
Cinzia verdrehte die Augen. »Wir sollten jetzt lieber unsere Familie suchen.«
»Geht voraus«, schlug Noth vor. »Astrid und ich kommen nach.«
»Seid ihr sicher?«, fragte Cinzia.
Noth nickte. »Ihr wart monatelang von eurer Familie getrennt und solltet das Wiedersehen genießen.«
Cinzia musterte Astrid, die mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze zu der Menge im Tal hinabblickte. Sie vermutete, dass ihre Familie nicht wusste, was Astrid wirklich war. Als Astrid im Stadtzentrum von Navone enttarnt worden war, hatte dort bereits heilloses Chaos geherrscht. Wenn ihre Familie von Astrid wusste, könnte es Probleme geben, aber sie würden es ihnen ohnehin früher oder später sagen müssen.
»Wie ihr wollt«, erwiderte Cinzia. »Aber wir werden nicht lange brauchen.«
»Wir bleiben ganz in der Nähe«, versprach Noth.
Diese Worte trösteten Cinzia. Nach Kovacs Tod fühlte sich ihr Herz so leer an. Sie hatte ihn geliebt wie einen älteren Bruder, und trotz der ihm innewohnenden Dunkelheit fühlte sie sich in Noths Nähe ebenso sicher, wie es bei Kovac der Fall gewesen war.
Als sich Cinzia und Jane den Versammelten näherten, streckten diese mit leuchtenden Augen die Hände nach ihnen aus. Sie schienen gespannt auf die beiden zu warten, aber Cinzia rief sich ins Gedächtnis, dass sie eigentlich nur an Jane interessiert waren, nicht an ihnen beiden. Rufe wie »Prophetin!« und »Jane die Auserwählte!« drangen an ihre Ohren.
»Sie werden uns nicht vorbeilassen«, wisperte Cinzia ihrer Schwester zu. »Du wirst schon etwas sagen müssen.«
Jane hob einen Arm, und augenblicklich herrschte Stille. Cinzia lief es kalt über den Rücken. Diese Art von Macht war gefährlich.
»Mein Name ist Jane Oden«, sagte Jane laut. »Das hier ist meine Schwester Cinzia. Einige von euch wissen vielleicht, dass sie Priesterin der cantischen Denomination ist.«
Die Menschen begannen zu murmeln. Vielen der Anwesenden war das anscheinend neu, und Cinzia wurde ein wenig mulmig. Sie blickte sich nach Astrid und Noth um, doch die beiden waren nicht mehr zu sehen.
»Ihr sagt, ich wäre eine Auserwählte, eine Prophetin.«
Jetzt kommt es, dachte Cinzia. Das war der ruhmreiche Augenblick ihrer Schwester.
»Aber da irrt ihr euch«, fuhr Jane fort. Cinzia musterte ihre Schwester überrascht.
»Ich bin nur eine Dienerin«, stellte Jane klar, »das ist alles. Ich hatte eine Frage und habe mich damit an Canta gewandt. Die Göttin hat mir in ihrer Gnade geantwortet, und nun wurde etwas in Gang gesetzt, das die Sphaera verändern wird. In diesen Zeiten, in denen wir uns auf die dunkelsten Tage vorbereiten, die die Welt je gesehen hat, war die Göttin gnädig und hat sich gezeigt. Aber ich bin nur ihre Dienerin. Ich bin keine Anführerin und auch keine Revolutionärin; ich bin nur eine Frau, die den Willen der Göttin ausführen möchte.« Jane drehte sich zu Cinzia um. »Meine Schwester Cinzia hat Canta ihr Leben lang treu gedient. Sie hat das Wort Cantas im großen Seminar in Triah studiert und Cantas Kindern ihr Wesen und ihre Lehre nähergebracht. Und jetzt ist sie an meiner Seite und dient weiterhin Cantas Willen.«
Jane zögerte einen Augenblick, bevor sie weitersprach: »Ihr alle, jeder einzelne von euch, ist aus gutem Grund hier. Einige von euch sollen Lehrer sein, andere werden Cantas Reich auf der Sphaera erbauen. Manche werden Kinder großziehen und ihnen den Weg der Göttin zeigen. Ferner sind unter euch auch jene, die wie ich direkt mit Canta sprechen können. Ihr alle dient einem Zweck, meine Brüder und Schwestern. Ihr alle seid Cantas Diener.«
Cinzia konnte die Energie, die von der Menge ausging, regelrecht spüren. Nein, die Energie geht nicht von ihnen aus, wurde ihr mit einem Mal bewusst, sondern von Jane.
Jane hielt erneut inne, als müsste diese knisternde Energie ihre Zuhörer erst durchdringen. »Meine Schwester und ich haben einen weiten Weg hinter uns«, sagte sie. »Wir haben große Dunkelheit gesehen. Wir wissen, was unsere Welt bedroht. Daher müssen wir uns erst einmal mit unserer Familie treffen, aber wir kehren bald zurück. Canta hat Großes mit ihren Kindern vor.«
Die Energie ließ zwar nach, doch ihre Wirkung hielt weiterhin an. Alle starrten Jane schweigend an, und sogar die Kinder schienen von ihr fasziniert zu sein.
Cinzia stellte überrascht fest, dass sich auch Tiellaner unter der Menge, die überwiegend aus Menschen bestand, befanden. Sie fielen aufgrund ihres kleineren, schmaleren Körperbaus und der spitzen Ohren umso mehr auf. Zwar waren Tiellaner innerhalb der Denomination nie ausdrücklich von den cantischen Zeremonien und Lehren ausgeschlossen worden, aber sie huldigten der Göttin in eigenen Gottesdiensten, die sich etwas anders gestalteten als die der Menschen und die eher an tiellanischen Traditionen ausgerichtet waren – zumindest hatte Cinzia das gehört.
Sie konnte aber verstehen, dass die Tiellaner von einer Alternative zur Denomination angezogen wurden, schließlich hatte diese sie nie besonders gut behandelt. Man behauptete zwar, sie zu akzeptieren, doch in Wahrheit hatte man sie nur noch erbitterter verfolgt.
Mit einem Seufzen musterte Cinzia ein tiellanisches Mädchen, das einige Jahre jünger war als sie und das sie an die beiden Tiellaner denken ließ, die sie in Roden verloren hatten: Winter, Noths Frau, und Lian, ihren Freund.
Cinzia und Jane gingen auf das Haus der Harmoths zu – die Familie ihrer Mutter –, und man machte ihnen Platz. Das wirkte schon ein wenig unheimlich, als wäre Jane von einer Energieblase umgeben, die die Umstehenden zurückdrängte. Als Cinzia sich umsah, stellte sie fest, dass die Reihen sich wenige Schritte hinter ihnen erneut schlossen. Endlich hatten sie die große Doppeltür des Herrenhauses erreicht. Jane drehte sich um und winkte der Menge mit einem strahlenden Lächeln zu. »Uns ist bewusst, dass viele von euch weit gereist sind, um uns zu sehen«, sagte sie so laut, dass alle sie hören konnten. »Canta weiß es ebenfalls, und wir sind euch sehr dankbar und werden bald zurück sein.«
»Es gefällt mir nicht, dass du ständig ›wir‹ sagst, Schwester«, erklärte Cinzia, sobald sich die Türen hinter ihnen geschlossen hatten. »Denn ich habe nicht vor, so bald zu ihnen zurückzukehren.«
»Es tut mir sehr leid, dass du das so siehst, Cinzia«, erwiderte Jane mit ihrer nervenaufreibend ruhigen Art.
Cinzia biss die Zähne zusammen. Wie konnte Jane so gelassen bleiben, während sie einen solchen Zorn spürte? »Warum sind sie überhaupt hier? Woher wissen sie von uns? Wie haben sie unsere Familie gefunden?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete Jane.
»Wenn uns solche Leute – einfache Menschen, Tiellaner, Dorfbewohner – finden können, wer wird dann noch alles hier auftauchen?«
»Canta wird uns leiten«, meinte Jane. »Solange wir tun, was sie verlangt, müssen wir uns keine Sorgen machen.«
Cinzia schüttelte fassungslos den Kopf. Begriff Jane denn wirklich nicht, dass sie allen Grund zur Sorge hatten? Aber sie fragte sich auch, warum sie selbst so heftig reagierte. Seitdem sie im letzten Jahr in Navone angekommen war, um ihre Schwester zur Rede zu stellen, hatte sie das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Dadurch wurde tiefer sitzender Groll nur umso stärker, und seit Kovacs Tod in Roden hatte sie das Gefühl, als wären diese Gefühle ins Unermessliche gewachsen.
»Da draußen sind doch etwa hundert Leute«, zischte Cinzia, »und wir wissen nicht, was sie hergeführt hat. Die Denomination setzt garantiert alles in Bewegung, um dich – und deine Bewegung – auszuschalten, und du kannst davon ausgehen, dass sie es nicht auf friedliche Weise versuchen werden. Und ich habe meine Göttinnenwache …« Cinzias Stimme brach kurz. »Ich habe meine Göttinnenwache an etwas verloren, das wir weder kennen noch verstehen. Die Sphaera ist in Gefahr, Jane. Da kannst du mir jetzt nicht erzählen, wir müssten uns keine Sorgen machen.«
»Hallo, meine Lieben!«
Cinzia wirbelte herum und sah ihren Vater Ehram im Türrahmen stehen. »Vater!«, rief sie.
»Hallo, Vater«, sagte Jane.
»Ich bin so froh, dass ihr hier seid.« Ehram lächelte seine Töchter an und breitete die Arme aus, und Cinzia und Jane drückten sich an ihn. »Ihr beide habt mir so gefehlt.«
»Wir haben dich auch vermisst, Vater«, erwiderte Jane.
Cinzia sagte nichts, da sie ihrer Stimme nicht traute, und vergrub das Gesicht nur in der weichen Lederjacke, die ihr Vater trug.
»Wo ist deine Göttinnenwache, Cinzia? Wie hieß er doch gleich, Kovac, richtig? Und wo sind die anderen, die euch begleitet haben?«
Bei der Erwähnung ihrer Göttinnenwache wurde Cinzia schlagartig ernst. Das hatte ja als Erstes zur Sprache kommen müssen. »Kovac wurde getötet«, berichtete sie. »In Roden.«
Ihr Vater wurde blass und nickte dann langsam. »Das tut mir so leid, Liebes. Ich habe doch deutlich gesehen, wie viel er dir bedeutet hat.«
Cinzia wusste nicht, was sie noch dazu sagen sollte. Diese Nacht in Izet war mit so vielen unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Direkt vor Kovacs Tod war Cinzia allein auf einem Dach gewesen und hatte den Schneeflocken zugesehen, die vom Himmel fielen. Sie hatte sich geliebt gefühlt, geglaubt, eine Bedeutung zu haben, und sich eingebildet, Cantas Gegenwart zu spüren – als würde sie, Cinzia, der Göttin etwas bedeuten.
Doch dann hatte nur wenige Augenblicke später etwas Schreckliches von Kovac Besitz ergriffen, und Cinzia war gezwungen gewesen, ihn zu töten.
»Aber euch beiden geht es gut? Ihr seid gesund?«
Jane nickte. »Ja. Wir haben eine weite Reise hinter uns, und draußen …«
Ehram nickte heftig. »Natürlich, natürlich. Das muss euch alles sehr seltsam vorkommen.« Er bedeutete ihnen, ihm zu folgen, und ging den Korridor entlang. »Kommt, kommt«, forderte er sie auf. »Die anderen werden überglücklich sein, euch zu sehen. Vor allem eure Mutter, möge die Göttin ihre Seele segnen. Sie schläft schlecht, was natürlich nicht eure Schuld ist, aber sie macht sich solche Sorgen … Ihr wisst, wie sie ist.«
»Jetzt sind wir ja wieder zu Hause, Vater«, entgegnete Jane. »Und es gibt viel zu tun.«
Ihr Vater lachte. »Natürlich. Kommt. Sorgen wir erst einmal dafür, dass ihr etwas Warmes zu essen bekommt.«
Er führte sie in den Speisesaal, in dem die Familie an einem großen Tisch saß und sich lautstark unterhielt. Sie waren alle da, stellte Cinzia überrascht fest – sogar ihr Onkel Ronn, der allerdings mehr graue Haare hatte und dünner aussah, als sie ihn in Erinnerung hatte.
Ehram trat vor, als wollte er ihr Erscheinen ankündigen, aber Cinzia legte ihm eine Hand auf die Schulter, woraufhin er sie erstaunt ansah.
Cinzia schüttelte den Kopf. »Gib uns einen Moment«, flüsterte sie. »Ich möchte ihnen gern kurz zusehen.«
Ihr Onkel Ronn saß am Kopfende des Tischs und blickte sich bekümmert um. Das Chaos, das sechs Oden-Kinder anrichteten, war für den auf Formalitäten bedachten Mann gewiss eine große Belastung.
Cinzias Mutter Pascia hatte das blonde Haar zu einem lockeren Knoten gebunden und huschte um den Tisch herum, um ihre beiden Jüngsten, Sammel und Ader, Jungen von zwölf und elf Jahren, auf ihre Plätze zu scheuchen, auf denen bereits zwei dampfende Schüsseln mit Haferschleim warteten. Ihnen gegenüber saßen Wina, Lana und Soffrena, die fünfzehnjährigen Drillinge. Lana schaufelte gerade löffelweise etwas in ihre Schüssel, das nur Zucker sein konnte.
»Lana!«, schimpfte Pascia, die noch eine Hand auf Aders Schulter liegen hatte, um zu verhindern, dass er wieder aufsprang, während sie mit der anderen nach Lanas Hand schlug. »Nimm nicht so viel Zucker, Schatz. Dir gerinnt ja noch das Blut.«
»Ich kann keinen Haferschleim mehr sehen, Mutter«, schmollte Lana. »Ich brauche den Zucker, ansonsten bekomme ich ihn nicht herunter.«
»Wir haben aber keine Unmengen davon, Lana.« Eward, Cinzias Bruder, griff über Lanas Schulter nach dem kleinen Glas. »Heb uns anderen auch noch was auf.« Der große, kräftig gebaute Eward war Cinzia und Jane altersmäßig näher als die anderen mit seinen fast zwanzig Sommern, womit er gerade mal vier Jahre jünger war als Cinzia und zwei Jahre jünger als Jane.
In diesem Augenblick hob Eward den Kopf und sah Cinzia in die Augen. Sofort zeichnete sich ein Lächeln auf seinen Zügen ab, aber sie legte einen Finger an die Lippen, und er nickte.
»Gib ihn mir zurück!«, protestierte Lana. »Mutter! Eward hat mir den Zucker weggenommen!«
»Und das ist gut so«, meinte Pascia, die sich noch immer mit Ader abmühte. Der Junge schien einfach nicht still sitzen zu wollen.
»Ich verstehe gar nicht, wie du so viel davon essen kannst«, merkte Soffrena an, während Wina schweigend weiteraß. Die Drillinge sahen zwar gleich aus und hatten alle rotbraunes Haar, haselnussbraune Augen und Sommersprossen im Gesicht, aber ihr Benehmen hätte kaum unterschiedlicher sein können. Wina war schüchtern und ruhig, ähnlich wie Sammel; Soffrena hatte schon immer ein ausgeglichenes Gemüt besessen, während Lana in ihrem ganzen Leben noch nie ernst gewesen war.
»Wie denn auch. Du bist doch viel zu langweilig«, stichelte Lana.
»Die Tatsache, dass du glaubst, man könnte vom Zuckerkonsum auf den Elan schließen, verrät uns bereits mehr als genug über dich.«
Cinzia warf Jane einen Seitenblick zu. Sie mussten beide lächeln. Zwar waren sie einander ähnlicher als Lana und Soffrena, aber auch sie hatten sich häufig genauso angekeift. Im Grunde genommen haben wir es gerade eben erst wieder getan, schoss es Cinzia durch den Kopf. Allerdings kamen ihr diese Streitigkeiten nicht mehr wie solche vor, da sich Jane weigerte, sie anzuschreien.
Lana wandte sich wieder ihrem Haferschleim zu, verschränkte die Arme und zog einen Schmollmund. Dann sah sie zum Eingang des Speisesaals hinüber, und ein Strahlen breitete sich auf ihrem Gesicht aus.
»Sie sind zu Hause!« Lana rannte auf Cinzia und Jane zu und schloss sie beide gleichzeitig in die Arme.
Nachdem sie sich alle begrüßt, mit Tränen in den Augen umarmt und die aufgeregt plappernden jüngeren Kinder beruhigt hatten, setzten sie sich wieder. Sogar Onkel Ronn schien sich zu freuen, sie zu sehen, er hatte sie herzlich, wenn auch etwas steif umarmt. Schließlich saßen sie alle um den großen Esstisch herum.
In diesem Augenblick erschien Gorman, Onkel Ronns oberster Diener, in der Küchentür und blickte den jüngeren Kindern verächtlich über die Schultern.
»Wie ich sehe, ist das Essen kalt geworden«, stellte er fest. »Dann muss ich Shal wohl bitten, noch etwas Neues zuzubereiten.«
»Nein«, beschied ihm Pascia rasch. »Die Kinder werden ihren Haferschleim auch kalt essen. Habe ich nicht recht?« Soffrena, Lana, Wina, Sammel und Ader nickten wenig begeistert.
Gorman schien auch nicht gerade erbaut darüber zu sein, nickte jedoch ebenfalls und trug das benutzte Geschirr ab. Erst da bemerkte er, dass Cinzia, Jane und Ehram auch am Tisch saßen, und verbeugte sich. »Herrin Cinzia. Herrin Jane. Ich bin sehr froh, dass ihr wohlbehalten eingetroffen seid.«
»Er hat sich kein bisschen verändert«, stellte Jane leise fest, als Gorman wieder in die Küche gegangen war.
Cinzia nickte. »Allerdings hätte er sich früher nie dazu herabgelassen, das Geschirr abzutragen. Irgendetwas hat sich verändert.«
»Bitte, wir würden gern alles über eure Abenteuer hören«, bat Pascia.
Cinzia erbleichte. Ihr war es schon zu viel gewesen, mit ihrem Vater über Kovac zu reden.
»Vielleicht können wir euch ein anderes Mal von unseren … Abenteuern erzählen«, erwiderte Jane ausweichend.
»Eher früher als später, hoffe ich«, meinte Ronn. »Ich habe so viel über euch beide gehört.«
»Wir haben Ronn alles erzählt«, erklärte Pascia.
»Ich bin nicht gläubig«, gab Ronn zu und verzog unter seinem ergrauenden Schnurrbart die Lippen. »Aber das, was ich von euren Eltern gehört habe … fasziniert mich, könnte man sagen.«
Cinzia war überrascht über die Erleichterung, die sie empfand. Vielleicht war es ganz gut, nicht die einzige Skeptikerin zu sein.
»Dann berichtet uns wenigstens von der Übersetzung«, bat Eward mit aufgerissenen Augen. »Was habt ihr herausgefunden? Wie viel habt ihr bereits übersetzt?«
Cinzia blickte von Eward zu Jane. Sie hatte nicht gewusst, dass der Rest der Familie über Janes Absicht, die Neun Schriften – den Kodex von Elwene – auf der Reise nach Roden zu übersetzen, informiert war, schließlich hatte selbst Cinzia erst nach ihrem Aufbruch davon erfahren.