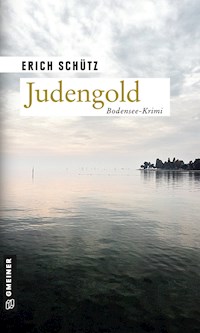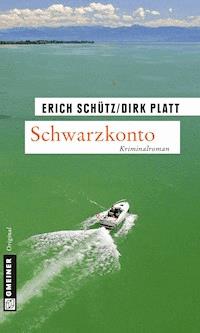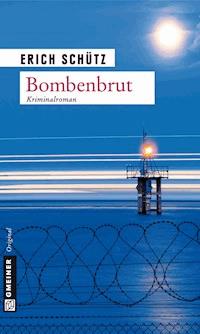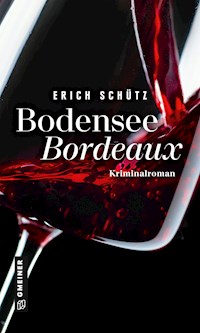Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Krimisommer für Ihn: In „Wer mordet schon am Bodensee“ verbinden sich spannende Kriminalfälle mit vielseitigen Freizeittipps rund ums schwäbische Meer. Journalist Dold stößt in „Judengold“ bei seinen Recherchen zu Goldschmuggel auf unglaubliche Machenschaften. Und der Lieblingsplatz „Bodensee“ bietet allerlei interessante Sehenswürdigkeiten und kulinarische Ausflüge in der Region.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 965
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Schütz * Ernst Obermaier
Bodensee-Paket für Ihn
Krimi, Kultur und Kulinarik
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Autor und Verlag haben alle Informationen geprüft. Gleichwohl wissen wir, dass sich Gegebenheiten im Verlauf der Zeit ändern, daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Sollten Sie Feedback haben, bitte schreiben Sie uns! Über Ihre Rückmeldung zum Buch freuen sich Autor und Verlag: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart unter Verwendung der Fotos von: aboutpixel.de / Blick in die Ferne © Gernot Weiser (Judengold); © Mundmaler Lars Höllerer, Überlingen. Mit freundlicher Genehmigung der Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler aus aller Welt e. V. (Wer mordet schon am Bodensee?); © »Landungssteg in Allensbach am Bodensee« des Kultur- und Verkehrsbüros Allensbach (Bodensee)
Zusammenführung: Simone Hölsch unter Verwendung von: © supakitmod – fotolia.com; © Susann Städter / photocase.com
ISBN 978-3-7349-9344-2
Inhalt
Erich Schütz
Judengold
Ernst Obermaier
Wer mordet schon am Bodensee?
Erich Schütz
Bodensee
Erich Schütz: Judengold
Widmung
Für Martina, die, während dieser Krimi geschrieben wurde, zuversichtlich ihre Chemotherapie durchstand.
Kapitel 1
»Grüezi«, murmelte Joseph Stehle kurz angebunden vor sich hin, ohne seinen Gesprächspartner anzuschauen. Dabei öffnete er eine abgegriffene, dunkelbraune Ledertasche und legte einige dicke, mit einem dünnen Gummi zusammengeschnürte Reichsmarkbündel, auf die Theke des schweizerischen Bankhauses Wohl & Brüder in Schaffhausen.
»Grüezi«, antwortete der rundliche Bankangestellte hinter den dicken Panzerglasscheiben, ebenfalls ohne besondere Freundlichkeit. Es war offensichtlich, die beiden kannten sich, es schien jedenfalls nicht das erste Mal zu sein, dass der Mann dem Kassierer lose Geldbündel auf den schmucklosen Tresen blätterte.
Der Schalterraum war nicht größer als ein ganz normales Wohnzimmer. Ein quadratisches, kleines Fenster zur Straße sowie eine alte Schreibtischlampe, direkt über der Kasse, dienten als einzige Lichtquelle. Außer der Ladentür führte nur noch eine weitere Tür direkt neben der Kasse in einen anderen Raum.
»Vier neue Nummernkonten«, befahl Joseph Stehle mit grobem schweizerischen Tonfall. Er sprach auffallend ungehobelt und ohne Höflichkeitsschnörkel. Er war groß gewachsen, hatte eine stattliche Figur, graue, kurze Haare mit angedeutetem Linksscheitel, ein schmales, strenges Gesicht mit tiefen Furchen und eine Nase, die ebenfalls schlank, aber etwas zu lang geraten war. Unter einem offenen, schwarzen Mantel trug er sichtbar eine dunkelblaue Uniform.
»Selbstverständlich, mein Herr«, nassauerte der Bankangestellte und kramte mit seinen wurstigen Fingern die für eine Nummernkontoeröffnung notwendigen Formulare aus einem Fach unter seiner Theke hervor. Der Angestellte wirkte hinter seinem Schalter klein und gedrungen. Er hatte eine Nickelbrille auf seiner Nase und im Verhältnis zu seinem Zwergenwuchs einen zu großen, quadratischen Kopf mit glatt gescheitelten, fettigen Haaren.
Während des gesamten bürokratischen Vorgangs fiel kein persönliches Wort. Vor allem aber war auffallend, dass beide weder einen Namen noch eine Adresse nannten.
Als Joseph Stehle die Bank verließ, knöpfte er trotz milden Sonnenscheins seinen Mantel fest zu. Er hielt dabei in seiner rechten Hand einen kleinen Zettel, auf dem vier Nummern geschrieben standen. Energisch marschierte er durch das Herrenackerviertel, einem der schönsten Winkel in der Schaffhauser Altstadt. Er ging hinunter, an dem kleinen, frühklassizistischen Kastenerker mit einfacher Namenkartusche vorbei, und blinzelte vergnügt der kleinen Friedenstaube zu, die seit der Französischen Revolution 1789 über der Rundbogenpforte verharrte.
Von Frieden war zu jener Zeit in ganz Europa keine Rede, auch nicht in Schaffhausen. Die gesamte Schweiz befand sich in einem Ausnahmezustand. Nachdem Hitler in Österreich einmarschiert war, die deutschen Truppen fast ganz Frankreich überrannt hatten und in Italien Mussolini mit faschistischer Skrupellosigkeit herrschte, war die Schweiz zur eingeigelten Trutzburg für viele Flüchtlinge geworden. Hauptsächlich Juden, aus allen besetzten Ländern, suchten Zuflucht – für sich und ihre Ersparnisse.
Joseph Stehle war über diese Situation nicht unglücklich. Im Gegenteil: Seine Geschäfte liefen glänzend. Er fühlte sich bestens, vertrieb mit einem angedeuteten Fußtritt eine Taube von einer Parkbank am Rhein und setzte sich selbst darauf. Er blinzelte kurz in die Sonne, dann stierte er auf den Zettel in seiner Hand. Seine Lippen bewegten sich leicht, er prägte sich die Nummern ein: Nummer 1017 Josef Weiß: 200.000 Reichsmark; Nummer 1020 Jakob Kaufmann: 130.000 Reichsmark; Nummer 1045 Samuel Rosenberg: 100.000 Reichsmark und 1048 Nathan Wolf: 250.000 Reichsmark.
Er hatte sich ein System erdacht, mit dem er sich die Nummern und vor allem die Höhe der Summen leicht merken konnte. Dabei fuhr er einfach gedanklich mit dem Zug seine Lieblingsstrecke, die Gäubahn, von Stuttgart nach Zürich ab. An jeder Bahnhofsstation – er kannte alle – hatte er vor seinem geistigen Auge Schließfächer eingerichtet. Schon vor Jahren hatte er damit begonnen. Im Hauptbahnhof Stuttgart hatte er in seinem Kopf das erste Depot angelegt. Dort fuhr der Zug nach Zürich schon seit Jahren um 7.58 Uhr ab. Sein erstes Nummernkonto in dem Schaffhauser Bankhaus Wohl & Brüder hatte so die Nummer 758. Das war leicht zu merken. Das zweite Konto, am ersten Halt Böblingen, hatte die Ankunftszeit als Nummer und damit 823, die Nummer des dritten Kontos war mit der Abfahrtszeit 825 identisch usw.
Die jeweiligen Kontonummern in der Bank erbat er sich nach dem Fahrplan der Reichsbahn, der in seinem Kopf fest verankert war. Er konnte alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten im Schlaf herunterleiern. Als Schaffner fuhr er die Strecke schon seit Jahren. Die Summe der Beträge merkte er sich ebenso leicht. Dafür brauchte er kein weiteres System, dabei halfen ihm seine Gier und ein kleiner Trick. In seinem Kursbuch unterstrich er mit Bleistift jene Ziffern, die an seinen Haltestellen zu weiteren Anschlusszügen führten. So waren zum Beispiel unter Böblingen bei der Ankunftszeit 8.23 Uhr die Ziffern der Zugnummer für die Anschlusszeit nach Sindelfingen unterschiedlich gestrichelt. Der Vorteil des Systems: Zugnummern änderten sich so wenig wie die Fahrpläne. Und es gab immer eine große Auswahl an Anschlusszügen und Nummern. Die glatten Tausenderbeträge konnte er so leicht verschiedenen Zügen zurechnen.
Die Namen der Eigentümer selbst, da war er sich sicher, konnte er vergessen. Nach allem, was er gehört hatte, war die Angst unbegründet, dass Juden nach 1940 es noch schafften, Deutschland zu verlassen. Und wenn schon: Wo wollten sie klagen? In Deutschland sicher nicht, lachte er selbstsicher in sich hinein, und in die Schweiz müssten sie erst einmal hereinkommen. Ein Beschluss des Bundesrates in Bern von 1939 machte eine Einreise für deutsche Juden fast unmöglich. Ohne gültige Ausreisepapiere, und zwar von deutscher Seite, ging nichts mehr. Die Schweizer Behörden wiesen Reichsdeutsche, die von den deutschen Behörden keine gültigen Ausreisepapiere vorlegen konnten, gnadenlos zurück, und Juden bekamen diese Genehmigung in Deutschland kaum noch. Viele Flüchtlinge, die schon vor dem Berner Beschluss schwarz über die deutsch-schweizerische Grenze gelangt waren, wurden von den Schweizer Behörden nach 1940 sogar wieder zurück an die Gestapo ›ausgeschafft‹, wie es im Schweizer Amtsjargon hieß.
Joseph Stehle und einige seiner Kollegen hatten schon zuvor das lukrative Geschäft erkannt. Ob Kellner im Speisewagen der deutschen Gesellschaft Mitropa oder eben Schaffner der Reichsbahn – mit fast allen Zöllnern standen sie auf Du und Du. Ihr Grenzübertritt als Zugbegleitpersonal war tägliche Routine. Illegale Vermögensverschiebungen aus dem Deutschen Reich in die Schweiz boten sich als lukratives Nebengeschäft geradezu an.
Joseph Stehle hatte die Geldscheine, Münzen oder den Schmuck stets in einem sicheren Versteck im Zug deponiert. Er schob seine alte Lederaktentasche in den Hohlraum der Waggonaußenwand im eigenen Schaffnerabteil und ließ die Sperrholzwand wieder zurückschnappen. Der Hohlraum maß immerhin zehn Zentimeter Breite und reichte über die gesamte Fläche unterhalb des Waggonfensters bis zum Heizungsschacht. Der Zutritt in das Abteil war nur dem Dienstpersonal gestattet. Die Abteiltür hielt er immer verschlossen. Selbst die Zöllner baten ihn nur selten, diese Tür zu öffnen. Schließlich galt er sowieso als ein Einhundertfünfzigprozentiger. Und meist verlief der tägliche Grenzverkehr ohnedies ohne Zwischenfälle.
*
»Wenn Sie mich umbringen, versiegt Ihre Quelle«, hatte sie ihn noch gewarnt. Doch Joseph Stehle drehte ihr die Halsschlagadern ab.
Sie schaute ihm flehend in die Augen.
Er lächelte sie kalt an und erhöhte den Druck.
Als er spürte, wie das Leben aus ihrem Körper weichen wollte, löste er die Fäuste, fing ihren dünnen Leib auf, damit dieser nicht lautstark auf den Boden ihres Wohnzimmers krachte, und trug sie ins Badezimmer.
Dort lehnte er die bewusstlose Frau mit der einen Hand an die grün geflieste Wand, öffnete ungeschickt mit der anderen Hand ihre Bluse, suchte dann die Knöpfe ihres Rockes, um diesen über ihre schmalen Hüften zu streifen, und entkleidete sie, so weit es ihm in dieser Stellung möglich war.
Zwischendurch öffnete sie ihre Augen, doch Joseph Stehle wusste, was er zu tun hatte, und drückte ihr schnell beide Halsschlagadern, jetzt leicht mit einer Hand, wieder ab.
Dann legte er den für ihn leichten Körper in die Badewanne, entkleidete sie vollständig und zückte aus seiner Hosentasche ein Schweizer Offiziersmesser.
Er kniete sich neben die Wanne, ließ die Klinge aufspringen und schnitt der Frau rasend schnell beide Pulsadern in ihren Unterarmen auf.
Die Arme legte er schlaff auf ihren nackten Bauch.
Zufrieden sah er das Blut aus den Wunden quellen.
Seine Hände waren blutig geworden und auch sein Messer. Er drehte einen Wasserhahn auf, dann den zweiten, und staunte, wie leicht er mit den beiden Hähnen die Wassertemperatur regeln konnte. Das Badezimmer in der Stuttgarter Schlossstraße war großzügig ausstaffiert, in dem Haus gab es eine der ersten Zentralheizungen und im Bad Mischbatterien für Warm- und Kaltwasser, wie sie Stehle noch nie gesehen hatte.
Für die Schönheit des Körpers der schlanken Frau hatte Joseph Stehle heute keinen Blick. Er schaute nur in ihr Gesicht und wusste, dass er ihr jederzeit, sollte sie doch noch einmal ihre Augen öffnen, schnell wieder die Halsschlagadern abdrücken würde.
Doch die junge Frau erwachte nicht mehr.
Joseph Stehle drehte das Wasser ab und blickte zufrieden auf sein Werk. Er ging in die Küche, holte aus einer Schublade ein scharfes Messer und drapierte es so bei der Leiche in der Wanne, dass man glauben konnte, es sei ihr aus der Hand geglitten. Eine Jüdin, die sich das Leben nahm, war in jenen Tagen nichts Besonderes. Da hatte er auch vonseiten der Stuttgarter Polizei keine weiteren Nachforschungen zu befürchten. Jüdisches Leben war zu jener Zeit keine Ermittlung wert.
Joseph Stehle wog sich in der Sicherheit, dass in der Wohnung über seine schwunghaften Schiebereien keine Hinweise zu finden waren. Der jetzt toten Dame, wie auch ihm, war von Anfang ihrer Geschäftsbeziehungen an klar gewesen, dass jede Art von Aufzeichnungen den eigenen sicheren Tod bedeuten konnte. Denn für Devisenvergehen gab es im Deutschen Reich kein Pardon. Aus Angst vor der Todesstrafe hatten sie sich gegenseitig immer wieder versichert, keine Beweise für ihre Geldtransaktionen aufzubewahren.
Luise Levy starb am 4. November 1940. Der für die Behörden offensichtliche Selbstmord einer 39-jährigen Jüdin war in den Kriegsjahren für die Öffentlichkeit kein Thema.
Mit Luise Levy versiegte für Joseph Stehle aber tatsächlich fürs Erste eine Einnahmequelle. Sie hatte recht gehabt, sie war wie eine Goldader für ihn gewesen, die ihn zu immer neuen Funden geführt hatte. Doch er hatte sie beseitigen müssen. Die Stuttgarter Jüdin hatte ihm zwar die meisten seiner Kunden zugeführt, aber das Geschäft wurde immer gefährlicher. Dabei hatte vor drei Jahren alles ganz harmlos begonnen.
*
Joseph Stehle tat am 13. August 1937 Dienst in dem Personenzug Singen–Winterthur, Abfahrt 9.30 Uhr, Gleis 1. Die Grenzzöllner durchstreiften die Waggons. Sie fuhren jeweils von Singen bis über die Grenze Rielasingen-Ramsen mit. Alle Passagiere mussten ihnen ihre Ausweise sowie eine Bewilligung zum Grenzübertritt oder die neue, gesetzlich vorgeschriebene Grenzkarte vorlegen.
Er, Joseph Stehle, kontrollierte als Schaffner die Fahrscheine, die Zöllner begutachteten die Grenzpapiere.
Joseph Stehle war den Zöllnern oft ein Stück voraus. Die Fahrkarten waren in jener Zeit schneller kontrolliert als die Ausweispapiere, und an jenem Tag hatte zudem eine attraktive Frau seine Aufmerksamkeit erregt. Sie saß im Erste-Klasse-Abteil allein am Fenster. Sie hatte eine blonde Dauerwelle, trug ein keckes rotes Hütchen und hatte sich in ein enges blaues Kostüm gezwängt, das die Konturen ihres Körpers mehr als erahnen ließ.
»Heil Hitler«, begrüßte Stehle sie freundlich. Die Frau war nach seinem Geschmack und nach der von ihm verinnerlichten Rassenlehre durch und durch arisch.
»Heil Hitler«, antwortete sie leise und reichte ihm ihre Fahrkarte.
Stehle sah ihre Hand leicht zittern.
Er nahm die Fahrkarte, schaute diese genau und in Ruhe an, um nichts zu übersehen. Dann lochte er sie und reichte sie der jungen Frau mit einer unverfänglich klingenden Nachfrage zurück: »Sie fahren heute wieder nach Hause?«
»Ja«, lächelte sie unsicher, »ich besuche eine Tante in Winterthur, sie hat heute Geburtstag. Um 18.30 Uhr geht doch wieder ein Zug zurück?«
Stehle zeigte sich hilfsbereit und griff nach seinem Kursbuch: »Was für einen Tag haben wir denn heute?«, fragte er ganz beiläufig, als wüsste er dies nicht ganz genau, und blätterte sich durch die dünnen Seiten seines dicken Kursbuches.
»Freitag«, wusste die Zugfahrerin.
»Schon«, lachte Stehle, »aber welches Datum?«
»Heil Hitler«, brachen die Zöllner in das Abteil ein.
»Stören wir?«, lachte der ältere der beiden Grenzer und klopfte Stehle kameradschaftlich auf die Schultern. »Tut uns leid, Joseph, aber es muss sein.«
Stehle zwinkerte der Frau komplizenhaft zu.
Der ältere Zöllner nahm ihre Papiere, prüfte sie sorgfältig und wurde plötzlich unfreundlich in seinem Ton: »Sie haben einen Tagesschein, Frau Levy«, herrschte er sie an. »Einen Tagesschein, eine Rückfahrkarte und doch eine ziemlich große Reisetasche?«
»Meine Tante in Winterthur hat Geburtstag, und sie hat nur einen Wunsch«, die junge Frau versuchte, unbefangen zu wirken und öffnete auf den Fingerzeig des Zöllners folgsam ihre Tasche. »Schauen Sie …«
»Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck …!«
Die Männer blickten ratlos. Zehn Mal hörten sie den künstlichen Schrei des Vogels, dann mussten sie alle lachen, nachdem Frau Levy das braune Packpapier von einer überdimensionalen Kuckucksuhr abgestreift hatte.
Es war Punkt 10 Uhr am 13. August 1937, und der Personenzug Singen–Winterthur überquerte, wie jeden Tag, ohne besondere Vorkommnisse die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz.
*
Die deutschen Zöllner verließen vor dem schweizerischen Ramsen den Zug, die Schweizer Zöllner stiegen zu, nur Joseph Stehle und der Lokführer blieben nach der staatsvertraglichen Vereinbarung Zugbegleiter bis nach Winterthur.
Joseph Stehle nutzte diese Chance: Kaum hatte der Zug den Schweizer Bahnhof nach dem Grenzübertritt verlassen, zog es ihn in das Abteil der blonden Dame zurück.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie ängstlich, als er wieder in ihrem Abteil stand.
»Ja«, lachte Stehle freundlich, »aber Sie wollten mir doch noch das heutige Datum nennen?«
Luise Levys Gesichtsfarbe veränderte sich. In die vornehme Blässe ihrer Wangen schoss dunkelrot das Blut.
»Tja«, Joseph Stehles Stimme wurde amtlich, »wir haben gar nicht in den Kasten der Kuckucksuhr reingeschaut, geschweige denn die dicke Tasche ordentlich durchsucht.«
Luise Levys Kopf glühte plötzlich. Sie schluckte deutlich und antwortete unsicher: »Wir sind doch jetzt in der Schweiz.« Es klang wie eine Frage, auch wenn es eine Feststellung sein sollte.
»Aber noch immer in einem Waggon der Deutschen Reichsbahn«, konterte Stehle amtlich, legte geschickt eine kleine Pause ein, in der Luise Levys Gesichtsfarbe nun wieder ganz blass wurde, und setzte zynisch lächelnd nach: »Heute ist der 13. – Freitag, der 13., der Geburtstag Ihrer Tante! Das ist wohl kein Glückstag für Sie, oder?«
»Warum?«
»Weil man als liebe Nichte dieses Datum doch immer parat hat, oder?« Stehles Tonfall war plötzlich harsch geworden.
»Wollen Sie die Polizei rufen?« Luise Levy hatte sich schnell gefangen, es war offensichtlich für sie, dass der Schaffner Lunte gerochen hatte. Sie fragte sich nur, warum er seinen Verdacht nicht schon den Zöllnern gemeldet hatte, und schöpfte deshalb gleichzeitig Hoffnung. Die Begehrlichkeit der Menschen, das hatte sie in den vergangenen Jahren schon oft erfahren, machte diese angreifbar.
Joseph Stehle antwortete nicht. Er spürte die Angst in der jungen Frau aufkeimen. Diesen Augenblick genoss er.
»Was wollen Sie?« Luise Levy wollte handeln, um möglichst schnell diese für sie prekäre Lage zu verändern. »Ich biete Ihnen die Hälfte meiner Provision.« Ihr war klar, sie musste diesen Mann ködern. Er hoffte offensichtlich auf einen Vorteil, sonst hätte er die Grenzer noch auf deutschem Hoheitsgebiet gerufen.
Stehle hingegen zögerte. Er beugte sich nah zu ihr hinunter, roch die Mischung ihres teuren Parfums und inhalierte die Aura ihrer Angst. Er versank fast in ihrem Dekolleté.
Luise sprang von ihrer Sitzbank auf, sie spürte die Überlegenheit des fremden Mannes. Sie hasste diese Situation und diesen Schaffner. In Augenhöhe stand sie ihm nun aufrecht gegenüber.
Er grinste ihr jetzt unverschämt ins Gesicht. Gleichzeitig wurde ihm aber klar, dass diese Frau kein leichtes Opfer sein würde. Er begehrte sie zwar auf der einen Seite und war noch nie einem sich bietenden Seitensprung ausgewichen, fürchtete aber zugleich, dass das Spiel mit ihr vielleicht doch zu gefährlich werden könnte. Er überlegte daher, ob er nicht doch lieber das Angebot annehmen sollte, um sich ein paar Mark nebenbei zu verdienen. »Wie hoch ist denn die Provision?«
»Zehn Prozent, ich würde sie mit Ihnen teilen. Das hieße dann für Sie und für mich jeweils fünf.«
»Wie viel ist das in Mark und Pfennig?«
»Rund 1.000 Mark für Sie.«
Joseph Stehle überschlug kurz. Er bekam im Monat 275 Reichsmark von der Reichsbahn. Dafür musste er 56 Stunden die Woche arbeiten. 1.000 Mark, das war weit mehr als ein Vierteljahresverdienst, für nichts! Nur dafür, dass er nicht wahrnahm, was sowieso nur er aufgedeckt hatte. »1.500«, forderte er kalt.
»In Ordnung«, erwiderte Luise Levy.
»Und Sie eröffnen für mich ein Konto in der Schweiz und zahlen den Betrag dort ein.«
Luise Levy sah jetzt die Unsicherheit in den Augen des deutschen Schaffners. Ihm war klar geworden, dass er solch eine Summe unmöglich mit nach Deutschland nehmen konnte. Er hätte sie dort auch gar nicht ausgeben können.
Joseph Stehle zögerte plötzlich: Was hatte er von dem Geld? Er begab sich damit in die Hand dieser fremden Frau. Sie konnte ihn jederzeit verpfeifen und noch schlimmer: Sie konnte ihn erpressen. Auf der anderen Seite malte er sich aus, was er mit dem Geld alles tun könnte.
»Wir sollten uns auf neutralem Boden in Winterthur weiter unterhalten«, unterbrach Luise Levy die Gedanken des plötzlich ängstlich wirkenden Schaffners. Sie musste diesen unbekannten Mann für sich gewinnen, zumindest so lange, bis sie aus diesem Zug ausgestiegen war. Sie setzte auf ihre weiblichen Reize, straffte ihren Oberkörper, zog ihre Bluse glatt und zeigte stehend ihre attraktive Figur. Mit großen Augen und geöffneten Lippen sah sie Joseph Stehle an.
Joseph Stehles Angst wich blitzartig. Er sah ihre Lippen, er blickte unverhohlen auf ihren festen Busen, musterte ihre zierlichen Hüften und roch ihr teures Parfum. Er schöpfte erneut eine vage Hoffnung. Er wähnte sie in seiner Hand. Hinter dem Winterthurer Eisenbahnheim kannte er ein ziemlich heruntergekommenes Hotel. Dort war er bei solchen Gelegenheiten schon mehrfach abgestiegen. Stehle fühlte sich wieder wie ein ganzer Kerl. »Sie überlassen mir Ihren Pass und die Bewilligung zum Grenzübertritt, und wir treffen uns in Winterthur im Hotel Studer hinter dem Eisenbahnerheim. Sie werden es leicht finden, Sie gehen aus dem Bahnhof heraus, dann rechts, über die Brücke der Zürcherstraße, über die Gleise, und biegen dann links in den Bahnmeisterweg ein.«
Luise Levy fiel ein Stein vom Herzen. Sie lächelte ihn ehrlich aus ihren blauen Augen an, reichte ihm den Pass und die Grenzübertrittsbewilligung und versprach: »Ich werde eine halbe Stunde nach Ankunft unseres Zuges in Winterthur im Hotel Studer sein.«
»Ich weiß«, antwortete Stehle arrogant, »ohne Ihren Pass gibt es keinen Weg zurück, und deutsche Schmuggler werden aus der Schweiz direkt der Gestapo überstellt.«
*
Als Luise Levy die Hände ihres Mörders um ihren Hals spürte, wusste sie, dass alles Gold und Geld, welches sie bisher mit diesem Mann über die Grenze geschafft hatte, verloren war. Sie allein war die Garantin für ihre jüdischen Kunden, dass diese den ihr anvertrauten Schatz nach der Hitlerzeit wieder zurückbekommen würden. Den meisten hatte sie nur von einem Konto in der Schweiz erzählt, wohin genau die Summen und Schätze geschafft wurden, wussten diese nicht. Sie alle hatten ihr in ihrer Notlage vertraut, ihr vertrauen müssen. Mit ihrem Tod waren jedoch alle entscheidenden Informationen über die tatsächlichen Eigentümer der Vermögen nur noch in Stehles Hand. Ihre begründete Vorsicht und ihr Misstrauen gegenüber allem hatten zur Folge, dass sie niemandem etwas über ihre Beziehung zu diesem Mann und der Schaffhauser Bank erzählt hatte. Schriftliche Dokumente, die Bargeldzahlungen belegt hätten, waren zu jener Zeit in Deutschland für alle Beteiligten tödlich. Deshalb gab es nur die Aufzeichnungen, die Stehle in der Schaffhauser Bank hinterlegt hatte.
Joseph Stehle war sich über seine Position schnell klar geworden. Er hatte darauf gesetzt. Sie waren sich damals in dem Winterthurer Hotel nähergekommen. Er hatte Zeit genug gehabt, sie kennenzulernen. Er hatte schon damals ihre ständige Angst gespürt, wie zuvor in dem Zugabteil. Zur Schmugglerin war sie nicht geboren. Deshalb empfand er sie schon bald als Gefahr für sich. Immer, wenn er sie in Stuttgart besuchte, um bei ihr neue Geldbündel und andere kleine Schätze abzuholen, war sie zu besorgt und furchtsam. Sie hatte es ihm leicht gemacht, ihr die gesamten Geschäfte abzunehmen. Jetzt hielt er alle wichtigen Papiere in seinen Händen. Seit dem Gerede über die Vernichtungsanlagen für Juden war ihre Angst ins Unermessliche gewachsen.
Er musste sie töten, bevor es zu spät war – ob er wollte oder nicht!
Sie musste weg.
*
Zunächst hatte er ihren Tod bedauert. Er hatte es geliebt, mit ihr zu schlafen, wenn sie bei seinen Besuchen in Stuttgart vor Angst zitterte. Später erst lernte er Katharina Gloger kennen. Sie war keine Goldader, dafür ein echter Goldschatz. Die junge Frau war auf der Flucht aus der besetzten Tschechoslowakei. Sie war ihm regelrecht in die Arme gelaufen. Es war im August 1943, kurz nach 22 Uhr. Er hatte Dienstschluss und wollte gerade das Bahnhofsgebäude in Singen verlassen, da hatte er sie getroffen.
Er hatte Katharina Gloger schon gesehen, bevor sie vor ihm stand. Sie trug einen auffallend schönen Koffer, mit hellem, braunem Holz gerahmt und mit dunkelbraunem Leder bezogen. Joseph Stehle fiel das Gepäckstück aber nicht wegen dessen Verarbeitung auf, sondern weil es offensichtlich schwer war. Für die Größe des kleinen Handgepäcks war es zu schwer. Stehle hätte gerne gewusst, was sich darin verbarg.
Sie hatte ihn gezielt nach der Wohnung des katholischen Stadtpfarrers gefragt. Joseph Stehle schilderte ihr hilfsbereit den Weg zum Pfarrhaus. Danach folgte er ihr unauffällig. Er ahnte, dass diese Frau eine illegale Absicht verfolgte. Eine fremde Dame, spätabends allein auf der Straße, das war ungewöhnlich. Und August Ruf, der Stadtpfarrer, war bekannt für seine antinazistische Einstellung. Joseph Stehle witterte ein mögliches Geschäft für sich. Zu lange schon hatte er seine Fähigkeit, Wertsachen über die deutsch-schweizerische Grenze zu schieben, nicht mehr genutzt.
Er sah in der Dunkelheit, wie der Frau im Pfarrhaus Einlass gewährt wurde. Er wartete. Es dauerte circa eine halbe Stunde, dann kam sie wieder aus dem Pfarrhaus heraus und ging direkt zum Central-Hotel.
Stehle folgte ihr durch die Adolf-Hitler-Straße bis vor das Hotel in der Innenstadt Singens. Er sah, wie nach kurzer Zeit in einem Gästezimmer ein Licht angeknipst wurde. Es war im ersten Stock, das dritte Zimmer von links.
Stehle rauchte genüsslich eine Zigarette und wartete, bis ihr Licht erlosch.
Dann wusste er, was er zu tun hatte.
Kapitel 2
»Nichts wäre leichter, als mit dem Boot den ganzen Kladderadatsch von Kreuzlingen nach Meersburg zu schippern, warum nur müssen wir versteckt über diese kahlen Felder kutschieren?«
»Was machst du dir einen Kopf? Bisher ging immer alles glatt, Opa wird schon wissen, warum er uns mit der Karre nach Zürich geschickt hat!«
»Sind wir überhaupt noch in der Schweiz? Oder sind wir schon in Deutschland?«
»Was soll’s, wir sind mitten in Europa, mach dir nicht ins Hemd, du Scheißer.«
Sven steuerte den schweren, silbergrauen Mercedes mit leichter Hand über die schmalen Straßen am Südhang des Randen entlang. Das eingebaute Navigationsgerät verriet ihm die kleinsten Feldwege mit allen möglichen Grenzübergängen. Sven war wie immer gut gelaunt. Er hatte eine große, neumodische Sonnenbrille auf der Nase, freche Sommersprossen und lockige, blonde Haare, die ihm tollkühn ins Gesicht hingen. Er grinste verwegen und drehte das Radio lauter. Er hatte gerade eine CD der Böhsen Onkelz eingeschoben und grölte mit. »Nur die Besten sterben jung …«
Sven führte oft und gerne Aufträge für seinen Opa aus. Der kleine Gefallen, den er ihm heute tat, war eine Lappalie. Einmal Zürich und zurück, pah! Er würde die Karre noch einige Zeit behalten dürfen, und schon allein dieser Gedanke gefiel ihm. Heute Abend würde er damit eine Tour durch die Singener Innenstadt unternehmen. Zwar waren die Gartenwirtschaften jetzt im späten Herbst längst geschlossen, aber seine Kumpels hingen noch immer gerne vor dem ›Exil‹, einer seiner Stammkneipen, herum.
Sein nur um wenige Jahre älterer Bruder Bernd dagegen wirkte eher ängstlich. Er saß steif neben Sven. Er trug eine etwas biedere Kombination: braune Kordhose, blaues Hemd und ein schwarzes Sakko. Seine Haare waren kurz geschnitten, seine Brille hatte dicke Gläser mit Zylindern. Im Gegensatz zu seinem Bruder gefielen ihm die Aufträge seines Opas nie. Er hatte dabei immer das Gefühl, etwas zu tun, das er nicht ganz durchschaute.
Auf der anderen Seite war der Auftritt heute Morgen cool gewesen. Sie waren in Zürich in der Bahnhofstraße direkt beim Hauptsitz der Schweizer Bankgenossenschaft vorgefahren. Locker hatte Sven den Wagenschlüssel in die Hände eines Bediensteten geworfen, dann hatten sie die Papiere von Opa auf einen Tisch gelegt, und schon waren sie bedient worden wie Staatsgäste im Bundespräsidialamt. Es hatte Kaffee und feinste Sprüngli-Pralinen und anschließend eine Führung in die Katakomben des noblen Bankhauses gegeben. Dort hatte ihnen ein weiterer Bediensteter mehrere Schlüssel überreicht, und gemeinsam hatten sein Bruder Sven und er mehrere Fächer seines Opas in dem Saferaum geplündert. Sie hatten dabei konzentriert vorgehen, zum Teil nummerierte Goldbarren entnehmen und notieren sowie einen nicht unerheblichen Batzen Bargeld zusammenzählen müssen.
»Befehl von Opa«, hatte Sven gegrinst und einige Scheine, wie in einem schlechten Hollywoodstreifen, in die Luft geworfen.
»Woher der das alles nur hat?«, wollte Bernd im Auto wissen.
»Du fragst, wie immer, zu viel«, wies ihn Sven zurecht. »Du weißt doch: W-Fragen beantwortet nur der liebe Gott.«
»Scheiß drauf, das muss gerade der Alte sagen, der weiß ja nicht einmal, wie man Gott schreibt.« Bernd hasste die Ausflüchte seines Opas auf alle die Fragen, die darauf abzielten, ein bisschen Licht in das mysteriöse Leben des alten Herrn zu bringen.
»Dafür muss er einen guten Draht zu ihm haben«, beschwichtigte Sven seinen Bruder, »der Nebel kommt doch wie vom lieben Gott selbst gemacht.«
Es war ein klarer Novembertag. Für die Jahreszeit war es bisher viel zu warm. Sonnenstrahlen schafften sich immer wieder einen Weg durch die wallenden Nebelbänke, die vom See aus dank dem leichten Ostwind sanft westwärts geschoben wurden. Jetzt in den späten Nachmittagsstunden drückten sich die Nebelbänke aus dem Tal unterhalb des Randen nach oben in die Hügelkette zwischen der Schweiz und Deutschland empor. Die Wälder liegen hier einsam, nur unterbrochen von einigen Wiesen und Feldern und wenigen einzelnen Bauernhöfen. Wanderer können sich nur schwer orientieren, wo und wann sie die Staatsgrenze überschreiten. Dabei kann es vorkommen, dass sie trotz Geradeausmarsch in nur eine Himmelsrichtung öfter die Grenzseite wechseln, als sie es selbst wahrnehmen. Hie und da stehen alte, längst vermooste Grenzsteine, manchmal ein neues Schild, das Grenzgänger ermahnt, nicht zu schmuggeln.
Die Autofahrer haben es leichter, sich zu orientieren. Sie sehen zumindest die obligatorischen Grenzschranken, sofern sie auf den ordentlichen Straßen fahren. Und an jedem offiziellen Grenzübergang entlang dieser kleinen Landstraßen wehen sichtbar deutsche und schweizerische Flaggen in gemeinsamer Eintracht.
Allerdings sind die Zollhäuser selbst oft unbesetzt. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht, denn hin und wieder wird trotz Personalmangels auch an den kleinen Grenzübergängen kontrolliert. Doch das Besetzen dieser Posten lohnt sich kaum. Es gibt an den kleinen Grenzübergängen fast keinen Verkehr. Meist sind es nur wenige Traktoren, die dort über die Grenze fahren, denn die deutschen Landwirte verpachten ihre Äcker gerne an Schweizer Bauern. Diese bezahlen mehr als ihre deutschen Kollegen.
Die beiden Brüder hatten sich den kleinen Grenzübergang bei Wiechs am Randen, zwischen dem kleinen Flecken der schweizerischen Ortschaft Bibern und dem noch kleineren deutschen Klecks Beuren, ausgesucht. Langsam näherten sie sich dem kleinen Zollhäuschen von der Schweizer Seite kommend. Beide Staatsfahnen hingen vor der Zollstation schlaff im Wind. Die Amtsstube war in einem Gebäude untergebracht, das nicht viel mehr Raum bot als eine Garage. Trotzdem war das Häuschen ordentlich hergerichtet. Vor den Fenstern haderten rote Geranien mit einem bevorstehenden Winter, dem noch immer die Kraft fehlte, echte, für sie tödliche Fröste zu schicken.
Sven hatte circa 100 Meter vor dem Grenzübergang angehalten. Er griff zu einem Fernglas auf der Rückbank des Wagens. Er schob seine Sonnenbrille lässig nach oben und hob das Glas vor seine Augen. Dann schwenkte er, wie ein Jäger auf der Pirsch, die Straße vor sich ab. Er spähte nach einem Auto der Zollbeamten, sah aber keines. Beruhigt gab er langsam wieder Gas.
»Lass uns doch erst mal zu Fuß die Lage abchecken«, riet Bernd und minderte die Lautstärke der Böhsen Onkelz.
»Pah, die faulen Säcke sind doch alle zu Hause«, provozierte Sven und drückte das Gaspedal kräftiger durch. Der schwere Wagen schaltete automatisch vom zweiten in den dritten Gang und beschleunigte.
Bernd nahm das Fernglas von Sven und spähte nun ebenfalls. Er sah die geöffnete Schranke und die Tür des Zollhäuschens verschlossen. Erleichtert erwiderte er: »Du hast recht, der Schlagbaum ist oben.«
»Give me five«, forderte Sven seinen Bruder auf, und sie schlugen ihre jeweils rechten Handflächen aneinander.
Lachend überquerten sie die unbesetzte Grenzstation.
»Und jetzt nichts wie Gas«, freute sich Bernd und drückte mit seiner linken Hand auf das rechte Knie seines Bruders und damit dessen Fuß noch fester auf das Gaspedal.
Nach dem ungehinderten Grenzübertritt bogen die beiden in ein weiteres Nebensträßchen auf dem Weg von dem schweizerischen Örtchen Thayngen in Richtung des deutschen Kleinstädtchens Tengen.
Über einen Feldweg bog Sven in ein Seitental ab, als er plötzlich scharf abbremsen musste. Jäh standen sie in einer Nebelwand, und direkt vor ihnen waren, wie aus dem Nichts, mehrere eisern schillernde Pflugscharen aufgetaucht. Die Scharen standen drohend in die Luft, direkt vor der Frontscheibe. Sie gehörten zu einem Traktor, der, ohne auf den Verkehr zu achten, von dem Acker auf die kleine Straße gefahren war. Die Straßenverkehrsordnung schien den Fahrer nicht zu kümmern. Der saß geschützt hoch oben auf seiner Zugmaschine, Nebelscheinwerfer hatte er nicht eingeschaltet. Warum auch? Mag sein, dass er gedacht hatte, beim Pflügen würden sie ihm auch im Nebel nicht weiterhelfen. Und auch Nebelschlussleuchten hatte der Bauer bis zu diesem Tag auf dem Feld noch nie eingeschaltet.
Sven hatte die Pflugscharen in Höhe seiner Frontscheibe gerade noch vor sich gesehen, war heftig erschrocken und stand unvermittelt auf dem Bremspedal, während er laut und aggressiv hupte.
Der Bauer hörte das Warnsignal offensichtlich nicht, oder es interessierte ihn nicht. Er streifte den für ihn vermeintlichen Städter in seinem Mercedes mit keinem Blick, wendete geschickt seinen schweren Traktor auf dem schmalen Sträßchen und setzte die sechs Pflugscharen danach in aller Seelenruhe wieder in das Erdreich am Straßenrand.
Sven sah das Schaffhauser Nummernschild an dem Traktor, hupte erneut und zeigte dem Schweizer Bauer seinen gestreckten Mittelfinger. Doch dieser schien sich um die beiden Jungs in dem teuren Auto immer noch nicht zu scheren und zog gemächlich weiter seine Bahn.
Die beiden Brüder fuhren mit deutlich hörbarem Vollgas weiter. Sie sahen nicht mehr, wie der Bauer grob lächelte, ebenfalls sein Gaspedal bis zum Anschlag drückte und zu seinem Handy griff.
»Bauerntrottel«, quittierte Sven die Begegnung und reduzierte das Gas gerade rechtzeitig vor der nächsten scharfen Rechtskurve wieder.
»Für den sind wir die Schwobenärsche, die hier eh nichts verloren haben, der Chaibe, der weiß doch nicht einmal den Unterschied zwischen Baden und Schwaben«, pflichtete Bernd seinem Bruder bei. »Dabei nehmen die mit ihren teuren Fränkli den deutschen Bauern ihre Felder weg.«
»Deutsches Land in deutsche Hand!«, skandierte Sven und reckte seine rechte Hand, mit ausgestrecktem Arm und ausgestreckten Fingern, hoch nach vorn.
»Stimmt«, pflichtete ihm Bernd bei, »die haben jetzt schon einige Tausend Hektar bei uns gepachtet oder gar gekauft. Die deutschen Bauern können bei diesen Preisen, die die Schweizer Bauern bezahlen, längst nicht mehr mithalten. Das ist nicht in Ordnung.«
»Genau«, stachelte Sven seinen Bruder an, »und wenn dann ein deutscher Bauer irgendetwas in die Schweiz einführen will, dann zahlt er kräftig Zoll, der Schweizer Chaibe aber nicht.«
Dass bei diesem Deal die deutschen Landbesitzer den Reibach machten, so wie auch die Schweizer Grundstücksbesitzer, wenn reiche Deutsche sich ihr Häuschen in der Steueroase Schweiz kauften, so weit wollten die jungen Männer nicht denken. Konnten sie auch nicht, denn so unvermittelt, wie zuvor der Traktor aufgetaucht war, tauchte jetzt ein Zollwagen vor ihnen auf.
»Scheiße«, entfuhr es Bernd. »Was machen wir jetzt?«
»Ganz cool bleiben«, versuchte Sven ihn zu beruhigen und holte eine Pistole aus dem Handschuhfach.
»Bist du verrückt?«, entsetzte sich Bernd.
»Bleib cool, lass die doch erst mal rankommen, meist winken sie einen sowieso durch.«
Der Zollwagen fuhr an die Fahrbahnseite, zwei Zöllner stiegen aus, beide setzten sich ihre Dienstmützen auf den Kopf. Dann stellten sie sich mitten auf die Straße und nahmen den Mercedes mit festem Blick ins Visier.
Sven lenkte den Wagen langsam auf die Beamten zu.
Er wirkte unentschlossen, er überlegte: Wenn sie ihn nur durchwinken oder nur die Papiere kontrollieren wollten, dann hatte er keinen Grund, sich jetzt auffallend zu verhalten.
Wenn sie ihn stoppen würden, um den Wagen zu filzen, dann musste er sich etwas einfallen lassen.
»Scheiße, jetzt sitzen wir in der Falle, der Stinke-Schwizer-Bauerntrottel, der hat uns die auf den Hals gehetzt«, fluchte Bernd.
Sven grinste verächtlich. Er hielt noch immer die Pistole in der rechten Hand, entsicherte sie jetzt mit der linken und ließ dabei dem Mercedes freihändig den Lauf. Leise schnurrend bewegte sich der Wagen auf die beiden Männer zu.
Diese postierten sich links und rechts der schmalen Fahrbahn.
Sven ließ den Wagen zwischen sie rollen.
Der Zöllner auf der rechten Seite des Wagens hielt seine Hand hoch. Das Zeichen war unmissverständlich: Stopp!
Sven blickte in den Rückspiegel und entdeckte einen Dienstwagen des Schweizer Zolls hinter ihnen.
»Aha, so ist das, na denn gut«, kommentierte er die Zange, in die sie geraten waren, und klemmte die Pistole zwischen seine Schenkel.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Bernd ängstlich.
»Opa sein Geld bringen«, erwiderte Sven völlig gelassen und betätigte den automatischen Fensterheber. Das Glas senkte sich, der Wagen rollte zwischen die beiden Zöllner. Der eine blieb auf der einen Seite am Wagen stehen, der andere stand links auf der Höhe des Beifahrerfensters.
»Guten Tag, Ihre Papiere bitte«, forderte der Zöllner auf der Fahrerseite Sven auf.
Sven schaute dem Zöllner in die Augen, lächelte freundlich und griff zwischen seine Beine.
Dann ging alles sehr schnell: Sven hob die Waffe für den Polizisten kaum sichtbar mit der rechten Hand hoch und feuerte gleichzeitig los. Er gab einfach einen Schuss aus der Hüfte durch das geöffnete Fenster in Richtung des Zollbeamten ab. Gleichzeitig schlug er das Lenkrad scharf nach rechts ein, gab Vollgas, touchierte den rechts stehenden Zöllner und fegte ihn damit von der Straße. Der Wagen machte einen Satz und stob geradeaus davon.
Die beiden deutschen Zöllner blieben auf dem Boden liegend zurück. Die Schweizer Zollbeamten schalteten vorschriftsmäßig ihr Martinshorn ein und preschten zu ihren deutschen Kollegen. Über Funk schlug der eine Alarm, der andere kümmerte sich zunächst um die beiden Verletzten.
Sven blickte in den Rückspiegel und lachte: »Dem hab ich ein Ei abgeschossen«, prustete er.
Bernd saß kreidebleich neben ihm: »Du spinnst, du bist völlig verrückt, was jetzt?«
»Bleib cool«, beruhigte Sven seinen Bruder, »bis die sich von ihrem Schock erholt haben, sind wir über alle Berge.«
Der Alarm der Schweizer Zöllner rief zunächst nur die Schweizer Kollegen auf den Plan. Doch dank der internationalen Zusammenarbeit gab es eine Alarmstufe, die auch auf der jeweils anderen Seite der Grenze gehört wurde. Im Hauptzollamt Singen blinkten nur wenige Minuten später die roten Alarmlämpchen in der Einsatzzentrale auf. Von dort aus wurde bald eine Großfahndung auf der deutschen Seite gesteuert. Mordversuch an einem Kollegen! Aus allen Polizeistationen von Waldshut über Villingen-Schwenningen bis nach Singen und Konstanz rückten alle Mann aus.
Sven aber gab sich zuversichtlich. Er fuhr zunächst in Richtung Engen. Er wollte diesem Wirrwarr der kleinen Sträßchen entlang der Grenze entkommen. Auf der Autobahn konnte er mit seinem stark motorisierten Wagen schnell Kilometer wettmachen. Auf der anderen Seite war ihm klar, dass gerade dort die Straßensperren zuerst aufgebaut würden. Das sprach für die kleinen Nebenstraßen.
»Wir sollten möglichst schnell in Singen alles in meinen Golf umladen«, schlug Bernd vor.
»Bist du verrückt? Jetzt nach Singen hineinfahren?«, herrschte Sven ihn an.
»Klar, volle Kanne der Polizei entgegen, das glauben die doch nie«, verteidigte Bernd seine Idee. »Die sind jetzt auf alle Autos geeicht, die möglichst weit vom Tatort wegfahren. Wer dagegen in der Nähe bleibt, hat nichts zu verbergen.«
Sven bremste scharf ab und schoss in einen Waldweg. »Schnell, wechseln wir die Nummernschilder aus«, befahl er seinem Bruder und sprang aus dem Wagen, riss die hintere Tür auf, hob die Rückbank hoch und machte sich an der Innenverkleidung des Wagens zu schaffen.
Bernd rannte in der Zwischenzeit um das Auto herum, löste die Kennzeichen vorne und hinten und reichte sie seinem Bruder in den Fond des Wagens. Der gab ihm zwei neue Schilder, die er unter der Innenverkleidung des Fußbodens hervorgeholt hatte, und schob die alten unter die Verkleidung. Dann zog er sein Portemonnaie aus der rechten Hosentasche, nahm den Fahrzeugschein heraus und tauschte ihn mit dem anderen, der zu den neuen Schildern gehörte. Den alten Schein legte er zu den gebrauchten Schildern in den Hohlraum hinter der Verkleidung.
Bernd hatte die neuen Schilder schnell angebracht und setzte sich wieder auf den Beifahrersitz, Sven klemmte sich hinter das Steuer, stieß auf die Straße zurück und fuhr lässig und gemächlich Richtung Singen.
»Give me five«, lachte Sven, und Bernd schlug ein.
Sven drehte die CD wieder auf: »Es regnet Wut, hier gibt es keine Arche, wir ertrinken in Blut«, grölten die Böhsen Onkelz.
*
Kriminalhauptkommissar Horst Sibold hatte endlich dienstfrei. Er hatte einen routinemäßigen Arbeitstag hinter sich mit öden Verwaltungsarbeiten. Der Vorteil: Er kam pünktlich um 16.30 Uhr aus der Amtsstube, wie er das Kommissariat verächtlich nannte.
Horst Sibold war ein gutmütiger Mensch, Karriereleiter und Hierarchiedenken waren seine Sache nicht. Er hatte sich freiwillig aus Stuttgart an den Hohentwiel versetzen lassen, als man zur Verstärkung der südlichen Grenzstadt Polizeibeamte suchte. Zwar nahm er damals die Beförderung zum Hauptkommissar mit, doch wegen der Beförderung war er nicht umgezogen. Es war die Nähe zum Bodensee, die ihn zu dem Umzug ermuntert hatte, und, wenn er ehrlich war, in erster Linie die Scheidung von seiner Frau sowie ernsthafte Alkoholprobleme, die sich in der Dienststelle in Stuttgart herumgesprochen hatten. Singen sollte ein Neuanfang für ihn werden.
Horst Sibold war ein leidenschaftlicher Angler. Ein Argument mehr, das für den Umzug an den Bodensee sprach. In Stuttgart fand er kaum geeignete Gewässer, die ihm gefielen. Den Neckar überließ er lieber Daimler und anderen Industriebetrieben als Abwasserkanal. Die Fische daraus wollte er nie verspeisen. Doch Sibold gehörte schon immer zu den Petrijüngern, die ihren Fang auch selbst konsumierten. Man sah es ihm an, dass er gut und viel aß.
Gleich nach seinem Umzug nach Singen suchte er direkt am See einen Angelverein, in den er eintreten konnte. Doch schon bald fand er im Umland von Singen, im Hegau, sein Jagdrevier, sodass er meist auf das Angeln im Bodensee selbst verzichtete. Ein Kollege war Mitglied der Anglergemeinschaft ›Östliches Hegau‹. Dieser hatte bald Horst Sibold am Haken und zog ihn mit in seinen Verein. In der Aach, im Riederbach oder in der Biber gab es zwar keine Felchen oder Kretzer, aber wunderschöne Forellen und vor allem Saiblinge. Ein frischer Bachsaibling, das war für Horst Sibold wie ein Gedicht. Das leicht rötliche Fleisch des Fisches dünstete er meist nur sanft in Butter, dazu Salz und Pfeffer, einen kleinen Spritzer Olivenöl mit Zitrone, das war’s.
Auch für heute Abend hatte er es sich so vorgestellt. Noch galt für den Saibling, Anfang November, keine Schonzeit, und es war noch hell, als er den Innenhof des Kommissariats mit seinem grünen Opel Omega verließ. Im Kofferraum hatte er die Angelausrüstung immer griffbereit liegen. Er entschloss sich, nicht nach Hause zu fahren, sondern bog an der Bahnhofskreuzung links ab und fuhr südlich aus der Maggi-Stadt in Richtung Gottmadingen.
Der Kriminalkommissar hatte als Petrijünger den Hegau schnell wie seine Westentasche kennengelernt. Er fuhr auf der Landstraße vor Gottmadingen links weg, in Richtung des kleinen Orts Randegg.
Randegg selbst kannte Sibold als Mineralwassertrinker. Die Ottilienquelle in Randegg ist das bekannte Mineralwasser der Region. Den Anglern ist der Ort dank der Biber bekannt, einem durch und durch sauberen Bach mit – für Horst Sibold – den besten Saiblingen.
Ein gutes Stück vor der Schweizer Grenze bog Sibold in einen schmalen Waldweg ab, der offensichtlich nicht weiterführte. Doch er ließ seinen Omega über den Waldboden rollen und lenkte den Wagen geschickt an einigen Bäumen vorbei in ein Gestrüpp. Von hier aus hatte er nur wenige Meter bis zu seinem Angelstand an der Biber.
Sibold öffnete die Fahrertür, stieg aus, schaute sich um, dann knöpfte er seinen Hosenladen auf. Er blickte nochmals in alle Himmelsrichtungen, ließ die Hose ganz runter fallen, setzte sich stöhnend auf den Fahrersitz zurück und zog die weiten Hosenbeine über seine Schuhe. Vom Vordersitz aus griff er rücklings auf die Hinterbank und fischte eine alte Militärhose, die er bei der Bereitschaftspolizei erhalten hatte, nach vorn. Sein dicker Bauch war ihm im Weg, trotzdem schaffte er es, auch diese Hosenbeine über seine Schuhe zu ziehen. Danach wuchtete er sich wieder aus dem Wagen und zog die Hose jetzt ganz hoch. Den oberen Knopf konnte er zwar beim besten Willen nicht mehr durch das dafür vorgesehene Knopfloch schieben, doch wo einst der Knopf hielt, erfüllte heute sein Hüftfett diese Aufgabe.
Dann stopfte er Taschentuch, Messer und Handy von seiner Diensthose in die Anglerhose und ging um den Wagen herum zum Kofferraum. Dort zog er sein Sakko aus, legte es in den Wagen, zog einen dicken Pullover an und darüber eine ärmellose Outdoorweste mit unzähligen Taschen.
Schließlich tauschte er noch seine Schuhe gegen Gummistiefel aus, setzte sich einen Jägerhut auf sein nur noch spärlich mit Haaren bewachsenes Haupt und war endlich bereit, die Angelrute in die Hand zu nehmen.
Gerade wollte er, ausstaffiert wie ein echter Petrijünger aus dem Fachmagazin ›Rute und Rolle‹, losziehen, da bog ein weiteres Auto in den Waldweg ein. Er befürchtete, dass es Abendspaziergänger waren, die ihr Auto parken wollten, sodass sie ihn später eventuell blockierten, wenn er mit seiner Jagdbeute auf die Straße zurückstoßen wollte. Also schaute er sicherheitshalber nach und ging, geschützt durch das Blattwerk der Sträucher, bis zum Rand des Buschs, hinter dem sein Auto stand.
Durch das Gebüsch sah er einen silbergrauen Mercedes und zwei junge Männer. Der eine verkroch sich im Fond, der andere rannte an die Front des Wagens zur Motorhaube und schraubte an der Stoßstange herum. Bald war Sibold klar: Der Mann entfernte das Kennzeichen.
»Heiliger Strohsack!«, fluchte Horst Sibold und fragte sich: »Muss ich diese Lausbuben eigentlich sehen?« Unwillig schüttelte er seinen Kopf. Er hatte Feierabend. Er schnupperte mit seiner Nase schon den Duft von Saiblingen. Er sah ihr zartrosa Fischfleisch vor sich. Er sah aber auch, wie der eine Bursche um das Auto sprang und nun ein neues Kennzeichen an dem Wagen befestigte.
Der Kriminalhauptkommissar fluchte. Er griff in seine Hosentasche und tippte eine Nummer in sein Handy. Auf dem Display erschien: ›Anrufe werden umgeleitet‹.
Horst Sibold wurde ungeduldig. Unwillig schaute er dem Schauspiel, das die beiden Burschen boten, weiter zu.
Mit der Wiederholungstaste versuchte er erneut, eine Verbindung in das Kommissariat herzustellen. Immer noch war besetzt. Jetzt wählte Sibold die Nummer der Zentrale. Es dauerte verhältnismäßig lange, bis abgenommen wurde. Sibold hätte am liebsten losgepoltert, doch er musste leise sein. Also nannte er nur kurz seinen Namen und gab an, was er gerade sah.
»Ein möglicher Autoschieber juckt uns gerade wenig, Herr Hauptkommissar«, urteilte der diensthabende Telefonist in der Einsatzzentrale am anderen Ende der Leitung, »hier ist die Hölle los, ein Kollege des Zolls wurde gerade angeschossen.«
»Wo?«, fragte Sibold.
»Beim Grenzübergang Bibern.«
»Wie ging das vor sich?«
»Ich habe jetzt keine Zeit, Herr Hauptkommissar«, entschuldigte sich der Telefonist und wollte das Gespräch beenden.
»Glauben Sie, ich?«, stöhnte Sibold. »Glauben Sie, ich habe Zeit? Ich habe dienstfrei! Schicken Sie eine Streife, aber hopp!«
»Kollege! Es gibt hier keine Streife, die ich schicken könnte. Alle Mann sind im Einsatz, wir haben im Moment Wichtigeres zu tun, als einem Autodiebstahl nachzugehen.«
Horst Sibold hörte nur noch ein Klicken. Er schluckte trocken und zwang sich zu innerer Ruhe. Er spähte zu den beiden Burschen hinüber und sah, wie sie jetzt wieder im Wagen saßen und rückwärts auf die Straße stießen.
Schnell schlug er sich die Saiblinge aus dem Kopf und den Kofferraumdeckel zu. Klar, stimmte er der Einsatzentscheidung zu: Versuchter Mord an einem Kollegen, da hatte alles andere hintenanzustehen. Aber er konnte deshalb doch nicht diese zwei Trübspitze einfach laufenlassen. Dazu war er viel zu sehr Polizist, als dass er nicht zumindest erfahren wollte, was da vor sich ging.
Kaum hatte der silberne Daimler sich auf der Landstraße Richtung Singen eingefädelt, setzte sich auch Sibold mit seinem grünen Omega auf die Fährte der beiden. Nur zwei Autos waren zwischen dem Daimler und ihm. Langsam wurde es dunkel, er musste nahe dranbleiben.
*
Sven und Bernd fuhren über Gottmadingen nach Singen. Bernd fummelte an einem Weltempfänger und suchte auf dem UKW-Bereich den Polizeisender.
»Das kannst du lassen, die wissen doch eh nichts«, versuchte Sven seinen Bruder zu beruhigen.
»In der Karre sind wir mit den neuen Nummernschildern vorerst sicher, das sehe ich auch so«, überlegte Bernd laut, »aber wenn der Zollbeamte überlebt, wird er dich identifizieren, das ist dann wohl ein Leichtes für ihn.«
»Blöd, ich weiß, aber ich hatte keine Zeit für einen weiteren Schuss, hinter uns standen schon die Schweizer Bullen. Jetzt lass uns erst mal unseren Schatz in deinem Golf verstauen.«
»Dann fahren wir aber sofort damit zu Opa, du musst erst mal für eine Zeit verschwinden!«, riet Bernd seinem Bruder.
*
Auch Horst Sibold hatte den Polizeifunk eingeschaltet. Allerdings genügte ihm ein Knopfdruck, und er war auf Empfang. Er hörte die Ringfahndungsanweisungen seiner Kollegen und konnte sich schnell ein genaues Bild über den Umfang der Straßensperren machen, die im gesamten Hegau errichtet worden waren. Es mussten auch Kollegen aus Villingen-Schwenningen und Rottweil vor Ort im Einsatz sein, dachte Sibold, denn sie hatten schon fast alle wichtigen Kreuzungsstraßen gesperrt.
Er überlegte kurz, ob er den Daimler vor sich nicht fahren lassen und sich sofort im Kommissariat melden musste, um sich ebenfalls dem großen Fahndungsring anzuschließen. Dann aber verwarf er den Gedanken schnell wieder. Seine Neugier siegte: Welches Geheimnis hatten die zwei Jungs zu verbergen?
*
Sven und Bernd nutzten die Südtangente in Richtung Innenstadt.
Der Kommissar lächelte zufrieden. Wenn sie nicht bald wieder die Tangente verließen, würden sie genau auf eine Sperre seiner Kollegen zurasen, das war ihm nach Sachlage klar. Gerade hatte er noch gegrübelt, wie er die beiden Burschen allein stellen könnte, da schien sich das Problem schon zu lösen.
Entschlossen griff Kommissar Sibold erneut zum Handy. Er telefonierte, während er seinen Wagen steuerte. Diesmal ließ er sich von dem jungen Schnösel in der Leitstelle nicht abweisen. Ruhig und sachlich stellte er klar: »Wir bewegen uns auf die Sperre der Südtangente Richtung Innenstadt zu. Vor mir fährt ein silbergrauer Mercedes mit folgendem Kennzeichen …«
Weiter kam er in seinen Ausführungen nicht. Der Telefonist unterbrach lebhaft: »Silbergrauer Mercedes, sagen Sie? Ist das der Wagen, den Sie bei Randegg sahen, bei dem zwei junge Männer die Kennzeichen tauschten?«
»Ja doch, aber nun lassen Sie mich doch …«
»Vorsicht, Kollege Sibold, es sieht so aus, als würden Sie dem gesuchten Tatfahrzeug folgen. Die beiden Burschen fuhren ebenfalls einen silbergrauen Mercedes.«
Horst Sibold stöhnte. Er dachte an seine Saiblinge und hätte am liebsten auf der Stelle umgedreht. Doch jetzt steckte er mitten im Schlamassel. Er war noch nie während seiner Laufbahn auf Verfolgungsjagden scharf gewesen. Er hatte Angst vor hilflosen Verbrechern, die eine Pistole in der Hand hielten, und noch mehr vor schießwütigen Kollegen.
Doch vor ihm zuckte schon das kalte Blau der Warnlichter der Einsatzfahrzeuge der Polizei durch die Nacht. Sibold wusste, dass die Einfahrtsschleuse zur Straßensperre immer 1.000 Meter vor der Kontrollstelle begann. Die Kollegen mussten sie schon im Auge haben.
*
Sven hatte ebenfalls die Sperre erkannt. »Du Volltrottel!«, zischte er seinem Bruder zu. »Die Bullen suchen uns am Tatort. Versteck dein Volksradio und schnall dich an!« Gleichzeitig holte er wieder seine Pistole aus dem Handschuhfach.
*
Im Wagen hinter den beiden Flüchtenden entsicherte Kommissar Horst Sibold seine Waffe. Er war mit dem Einsatzführer der Straßensperre Südtangente über eine Ringleitung mit der Zentrale verbunden. Der Einsatzleiter hatte schnell entschieden. Alle Autos vor dem Mercedes wurden hektisch ohne Kontrolle durchgewunken. Dann rannten vor dem herannahenden Mercedes schnell einige Beamte über die Fahrbahn. Im Schlepptau zogen sie Kunststoffhürden, ein Nagelbrett und zwei Straßensperren aus Kunststoff, wie sie Bauarbeiter auf Autobahnen verwenden, mit sich. Wie im Schulbuch beschrieben, ordneten sie die Barrieren hintereinander an. Selbst für einen Lastwagen war ein Durchkommen nicht mehr möglich. Daraufhin rannten die Polizisten in Deckung.
Sven hatte die ausweglose Sackgasse schnell erkannt. Es waren vielleicht noch 100 Meter bis zur Kontrollstelle. Er fluchte, trat entschlossen das Gaspedal ganz durch, drückte mit dem linken Fuß die berühmte Daimler-Handbremse bis zum Anschlag und riss gleichzeitig das Lenkrad so herum, dass der schwere Mercedes ausbrach und sich um 180 Grad drehte. In neuer Fahrtrichtung, so dachte Sven, könne er vielleicht ausbrechen.
Doch Horst Sibold stand mit seinem grünen Omega quer hinter ihm. Er hatte ebenfalls schnell reagiert und seinen Wagen so auf die Fahrbahn gestellt, dass es fast aussichtslos war, zwischen den Leitplanken und ihm durchzukommen.
Sibold saß noch im Wagen, er schwitzte. Er sah die Xenonleuchten des Mercedes wie eine Drohung auf sich gerichtet. Reflexartig öffnete er die Fahrertür und ließ sich seitlich aus dem Auto fallen. Zunächst musste der Wagen ihm Schutz bieten, dann robbte er mit seinem Revolver in der Hand von dem Fahrzeug weg, sprang, als er außerhalb des Lichtkegels des Mercedes war, ins Dunkel und verkroch sich hinter der nächsten Leitplanke. Sein Jägerhut blieb auf der Fahrbahn zurück.
Die Autos hinter ihm waren stehen geblieben. Einige Fahrer suchten hektisch einen Fluchtweg und legten die Rückwärtsgänge ein. Sibold grinste. Zwar war die Lage für die unbeteiligten Autofahrer prekär, aber ihre Sperre für den Mercedes war perfekt. Der Weg zurück, an ihm vorbei, wurde durch das Chaos versperrt.
Der schwere Daimler stand mitten auf der Straße: das Heck Richtung Straßensperre, wo die Polizei in circa 50 Metern Entfernung wartete; die Schnauze des Mercedes rund 20 Meter vor Sibolds Omega.
Sibold selbst kauerte unterhalb der Leitplanke im Gras. Er spähte zu den beiden Burschen, wollte gerade näher an den Wagen kriechen, da zischten unvermittelt vier Schüsse durch das Dunkel.
Der Daimler senkte sich mit einem Knall.
Sibold war klar, dass seine Kollegen aus der Deckung der Kontrollstelle die Reifen zerschossen hatten. Bravo, dachte er, alle vier auf einen Streich!
Dann war es still.
Eine Ruhe wie kurz bevor ein Fisch anbeißt, dachte Sibold, verscheuchte diesen Gedanken aber schnell wieder.
Über ein Megafon hörte er jetzt die Stimme seines Chefs: »Werfen Sie die Waffen aus Ihrem Wagen und steigen Sie mit erhobenen Händen aus. Sie haben keine Chance, unsere Scharfschützen haben Sie im Visier!«
Sibold lächelte. Eine bevormundende Anweisung, typisch sein Boss. Gerade hatte er sie zur Weiterbildung ›Psychologische Ansprache während Extremsituationen‹ geschickt. Als erstes Gebot hatten sie gelernt: Treiben Sie nie den Täter in die Enge! Doch sein Chef liebte nun mal Fakten. Und Sibold war klar: Wenn die beiden Burschen nicht schnell der Aufforderung nachkommen würden, dann würde die Androhung zur definitiven Realität werden. Vermutlich hatten die beiden in dem Wagen den Kollegen angeschossen, da lagen die Nerven und auch die Revanchegelüste bei jedem Polizisten blank.
Ein weiterer Einzelschuss hallte durch die angespannte Stille.
Die Heckscheibe des Daimlers barst.
Sibold drückte sein Gesicht ins Gras, es roch widerlich. Vorsichtig hob er seinen Kopf.
Der Wagen stand noch immer unbeweglich da, es tat sich nichts.
Kaum war der Hall verklungen, klinkte sich das Megafon erneut ein, die Stimme des Chefs klang jetzt ungehalten: »Wir zählen bis drei, dann sollten Sie die Türen geöffnet haben!«
Doch bevor irgendjemand mit Zählen beginnen konnte, hallte schon ein weiterer Schuss durch das Dunkel. Dieser aber klang deutlich anders – wie ein dumpfer, lauter Silvesterkracher. Gleichzeitig war es kurz blitzhell in dem Mercedes geworden, dann schien es, als würde dieser brennen. In Sekundenschnelle umhüllten Rauchwolken den Wagen.
Flutlichter gingen fast gleichzeitig wie aus dem Nichts an und setzten den Mercedes in ein gleißendes Licht.
Sibold sah, wie die beiden Türen aufflogen und die beiden jungen Männer hustend und keuchend aus dem Wagen flüchteten. Sie hielten ihre Hände schützend vor ihre Augen und bewegten sich, als wüssten sie nicht, wohin sie liefen.
Sibold sprang über die Leitplanken aus seiner Deckung.
Doch bevor er bei dem Wagen angekommen war, standen auch schon Polizeibeamte mit schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen im Anschlag neben ihm. Sie warfen die jungen Männer zu Boden und fesselten sie mit Plastikbändern an Armen und Beinen.
Der Einsatzleiter kam hinzu, hob Sibolds Jägerhut von der Straße auf und setzte ihm diesen auf den Kopf: »Du hast dir die Krönung heute verdient.«
Svens Waffe sowie Goldbarren, einige Edelsteine und Bargeld im Kofferraum des Mercedes wurden sichergestellt. In der Bilanz des Polizeiberichts stand noch am selben Abend in korrektem Beamtendeutsch: Hoch steuerbare Waren: Gold-/Silbermünzen im Wert von circa drei Millionen Euro; Schmuck im Wert von circa 800.000 Euro; und unter der Rubrik Bargeldaufgriffe war ein Wert von rund zwei Millionen Euro angegeben, aufgeteilt in verschiedene Währungen.
Kapitel 3
Der freie Journalist Leon Dold las die Polizeimeldung an seinem Bildschirm in seinem Büro in Überlingen. Er hatte für Eilmeldungen ein akustisches Signal auf seinem PC installiert. ›Zwei Zöllner nach Schießerei verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr‹. Kurz überlegte Leon Dold, ob er mit seiner Kamera losziehen sollte. Doch am Tatort war für ihn, das war klar, nichts mehr zu sehen. Die Polizei lud am Ende der Pressemitteilung zu einer Pressekonferenz ein. Aber was sollte er dort?, fragte er sich. Für die Kollegen der lokalen Medien wie dem Südkurier würde es morgen der aktuelle Aufmacher sein. Zwei verletzte Zöllner, einer in Lebensgefahr, ein Kofferraum voller geschmuggelter Schätze. Das war der Stoff, von dem die Tageszeitungen tagelang leben würden. Aber für ihn, als freier Journalist, brachten solche Storys nicht viel ein. Diese Geschichten übernahmen die festangestellten Mitarbeiter der Medien. Journalisten, die im Tagesablauf der aktuellen Redaktionen integriert und jederzeit einsatzbereit waren. Das war er nicht. Er produzierte meist längere Storys, Features genannt. Er recherchierte intensiv, investigativ und gründlich. Deshalb notierte er sich die Polizeimeldung zunächst nur im Kopf– als Anregung für den eventuellen Einstieg in eine Reportage über den letzten Grenzzaun im HerzenEuropas. Die Geschichte hatte er gerade jüngst wieder verschiedenen Sendern vorgeschlagen. Eine Reise entlang des Zauns sollte der rote Faden für eine halbstündige Fernsehreportage sein. Er hatte das Exposé dem Regionalprogramm angeboten sowie dem ZDF. Schließlich sei diese Staatsgrenze zwischen der Schweiz und Deutschland heutzutage, in Zeiten der weltweiten Globalisierung, irgendwie ein Anachronismus, hatte er argumentiert. Die Schweiz, sie war in sämtlichen Gremien der EU vertreten, trotzdem aber nicht ordentliches Mitglied der EU.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!