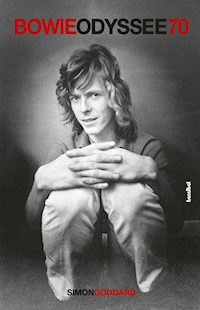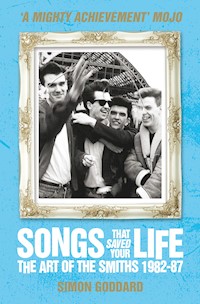Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bowie Odyssee
- Sprache: Deutsch
David Bowie 1971: schicksalhafte Bewegungen Mit Bowie Odyssee 71 erscheint jetzt Band 2 der aufregenden neuen Reihe über David Bowies Leben und Werk in den schillernden Siebzigern. In Bowie Odyssee 70 hatte Autor Simon Goddard bereits einige der Protagonisten etabliert, die für Bowies Karriere von entscheidender Bedeutung werden sollten - darunter Gattin Angie, den zwielichtigen Manager Tony Defries, den genialen Produzenten Tony Visconti und die Band, mit der Bowie den großen Durchbruch schaffen sollte, die Spiders From Mars. 1971, in dem Jahr, das er in diesem Band darstellt, scheint dieser große Durchbruch noch immer weit entfernt. Trotz des Skandals um The Man Who Sold The World, auf dessen Cover Bowie im Kleid zu sehen ist, tritt der Sänger auf der Stelle. Und die britische Musikszene verändert sich allmählich: Ausgerechnet Bowies Freund Marc Bolan erobert mit einem ersten Hauch von Glam und Glitter die Teenagerherzen. Bowie erkennt, dass die Zeiten der Akustik-Troubadoure vorbei sind, und sieht sich nach neuen Inspirationen um: Vor allem seine Begegnungen mit Lou Reed und Iggy Pop werden zu einem schicksalhaften Wendepunkt. "Changes" stehen an, und ganz allmählich wird es auch für Bowie kosmisch ... Erneut lässt Simon Goddard die Grenzen zwischen Dokumentationen und Roman meisterlich verschwimmen. Dieses Mal führt er die Leser in die Schwulenclubs von London, in denen Bowie ebenso nach frischen Ideen sucht wie auf einem winzigen Festival im ländlichen Glastonbury - und der Autor folgt Bowie nach New York, auf dessen rauen Straßen ein anderer Ton herrscht als im vor kurzem noch swingenden London. Wieder fangen viele kleine Szenen den Geist jener entscheidenden Jahre ein und machen Bowie Odyssee 71 zu einer packenden, lebendigen Zeitreise, an der nicht nur Bowie-Fans Spaß haben werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Goddard
BowieOdyssee71
www.hannibal-verlag.de
Impressum
Der Autor: Simon Goddard wurde 1971 in Cardiff geboren – in derselben Woche, als in Großbritannien die ersten Plattenkritiken zu Hunky Dory in den Zeitschriften Disc und Sounds veröffentlicht wurden und Benny Hill verhinderte, dass T. Rex zu Weihnachten auf Platz 1 der Charts standen. Er veröffentlichte unter anderem auch Bowie Odysse 70 (ebenfalls erschienen im Hannibal-Verlag). Dieses Buch ist die Fortsetzung.
Deutsche Erstausgabe 2022
© 2022 by Hannibal
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-741-1
Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-740-4
Titel der Originalausgabe: Bowie Odyssey 71
Copyright © 2021 Omnibus Press
(A Division of the Wise Music Group)
ISBN 978-1-913172-06-0
Coverdesign: Fabrice Couillerot
Bildrecherche: Simon Goddard
Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer
Übersetzung: Andreas Schiffmann
Deutsches Lektorat und Korrektorat: Thorsten Schulte
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Die folgende Erzählung ist im Jahr 1971 angesiedelt. Sie enthält zeittypische sprachliche Formulierungen und Auffassungen, die als anstößig empfunden werden könnten. Der Verlag weist darauf hin, dass sie dem ausdrücklichen Zweck dienen, den soziohistorischen Kontext jener Periode korrekt widerzuspiegeln.
Widmung
FÜR LEESA
Alexandra Maternity Home, 1971
„Jeden Tag wird deutlicher, dass die Leute den Scheiß, der sich anbahnt, nicht hinnehmen werden! Sie organisieren sich überall – die Schiffsbauer halten das Clyde-Gebiet in der Hand, die Menschen in Irland kämpfen für ihre Selbstbestimmtheit, Frauen wehren sich gegen eine egoistisch-chauvinistische Männerwelt, und unsere schwarzen Brüder und Schwestern bekämpfen den Rassismus einer von Weißen dominierten Welt. Und jetzt stehen auch die Homosexuellen auf, um zu sagen: ‚Es reicht!‘ Unsere Unterdrückung hört jetzt auf.“
Jugendgruppe der Gay Liberation Front,
Speaker’s Corner im Hyde Park,
London, 28. August 1971
EINS
„Ist das David Bowie?“
Die Ballkönigin fragt den Traumprinzen. Ihre Lippen sind so nah, dass ihr Atem sein Ohr kitzelt. Nur so kann sie sicher sein, dass er sie trotz des dröhnenden bah-bah-bah-bah der Jackson 5 versteht. Unter ihren Füßen irrlichtert es rot und grün, die Lampen unter dem bunten Plexiglasboden der vollen Tanzfläche blinken im wummernden Takt, obwohl dieses Paar auch ohne sie hell genug strahlen würde. Sie ist ein Starlet: via Chelsea auf dem Weg nach Hollywood, mit High Heels von Terry de Havilland, die bei jedem Schritt Glitzerstaub aufwirbeln. Er ist auch ein Star: ein blonder Rudolf Nurejew in einem selbstgeschneiderten Balletttrikot aus Sakko und Hosenrock, dessen Nähte seiner geschmeidigen Figur schmeicheln wie baumwollener Beifall. Sie kommen nicht bloß zum Tanzen, sondern zum Bezaubern. Und tun es auch.
„OH MEIN GOOOTT!“
Vor kaum zwei Minuten hat sich die Bewunderung eines neuen Fans über sie ergossen wie eine texanische Ölquelle.
„IHR ZWEI SEHT TOOOLL AUS!“
Eine Einladung folgte.
„KOMMT RÜBER, SETZT EUCH ZU UNS UND TRINKT EINEN SCHAAAMPUS!“
Der Bote stolzierte anschließend zu einer der mit rotem Samt gepolsterten Sitzecken zurück, die rings um die Tanzfläche angeordnet und von der anderen Hälfte von „UNS“ besetzt sind – einem langhaarigen Geschöpf in einer Art Kleid. Das Girl ist diejenige, die das Gesicht unter dem Pony erkannt hat: dasselbe putzige Gesicht, das vor ungefähr einem Jahr den Song über Einsamkeit im Weltraum gesungen hat, den sie so gerne mag. Während der Kopf damals mit kurzen, blonden Locken bedeckt war, hat er jetzt Haare wie Rapunzel. Darum musste sie ihren Freund fragen: „Ist das David Bowie?“
Er ist es. David Bowie, bekannt durch „Space Oddity“ und sonst nichts, sitzt in einem lachsroten Gewand mit Blumenmuster da, umgeben von den Samtpolstern, berockt und mit übereinandergeschlagenen Beinen. Er nestelt geistesabwesend am Stiel eines Glases, während er über die regenbogenfarbene Welle aus sich schüttelnden Leibern blickt. Auf dem Tisch vor ihm seufzt ein Teller mit eingefallenem Salat und gelbsüchtigem Schinken, den ein vorbeihuschender Kellner mit Latzhose von Mr Freedom vor zehn Minuten abgestellt hat. David, der von Mr Fish eingekleidet ist, rührt ihn nicht an. Identische Teller welken in den Nachbarsitzecken: Aufmerksamkeiten der Clubleitung, in deren Eintrittspreis ein „Abendsnack“ enthalten ist, um den Gesetzen über den Spätausschank Genüge zu tun. Der Salat ist völlig oberflächlich. Die Kundschaft auch. Vor einem Jahr kamen, sahen und sprachen die Männer von der Zeitschrift, die einmal Jeremy hieß, ein vernichtendes Urteil. „Hier ist das Allerletzte cool. Die Mode. Die Haltung. Der Haufen trendiger Püppchen, bei dem man den Eindruck gewinnt, falls jemand unter den Jungs oder Mädchen Sex hat, dann vor ihrem Zimmerspiegel – mit sich selbst.“ Der Haufen trendiger Püppchen fasst es mit einem Ausdruck zusammen: „super-elegant“. Es ist der einzige Style, der etwas gilt im Sombrero.
Da hier nichts ist, was es zu sein scheint, ist „das Sombrero“ eigentlich nicht das Sombrero. Eigentlich heißt der Club Yours Or Mine?, wie die silbernen Streichholzbriefchen zeigen. Das eigentliche Sombrero – El Sombrero – ist das mexikanische Restaurant oberhalb in der Kensington High Street an der Ecke Campden Hill Road. „Is’ guuut!“, versichert die Werbeanzeige. „Is’ seeehr gut!“ Man kann das El Sombrero nicht verfehlen wegen des Neon-Sombreros, der draußen neben dem Erdgeschosseingang zum Club im Keller angebracht ist und abends eingeschaltet wird. Beide Lokale gehören demselben kleinen Schweizer Harry, der das Sombrero in den Fünfzigern als Café eröffnete und den Namen wählte, weil er gerne in Spanien Urlaub machte. Nachdem es in den Sechzigern abgebrannt war, baute er es wieder auf und vergrößerte das Untergeschoss zu einem Nachtclub, dem ersten in London mit beleuchteter Tanzfläche, die er aus der Schweiz herübergebracht hatte. Dinner oben, Tanzen unten, alles im Sombrero.
Die lebhafte Schlange vor dem Laden, den niemand Yours Or Mine? nennt, zieht sich an der Front des Restaurants entlang, während sie darauf wartet, den Eingangsbereich hinter dem Neon-Hut zu betreten. Sobald man die zwei machohaften jugoslawischen Türsteher und den engelsgleichen Garderobenjungen passiert hat, geht es die Treppe runter, wo man von dem extravaganten Manager Amadeo empfangen wird. Seine Haare sind eine blonde Welle, und zwischen seinen großen Zähnen klemmt ein Noël-Coward-Zigarettenhalter, den er nur herausnimmt, um seine Stammgäste mit einem dreisilbigen „Dha-rrr-ling!“ zu begrüßen. Ein Podest am Fuß der Treppe lockt einen steten Aufzug von Frauen an, die sich beim Eintreten gegenseitig darin überbieten, wie die Schauspielerin und Stilikone Gloria Swanson zu posieren. Erst wenn sie das lange genug getan haben, um von allen gesehen zu werden – eine Hand hochwerfend, mit einer Wimper klimpernd, oder den Kopf für eine imaginäre Großaufnahme zur Seite neigend –, sind sie endlich angekommen.
Einige dieser Leute sind bettelarm, aber ihr Chic bleibt unbezahlbar. Viele sind herausgeputzte Prinzessinnen, unterbezahlte Modehausangestellte, die mit den Waren, die sie anbieten, aber niemals selbst bezahlen könnten, für eine Mitternachtstour auf die Piste gehen, bevor sie sie zurück an die Kleiderbügel hängen, um sie als fabrikneue Ware von Yves Saint Laurent zu verkaufen. Die Kleider der Ärmsten zeugen zumindest von Reichtum an Fantasie: ein Bettlaken wird zur Toga, und ein wertloser, mit Goldfarbe bemalter Plastiklorbeerkranz verwandelt jemanden, der tagsüber ein Niemand ist, in einen Disco-Nero. Peinliche Fragen werden nicht gestellt. Man glaubt dir, wie du dich verkaufst, und nichts verkauft sich so leicht wie Äußerlichkeiten. An diesem Ort darfst du sein, was du willst, nicht was du bist. King’s Road Queens, Mandrax-Miezen, Gauner, Dandys, Gecken, Flittchen, Gigolos und Speedfreaks. Alle verdammt, aber im Licht des Sombrero auch alle verdammt hübsch.
Die Hübschesten gehen nie samstags aus, weil da die Atmosphäre verpestet ist von Anfängern auf Auswärtsfahrt. Ein beliebiger Abend unter der Woche ist besser, und der Sonntag am besten – die angesagteste Nacht für Eingeweihte, wenn diejenigen, die kommen, um zu funkeln und beneidet zu werden, am hellsten funkeln und die heftigsten Neider auf den Plan rufen. Diejenigen, die nie Schlange stehen, nie zahlen und, wenn sie nicht gerade tanzen, im queeren Polari-Slang zwischen Zigarettenzügen in der DJ-Kabine mit Antonello turteln, einem gutaussehenden italienischen Friseur mit trockenem Humor, der die Sounds spendiert, zu denen die Pillenschlucker bis drei Uhr morgens zappeln können. Solche wie Glitter-Fred und Ginger, die gerade verstohlen zu dem androgynen Wesen blicken, das sie für das One-Hit-Wonder David Bowie halten.
Fred ist wirklich ein Freddie, doch Ginger heißt Wendy – ein gewieftes Girl aus Fulham, schlank, attraktiv und nackt, falls sie nichts von Quorum oder Biba beziehungsweise ähnlich schicke Stoffe trägt. Meistens schläft sie bis lange nach Mittag, da sie nachts als Hostess im Churchill’s in der New Bond Street arbeitet, wo ihr Job darin besteht, wohlhabende Gentlemen zu umschmeicheln, damit die den Club um mehrere Hundert Pfund leichter und den Bauch voll mit Champagner und Kaviar verlassen. Wenige können Wendys Reizen widerstehen. Freddy ist zwei Meter groß, hellhaarig und blauäugig. Er ist bei einer Model-Agentur registriert, obwohl die Hauptgönner seiner Schönheit einem raueren Schlag angehören. In erster (Mode-)Linie ist er Schneider und derzeit in der King’s Road angestellt, um Änderungen vorzunehmen, doch sein ganzes Talent bleibt der Privatwirtschaft der kleinen Nähmaschine vorbehalten, mit der er umgeht wie mit einem unerlässlichen fünften Glied. Er ist eine vollständig selbstgenähte Kreation, und sein Name „Freddie Burretti“ eine notwendige italianisierte Verschnörkelung von Fred Burrett aus Bletchley. Seine Garderobe ist seine Welt, und die Welt ein Laufsteg zum Präsentieren seiner Garderobe, die stets ergänzt wird von schwarzen Schnürschuhen mit dicken Korksohlen.
Zusammen mieten sie eine Wohnung in Holland Park, die weiter heruntergekommen ist, als der Stadtteil es vermuten lässt, wenn man von einem Aubrey-Beardsley-Kunstdruck an einer Wand als Eingeständnis von Klasse absieht. Es gibt zwei Schlafzimmer: eins mit Doppelbett, in dem sie gemeinsam schlafen – allerdings nicht als Liebespaar –, das andere unbelegt für Freddies gelegentliche Verabredungen. Zwei schwarze Schafe, die von ihren Familien verstoßen wurden, seitdem in geschwisterlicher Liebe zueinander gefunden haben und noch keine 20 sind. Freddie ist Bruder und häusliche Mutter, Wendy die kleine Schwester, die nichts mit einem Geschirrtuch anzufangen weiß, weil sie zu gespannt darauf wartet, dass „Fifi“ und seine Bande anklopfen, die Klamotten wie vom letzten Vogue-Cover geklaut hatten. Manchmal begegnet man Freddie und Wendy in Chelsea, im La Douce in Soho oder drüben im Catacombs oder Boston in Earl’s Court – überall dort, wo die graue Hetero-Welt der Polyester-Pollys und Old-Spice-Olafs nicht eindringen kann. Aus ebendiesem Grund mögen sie das Sombrero am liebsten.
Es ist Angie, Davids Frau, die zuerst vom Sombrero erfährt, und sie ist auch diejenige, die ihn zum Hingehen überredet. Er widersetzt sich nicht. Den Tipp gab ihr eines der Mädchen bei der Theateragentur Al Parker’s im West End, wo Angie gejobbt hat, um ein bisschen Extrakohle zu verdienen. Falls sie es aber nicht so erfahren hätte, wäre sie früher oder später von jemand anderem darauf gestoßen worden. Das Sombrero passt zu gut zu ihr, um lange vor ihr verborgen zu bleiben: irre Mode, heiße Disco und vollgepackt mit mehr Queers, als ein Zivilbulle mit seinem Knüppel bedrohen könnte. Schon wenige Sekunden nach ihrer Ankunft bestätigt sich alles, was ihnen vom Sombrero erzählt wurde, und mehr.
David analysiert das super-elegante Ambiente schnell und passt seine Maske entsprechend an. Insgeheim aber hat er Herzklopfen. Er erkennt, dass er mit seinen langen Haaren und dem Blumenmusterkostüm nicht mehr die faszinierendste Kreatur im Raum ist. Und auch nicht mehr die androgynste. Sein erster reizüberfluteter Blick fällt auf Freddie, der mit Wendy tanzt wie die optische Entsprechung eines Glockenspiels. Er sieht stattlich, stylisch, prahlerisch: einen Pfau, einen Schauspieler, einen unbelehrbaren Poser; einen verlorenen Jungen, wie er selbst einer ist. David muss seine Neugier befriedigen, ist es aber nicht gewohnt, ohne Hilfe erste Schritte zu machen. Deshalb ist Angie hier.
„OH! SIND SIE … NICHT … TOOOLL!“
David schickt Angie über die Tanzfläche, um sie in ihre Sitzecke zu locken. Die Szene flackert vor ihm wie ein Stummfilm. Angie nähert sich selbstbewusst. Ihre Augen funkeln, sie streckt einen Arm zum Zeigen aus, woraufhin der Junge und das Mädchen in seine Richtung schauen. Nervöses Lächeln, die Münder bewegen sich, ihre Worte ein Rätsel unter dem liebeskranken Geheul des kleinen Michael Jackson.
Angie kehrt allein zurück.
„SIE KOMMEN RÜBER.“
Freddie und Wendy besprechen sich noch. Er beschließt, dass sie Recht hat: Es ist David Bowie.
„Was denkst du?“, fragt Wendy. „Sollen wir rübergehen?“
Beim ersten Prickeln von Champagner in der Nase an einen fremden Tisch zu springen ist nicht die super-elegante Art. Der Instinkt sagt nein, doch die Neugier sagt ja. Freddie schürzt die Lippen. Dann grinst er. „Na dann, komm mit.“
Die Tanzfläche blinkt blau, als das Tempo zu Miriam Makebas Afro-Boogie „Pata Pata“ wechselt. Angie klatscht innerlich mit strahlendem Lächeln, während sich die beiden gelassen nähern und aus zwei vier werden. Obligatorische Vorstellungen. „Wendy.“ „ANGIE.“ „Freddie.“ „David“, sagt David, und seine Gäste nicken, als wüssten sie es nicht bereits. Das Licht ist schwach, aber hell genug, um einander genau zu beäugen. Freddie ist von Davids verschiedenfarbigen Pupillen fasziniert, deren eine unendlich blauer leuchtet als die andere. David taxiert Freddies Haare, Lippen und Wangenknochen und findet, dass er Mick Jagger stark ähnelt: der nächste Mick Jagger werden könnte.
„Singst du?“, fragt David.
„Ich war mal im Schulchor“, antwortet Freddie mit schüchternem Augenaufschlag. „Allerdings vor meinem Stimmbruch. Bis dahin hatte ich wirklich eine sehr schöne Stimme. Wie die meisten kleinen Jungen.“ Sein Blick wird übermütig verschmitzt. „Nein“, fährt er fort. „Ich entwerfe Kleider. Meine eigenen sind alle selbstgeschneidert.“ Er drückt sanft sein Revers zusammen. „Das hier ebenfalls.“
Eine von Davids Augenbrauen zuckt. „Könntest du mir auch was schneidern?“
Freddie schaut zu Davids Bauchnabel hinunter und wieder hoch. „Ja, könnte ich.“ Er setzt sein Glas an und nimmt behutsam einen großen Schluck. „Wenn du mir deine Maße gibst.“
David lächelt. Wendy kichert. Angie wiehert.
„OH SCHATZ! BITTE, DU MUSST DAVID WAS TOOOLLES SCHNEIDERN!“
Mehr Schaumwein wird eingeschenkt, eine Fülle unausgesprochener Gemeinsamkeiten wahrgenommen. Als die Flasche leer ist, besteht ein Bündnis zwischen Enfants terribles. Sie unterhalten sich, sie trinken, sie tanzen; und die ganze Zeit mustern sich David und Freddie einander verhalten – beide Künstler, die langsam ahnen, dass die Suche nach ihrer nächsten Muse vorbei ist.
Sie tauschen Telefonnummern und versprechen, sich wiederzutreffen. David und Angie haben das Sombrero zum ersten, aber nicht zum letzten Mal besucht; bis zur Zeit der ersten Frühlingsblüte werden sie genauso zum Inventar gehören wie roter Samt, Strichjungen und Melanies „Lay Down“, Antonellos übliches Vierminutensignal zum Ende der Party. Sie geht für manche weiter – Freddie und Wendy tragen ihren Hunger mit dem Rest der aufgeputschten Morgentanztruppe die Straße runter in ein persisches Café –, nicht aber David und Angie. Sie torkeln zu einem Taxi in Richtung Beckenham in Südlondon, wo sie wohnen, und lassen sich auf die Rückbank fallen, während ein verzückendes Nachbeben ihre Köpfe durchrüttelt. Ihre Körper wiegen sich zum sanften Rhythmus der Straße, seine Hand liegt auf ihrem Knie, und die Augen werden ihm schwer. Ihre auch. Dann reißt sie sie plötzlich auf.
„OH!“
Stecknadelkopfgroße Ohren aus Zellen, die noch vor einer Woche nicht da waren, um Melanie wummern zu hören, zucken unter einer neuen Empfindung. Sie stöhnt wieder, lauter, und David wacht aus seinen Traumvisionen von Mick Jagger auf. Angie legt seine Hand auf ihren Bauch.
„Fühlst du’s?“
Unter der Haut strampeln Beinchen.
ZWEI
Traumvisionen von Mick Jagger werden auf einer 13-Meter-Leinwand zum Alptraum. Im Film Performance spielt der Rolling Stone den zurückgezogenen Rockstar Turner, der sich von seinem Dämon verlassen in einem Reihenhaus in Notting Hill in ein klaustrophobisches Chaos aus psychotropen Orgien mit seinen beiden Freundinnen stürzt. Unten zieht ein suspekter Störenfried ein: ein zerschrammter James Fox mit zurückgekämmten Haaren, die kunstlos feuerrot gefärbt sind. Er gibt sich als Jongleur „Johnny Dean“ aus, doch Jagger glaubt ihm nicht und sollte es auch nicht. Fox ist in Wirklichkeit ein Gangster namens Chas: ein Pistolenheld, ein Schläger, einer, der schon mal einen Rolls-Royce mit Batteriesäure verätzt, der generell kleine, versnobte Knalltüten einschüchtert und jetzt, nachdem er einen Bekannten umgebracht hat, vor seiner eigenen Bande flieht. Seine letzte Rettung: dieses Boheme-Drecksloch am Powis Square in Notting Hill.
„Wenn du ich wärst, was würdest du tun?“, fragt Jagger.
„Kommt darauf an, wer du bist“, erwidert Fox, und im Zuge eines bisexuellen Trips dämmert dem Pop-Idol und dem Gauner allmählich, dass sie ein und derselbe sind: jeder nur ein Darsteller der Figur, von der sie glauben, sie im Spiegel zu sehen.
Wie auf dem Filmplakat steht, geht es um „WAHNSINN UND VERNUNFT, EINBILDUNG UND WIRKLICHKEIT, TOD UND LEBEN, VICE UND VERSA“. Die Hippie-Presse nennt den Film „die schwerste Kost, die je gedreht wurde“, wodurch sich erklärt, weshalb er zwei Jahre lang bei der Zensurbehörde verstaubte, während er auf die üblen Kürzungen wartete, die seine Premieren-Benefizvorstellung im Warner West End-Kino erst jetzt erlaubten, vier Tage vor Davids 24. Geburtstag. Über den ersten roten Teppich von 1971 zieht eine benebelte Parade aus Rockmusikern, Schauspielern, Diskjockeys und Models, aber kein Mick Jagger. Er sitzt im Janvier-Nebel an einem Pariser Flughafen fest. Ersatzweise beansprucht Keith Richards die Blitzlichter der Fleet-Street-Journaille, Arm in Arm mit seiner Partnerin Anita Pallenberg, der weiblichen Hauptdarstellerin. In ungefähr einer Stunde wird sie sich in prächtigem Technicolor mit Keiths bestem Kumpel splitterfasernackt unter einer Bettdecke wälzen.
Davids Gesicht ist nicht berühmt genug für die Premiere, doch kaum dass er 24 ist, drängelt er durch die Menge auf dem Leicester Square, um sich den Film anzusehen. Bloß um sich zu sehen. Sein farbloses London aus Abfällen in der Portobello Road und nach Kippen stinkenden Telefonzellen in der Wandsworth Bridge Road. Seine Wohnung und Festung aus mit Wasserfarbe bemalten Wänden, Gitarren und Lautsprechern, Ständern voller seltsamer Kleider, merkwürdigen Kunstgegenständen und exotischen Teppichen. Sein und Angies Bett voller Frauen, die Männer küssen, die Frauen sein könnten, die Frauen küssen, die Männer sein könnten. Seine Stimme, wenn sich ein Mund bewegt und sagt: „Weißt du, ich amüsiere mich mit meinem Image.“ Er ist Turner aus Beckenham, der Außenseiter-Poet. „Ich will meinen Schädel komplett ausleeren.“ Er ist Chas aus Brixton, der rotzfreche kleine Gauner. „Ich mag’s ein bisschen ausschweifend.“ Einer und beide, vice und versa, Jones und Bowie.
„Die einzige Performance, die was bringt – die wirklich was bringt, die es voll bringt –, ist diejenige, die wahnsinnig macht, richtig?“
Die Würfel sind gefallen, feuerrot.
Performance haut David um.
Der Junge namens Mark aus Walnut Court, dem Appartement-Block auf der anderen Straßenseite von David, sitzt da und hört sich dessen Lobrede auf Performance an. David spricht nicht so darüber, als hätte er einen Film gesehen, sondern wie jemand, der das Licht gesehen hat. Er strahlt es in 100-Watt-Worten aus, die zwischen Zigarettenzügen flackern, während seine Augen leuchten wie 70mm-Projektorlampen. Eindeutig besessen, aber genauso eindeutig inspiriert. Im gleißenden Glühfaden seines Hirns leuchten jetzt im Rot und Gelb der Sombrero-Tanzfläche Ideen, die ihn mitten in der Nacht wecken, wobei seine Augen von irren Worten und wilder Musik aufgesprengt werden. Es sind Geschenke der Götter des Schlafs, die um vier Uhr morgens Phantome auseinanderjagen, wenn er im schummrigen Mondlicht zum nächsten Stift, Schreibblock und Instrument wankt, um die schwelende Glut zu entfachen, bevor sie abkühlen und erlöschen kann, und die Morgendämmerung Dämon-am-Fenster-Alpträume vertreibt, während Harmonien aus Halbtönen und unerwarteten Sexten aus seinem Kopf purzeln. Er überrascht sich selbst mit seinen Melodien und ihren schlagkräftigen Anmutungen, selbst wenn seine Lyrics nicht ganz so kräftig sind – ein Konfetti aus Ängsten, Hoffnungen und Vaterschaftsfantasien, Überwesen und blendender Super-Eleganz.
Jetzt spielt er eine von ihnen, indem er seine zwölfsaitige Akustikgitarre an sich drückt. Mark folgt ihm auf seiner eigenen Gitarre, während sie beide im Schneidersitz auf dem Teppich des Wohnzimmers hocken. Im enttäuschten Herbst des vergangenen Jahres war es noch Davids und Angies Schlafzimmer; die blauen Wände sind jetzt in einem tieferen Ton von Marineblau gehalten und werden seit Kurzem von einer neuen Sitzbank flankiert, die königlich aussieht, aber so unbequem ist, dass die meisten Gäste lieber zu Boden rutschen. Das Gesicht der ewigen Garbo auf dem Kamin will nicht weichen, genauso wenig wie das von Aleister Crowley, während hier, dort und überall neuer Plunder von Antikmärkten glänzt. Er breitete sich von Regal zu Wand zu Fenstersims aus wie ein üppiger Pilz: Glasgeschirr von Lalique, Daum-Kristallwaren, Vasen von Émile Gallé, Motive von Erté und gerahmte Feen-Illustrationen aus der Zeit Eduards VII.
Das alte Riesenwohnzimmer, in dem aus dem Norden Entflohene einst träumten, sie hätten Obdach gefunden, ist jetzt Davids und Angies Elternschlafzimmer und künftige Kinderstube, die Wände – in letzter Zeit waren sie Salon-mäßig dunkelgrün – werden gerade zartrosa wie ein Damenzimmer gestrichen. In der Ecke des zusätzlichen Schlafzimmers gegenüber, von dessen Fenster man den Garten hinterm Haus sieht, steht noch ein Doppelbett, doch es ist jetzt Davids Musikzimmer mit einem gebrauchten Piano in der Mitte, das sie einem Nachbarn kürzlich für 50 Mäuse abgekauft haben. Wenn er darauf spielt, bebt die ganze Wohnung wie ein Glockenturm, und eine der Tasten ist kaputt. Es hat ihm aber schon „Oh! You Pretty Things“ und anderes noch unbetiteltes Mitternachtsgeklimper geschenkt.
Alles andere in Appartement 7, Southend Road 42 – das Bad, die Küche, der Saal mit seiner riesigen Treppe, die auf einem Absatz nach Nirgendwo endet – ist unverrückbar gleichgeblieben. Verändert haben sich eigentlich nur Betten, Sitzmöbel, Farben, Ornamente und Gesichter. Angie, die im vierten Monat schwanger ist, hat grundlegende häusliche Tätigkeiten an Marks Mum delegiert, die als Doris geboren wurde, aber „Donna“ genannt wird, und zahlt ihr einen Pauschalbetrag dafür, dass sie die enge Küche blitzblank und die weite Bodenfläche wie geleckt hält. Die unverzichtbare Mrs. Pritchett ist auch eine willkommene Ablenkung für Davids Mum Peggy, die ihre Besuche, falls sie kann, zeitlich so abstimmt, dass sie sich bei einer guten Tasse Tee mit Donna über mütterliche Mühen austauschen kann.
Mr. Hoy, der alte Vermieter, kümmert sich noch mit scharfer Baumschere um die Sträucher vorn wie hinten und hat das neue Schild festgemacht, das draußen über der Eingangstür hängt und die würdevolle Geschichte des Gebäudes in weißen Großbuchstaben auf Schwarz deklariert: „HADDON HALL“. Geht man hinten herum, findet man unter der Südseite neben der Kellerwohnung ihrer Freunde Sue und Tony Frost die gemeinsame Garage, die in der pferdebetriebenen Vergangenheit des Anwesens der Stall und bis vor kurzem der Stellplatz für Davids alten Rover war. Mittlerweile hat er ihn verkauft und sich einen schwarzen Riley RM zugelegt, der „nicht so an Croydon erinnert“ und gut zu einem Cockney-Gangster in einem alten Schauspiel-Drama passen würde. Dahinter lümmelt sich ein noch älterer Holzhaufen mit Scheinwerfern und samtenen Sitzpolstern, den man vage als 1930er Riley Gamecock erkennen kann – früherer Besitzer schätzungsweise Kröterich von Schloss Krötenstein. David hofft, ihn wieder vollständig schnellstraßentauglich machen zu können, sobald er Freizeit und Muskelschmalz dazu hat. Das bisherige Ausmaß seiner Bestrebungen ist an den Ölflecken auf dem Wohnzimmerteppich erkennbar, wo er verregnete Nachmittage damit verbringt, in einem dreckigen Overall Motorenteile zu zerlegen. An genau derselben Stelle, wo er nun seltsam traurige Akkorde schrammelt – ein bisschen wie „Space Oddity“, bloß härter klingend – und provisorische Lyrics über heftige Trips und Weltraumgesichter lautmalt.
„Glaubst du, du könntest das lernen?“, fragt er.
Mark ist jünger als David, ein dunkler Schopf aus dichten, schulterlangen Haaren wie eine Allongeperücke über einem Gesicht, das älter wirkt, als er ist – 17 nämlich, Schüler am Dulwich College, wo er mit seinen Kumpels Tim und Pete die Band Rungk gegründet hat. Der Name leitet sich von dem schwedischen Wort für „wichsen“ ab, doch so sind Schuljungen eben, wie die Redaktion der Zeitschrift Oz genau weiß, auch wenn ihre wie Geier über ihr kreisenden staatsanwaltlichen Ankläger das nicht tun. David hat Mark vor etwa anderthalb Jahren im nahegelegenen Beckenham Arts Lab hinten im Three Tuns Pub kennengelernt. Erst nachdem sie über Lyrik, Musik, Bücher und Bands gequatscht hatten, wurde ihnen bewusst, dass sie beide in der Southend Road wohnen. Bald darauf schaute David regelmäßig bei Mark vorbei, um sich Platten oder eine seiner E-Gitarren zu leihen. Nach einem Besuch in Walnut Court überquerte Marks Revox-Bandmaschine die Straße nach Haddon Hall und kehrte nie mehr zurück.
„Dann hätte ich noch dieses andere“, sagt David.
Dieses andere ist etwas schneller und lebendiger, heißt „Hang On To Yourself“ und hat ebenfalls einen provisorischen Text. Mark erkennt und kopiert den Eddie-Cochran-Vibe im Handumdrehen.
„Meinst du, du könntest es den anderen beibringen?“, will David wissen.
Das bezieht sich auf Rungk, und mit „beibringen“ ist gemeint, wie Mark begreift, dass David auf seine typische Art, in Gesprächen stets zwei Gedankenschritte weiter zu tanzen wie bei einem Jump Cut im Film, der alle erklärenden Dialoge auslässt, ihn bittet oder besser gesagt ihm mitteilt, dass Rungk jetzt seine neue Begleitband ist. Das ist, wie David entschieden hat, beschlossene Sache. Mark widerspricht nicht. Und ahnt, dass der Rest von Rungk genauso wenig dagegen ist.
„Ich will sie aufnehmen“, erklärt David. „Aber nicht unter meinem Namen. Ihr seid die Band, werdet aber auch nicht Rungk heißen. Es wird … also, ich hab da so eine … Idee.“
Weiter führt David es nicht aus. Alles zu seiner Zeit. Erst Mark die neuen Songs beibringen, seine Band dazu bringen, sie einzustudieren, dann warten, bis sie bereit sind, und sie wissen lassen, wer ihr Sänger ist. Das Witzigste daran? Nicht einmal der Sänger weiß schon, dass er der Sänger ist. Er wird es aber erfahren. Bald, wenn der Neon-Sombrero wieder aufleuchtet.
DREI
Laurence Myers bürstet ein Lächeln durch seinen Schnurrbart, seine Augen und sein Medaillon funkeln wie die neue Silberne Schallplatte an seiner Bürowand. Mehr als ein Jahr ist vergangen, seitdem er die Buchhaltung gegen das Musik-Business eingetauscht und Gem Music gegründet hat, seinen Produktions- und Management-Stall am Oxford Circus, Ecke Regent Street. Seine jüngste Auszeichnung für eine Viertelmillion verkaufter Exemplare von Johnny Johnson & His Bandwagons „Blame It On The Pony Express“ bestätigt ihm erfreulicherweise, dass es doch kein so übler Karriereschritt war. Schon wenige Wochen nach Silvester entpuppt sich 1971 als sehr gutes Jahr, glaubt Laurence. Falls er es jetzt auch noch schafft, seinen Plan umzusetzen, die Tremeloes in Amerika groß herauszubringen, und vielleicht ein Wörtchen mit Gott redet, damit Arsenal das Double holt, kann er als glücklicher Mann sterben, wie er denkt, während er leise auflacht und sich zurücklehnt, um seine Silberscheibe zu bewundern.
Ein kurzes Stück weit den Flur hinauf befindet sich das Büro des Mannes, ohne den keine Schallplatte an Laurences Wand hängen würde. „Pony Express“-Autor Tony Macaulay, der Goldjunge von Gem, ist heute damit beschäftigt, sein Edison Lighthouse wieder leuchten zu lassen: Die Band, die nie eine richtige Band war, sondern bloß vier arme Schwachköpfe, die sich als jene gesichtslose Session-Combo ausgaben, die „Love Grows (Where My Rosemary Goes)“ aufnahmen und damit zur Nummer 1 in Top of the Pops wurden. Obwohl sie nie eine Platte aufgenommen haben, waren die gefaketen Edison Lighthouse letztes Jahr als die Edison Lighthouse auf Tour. Erst jetzt bringt Macaulay, der noch die Rechte am Namen der Gruppe hat, eine brandneue Version von Edison Lighthouse. „Das Problem mit den alten Edison Lighthouse bestand darin“, erklärt die neue Besetzung, „dass die Platte am Ende größer wurde als die Band selbst.“ Was zumindest im Fall ihrer Eigenkomposition „It’s Up To You Petula“ nichts ist, worüber sich die neuen Edison Lighthouse Sorgen machen müssen.
„Wir sind überhaupt nicht böse auf die neuen Edison Lighthouse“, lügen die alten Edison Lighthouse, selbst als sie genötigt werden, ihren Namen für die Retourkutschen-Single „Everybody Knows“ schlicht zu „Edison“ zu verkürzen. Die Werbung in der Presse macht keinen Hehl daraus: „‚Everybody Knows‘ ist eine aufregende neue Single der Edison, die jeder kennt.“ Alle wissen Bescheid – ob alt oder neu, Edison oder Lighthouse, Original-Fake oder gefaktes Original –, doch niemanden interessiert es.
Paul Raven interessiert auch niemanden. Der Bürogehilfe von Songwriter und Produzent Mike Leander im Zimmer neben Macaulay hofft immer noch auf seinen großen musikalischen Durchbruch. Mit seinem Cover von Sly Stones „Stand“ hat es neulich nicht geklappt, obwohl Paul sich immer noch für so etwas wie einen weißen Soulsänger hält. Vermutlich besteht das Problem in seinem Namen, denn „Paul Raven“ ist gar nicht sein richtiger, sondern eine Abart seines Taufnamens Paul Gadd. Vielleicht muss er ihn aufpeppen; etwas Besseres, eher zu einem Star Passendes mit ein bisschen mehr Glitter? Er wartet und hofft weiterhin, dass ihm Leander eines Tages eine eigene Komposition zu singen gibt. Unterdessen macht er Botengänge, kocht Tee, liest den Melody Maker und flirtet mit Anya weiter unten auf dem Flur.
Alle flirten mit Anya Wilson. Verständlicherweise, denn sie ist unprätentiös gescheit, witzig, ähnelt Brigitte Bardot ein wenig und ist von der Fleet Street bis nach White City als fleißigstes Reklame-Girl im Pop-Geschäft bekannt. Und zum Leidwesen aller hat sie einen neuen Freund, einen strammen Kerl aus Wales namens Dai, der freier Journalist und PR-Agent ist. Anya arbeitet selbstständig, doch weil sie viel für Gem macht, hat ihr Laurence ein kleines Büro überlassen, wo sie im Augenblick mit einem zwischen Schulter und Kinn eingeklemmten Telefonhörer sitzt, während sie mit der Zunge über ihre Zähne fährt und den frischen Geschmack von Rahmblumenkohl aufnimmt. Vor einer Stunde war sie im Cranks, dem vegetarischen Restaurant ein paar Straßen weiter, das sich mit dem „besten Brot der Stadt“ brüstet. Dort hat sie Suppe, Kräuterbuletten und Buchweizennudelauflauf mit ihrem Freund und Klienten Marc Bolan und seiner Frau June gegessen. Das ist deren Dank für all die unbezahlte Hilfe beim Pushen von T. Rex’ „Ride A White Swan“ auf Platz 2 der Charts, genauso wie der neue, pelzbesetzte Wildledermantel, der an Anyas Stuhllehne hängt. June hat gerade gemeint, sie solle künftig für alle von Marcs Platten arbeiten – beim nächsten Mal würde sie mehr bekommen als Kräuterbuletten und Klamotten.
Schade ist bloß, dass Anya nicht bei jeder Single, die man ihr gibt, Wunder bewirken kann. Andererseits ist auch nicht jede ein „White Swan“; manchmal sind es Bleienten. Sie schaut auf die Presseausschnitte, die kläglich auf ihrem Schreibtisch schnattern.
„Ein recht merkwürdiges kleines Stück.“
„Dieser Song vermittelt so ein eigenartiges unterschwelliges Gefühl von Verhängnis und Wahnsinn zu gleichen Teilen.“
„Er steckt so tief in seinem eigenen Trip drin, dass ein kommerzieller Erfolg wohl in weiter Ferne liegen dürfte.“
„Völlig unkommerziell und wahrscheinlich nichts fürs Radio.“
Recht merkwürdig, halber Wahnsinn, weit weg von kommerziellem Erfolg und wahrscheinlich nichts fürs Radio. Das ist die neue David-Bowie-Single auf den Punkt gebracht – quasi eine Totgeburt. Selbst David fällt es schwer, ein gutes Wort über „Holy Holy“ zu sagen. „Es ist mir nicht sonderlich leicht von der Hand gegangen“, entschuldigt er sich bei Kid Jensen von Radio Luxemburg und rekapituliert, wie er einen Song schreiben wollte, der klingt wie „das Ende der gegenwärtigen Zivilisation“. Stattdessen hat er einen geschrieben, der wie das Ende seiner gegenwärtigen Laufbahn klingt. Anya bewirbt ihn vergeblich. Oder fast vergeblich. Ein Einsatz in einer Lokalnachrichtensendung im Einzugsgebiet von Granada TV ist das Beste, was sie bieten kann. David fährt hoch nach Manchester und am selben Tag wieder zurück, wobei ihn Anya und ihr Freund Dai begleiten. Er singt „Holy Holy“ für die Studiokameras und trägt dabei dasselbe Mr-Fish-Outfit wie zuletzt im Sombrero. Das Ende der Zivilisation bricht nicht an, obwohl es Manchesters freudlose Straßen im Jahr 1971 auch ohne Davids Zutun erahnen lassen: George Best wurde gerade wegen versäumter Trainingseinheiten von United entlassen, und die Stadt zeigt ihre Verzweiflung wie eine explodierte Bombe.
Anya hat aber nicht aufgegeben. Sie liebt David so innig wie Marc. Die Musik hörende Öffentlichkeit wird das früher oder später bestimmt auch, nicht wahr? Sie schiebt die Zeitungsausschnitte beiseite, während sie an ihrem Stift kaut, und wählt eine weitere Nummer.
„Ted? Hi, Anya hier. Hör mal, ich wollte fragen, ob du schon mehr wegen David Bowies neuer Scheibe weißt. Für Savile’s Travels?“
Anrufe, Mittagessen, Drinks, Meetings. In der Pop-Branche geht es nicht anders zu als im Spionagewesen. MI5 oder EMI, alles läuft aufs gleiche Machtspiel hinaus. Abmachungen, Gefälligkeiten, Geheimnisse, Druck, Nötigung, Verrat, Treuebrüche, Diebstahl, Unterschlagung, belohnter Erfolg, bestrafte Niederlagen, verlorenes Geld, Auslandsreisen, teure Autos, Landhäuser, fingierte Erzählungen, dementierte Gerüchte, ruinierte Leben, gemachtes Vermögen. Und die ganze Action – die wirkliche Action wohlgemerkt – spielt sich in den gleichen unscheinbaren Gebäuden ab, an denen Passanten nie hochschauen, besetzt mit von Schreibmaschinen umgebenen Frauen, Aktenordnern und -schränken sowie Fotokopierern in Sitzungssälen, mit geschlossenen Jalousien und polierten Tischen oder Büros mit Drehstühlen, Topfpflanzen und Aschenbechern. Büros wie das am Ende des Flurs hinter jenen von Laurence, Macaulay, Leander und dessen Tee-Junge Paul, hinter Anyas und dem Besprechungszimmer, wo sie den Weihnachtsumtrunk abgehalten haben, in dessen Rahmen Paul und Anya Twist tanzten. Das Büro von Tony Defries.
Defries sieht nicht wie der typische Chef eines Spionagerings aus. Das macht ihn zu einem guten. Er ist ein Staranwalt, mit den Kleidern eines Partylöwen, seine lässig schicke Garderobe passt zu seinem wuscheligen Afro. Wenn man ihn von Weitem sieht, denkt man, er würde nach Marihuana riechen und alle „Baby“ nennen: In unmittelbarer Nähe riecht er nach dicken Zigarren und ist bei allem, was er tut, ausgesprochen höflich. Für Defries ist alles Schach. Die Kundschaft – der Mann oder die Frau auf der Straße, das kreischende Girl in der dritten Reihe, der picklige Knabe an den Schallplattenregalen bei Woolworth – glaubt nämlich, dass sich alles um die Bands, dieSänger und dieSongs dreht. Lass sie’s glauben. Das Märchen, demzufolge Platten auf Platz 1 landen, weil die Leute sie einfach mögen. Nicht verraten. Sag ihnen nicht, dass Clive Dunn nicht deswegen gerade mit „Grandad“ an der Spitze der Charts steht, nur weil er in der beliebten Sitcom Dad’s Army mitspielt. Lass sie nicht wissen, dass er dort hingelangt ist, weil irgendjemand irgendwo Hoden gequetscht und Kneipenrechnungen in die Höhe getrieben hat, damit es bei Tony Blackburn gespielt wird und um Dunn für Stewpot zu buchen, und dafür sorgte, dass die armen Teufel in den Presswerken Extraschichten machten, und alle weiteren Hebel in Bewegung setzte, an denen Leute wie Defries ungesehen hinterm Vorhang ziehen, um die Konkurrenz auszubooten. Das ist das wahre Geschäft mit Pop-Musik. Defries’ Geschäft. Kleine, versnobte Knalltüten einschüchtern.
Es ist wie sein aktuelles Problem. Das auf seinem Schreibtisch, das gleiche wie auf Anyas Schreibtisch. „Völlig unkommerziell und wahrscheinlich nichts fürs Radio.“ Nicht das, was Defries erwartete, als er im letzten Sommer zum ersten Mal zu Laurence kam und bat, sich Gem anschließen zu dürfen, nachdem er ihm im Gegenzug die Managementzügel seines neuen Gauls David Bowie übergeben hatte. Er zieht nachdenklich an seiner Zigarre. Die Hiobsbotschaften verschwinden in einer Wolke Qualm – nur eine Sekunde lang, ehe er dünner wird wie Hafennebel, der sich vor einem Schiffswrack lichtet. Anya schwört ihm, alles Menschenmögliche zu versuchen. Vielleicht. Also, was tun mit dem Jungen?