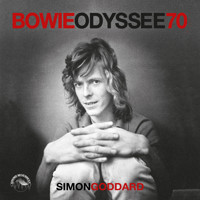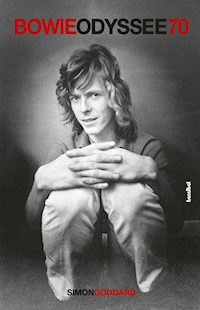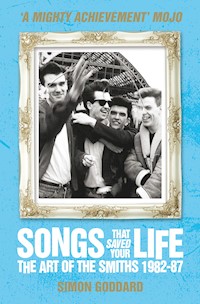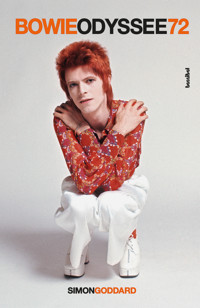
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1972 – David Bowies künstlerischer Höhepunkt: Extrem, wegweisend, grenzüberschreitend 1972 verbreitete sich der Glamrock wie ein Lauffeuer und strahlte bis in die letzten Winkel der Musikwelt. Die Rolle des Macho-Frontmanns gehörte der Vergangenheit an, war einem androgynen Image gewichen – und wie kein anderer stand David Bowie mit seinem damals aktuellen Kunstwerk The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars für diesen Jugendkult. Hier vereinten sich Themen wie Science Fiction, Religion, kultische Verehrung und eine frei ausgelebte, ausschweifende Sexualität, die bei der 72er-Tournee durch eine Bühnenshow mit dramatischen Theaterelementen noch intensiviert wurden. Dank Simon Goddards fesselndem Schreibstil, bei dem er exzellent recherchierte Fakten durch überzeugende fiktionale Ausflüge belebt, entsteht ein plastisches Bild, das Bowie und sein Werk fassbar macht. Im Gegensatz zu bisherigen Publikationen stellt er eine unvergleichliche Nähe zum Künstler und seinen kreativen Experimenten her, die den Leser zum Zeitzeugen des stilprägenden Jahres macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Goddard
BowieOdyssee72
www.hannibal-verlag.de
IMPRESSUM
Der Autor: Simon Goddard wurde 1971 in Cardiff geboren. Neben der Bowie Odyssey-Reihe verfasste er weitere Bücher über Popmusik.
Deutsche Erstausgabe 2023
© 2023 by Hannibal
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-765-7
Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-764-0
Titel der Originalausgabe: Bowie Odyssey 72
Copyright © 2022 Omnibus Press
(A Division of the Wise Music Group)
ISBN 978-1-913172-48-0
Coverdesign: Fabrice Couillerot
Bildrecherche: Simon Goddard
Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer
Übersetzung: Andreas Schiffmann
Deutsches Lektorat und Korrektorat: Thorsten Schulte
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.
Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Die folgende Erzählung ist im Jahr 1972 angesiedelt. Sie enthält zeittypische sprachliche Formulierungen und Auffassungen, die als anstößig empfunden werden könnten. Der Verlag weist darauf hin, dass sie dem ausdrücklichen Zweck dienen, den soziohistorischen Kontext jener Periode korrekt widerzuspiegeln.
ZITATE
„Wir sehen keine Gemeinsamkeiten zwischen Marc Bolan und diesem schwulen Gruselclown David Bowie. Wir glauben nicht, dass in ein paar Jahren noch die Rede von Bowie sein wird, wie es sicherlich bei Marc der Fall sein wird.“
– DEBBIE & LYNN,
Gesellschaft für die Auslöschung von David Bowie
„Warum in aller Welt wenden sich so viele David zu, diesem lauen Lüftchen in der Popmusik mit dem Freak-Gesicht? Bowie … ein Blick auf ihn, und man muss garantiert kotzen. Es gibt jetzt so viele fantastische Künstler – Harry Nilsson, Slade, Rod Stewart –, dass es eigentlich ein Unding ist, dass irgendjemand Bowies beschissene Musik hören möchte.“
– AL DELDERFIELD,
Verband für die Auslöschung von David Bowie
LESERBRIEFE IM RECORD MIRROR, SEPTEMBER 1972
EINS
„Hallo, wir sind hier, um David Bowie zu sehen.“
Die Rezeptionistin schaut, mit den Wimpern klimpernd, auf das verwegene Duo, das gerade aus dem Aufzug gestiegen und an ihren Tisch getreten ist. Schulterlange Haare, lässig schicke Klamotten, der Geruch von Gauloises und Crosby, Stills & Nash. Es könnten Musiker sein.
„Wir sind vom Melody Maker.“
Sie lächelt und senkt ihr Kinn, ein unsagbar sanftes Nicken. Aber sicher doch.
Den mit dem Schnurrbart, der dem von Jason King leicht ähnelt, kennt man weithin als „Mick“, obwohl er viel lieber „Michael“ genannt werden würde wie in seiner Autorenzeile. Er ist seit fast zwei Jahren fester Redakteur beim meistverkauften Musik-Wochenmagazin, wahnsinnig dankbar, dem Lokalblatt aus Mittelengland entkommen zu sein, wo seine eigene Entertainment-Kolumne allwöchentlich als Erholung von dem „Rumtreiberproblem“ und den Forderungen nach einer Wiedereinführung der Prügelstrafe für randalierende Skinheads diente. Statt die ehemalige Crossroads-Darstellerin Sue Nicholls über ihre Wurzeln in Walsall zu interviewen, verdient er nun seinen Lebensunterhalt, indem er mit John Lennon über Goebbels streitet.
Michaels zerzauster Handlanger mit dem fröhlichen Blick, der breit wie ein Kleiderbügel grinst, ohne zu erklären, was so witzig ist, heißt Barrie. Er umklammert eine braune Arzttasche, die mit einem schmuddeligen Mosaik aus Tour-Pässen von Bands beklebt ist. Dass kein Stethoskop drinsteckt, würde niemanden wundern, auch nicht Jan, die Rezeptionistin. Stattdessen sind es eher schamanische Heilmittel: Regenschirm, Blitzgerät und eine Pentax Spotmatic, die schon die Seele der Beatles, von The Who, Jimi Hendrix, Led Zeppelin und allen anderen Melody Maker-Titelhelden eingefangen hat, die mit unsagbar verschlafener Durham-Näselstimme vor seinem Objektiv in Position gebracht wurden.
Michael Watts’ Worte und Barrie Wentzells Fotos helfen dem Blatt gemeinsam, 174.000 Exemplare wöchentlich zu verkaufen – mehr als seine poppigere Schwester Disc and Music Echo, sein tödlichster Rivale New Musical Express, das immer noch zu ernste Sounds und der zu launige Record Mirror – der Grund dafür, dass sich der Maker traut, sich die „Bibel des Rock“ zu nennen, obwohl sein Herausgeber ein 34-jähriger ehemaliger Schachmeister ist, der mit Eulenaugenbrille, bunter wie breiter Krawatte und überkämmter Halbglatze seine wahre Berufung als BBC-Wetterfrosch verfehlt zu haben scheint. Nicht dass es Ray Coleman bekümmern würde. An den Kiosken sticht seine Zeitschrift die Konkurrenz nach wie vor aus. Er setzt großmeisterliches Vertrauen in seine ausnahmslos männliche Belegschaft, die ihn behutsam überredet, die Seiten ihren eigenen Geschmäckern entsprechend zu füllen, wenn sie nicht gerade mit Klebeband umwickelte Exemplare des Hefts von letzter Woche durchs Büro kicken oder sich nach einem feuchtfröhlichen Lunch im Red Lion wieder nüchtern tippen. Aus diesem Grund sind Michael und Barrie trotz Rays partieller Bedenken an diesem tristen Januarmorgen hier in der Regent Street.
„Um David Bowie zu sehen.“
Hunky Dory hat die Sache geschaukelt – das Album, das David kurz vor Weihnachten herausbrachte, als Michael sein Exemplar zusammen mit einem Presseschreiben bekam, das ihn anhielt: „Sperr’ die Lauscher auf, und du verstehst es.“ Also sperrte er die Lauscher wieder und wieder auf, bevor er in seiner aktuellen Maker-Kritik das Fazit zog: „Es ist nicht nur das beste Album, das Bowie je gemacht hat, sondern auch das einfallsreichste Stück Songwriting, das in der letzten Zeit auf einer Platte erschienen ist.“ Er schwärmte noch gestern bei der Redaktionssitzung davon, als er sich erfolgreich um ein Interview-Feature mit dem Schöpfer von Hunky Dory bemühte, das seiner begeisterten Kritik folgen sollte. Es bedurfte nur eines Anrufs bei der Plattenfirma, um das Treffen an diesem Morgen in den Büros von Davids Management Gem Music anzuberaumen.
„Nehmen Sie Platz“, sagt Jan lächelnd und greift nach einem Telefon, während Michael und Barrie ihre knochigen Hintern in die Polster des Rezeptionssofas sinken und ihre Blicke vom Teppich über Chrom und eine Topfpflanze zu einem Beistelltisch mit Hochglanzzeitschriften huschen lassen, die keiner von ihnen anrührt.
Das letzte Maker-Interview mit David fand im April statt, als der für heitere Artikel zuständige Redakteur Chris Welch ihn auf ein Pint ins Red Lion mitnahm, um herauszufinden, warum er auf dem Cover des neuen Albums ein Kleid trägt. Die Überschrift lautete: „WARUM ZIEHT DAVID BOWIE GERN FRAUENKLEIDER AN?“
Und immer noch denselben Sänger erwartet Michael heute noch zu treffen, den er schon Schwarz auf Weiß einen „Priester des high camp“ genannt hat, wobei seine neugierige Nase den frischen Duft witterte, der dem gewöhnlichen Schweißgeruch des Rock eine zunehmend blumige Note verleiht. In den letzten zwei Monaten saß Michael vor Marc Bolan, der sich die Locken aus den Augen strich, während er über sein „bisexuelles Auftreten“ sprach, und beobachtete, wie Rod Stewart aus einem weißen Lamborghini stieg, der nach Blondinen und Blue-Nun-Wein roch, um den „queeren Aspekt“ seiner Bühnenpräsenz zu erläutern. Unterdessen hörte man Michaels Maker-Kollegen und Print-Mitbewerber über Aschenbechern und Bierdeckeln raunen, welche neuen Genrebezeichnungen infrage kämen: „Queer-Rock“, „Schwulen-Rock“ und „Camp-Rock“. Wie ihm Rod allerdings erst letzte Woche sagte, als er eine Fluse von seinem scharlachroten Samtanzug schnippte: „Alles Glamouröse ist ein bisschen camp.“ Die weibische Pose hat Saison, und Michael kommt heute in die Gem-Büros in der Erwartung, eine weitere farbenprächtige Blüte zu sehen. Genauso wie Barrie, der tief im prächtigen Gomorrha von Soho logiert, wo man ihn gelegentlich beim Scrabble-Spielen mit Quentin Crisp antrifft. Wenn die Männer vom Maker eines sind, dann durch nichts aus der Fassung zu bringen.
„Wenn Sie mir bitte einfach folgen mögen.“
Jan begleitet sie durch einen Flur an halboffenen Türen vorbei, hinter denen gedämpfte Unterhaltungen, leise Musik und schrillende Telefone locken. Dann bleibt sie stehen, klopft kaum wahrnehmbar an einer und öffnet sie im selben Moment weit genug, um ihren Kopf durch den Spalt zu schieben. Sie hören sie sagen: „David? Melody Maker ist hier.“ Dann tritt sie höflich lächelnd zur Seite, gleichzeitig schwingt die Tür auf, sodass sie ungehindert in den Raum schauen können …
Irgendwo in nicht allzu weiter Entfernung der Gem-Büros befindet sich eine Schule. Und wo eine Schule ist, da sind auch Schulmädchen. Wenn die Schulglocke läutet, ist Pausenzeit. Und wenn sie Pause haben, stehen Schulmädchen zusammen in den Ecken von Umkleiden, Spielplätzen, Gängen und Toiletten, um in der Mirabelle dieser Woche zu blättern. Und in der Mirabelle dieser Woche steht zwischen dem Dolly-Pops-Comicstrip und einem Gewinnspiel mit dem fantastischsten Mr-Freedom-Zwirn im Wert von 50 Mäusen als Preis, auf Seite 8 die unheimlichste aller Prophezeiungen.
„Schon wieder liegt ein neues Jahr vor uns, und mit ihm kommt ein brandneuer Mann – der Super Guy von 1972. Er wird ganz anders sein als sein Vorgänger. Genaugenommen ähnelt er Ende des Jahres vermutlich einem Astronauten.“
Der begleitende Comic von Super Guy ’72 zeigt einen recht jungen Mann in einem Weltraumanzug und kniehohen Stiefeln mit Plateausohlen, der strähnig gefärbte Haare hat und geschminkt ist.
„Der trendigste aller Männer wird Wimperntusche auftragen und vielleicht auch ein wenig Lidschatten an seine Augen lassen.“
Die Glocke läutet. Die Pause ist um. Die Mirabelle wird wieder zusammengerollt und in einen Ranzen gesteckt. Doch der Geist von Super Guy ’72 wurde aus der Flasche gelassen …
Michael und Barrie blinzeln. Aus einem Sessel vor ihnen erhebt sich eine Gestalt in einem merkwürdigen, zweiteiligen, gesteppten, futuristischen Overall, der wie eine elektrische Leiterplatte gemustert ist. Das kragenlose Oberteil wird am Reißverschluss aufgezogen und entblößt eine knochige, alabasterweiße Brust. Der Schritt ist gepolstert, die Hosenbeine haben zu den Knien hin Hochwasser und klotzen mit einem glänzenden Paar feuerwehrroter Ringkampfstiefel mit dicken Plateausohlen. Die Haare sind ganz anders als bei der eindrucksvollen Greta Garbo auf dem Cover von Hunky Dory, kurz und gescheitelt, stachelig auf dem Kopf und elfenhaft fransig an den Seiten, wo die Ohren abstehen. Am seltsamsten sind die Augen unter dem flaumigen Pony, weil sie farblich nicht zusammenzupassen scheinen; das eine, das irrsinnig starrt, ist blau, das andere braun und geweitet wie unter Drogeneinfluss. Die bereifte Hand, die keine qualmende Zigarette hält, streckt sich unvermittelt aus. Michael nimmt und schüttelt sie, ordnet seine Gedanken neu. Hinter ihm wird das Grinsen, das Barrie im Gesicht steht, seit er heute Morgen aufgewacht ist, noch etwas breiter.
„Hi.“ Kurz blitzen schiefe Zähne auf. „Ich bin David.“
Er setzt sich wieder und spiegelt dabei Michaels Bewegungen, der es sich im Sessel gegenüber bequem macht. Ein Stück weit vor der hinteren Wand nimmt Barrie leise die Pentax aus seiner Arzttasche. David beugt sich in seinem Sessel nach vorn, um eine neue Marlboro Red anzuzünden, und erstickt die Flamme beim Ansaugen, ehe er sich zurückfallen lässt und die Zigarette hält wie es in Schals gewickelte Vamps in alten Filmen tun: wackelnd zwischen Zeige- und Mittelfinger der Hand, die mit der Innenfläche nach oben abgeknickt ist, während der Qualm aufsteigt und verfliegt wie bei einer Leuchtfackel auf dem Meer. Er schlägt sein rot gestiefeltes linkes Bein – der Fuß zuckt merklich – über sein rechtes Knie. Er knetet sein Kinn sanft. Er haucht aus. Er grinst. Er ist bereit zu explodieren.
David weiß, was er sagen wird, bevor überhaupt eine Frage gestellt wurde. Er wusste es schon heute Morgen beim Aufwachen, geweckt von fernem Tellerklappern, als Donna von gegenüber – manchmal liebevoller „Dolly“ genannt – mit ihrem täglichen Küchenputz begann. Er wusste es gestern Nacht, als er mit seiner Frau Angie in sein Himmelbett fiel, während ihr sieben Monate alter Sohn Zowie in seinem Bettchen gluckste. Er wusste es letzten Sonntag, als er mit seiner gepuderten Gang aus Freddie, Daniella, Wendy und allerlei amphetaminisierten Kurtisanen – männlich, weiblich und in allen 57 Zwischenvariationen – Hüftstöße auf der Tanzfläche des Sombrero vollführte. Er wusste es letzten Samstag, als er 25 wurde und die Schicksalsglocke ein stürmisches „Jetzt oder nie“-Ding-Ding ertönen ließ. Er wusste es seit Tagen, Wochen, den letzten paar Monaten: der sich aufbauende Druck, sein schärfer werdender Verstand, seine härter werdende Musik, sein ganzer Körper wie unter Strom gesetzt. Er wusste bloß nicht, wann. Bis gestern, als man ihm mitteilte, der Melody Maker wolle ein Treffen. Sein erstes Interview 1972. Da wusste es David.
Heute fängt es an.
Wie an den meisten Tagen fängt es für David in der gemieteten Erdgeschosswohnung in der Southend Road 42 in Beckenham mit einer Tasse Kaffee, einem Glas Orangensaft und einem „Morgen, Dolly“ für Donna Pritchett an. Die Morgenstunden in Haddon Hall sind deutlich stiller, nun da der obere Treppenabsatz seine drei Untermieter verloren hat: Davids Band – Mick, Trevor und Woody – sind gemeinsam in eine Mietwohnung im ersten Stock zwei Meilen weiter nördlich in der Nähe des Bahnhofs West Wickham gezogen. Während Donna abstaubt, lässt Angie David ein Bad ein, wo er in Ruhe über den bevorstehenden großen Tag nachdenken kann, umgeben von Seife, Shampoo und einem Stapel Sex-Magazine – Forum, Curious, Heat, Club International – für eine vertiefte Lektüre, während sein kleiner Sohn in die Obhut ihrer Untergeschossnachbarin und hauseigenen Nanny Sue Frost gegeben wird. Dann hilft Angie Donna beim Aufräumen des Vorderzimmers, wo noch der schwache Duft von Rotem Libanesen in der Luft schwebt, über verstreuten Plattencovern von There’s a Riot Goin’ On, Roger the Engineer, Fun House und Chuck Berry’s Greatest Hits. Gleichzeitig steht draußen der alte Mr. Hoy, der das Anwesen vermietet, und harkt nach vorne gebeugt sorgfältig das Laub von der vorderen Grundstücksgrenze wie eine Figur im Hintergrund eines Gemäldes von John Constable.
An jedem anderen Tag würde David vielleicht schnurstracks in sein Klavierzimmer mit Blick auf den riesigen Garten hinterm Haus gehen, wo Curly-Lampen und Lalique-Glas sein stilles Publikum abgaben bei den ersten Schwingungen von „Five Years“, „Lady Stardust“ und all den anderen Songs, als diese noch unberührt von den kürzlichen Streichungen und plötzlichen Akkordwechseln zwischen den Wänden ihr Debüt feiern. Heute jedoch, an dem Tag, wo es anfängt, ist keine Zeit. Nach dem Baden verbringt er eine notwendige Ewigkeit in seinem rosa Schlafzimmer, um in die neuen Kleider zu schlüpfen, die ihm sein lieber Freund Freddie genäht hat. Ein passender gesteppter Baumwollzweiteiler, geschneidert aus grau-dunkelgrüner Leiterplatte von Liberty London. Das Oberteil ähnelt einer kleinen Windjacke, die Jeans wurde von Freddies Lieblingsdesigner inspiriert, Antony Price vom Che Guevara an der Kensington High Street. Price hat neulich freche „Knackarsch“-Caprihosen für Damen mit ins Gesäß genähtem Zusatzmaterial herausgebracht. Für David bedient sich Freddie der gleichen Idee, bloß andersherum mit dem Polster im Schritt für eine noch frechere Beule – als wäre Davids Gemächt nicht auch so schon dick genug. Schließlich schlüpft er in seine neuen, roten Plateaustiefel, die Russel & Bromley auf Bestellung geschustert haben. Noch einmal vor dem Kupferrahmenspiegel an seinen frisch geschnittenen Haaren zupfen, dann geht er hinaus in die Kellergarage an der Südseite des Hauses, wo seine drei Rileys stehen: der museumsreife Gamecock, der schwarz-graue und der rot-weiße, in den er steigt und den Zündschlüssel dreht. Mr. Hoy, der noch Laub recht, blickt nicht auf, während sich David in die Einfahrt windet und Richtung City aufbricht.
So fängt es an.
Wie ein Film, in dem Davids Wagen in einem Panoramaschwenk des Kamerakrans in der Ferne verschwindet, während die Titelmusik mit dem eröffnenden C-Dur-Septakkord seiner neuen Single „Changes“ losbebt. Sein Management hat es von Hunky Dory ausgewählt und sieht darin die größte Chance, die zweijährige Flaute seit seinem letzten Hit „Space Oddity“ zu beenden. Die Strophen sind vielleicht etwas eigenartig, doch es hat eine sehr anregende, Beatles-artige Piano-Bridge aus seinem früheren Lied „London Bye Ta-Ta“ und einen gewaltigen, poppigen Refrain, der auf stotternden Lyrics beruht wie „My Generation“ von The Who. Darum liebt Tony Blackburn das Stück. Er spielt es die ganze Woche über täglich in seinem Frühstücksprogramm auf Radio 1; heute Morgen, als David aufstand und badete, lief es zwischen dem Gin-Mundgeruch „Stay With Me“ von den Faces und dem Soul-Geklatsche „Festival Time“ der San Remo Strings.
Dass Blackburn „Changes“ so liebt, hat einen sehr guten Grund. Später am Abend dieses Tages, an dem es anfängt, hält er um die Hand seiner neuen Freundin an, die Schauspielerin Tessa Wyatt. Sie wird ja sagen, und morgen nach einem weiteren Frühstücksprogramm, in dem er „Changes“ erneut spielt, werden sie Ringe kaufen gehen. Ihrer wird 300 Pfund kosten. In sieben Wochen heiraten sie, der Bräutigam in einem burgunderroten Twill-Reiteranzug, die Braut in cremefarbenem Wollkleid mit schwarzen, kniehohen Stiefeln. Zu diesem Zeitpunkt hat Blackburn endlich seine Junggesellenbude in Regent’s Park aufgegeben, und sie wohnen in einer neuen, dreigeschossigen Doppelhaushälfte mit vier Zimmern auf einem Privatgrundstück in St. John’s Wood. Bis dahin wird er Davids Single den ganzen Januar hindurch als morgendliche Ouvertüre zu pfeifenden Wasserkesseln, verbrennendem Toast und aufgeweichten Cornflakes laufen lassen. Wie ein eheliches Mantra.
David sieht „Changes“ jetzt nur noch als frühere Vorahnung, die er vor sechs Monaten hatte und die seitdem in Frisur, Kleidung und Ton wahr geworden ist. Das Schicksal des Songs in den Pop-Charts, die derzeit von „I’d Like To Teach The World To Sing“ von den New Seekers angeführt werden, juckt ihn nicht sonderlich. Hunky Dory ist seit nicht einmal vier Wochen draußen, aber schon Vergangenheit. Die Stunde hat geschlagen, der Kalender wurde umgeblättert, der Tisch rein gemacht. Heute fängt es an. Oder sie. Die Zukunft. Ein neues Jahr, ein neuer David.
„Er wird ganz anders sein als sein Vorgänger …“
„Ziggy Stardust.“
Er sagt es, während er dandyhaft Zigarettenqualm aushaucht und Michaels Stift in Kurzschrift über seinen Spiralnotizblock tänzelt. David wiederholt es.
„The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.“
Der Titel seines neuen Albums, das mehr oder weniger fertig ist und gerade in seiner harten, glitzernden Beinahe-Vollendung auf einem Tonbandgerät in der Büroecke läuft.
Er erzählt Michael: „Es handelt von den Abenteuern und der letztlichen Auflösung einer fiktiven Rockband.“ Abgesehen von einem gelegentlichen „kosmisch“ und „abgespaced“ sagt er kein Wort über Außerirdische oder den Weltraum. Das erachtet er nicht als notwendig. Ziggy ist schlicht ein Archetyp – ein „Klischee“, wie er ihn später nennen wird –, Davids eigenes Frankensteins Monster, zusammengenäht aus ganz irdischem Rock-’n’-Roll-Fleisch: die traurige Geschichte des Legendary Stardust Cowboy, seines wilden Freundes Iggy, von Syd Barretts Wahnsinn und der Tragik des englischen Rockers Vince Taylor, dem David in den 1960ern in Soho begegnete und der dermaßen auf Acid war, dass er sich für den Sohn Gottes hielt. In dem einen Song, der nach ihm benannt ist, lastet ein ähnlicher Heiland-Komplex auf Ziggy: das ultimative Jugendidol, gequält von seiner eigenen Eitelkeit wie eine überzeichnete Karikatur von Jagger oder Marc, seine Band The Spiders From Mars ein Pendant zu den Stones oder T. Rex. Der Rest des Albums folgt keiner Erzählung, sondern ist bloß eine Sammlung von Songs, die Ziggy und die Spiders in Davids Vorstellung spielen würden, sei es sein alter Arnold-Corns-Rocker „Hang On To Yourself“ oder Chuck Berrys „Round And Round“. Michael ist der erste Journalist, der das Album hört und entscheiden muss, wo musikalische Fantasie aufhört und gedruckte Wirklichkeit beginnt. Spricht er mit dem Sänger oder der Hauptfigur der Lieder?
„Ich mag einfach keine Kleider, die man in Geschäften kaufen kann“, sagt David zur Erklärung seines Aufzugs. „Frauenkleider trage ich auch nicht ständig. Ich wechsle sie täglich. Ich bin nicht ausgefallen. Ich bin David Bowie.“
Er prophezeit, er „werde berühmt, und das ist ziemlich beunruhigend.“ Seines Erachtens hat er „mit meinem Chiffon und meinem queeren Getue einen neuen Typ Künstler“ geschaffen. Sein Werk diene einem ähnlichen Zweck wie „Gespräche mit einem Psychoanalytiker.“ Michael schreibt die Antworten auf seine Fragen schnell nieder und bemüht sich, das Innere des Menschen, der David Bowie sein könnte, anhand der Oberfläche dieser wahrscheinlich neuen Rolle zu ergründen, die er Ziggy Stardust nennt. Womöglich sind sie ein und dieselbe Person, Ich und Es. Einander jagend wie Katz und Maus, sowohl zu ihrer eigenen neckischen Unterhaltung als auch für das heutige Zwei-Mann-Publikum, verspielt und frotzelnd in knallbuntem Polari. Die „Queer-Masche“, könnte Rod mit einem Gackern sagen, das BH-Verschlüsse aufhakt. Bloß dass dies anders ist. Als Ehemann und Vater spart sich David die Mühe, Michael seinen pulsierenden Machismo zu beweisen. Auf die „Schwulenbewegeung“ angesprochen spürt er schwach Sombrero-Champagner auf seiner Zunge perlen.
„Ich bin vermutlich das, was die Leute als bisexuell bezeichnen würden.“
Und so fängt es an.
„Ich bin und war immer schwul, schon als David Jones.“
David lächelt. Michaels Stift gleitet über den Block, während hinter ihm die Pentax klickt. Die Farbfilmfiktion von Ziggy Stardust wird 35-mm-Schwarzweißfakt.
Der kurze Januartag der Offenbarungen ist im Nu zur blauen Abendstunde vorgerückt. In der Fleet Street haut Michael in die Tasten seiner Schreibmaschine. In der Dean Street bereitet Barrie in der Dunkelkammer seiner Wohnung über Pizza Express Entwicklerlösung und Stoppbad vor. In der Regent Street trotzen die hellen Ladenfenster unterhalb der Gem-Büros der Dämmerung, während die Leute im Konvexspiegel von Pfützen nach Hause eilen, die der Nieselregen tagsüber hinterlassen hat, wobei die feuchte Luft mehr davon verheißt. David eilt allerdings nicht weiter als wenige Hundert Yards die Straße hinunter.
Heddon Street. Im kalten Feierabendzwielicht, wenn die Kneipen wieder öffnen, ist sie so leer und geheimnisvoll wie ein Edward-Hopper-Gemälde oder die nach Bourbon riechende wehmütige nächtliche Stimmung auf einem alten Sinatra-Plattencover. Die perfekte Kulisse also für Ziggys Gegenstück zu Franks In The Wee Small Hours. Eine andere Rolle Kodak-Film in einem anderen Apparat. Er gehört dem Fotografen Brian, der die Porträts für Hunky Dory angefertigt hat, und bereit ist, heute Abend in der Nebengasse von Mayfair, wo sich Lagerhallen für Mode befinden und er ein Studio mietet, neue zu machen.
David, der noch seinen Leiterplatten-Anzug und die roten Stiefel anhat, trägt eine Shaftesbury-Les-Paul-Kopie. Eigens für diese Fotosession hat er sie von seinem Freund Mark geliehen, dem halbwüchsigen Sohn von Donna von gegenüber. Normalerweise spielt er dieses Gitarrenmodell nicht, glaubt aber, Ziggy würde es tun – und Ziggy ist derjenige, den David spielt, während er vor Brians Objektiv auftaucht und wieder verschwindet. Er raucht unter dem schmiedeeisernen Laternenpfahl, in und vor den Telefonzellen an der Ecke, geht x-beinig knurrend in die Knie, indem er Marks Gitarre einen Stoß versetzt, streift an am Bordstein parkenden Autos entlang, die der Regen zu glänzenden Särgen aus Metall und Glas macht, vorbei an überquellenden Mülltonnen, aus denen haufenweise ungewollter Krempel auf den Gehsteig gepurzelt ist. Bis Brian ihn ins Clair-obscur eines Eingangs führt, wo ein Leuchtschild auf eine Kürschnerei verweist.
K. WEST
David stellt einen Fuß auf eine Tonne, legt den linken Arm aufs Knie und lässt die Hand hängen wie eine Michelangelo-Skulptur. Er greift den Hals der Gitarre, die zu seiner Rechten hängt, und richtet sie wie ein Gewehr geradewegs auf Brians Objektiv. Schussbereit. Sein Kopf bewegt sich nicht, die geschminkten Augen schauen ins Unendliche hinaus. Der Blick eines Mannes, der plötzlich seine eigene Zukunft sehen kann.
Bloß dass sie näher ist, als du denkst, David. Viel näher. Sie ist schon da, heute Abend in der Stadt, auf der Fluglinie der Picadilly-Tauben weniger als eine halbe Meile von der Stelle entfernt, wo du im strömenden Regen gestanden hast. Die Regent Street hinunter und hinterm Café Royal ab, geh weiter, genau, das ist es, ganz durch bis zur anderen Seite des Leicester Square. Siehst du sie jetzt? Eine Filmpremiere im Warner West End. Das ist deine Zukunft, David. Deine Zukunft.
Die Abenteuer eines jungen Mannes, der sich vornehmlich für sexuellen Missbrauch, extreme Gewalt und Beethoven interessiert …
ZWEI
Da sind sie. Das heißt: David und seine drei Spiders, also Mick, Trevor und Woody. Sie sitzen zu viert in einer Reihe im Dunkel des Kinos, wo es an diesem elendig kühlen Winterabend warm und behaglich ist. Es ist dasselbe Kino mit der bolschigen 43-Fuß-Riesenleinwand, in dem ihm vor nicht einmal einem Jahr beim Viddieren von Performance mit Mick Jagger die Glasiäpfel hervorgetreten sind. Und natürlich treten sie in dieser eisigen Notschi wieder so weit hervor; er wusste, dass sie das würden, seitdem er das erste Slowo über Uhrwerk Orange gelesen hatte.
In den letzten 14 Tagen konnte man keine Zeitung aufschlagen, ohne den neuen Stanley-Kubrick-Streifen ins Litso gerieben zu kriegen. Vor allem die mit den großen Buchstaben, die völlig besummst und besorgt sind wegen der Szenen mit den nackten Petiezas und der extremen Gewalt, halten ihn für viel schlimmer als die Titten- und Vampirfilme der Hammer-Studios, obwohl nicht viel Ketchup herumspritzt. Es handelt sich gewissermaßen um einen Science-Fiction-Film, der im England einer so nahen Zukunft spielt, dass man sie schon riechen kann. Es geht um diesen bösen jungen Bratschni Alex und seine fiesen Freunde oder Droogs, die ihre Abende damit verbringen, zu vergewaltigen, zu rauben und mit Britwas gegen andere Gruppas fieser kleiner Bratschnis zu kämpfen, nur zum Spaß und für den Kick quasi. Bis Alex gefasst und in den Knast gesteckt wird. Wo er einer radikal neuen Aversionstherapie unterzogen wird, die ihn zu einem spugi Pazifisten-Schwächling macht. Eigentlich ist es eine pechschwarze Komödie, die jedoch eine sehr ernste Aussage über den freien Willen trifft. Trotzdem empören sich alle Gazetten: „DER FILMSCHOCKER, NACH DEM NICHTS MEHR KOMMEN KANN.“ Am lautesten scheinen sie darüber zu klagen, dass es da draußen ihres Erachtens eine Generation gelangweilter junger Brüder gibt, die Alex und seinen Droogs nacheifern, wenn sie sie viddiert haben, indem sie Overalls, Hemden ohne Kragen, Springerstiefel, Melonen, Hosenlätze und Hosenträger mit Plastikansteckern in der Form von Wunden oder blutenden Glasiäpfeln tragen. Das Sunday Times Magazine bezeichnet das als „futuristischen Skinhead“-Look. Und nicht nur, dass sie sich wie sie anziehen, sondern auch so sprechen und handeln würden, weshalb viele befürchten, dass ein „Uhrwerk-Kult“ aus Banden umherziehender Trittbrettfahrer entsteht, die wahllos vergewaltigen, plündern und töten, während sie „Singin’ In The Rain“ grölen. Was nicht so weit hergeholt ist, wenn man an jene arme Schwuchtel denkt, die vor zwei Jahren in der Nähe des Wimbledon Common von einer Gruppe stockschwingender Bratter zu Tode getolschockt wurde. Echte Horrorshow.
Das Komische an der ganzen Panik ist jetzt, dass die Beule in Davids neuer Hose schon entworfen und vernäht war, ehe er nur ein Standbild irgendeines Droogs mit Latz viddiert hatte – und sei es nur in der Presse. Die Tintenkleckser-Sophistos von den Klatschblättern werden aber einfach mutmaßen. „Sag mir, ist deine Buchse von Alex’ Latz inspiriert?“ Und weil David ein umniger Maltschick ist, wird er lediglich nicken. „Ganz recht, Bruder.“ Weil es ihm nicht schadet, sie glauben zu lassen, ihm ginge es nur um das alte Rein-raus, Synthomeskal und Rock ’n’ Roll. Aus dem gleichen Grund hat er seine Spiders in ebendieser Notschi in diesen sündigen West-End-Salon mitgenommen und gebetet, dass Uhrwerk Orange ihren Rassudock beruhigt wegen des aparten neuen Fummels, den sie auf der Bühne tragen sollen. Echt schicke Starklamotten also. Hose und Blouson in Gold für Mick, leuchtendes Blau für Trevor, silbrig glänzendes Rosa für Woody, jeder mit einem eigenen bolschigen Paar Ringkampfstiefel in anderer Farbe und vielleicht, wie David hofft, ein bisschen Lubbilubbi mit Wimperntusche. Dummerweise denken sie, weil sie mit Humber-Wasser getauft sind: Wenn du mit Satin-Plattys und nuttigen Wimpern herumstolzierst, kannst du nur ein eierloser, qualliger Eunuch sein. Insbesondere Mick, der davon überzeugt ist, dass seine armen, alten Em und Pe daheim in Hull in ihre Cornflakes heulen und kreischen werden, weil ihr geliebter Sohn nur noch wie enteiert mit gespreiztem Handgelenk herumfuchtelt. „Was werden die Nachbarn denn sagen?“ und lauter solche Jammerei.
Auch war es nicht von Vorteil, dass David neulich ein Ballett in der Royal Festival Hall mit ihnen viddierte, um ihnen den Gulliver für die Möglichkeiten zu öffnen, die Licht, Posen und das Abziehen einer Show bieten – bis an die äußerste Grenze dessen, wozu ein verschworener Haufen auf der Bühne imstande ist. Das ganze zauberhaftes Geflacker und der Kostüm-Wahnsinn. „Fantasie“, meinte David zu ihnen. „Die Leute schießen sich gerne auf jemanden ein, von dem sie das Gefühl haben, dass er nicht genauso ist wie sie. Momentan gibt es nur ganz wenige Stars. Die Leute, die Bands – alle sind so langweilig.“ Wie sie aber so dasaßen, aus ihren Limo-Flaschen schlürften und rülpsten, Knabbereien mampften und mit den Tüten raschelten, mit ihren Glasis auf all die Ludis in Tutus und Strumpfhosen glupschten, dem putzigen russischen Tamtam und Zuckerfeen-Geplänkel sluschten, verstanden sie kein bisschen, was Der Nussknacker mit dem wummernden, hart verzerrten Bäm-Bäm zu tun haben sollte, das sie mit David einstudieren. Als sie sich also vor wenigen Notschis in ihren schönen neuen Plattys und Stiefel ablichten ließen, wunderte sich David darüber, dass ihnen immer noch das Krowy in die Wangen stieg. Als ob die kindischen Rotbäckchen sich die Horrorshow-Abreibung vorstellten, die ihnen blühen würde, wenn sie mit diesem Zeug in der Hessle Road oder irgendeiner anderen hinterletzten Seitengasse daheim im stinkigen Hull herumliefen.
Dann aber greift David wie in einem Märchen zu einer Zeitschrift, viddiert seine ersten Standbilder von Alex und dessen Droogs – alle beängstigend coole, ausgeflippte Halbstarke – und liest das wütende Gefasel über Mr. Kubricks sündhaften neuen Filmhit. „Eine Sinneserfahrung, die einem sichtbaren Äquivalent von Musik gleicht. Visuell näher als mit der Brutalität und dem Rhythmus dieses Streifens käme man den Stones, wollte man sie verfilmen, wahrscheinlich nicht. Und dies scheint über die Verbindung von Sinnlichkeit und Gewalt hinauszugehen.“ Und heureka! In seinem Gulliver geht ein Licht auf wie eine 100-Watt-Glühbirne, ein einziges Halleluja und bolschiges Lobpreisen von Bog oder Gott.
„Kommt, Brüder“, skasert David. „Keine Angst, ihr werdet keine malenkig piefigen Zuckerfeen sein. Folgt mir, und ich zeige euch etwas dobriges, das euren Jarbeln neuen Schwung verleiht.“
Darum sind sie jetzt hier: David, Mick, Trevor und Woody klappen die samtbezogenen Sitze genau zum richtigen Ras herunter, denn es heißt: „KEIN ZUTRITT NACH FILMBEGINN“. Und wenn das Licht ausgeht und die Leinwand rot aufleuchtet und ihre Plätze vom Tamtam des Marschs vibrieren, dämmert ihnen langsam, dass dies überhaupt nicht mit Der Nussknacker vergleichbar sein wird.
Gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut!
Dann – oh Schreck und du liebe Zeit – ist da Alex mit angeklebten Wimpern, als wüsste er nicht, ob er ein Maltschick oder eine Dewuschka ist, in queeren Plattys und Springerstiefeln.
Ah! Doobidoob!
Dann goworitzt Alex, und die drei Spiders … Tja, sie müssen unweigerlich loswiehern und smeckern, denn kaum zu glauben, aber er spricht mit breitem Yorkshire-Akzent, genauso wie sie. Knuff-knuff, macht David mit dem Ellbogen. Und siehe da, endlich ponieren sie es. Klar wie ein azurblauer Hochsommerhimmel. Diese komischen Plattys und die puppenhafte Schminke, die ihnen David aufdrängt. Jetzt viddieren sie es deutlich.
Sie sind nicht tuntig. Sie sind droogig.
Sie sehen aus wie ein zünftiger Uhrwerk-Kult, richtig, richtig. Wie harte Bratschnies in Weichkonfekt-Papier, Satin und Stiefelleder gewordene Pracht und Herrlichkeit.
Und oh! Wie die Subis in Davids Litso aufblitzen, nun da er sieht, dass seine drei Spiders glückliche kleine Droogs sind, die immer noch wiehern, einen auf bolschige Eier machen und „Singin’ in the Rain“ summen. Bog oder Gott sei Dank für Mr. Kubrik, denkt David. Sie sind geheilt, alles gut.
DREI
Es sind Tausende. Besinnungslos rasend im Aufruhr der Hormone belagert eine wilde Masse, die nach Billigparfüm riecht, eine ehemalige Eislaufbahn in Boston, Lincolnshire. Die Ersten kamen gestern Abend, die Restlichen an diesem Samstagmorgen per Anhalter, Zug und Bus aus Liverpool, Glasgow, Cardiff, Sheffield, London und allen anderen Städten im Überlandleitungsnetz. Niemand unter ihnen ist von Vernunft beseelt, sondern nur mit den notwendigen 60 Pence ausgestattet und hoffnungsvoll, sich früh genug in die Warteschlange einzureihen, um unter den Ersten zu sein, die in den Starlight Room des Gliderdrome gelassen werden. Dabei nehmen sie das Risiko in Kauf, sich zu erkälten und zu hungern, sodass ihre Pilgerreise höchstwahrscheinlich im hinteren Teil eines Krankenwagens von St. John’s endet. Nichts davon spielt eine Rolle. Weil er es wert ist.
„MAAARRRCCC!!!“
Der erste T.-Rex-Gig 1972. Ihr erster im Vereinigten Königreich seit zwei Monaten. Ihr erster, seit sie für die meistverkaufte Single 1971 ausgezeichnet wurden. Ihr erster, seitdem sie in der jüngsten NME-Leserabstimmung in den Kategorien Beste britische Gesangsgruppe, Beste internationale Gesangsgruppe und Bestes Album abgeräumt haben.
„Nie hat es einen so eindeutigen Sieg gegeben, seitdem die Beatles auf ihrem Zenit waren.“
Ihr erster Gig, seitdem Marc seinen neuen Vertrag bei EMI unterzeichnet hat, die gerade eine Viertelmillion Exemplare der nächste Woche erscheinenden neuen T.-Rex-Single „Telegram Sam“ gepresst haben und damit rechnen, dass sie seine dritte Nummer 1 wird. Der erste, seitdem ihr neuer Kumpel Elton John der Presse sagte: „Marc verpasst der britischen Musikszene einen kräftigen Tritt – und mein Gott, hatte sie das nötig!“ Der erste, seitdem Marc im Gespräch mit dem Mirror in aller Bescheidenheit zustimmte, zu der er fähig war: „Ich bin ein Phänomen. Die Leute brauchen ein Idol. Sie haben mich ausgesucht.“
Ein Fernsehkamerateam ist hier in Boston, um das Phänomen in Aktion zu filmen, gemeinsam mit einer Busladung Journalisten und Fotografen, die alle auf Kosten von EMI verköstigt und hergebracht worden sind, um in den Zeitungen von nächster Woche überschwängliches Zeugnis davon abzulegen. Unter ihnen: ein Mann mit Jason-King-Schnurrbart und sein lächelnder Gefährte mit beklebter Arzttasche unterm Arm.
Michael und Barrie steigen aus dem Pressebus und treten schnurstracks auf ein Boots-17-Schlachtfeld.
„MAAARRRCCC!!!“
Der Name wird geschrieen, geseufzt und mit schmierendem Filzstift auf Unterarme gekritzelt. Poster aus Magazinen werden über Köpfen geschwenkt wie Signalflaggen. Einige der Schwenkenden fallen in Ohnmacht, bevor er überhaupt auf der Bühne steht.
„MAAARRRCCC!!!“
Und dann ist er da. In voller 1,64-Meter-Pracht rudert er mit seinen hochgestreckten Ärmchen, in blauen Hosen und einem goldenen Hemd unter einem dazu passenden Goldlamé-Jackett und zwei perfekten Tupfern Glitter unter den Augen. Er wird empfangen von einem Lärm, der klingt wie 6.000 Zahnarztbohrer, die alle auf einmal eingeschaltet werden. Er tänzelt zum Mikrofon. Er brüllt „YEEEAH!“ Noch mehr Leiber fallen in Ohnmacht. Er schlägt gegen seine verstimmte Gitarre, während der knackige Mickey Finn seine Congas streichelt und die T.-Rex-Rhythmusgruppe den funky Motor anschmeißt. Die Kids, deren mit Mascara verschmierte Augen wie Rorschachtests aussehen, verziehen ihre Säuglingsmünder wie in tausendfacher Agonie der Wollust und Sehnsucht. Sie sind zu beschäftigt mit Schreien, um zu hören, was für einen verstärkten Krach die Band macht. An der Seite der Halle keuchen Polizisten mit knallroten Köpfen um Verstärkung flehend in ihre Funkgeräte. Wie Stoffpuppen erschlaffte Körper werden von angespannten Ordnern aus der Menge gezogen, während hemmungslos abgehende Fans versehentlich eine der Lampen der Kameraleute von der Galerie stoßen. Sie stürzt auf ein Mädchen, das darunter steht. Ihr Schlüsselbein wird zerschmettert.
Vom Theatervorhang am Bühnenrand aus, wo sich die Presse drängt, folgt Barries Objektiv Marc, der die erste Reihe herausfordert, indem er mit einem Fingernagel über die Seiten seiner Stratocaster kratzt. Ein Meer aus Händen streckt sich nach ihm aus; sie könnten Tobsüchtigen oder Ertrinkenden gehören. Barries Blende klickt. Ein Sekundenbruchteil Chaos, eingefroren für immer.
Morgen um diese Zeit wird Barrie eine weitere schlaflose Sonntagnacht antreten, um in ruheloser Panik zu entwickeln und zu drucken, denn am Montag ist Redaktionsschluss beim Maker. Erst dann trifft Ray, der Chefredakteur, eine endgültige Entscheidung für die Titelseite. Entweder die T.-Rex-Manie in Boston, die Trennung bei King Crimson oder die neuen Jethro-Tull-Tourdaten. Vielleicht auch dieser interessante Artikel über David Bowie, den Michael eingereicht hat?
„Der Ausdruck seiner sexuellen Doppeldeutigkeit setzt ein faszinierendes Spiel in Gang. Ist er, oder ist er nicht?“