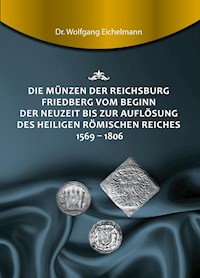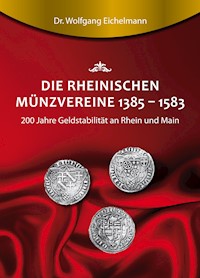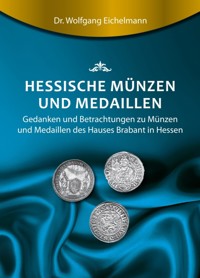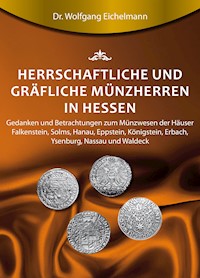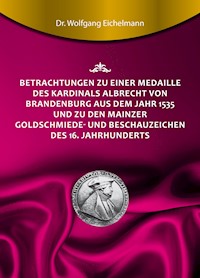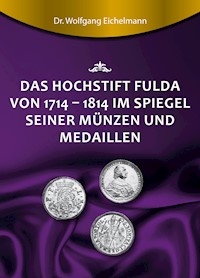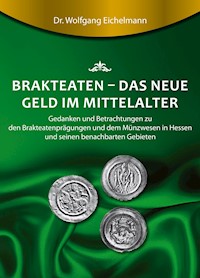
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im vorliegenden Buch wird das mittelalterliche Münzwesen in Hessen und die Ausbreitung der Brakteaten, der dünnen, einseitigen Silberblechmünzen, beschrieben. Es wird eine Übersicht über ihre Verbreitung im hessischen Raum, über ihre Münzstätten und soweit möglich auch über die Münzmeister gegeben. Es wird die Bedeutung der Brakteaten als regionale Währung und ihre Bedeutung für die lokalen Märkte aufgezeigt und wie sie durch ihre Verrufung als Steuerquelle für den Landesherrn dienten. Außer ihrer geldgeschichtlichen Bedeutung sind viele dieser Prägungen großartige Zeugnisse romanischer Kleinkunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
WOLFGANG EICHELMANN
BRAKTEATEN – DAS NEUE GELDIM MITTELALTER
WOLFGANG EICHELMANN
BRAKTEATEN – DASNEUE GELDIM MITTELALTER
BETRACHTUNGENUND GEDANKENZUDEN BRAKTEATENPRÄGUNGENUNDDEMMITTELALTERLICHEN MÜNZWESENIN HESSENUNDSEINEN NACHBARGEBIETEN
Dr. Wolfgang Eichelmann, »Brakteaten – Das neue Geld im Mittelalter «
Erstauflage 2017
© 2017 Dr. Wolfgang Eichelmann
Alle Rechte vorbehalten
Satz und Layout: Dr. Wolfgang Eichelmann
Umschlagestaltung: OOOGrafik, Corina Witte-Pflanz, 78256 Steißlingen
Bildarchiv Fotolia, Datei: 77179920, Urheber esdras 700
Verlag: tredition GmbH, 20144 Hamburg
ISBN 978-3-7439-2292-1 (Paperback)
ISBN 978-3-7439-2293-8 (Hardcover)
ISBN 978-3-7439-2294-5 (e-Book)
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Die lehensrechtliche Prägung der mittelalterlichen Gesellschaft – die Heerschildordnung
Brakteaten, das neue Geld im hohen Mittelalter – Brakteatenprägung zwischen 1150 und 1300
Das mittelalterliche Hessen und die Ludowinger 1122 – 1247 Die Münzstätten der Landgrafen von Thüringen und Hessen
Der Beginn der Landesherrschaft des Hauses Brabant in Hessen
Geistliche Münzstätten in Nordhessen – Das Kanonissenstift St. Cyriacus zu Eschwege und die benediktinischen Abteien Fulda und Hersfeld
Die königlichen Münzstätten in Frankfurt und in der Wetterau
Die Herren von Münzenberg, ein staufisches Ministerialengeschlecht in der Wetterau und ihre Nachfolger
Die Münzstätten der Erzbischöfe von Mainz in Hessen
Am Geld interessiert uns nicht die Prägung, sondern wir fragen nach dem Material, aus dem es verfertigt ist. Giovanni Conte della Mirandola (1463 – 1494)
VORWORT
In der Geldgeschichte nehmen die Brakteaten eine gewisse Sonderstellung ein, weil sie eine regionale Umlaufwährung bildeten. Ihre Eignung für den Fernhandel war nur von geringer Bedeutung, denn sie waren keine im gesamten Römisch-Deutschen Reich allgemeingültige Währung. Sie waren aber die ersten Münzen, auf denen nicht nur die Kaiser und Könige, sondern auch geistliche und weltliche Fürsten ihre Macht demonstrierten.
Oft werden die Brakteaten als romanische Kleinkunstwerke betrachtet, was sie ohne Zweifel auch sind. Zu dieser Betrachtung hat sicher beigetragen, dass Brakteaten in aller Regel stumme Münzen sind, also sehr oft keine schriftlichen Angaben über ihre Herkunft oder ihren Münzherrn machen. Für den Zeitgenossen, der zumeist eh ein Analphabet war, war das ohne Bedeutung. Er konnte die Bilder lesen so wie wir heute die Verkehrsschilder. Zum Verständnis von Brakteaten ist es daher notwendig, den Versuch zu unterhehmen, sich auf die Denk- und Vorstellungswelt unserer mittelalterlicher Ahnen einzulassen und Brakteatendeutungen in einer uns heute verständlichen Weise zu wagen. Man darf aber bei aller künstlerischen Qualität der Brakteaten und der herrschaftlichen Machtdarstellung auf ihnen nicht vergessen, dass sie nur Geld waren.
In diesem Buch möchte ich in mehreren Kapiteln eine Einführung in die Zeit der Brakteaten in Hessen geben, allerdings auch mit einem Blick auf Thüringen und auch Sachsen, weil ihre Fürsten die Entwicklung des hessischen Währungsraumes in jener Zeit bestimmt und beeinflusst haben.
Mein Dank gilt den privaten Sammlern und besonders Herrn Aleander Fay, der mir während unserer nun mehr langjährigen numismatischen Zusammenarbeit zu einem Freund geworden ist. Sie haben wiederum in uneigennütziger Weise mit Rat und Tat mein Vorhaben unterstützt und und mit geeignetem numismatischem Material zur Ausstattung dieses Buches beigetragen.
Dr. Wolfgang Eichelmann
Buseck, im Februar 2017
DIE LEHENSRECHTLICHE PRÄGUNG DER MITTELALTERLICHEN GESELLSCHAFT LEHENSRECHT UND LEHENSBESITZ – DIE HEERSCHILDORDNUNG
LEHENSRECHT UND LEHENSBESITZ
Die mittelalterlichen, feudalen Herrschaftsstrukturen gründeten sich im Deutschen Reich auf das altüberlieferte Lehensrecht, an dessen Spitze der König stand. Er war traditionell Herr jedweden Landes und der darauf ruhenden Rechte. Das bedeutete jedoch nicht, dass dies alles sein Eigentum war – es war Reichsgut, das er verwaltete, aus dem er seinen Staatshaushalt und seine Hofhaltung bestreiten musste und aus dem er seine Vasallen belehnte und belohnte. Das Lehensrecht schuf und formte die rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheit der Menschen im Mittelalter und knüpfte ein vielfältiges Netz von Abhängigkeiten, was erst eine Herrschaftsstruktur ermöglichte, in der die Ausübung der Herrschaft und die Erfüllung öffentlicher Funktionen an die Anhäufung von Rechten und Territorien bei einer Person gebunden waren. Das alles verursachte letztlich die oft sehr komplizierten Rechtsverhältnisse und Herrschaften im mittelalterlichen deutschen Staat.
Das Lehensrecht hatte zwei Grundpfeiler, einen dinglichen – dasbenefitiumoder auch Feod, den Grundbesitz zur lebenslänglichen Nutzung – und einen personenrechtlichen – die Vasallität, das Dienstund Treueverhältnis zwischen Herr und Mann. Einem Lehensverhältnis lag in aller Regel ein Lehensvertrag zugrunde, in dem ein freier Mann sich und sein Eigentum einem mächtigeren Herrn unterstellte, sich ihm zu Treue und Dienst verpflichtete, dafür im Gegenzug Schutz und Unterhalt erhielt und so zum Vasall wurde. Die Unterhaltsverpflichtung seitens des Lehensherrn wurde durch die Überlassung von Ländereien nach dem Recht der Landleihe erfüllt, wobei dem Lehensmann die Verpflichtung zur Leistung von Abgaben erlassen werden konnte, was dann einbenefitium, eine Wohltat, darstellte. Allerdings musste der Lehensmann aus der Bewirtschaftung und Nutzung dieser Ländereien auch seine Verpflichtungen gegenüber seinem Lehensherrn bestreiten. Beim Lehensempfang huldigte er seinem Herrn. Die Huldigung beinhaltete den Treue- und Mannschaftseid, welcher verlangte, alles zu unterlassen, was dem Lehensherrn schaden konnte oder was mit dem Sinn des Lehensverhältnisses unvereinbar war, und die Verpflichtung zur Heerfahrt und Hoffahrt, also zu militärischem und höfischem Dienst. Obwohl der Lehensherr keinen entsprechenden Eid leistete, war er dennoch dem Lehensmann verpflichtet und durfte ihm weder durch Rat noch durch Tat Schaden zufügen, etwa durch Heerschilderniedrigung, Treuebruch oder Straftat.
Für die Entwicklung des Lehensrechtes im Hochmittelalter war die kausale Verknüpfung des Vasallentums mit dembenefitiumvon entscheidender Bedeutung. Das Dienst- und Treueverhältnis des Vasallen wurde mit seiner wirtschaftlichen Absicherung durch die Landleihe unlösbar verknüpft – vereinfacht gesagt hieß das Dienstleistung gegen Landleihe. Die früher übliche Einbringung von Eigengut des Vasallen in das Lehensverhältnis verlor an Bedeutung und war letztlich auch nicht mehr nötig. Der König oder ein lehensberechtigter Herr verlieh einem Vasallen in aller Regel für besondere Verdienste oder für geleistete, aber auch mitunter auch für noch zu leistende Dienste Land, ein Lehen. Dafür stand dieser dann als Lehensmann in einem besonderen Treueverhältnis zu seinem Lehensherrn und musste ihm entsprechende, meist militärische Dienste leisten. Als Lohn dafür hatte der Lehensmann das Land samt den Nutzungsrechten inne, den Regalien, wie z.B. Zoll-, Wald-, Jagd- und Fischereirechte oder andere dingliche Nutzungsrechte. Das Lehenswesen war also ein Verhältnis, das auf Gegenseitigkeit beruhte und zur Stärkung der Herrschergewalt eingesetzt werden konnte, indem es Abhängigkeiten der Lehensnehmer vom Herrscher schuf. In einer schwachen Monarchie konnte es aber auch das Gegenteil bewirken, weil der König durch Zugeständnisse in Abhängigkeit von seinen Lehensnehmern geriet. Dies konnte durch dynastische Krisen, Aussterben eines Herrscherhauses, Nachfolgekämpfe und Wahlkapitulationen, also Herrschaftsverträge, in denen die königlichen und fürstlichen Rechte festgelegt wurden, geschehen.
Ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Lehensrechtes war die Belehnung von Kronvasallen oder anderen adligen Herrschaftsträgern durch den König mit Amtsfunktionen, die an ein bestimmtes Territorium gebunden waren – Herzogtümer, Markgrafschaften, Grafschaften. Dies war eine nötige Konsequenz aus dem deutschem Wanderkönigtum. Die Herrschaftsausübung war an die Anwesenheit des Herrschers gebunden und der Volksmund sagte nicht ohne Grund: Wo der Kaiser nicht ist, hat er sein Recht verloren. Die Belehnung mit einem Herzogtum oder einer Markgrafschaft beinhaltete neben der Landleihe den königlichen Auftrag, Hoheitsrechte auszuüben. Hierzu zählten insbesonders der Heerbann, der Gerichtsbann und das Münzregal. Der Heerbann gab das Recht, militärische Verbände aufzustellen und sogar militärische Aktionen durchzuführen, die sich jedoch nicht gegen das Reich richten durften. Die lehensrechtliche Verpflichtung zur Heerfahrt, die nur„binnen deutscher Zunge“zum Schutze des Reiches galt, hatte bei Belehnungen östlich der Saale eine bedeutsame Erweiterung erfahren, denn sie konnte sich hier auch gegen Wenden, Sorben, Polen und Böhmen richten. Dieses spielte bei der deutschen Ostkolonisation durch die Welfen, Askanier und Wettiner eine wichtige Rolle. Der Gerichtsbann beinhaltete eine ganze Reihe von Rechten. Neben der Rechtsprechung waren es die Aufrechterhaltung des Landfriedens und der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, der Wegeschutz, der Geleitschutz von Kaufleuten und die Erhaltung des Marktfriedens – also polizeiliche Aufgaben – das Beurkundungswesen – also notarielle Funktionen – und Weisungs- und Anordnungsbefugnisse in Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung, wie z.B. die Kontrolle der Märkte und die Durchsetzung des Marktfriedens. Das Münzregal, das eng mit dem Bergbauregal verbunden war, beinhaltete das Recht zur Prägung von Münzen nach der jeweils gültigen Reichsmünzordnung und das Recht zur Kontrolle des Münzumlaufs, was fiskalisch von Bedeutung war.
Von großer Bedeutung für das Lehenswesen war das Wormser Konkordat von 1122, das den langen Investiturstreit zwischen König Heinrich V. und dem Papst beendete. Durch den Verzicht des deutschen Königs auf das Recht zur Einsetzung von Bischöfen mit Ring und Stab ud die Erlaubnis der freien Wahl und Weihe der Bischöfe wurde die Kirche von der weltlichen Vorherrschaft des Königtums befreit. Andererseits wurde die Regalieninvestitur der Bischöfe, also die Übergabe des Szepters für das weltliche Lehen und die Leistung des Lehenseides, mit der Zustimmung des Papstes in einen lehensrechtlichen Akt umgewandelt. Die geistlichen Fürsten waren somit den weltlichen gleichgestellt.
Mittelalterliche Herrschaftsausübung im Rahmen des Lehenswesens bedeutete also, dass der Vasall, besonders der Kronvasall, nicht bloß im Namen seines Lehensherrn, des Königs, handelte, sondern direkt an seiner Stelle. Die durch die Treueverpflichtung gegebenen gegenseitigen Pflichten und Abhängigkeiten bargen jedoch eine Schwierigkeit in sich, nämlich, wer sich wohl im Falle eines Pflichten- oder Interessenkonfliktes durchsetzen konnte, der Lehensherr oder der Lehensmann, der König oder der Vasall. Im mittelalterlichen Deutschen Reich wurde diese Frage durch den Geschichtsverlauf zugunsten des Vasallenrechtes entschieden und das im Lehensrecht ebenfalls vorhandene Königsrecht zurückgedrängt. Solange die Königs- und Vasallenrechte im Gleichgewicht waren, stellte das Lehensrecht die überlegene gesellschaftliche und politische Ordnung dar und ermöglichte großräumige territoriale Organisationen – heute würde man solche etwa als Gebietskörperschaften bezeichnen. Für die lehensrechtlich strukturierte Gesellschaft war aber gerade die dezentralisierte Macht und die Teilhabe an Hoheitsrechten ein wirksames Mittel zur Rechtssicherheit und auch zur Friedensstiftung, vor allem zur Durchsetzung des Landfriedens. Die mittelalterlichen Territorien waren somit Rechtsräume, in denen ein bestimmtes Recht galt, das durch die Macht von Kaiser und Reich abgesichert war. Die Störung des Gleichgewichts der herrschenden Kräfte im Reich durch das zunehmende Überwiegen fürstlicher Rechte führte aber nicht nur zu einer inneren Instabilität des Römischen Reiches, sondern auch zu einer sich allmählich verschärfenden Rechtsungleichheit seiner Glieder, die sich durch die Ansammlung von Rechten und Privilegien bei einer immer kleiner werdenden Anzahl von Personen ergab.
Seit dem Interregnum, 1256 – 1273, waren dann auch die mächtig gewordenen Landesfürsten in Ermangelung einer stabilen, kontinuierlich wirkenden Reichsgewalt bei der Regelung der Reichsangelegenheiten ausschlaggebend und bestimmend. Solange die Lehen zeitlich befristet waren und damit auch die mit ihnen verbundene Vergabe der Hoheitsrechten, konnte die Belehnung von Vasallen den Erfordernissen des Reiches und der Reichspolitik angepasst werden. Mit der Erblichkeit der Lehen wurde dieses System aber weitestgehend ausgehebelt und das Römische Reich entwickelte sich zu einem Bund von Mitgliedern unterschiedlichen Rechts. Der in Grimma zur Schule gegangene Staatsrechtler Samuel von Pufendorf bezeichnete es in seinem BuchDe statu imperii Germanici,das 1667 in den Haag erschien, alsirregularealiquod corpus et monstro simile, als irgendeinen unregelmäßigen und zugleich einem Monstrum ähnlichen Körper, wobei man Monstrum sowohl als ein Ungeheuer oder auch als ein Wunderzeichen übersetzen kann.
DAS ALLOD – EIGENBESITZ IM FEUDALSTAAT
Neben dem Besitz durch Belehnung gab es noch das Allod, das Hausgut eines Adligen oder einer adligen Familie. Es stand außerhalb des Lehensrechtes des Königs, unterlag der uneingeschränkten Verfügung seines adligen Eigentümers und war somit eine von der Krone unabhängige Adelsherrschaft. Im Gegensatz zu einem Lehen konnte er es nach seinem eigenen Ermessen beleihen, verpfänden, verkaufen, verschenken und vererben. Hier waren der Herr, sein Besitz und seine Hintersassen – heute würde man seine Untertanen sagen – frei von fremder herrschaftlicher Gewalt, auch von der königlichen. Die Ausübung der Gerichtsbarkeit folgte hier dem Landrecht und unterstand nicht den Grafengerichten. In diesem Rechtsraum war man auch frei von der Forderung fremder Herren nach Diensten und Abgaben. Außerdem bestand im Bereich dieses Eigentums keine Treuepflicht gegenüber irgendeinem anderen Herrn.
Eigenbesitz war die Voraussetzung für die Errichtung oder Wiederherstellung einer eigenen Herrschaft. So spielte der welfische Allodialbesitz bei Braunschweig und Lüneburg nach der Entmachtung Heinrichs des Löwen und der Aufteilung seiner Herzogtümer eine wichtige Rolle bei der Erneuerung der Macht des welfischen Hauses. Von ähnlich großer Bedeutung war das wettinische Hausgut in der Mark Meißen bei der Rückgewinnung der Mark durch Dietrich den Bedrängten.
Während der Zeit der deutschen Ostkolonisation entstanden im Zusammenhang mit Allodial- und/ oder Lehensbesitz Rodungsherrschaften, wobei die neue, durch Rodung von Waldgebieten entstandene Herrschaft sich oft zu einer eigenen verselbständigte, wie es bei den Burggrafen von Meißen mit ihrer Herrschaft Hartenstein geschah oder auch bei dem Aufbau des Herrschaftsgebietes der Vögte, dem Vogtland. Auch bot der Allodialbesitz seinem Eigentümer eine gewisse politische Sicherheit. Dadurch, dass er sich und seinen Besitz einem mächtigeren Herrn unterstelle, z.B. dem deutschen König, konnte er sich seine Reichsunmittelbarkeit erhalten und sich so dem Zugriff begieriger Territorialfürsten entziehen. Der so handelnde Adlige erhielt dann sein Eigentum in Form eines Lehens zurück und stand nun unter dem Schutz seines neuen, königlichen Lehnsherrn.
DER SACHSENSPIEGEL
Zwischen 1220 und 1230 verfasste Eike von Repgow, ein anhaltischer Edelfreier, Rechtskundiger und Schöffe aus dem Dorf Reppichau zwischen Dessau und Köthen sein berühmt gewordenes Rechtsbuch, den Sachsenspiegel, eine Aufzeichnung des damals geltenden Stammesrechtes in niederdeutscher Sprache. Er übernahm und verarbeitete dabei die lateinischen Rechtsaufzeichnungen des Grafen Hoyer von Falkenstein. In einem Reim erklärte Eike von Repgow den Namen Sachsenspiegel:„Spigel der Sachsen/ sal diz buch sin genant,/ wenne der sachsen recht ist hir an bekannt,/ alse an eime Spigel de vrouwen/ di ire antlitz schowen.“– Spiegel der Sachsen soll dieses Buch genannt sein, denn Sachsenrecht wird hieraus erkannt, wie in einem Spiegel die Frauen ihr Antlitz beschauen.
Der Sachsenspiegel fand sehr schnell eine allgemeine Akzeptanz. Er war zweigeteilt. Sein erster Teil umfasste das allgemeine Landrecht der freien Leute und der Bauern, regelte Grundstücksangelegenheiten, Erbschaften und Ehestand und enthielt das Strafrecht und die Gerichtsverfassung. Der zweite Teil stellt eine Art Verfassungsrecht dar, das die Verhältnisse zwischen den Ständen, die Königswahl und das Lehnrecht regelt. Er wurde als Rechtsgrundlage und zur Urteilsfindung von Gerichten, von Trägern hoheitlicher Funktionen und von Ämtern benutzt, obwohl er nie von irgendeiner Obrigkeit in Kraft gesetzt worden war.
Vom Sachsenspiegel existieren heute noch vier Bilderhandschriften in Heidelberg, Dresden, Osnabrück und Wolfenbüttel. Diese gehen auf eine Urfassung zurück, die wahrscheinlich gegen Ende des 13. Jahrhunderts im Bistum Halberstadt oder in der Mark Meißen entstanden war. DerCodex palatinus,die Heidelberger Handschrift, die in der Heidelberger Universitätsbibliothek verwahrt wird, ist zwar die lückenhafteste aber dafür die älteste. Sie entstand um 1330. Ihre Bilder dürften denen des verschollenen Originals wohl am nächsten kommen. Die Figuren mit den charakteristischen Farben ihrer Gewänder, ihrer Gebärdensprache, den ihnen beigefügten Attributen wie Lehensfahnen, Schwertern, Zeptern, Hüten u.a. und ihrer Zuordnung zu einander bilden ein System von Chiffren, welches das Auffinden von Rechtsstellen im Text schnell ermöglichte, eine rasche Orientierung erlaubte und auch dem Schriftunkundigen Rechtsverhältnisse verdeutlichte.
Im ersten Buch des Sachsenspiegels wird unter dem Titel„Von den Heerschilden“das Lehensrecht erläutert, wobei die Rang- und Reihenfolge der Lehnsherrn und Lehensmänner auch heraldisch dargestellt werden. Der Illustrator des Sachsenspiegels benutzte für die Darstellung der Lehens- und Rangverhältnisse als Rechtssymbole repräsentative Wappen aus dem sächsisch-anhaltisch-meißnischen Raum. So findet man, wenn auch bei einigen Wappen mit veränderter Tinktur, die Wappen der Markgrafen von Meißen, der Burggrafen von Magdeburg, der Grafen von Anhalt und der Grafen von Wernigerode. Ebenso wie die Figurensymbolik mussten die Wappen, hier in Anspielung auf ihre Vertreter in der Funktion von Chiffren für Rechtsverhältnisse, allgemein verständlich sein. Dies war dann der Fall, wenn der Wappeninhalt selbst ein Rechtsverhältnis verdeutlichte oder wenn er und das Amt und die Funktion des Wappeninhabers allgemein bekannt, unlösbar miteinander verknüpft und zur Veranschaulichung eines Rechtsgrundsatzes geeignet waren.
Für die lehensrechtlich gegliederte Adelsgesellschaft werden sieben Heerschilde beschrieben, also Treue- und Rechtsverhältnisse, die die Schichtungen und Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb des Adels verdeutlichen. Vereinfacht gesagt gibt die Heerschildordnung an, wer in der Adelsgesellschaft wessen Lehensmann werden konnte, ohne seinen Schild, also seine gesellschaftliche Stellung, zu verringern. Diese Rechtsprinzipien waren für die gesellschaftliche und staatliche Entwicklung während des gesamten Mittelalters im Deutschen Reich grundlegend und prägend.
DERERSTE HEERSCHILDER KÖNIGLICHE ADLER
Den ersten Heerschild hatte der Kaiser/König inne. Im Sachsenspiegel wurden die Bezeichnungen König und Kaiser bereits synonym angewandt, Der König war der Herr über den Grund und Boden des gesamten Reiches. Er wurde durch den Adlerschild symbolisiert. Der Adler trat als Herrschaftssymbol bereits bei Kaiser Karl dem Großen auf. Von ihm ist ein Denar aus dem Jahr 811 bekannt, der den Adler als kaiserliches Symbol auf der Mastspitze eines Segelschiffes zeigt. Dieser Denar wurde in der am Ärmelkanal südlich von Boulogne gelegen Stadt Quentowik geprägt. Unter der Herrschaft Kaiser Ottos III. wurden in der königlichen Münzstätte in Andernach Denare mit dem Abbild eines Adlers geschlagen.
Abb. 1. Dresdener Sachsenspiegel. Die Miniatur stellt in der obersten Abbildung die Zweischwerterlehre dar, nach der der Papst und der Kaiser als Zeichen ihrer Macht, die von Jesus ein Schwert erhalten. Der Papst soll die geistlichen Angelegenheiten und der König/Kaiser die weltlichen regeln. In der darunter folgenden wird das Steigbügelhalten des Kaisers für den Papst dargestellt, was hier nicht als Zeichen der Unterwerfung oder Unterordnung, sondern als Geste der Höflichkeit interpretiert wird. Die weiternen Abbildungen zeigen Darstelllungen von Sitzungen und Verhandlungen weltlicher und geistlicher Gerichte.Aus der Faksimile Ausgabe des Sachsenspiegels von Karl von Amiras, Leipzig, 1902
In dem Evangeliar Kaiser Ottos III., das sich in der Staatsbibliothek München befindet, wurde der Kaiser mit einem Adlerzepter dargestellt. Mit der Übernahme des Adlers als Zeichen der kaiserlichen Herrschaft bekräftigte Kaiser Otto III. eindeutig seinen Anspruch auf den italienischen Teil des Reiches in der Nachfolge Karls des Großen und der römischen Imperatoren, die das elfenbeinerne Adlerzepter,scipio eburneus, das Symbol fürJupiter Optimus Maximus,den höchsten römischen Staatgott, als kaiserliche Insignie führten.
Die Anknüpfung der ottonischen Kaiser an die römische Staatssymbolik lag in ihrem Reichverständnis begründet. Sie betrachteten sich als die Erneuerer des Reiches der Caesaren und Karls des Großen. Die Betonung derrenovatio imperii,der Erneuerung des Reiches, war die Wurzel für das spätere Heilige Römische Reich Deutscher Nation,sacrum Romanum imperium, und beinhaltete den Anspruch des deutschen Königs auf die Kaiserwürde und die weltliche Kirchenherrschaft. Diese beruhten auf demdominum mundi, der Weltherrschaft des Caesarentums Roms und der daraus resultierenden Titularherrschaft über die Stadt Rom. Mit demdominum mundiwar der formale Anspruch der Oberherrschaft über andere Königreiche verbunden.
In Deutschland beruhte das Königtum auf der Wahl des Königs durch das Volk, später nur nochdurch die Fürsten, und in Italien auf der Inbesitznahme des Langobardenreiches, der Krönung mit der Eisernen Krone und der Schutzherrschaft über den Kirchenstaat,patrimonium Petri.Hinzu kamen das Königreich Burgund,regnum Arelatense,bestehend aus dem Herzogtum Burgund und der Freigrafschaft, der Franche Comté, das 1033 durch die Heirat Kaiser Konrads II. mit Gisela von Burgund an das Reich kam, Böhmen, dessen Herzog Ottokar I. Przemysl 1198 von König Philipp von Schwaben zum König erhoben wurde, das Königreich Jerusalem mit dessen Krone Kaiser Friedrich II. 1229 sich während des 5. Kreuzzuges selbst krönte, und das Königreich Polen, das seit Kaiser Otto III. in einem lockeren lehensrechtlichen Verhältnis zum Deutschen Reich stand, aber auf Dauer keine Abhängigkeit oder engere Bindung zu ihm entwickelte.
Abb. 2. Miniatur aus dem Sachsenspiegel. Die obere Bildhälfte zeigt die sieben Heerschilde und den Rechtsgelehrten mit einer Rute in der rechten Hand beim Unterricht eines Schülers. Mit der linken Hand verweist er auf den Text:»Swer lenrecht können wil der volge dis buches lere. Alrest sul wi merken daz der herschilt an deme könige begint un in deme sibenten lent.«– Wer Lehnrecht können will, der befolge dieses Buches Lehre. Als Erstes sollen wir uns merken, dass die Heerschilde mit dem des Königs beginnen und mit demsiebenten enden. Die untere Bildhälfte zeigt unter dem LeerschildPhaffen, koufluyte, unsere wip, von Alle direchtes darben– Geistlche, Kaufleute und unsere Frauen, die alle dieses Rechtes entbehren.Die untere rechte Bildhälfte zeigt die Huldigung des Königs.Aus der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels, Universität Heidelberg
Abb. 3. Widmungsblatt aus dem Reichenauer Evangeliar Kaiser Ottos III., 983 – 1002.Der thronenden Kaiser mit einem Szepterstab in seiner rechten, der dem elfenbeinernen Adlerszepter der römischen Cäsaren,scipio eburneum, nachempfunden ist, und mit dem mit einem Kreuz geschmückten Reichsapfel in der linken Hand.Meister der Reichenauer Schule, Evangeliar Kaiser Ottos III, 10. Jahrhundert, Staatsbibliothek München.
Abb. 4. Kaiser Ludwig der Fromme, 814 – 840, Denar, Münzstätte Dorestad (834 von den Normannen zerstört), Suhle, MünzgeschichteVs.: Brustbild des lorbeerbekränzten Kaisers in antikem Gewand, Umschrift.:HLVDOVVICVS IMPAUG(Ludovicus Imperator Augustus)Rs. Schiff mit Ruder, auf der Mastspitze ein fliegender Adler,DORESTATVS. Denare diesen Typs wurden schon von Kaiser Karl dem Großen in Quentowik (844 von den Normannen zerstört) geprägt.(Abb. vergrößert).
Durch die Italienfeldzüge der deutschen Kaiser wurde der Adler, der den Heerbann zierte, zum Herrschaftssymbol und schließlich unter den staufischen Kaisern zum Symbol des römisch-deutschen Reiches. Kaiser Friedrich I. Barbarossa machte ihn letztendlich zum Symbol des römisch-deutschen Kaisertums und er erhielt seine bis heute bestehen gebliebene Tingierung: ein schwarzer Adler auf Gold. Die erste Darstellung des Reichswappens auf Denaren findet sich auf solchen, die unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa zwischen 1172 und 1190 im Königshof zu Maastricht geprägt wurden. Sie zeigen vorderseitig den gekrönten Kaiser mit Reichsapfel und Kreuzzepter und die UmschriftIPEATOR, imperator,und rückseitig den Adlerschild mit der rückläufigen UmschriftSCUT-IPEAT, scutum imperatoris,was Schild des Kaisers bedeutet.
In der Reichsmünzstätte Nürnberg ließ Kaiser Friedrich I. Barbarossa Halbbrakteaten schlagen, die den Adler mit gekröntem Königshaupt zeigten. Hier wurde bereits die Identifizierung des Kaisertums mit dem Reichssymbol deutlich. Diesen Königsadler, der als Wappenfigur in der Heraldik als Jungfrauenadler oder auch Harpyie bezeichnet wird, nahm die Stadt Nürnberg in ihr Stadtsiegel auf – das älteste erhaltene stammt aus dem Jahr 1254, wurde aber sehr wahrscheinlich schon 1220 benutzt. Unter den Kaisern Heinrich VI. und Friedrich II. wurde der Adler auch zum Zeichen der Staufer, die als Adlergeschlecht,genus aquile, bezeichnet wurden. In seinem in Versform geschriebenen BuchLiber ad honorem Augusti,das Buch zu Ehren des Erhabenen, beschrieb Peter von Eboli auch den Einmarsch Kaiser Heinrichs VI. und seiner Streitmacht 1191 in Sizilien und seine Ankunft in Capua, wo ihm der staufisch gesinnte Erzbischof Matheus entgegen ritt:„Ecce venit dominus, quem tua vota petunt/ Assigna populos aquilis victribus, orno/ Menia, quod doleas, ne furor ensis agat.“- Siehe der Herr kommt, den deine Gebete erflehen/ Unterstelle deine Truppen den siegreichen Adlern, schmücke/ die Mauern, damit der Schrecken des Schwertes dir kein Leid bringt. In der Regierungszeit Kaiser Friedrichs II. wurden in deutschen Reichsmünzstätten, wie z.B. in Donauwörth und Rottweil, Adlerdenare geprägt oder im thüringischen Mühlhausen Reiterbrakteaten, die auf dem Schild des reitenden Kaisers einen Adler zeigen. Nach der Einnahme Österreichs fand sich auf seinen Münzen, erstmals auf einem Wiener Pfennig, auch ein heraldisch stilisierter, gekrönter Adler. Aus staufischer Zeit sind Adlerdenare ebenfalls aus den italienischen Münzstätten Brindisi und Messina bekannt. Noch nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. und dem Untergang des staufischen Hauses prägten in der Toskana die ghibellinischen, die prostaufisch-waiblingischen Städte Pisa und Siena weiterhin Adlermünzen. In der italienischen Heraldik findet sich eine Besonderheit: Staufer- und reichstreue Familien führten – z.T. noch bis zum heutigen Tag – im Schildhaupt ihres Wappens einen schwarzen ein- oder doppelköpfigen Adler auf Gold, dasCapo dell‘ Imperio.Auch in dem aragonesisch gewordenen Sizilien wurden noch Münzen mit dem staufischen Adler geprägt.
Abb. 5. Kaiser Heinrich VI., 1165 – 1197, mit goldener Laubkrone und Lilienszepter im Purpurumhang. In der linken Hand hält er ein Schriftband. Das Schwert in der linken Bildseite weist ihn als höchsten Repräsentanten des Ritterstandes aus. Über dem Kaiser das Reichswappen.Codex Manesse, Universitätsbibliothek Heidelberg
Auch wenn im römisch-deutschen Reich sich der Adler als Herrschaftssymbol durchsetzte, so ist doch auffällig, dass besonders auf Brakteaten königlicher Münzstätten im Osten des Reiches, so im pleißenländischen Altenburg, das Lilien- oder das Kugelzepter als kaiserliches Herrschaftssymbol beibehalten wurden. Die Lilie war als heraldische Figur im 12. Jahrhundert mit den Kreuzfahrern nach Europa gekommen und wurde zur Hauptwappenfigur des französischen Königs. In Deutschland wurde das Liliensymbol zum Zeichen der Gerichtshoheit und damit auch des Kaisers. Kaiser Friedrich II. hatte eine Aversion gegen das Liliensymbol. So berichtete der Dominikanermönch Francesco Pipini aus Bologna in seiner Chronik:„Im Jahre des Herrn 1250, am Tage der(heiligen)Lucia(13. 12. 1250), im 30. Jahr seiner Krönung, im 57. Jahr seines Lebens wurde Friedrich von einer Krankheit befallen und starb. Er ließ König Konrad(IV.)und zwei Söhne(die Zwillinge Heinrich und Friedrich)seines erstgeborenen, im Kerker verstorbenen Sohnes Heinrich(VII.), ferner König Enzio, der in Bologna im Gefängnis gehalten wurde, Manfred, den Fürsten von Tarent, und andere(uneheliche)Kinder beiderlei Geschlechts zurück. Es hatte Friedrichaber von Astrologen erfahren, er werde »vor eisernen Pforten« sterben, sobald er in eine Stadt gekommen sei, die ihren Name »von der Blume« habe.(Er betrat daher niemals die Stadt Florenz, die die Lilie im Wappen führte).Am Ende seines Lebens also, als er krank in Samnium lag, in einer Stadt, deren Name Fiorentino lautet(bei Lucera in der Provinz Foggia), wurde ihm das Lager an der Wand eines Turmes bereitet, an die das Kopfende seines Bettes stieß; der Eingang des Turmes war mit Mauerwerk ausgefüllt, innen waren jedoch eiserne Pfosten. Er gab den Befehl zu untersuchen, wie der Turm inwendig beschaffen sei. Es wurde gemeldet, an der Stelle der Mauer, an der er liege, sei der Eingang durch das Mauerwerk verkleidet und die Pfosten seien aus Eisen. Als er das gehört hatte, wurde er nachdenklich und sprach: ‚Hier ist der Ort meinesmir längst voraugesagten Endes. Gottes Wille geschehe! Hier werde ich mein Leben beschließen.‘ Nicht viel später aber starb er dort, und es ging in Erfüllung, was der Kaiser gesagt hatte.“Völlig verdrängt vom Adler wurde hingegen das alte Reichssymbol: Die Rose, mit der viele Burgberge bewachsen waren und sie so schwer einnehmbar machte. So war sie zugleich das Symbol für die Schönheit und wegen ihrer Dornen auch das der Wehrhaftigkeit.
Abb. 6. Die Belagerung von Neapel im August 1191. Das Bild zeigt Kaiser Heinrich VI., 1190 – 1197, mit seinen Herzögen,imperator et duces, im kaiserlichen Feldlager. Der Kaiser trägt einen bekrönten und mit einem Adler verzierten Helm mit einem Nasale und einen Adlerschild. Die Pferdedecke ist ebenfalls mit Adlern geschmückt. Vor der Kavalkade reitet ein Fähnrich mit dem kaiserlichen weißen Banner mit einem roten Kreuz. In der mittelalterlichen Kunst ist diese Fahne das Symbol für den auferstandenen, siegreichen Christus. Hiermit wird auch demonstriert, dass der Kaiser in der Nachfolge Christi steht. Zugleich ist diese Buchmalerei eines der frühesten Bilder, die eine Wappenbemalung des Helmes zeigen.
Aus:Liber ad honorem Augustides Petrus de Ebulo.
Abb. 7. Die Eroberung des Mailänder Carroccios nach der Schlacht von Cortenuovo 1237 und nach einjähriger Belagerung der Einzug Kaiser Friedrich II.in die besiegte Stadt. Vor dem Kaiser reitet ein Fähnrich mit der deutschen Reichsfahne.Buchmalerei, Giovanni Villanis, Nuova Cronica, 14. Jahrhundert, Codex Chigi, Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom.
Abb. 8. Am 26. August 1240 begann Kaiser FriedrichIi.nach der Einnahme von Ravenna mit der Belagerung der Stadt Faenza, die von Bologneser und venezianischen Truppen unter Graf Guido Guerra verteidigt wurde. Während der acht Monate dauernden Belagerung ging dem Kaiser das Münzgeld aus und er ließ mit seinem Antlitz beprägtes Ledergeld ausgeben. Diese «Ledermünzen» hatten einen Wert von jeweils einer Augustale. Mit diesen bezahlte er seine Truppen. Buchmalerei, Giovanni Villanis, Nuova Cronica, 14. Jahrhundert, Codex Chigi, Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom
Abb. 9. Harpye (Jungfrauenadler) im alten Nürnberger Stadtsiegel von 1254. Dieses Wappenbild entstand aus der Verschmelzung des Reichsadlers, mit dem über ihm schwebenden, gekrönten Haupt des Königs.
DERDOPPELKÖPFIGE REICHSADLER
Im 13. Jahrhundert wurde die Tinktur des deutsche Reichsadlers festgelegt, ein rot bewehrter und rot bezungter schwarzer Adler auf Gold. Dieses Wappen führte der Herrscher des Deutschen Reiches sowohl als Kaiser als auch als König. Hauptsächlich von englischen Herolden kam die Forderung nach einem Unterscheidungsmerkmal zwischen dem kaiserlichen und dem königlichen Wappen, und so wurde in englischen Wappenrollen der doppelköpfige Adler als deutsches Kaiserwappen geführt.
Ein anderer Hinweis auf den staufischen Doppeladler stammt von dem berühmten englischen Herold Matthew Paris. Er berichtet, dass die drei Söhne Kaiser Friedrichs II. ebenso wie ihr Vater den Doppeladler als Schildfigur führten. Dies waren Konrad, der spätere deutsche König, und seine beiden unebenbürtigen Brüder Enzo und Manfred. Konrad führte wie sein Vater den schwarzen Doppeladler auf Gold. Zwischen seinen Köpfen befand sich ein steigender, also mit den Sichelhörnern nach oben zeigender, roter Mond. Dieses war das Sinnbild für den Thronfolger. Als deutscher König führte Konrad IV. nur den einköpfigen Adler im Schilde. Lediglich als er 1254 de facto im Besitze Siziliens war, ließ er Münzen mit einem Doppeladler prägen. Enzo, der König von Sardinien wurde, führte einen Doppeladler auf einem gelb-grün gespaltenem Schild. Bei Manfred hatte der Schild mit dem Doppeladler einen weißen Querbalken. Als er jedoch 1258 – 1266 König von Sizilien wurde, änderte er seinen Wappenschild. Offensichtlich spielten hierbei politische Zwänge eine Rolle, denn der Papst, mächtig geworden und in Italien selbst Territorialpolitik treibend, ließ zum Ende der staufischen Herrschaft eine Vereinigung der deutschen und der sizilianischen Krone, die ja seinen Kirchenstaat in die Zange nähme, nicht mehr zu. Konrad führte nun einen schwarzen Adler auf Weiß. Von Manfred sind Denare bekannt, die den Adler und die UmschriftMAYNFRIDUS R. SICILIE, Manfred König von Sizilien, aufweisen. 1282 ergriff Pedro I., König von Aragon, der mit Manfreds Tochter Constanze verheiratet war, Besitz von Sizilien. Sein Wappenschild war schräg quadriert mit den roten und goldenen Pfählen von Aragón im oberen und unteren Feld und dem staufisch-sizilianischen schwarzen Adler auf Weiß in den beiden seitlichen Feldern.
Der Doppeladler wurde von den Staufern also nicht aus den englischen Wappenrollen übernommen. Er geht auf das römisch-deutsche / sizilianische Doppelkönigtum der Staufer zurück.
1186 heiratete der spätere Kaiser Heinrich VI., der Sohn von Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Constanze, die normannische Königstochter und Thronerbin von Sizilien. Als 1189 ihr Vater König Wilhelm II. starb, machte ihr Vetter Tankred, Graf von Lecce, ihr das Königreich Sizilien strittig, besetzte es und ließ sich zum König von Sizilien krönen. 1194 zog Kaiser Heinrich VI. aus, um das sizilianische Erbe zurückzuerobern. Der Chronist Peter von Eboli beschrieb Heinrichs Kriegszug. Hier trug der Kaiser auf seinem Schild, seinem Stirnreif und seiner Pferdedecke den Reichsadler, aber auch sein Widersacher Tankred führte einen Adler als Feldzeichen. 1195 wurde Constanze Königin von Sizilien und setzte 1197 die Anerkennung ihres minderjährigen Sohnes Friedrich als König von Sizilien durch. 1212 wählte die staufisch gesonnenen Fürsten Friedrich zum Gegenkönig Kaiser Ottos IV., des Welfen. 1215 wurde Friedrich allgemein als deutscher König anerkannt. Jetzt waren beide Königreiche, das Deutsche Reich und das normannische Königreich Sizilien in Personalunion miteinander verbunden und König Friedrich führte in seinem Wappen einen Doppeladler, auch wenn seine Münzen nur einen einköpfigen zeigten. Hingegen sind Münzen von dem welfischen Kaiser Otto IV. bekannt, die auf ihrer Vorderseite einen gekrönten Löwen und ihrer Rückseite einen Doppeladler, der von zwölf Sternen umrandet ist, zeigen. Diese Münzen lassen sich in das Jahr 1211 datieren, als Ottos Streitkräfte Apulien besetzt hatten und ihren Angriff auf Sizilien planten, um es Friedrich Roger zu entreißen. Kaiser Otto IV. hatte ein Hilfeersuchen aufständischer süditalienischer Barone erhalten, die sich gegen ihren König Friedrich Roger, den späteren Kaiser Friedrich II., erhoben hatten, weil er eine zentralisierende, die Adelsrechte einschränkende Politik betrieb. Der Kaiser kam diesem Ersuchen unter dem Vorwand der Wahrung von Reichsrechten nach. Tatsächlich war dies nur eine weitere Facette des staufisch-welfischen Gegensatzes. Hier erhob also Kaiser Otto IV. in propagandistischer Form Anspruch auf das deutsch-sizilianische Doppelkönigtum, allerdings unter welfischer Führung.
Während der staufische Doppeladler ein Symbol des deutsch-sizilianischen Doppelkönigtums war, trug der kaiserliche Adler der Luxemburger deutlich religiöse Züge. Das Deutsche Reich galt Kaiser Karl IV. als heilig, und folglich erklärte er die Reichsinsignien zu Heiligtümern, so wie es die Reliquien waren. Er benutzte auch noch die alte deutsche Reichsfahne, eine rote Fahne mit einem weißen Kreuz. Sie war das Symbol für die Heiligkeit des Königtums und des unter königlichem Schutz gewahrten Friedens – man denke hier an die Funktion der alten Marktkreuze, aber sie wurde auch als Feldzeichen benutzt. So berichtete Peter von Eboli, dass den Streitkräften Kaiser Heinrichs VI. auf seinem sizilianischen Feldzug 1194 die Kreuzesfahne vorangetragen wurde. Diese alte Reichsfahne wurde zuletzt offiziell im Leichenzug Kaiser Karls IV. in Prag 1378 mitgeführt. Sein Sohn Wenzel, deutscher König von 1376 bis 1419, nahm den Doppeladler als Reichswappen um 1410 wieder an. 1413 ließ er ein Siegel schneiden, das einen nimbierten Doppeladler zeigte und als Aufschrift einen Hymnus trug, der sich auf den Propheten Hesekiel (Hesekiel 17, Vers 3 und 7) bezog:AGUILA. EZECHIELIS./ SPONSE. MISSA. EST. DE. CELIS./ VOLAT. IPSA. SINE. META./ QUO. NEC. VATES. NEC. PROPHETA./ EVOLABIT. ALCIUS.– der Adler des Hesekiel, die vom Himmel gesandte Braut, fliegt ohne Grenzen, wo weder ein Seher noch ein Prophet höher flöge. Dieses Siegel wurde jedoch erst mit der Kaiserkrönung seines Bruders Sigismund in Gebrauch genommen. Für die beiden Adler standen die beiden Heiligen Mauritius und Wenzel. Der heilige Mauritius, der Führer der Thebäischen Legion, war der Patron des Deutschen Reiches. Ihm wurde in den Kirchen oft der Reichsadler in den Schild gesetzt. Der heilige Wenzel war der Landespatron von Böhmen. Er führte den schwarzen Adler auf Weiß in seinem Schild und auf seinem Banner. Dies war auch das Wappen Alt-Böhmens. Als die Grafen von Luxemburg die böhmische Krone erlangten, wurde der heilige Wenzel auch der Schutzherr des Hauses Luxemburg. Das Zusammenfügen dieser beiden Adler ergab dann den doppelköpfigen, nimbierten Reichsadler. Der Gebrauch des einköpfigen Adlers als königliches Wappen und des doppelköpfigen als kaiserliches setzte sich unter Kaiser Sigismund durch. Er benutzte als Reichvikar den doppelköpfigen Adler in seinem Wappen, als deutscher König den einköpfigen und 1433 nach seiner Kaiserkrönung den doppelköpfigen. Die Nimbierung des Doppeladlers wurde nun als ein Zeichen der Heiligkeit des Römisch Deutschen Reiches in das Reichswappen eingeführt.
Abb. 10. Kaiser Sigismund, 1419 –1437, Miniatur aus der Chronik des Ulrich von Richental, 1482, Konstanz.
Abb. 11.Das Wappen des hansischen Stahlhofs in London
Abb. 12.Das Wappen des Hansekontors in Brügge
Der Doppeladler war aber nicht nur das Amtsund Herrschaftswappen des Kaisers, sondern wurde auch als Gnadenwappen verliehen. Das bedeutete, dass der Träger dieses Wappens unter dem besonderen Schutz des Kaisers stand. Auf dem Burgberg in Meißen sieht man in der Toreinfahrt zum Bischofsschloss, in dem sich heute das Amtsgericht befindet, eine runde Steintafel aus dem Jahr 1541, auf der unter einer Krone der kaiserliche doppelköpfige Adler dargestellt ist, und darunter eine zweite mit dem Namen des Kaisers:CAROLUS QUINTUS ROMANO-RUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, Karl V., römischer Kaiser, der immer Erhabene (oft übersetzt als der Bewahrer oder der Mehrer des Reiches).
Als 1539 in der Mark Meißen die Reformation eingeführt wurde, widersetzten sich der meißnische, katholische Bischof und das Domkapitel der landesherrlichen Anordnung zum Glaubenswechsel, und der katholische Kaiser Karl V. stellte den Bischof unter seinen besonderen Schutz, was jedermann durch die Verleihung des kaiserlichen Gnadenwappens kundgetan wurde. Die Missachtung dieser kaiserlichen Schutzanordnung hätte die Ächtung nach sich gezogen.
Die Hanse als Städtebund führte selbst zwar kein Wappen, wohl aber etliche ihrer Niederlassungen in anderen Ländern. Ihre älteste Außenhandelsvertretung, der Stahlhof in London, führte einen Doppeladler mit goldenem Schwanz, goldener Bewehrung und Halskrone auf einem weiß-rot geteiltem Schild. Zwischen den Adlerköpfen befand sich noch der Reichsapfel. Dieses Wappen entstand 1434, wobei die Kombination hansisch-lübischer und reichsstaatlicher Symbole auffällig ist. Dies verdeutlicht, dass der Stahlhof in London den Charakter einer halbstaatlichen deutschen Handelsvertretung hatte. Auch das Hansekontor in Brügge besaß ein Wappen mit einem Doppeladler, das ihm 1486 von Kaiser Friedrich III. verliehen worden war. Es zeigte den Doppeladler in wechselnder Tinktur, rechts ein gespaltener schwarzer Adler auf Gold, links ein goldener auf Schwarz. Die Brust des Doppeladlers war mit einem sechszackigen Stern,stella maris, dem Mariensinnbild, ebenfalls in wechselnder Tinktur belegt.
ANMERKUNGZUR MONETARISIERUNGDER WIRTSCHAFTUNTERDEN STAUFERN
Bereits unter den salischen Kaisern kam es durch die Verleihung des königlichen Münzregals an andere Münzherren zu einer Auflösung der alten karolingischen Münzordnung und zu einer Entwertung des königlichen Münzrechts mit der Folge, dass die neuen Münzherren den Münzfuß veränderten und das Münzbild des Königs durch ein eigenes ersetzten. Es wurden nun verschiedene Pfennigtypen geprägt – Sachsen-, Regensburger- Kölner-, Otto-Adelheids-Pfennige, die nicht mehr im Feingehalt und im Raugewicht übereinstimmten. Die Vergabe des Münzrechtes erfolgte überwiegend an geistliche Herren, weil ihnen aus Donationen, Nachlässen und kirchlichen/klösterlichen Einnahmen ausreichende Mengen an Münzmetallen, vornehmlich an Silber, zur Verfügung standen. Man kann davon ausgehen, dass bereits Mitte des 12. Jahrhunderts der königliche Einfluss auf die Prägetätigkeit verloren gegangen war und die einzelnen Münzherrern den Gewinn aus ihrer Münztätigkeit nach eigenen Regeln oder Absprachen festlegten.
Diese territoriale Münzpolitik war der Grundstein für die Regionalisierung des Münzwesens.
Abb. 13. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 1152 – 1190, doppelseitiger Pfennig, 0,93 g,Reichsmünzstätte Nürnberg, Erlanger 12Vs.: Mittig in einem Wulstreif eine achtblättrige Rosette, darum in einem Fühfpass je eine siebenbättrige Rosette, in den Winkeln jeweils ein Kringel.Rs.: Wegen des Durchschlags der vorderseitigen Prägung ist der thronende Kaiser kaum erkennbar.
Abb. 14. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 1152 – 1190, Brakteat, 1160 – 1170, 0,55 g, Münzstätte Donauwörth, Peus 308/907In einem Wulstring der königliche Adler. Auf dem Außenrand Halbmonde mit Lilien.
Abb. 15. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 1152 – 1190, Grosso, nach 1155, 2,89 g, Münzstätte Pisa,Corpus Nummorum Italicorum XI 290, 38, Rom 1912Vs.: Bekrönter Adler auf einem Podest, Umschrift+FR . IM –– RATORRs.: Thronende, nimbierte Gottesmutter mit Jesuskind, Inschriften oben MP –– OV, unten PI –– SE
Unter den Staufern schreitet die Regionalisierung des Münzwesens fort und es bilden sich in ihrem Reich mehrere Wirtschaftszentren aus, die sich in ihrer Struktur und Entwicklung erheblich von einander unterscheiden. Dies sind auf der einen Seite in Italien die norditalienischen Städte und das normannische Königreich in Sizilien und Süditalien, das durch Heirat an die Staufer fiel, und auf der anderen im deutschen Reichsgebiet der schwäbische Raum vom Bodensee bis in das Elsass, die Wetterau mit der Stadt Frankfurt in Südhessen und das Gebiet an der oberen Saale in Thüringen und das Pleißenland.
Unter den Staufern gab es keine einheitliche Reichsmünzpolitik, was sich daraus erklärt, dass die Regionalisierung des Münzwesens soweit fortgeschritten war, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, dass das Vorrecht der königlichen Münzprägung und die damit verbundene allgemeine Gültigkeit königlicher Gepräge, weil es nicht durchgesetzt wurde oder einfach nicht durchsetzbar war, in der Bedeutungslosigkeit verschwand und andere Münzherren, vor allem geistliche, das Münzvorrecht beanspruchten, was sogar soweit führen konnte, dass dem König das Recht der Münzprägung in einem bestimmten Territorium untersagt wurde – so 1140 Bischof Otto von Freising„in predicto episcopatu nemo monetam habeat preter ipsum episcopum“oder der König nicht mehr als oberster Münzherr angesehen wurde wie im Fall des Bischofs Ortlieb von Basel, der sich im Jahr 1146 sein sein Münzrecht in Basel von Papst Eugen III. bestätigen ließ„ius monete in civitate Basilea et in toto episcopatu“.
Abb. 17. Kaiser Heinrich VI., 1191 – 1197, Denar, Münzstätte Messina/PalermoVs.: In einem Perlkreis das Brustbild Friedrichs mit pendilienbehängter Kaiserkrone, Umschrift FRIDERIC REXRs.: In einem Perlkreis ein Adler, Umschrift: +E INPERATOR (Enrico Imperaror)Auf dem Reichstag 1196 in Frankfurt am Main setzte Kaiser Heinrich VI. durch, dass sein Weinachten 1194 in Jesi bei Ancona geborener Sohn Friedrich zum römischdeutschen König gewählt und somit zu seinem Nachfolger bestimmt wurde. Nach diesem Reichstag wurde Friedrich Ende November/Anfang Dezember 1196 getauft. Aus dem Anlass der Königswahl under Taufe seinen Sohnes Friedrich ließ Kaiser Heinrich VI. in seinen sizilianischen Münzstätten den obigen Denar prägen. Dieser Denar ist die propagandistische Antwort Kaiser Heinrichs VI. auf die Ablehnung Papst Coelstins III., Friedrich zu taufen und zum König zu salben.
Ein Mittel, um die verbliebenen Möglichkeiten im Münzwesen auszunutzen und verlorenen Boden wieder zurückzugewinnen, war die Einrichtung neuer königlicher Münzstätten. Unter König Konrad III. gab es fünf, unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa zwölf und unter Kaser Friedrich II. zweiunddreißig Münzstätten. Dem gegeüber standen aber rund vierhundert nichtkönigliche Münzstätten. Es lag somit im Interesse der Staufer, anheimfallende Münzstätten wie z. B. Nordhausen und Saalfeld einzuziehen und nicht wieder zu verlehnen. Eine Möglichkeit zur Schwächung einer Münzstätte war die, sie an mehrere Münzherren zugleich zuvergeben, was dann oft genug zu Streitigkeiten zwischen den Inhabern der Münzstätte führte.
Abb. 18. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 1122 – †1190, Brakteat, Ø 45 – 46 mm, 0,87 g, königliche Münzstätte Mühlhausen, Fund Seega 58In einem von dem Banner durchbrochener Kerbkreis der nach links reitende Kaiser mit Banner und Schild. Auf dem Schild ein frei schwebendes, gleichschenkliges Kreuz. Hinter dem Kaiser über der Kruppe des Pferdes eine sechsblättrige Rosette. Trugschrift. Auf dem Außenrand8 Punkte.Dieser Brakteat nimmt Bezug auf das Kreuzfahrtsgelübde, das Kaiser Friedrich I. am 27. März 1188 in Mainz abgelegt hat.
Abb. 19. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, *1122 – †1190, Brakteat, Ø 47 mm, 0,92 g, königliche Münzstätte Mühlhausen,Fund Gotha 42In einem Kerbkreis der nach links reitende Kaiser mit einem kurzbewimpelten Banner und einem sternförmig beschlagenem Langschild, hinter dem Kaiser auf einem Bogen ein Gebäude mit beknauftem Kuppelturm. Umschrift + FRIDERICVS . IMPERATOR MVHLEHVSIGENSIS . DENARIIV
Diese Situationen suchte Kaiser Friedrich I. Barbarossa zu seinem Vorteil zu nutzen. In den Gebieten, die unter seinem Einfluss standen, wie die Reichsterritorien der Wetterau und des Pleißenlandes, wurden Herrschaft, Wirtschaftsentwichlung und Monetarisierung fest miteinander verknüpft. Dazu dienten vorallem die Gründung oder Privilegisierung von Städten, die Einrichtung von Märkten und Münzstätten und der Aufbau einer Verwaltung, in der den Landvögten eine besondere Bedeutung zukam. Barbarossa erreichte damit, wie sich gut am Beispiel der Wetterau zeigen lässt, eine Raumerfassung und einen Herrschaftsausbau mit wirtschaftlichen Mitteln, die Erschließung von Finanzquellen, das Zurückdrängen von fremdem Geld – in der Wetterau war es die Mainzer Währung – zugunsten des eigenen. Zum anderen wurde territorialen Ausdehnungsestrebungen der Ludowinger nach Süden in die Wetterau und dem Erzbischof von Mainz nach Norden ein Riegel vorgeschoben. Eine zusätzliche Schwächung der Mainzer Position ergab sich noch durch die Absetzung des Mainzer Erzbischofs Konrad von Wittelsbach im Jahr 1065.
Abb. 20. Kaiser Friedrich II., 1212 – 1250,Brakteat, 0,493 g, 1240 – 1250, Münzstätte Rottweil Sammlung De Witt, Künker 130/2486In einem Perlkreis der königliche Adler
Abb. 21. Kaiser Friedrich II., 1212 – 1250,Augustalis, 5,30 g, Münzstätte Brindisi/Messina,Corpus Nummorum Itlalicorum XVII,197,13Vs.: Büste des Kaisers im Lorbeerkranz nach rechts, Umschrift CESAR AVG ––IMP ROMRs.: Königlicher Adler, Umschrift + FRIDE –– RICVSIm Rahmen seiner sizilianischen Staatsreform ließ Kaiser Friedrich II. in Brindisi und Messina ab Dezember 1231 neue Goldmünzen, die Augustalen, prägen, die ab Januar 1232 emittiert wurden.
Abb. 22. Kaiser Friedrich II., 1212 – 1250,Brakteat, 1235 – 1240, 0,46 g, Münzstätte Ulm, Cahn 325, Kästchen-Kreuzrand zwischen zwei Wulstreifen, darin die gekrönte Büste des Kaisers zwischen zwei Adlerflügeln mit aufgesetzeten Rosetten.
Abb. 23. Kaiser Friedrich II., 1212 – 1250,Brakteat, Ø 33 mm, 0,31 g, Münzstätte Mühlhausen, Fund von Effelder, Münz Zentr. 73/3052In einem Perlkreis der nach links reitende Kaiser mit Fahne und Adlerschild, über der Kruppe des Pferdes der Reichsapfel. Auf dem Außenrand 8 Punkte
Zur Zeit des regionalen Pfennigs erfolgte die fiskalische Geldabschöpfung durch die Münzverrufung und den Zwangsumtausch. In dem Reichsterritorium Wetterau erfolgte die Münzverrufung einmal im Jahr Dabei wurden die alten Brakteaten eigezogen und durch neue ersetzt, wobei es für zwölf alte neun neue Brakteaten gab. Diese Form der Besteuerung in Höhe von 25% betraf vor allem die eigene Bevölkerung. Sie hatte den Effekt, dass das Geld in regionalen Geldumlauf blieb und der heimischen Wirtschaft diente und dass die Hortung von Geld eingedämmt wurde, was aber zur Folge hatte, dass eine Bevorratung mit Geld für irgendwelche Investitionen nur schwer möglich war.
Der Zwangsumtausch von Geld auf jedem Markt hingegen war eine Form der Besteuerung fremder Kaufleute. Der Gewinn lag hier etwa in der gleichen Höhe wie bei der Verrufung. Der Zwangsumtausch schütze die Märkte und Münzstätten vor fremdem Geld und diente der Versorgung der Münzstätten mit Prägesilber. Es musste daher nur wenig teures Bergsilber für neue Gepräge zugekauft werden, es sei denn, der Münzherr verfügte über ausreichende eigene Bergsilbermengen.
Für die Kaufleute waren Münzverrufungen von untergeordneter Bedeutung, weil sie bei größeren Geschäften das Silber wogen oder auch Barrensilber benutzten. Auf längere Sicht wirkten sich Verrufung und Zwangsumtausch als ein Wirtschaftshindernis aus, weil sie eine großräumige Organisation von Wirtschaft und Handeln stark behinderten. Es war daher eine Notwendigkeit, eine überregionale, überall verfügbare und allseits anerkannte Münze einzuführen.
In der königlichen, von Kaiser Friedrich I. Barbarossa errichteten Münzstätte in Schwäbisch Hall wurden erstmals im Jahr 1189 Heller geprägt. Dies waren Kleinmünzen von 0,3 bis 0,55 g, die als Reichsmünzen in großen Mengen emittiert wurden. Der Heller war der zwölfte Teil eines Schillings, 20 Schillige entprachen 240 Hellern und ergaben ein Pfund Heller. Auf der Vorderseite zeigte der Heller eine Hand, was zumeist als Zeichen für die Stadt Hall gedeutet wird, Man kann diese Münzbild auch als einen Handschuh deuten, der verbunden mit dem Marktkreuz die Anwesenheit des Kaisers auf dem betreffenden Markt bedeutete und als Zeichen des Markfriedens und des kaiserlichen Schutzes galt. Dem entsprechend trug die Rückseite des Hellers ein Markt- oder Krukenkreuz. Man kann daraus schließen, dass der Heller als einfache Münze für Märkte und kleine Geschäfte gedacht war. Ein andere Grund für die Hellerprägung war, dass der Kaiser viel Geld für seine Feldund Kreuzzüge brauchte und seine Kriegskasse mit seiner eigenen Währung füllte. Diese kleinen Münzen waren für die Entlohnung seiner Truppen besonders geeignet, die dieses Geld auf den verschiedenen Märkten schnell umsetzen konnten, was wiederum zu seiner schnellen Verbreitung beitrug.
Der Erfolg des Hellers hatte mehrere Gründe. Er kam aus einer königlichen Münzstätte und war daher per se vertrauenswürdig, er unterlag keiner Verrufung und keinem Umtauschzwang, galt auf jedem Markt und er ließ sich schnell durch Umschmelzen aus den alten, höherwertigen Münzen herstellen. Als Kleinmünze war er zum Horten wenig geeignet, wohl aber zum Ansparen für kleinere Investitionen. Damit begann ein Verdrängungs- und Konzentrationsprozess, der allmählich zur Auflösung vieler Münzstätten führte. Ob dies ein langfristig angelegter Coup der staufischen Politik gegen das nach Bistümern gegliederte Münzsystem und den regionalen Pfennig war, wäre einer Überlegung Wert; jedenfalls trug der Heller dazu bei, den regionalen Pfennig zu verdrängen.
Um das Jahr 1300 begannen die Münzstätten in Frankfurt und Nürnberg ebenfalls mit der Prägung von Hellern. Andere Münzstätten zogen nach, was schließlich zu einer Inflationierung des Hellers und zu seinem Niedergang führte.
DERZWEITE HEERSCHLD – DIEGEISTLICHEN FÜRSTEN
Der zweite Heerschild gehörte der hohen Geistlichkeit, die einen Bishof mit Mitra, Bibel und Krummstab im Schilde führte. Auf Brakteaten wurde das Bild des Bischofs oft durch den Bistumsheiligen ersetzt oder ergänzt. Auch wenn die geistlichen Fürsten nicht mächtiger waren als die weltlichen, so genossen sie doch trotz der Ranggleichheit eine gewisse Höhereinstufung oder Höhereinschätzung. Ihre Bevorzugung ergab sich konsequenterweise aus der Vorstellung des Reichskirchenstaates der ottonischen Kaiser. Diese stützten sich bei der Regierung und der Verwaltung des Reiches vor allem auf die Geistlichkeit, die gebildeter und geschulter war als die meisten weltlichen Fürsten, die oft weder lesen noch schreiben konnten, die weniger nach Eigeninteressen handelte und die Macht der Kirche hinter sich hatte. Außerdem konnten die Ottonen, die ja das Recht der Investur hatten, ihnen genehme Fürsten als hohe kirchliche Würdenträger einsetzen und damit Reich und Kirche, weltliche und geistliche Macht, miteinander eng verbinden. Die Volksgemeinschaft war eine Religionsgemeinschaft und die Gemeinschaft der Gläubigen das Staatsvolk. Hier zeigen sich deutliche Parallelen zu den Thesen des Kirchenvaters Augustinus in seinem BuchDe Civitate Dei,über den Gottesstaat auf Erden.
DER INVESTITURSTREITUNDDAS WORMSER KONKORDAT
Vor dem Wormser Konkordat erfolgte die Einsetzung, die Investitur (investitura,die Einkleidung), hoher geistlicher Würdenträger, besonders der Bischöfe, durch den König. Die symbolische Handlung, mit der der König den neuen Bischof in sein Amt einführte und ihm die Regalien, die weltlichen Rechte, und zugleich die Spiritualien, die geistlichen Amtsrechte, übertrug, war die Übergabe von Ring und Stab. Danach erfolgte erst die Konsekration, die kirchliche Weihe. Bei der Übertragung kirchlicher Ämter spielten zur materiellen Absicherung der Amtsinhaber und ihrer Herrschaft immer auch Vermögenswerte, Geld, Land und Nutzungsrechte eine Rolle. Durch diese Form der Investitur waren die Bischöfe Amtsträger im Deutschen Reich, nicht aber Lehensmänner und bei deren Tod fielen die Regalien und das verliehene Königsgut in die Vergabegewalt des Königs zurück.
Das Verbot der Laieninvestitur, der Einsetzung von Bischöfen durch eine weltliche Macht, und der Simonie, des Ämterkaufs, durch Papst Gregor VII. auf der Synode von Ravenna im November 1078 löste den Investiturstreit aus, der letztlich die königliche Kirchenherrschaft beendete. Die Vorarbeit zu diesem Konflikt hatte der Bischof und Kardinal Humbert von Silva Candida mit seinen drei Büchern gegen die Simonie„Libri tres adversos Simoniacos“schon geleistet. Unter Berufung auf die Apostelgeschichte und auf Papst Leo I. rechnete er die Laieninvestitur der Simonie zu, weil diese Bischöfe„nicht vom Klerus erwählt, vom Volk verlangt und nach dem Urteil der Metropoliten von den Bischöfen der Kirchenprovinz geweiht waren.“Damit lieferte er die Argumente, um die Kirche und die Klöster von weltlicher Herrschaft unabhängig zu machen. Hiermit verbunden war aber ein handfester Eingriff in die Rechte des deutschen Königs. Er war der oberste Lehensherr sowohl der weltlichen als auch der geistlichen Fürsten, hier soweit es das Reichskirchengut betraf. Verlöre der König dieses Lehensrecht, verlöre er auch die Lehen selbst nebst den wirtschaftlichen und militärischen Leistungen, die ihm von den Bischöfen aus dem Reichskirchengut zustanden. Diese Dienste hätten die deutschen Kirchenfürsten dann dem Papst leisten müssen.
Das wiederum bedeutete, dass ein päpstlich dominierter Staat im mittelalterlichen Deutschen Reich entstünde und dieses letztlich zerstören konnte. Somit entstand ein Kampf der Kirche um die weltliche Macht mit dem deutschen König/Kaiser. Als Papst Gregor VII. im Februar 1075 das Verbot der Laieninvestitur erneuerte, ließ er seine Tiara mit einer weltlichen Krone schmücken. Es war aber zugleich ein Kampf um die Freiheit der Kirche von weltlicher Macht, der zu heftigsten, oft blutigen, ein Menschenalter dauernden Auseinandersetzungen im Deutschen Reich führte.
Voraussetzung für die Schlichtung des Streites zwischen den beiden höchsten Gewalten im Mittelalter, Kaiser und Papst, war die neue von Bischof Ivo von Chartres entwickelte Kirchenrechtslehre von der Trennung der weltlichen und geistlichen Amtsbereiche. Der geistliche, die Spiritualien, umfasste die Seelsorge, die Weihebefugnis, die Lehre und die kirchliche Rechtsprechung, der weltliche, die Temporalien, die Verwaltung der Kirchengüter und der übertragenen Regalien. Im Wormser Konkordat 1122 einigten sich Papst Calixt II., der aus dem fränkischburgundischen Hochadel stammte, und Kaiser Heinrich V. über die Grundsätze und das Verfahren bei der Besetzung der Bistümer. Die Wahl eines Bischofs erfolgte durch den Klerus in Anwesenheit des Kaisers oder eines kaiserlichen Beauftragten. Den Kompromiss zwischen Kaiser und Papst hatten der gelehrte Bischof Wilhelm von Champeaux, Anselm von Laon, ein Mitbegründer der Scholastik, und Abt Pontius von Cluny in Straßburg mit Kaiser Heinrich ausgehandelt. Bischof Wilhelm konnte den Kaiser davon überzeugen, dass er als erwählter französischer Bischof und auch ohne Investitur durch den französischen König diesem alle Abgaben und Dienste ebenso treu leiste wie die deutschen Bischöfe im Deutschen Reiche dem Kaiser, wo dieser durch deren Investitur aber einen unnötigen Zwiespalt mit der Kirche begründet habe. Darauf soll der Kaiser geantwortet haben, dass er mehr auch nicht erstrebe. Im Oktober 1119 gaben Kaiser Heinrich IV. und Papst Calixt II. Erklärungen ab, die die Grundlage des Wormser Konkordates wurden.„Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener Kaiser der Römer, verzichte aus Liebe zu Gott und zum heiligen Petrus und zum Herrn Papste Calixt auf jede Investitur in allenKirchen, und ich gebe wirklichen Frieden all denen, die seit Beginn dieses Streites für die Kirche gekämpft haben oder kämpfen. Ich gebe die Besitzungen der Kirche und der Menschen, die im Dienste der Kirche stehen, zurück, soweit ich sie in Besitz genommen habe, soweit aber nicht ich sie habe, werde ich ihnen zur Rückerlangung verhelfen...“und„Ich, Calixtus, von Gottes Gnaden katholischer Bischof der römischen Kirche, gebe wahren Frieden Heinrich, dem erhabenen Kaiser der Römer, und allen Menschen, die um seinetwillen wider die Kirche gewesen waren oder sind. Ihre Besitzungen, die sie im Laufe des Kampfes verloren haben, gebe ich ihnen zurück, soweit ich sie habe, soweit aber nicht ich sie habe, werde ich ihnen zur Rückerlangung verhelfen...“Mit der gegenseitigen Garantie der Wiederherstellung der Besitzstände und Heinrichs Verzicht auf die Investitur waren die Voraussetzungen für die Beendigung der seit über vierzig Jahren währenden oft bürgerkriegsähnlichen Zustände im Deutschen Reich und des Konfliktes zwischen Papst und Kaiser geschaffen.
Abb. 24. Miniaturenzyklus aus der Jenaer Handschrift der Weltchronik des Bischofs Otto von Freising (1138 – †1158),Oben links Kaiser Heinrich IV. und Gegenpapst Clemens III. Die Flucht Papst Gregors VII. (oben rechts) und sein Tod (unten rechts)
Auf dem Hoftag zu Würzburg im September 1120 gaben die deutschen Fürsten, die sich 1105 von Heinrich IV. abgewandt hatten, vor dem Kaiser eine Erklärung ab:„Der Herr Kaiser soll dem Apostolischen Stuhl gehorchen. Wegen der Beschwerde, die die Kirche gegen ihn hat, soll er mit dem Rat der Fürsten zwischen ihm und dem Herrn Papst ein Vergleich gemacht werden, und es soll ein sicherer und dauerhafter Frieden sein, so, daß der Herr Kaiser, was sein und was des Reiches ist habe, die Kirchen und ein jeglicher das Seine ruhig und in Frieden besitzen möge... Auch darin, daß die Kirche gegen den Kaiser und das Reich über die Investituren im Rechtsstreit liegt, denken die Fürsten darauf, daß in dieser Sache das Reich seine Ehre bewahre...“, was bedeutete, dass die deutschen Fürsten nicht daran interessiert waren, dass der Kaiser jeglichen Einfluss auf die Investitur der Bischöfe verlöre. Andererseits formulierten sie hier erstmals den Primat der Fürsten:„Und wenn in Zukunft der Herr Kaiser nach irgend jemandes Rat oder Eingebung gegen irgend jemand eine Racheübung für die Feindschaft wird angestiftet haben, so sollen mit seiner eigenen Zustimmung und Erlaubnis die Fürsten unter sich das festsetzen, daß sie selbst zusammen verharren und mit aller Liebe und Ehrfurcht ihn ermahnen sollen, daß er nichts in dieserArt tun möge. Wenn aber der Herr Kaiser diesen Rat nicht beachtet haben wird, so sollen die Fürsten so, wie untereinander das gegeben haben, es auch beachten.“Damit schufen die Fürsten eine Instrument zur permanenten Kontrolle des Herrschers.
Am 23. September 1122 einigte man sich in Worms auf das Konkordat, das den langen Streit zwischen Reich und Kirche beendete. In dem kaiserlichen Privileg heißt es:„Ich, Heinrich... verzichte aus Liebe zu Gott und der heiligen römischen Kirche... zugunsten Gottes und der heiligen Apostel Petrus und Paulus und der heiligen römischen Kirche auf alle Investitur mit Ring und Stab, und ich gestatte in allen Kirchen, die in meinem Regnum und Imperium liegen, kanonische Wahl und freie Weihe...“und es steht an dessen Schluss der unscheinbare, aber äußerst bedeutsame Satz:„Dies alles ist geschehen mit der Zustimmung und nach Beratung mit den Fürsten, deren Namen unterschrieben sind.“Das Kernstück des päpstlichen Privilegs lautet:„Ich, Bischof Calixtus, servus servorum Dei, gestehe Dir, mein geliebter Sohn Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener Kaiser der Römer, das Recht zu, daß die Wahlen von Bischöfen und Äbten im Deutschen Reich, die zum Regnum gehören, in Deiner Gegenwart geschehen sollen, frei von Simonie und Gewalttat; sollte zwischen den Parteien daher Streit entstehen, dann sollst Du mit dem Metropoliten und den Konprovinzalen gemeinsam beraten und entscheiden und dem Würdigsten Deine Zustimmung und Hilfe leihen. Der Erkorene aber soll von Dir mit dem Zepter die Regalien erhalten und Dir dafür leisten, was er von Rechts wegen schuldig ist. In den anderen Teilen Deines Imperiums soll der Gewählte binnen sechs Monaten mit dem Zepter von Dir die Regalien erhalten und Dir dafür leisten, was er von Rechts wegen verpflichtet ist; ausgenommen davon seien alle Leistungen an die römische Kirche...“
Der Kreis der Bischofswähler grenzte sich langsam ein. Die Ursache hierfür war die frühzeitige Fixierung der Bischofssitze an eine Kathedrale oder einen Dom und die Bindung der Geistlichen an ihre Diözese. Seit dem 13. Jahrhundert erfolgte die Bischofswahl ausschließlich durch das Dom- oder Stiftskapitel des betroffenen Bistums.
1213 verzichtete Kaiser Friedrich II. auf sein Mitwirkungsrecht bei der Entscheidung unklarer, zwiespältiger Wahlen. Die Spiritualien, die Vollmacht zur Ausübung und Durchsetzung der geistlichen Rechte, übertrug der Papst dem gewählten Bischofskandidaten bei dessen Konsekration. Zuvor wies der König ihn durch die Übergabe des Zepters in die Temporalien ein. Dieses erfolgte nach dem Lehensrecht. Die Bischöfe wurden so zu Kronvasallen und waren nun nicht mehr Amtsträger des Reiches, also Beamte, sondern dessen Lehensleute. Weil das Zepter das königliche Übergabesymbol bei dieser Belehnung war, wurden die geistlichen Reichslehen als Zepterlehen bezeichnet. Die lehensrechtliche Deutung der Zepterinvestitur gab den Bischöfen somit Rang und Stand in der Heerschildordnung und machte sie jetzt zu geistlichen Fürsten. Diese kombinierte Stellung, Bischof und zugleich Landesherr, war eine deutsche Besonderheit innerhalb der römischen Kirche, mit Ausnahme des Vatikans selbst. Grundlage für die Entwicklung der geistlichen Territorien waren die bischöfliche Weihe-, Lehr- und Aufsichtsvollmacht. Für ihre Größe und Macht war ausschlaggebend, dass keine territorialen Teilungen oder Minderungen durch Erbgänge erfolgen konnten.
DIE ÜBEREINKUNFTMIT DEN GEISTLICHEN FÜRSTEN
Ein weiteres Zeichen für die Bevorzugung der geistlichen Fürsten findet sich bei dem Stauferkaiser Friedrich II., der zur Sicherung seiner Herrschaft 1220 ein Bündnis mit der hohen Geistlichkeit abschloss, dieconfoederatio cum principibus ecclesiasticis. Dieses ist im Zusammenhang mit der Wahl seines Sohnes Heinrich VII. zum deutschen König zu sehen. Es wurde bereits vor der Wahl ausgehandelt, um Heinrichs Wahl zu sichern, denn bei den wahlberechtigten Fürsten und Großen des Reiches waren die geistlichen Fürsten in der Überzahl. Die Originalschrift dieses Bündnisses liegt nur noch in der Ausfertigung für das Bistum Eichstätt vor. In diesem Vertrag wurden die geistlichen Fürsten erstmals als eine einheitliche Gruppe angesprochen, ihre Bedeutung für das Kaisertum hervorgehoben und ihr und der Kirche der kaiserliche Schutz zugesagt:„Als Wir Uns in angemessener Betrachtung daran erinnerten, mit welcher Wirksamkeit und Treue Unsere lieben getreuen geistlichen Fürsten Uns bislang beigestanden haben, indem sie Uns zum Gipfel des Kaisertums erhoben, nach der Erhebung dort stärkten und sich schließlich Unserem Sohn Heinrich wohlwollend und einträchtig zum König und Herrn erwählten – kamen Wir zu der Überzeugung, Wir wollen diejenigen, durch die Wir erhoben wurden, ständig erheben, und durch die Wir gestärkt werden, zusammen mit deren Kirchen ständig durch Unseren Schutz gegen jeglichen Schaden stärken. Weil nun zu deren Beschwernis einige Bräuche, und um es genauer zu sagen: Missbräuche infolge der langen Wirren des Reiches, das nun durch die Gnade Gottes ruhig und friedlich geworden ist, eingerissen sind an neuen Zöllen und Münzen, die sich gegenseitig wegen der Ähnlichkeit der Bilder zu stören pflegten, an Streitigkeiten der Vögte und an anderem Übel ohne Zahl, sind Wir mit einigen Anordnungen diesen Missbräuchen begegnet: Erstens versprechen Wir, dass Wir künftig beim Tode eines geistlichen Fürsten niemals seinen Nachlassfür das Reichsgut beanspruchen werden; Wir verbieten auch, dass ein Laie ihn jemals unter irgendeinem Vorwand für sich beansprucht, vielmehr soll er dem Nachfolger zufallen, wenn der Vorgänger ohne letztwillige Verfügung dahingegangen ist; wenn er dafür eine letztwillige Verfügung getroffen hat, soll diese, so wollen Wir, gültig sein...“Damit wurde die territoriale Entwicklung und der Bestand geistlicher Fürstentümer mit einer der Erbfolge ähnlichen Regelung abgesichert.
Abb. 25. Wichmann von Seeburg, 1152 – 1192, Erzbischof von Magdeburg, Brakteat, 0,98 g, Münzstätte Magdeburg,Höhn 33, 1887Unter einem Dreipass über einer Mauer das Brustbild des nimbierten, kraushaarigen heiligen Mauritius mit einem Schwert in der rechten und einer Fahne in der linken Hand. Beidseits des Heiligen ein Gebäude. Über dem Dreipass mittig zwischen zwei beknauften Türmen ein größeres Gebäude. Umschrift SC S MAVRICIVS . DVX
Abb. 26. Wichmann von Seeburg, Erzbischof von Magdeburg, 1152 – 1192, Brakteat, Münzstätte Halle, aus dem Fund von 1859, Münz Zentrum 73/2996, Sammlung Löbbecke 360Stehender, segnender Erzbischof zwischen zwei knienden Diakonen, von denen der linke einen Kreuzstab und der rechte einen Krummstab hält.
Abb. 27. Wichmann von Seeburg, Erzbischof von Magdeburg, 1152 – 1192, Brakteat, Ø 35 mm, 0,91 g, Münzstätte Halle,Fund Bardowick 16, Münz Zentrum 73/2993.Auf einem Bogen sitzend links der Erzbischof im Pontifikalgewand mit einer infulierten Mitra bicornis und einem Krummstab in seiner rechten und einem Buch in seiner linken Hand. Rechts der sitzende nimbierte heilige Mauritius mit einer Fahne in der rechten und einem Lilienszepter in der linken Hand. Trugschrift
Abb, 28. Agnes II. von Meißen, Äbtissin von Quedlinburg, 1181 – 1203, Brakteat, 0, 762 g, Münzstätte Quedlinburg, Slg. Bonhoff 523, Künker 130/1807 In einem Perlkreis zwischen zwei beknauften Türmen auf einem Bogen sitzend die Äbtissin mit einem Kreuzstab in der rechten und einem Lilienszepter in der linken Hand, Umschrift + AGNES ABATISA INCVDDELNBV.Auf dem Außenrand sechs Kringel
Abb. 29. Gardolf von Harbke, Bischof von Halberstadt, 1193 – 1201, Brakteat, Ø 40 – 41 mm, 0,77 g,Münzstätte Halberstadt, Fund Erfurt 17