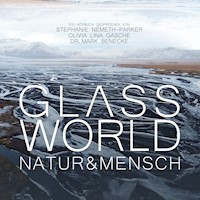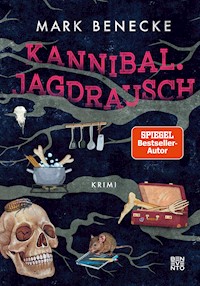14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ob Forensik-Freak, Herr der Maden oder Käfer-Nerd - eines ist klar: Der Kriminalbiologe Mark Benecke hat eine ganz besondere Leidenschaft, nämlich Leichen. In seiner Autobiografie erfahren wir nun endlich, ob er sich bereits als Kind für Tatorte interessiert hat, was ihn an Insekten so fasziniert und warum er sich heute auch politisch engagiert. Dass spezielle Interessen kein Hindernis für ein erfülltes und glückliches Leben sind, zeigt er mit seinem Buch und macht damit allen Leser*innen Mut, den eigenen Weg zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorwort
Ante Mortem
Eine total normale Kindheit und ihre Folgen
Vom Biologie-Studenten zum DNA-Experten
Ein Nerd zu sein ist fein
Bildteil
OCME, plastinierte Leichen und Theater
Be a Sherlock
Post Mortem
Anhang
Über das Buch
Mark Benecke ist Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe und auf der ganzen Welt unterwegs, um mithilfe seiner speziellen Kenntnisse und Methoden Leichen zu identifizieren und Kriminalisten wie Archäologen, Historikern und Paläontologen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Mark Benecke ist auch der Crazy Crime Nerd, der schon auffällt, bevor er hochkompetent loslegt und mit Wissen, Kreativität, Kompetenz überzeugt.
Über den Autor
Ob Forensik-Freak, Herr der Maden oder Käfer-Nerd – eines ist klar: Der Kriminalbiologe Mark Benecke hat eine ganz besondere Leidenschaft, nämlich Leichen. In seiner Autobiografie erfahren wir nun endlich, ob er sich bereits als Kind für Tatorte interessiert hat, was ihn an Insekten so fasziniert und warum er sich heute auch politisch engagiert. Dass spezielle Interessen kein Hindernis für ein erfülltes und glückliches Leben sind, zeigt er mit seinem Buch und macht damit allen Leser*innen Mut, den eigenen Weg zu gehen.
MARK BENECKE
MIT ANDREAS HOCK
MEIN LEBEN NACH DEM TOD
WIE ALLES BEGANN
LÜBBE
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Anne BuentigUmschlaggestaltung: Tanja ØstlyngenEinband-/Umschlagfoto: © Daniel HammelsteinE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-8095-8
www.luebbe.dehttp://benecke.comwww.lesejury.de
Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils netto ohne UST überall dasselbe. Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
Vorwort
„Nothing is little“(Sherlock Holmes)
Wenn ich Vorträge halte, liegt neuerdings ein Fragenbuch aus. Dort kann jede Zuhörerin und jeder Zuhörer hineinschreiben, was sie oder ihn neben dem Vortragsinhalt noch interessiert. Etwa die Hälfte der Fragen dreht sich um den Fäulniszustand von Leichen, um Gerüche oder Blutspuren. Oft fragen mich Menschen aber auch danach, wie mein Leben verlaufen ist.
Also setzten Andi Hock und ich uns in meiner Bibliothek zusammen und sprachen über mein Leben. Andi hat aus diesen Gesprächen die Teile herausgefiltert, die ihm besonders erzählenswert erschienen. Mir wäre nicht viel eingefallen, denn ich finde mein Leben ganz normal und hätte nicht gewusst, was ich außer kriminalistischen Untersuchungen aufschreiben sollte. Als ich den Entwurf für das Buch dann durchgesehen, geprüft und stark verfeinert habe, staunte ich und musste ziemlich viel lachen.
Die Geschichten mit den Liebespfeilen, meinen Tätowierungen oder der Ameise unter dem Stiefel des Täters waren mir gar nicht mehr richtig bewusst gewesen. Danke an Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Fragen im Fragenbuch, an Andi für seine menschliche und liebevolle Auswahl von Erlebnissen aus einem Meer der Ereignisse und natürlich an Sie, liebe Leserinnen und Leser, die nun erfahren, wie aus einem Kind mit Karohemd ein Kriminalbiologe wurde.
Dieses Buch ist übrigens weder ein Lehrbuch noch ein Lebenslauf, sondern es soll ziemlich locker Schlaglichter auf meinen bisherigen Weg werfen. Ich hoffe, Sie finden Gefallen an der Geschichte vom Jungen, der erst in die Forschung und dann ins Leben stolpert. Da mich mehrere Freundinnen und Freunde gefragt haben, ob sie in dem Buch vorkommen: Ich schreibe gerne einen weiteren Band mit Geschichten von Freundschaft und Begegnungen. Dieses Buch hier handelt – siehe Titel – davon, wie alles anfing.
Viel Freude beim Lesen!
Rom, im April 2019
Mark Benecke
Ante Mortem
Dass ich keinen alltäglichen Job mache, ist mir klar. Ich bearbeite Umstände, die sich für die meisten Menschen ganz furchtbar anfühlen würden, weil sie furchtbar aussehen und furchtbar riechen, und weil möglicherweise etwas Furchtbares passiert ist. Ich untersuche Leichen, die tagelang bei voll aufgedrehter Heizung auf einem Sofa lagen und bei denen man den eigentlichen Menschen unter dem Insektenteppich nur noch erahnen kann. Ich sichere Spuren an Orten, gegen die eine Rastplatztoilette aus dem Jahr 1975 deutlich hygienischer wäre. Ich spreche mit Angehörigen, deren Kind von einem Sexualstraftäter verschleppt, vergewaltigt und zerteilt worden ist. Und ich treffe Serienmörder, deren Taten nicht einmal ein Drehbuchautor für einen Splatter-Film erfinden würde.
Natürlich ist das auch für mich etwas Besonderes. Jeder Fall ist neu und anders. Bloß sehe ich darin nicht das Grauen, bekomme keine Gänsehaut und spüre auch keinen Würgereiz, wenn ich zum Beispiel einen Speckkäfer auf einem fast vertrockneten Körper sicherstelle oder mich Blutspuren, Spermaflecken, Kotresten oder Hirnflüssigkeit widme, die mir an einem Tatort aufgefallen sind und die oft viel mehr über das eigentliche Geschehen aussagen, als es auf den ersten und manchmal auch den zweiten oder dritten Blick erscheint. Dabei bin ich weder ein Held, noch bin ich Superman. Ich bin nicht mal besonders mutig und habe beispielsweise Respekt vor Spinnen und hasse Haare im Abfluss. Zudem ekle ich mich vor Lebensmitteln wie Leberwurst und Milch: Wer mag schon gewürzte Leichen-Paste und flüssige Tierbaby-Nahrung? An einem Toten finde ich dagegen nichts Abstoßendes – ganz gleich, welche Farbe die Haut nach ein paar Tagen Liegezeit haben mag und wie viele Schmeißfliegen sich auf ihr schon niedergelassen haben. Denn das sind Hinweise aus einer Welt, die wir leicht übersehen – geheime Spuren im Offensichtlichen.
Daher kommt auch meine Abscheu gegen verdeckende Kalkspuren. Im Labor haben wir sehr hartes Wasser, sodass ich dort laufend irgendwelche Kalkecken entfernen muss, die sich minütlich im Waschbecken und auf den langen Edelstahltischen bilden. Am gruseligsten finde ich aber wie gesagt Haare, die sich im Sieb der Badewanne verfangen und nur mühsam herauspulen lassen. Das mache ich allerdings nicht selbst, sondern kann zum Glück meine Frau meist dazu überreden. Und dass man mich mit Fleisch jagen kann, hatte ich ja schon erwähnt: Ein Kotelett ist eine Leichenscheibe mit Leichenknochen, Gulasch sind Leichenmuskelwürfel, und eine Wurst ist reichlich Leichenfett in Leichendarm. Einen Tatort empfinde ich vielleicht deshalb nicht als eklig, weil dort für mich tiefer Frieden herrscht. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo ein Mensch gestorben ist, auf einem meiner Tatortkoffer sitze und überlege, in welcher Reihenfolge etwa die Blutspuren an der Wand entstanden sein könnten, nachdem ich sie vermessen habe, dann bin ich ganz ruhig, konzentriert – und alles ist klar und geordnet. Es verändert sich nichts mehr. Da gibt es null Ekel und keine Angst.
Bei den meisten Menschen ist das anders. Selbst meine Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin kennen Bereiche, die sie an die Grenze des Erträglichen bringen: Es gibt kaum Expertinnen und Experten, die sich auf die Analyse des Mageninhalts von Toten spezialisiert haben, weil das sogar für hartgesottene Forensikerinnen und Forensiker fast das Widerwärtigste zu sein scheint, was sie sich vorstellen können: zu untersuchen, was ein Verstorbener in den Stunden vor seinem Ableben wann und wie zu sich genommen hat.
Komisch ist nur, dass der Tod – vor allem der unnatürliche, durch Gewalt oder ein tragisches Unglück hervorgerufene und somit kriminalistisch bedeutsame Tod – auf viele Menschen eine gehörige Anziehungskraft ausübt. Früher war das entspannter. Da war der Tod normaler, weil die Menschen andauernd Leichen gesehen haben – in Kriegen, bei Krankheitswellen oder schlicht, wenn ein Verstorbener, wie lange üblich, zu Hause aufgebahrt wurde. Doch diese unmittelbare Begegnung mit dem Tod gibt es heute kaum noch. Deshalb suchen sie viele auf eine andere Weise – auch in meinen Vorträgen. Die Menschen wollen wissen, was am Rande der Wahrnehmung los ist, und wünschen sich vermutlich jemanden, der mit ihnen am Rand entlanggeht. Vielleicht möchten sie sich auch einen Moment lang dem Fremden und Bösen aussetzen, aber danach soll einer das Tor zur Hölle wieder zumachen. Manche meiner Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich aber weder für meine Arbeit noch für den Tod. Sondern eher dafür, wie es wohl wäre, wenn sie selbst einen anderen Menschen umbringen würden; zumindest haben mir das einige Besucherinnen und Besucher schon erzählt. Sie versetzen sich während der Veranstaltung nicht nur in das Opfer hinein, sondern auch in den Täter. Diese Erkenntnis finde dann wiederum ich ziemlich gruselig, aber gut – damit muss ich leben und erkläre daher aus Sicht der Täter, dass sie zwar meist kein Mitleid benötigen, aber trotzdem gebeugte und traurige Figuren sind. Serienmörder-Fans könnten daher ebenso gut Lungenkrebs-Fans werden.
In Ermittlerkreisen gelten meine Kolleginnen, Kollegen und ich oft als Nerds, als Freaks, als Sonderlinge. Sachlich betrachtet gehen wir einem mies bezahlten Scheißjob nach, kennen keinen Feierabend, arbeiten mit allerhand siffigen Dingen, und während eine normale Polizistin oder ein Polizist für das Gute kämpft und die Welt vor dem Bösen beschützen will und soll, hat uns das alles nicht zu interessieren. Dennoch oder gerade deswegen übe ich meinen Beruf sehr, sehr gerne aus: Die Arbeit ist eben ruhig und klar.
Auch wenn es vielleicht niemand hören will, aber mir ist es wirklich egal, wem meine Arbeit nützt. Ich arbeite weder für die Guten noch für die Bösen. Ich weiß nämlich manchmal gar nicht, wie ich das in einem Krieg oder Beziehungsstreit festlegen soll. Dort halten sich ja alle für die Guten.
Schon gar nicht arbeite ich für die Gerechtigkeit – denn die gibt es gar nicht. Zumindest habe ich sie noch nie gesehen. Was ist schon gerecht daran, wenn ein Mensch, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist, von einem antisozialen Narzissten missbraucht und erschlagen wird? Dass man den Täter aufhängt? Oder foltert und für die nächsten 50 Jahre in einem dunklen Loch einsperrt? Das alles bringt das Opfer nicht wieder ins Leben zurück und nimmt den Angehörigen auch nicht ihren Schmerz. Möglicherweise wurde auch der Täter selbst einst von seinen Eltern hart misshandelt. War das ihm gegenüber gerecht? Und vielleicht hätte das Opfer als Erwachsener selbst einen folgenschweren Fehler begangen, ein Baby totgeschüttelt oder eine alte Frau überfahren. Wer weiß das schon? Deshalb kann das, was wir als Spurenkundler tun, keine Gerechtigkeit herstellen. Stattdessen kämpfe ich für die Wahrheit. Denn die gibt es: Ob eine Spur vorliegt oder nicht, das kann ich messen.
Vielleicht liegt mein Blick auf die Dinge darin begründet, dass ich Naturwissenschaftler bin. In der Biologie, also der Wissenschaft vom Leben, wissen wir, dass der natürliche Tod dazu dient, Platz für die nächsten Bewohner der Erde zu schaffen. Einer geht, einer kommt – so ist das nun mal. Aber so nüchtern betrachten das nur die wenigsten. Muss ja auch nicht sein. Ich verstehe, dass Menschen lieber an eine höhere Macht glauben, an Fügung oder an Schicksal. In meiner Welt ist dafür kein Platz.
Zugegeben, es gibt schon seltsame Arten, wie ein Leben enden kann. In diesem Zusammenhang fällt mir der Fall von Isadora Duncan ein, eine der berühmtesten Tänzerinnen zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Ich beschäftige mich gerne mit Spuren aus alten Fällen, weil ich schlecht damit leben kann, lösbare Rätsel nicht zu lösen. Jedenfalls verließ die elegante Dame, die aus San Francisco stammte und das klassische Ballett durch ihren freizügigen Tanzstil auf den Kopf stellte, am 14. September 1927 ihre Wohnung in Nizza. Es war ein frischer Herbsttag, der Wind wehte vom Mittelmeer herüber, und sie trug daher einen riesigen, zwei mal zwei Meter großen Seidenschal. In einer nahen Bar nahm Frau Duncan einige Drinks, und weil es danach offenbar noch ein bisschen kälter war, holte sie sich einen zweiten Schal von zu Hause, bevor sie an der berühmten Promenade des Anglais in die offene Limousine ihres Lebensgefährten Ivan Falchetto einstieg. Es war derselbe rote Schal, den sie bei vielen ihrer umjubelten Auftritte trug. Und weil diese Auftritte, die sie gerne ohne Korsett, barfuß und mit entblößten Armen und Beinen absolvierte, regelmäßig für Aufruhr sorgten, war auch der rote Schal einigermaßen berühmt.
Der Beifahrersitz des Cabrios war im Vergleich zum Fahrersitz leicht nach hinten versetzt, also hätte sich Falchetto am Steuer zur Seite wenden müssen, um seine Freundin zu sehen. Wahrscheinlich aus diesem Grund bemerkte er beim Anfahren nicht sofort, dass Duncans Schal, vielleicht durch den Wind, in die rechte hintere Felge seines Wagens geraten war. Duncans Kopf prallte durch die plötzliche Verkürzung des Stoffes gegen die Innenverkleidung des Wagens. Als Falchetto nach zwanzig Metern anhielt, stellte er fest, dass sich der Schal bereits so weit verdreht hatte, dass seine Begleiterin bewusstlos war. Im Krankenhaus wurden Brüche der Nase, der Wirbelsäule und des Kehlkopfes festgestellt. Außerdem waren Hals- und Kopfschlagader zerrissen. Isadora Duncan war tot, erdrosselt durch ihren eigenen Schal.
Traurigerweise waren schon ihre beiden Kinder bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall vierzehn Jahre zuvor in Paris ums Leben gekommen. Der Fahrer des Autos, in dem die siebenjährige Deirdre, ihr vier Jahre jüngerer Halbbruder Patrick und deren Kindermädchen saßen, stoppte in einer Kurve, um ein entgegenkommendes Taxi vorbeizulassen. Dabei soff der Motor ab, und so musste der Chauffeur die wie seinerzeit üblich vorn am Fahrzeug befindliche Anlasserkurbel betätigen. Allerdings hatte er vergessen, den Leerlauf einzulegen. So machte das Auto beim Neustart einen mächtigen Satz und versank binnen weniger Sekunden im Fluss, der sich direkt neben der Straße befand. Wegen der starken Strömung gab es keine Rettung: Das Kindermädchen und Deirdre ertranken, der kleine Patrick starb wenig später im Krankenhaus.
Isadora Duncan wurde fünf Tage nach ihrem Tod verbrannt. Ihre Urne wurde auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise neben den sterblichen Überresten ihrer insgesamt drei Kinder beigesetzt – ein weiteres Kind war direkt nach der Geburt gestorben. Der rote Schal, durch den die Künstlerin zu Tode kam, soll wenige Wochen später für 50.000 Franc an die Tochter eines amerikanischen Ananaspflanzers in Honolulu verkauft worden sein. Ich weiß das, weil ich den Fall vor über 20 Jahren mal für eine rechtsmedizinische Fachzeitschrift nachuntersucht habe. Das aber nur am Rande.
Denn was ich eigentlich sagen will: Man kann nie, wirklich nie, vorhersehen, wie und wann der Tod in unser Leben tritt. Selbstverständlich können wir uns möglichst gesund ernähren, Extremsportarten meiden oder einen weiten Bogen um Kriegsgebiete machen – und so unser Risiko verringern, einen Herzinfarkt zu erleiden, beim Gleitschirmfliegen abzustürzen oder vom Projektil eines Heckenschützen getroffen zu werden. Trotzdem könnte uns beim Entlanglaufen auf dem Gehweg das berühmte Klavier auf den Kopf fallen, das die Mitarbeiter der Umzugsfirma nicht ordentlich befestigt hatten. Obwohl es dafür zwar kein dokumentiertes Beispiel gibt, gibt es genügend Fälle, bei denen vom Baum fallende Kokosnüsse Menschen getötet haben. Am häufigsten hat es Kinder erwischt, die mit Fernsehern spielten. In den zehn Jahren zwischen 2000 und 2010 wurden über zweihundert schwer verletzt. Wir können von einem unbemannten Gabelstapler aufgespießt werden, weil der Kontakt im Sitz, der eigentlich verhindern soll, dass sich der Stapler von allein bewegt, im Laufe der Jahre ausgeleiert und feucht war. Auch das ein echter Fall.
Und es kann sich eben ein Schal in der Felge eines Autos verfangen und uns das Blut abschnüren. Deshalb ergibt es in meinen Augen auch keinen Sinn, sich im Alltag dauernd Sorgen zu machen, was alles passieren könnte. Für mich ist nur wichtig, was wirklich passiert ist. Und wenn das andere Menschen ebenfalls interessiert, freut mich das. Ebenso wichtig ist mir, dass aus meinen Vorträgen mit Fallbeispielen keine Grusel-Show wird. Denn Effekte gibt es in Horrorfilmen und -serien genug. Ich dagegen nehme meine Besucher mit auf eine Reise in meine Welt der Spurenkunde, in der ein winziges Detail – sei es die Larve einer Stubenfliege, eine Hautschuppe oder ein um einen Zentimeter verrutschter Couchtisch – ein spannendes Puzzle-Stück bei der Fallbearbeitung darstellen.
Das wissen fast alle, die zu meinen Vorlesungen kommen. Wer sich gegen seinen Willen in diese Welt der Spuren schleppen lässt, dem kann das natürlich blutig vorkommen. Doch die meisten meiner Zuhörer und Zuhörerinnen haben die Welt schon vorher ohne Zuckerguss gesehen, sonst würden sie nicht in die Trainings und Vorträge kommen. Ich bin Wissenschaftler und verwende zwangsläufig Methoden wie Sherlock Holmes, aber ich möchte kein Unterhaltungskünstler sein. Ab und zu bekomme ich Angebote von großen Managementagenturen, die mir anbieten, aus meinen Veranstaltungen Shows für tausende Zuschauer zu machen – in großen Hallen und mit viel Hokuspokus. Aber so bin ich nicht und bleibe daher lieber bei Menschen, die nicht den Nervenkitzel suchen, sondern Spaß an Spuren und der Wahrheit haben.
Unabhängig davon werde ich öfter gefragt, wie ich das alles aushalte, von welchen Erlebnissen ich träume – oder wie es sich anfühlt, einer Arbeit nachzugehen, bei der es vorwiegend um den Tod in all seinen Ausprägungen geht. Deshalb habe ich mich zu diesem Buch entschlossen, in dem ich davon erzählen möchte, wie für mich alles begonnen hat – und welche Ereignisse mich so stark geprägt haben, dass ich das wurde, was ich heute bin. Manche Antworten mögen schräg wirken, und vielleicht ist der ein oder andere ja auch enttäuscht, dass ich weder nachts schreiend aus dem Schlaf hochschrecke noch ein Zimmer mit Glitzer-Einhörnern besitze, um all die scheußlichen Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Für mich ist das alles ganz normal. Ob ich das auch bin – »normal« –, das kann jeder selber entscheiden. Denn was »normal« überhaupt bedeuten soll, das verstehe ich nicht.
Eine total normale Kindheit und ihre Folgen:
Wie ein Chemiebaukasten mein Leben veränderte
Um ein Haar hätte mein Leben eine ganz andere Wendung genommen. Aber der Reihe nach. Ich bin ein gebürtiger Bayer: 1970 kam ich in Rosenheim zur Welt. Wobei ich vorsichtshalber sagen möchte, dass ich auf meinen Geburtstag keinen Wert lege. Deswegen antworte ich auch grundsätzlich auf keine Glückwünsche oder sonstige Gratulationsbekundungen, die mich in sozialen Netzwerken (lese ich nie) oder per E-Mail (lese ich immer) erreichen. Irgendjemand hat mein Geburtsdatum mal auf Wikipedia eingetragen … Wenn mir jemand schreibt, ist das nett gemeint. Aber es ist dann auch klar, dass die- oder derjenige mich nicht näher kennt.
Alle anderen Menschen in meinem Umfeld wissen Bescheid. Mir bedeuten solche Anlässe einfach nichts, weil sie ja nur eine vom menschlichen Kalender, aber nicht von wirklich exakten Zeitabständen vorgegebene Fantasie sind. Es ist wie bei Sternbildern, die wir nur deshalb zu sehen glauben, weil wir so verdammt weit weg von ihnen sind. Die »Jungfrau«, unter deren Sternbild ich angeblich geboren bin, ist beispielsweise eine bloß von der Erde aus zusammenhängend erscheinende Gruppe von Leuchtpunkten. Aus jeder anderen Ecke des Alls ergeben dieselben Sterne ein anderes Muster. Für mich sind Geburtstage und Sternzeichen daher Tage wie alle anderen: Ich arbeite, oder ich reise zur Arbeit. Oder beides.
Die ersten nicht ganz drei Jahre meines Lebens verbrachte ich in Rosenheim und Bruckmühl, besser gesagt in Heufeldmühle, einem kleinen Ortsteil im Mangfalltal. Es gibt dort keinen wirklichen Ortskern, keinen zentralen Platz mit Maibaum, Rathaus, Dorfkirche, Brunnen und so, aber es ist eine Gegend, in der andere Leute Urlaub machen – oder zumindest auf dem Weg in den Urlaub dran vorbeifahren. Die Alpen sind nicht weit entfernt, die Luft ist sauber und die Flüsse oft kristallklar.
Ich habe keine Erinnerungen mehr an diese Zeit. Das heißt nicht, dass ich meine bayerische Herkunft verdränge. Aber unser Erinnerungsvermögen setzt eben erst ab einem Alter von etwa drei bis vier Jahren ein. Die älteren Eindrücke sind alle weg, wenn man erwachsen ist – wie von der Festplatte gelöscht. »Infantile Amnesie« nennt man das. Was ich über diese Jahre noch weiß, stammt von ein paar Fotos. Die enorm großen bayerischen Eiszapfen sind mir als Einziges im Gedächtnis geblieben. Im Winter hingen sie vom Dach meiner Urgroßeltern, und vielleicht auch von der »Bayerischen Wolldeckenfabrik Bruckmühl« in Heufeldmühle herunter.
In dieser Fabrik, deren Wahrzeichen ein hoher Turm mit den Buchstaben »B-W-B« am Dach war und die mit fast 800 Beschäftigten im Prinzip der einzige Arbeitgeber vor Ort war, arbeitete meine Mutter. Sie stammt aus der Region. Ihre Eltern, also meine Großeltern, waren waschechte Oberbayern, und meine Mutter spricht noch heute mit der typischen Färbung, die man als Nicht-Bayer nur aus Heimatfilmen oder von Schlagertexten kennt. Ich liebe Dialekte jeder Art – von Erzgebirgssächsisch über MedellínSpanisch bis hin zu algerischem Französisch. Wenn ich unterwegs bin, mache ich oft Videos mit Menschen, die diese Dialekte, Akzente und Lautvertauschungen zum Glück sprechen. Wie unfassbar langweilig wäre die Welt ohne Vielfalt, auch in den Sprachfärbungen.
Als junge Frau lernte meine Mutter meinen »genetischen Vater« – so heißt das in der Vaterschaftskunde – kennen. Er arbeitete »im Berg« – so heißt das in Bayern – bei einer Seilbahngesellschaft als Techniker. Er stammt eigentlich aus Erfurt, aber irgendwie hatte es seine Eltern aus der DDR ins tiefste Bayern verschlagen. Später zog sie nach Köln, wo wir eine Patchworkfamilie mit meinem sozialen Bruder und meinem neuen Vater wurden.
Außer den Eiszapfen sind die Bilder meiner frühen Kindheit aus der Bilderbuchlandschaft aber, wie gesagt, von neuen Erinnerungen überlagert oder nicht mehr vorhanden. Ziemlich sicher ist, dass mir meine Mutter aus der Häschenschule vorgelesen hat, einem Kinderbuch aus den 1920er Jahren. Sie liebt das Buch, und es geht darin um eine Schulklasse, die – wie der Name schon sagt – aus lauter kleinen Hasen besteht und die von ihrem Hasen-Lehrer alles über Natur und Tierwelt beigebracht bekommen, zum Beispiel, dass Kohl gesund ist und man sich vor dem Fuchs hüten sollte. Stimmt ja auch!
Bis heute liebe ich Züge und fahre fast jeden Tag damit. Vielleicht beruhigt mich das Geräusch und Gerumpel von Zügen, weil die Wohnung in der Heufeldmühle direkt an den Bahnschienen lag. Am liebsten sind mir Nachtzüge, aber die sterben vielleicht aus. Hoffentlich nicht.
Bald zogen wir also nach Köln – der Grund war mein neuer Vater, der Ingenieur und Kollege meines genetischen Vaters bei der Seilbahn war. Die beiden sind Spezialisten für Fördertechnik, aber in diesem Fall beförderte, wenn man so will, die Seilbahn meinen neuen Vater direkt in die Arme meiner Mutter. Im stockkatholischen Bayern der frühen siebziger Jahre war das vermutlich nicht ohne. Aber meine Mutter hörte auf ihr Herz und zog es durch. So kamen wir nach Köln.
Ich weiß nicht, ob ich das seltsam fand oder nicht. Vermutlich habe ich die Dinge auch damals schon so akzeptiert, wie sie waren, weil alles andere vergeudete Energie bedeutet. Und die Dinge waren in diesem Fall eben so, dass ich nach einer kurzen Kindheit auf dem Land zwischen hohen Bergen und tiefen Seen in eine Metropole kam, die von Außenstehenden als hässlich und verdreckt bezeichnet wird. Ich liebe Köln, und für mich war dieser Umzug ein echter Glücksfall.
Unser vorübergehendes Zuhause bestand aus einer kleinen Wohnung an der Nordsüdfahrt – also an einer von Kölns breiten Straßen, die diese Stadt durchschneiden. Sie wurde nach der fast vollständigen Zerstörung im Krieg gewollt autofreundlich aufgebaut. Wenig später zogen wir nach Zollstock, einem Stadtteil südlich der Altstadt, in dem lustigerweise das damals neu gegründete »Bundesamt für den Zivildienst« seinen Sitz hatte und in dem darüber hinaus straßenweise die von mir seitdem sehr geschätzten Genossenschaftswohnblocks standen. Meine Eltern waren inzwischen auch verheiratet, und der Kontakt zu meinem genetischen Vater war wegen der großen Entfernung von fast siebenhundert Kilometern kaum mehr vorhanden. Aus dem bayerischen Buben wurde blitzschnell ein »Imi«. Das ist liebevolles Kölsch für alle Immigranten, also Menschen, die aus mehr als zehn Kilometern Entfernung zuziehen. Die nächste Stufe war der Kölsche Jung mit einer Schwäche für original bayerische Brezen, die man damals wie heute in Köln aber leider nicht bekommt. Wann immer ich in Bayern bin, muss ich sofort eine gescheite Brezen essen. Zumindest, wenn sie vegan ist. Ausgerechnet und nur in Berlin, also bei den von Bayern viel geschmähten »Saupreißn«, gibt es neuerdings einen Laden, der »gscheide Brezn« herstellt. So ganz wird man seine Herkunft nie los.
In Zollstock wohnten wir in einem – wie ich fand und finde – völlig abgefahrenen Plattenbau. Das Haus bestand aus zwei in Weiß gestrichenen Blöcken, einer hochkant, einer liegend, die wie die Flügel eines Riesenraumschiffes zwischen Grünflächen und dem alten Viertel gestrandet waren. Das Gebäude war nagelneu, und während ich heute eher überlege, welche wilden Pflanzen der Architekt wohl gegessen hatte, bevor er seinen Entwurf erstellte, empfand ich das Gebäude schon damals als total cool. Das lag auch daran, dass sich auf einer Seite direkt davor ein wirklich gigantischer, zerstrubbelter Park befand, in dem Hunderte Kaninchen und gefühlt Millionen von Vögeln lebten. Für uns Kinder war es das Paradies. Wir brauchten zu jeder Jahreszeit nur aus der Haustür des weißen Raumschiffes rauszugehen und standen mitten in der Natur, unter immer höher wachsenden Bäumen, Büschen und umgeben von hoppelnden und besonders in der Dämmerung tirilierenden Tieren. Ich habe solche fantastischen Konzerte später nur noch im Urwald gehört, allerdings von Zikaden und anderen Insekten. Die Zeit der Vögel neigt sich nun weltweit langsam dem Ende zu.
In unserem Wohnraumschiff sah es überhaupt nicht futuristisch aus. Pragmatisch, wie meine Eltern waren, richteten sie die Wohnung durch und durch funktional ein: mit vernünftigen Schränken und Regalen, einer zeitlosen Couch im Wohnzimmer und einem Küchen-Esstisch, an dem man auch Karten spielen und elektrische Bauteile zusammenlöten konnte. Bei uns war alles durchstrukturiert. Mein Bruder und ich hatten eigene Zimmer, aber meins hatte ein Klappbett, das tagsüber eingeklappt werden musste, damit ich dort arbeiten und experimentieren konnte. Das empfand ich nicht als Nachteil, sondern als lässig – wer braucht tagsüber schon ein Bett? Auch mein Extra-Schreibtisch, den mir mein Vater für chemische Versuche gebaut hatte, war klappbar. Ich habe wohl ein bisschen zu viel Zeit an diesen Tischen verbracht, denn von meiner früheren Lese- und Arbeitsposition mit dem linken, aufgestützten Arm ist mir ein dauerhaft überstehender Schlüsselbeinknochen geblieben. Doch das war es wert!
Die Strukturliebe meiner Eltern hatte ich schnell verinnerlicht. Vor allem meine Mutter ist hier – es fühlt sich schon fast genetisch an – verantwortlich für eine Vorliebe, die mir inzwischen bei meinem Beruf gewaltig hilft. Sie arbeitete in einem Büro und kümmerte sich dort um die gesamte Organisation, von der Korrespondenz bis zu Umbauten. Sie brachte mir bei, dass alles, was eine Schreibmaschine verlässt, auf Punkt und Komma richtig geschrieben sein muss. So war es nur folgerichtig, dass ich bei meinen ersten Versuchen, unsere Sprache auch schriftlich zu beherrschen, sämtliche Rechtschreib- und Kommaregeln von ihr gleich mitlernte. Sie hatte sich sogar eine von mir sehr bewunderte Liste erstellt, in der häufige Schreib-Hürden übersichtlich aufgelistet waren. Der Nachteil daran ist, dass ich die neuen, seit einigen Jahren gültigen Komma- und Kleinschreibregeln immer noch nicht kenne.
Auch sonst konnte und kann ich noch immer Einiges wirklich ganz, ganz schlecht: Singen zum Beispiel, Malen, Tanzen oder jede Art von Sport. Dinge, die mit Reden, Schreiben und dem Zusammensuchen und Ordnen von Wissen zu tun haben, finde ich hingegen spitze.
Ich sortiere schon immer gerne. Selbst meine Comic-Hefte, deren Bestand immer größer wurde, habe ich bis heute nach Themen – hier: den Helden und Welten, in denen sie spielen – geordnet. Dass so etwas komisch wirken kann, habe ich erst als Erwachsener erfahren. Ich war natürlich auch leidenschaftlicher Yps-Fan, auch wenn das »Gimmick«, wie die wöchentliche Beilage hieß, manchmal nicht funktionierte. Totaler Quatsch war die Druckmaschine, für die man eine Moosgummi-Einlage als Ersatzteil benötigte, die aber niemand in Zollstock besorgen konnte. Selbst der Besitzer des damals noch bestehenden Spielwarenladens in unserem Viertel hatte Fragezeichen in den Augen, als der Junge mit dem gestreiften Hemd (die fand ich zeitweise besser als Karo-Hemden) und den zur Seite gegelten Haaren mit großem Ernst nach Moosgummi fragte. Der Windgeschwindigkeitsmesser fürs Fahrrad funktionierte auch von Anfang an nicht: Die Einzelteile waren unsauber gegossen und verkanteten sich sofort. Grrrr! Dabei hatte ich bestenfalls Geld für drei Hefte pro Monat, sodass ich mich natürlich umso mehr über solche Fails ärgerte.
Aber von vielen dieser »Gimmicks« lernte man wirklich etwas: beispielsweise beim Solarzeppelin, der bis in 50 Meter Höhe aufstieg, wenn man ihn in die Sonne legte, und der sich gleichsam von selbst aufblies. Ich habe ihn zwar nicht gekauft, aber das Prinzip hat mir später geholfen, die veränderte Entwicklung der Tiere und Bakterien in schwarzen Leichensäcken zu verstehen: Sie heizen sich stark auf und zersetzen das Gewebe dann entsprechend schneller. Auch die bekannten »Urzeitkrebse«, die eigentlich Salinenkrebse sind und als Zierfischfutter verkauft wurden, beeindruckten mich wegen ihrer Widerstandsfähigkeit: Immerhin konnten ihre Eier in trockener und sauerstoffarmer Umgebung mehrere Jahre – angeblich sogar Jahrtausende – überstehen, bevor wir Yps-Leser sie ins Wasser schütteten und die Tiere schlüpfen ließen. Als die Zeitschrift dann vor ein paar Jahren noch einmal für große Jungs wie mich erschien, durfte ich sogar im Heft ein Interview geben. Das hat mich wirklich unglaublich gefreut.
Ansonsten stand ich auf Clever & Smart, Super-Meier, die Provi-Star, Die Fantastischen Vier und das meiste an Marvel-Zeugs – allen voran natürlich Spider-Man, den ich bis heute verehre. Aber dazu später mehr!
Noch heute sortiere ich meine Comics, Bücher, Zeitschriften, Bildbände und natürlich die Akten nach einem sauberen System, um genau zu wissen, wo ich hineingreifen muss, wenn ich etwas nachschlage. Und ich habe echt viele Comics und Akten. Das sagen zumindest manche Gäste, die mich immer fragen »ob ich das alles gelesen habe«. Bis auf die Lexika: Ja, logo. Da ich keine Romane lese, mit Ausnahme von Sherlock Homes, stehen meine Bücher einfach nur lange oder für immer im Regal. Mehr ist es gar nicht.
Ich fühlte mich wohl in Köln, aber womöglich hielt meine Psyche dem Umzug und den sich daraus ergebenden Veränderungen dann doch nicht ganz stand. Vielleicht war aber auch nur der Feinstaub – damals noch Smog genannt – ein zu großer Schock für meine Lungen, die bislang nur die saubere Heufeldmühler Luft gewohnt waren. Auf alle Fälle bekam ich einige Zeit, nachdem wir Bayern verlassen hatten, einen elenden Husten, der nicht mehr wegging. Also schickten mich meine Eltern zur Kur zurück dorthin, wo man besser durchatmen konnte als zwischen Pohligstraße und Kalscheurer Weg: nach Berchtesgaden. Wobei Kur eigentlich der falsche Begriff war, denn in dem Wort steckt ja der lateinische Begriff für Fürsorge. Doch die beiden Aufenthalte, die ich dort absolvieren musste, waren nur so mittelschick.
Das Gebäude lag außerhalb von Berchtesgaden und war, vielleicht als ehemaliges Kloster, zum Kinderkurheim umfunktioniert worden. Nonnen waren die Chefinnen, geschlafen wurde in Schlafsälen, die den Gemütlichkeitsfaktor eines Lazarettes hatten. Soweit ich mich erinnere, war es dort kahl und kalt, und zu allem Übel waren die Gottesfrauen nicht so herzlich, wie man sich Nonnen so vorstellt, sondern echt streng. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie anstrengend ich für sie war. Sie hatten jedenfalls keine erkennbare Ahnung von Kinderseelen. Ich kann mich nur an Spaziergänge erinnern und daran, dass wir, wenn wir nicht brav waren, die Post unserer Eltern nicht erhielten. Einmal durfte ich auch im Vorraum der Toilette schlafen, weil ich offenbar eine große Klappe gehabt hatte. Diese unpädagogische Maßnahme war mir später noch nützlich, wenn ich beispielsweise schnarchenden Menschen ausweichen und meine Ruhe haben wollte. Ich mag keine Atemgeräusche …
In den Kuren schauten meine bayerischen Großeltern mal vorbei, und ich hatte auch einen Kumpel gefunden, mit dem ich mich anfreundete. Auch der damals bekannte Bergsteiger Luis Trenker (s. Bild am Ende des Kapitels) besuchte uns Kinder. Wir kannten ihn zwar nicht und wussten nur, dass es ein aus unserer Sicht alter Mann war, der sich in den Bergen auskannte. Er brachte uns den besten Knoten zum Schuhezubinden bei, den es gibt. Ich verwende den Luis-Trenker-Knoten noch heute jeden Morgen und habe ihn auch schon oft anderen gezeigt.
In eine der Kuren hatte mir meine Mutter als Bettlektüre einen großartigen Disney-Comicband als Überraschung mitgegeben. Als ich meinen Koffer auspackte, lag das querformatige Buch mit Donald-Duck-Geschichten von Carl Barks und Mickey-Mouse-Strips von Floyd Gottfredson obenauf. In diesen klassischen Geschichten tauchten neben Donald und der damals noch lässigen Mickey Mouse auch Flederohr, Hauptmann Setter a.k.a. Käpt’n Dobermann und Madame Triple-X auf. Die Einzelbilder waren auf die ungewöhnlich breiten Seiten ummontiert und das Buch mit einer Einleitung zur Formveränderung der Disney-Figuren über die letzten Jahrzehnte versehen. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen mir und den Bewohnern von Entenhausen. Zum Glück hat mich meine Buchbinderin lieb und fand es nicht seltsam, dass ich es vor einigen Jahren bei ihr restaurieren ließ.
Ich weiß nicht, ob die beiden Kuren meine spätere Fähigkeit ausprägten, sogar an höchst ungewöhnlichen Orten die Gegebenheiten hinzunehmen (rheinisches Grundgesetz: »Et is wie et is«) und zur Not halt das zu tun, was zu tun ist. Aber ich habe bei meinen Dienstreisen rund um die Welt an Orten einwandfrei geschlafen, gegen die mein Klosterschlafsaal wie ein gutes Hotelzimmer ausgesehen hätte, und mich nie darüber beschwert. Das hätte auch nichts gebracht, wenn irgendwo in Berlin oder Bogotá nichts anderes vorhanden war als eine alte Matratze auf dem nackten Fußboden. Dann legte ich mich eben darauf. Bis heute kann ich auch auf jedem Teppichboden schlafen, wenn der Untergrund nicht zu kalt ist. Vor ein paar Jahren habe ich sogar mal monatelang auf einem Feldbett geschlafen. Heutzutage habe ich immer eine Flasche Isopropanol dabei – damit kann man notfalls alle Oberflächen keimarm sprühen.
Was ich in Berchtesgaden auch noch lernte: wie man richtig fotografiert. Meine Eltern hatten mir eine Agfamatic-Pocketkamera mitgegeben, die wir »Ritsch-Ratsch-Klick-Klack« nannten. »Ritsch-Ratsch-Klick« – das »Klack« hatten wir dazuerfunden – hörte sich zwar lustig an. Die benötigten Pocket-Film-Kassetten zum Einlegen waren aber für mich sehr teuer. So überlegte ich mir genau, was ich fotografieren wollte, bevor ich auf den orangefarbenen, weichen Auslöser des flachen Metallgeräts drückte. Und schon hatte ich aus einer Einschränkung heraus erneut etwas gelernt: Verschwende nichts!
Zurück in Zollstock verlief unser Leben entspannt. Nur der Husten begleitete mich trotz – oder vielleicht auch wegen – der Kuren noch ein paar Jahre. Meine Eltern waren liebevoll, konsequent und freuten sich, wenn mein Bruder und ich mal vor die Türe gingen.
Mein biologischer Vater hatte mir ein Plastik-Mikroskop geschickt, vermutlich, nachdem er von meiner Mutter einen Hinweis bekommen hatte, was seinen Sohn im fernen Köln den ganzen Tag so beschäftigte. In dem Biologie- und Geologie-Starter-Set befand sich auch eine Packung mit Pflanzensamen, deren Feinstruktur ich prima vergrößern konnte. Mich interessierten auch die verlorenen Federn unseres Wellensittichs »Puckiline«. Deren Verästelungen sahen in fünfzigfacher Vergrößerung trotz grauenvoller Mikroskop-Linsen natürlich verdammt spannend aus. Zum Glück gab es ein sehr gutes Begleitbuch im Mikroskop-Kasten, in dem auch beschrieben wurde, wie man Schneeflocken in Lack fangen, Staubteilchen auf Tesafilm zählen und Vogelfedern dauerhaft »einbetten«, also auf einem Objektträger mit Deckplättchen versiegeln kann. Da das Buch liebevoll gemacht und vor allem detailliert war, habe ich das gleiche später auch bei meinem Forensik-Kasten für heutige Kinder umgesetzt: gutes Begleitheft und – das war für den Verlag neu – eine vernünftige Lupe. Dafür habe ich wochenlang gekämpft, und zum Glück fand sich ein Hersteller, der solche Lupen für Kinder liefern konnte. Rand- und Farbverzerrungen nerven eben beim Vergrößern.
Als wir etwas älter wurden, spielten wir gelegentlich zusammen mit den anderen Kindern aus dem Betonraumschiff Rollhockey. Das kam damals in Mode, vielleicht, weil der Eishockeyclub »Kölner Haie« ein paar Jahre zuvor gegründet worden war. Spieler wie Erich Kühnhackl oder Udo Kießling waren sehr bekannt, was ich aber erst beim Stöbern für dieses Buch herausgefunden habe. Ich hatte von Sport keine Ahnung, und das hat sich auch nicht geändert. Unsere Ausrüstung bestand aus flachen Schlägern, Knieschonern und Rollschuhen, von elastischen Hochleistungstextilien keine Spur – die gab es damals wohl auch noch gar nicht. Obwohl wir mitten auf der Straße vor unserem weißen Wohnriegel spielten und nur kurz zur Seite rollten, wenn ein Auto unbedingt an uns vorbeifahren musste, regte sich niemand je über unseren Zeitvertreib auf. Im Gegenteil. Als mal eine gigantische Pfütze entstand, weil der Gully verstopft war und es in Strömen geregnet hatte, brachte uns die Mutter eines Nachbarn bloß ein paar Regensachen runter, und wir plantschten im knöchelhohen See herum. Der sportliche Ehrgeiz hielt sich dabei erkennbar in engen Grenzen.
In unserem Wohnzimmer gab es natürlich einen Fernseher. Dort liefen nachmittags Dick und Doof, Western von gestern oder irgendetwas von Walt Disney – es gab ja nur die drei Sender ARD, ZDF und WDR. Das ging meist genau so lange gut, bis unser Vater nach Hause kam und verständlicherweise etwas Ruhe wünschte. Abends schauten wir gemeinsam das, was allen gefiel: Wetten, dass …, Auf los geht’s los, Dalli Dalli und dergleichen – wie Millionen anderer Familien damals auch.
Urlaub machten wir in Spanien, wo ich meinen Comicbestand des Öfteren erweitern konnte. Ich verstand zwar nichts, aber die Zeichnungen waren wie bei Floyd Gottfredson (Mickey Mouse) oder Carl Barks (Donald Duck) hin und wieder klar von Könnern gemacht. Dort entdeckte ich beispielsweise The Phantom von Lee Falk sowie Will Eisners Spirit. Will Eisner, einen der besten Geschichten-Erzähler überhaupt, traf ich in den neunziger Jahren auf dem Comic-Salon in Erlangen. Sein von ihm auf der Comic-Messe mit Widmung unterschriebener Comic wird noch im Altersheim neben mir stehen.
Öfter besuchten wir auch Opa und Oma in Bayern und verbrachten dort ein bisschen Zeit an der frischen Luft. Wir lebten in einer ziemlich heilen Welt. Dazu passte, dass mein Bruder und ich wie fast alle Kinder Blockflöte lernten. Das war allerdings ein bisschen zu heile für unseren Geschmack und so ließen wir es schleifen.
Meine Eltern achteten darauf, dass mein Bruder und ich von Bildern verschont wurden, die sie als unangemessen für Kinder ansahen. Das betraf zum einen die damals sehr bekannte Musik- und Jugendzeitschrift Bravo, die wir ab einem gewissen Alter zwar lesen durften – aber nur die Teile ohne sexuelle Erklärungstexte, die vom »Dr.-Sommer-Team« stammten. Gleiches galt für zu ausdrückliche Foto-Love-Storys, die unsere Mutter vorsichtshalber aus den Heften entfernte, bevor wir sie von den Nachbarn erhielten. Auch Sendungen wie Aktenzeichen XY