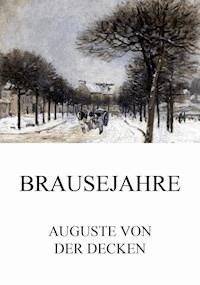
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Roman "Brausejahre" erzählt die Autorin Bilder aus Weimars Blütezeit. Nicht nur der Dichterfürst Goethe spielt darin eine Rolle ....
Das E-Book Brausejahre wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brausejahre
Auguste von der Decken
Inhalt:
Auguste von der Decken – Biografie und Bibliografie
Brausejahre
Brausejahre, A. von der Decken
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849638214
www.jazzybee-verlag.de
Auguste von der Decken – Biografie und Bibliografie
Brausejahre
Bilder aus Weimars Blütezeit
Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder.Goethe, "Tasso".
Anfangs ist es ein Punkt, der leise zum Kreise sich öffnet, Aber wachsend umfaßt dieser am Ende die Welt.Hebbel über Goethe.
"Er ist da, Christel! er ist da!" rief ein frisches hübsches Mädchen, indem es rasch die Tür eines Kämmerchens aufstieß und mehr springend als gehend eintrat.
In dem kleinen Schlafzimmer herrschte noch Dämmerung; das halbe Licht eines Novembermorgens vermochte nicht viel Helle zu verbreiten; man erkannte kaum ein einfaches, weißumhangenes Bett und einige binsenbeflochtene Stühle.
"Aber wie finster ist es noch bei dir, Langschläferin!" fuhr die Eintretende fort; ging an das Fenster, schlug die Vorhänge zurück, betrachtete fröstelnd den ersten langsam herabflatternden Schnee und trat an das Bett. Eine jugendliche Mädchengestalt richtete sich eben halb empor, öffnete groß die Augen und sagte: "Wie früh kommst du, Gustchen, eben graut der Tag, Tante Barbara hat noch nicht angeklopft."
Auguste von Kalb, die Besuchende, zog einen Stuhl an die Bettkante, setzte sich und ergriff die kleine weiße Hand der Freundin.
Die beiden jungen Mädchen waren sehr verschieden; so frisch, üppig, brünett und lebhaft Gustchen Kalb erschien, so zart, blond und sanft war Christel Laßberg; ihre blauen Augen schimmerten halbversteckt unter schweren Lidern und langen gekräuselten Wimpern; das weiche Oval des Gesichtes, die ruhige Unbeweglichkeit der mattgefärbten Züge, bildeten einen Gegensatz zu der lachenden, beweglichen Erscheinung der anderen.
Die frühe Morgenstunde hatte Auguste nicht verhindert, sich festlich zu kleiden, und der weiße Musselinanzug, nach der Mode des Jahres 1775 mit Falbeln ausgeputzt, sowie ein durch die schwarzen, leichtgepuderten Locken geschlungenes gelbes Band stimmten vortrefflich zu dem Rot der bräunlichen Wangen.
"Ich habe dir unendlich viel zu erzählen!" sagte sie hastig, mit den Fingern der Freundin spielend.
"Gestern nachmittag, nachdem du fortgegangen warst, kam ein Expresser von meinem Bruder, der meldete, daß er und sein Gast die Nacht durchfahren und heute früh bei uns ankommen würden."
"Ach! heute?" sagte Christel, indem sie sich etwas mehr aufrichtete.
"Ja, ja! und sie sind da! Aber höre mich ruhig an, denn ich muß dir von einer sehr wichtigen Unterredung mit Papa erzählen. Kaum war des Boten Brief eine halbe Stunde in Papas Händen, so ließ er mich rufen. Als ich eintrat, sah ich, daß die Eltern augenscheinlich eine wichtige Besprechung gehabt hatten. Frau Mama saß auf dem Thron am Fenster, und Herr Papa ging in seinem gelbblumigen Hausrock im Zimmer umher und ruckte so arg mit dem Kopfe, daß der Haarbeutel bald über dem rechten, bald über dem linken Ohr erschien, und das hat immer etwas zu bedeuten. Ich stand und machte meinen Knicks, küßte Papa die Hand und fragte, was er befehle?
"Er räusperte sich, ja er klopfte mir die Wange, Mama wurde rot und bückte sich über ihre Filetarbeit, endlich sagte er: ›Gusta, mein Kind, dein Bruder kommt zurück und wird einen Gast mitbringen, den Freund Seiner Durchlaucht unseres allergnädigsten Herzogs, daher ist es eine Ehre für uns, ihn zu empfangen; man muß ihm das Haus angenehm machen, hörst du, Gusta! Jugend gesellt sich gern zur Jugend, dir wird es also dann und wann obliegen, den jungen Mann zu unterhalten.‹ – Mein Herz klopfte vor Vergnügen bei diesem Auftrage! – ›Nun aber erheischt es meine Vaterpflicht dich zu warnen; dieser Doktor Wolfgang Goethe soll ein wilder, unbändiger Jüngling sein, absonderlich gefährlich für jedes wohlgebildete Frauenzimmer; hüte dich also, nicht zu denen zu gehören, von welchen er in Büchern schreiben kann! Hüte dich auch, einen Gedanken an die Möglichkeit ehelichen Bündnisses aufkommen zu lassen; denn obgleich er der erwählte Freund unseres Herrn Herzogs Durchlaucht sein soll, ist er nur ein Frankfurter Bürgerssohn und die Verbindung mit einem solchen für ein adliges Fräulein nimmermehr zulässig.‹
"Ich schwieg ergeben lauschend, der Papa fuhr, das Haupt bedächtig wiegend, fort: ›Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird dieser Herr Wolfgang Goethe für die nächste Zeit der einflußreiche Freund Seiner Durchlaucht werden. Als unser gnädigster Fürst im Winter mit dem Prinzen Konstantin und Herrn von Knebel in Paris war, besuchten sie auf der Durchreise den jungen Goethe in Frankfurt. Nachher trafen sie sich wieder in Mainz, und ein absonderliches Wohlgefallen an dem Doktor bestimmte unseren Herrn Herzog, ihn zu sich einzuladen; mein Sohn wurde jetzt beauftragt, ihn abzuholen; man ästimiert ihn also auffällig genug; er wird hier sehr in seiner Assiette sein –‹
"Papa räusperte sich: ›Ich bin ein alter Mann,‹ fuhr er in kläglichem Tone fort, ›meine Amtspflichten werden mir täglich lästiger, die Art und Weise der jetzigen Regierung stimmt nicht mehr zu mir, ich sehe mich nach einem Nachfolger um! Aber es ist mir nicht gleichgültig, wer meinen Platz einnimmt; das Glück des Landes hängt von der würdigen Besetzung dieses hohen Postens ab, meine Pflicht ist es, dem Herrn Herzoge einen tüchtigen Mann vorzuschlagen. Dein Bruder ist bereits Kammerjunker und hat mich in meinen Geschäften oftmals unterstützt, in seine Hände möchte ich mein Amt niederlegen. Dieser Wunsch muß mit Delikatesse behandelt werden; du, Gusta, bist aber vielleicht im stande, durch den Günstling für deinen Bruder zu wirken; man darf kein Mittel gering achten, das Familienwohl zu fördern! Politesse also, mein Kind, Zuvorkommenheit, aber in den angedeuteten Grenzen!‹
"Ich verneigte mich mit einem: ›Wie der Herr Papa befiehlt!‹ und verließ nach seinem Winke das Zimmer.
"Was sie von mir wollen, sehe ich klar genug, Christel, der Speck soll ich sein, um für den Bruder die Maus zu fangen; ich soll seinetwegen mit Doktor Goethe liebäugeln, bah! ich weiß, was ich will, und werde mein eigenes Vergnügen bedenken: ist er schön, gefällt er mir, wie sein ›Werther‹, so gehorche ich, wie weit, das ist meine Sache.
"Ich schaute, als ich die Treppe hinanstieg, ins Gastzimmer, da war alles auf das beste hergerichtet; ein Wachslicht auf dem Leuchter und zwei Flaschen Wein, wenn sie in der Nacht kämen. Als ich an das Fenster trat und in den Hof hinaussah, bemerkte ich, daß man sehr gut in mein Stübchen im Seitenflügel blicken könne; also kann ich auch sein Fenster übersehen. Und nun rate, Christelchen, warum ich nicht gleich herumkam, um dir alles zu erzählen; rate, was ich Wichtiges zu beschaffen hatte?"
Das stille blonde Mädchen lächelte. "Nun?" fragte sie entgegen ohne sonderlichen Eifer.
Auguste ertrug die Ruhe der Freundin schwer.
"Raten wirst du es doch nicht, du harmlose Taube!" rief sie, "so wisse denn: ich kramte mein Zimmer um! Vor das bewußte Fenster trug ich mein Nähtischchen, auch das Spinnrad, Stuhl und Bank; ich schürzte die Vorhänge etwas höher, rieb die Scheiben klar und ersah mir eine Ecke, von der aus ich auch ungesehen hinüberspähen konnte; dann nahm ich ›Werthers Leiden‹, sein himmlisches Buch, bei dem wir so oft süße Tränen weinten, und setzte mich, in Vorgefühlen schwelgend, auf den neuen Platz.
"Daß ich in dieser Nacht, da er jeden Augenblick ankommen konnte, nur halb schlief, wirst du begreifen! Endlich, als kaum der Tag graut, tönt ein Posthorn, ich höre das Knarren der schweren Haustür, des Bruders Stimme auf dem Korridor, Türen werden geschlagen, Koffer werden die Treppe heraufgeschleift. Bebend vor Kälte und Erwartung stürze ich im Dunkeln ans Fenster – da wird drüben das Zimmer hell – man hat Licht angezündet." –
"Und du hast ihn gesehen?" rief Christel sich rasch aufrichtend und mit flüchtigem Rot übergossen.
"Zwei Schatten habe ich gesehen, welche sich die Hände schüttelten, dann ging mein Bruder hinaus und die Treppe hinab nach seinem Zimmer; und nun kommt das beste: er trat an das Fenster und sah sich um; aber das Licht stand hinter ihm, ich gewahrte nur eine Silhouette und auch die nur kurze Zeit und undeutlich; aber getrost, heute werde ich ihn genau sehen! Christel, begreifst du meine Freude? Mit ihm, dem Dichter des Werther, unter einem Dache!"
Es war schwer zu sagen, ob Christel begriff oder nicht; sie hatte die Arme über den Kopf gelegt und die großen blauen Augen mit träumerischem Ausdruck hinauf in die Falten des weißen Bettumhangs gerichtet. Als sie die Antwort schuldig blieb, wurde Auguste ungeduldig.
"Du bist stumm wie ein Fisch!" rief sie, "warum sitze ich noch hier? Vielleicht kann ich ihn am Fenster sehen, es ist hell genug! Adieu, mein kleiner Fisch, mein Goldfisch!" fügte sie tändelnd hinzu, indem sie eine gelbblonde Locke der Freundin um den Finger rollte, rasch Christels weiße Stirn küßte, und ebenso lebhaft, wie sie gekommen war, aus dem Zimmer eilte.
Die Zurückbleibende machte keinen Versuch, ihren munteren Gast länger festzuhalten; unbeweglich lag sie da, wie geistesabwesend. Dieser seltsame Zustand hatte sich in ihrer Kindheit oft bis zur Erstarrung gesteigert; jetzt überfiel er sie mehr wie waches Träumen; Fühlen und Denken flossen ineinander. Ein süßes unklares Schauen, dem sie sich nicht entreißen mochte, trug sie weit über alle Wirklichkeit hinaus, bis sie, gewaltsam aufgerüttelt, oder durch zufälliges Geräusch geweckt, wieder zu sich kam und verwundert, manchmal weinend um sich blickte.
Christine von Laßberg war die einzige Tochter des weimarischen Obersten Maximilian von Laßberg. Ihre Mutter, eine Schwedin, war bei der Geburt dieses jüngsten Kindes gestorben. Ihre Brüder, bedeutend älter als sie, hatten sobald als möglich das Haus verlassen. Der alte Oberst war als einer der tyrannischsten Hausväter bekannt und deshalb fühlten sich die Kinder nicht wohl in der Heimat.
Nach dem Tode seiner leidenschaftlich geliebten Frau nahm er seine unverheiratete Schwester, Tante Barbara, in das Haus, eine vortreffliche alte Dame, welche mit der zärtlichsten Sorgfalt die schwache kleine Nichte aufzog. Anfänglich wollte der Oberst nichts von dem Töchterchen wissen; er hatte einen eigensinnigen Grimm auf das blasse Kind geworfen; nach und nach aber, als er bemerkte, wie ähnlich Christine ihrer schönen blonden Mutter wurde, gewann er Teilnahme, ja eine stolze Freude an dem Mädchen. Sie war jetzt siebzehn Jahre alt und ohne alle Beschränkung aufgewachsen. Weder Vater noch Tante hinderten sie in ihren Neigungen, und harmlos genug waren dieselben; zu verbieten wäre ihr selten etwas gewesen, eher zu gebieten, denn in ihrem ganzen Wesen lag eine schlaffe träumende Tatlosigkeit.
In dem alten Hause des Obersten war eine schattige, weinumrankte Gartenstube, vor der ein immerfließender Brunnen plätscherte, und in einem klaren Rinnsal durch den Garten ablief; auf den steinernen Stufen dieses Brunnens, oder in einer dämmernden Ecke unter Weinblättern saß das Kind ganze Tage lang. Mit zufriedenem Lächeln um den lieblichen Mund, schaute es hinauf in die flüsternden Blätter, oder verfolgte das fortrinnende Wasser.
Talente zeigten sich gar nicht bei der Kleinen, sie lernte schwer und wenig; selbst die gebräuchlichen weiblichen Handarbeiten waren ihr zuwider. Und doch war das Mädchen nicht einfältig. Es besaß ein reges, ja ein mutiges Rechtsgefühl, und trat nicht selten als Vermittlerin zwischen dem herrischen Vater und den Brüdern auf. Mit lebhafter Phantasie erging es sich in langen Gesprächen zwischen den Vögeln, dem Brunnen, dem Weinstock und der Puppe, so daß Tante Barbara, ja der Vater selbst oft mit stillem Entzücken lauschten.
Ihre Freundschaft mit Auguste von Kalb war mehr durch die Verhältnisse als aus Übereinstimmung entstanden. Die Häuser der Eltern lagen nebeneinander, ebenso die Gärten, letztere nur durch eine Stachelbeerhecke getrennt, in der das unbändige Gustchen, stets die Besuchende, manches Stück ihrer Kleidung hängen ließ. Sowohl der alte Kammerpräsident wie der Oberst waren zu hochmütig oder eigensinnig gewesen, eine Verbindungstür herstellen zu lassen. Sie waren Leute der alten Zeit; sie lebten in ihren abgesonderten engen Schneckenhäusern, aus denen sie kaum hervorkrochen, um sich an einem allgemeinen, öffentlichen Interesse zu sonnen. Die Nachbarschaft hatte dazu gedient, eine gewisse Spannung zwischen den beiden Häusern zu bilden, die ihren Grund in einem ähnlichen Streben und ihre Nahrung in gehässigen Beobachtungen gefunden hatte. Der Kammerpräsident von Kalb war Exzellenz und gründete darauf Ansprüche, welche dem alten, derben Haudegen Laßberg übertrieben vorkamen. Den Kalbs schien alles zu gelingen, während es bei Laßberg vielen Kummer und Verdruß gegeben hatte. Seine Frau war früh gestorben, seine Söhne hatten in Unfrieden das Haus verlassen; die Kalbschen Söhne dagegen waren gut untergebracht; der jüngere, als Kammerjunker beim Weimarschen Hof angestellt, hatte sich vor drei Jahren mit einer reichen Frau vermählt.
Wo man vergleicht, ist der Neid nicht fern; die beiden Herren waren echte Vergleichsbrüder; sie konnten eine Schar vom Glück begünstigter Leute unbeneidet vorübergehen sehen, sowie aber dann einem von ihnen Gutes geschah, wurde der andere verdrießlich. Bei dem alten, zeitweise unbeschäftigten Laßberg hatte sich nachgerade eine bittere Stimmung festgesetzt, die in schlimmen Stunden den Groll über das Schicksal auf den Nachbar übertrug.
Am 3. September dieses Jahres 1775 war die Mündigkeitserklärung des neunzehnjährigen Herzogs Karl August erfolgt. Die Herzogin-Mutter hatte ihm freudig die Geschäfte der Regierung übergeben, sich selbst in das Privatleben zurückziehend. Ihr Einfluß auf den Sohn und ihre Sorge für denselben blieben aber unablässig rege. Sie glaubte den kräftigen, unbändigen Jüngling am leichtesten durch eine Heirat zu zähmen, und vermochte ihn, sich am 3. Oktober mit der reizenden Landgräfin Luise von Hessen-Darmstadt zu vermählen. Das junge Paar war seit vier Wochen in Weimar, und der Hofstaat für dasselbe eingerichtet.
Anna Amalie hatte ihrer Schwiegertochter zwei junge, schöne Hofdamen abgetreten, die anmutige, neckische Adelaide von Waldner und die verständige Henriette von Wöllwarth; sie selbst war vorderhand ohne Gesellschaftsfräulein. Diese Stellung bei der allverehrten Herzogin wünschte Laßberg für seine Tochter.
Zufällig hatte Anna Amalia sich tadelnd gegen ihn über Auguste Kalb ausgesprochen – und der Oberst die Gelegenheit ergriffen, nach einem väterlich bescheidenen Lobe der Tochter, Christel als Hofdame zu empfehlen. Er wagte sich offen mit seinen Wünschen hervor, da er jetzt wußte, daß "die gefallsüchtige Kalb" nicht vorgezogen werden würde.
Die Herzogin hatte sich unbestimmt geäußert, Laßberg sah, daß alles auf einen persönlichen Eindruck, den die Tochter mache, ankomme, und erbat sich die Ehre, sein Kind auf dem nächsten Balle der hohen Frau vorzuführen. Anna Amalie bewilligte diesen Wunsch freundlich. Seitdem gab es keinen anderen Gedanken, kein anderes Gespräch im Hause des Obersten, als Christels Aussichten, als den Festabend, als die vortreffliche Herzogin und den Putz des jungen Mädchens. Tante Barbara mußte natürlich ihr Pflegekind begleiten; sie war nie so geschäftig, so ängstlich bedacht auf die Mode, so freudig und unruhig zugleich gewesen.
Auch Christel dachte seit dem Morgenbesuch der geschwätzigen Freundin mit unbeschreiblicher Wonne und laut klopfendem Herzen an ihre Aussichten, und diese Gedanken waren es, welche sie in eine so tiefe Träumerei versenkten.
Sie hatte seit einigen Jahren Bertuchs Bilderbuch aus der Hand gelegt und statt dessen mit leidenschaftlich erregten Gefühlen "Götz von Berlichingen" und jetzt "Die Leiden des jungen Werther" gelesen.
Nun kam Er! Der Schöpfer jener Gestalten, für die ihre empfängliche Seele glühte, Er! dessen Ruf schon jetzt die Jugend begeisterte und dem Alter ein bedenkliches, staunendes Kopfschütteln abnötigte, Er! der Freund des Herzogs, Kalbs geehrter Gast, der als "gefährlich" geschilderte Hausgenosse der Freundin. Ein Meer von Gedanken, von Möglichkeiten, Ahnungen und Hoffnungen flutete über sie herab. Sie sollte, sie mußte ihm begegnen, wenn sie vor der Herzogin auf dem Ball erschien.
Ein Viertelstündchen nach Augustes Fortgehen trat Tante Barbara in das kleine Schlafzimmer; sie trug in der Hand eine glänzende Zinnschale, in welcher eine Milchsuppe dampfte; leise hatte sie angeklopft, leise nahte sie dem Bette ihres Lieblings.
Christel lag mit offenen Augen; bei dem Nahen der mütterlichen Frau kehrte ihr Geist in die Gegenwart zurück, und zärtlich breitete sie die Arme der Kommenden entgegen.
Die Nebel zerreißen, Der Himmel ist helle, Und Aeolus löset Das ängstliche Band. Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiffer. Geschwinde! Geschwinde! Es teilt sich die Welle, Es naht sich die Ferne; Schon seh' ich das Land!Goethe.
Bald nachdem Auguste Kalb von ihrem Besuch im Morgenzwielicht zurückgekehrt war, schritt, vom Fürstenhause über den Markt kommend, ein kräftiger junger Mann dem Hause des Kammerpräsidenten von Kalb zu.
Er war von mittlerer Größe und breitem, knochigem Bau, sein dunkelblondes Haar trug er an den Schläfen in zwei Locken gerollt, nach rückwärts mit einer schwarzen Schleife zusammengebunden. Hell und fest blickte er um sich, und die kräftige Nase, sowie ein energisch geprägter Mund gaben dem Kopfe trotz aller Jugend und aufblitzenden Leidenschaftlichkeit etwas Fertiges, Charaktervolles. Über dem rötlich-violetten Rock mit Stahlknöpfen, der Schoßweste und dem kurzen schwarzen Beinkleide trug er einen weiten dunkelblauen Mantel zum Schutz gegen das Schneestäuben des Novembermorgens. In der Hand hielt der rüstig Zuschreitende eine Hetzpeitsche mit Hirschhorngriff, welche er, dann und wann einen Jagdpfiff ausstoßend, lustig über zwei ihn begleitende Rüden schwang, die allemal mit hohen Sprüngen und kurzem Freudengebell antworteten.
Vor der Einfahrt des Kalbschen Hauses angekommen, blieb er stehen; mit vergnügtem Lächeln sah er den von Straßburg erwarteten Landauer Staatswagen an, in welchem diesen Morgen der Kammerjunker mit dem Gaste gekommen war.
"He, Philipp!" rief der Nahende, "bist du auch mit da? Das ist schön, was macht dein Herr?"
Die am Wagen beschäftigten Leute traten respektvoll zur Seite, der angeredete junge Diener kam mit dem Hut in der Hand heran.
"Ja, ja, glücklich angelangt, Durchlaucht!" sagte er schmunzelnd. "Soll ich meinen Herrn Doktor holen? Er ist oben im Gastzimmer."
"Laß nur, Philipp!" rief der Herzog Karl August, denn er war's, und die breite Treppe hinanspringend, öffnete er die Tür des ihm bezeichneten Gastzimmers und stürmte hinein.
Goethe trat ihm entgegen, leuchtende Freude im Antlitz – aber so groß war der Adel dieser Erscheinung, so herrlich die blühende Schönheit dieses Auserwählten unter den Menschen, daß der Herzog einen Augenblick wie gebannt stehen blieb, in Anschauen verloren.
Dann stürzte er auf ihn zu, ihn leidenschaftlich umarmend und einmal über das andere jubelnd: "Bist du da? Habe ich dich endlich in Weimar, mein Wolf! Mein einziger Freund!"
"Mein teurer gnädiger Herr!" entgegnete der andere, "Sie kommen zu mir? Kalb versprach mir, mich zu Ihnen zu führen."
"Glaubst du, ich hätte darauf warten können, Herzensbruder? Gestern erhielt ich durch den Boten die Kunde deines Kommens, heute laufe ich natürlich selbst her, um zu sehen, ob du wirklich da bist. Wie wohl wird mir bei deinem Anblick! Ich atme auf, und Pläne freudigen Lebensgenusses strömen mir zu. Ach, ich habe zu viel Hofluft ertragen müssen!"
"Ich glaubte, Eure Durchlaucht hätten über den Wonnen des Honigmondes alles andere vergessen?"
"Vergessen, wohl gar dich? Bleibe mir damit und mit deiner Durchlaucht vom Halse! Weißt du nicht mehr, daß wir Brüder sein wollten? Denkst du nicht mehr an den göttlichen Abend in Frankfurt? Leute, welche per Durchlaucht reden und mir Reverenzen schneiden, habe ich genug. Mich verlangt nach einem Genossen, einem Vertrauten, der nicht unter mir, nach einem Freunde, der neben mir steht, von dem ich gewinnen mag an Lebensfreude und" – setzte er plötzlich ernst hinzu – "an Weisheit!"
"Mein Fürst!"
"Still! Sag Karl, oder ich verlasse dich und gebe dir eine Audienz im Kreise meiner stirnfaltenden Räte."
"Nun denn, Karl, warum der Spott: von mir Weisheit lernen zu wollen? Von mir, den man einen Ausbund jugendlicher Torheiten, einen Tollkopf, einen Schwärmer nennt!"
"In deiner Tollheit, deiner Schwärmerei liegt Weisheit; die große Weisheit der Wahrheit und Naturwärme, die ich oft mit Diogenes' Laterne suche und nicht finde."
"Wie! Du vermissest Wahrheit und Wärme? Sei gerecht, Karl, ein Wort nur, einen Namen halte ich dir entgegen – Luise!"
Eine flüchtige Röte streifte die Stirn des Herzogs, und leise seufzend entgegnete er: "Der Name sagt viel. Aber diese erste Stunde sei dem freudigen Willkommen geweiht! Reiche mir das Glas, schenk ein: ein Freudengruß deinem Hiersein!"
Die Gläser klangen, sie schüttelten einander die Hände, und wie ein Willkommengruß von oben teilte plötzlich die Sonne Schneewolken und Morgennebel, glitzerte auf den letzten Flocken, die wie seines Silber in der Luft tanzten, und strahlte warm in das Zimmer und über die freudig bewegten Jünglinge.
Karl August ergriff zuerst wieder das Wort: "Es verdrießt mich, daß ich dich nicht bei mir aufnehmen kann. Du weißt, das Schloß ist vor vier Jahren abgebrannt, und wir sitzen mit Sack und Pack im Fürstenhause.
Ganz oben die Kanzlei, meine Gemahlin in der Beletage, unten Damen, Kavaliere, Dienerschaft, was weiß ich, wer alles. Ich habe meinen alten Hofmarschall Witzleben bis zum Verzweifeln gedrückt, daß er mir ein Quartier für dich schaffen soll; er windet sich wie ein Wurm und schwitzt vor Angst und Diensteifer, aber ein resoluter Kehraus wird nicht gehalten; so muß ich meinen Gast bei anderen unterstecken. Ich hoffe aber, du sollst es nicht schlecht haben bei diesen Kalbs; sie sind abhängig von mir, eigennützig und darum windelweich. Der Kammerjunker wird dich wie einen jungen Gott traktiert haben? Aber er weiß auch warum! Dann gibt es hier eine Tochter im Hause –"
Goethe lächelte, und sein feuriges Auge schweifte zum Fenster hinüber; der Herzog fing den Blick auf.
"Ah, das weißt du schon?" rief er. "Gustchen wirft wohl gar Angeln aus, laß sehen!"
Lebhaft sprang er auf, der Freund folgte, und beide spähten vorsichtig durch das Fenster.
Ein gar anmutiges Bild zeigte sich ihnen. Vergoldet vom Sonnenschein, eingerahmt von weißen, bauschenden Vorhängen, neben sich in der Fensterbank ein blühendes feuerrotes Geranium, saß Gustchen Kalb, eine Näherei auf dem Schoße; sie ließ den blitzenden Fingerhut so eifrig auf der Scherenspitze tanzen, als ob es nichts Interessanteres auf der Welt gäbe. Ihre runde Wange brannte, die Augen leuchteten in freudiger Erregung, denn sie hatte eben die lauschenden jungen Männer bemerkt.
"Gut gemacht!" rief Karl August überrascht, "fürwahr ein schönes Bild! Wie wird meinem Dichter? Ich glaube, sein Quartier gefällt ihm schon?"
Goethe zog den Freund vom Fenster zurück. "Das Mädchen ist reizend," sagte er warm, "der erste Eindruck könnte nicht günstiger sein; aber was werde ich unter der schönen Hülle finden?"
Der Herzog lachte und zuckte die Achseln: "Du wirst sehen und – siegen!" rief er mit komischem Pathos; "aber jetzt zu etwas anderem. Ich möchte dich bald einführen, dir's wohnlich bei uns machen; du mußt Menschen und Verhältnisse kennen lernen. Da ist vor allen Dingen meine Mutter. Ich gestehe dir, daß sie eine kleine Pike auf dich hat, weil du gegen unseren alten Wieland deine stachligen Verse losgelassen hast; aber sie ist versöhnlich, alles Große, Edle zieht sie an, steht mit ihrer herrlichen Natur in harmonischer Wechselwirkung. Du wirst sie kennen und verehren lernen, wie ich es tue; zu ihr führe ich dich bald. Meine Frau hast du gesehen –" Karl August stockte.
"Und bewundert!" fügte Goethe hinzu. "Die Herzogin ist die reizendste, anmutigste Dame, die ich kenne."
"Später von ihr!" rief der Herzog ungeduldig, "sehen sollst du sie auch; wen kennst du sonst noch hier? Ah, meinen Exmentor Görtz; der Graf möchte gern Luisens Hofmarschall werden, aber ich habe vorderhand der Schranzen genug. Auch meinen Bruder Konstantin kennst du; er ist und bleibt der weiche, schwärmerische Gemütsmensch, dabei aber eigensinnig und sehr bestimmt für seine achtzehn Jahre. Eine zärtliche Neigung ist auch schon bei ihm eingezogen. Karoline von Ilten heißt seine Schöne, ein sechzehnjähriges blondes Kind, aber doch erwachsen genug, um die Liebe und Aufmerksamkeit des Prinzen mit leidlicher Grazie entgegenzunehmen. Konstantin wohnt mit seinem biederen Knebel, der noch als Hofmeister fungiert, in Tiefurt, kaum eine Stunde von hier. Was möchtest du sonst von Weimar und seinen Menschen wissen, ehe ich dich hinausführe?"
Goethe zögerte.
"Ich sah bei einem Doktor Zimmermann, den ich mit Lavater in Straßburg traf, unter vielen Silhouetten, die wir beurteilten, diejenige einer jungen Frau aus den hiesigen Hofkreisen. Das Gesicht hatte, trotz der Unvollkommenheit des Bildes, einen so entzückenden Ausdruck von Liebe und Güte, daß es sich mir unauslöschlich einprägte; ja, es verfolgte mich, und ich träumte mehrere Nächte nacheinander von dieser Frau. Ein Gesicht, das sanft und zärtlich im Ausdruck die Welt klar sieht, wie sie ist, aber stets durchs Medium der Liebe. Von ihr möchte ich hören, sie kennen lernen!"
"Und wer ist es? Wie heißt sie?" fragte der Herzog gespannt.
"Es ist die Frau des Oberstallmeisters von Stein, geborene von Schardt."
"Wie! Die Stein? Lottchen Schardt?" rief Karl August überrascht.
Goethe erschrak. "Habe ich mich geirrt, verdient sie meine Bewunderung nicht?"
Der Herzog entgegnete ernst: "Sie wird allgemein verehrt; Männer und Weiber nennen sie die bedeutendste Frau unseres Kreises, und gewiß haben sie recht; für mich ist sie zu ruhig und – erschrick nicht, Freund – zu alt! Das ist ein abscheulicher Fehler, der täglich schlimmer wird!"
Goethe lächelte. "Vielleicht findet man doch nur bei einem gewissen Alter reifen, seelischen Reiz. In welchen Verhältnissen lebt die Dame?"
"Die Stein war lange Hofdame meiner Mutter, dann heiratete sie vor jetzt vierzehn Jahren den Oberstallmeister. Drei ihrer Kinder leben, sie muß dreiunddreißig Jahre alt sein; schön war sie wohl nie, aber es fehlt ihr nicht an Anmut. Ihr Wesen hat einen sanften Ernst und eine ganz eigene Offenheit. Gesunder Verstand, Wahrheit und Gefühl sprechen aus jedem ihrer Worte, dabei ist sie graziös und freundlich, von tadellosem Takt und immer gleich an Milde und ruhiger Würde."
"So habe ich sie mir gedacht!" rief der junge Dichter mit vor Freude und Begeisterung strahlenden Blicken. "Ich brenne vor Verlangen, sie zu sehen! Wo kann ich sie finden?"
"Gemach!" rief der Herzog. "Steins sind auf ihrem Gute Kochberg, näher bei Rudolstadt als bei Weimar, kaum in vier oder fünf Stunden zu erreichen. Gegen Weihnachten kommen sie zu uns. Neulich waren sie hier, um Luisen vorgestellt zu werden, da habe ich ihre Rückkehr mit dem Oberstallmeister besprochen; bist du aber gar zu ungeduldig, so will ich in den nächsten Tagen mit dir hinüberreiten. Laß sehen, heute haben wir Dienstag; am Freitag ist der erste Ball im Stadthause, da dürfen wir nicht fehlen; aber am Sonntag können wir frühzeitig zu ihnen reiten. Stein ist immer begierig, mir seine jungen Pferde zu zeigen, dann hast du die Frau allein; gelegentlich hoffe ich auf einen Gegendienst von deiner Seite" – der Herzog hatte die letzten Worte mit einem verlegen schelmischen Ausdruck vorgebracht, welcher Goethe stutzig machte; er wollte eben eine Frage anknüpfen, als die Tür bescheiden geöffnet wurde, und Philipps intelligentes Gesicht hereinschaute.
"Der Kammerjunker von Kalb wünscht meinen Herrn Doktor zu besuchen," sagte er.
Goethe sah den Herzog an. "Soll uns recht sein!" rief derselbe.
Der Kammerjunker trat ein. Er war ein gut aussehender Mann in der Mitte der zwanzig; nicht ganz so feurig und frisch wie die Schwester, sah er ihr doch ähnlich, nur war ihre kecke Selbstgefälligkeit bei ihm hinter schlauer Zurückhaltung versteckt.
Sein Anzug war mit Sorgfalt gewählt, sein Kopf wohl frisiert und gepudert und sein Benehmen so respektvoll wie möglich.
Nachdem er dem Herzog mehrere tiefe Verbeugungen gemacht hatte, welche derselbe mit einem raschen: "Guten Morgen, Kalb!" und kurzem Kopfnicken beantwortete, wandte er sich an den Gast, ihm eine wohlgesetzte Begrüßungsrede des Kammerpräsidenten, seines Vaters, überbringend, welche mit der Bitte schloß, ganz und gar über die Kräfte des Hauses verfügen und bestimmen zu wollen, wen man zum Diner einladen solle.
Er hatte noch nicht ganz geendet, als der Herzog rasch einfiel: "Mich vor allen Dingen! Ich will einmal gemütlich außer dem Hause essen; dann könnt ihr den Hofrat Wieland, meinen freundlichen Hildebrand von Einsiedel, Bertuch, Oberforstmeister von Wedel, Musäus – " Halb mitleidig, halb lachend sah Goethe, wie bei Aufzählung der Namen, welche kein Ende nehmen wollten, das Gesicht des Kammerjunkers immer länger und betretener wurde; er fiel also dem Herzoge, der in seiner heiteren Laune nichts bemerkte, in die Rede und sagte: "Ich möchte mich, wenn Eure Durchlaucht nichts dagegen haben, vor allen Dingen dem Hausherrn präsentieren."
Karl August erklärte sich einverstanden; er gebot dem Kammerjunker voranzugehen und sie anzumelden; Kalb eilte fort.
"Wir wollen uns einen ungebunden lustigen Mittag machen, lieber Junge!" sagte der Herzog, des Freundes Arm ergreifend. "Und nun komm, der alte Perückenstock wird sehnlichst unser harren!"
Dem war aber nicht so. Die Familie saß in zwangloser Weise beim Frühstück, und ein allgemeiner fluchtartiger Aufstand, durch des Bruders Meldung veranlaßt, brachte diesen in große Verlegenheit.
Der alte Kammerpräsident, aus dem Kanapee aufgescheucht, entfloh mit flatterndem Schlafrock um die Ecke in die Tür eines Nebenzimmers. Er zerbrach im Verschwinden seine Tonpfeife, die funkensprühend in das Zimmer zurückflog. Seine Gemahlin, ebenso nachlässig gekleidet und mit einer Filetarbeit, an der Decke des Frühstückstisches befestigt, brachte ein bedenkliches Klirren und Schwanken des Geschirrs hervor, der Milchtopf fiel um und ergoß seinen Inhalt; ein wohlgenährter Mops saß zornig aufrecht und kläffte wütend die Ruhestörer an. Gustchen hielt, was zu halten war, drückte dann die Mutter wieder in ihre Ecke und hüllte sie in eine Mantille. Zur Seite wurde eine zweite Frühstücksstunde gestört, die Frau Leonore Kalb ihrem Kindchen bereitete; die junge Mutter beschäftigte sich errötend mit ihrem Anzuge, während das kleine Wesen schreiend und zappelnd die Fortsetzung des Mahls begehrte.
Fürst und Dichter traten lächelnd unter diese Gruppen. Nach und nach beruhigten sich Lärm und Aufstand.
Die Kammerpräsidentin empfing den Besuch mit rasch wiedergewonnenem Anstande; Frau Leonore entfloh mit ihrem Kleinen; der Mops leckte die Milch, und Gustchen sowie der Bruder unterstützten die Mutter in höflichen Formen und artigen Reden.
Nach einiger Zeit kam auch der Vater in gewählterem Anzuge, doch mit aufgeregtem Schwenken des Haarbeutels wieder zum Vorschein; er suchte mit einer Menge untertäniger Floskeln den vorhergehenden Eindruck gut zu machen, und die geehrten Gäste von ihrem Wert und der so unwürdigen wie zerknirschten Persönlichkeit ihres submissest ersterbenden Wirts zu überzeugen.
Karl August ertrug dergleichen nicht lange; er fuhr kurz dazwischen und sagte, was er von seinen "untertänigsten Knechten" wollte.
"Sie müssen mir den Doktor gut halten, Präsident!" sprach er bestimmt. "Sie müssen ihm nach Kräften unser Weimar angenehm machen. Er muß sich frei bewegen, tun und lassen können, was er mag; geben Sie ihm einen Hausschlüssel und die Kost auf seinem Zimmer, wenn er es befiehlt. Wünscht er Ihre Gesellschaft, so wird er zu Ihnen kommen; größtenteils wird er wohl bei mir im Fürstenhause sein. Diesen Mittag essen wir bei Ihnen; – Ihr Sohn sagt, daß Sie eingerichtet sind," – fügte er freundlich, zur Hausfrau gewandt, hinzu – "und die Damen werden sich hoffentlich nicht ausschließen! Wir werden dann auch Ihre Frau begrüßen, Kammerjunker, die wir diesen Morgen in den süßesten Pflichten störten, und wollen munter und guter Dinge zusammen sein. Einige Winke, wen ich gern hier sehen würde, habe ich schon fallen lassen."
Mit diesen Worten stand er auf. Alles folgte seinem Beispiel; Goethe brach eine halblaute neckische Unterhaltung mit seiner reizenden Nachbarin ab, um gleichfalls dem Kammerpräsidenten und seiner Gemahlin einige Worte zu sagen, während der Herzog sich jetzt Augusten nahte: "Ich glaube, Frau von Werthern ist eine gute Freundin von Ihnen?"
Gustchen sah erstaunt zu ihm auf; er aber fuhr eilig fort: "Es freut Sie gewiß, die schöne Frau einmal zu sich einzuladen, und es würde mir angenehm sein, Ihre Freundin am heutigen Mittag hier zu sehen; gehen Sie gleich selbst zu ihr, dann wird sie gewiß kommen."
Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich rasch und ging.
Karl August und Goethe verließen bald darauf das Haus, um sich nach dem Wittumspalais zur Herzogin Anna Amalie zu begeben, welche der Herzog gern für den Freund gewinnen wollte.
Wer recht will tun, immer und mit Lust, Der hege wahre Lieb' in Sinn und Brust.
Mann mit zugeknöpften Taschen, Dir tut niemand was zu lieb: Hand wird nur von Hand gewaschen; Wenn du nehmen willst, so gib!Goethe.
Der alte Oberkämmerer von Göchhausen galt für den wunderlichsten Sonderling in ganz Weimar. Unverheiratet, wohlhabend, in seiner Jugend kränklich, hatte er eine ängstliche Selbstpflege, einen Kultus der Gewohnheit und Regelmäßigkeit sich zur Lebensaufgabe gemacht. Was nicht in nächster Beziehung zu seiner Person stand, existierte für ihn nicht. Er besaß ein eigenes Haus an der breiten Gasse, wo er mit Ursula, seiner Wirtschafterin, und Rohrmann, seinem Bedienten, seit etwa zwanzig Jahren in immer gleicher Weise lebte, sich auch einbildete, nie anders leben zu können. Seine Geschäfte nahmen wenig Zeit in Anspruch. Die Akten wurden jeden Morgen Rohrmann überantwortet und jeden Abend wieder abgeholt; nur einmal in der Woche mußte er in die Kanzlei, um dem Herzoge Bericht abzustatten und seine Befehle entgegenzunehmen. Wenn er zu Hofgesellschaften befohlen wurde, ging er hin, denn er hätte es der Würde eines Barons Louis Wilhelm von Göchhausen durchaus unangemessen gehalten, nicht bei Hofe zu erscheinen; dies waren aber auch die einzigen Gelegenheiten für ihn, mit Menschen zu verkehren.
Außerdem widmete er den ganzen Tag seinen beiden einzigen Leidenschaften: der Ordnungsliebe und der Reinlichkeit, Tugenden, welche in seiner Übertreibung Untugenden wurden, und neben einer großen Sparsamkeit ihn ganz beherrschten.
Es konnte keine Tageseinteilung regelmäßiger sein, als die des Oberkämmerers. Rohrmann erschien im Winter und Sommer um sechs Uhr, trug auf einem Teller ein Glas Wasser und sagte: "Guten Morgen, Herr Baron, es ist Aufstehenszeit!"
Dann erhob sich Herr von Göchhausen, trat unbedingt mit dem rechten Fuße zuerst auf die Erde, hustete dreimal – er wäre lieber erstickt, als daß er es sich ein viertes Mal gestattet hätte – und nahm den Schlafrock. Nun wurde der ganze Mann in möglichst gründlicher Weise gewaschen, gebürstet, gebadet, gerieben und abgespült. Dann legte er silbergraue Beinkleider, feine Strümpfe und Schuhe an, eine graue langschößige Weste folgte, wohlgefältete breite Jabots, ein steifes weißes Halstuch bis dicht unter die Ohren reichend, so daß sich der kleine Kopf kaum wenden konnte; ein gleichfalls silbergrauer Rock mit breiten Taschen und glänzenden Knöpfen vervollständigte den Anzug, welchen eine gepuderte Perücke mit zierlichem Zopf und großen Seitenlocken, sowie ein betreßter dreieckiger Hut krönte. Dann nahm der Baron seinen hohen Stock mit silbernem Knopf und schritt der Haustür zu, um Punkt acht Uhr auf die breite Gasse hinauszutreten und seine erste Morgenpromenade zu beginnen. Auch die Promenade hatte ihren gewiesenen Weg und ihr ganz bestimmtes Ziel, das war die kleine Schleuse am Schwansee, auf welche er dreimal mit dem Stocke schlug, und wie nahe Arbeiter gehört haben wollten, dazu sprach: "Baron Louis Wilhelm von Göchhausen ist dagewesen!" Dann wandte er sich und kehrte nach seinem Hause zurück.
Frau Ursula hatte jetzt eine Milchsuppe und einige Schnitte Weizenbrot bereit, die er mit besonderen Feierlichkeiten genoß.
War der Tag in strengster Gleichmäßigkeit hingebracht, so erschien Abends neun Uhr Rohrmann wieder mit einem Glase Wasser und sagte: "Gute Nacht, Herr Baron, es ist Schlafenszeit!" – Worauf der Oberkämmerer sich sofort erhob und unter dem Beistande seines Dieners das Lager aufsuchte.
In diese wohlgeordnete Häuslichkeit paßte ein fremdes Element sehr wenig, und doch war es dem alten Herrn beschieden, ein solches bei sich aufzunehmen.
Es war etliche Tage vor Goethes Ankunft in Weimar, als der Baron Göchhausen ungewöhnlich erregt in seinem Arbeitsstübchen auf und ab schritt. Er hielt die Bewegung zu dieser Stunde für ungesund, und zürnte sich selbst deshalb, noch mehr aber der Veranlassung seiner Unruhe.
"Es geht nicht! Es geht nicht, und es geht nicht!" murmelte er, auf und ab schreitend, in verschiedener Betonung vor sich hin. "Seit ihr Brief da ist, Wallungen, Unruhe, Zerstreutheit; wie soll das werden? Es reibt mich auf! – Selbsterhaltung – Notwehr! O ihr schrecklichen Weiber! Und in einer halben Stunde!" seufzte er stehen bleibend, die Stirn trocknend und den Blick mit verzweifelndem Ausdruck auf eine dicke silberne Taschenuhr, die an seinem Schreibtische hing, richtend, und eben halb acht wies.
Einen Augenblick nur zögerte er noch, dann setzte er sich an den Tisch, ergriff einen langen Gänsekiel und begann zu schreiben.
"Ich werde ihr sagen," murmelte er, "daß meine Gesundheit mir verbietet, Besuch zu empfangen, daß sie Mitleid haben soll mit einem leidenden Greise, daß ich sie anflehe, mir den Embarras nicht aufzuladen; mit diesem Briefe schicke ich Rohrmann zur Post."
Das Billett war gefaltet, der alte Herr klingelte, und Rohrmanns große knochige Gestalt erschien in der Tür; der Versuch eines Lächelns erhellte das pergamentartige Gesicht, als sein Herr voll überredender Güte zu ihm sprach: "Sieh Er diesen Brief, Rohrmann, derselbe muß in die Hand eines jungen Frauenzimmers gelangen, das um acht Uhr mit der gothaischen Post ankommt. Sie will uns besuchen, heißt Luise von Göchhausen, und Er weiß selbst, Rohrmann," fügte er, seine schwimmenden Äuglein mit kläglichem Ausdruck nach oben kehrend, hinzu, "daß ich zu leidend bin, um Damenbesuch anzunehmen; wende Er also diese Inkommodität von Seinem armen Herrn, und sag Er der Person mündlich, daß sie partout wieder abreisen müsse!"
Rohrmann verschwand, und der Baron atmete erleichtert auf. Er begann wieder ruhig und behaglich zu werden, konnte still sitzen, schob die Feder hinter das Ohr und studierte jetzt, da er die Gefahr als beseitigt ansah, mit Muße zwei vor ihm liegende Papiere. Der Anmeldebrief seiner Nichte lautete:
"Karlsruhe, den 15. Oktober 1775.
Teurer Oheim, Vormund und Gevatter!
Es hat sich in dieser mit Gott hinschleichenden Zeit begeben, daß Ihrer submissest unterzeichneten Nichte – wie Einliegendes ausweist – der Stuhl vor die Tür gesetzt worden. Selbige schaut sich um in der weiten Welt und gewahrt, daß ihr verehrter Oheim in Weimar der einzige ist, welcher gegründete Ansprüche an ihre Person zu erheben hat. In edlem Gerechtigkeitseifer und nach dem Spruch: gebt jedem das Seine! ist sie entschlossen, ihr Dasein dem Wohl und Penchant des ihr unbekannten, aber verehrten Herrn zu widmen.
Morgen verlasse ich Karlsruhe – das keine Ruhe mehr für mich bietet –, um am zweiten November mit der gothaischen Post in Weimar anzukommen!
Bis dahin Geduld, o Sehnsucht!
Ergebenst und gehorsamst, cher oncle, Ihre devoteste Luise von Göchhausen."
"Das muß ein übermütiger Satan sein!" murmelte der alte Herr, nachdem er den Brief wieder gelesen hatte, dann nahm er das zweite Schreiben vor; es war ein großes, mit markgräflichem Siegel versehenes Dokument und enthielt die Entlassung der Hofdame Luise von Göchhausen aus dem Dienst Ihrer Durchlaucht der Frau Markgräfin von Baden.
"Was mag sie nur für kniffliche Sachen angezettelt haben?" fragte sich der alte Herr kopfschüttelnd. "Eine solche Hexe sich ins Haus nehmen, brrr!"
In diesem Augenblicke ging unten die Glocke der Haustür; "Rohrmann schon wieder da?" dachte der Baron erstaunt und lauschte.
Leichte Schritte eilten die Treppe herauf; der Oberkämmerer erbleichte, ein Zittern befiel ihn, ängstlich blickte er auf die Tür – sie wurde geöffnet und herein trat ein rasches kleines Frauenzimmer.
Sie war es! Die unabwendbare, gefürchtete Nichte, Luise von Göchhausen, stand vor ihm! Und wie! Spöttischen Ernst in den geistreichen Augen, ein ironisches Lächeln um den großen Mund, auf dem leichtgepuderten Haar einen weißen Musselinhut und über den braunen Reiserock ein grasgrünes Mäntelchen geworfen. Die ganze kleine Gestalt, etwas verwachsen, schien zu sagen: ja, sieh mich nur an! übersehen sollst du mich nicht!
"Da bin ich, cher oncle!" rief sie munter und griff nach seiner Hand, um sie zu küssen.
"Hast du meinen Brief nicht bekommen?" stotterte er.
"Gewiß, mein teurer Oheim!" entgegnete das junge Mädchen, "und sein Inhalt beflügelte meine Schritte; den Leidenden zu pflegen, zu unterhalten, wird meine künftige Lebensaufgabe sein!"
Ein Schauder überlief den Oberkämmerer. "Ich kann das nicht akzeptieren," sagte er nach Festigkeit ringend.
Luise trat zurück. "Warum nicht?" fragte sie.
"Weil, weil –" stammelte er, "weil ich dich nicht kenne – und –"
"Nicht kenne?" betonte sie scharf; ein tiefer, trauriger Ernst sank wie ein Schleier über das lustige Gesicht. "Der einzige Bruder meines Vaters, mein Vormund, mein Pate kennt mich nicht? Großer Gott, wer kennt mich denn? Dann bin ich ganz allein und verlassen auf der Welt!"
Eine augenblickliche Pause trat ein; dem alten Baron brach der Schweiß aus, es erschreckte ihn furchtbar, daß er für ein Wesen außer sich sorgen solle, ja vielleicht Teilnahme dafür gewinnen könne. Er wollte diesen ersten selbstlosen Anwandlungen entfliehen und polterte heraus: "Warum macht Sie unnütze Streiche? Warum wird Sie fortgejagt?"
Wie Sonnenschein flog es bei diesen Worten über die Züge des Mädchens.
"Es war ein sehr guter Spaß, cher oncle!," sagte sie, ein Auflachen kaum unterdrückend. "Um vieles möchte ich den nicht ungeschehen machen!"
"So trag die Folgen!"
"Ich muß wohl."
"Ich weiß nicht, was du beginnen willst, denn in meinem Hause ist kein konvenabler Aufenthalt für dich. Du kannst ja nach Frankreich zu den Verwandten deiner Mutter gehen." Aufatmend nach diesem Auskunftsmittel ließ er sich wieder in seinen Sessel vor den Schreibtisch gleiten.
Luise hockte zu seinen Füßen auf einem Aktenkasten und sagte: "Wie ist es möglich, daß mein Oheim von dem Ableben aller jener Verwandten nichts weiß?"
"Ein Sachwalter hat dein kleines Vermögen unter Händen – an ihn schickte ich alles, was von dir einlief; nur deinen letzten Brief bekam ich von ihm zurück," stotterte er.
Sie sah ihn verächtlich an. "Gut!" sprach sie endlich ernsthaft, "kann ich nicht bei Ihnen bleiben, so muß ich mich allein durchschlagen. Die Straße, in welcher Sie wohnen, hat mir gefallen, es wird irgendwo, etwa gegenüber, ein Zimmerchen zu vermieten sein; dahin ziehe ich und arbeite, weil ich sonst kein Brot habe; ich werde Putzmacherin und schaffe mir ein Schild an, auf dem mit großen Buchstaben zu lesen ist: Luise von Göchhausen, Nichte, Mündel und Pate des Herrn Barons Oberkämmerer von Göchhausen, bittet um gütigen Zuspruch als – Putzmacherin!"
Empfindlicher hätte sie ihn nicht treffen können; seinen Namen preisgeben, das vertrug er nicht! Er putzte das Licht und wandte es, um ihr Gesicht anzusehen: ob sie ihren Vorschlag ernstlich gemeint habe. Er saß da in seinem abendlichen grauen Überwurf, mit den dicken Locken, den hervortretenden Augen und der langen Schreibfeder hinter dem Ohr, wie ein grau bestaubter Käfer, der prüfend sein Fühlhorn ausstreckt.
Sie dagegen glich mit ihrer kleinen, kecken Gestalt und in ihrem grünen Mäntelchen einer lustig zirpenden Grille.
"Oder," fuhr sie unbekümmert fort, "wenn es hier einen Hofbäcker gibt, könnte ich in seinem Laden verkaufen; vielleicht würde das seine Kundschaft vergrößern!"
Dem Baron und Oberkämmerer schauderte es. Er rieb sich die Stirn und rang seine wohlgepflegten Hände. Sie ließ ihn, mit lachenden Seitenblicken, in selbstgeschaffenen Leiden zappeln.
Endlich sagte er: "Mir geht ein Licht auf; eine wahre Inspiration! Ihre Durchlaucht die Frau Herzogin-Witwe hat die bisherigen Hofdamen der jungen Herzogin Luise abgetreten und sieht sich nach einem Gesellschaftsfräulein um. Wenn ich meinen Einfluß aufbiete, hoffe ich dir die Préférence zu verschaffen."
Luisen gefiel dieser Vorschlag. Der Ruf der Herzogin Anna Amalia, als einer munteren und geistvollen Dame, war nach Karlsruhe gedrungen, und die Verhältnisse des weimarischen Hofs in den dortigen Kreisen oft besprochen; ja, sie hatte die jungen Herrschaften, Karl August und Luise, schon im Herbste dort gesehen. Eine Stellung bei der Herzogin sagte ihr allerdings besser zu, als der Aufenthalt im Hause des ungastlichen Oheims.
"Sie denken, daß es möglich wäre, Onkel?" fragte sie rasch.
"Ja, ja!" versetzte er, sein Haupt schüttelnd, soweit die hohe Krawatte dies zuließ. "Wenn nur nicht – dieser Abschied – diese Betisen! Davon darfst du nicht sprechen. Der Herzogin werde ich sagen, ich habe dich aus väterlicher Attention aus dem badenschen Dienstverhältnisse enleviert; so gibt es für uns beide mehr Lüstre."
Das junge Mädchen lächelte fein. In diesem Augenblicke schlug es von der Stadtkirche neun, und gleich darauf trat Rohrmann mit dem Glase Wasser und der allabendlichen Rede: "Gute Nacht, Herr Baron, es ist Schlafenszeit!" in das Zimmer.
Der kleine Oberkämmerer fuhr wie von einer Wespe gestochen empor; hatte er kurze Zeit seiner Nichte einige Teilnahme zugewandt, so war er jetzt wieder der alte pedantische Egoist.
"Gute Nacht! Gute Nacht!" rief er forteilend seiner Nichte zu.
"Aber wo sollen wir denn hin, wo sollen wir Abendbrot und Logis hernehmen, wenn Sie nicht den Befehl dazu geben?" fragte sie rasch.
Der alte Herr war stehen geblieben.
"Wir? – Wir?" sprach er mit strenger Betonung. "Das Fräulein von Göchhausen wagt es, mit einem Galan unter das honette Dach ihres Oheims zu kommen?"
Luise lachte laut. "Das Fräulein von Göchhausen hat und braucht keinen Galan," entgegnete sie spöttisch, "eine Kammerzofe aber hat und braucht sie, so lange, bis sie Putzmacherin oder Küchenmädchen ist."
"Gut," sagte er erleichtert, "so geh zur Ursula und befiehl ihr in Gottes Namen, daß sie für euch sorgt."
Mit diesen Worten verschwand er, bedenklich nachsinnend, welche Folgen die Aufregung des Abends noch für ihn haben könne.
Wie so bunt der Kram gewesen, Musterkarte, gib's zu lesen!Goethe
Das Gastmahl im Hause des Kammerpräsidenten von Kalb nahm einen sehr befriedigenden Verlauf.
Mit dem Aufwande aller zu Gebote stehenden Mittel war im besten Zimmer die Tafel hergerichtet. Die Kammerpräsidentin hatte mit ihrer Schwiegertochter die nötigen Küchenanweisungen gegeben und die Dienerschaft angeleitet, während Gustchen für eine gefällige Außenseite und den Schmuck des Ganzen sorgte. Jeder grüne Zweig, den der November noch im Garten gelassen hatte, fiel unter ihrer Schere, ja sie entäußerte sich sogar einiger Blüten ihres dunkelroten Geraniums, um zierliche Sträuße für den Herzog und Goethe zu binden, und gab sich dabei der Hoffnung hin, einen, vielleicht beide Sträuße zu sich zurückkehren zu sehen.
Die gewünschten Gäste waren alle erschienen. Der Herzog hatte seinen Platz neben der Frau vom Hause und der jungen und reizenden Frau von Werthern, die, auf seinen Wunsch von Auguste eingeladen, mit Freuden gekommen war.
Emilie von Werthern, gewöhnlich Milli genannt, war mittelgroß und zart gebaut, ihr lebhaftes, blitzendes Auge, die dunkle, feingezeichnete Braue, die kleine gebogene Nase, der zarte, leidenschaftlich zuckende Mund, das rasch wechselnde Farben- und Mienenspiel machten ein höchst anziehendes Ganze. Man nannte sie kokett und tadelte ihr Suchen und Haschen nach jedem Vergnügen; doch ließ sich zu ihrer Entschuldigung anführen, daß sie mit einem viel älteren, rohen Manne verheiratet und kinderlos war.
Ihrer ganzen Anlage nach eine echte Enthusiastin, schien sie zu allem fähig, wenn ihr Gefühl angeregt wurde. Für und wider Partei nehmend, auflodernd, bebend und jubelnd, liebeselig sich anschmiegend, war sie zugleich schwankend in ihren Neigungen, zaghaft und zusammensinkend wie ein verlöschendes Strohfeuer. Eine solche Frau übte eine große Anziehungskraft auf den jungen, lebhaften Herzog. Auch an dem heutigen Mittage brach die Unterhaltung zwischen den beiden selten ab. Dem Herzog gegenüber saß Goethe zwischen Gustchen Kalb und Wieland. Auguste hatte sich glänzende Erfolge von dem heutigen Mittage versprochen, es blieb aber bei einigen flüchtigen Artigkeiten von Goethes Seite, und sie war genötigt, sich mit den ihr verehrten roten Geranien zu begnügen oder ihrem anderen Nachbar, dem Oberforstmeister von Wedel, ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Goethes Teilnahme wurde durch die Bekanntschaft mit Wieland in Anspruch genommen. Obgleich beide Männer im Alter, in der äußeren Erscheinung, im Denken und Leben durchaus verschieden waren, auch schon auf dem literarischen Kriegsfuß gestanden hatten – so fanden sie beide, bei diesem ersten persönlichen Zusammentreffen, doch so viele gleiche Interessen, daß sie sich eifrig miteinander beschäftigten.
Der Hofrat Wieland zählte damals zweiundvierzig Jahre, seine zarte Gestalt, das Saubere, Wohlgepflegte der ganzen Erscheinung hatte ihm den Beinamen: "Die zierliche Jungfrau" erworben, ein Titel, auf den er einigen Wert legte. Seit drei Jahren von der Herzogin- Mutter nach Weimar berufen, hatte er unter Aufsicht des Grafen Görtz die Erziehung Karl Augusts geleitet. Er galt wegen seiner heiteren Milde, seiner freundlichen Herzensgüte und auch als achtbarer Vater einer zahlreichen Familie bei seinem Zögling und besonders bei der Herzogin Anna Amalie außerordentlich viel. Man schätzte ihn als Menschen und Dichter gleich hoch und hatte den gegen ihn gerichteten Angriff Goethes dem jüngeren Mann übel genommen.
Wieland gegenüber, an der anderen Seite der Frau von Werthern, saß der junge Hildebrand von Einsiedel, im Pageninstitute zu Weimar erzogen, seit vier Wochen aber vom Herzog zum Hofrat ernannt. Welch ein feines, träumerisches Gesicht! Welch ein Ausdruck poetischer Versunkenheit in den tiefen, dunklen Augen! Welch zierlich anmutige Gestalt mit nachlässiger Haltung. Zerstreut spielten seine Finger mit einigen Brotkrumen oder bogen die herabhängenden Enden seiner weißen, spitzenbesetzten Krawatte in kleine Falten. Seine künstlerische Begabung war nicht unbedeutend; er liebte leidenschaftlich die Musik, spielte Violoncell mit Meisterschaft, komponierte und sang, auch versuchte er sich in der Poesie, fertigte Gelegenheitsgedichte und dramatische Sachen. Die Bekanntschaft mit dem vielbesprochenen Goethe interessierte ihn, und er folgte mit großer Aufmerksamkeit der Unterhaltung ihm gegenüber.
Neben Einsiedel auf der anderen Seite saß der Pagenhofmeister Musäus, jetzt Professor am Gymnasium. Ein vierzigjähriger, heiterer, harmloser Mann, aller Übertreibung und Gefühlsschwelgerei abgeneigt; er hatte mancherlei geschrieben und beschäftigte sich jetzt damit, die Volksmärchen der Deutschen zu sammeln und auf seine Art zu überarbeiten. Lebhaft beteiligte er sich an den literarischen Streitfragen und polemisierte eifrig gegen Lavater, dessen Lehren damals die Gemüter beherrschten und auch in Weimar enthusiastische Anhänger fanden.
Endlich wurde das Mahl aufgehoben und darauf die Unterhaltung in Gruppen vertraulich weitergeführt.
Der Herzog sprach noch an einem Fenster stehend mit Frau von Werthern, als Wieland mit geröteten Wangen und begeistert blitzenden Augen zu ihnen herantrat.





























