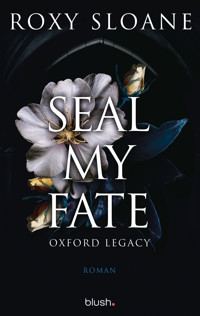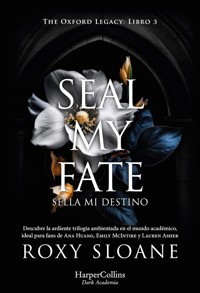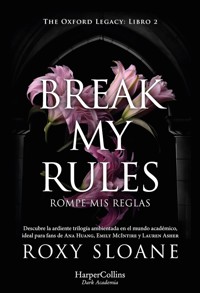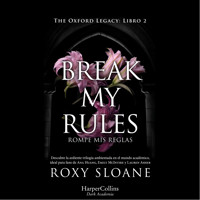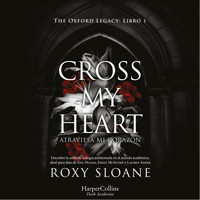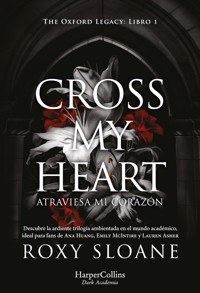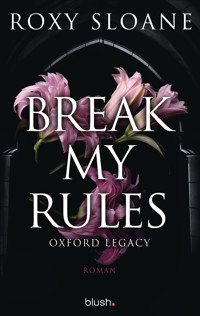
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Oxford Legacy
- Sprache: Deutsch
Der Mann, den sie liebt, könnte das Monster sein, das sie jagt ...
Tessa kam nach Oxford, um den Tod ihrer Schwester aufzuklären. Der Kreis der Verdächtigen wird immer enger – doch ausgerechnet der Mann, den sie liebt, scheint einer von ihnen zu sein. Nur zu gern würde Tessa Anthony vertrauen, doch sie weiß, dass er seinen mächtigen Freunden verpflichtet ist. Für wen wird er sich entscheiden, wenn es hart auf hart kommt? Muss Tessa ihn hintergehen, um Rache an denen nehmen zu können, die das Leben ihrer Schwester ruiniert haben?
Dark Academia meets teacher x student, forbidden love und enemies to lovers – auch Band 2 der Oxford-Legacy-Reihe wird dich in seinen Bann ziehen!
Books that make you – blush.
Du suchst Liebesgeschichten mit reichlich Spice, mitreißenden Tropes oder morally grey book boyfriends? Dann entdecke weitere Bücher von blush.!
Enthaltene Tropes: Dark Academia
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Tessa kam nach Oxford, um den Tod ihrer Schwester aufzuklären. Der Kreis der Verdächtigen wird immer enger – doch ausgerechnet der Mann, den sie liebt, scheint einer von ihnen zu sein. Nur zu gern würde Tessa Anthony vertrauen, doch sie weiß, dass er seinen mächtigen Freunden verpflichtet ist. Für wen wird er sich entscheiden, wenn es hart auf hart kommt? Muss Tessa ihn hintergehen, um Rache an denen nehmen zu können, die das Leben ihrer Schwester ruiniert haben?
Autorin
Roxy Sloane ist das Pseudonym einer erfolgreichen USA-Today-Bestsellerautorin. In England geboren und aufgewachsen, hat Roxy ihren Bachelor an der University of Oxford abgeschlossen. Im Gegensatz zu ihrer Protagonistin Tessa hat sie dort aber ernsthaft studiert und keinerlei skandalöse Partys oder Veranstaltungen von Geheimgesellschaften besucht. Derzeit lebt sie in Los Angeles und gibt sich ihrer Leidenschaft hin, süchtig machende Romance-Welten zu erschaffen und an öffentlichen Orten ganz ungeniert super-spicy Szenen zu schreiben.
ROXY SLOANE
BREAK MY RULES
OXFORD LEGACY
Roman
Deutsch von Luzi Bast
Die Originalausgabe wurde 2023 unter dem Titel Break My Rules von AAHM, Inc/Roxy Sloane veröffentlicht.Die erste Verlagsausgabe erschien 2024 bei Avon, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by AAHM, Inc/Roxy Sloane, published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers LLC.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by blush. Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Ulrike Gerstner
Covergestaltung: bürosüd nach einer Vorlage von Roxy Sloane und unter Verwendung von Bildmaterial von Adobe Stock (New Africal) und Getty Images (Michael Duva)
Innengestaltung unter Verwendung der Bilder von: © Adobe Stock (Gizele)
StH · Herstellung: DiMo
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-33327-0V001
Für alle Leser*innen, die es nach Rache gelüstet …
KAPITEL 1 Tessa
Ich kann nicht atmen.
Wie erstarrt knie ich dort am Seeufer. Saint liegt splitternackt vor mir auf dem Boden und bebt vor Lust und Erregung. Einen Augenblick zuvor war ich selbst noch im Rausch, habe ihm die Kleider vom Leib gerissen und wollte ihn mit heißem Sex beglücken, doch jetzt …
Jetzt fühlt sich mein Herz bleischwer an, und ich sehe nur noch das kleine Tattoo auf seinem Oberschenkel. Eine Krone in einem Schlangenkranz. Es ist klein, aber sehr klar gestochen, ich würde es überall erkennen.
Es ist die Tätowierung, die meine Schwester beschrieben hat. Das einzige Detail ihres Peinigers, an das sie sich erinnern konnte. Seit ich in Oxford bin, habe ich nach diesem Tattoo gesucht, und nach dem Monster, das meine Schwester unter Drogen gesetzt, Unsägliches mit ihr angestellt und sie damit in die Depression gestürzt und schließlich in den Suizid getrieben hat. Ich hatte gehofft, das Symbol auf der heutigen Party der Geheimgesellschaft endlich zu finden, und nun habe ich es gefunden. Allerdings nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Denn da ist es, auf Anthony St. Clairs Oberschenkel. Saint. Der Mann, in den ich mich verliebt habe, der Einzige, dem ich vertraut habe, und der mich in die Welt wilder, hemmungsloser Lust eingeführt hat.
Der Mann, der mich gerade noch zärtlich im Arm gehalten hat, als ich meinen Kummer hinausschluchzte, und mir gesagt hat, ich müsse mit meinen selbstzerstörerischen Rachegedanken endlich abschließen.
Dieser Mann ist das Monster.
Nein.
Das darf nicht sein. Ich will es nicht glauben.
»Tessa?« Saint hebt den Kopf, seine klaren blauen Augen glänzen verlangend. Er schenkt mir sein verführerisches Lächeln, bei dem ich schon so oft dahingeschmolzen bin. »Ich habe doch gesagt, du sollst mich nicht so zappeln lassen.«
Ich ringe nach Luft, schwanke. Wie kann es sein, dass mir das Tattoo bisher nicht aufgefallen ist? Irgendwie war unser Sex immer so spontan und leidenschaftlich, dass ich Saint noch nie komplett nackt gesehen habe. Bei der Mitternachtsparty war es so schummrig … Im Club hatte ich die Augen verbunden … Und in der Küche, als wir es zum ersten Mal so richtig getrieben haben, da hat er mich von hinten genommen.
Und ich habe das alles so genossen.
»Tut mir leid …«, stoße ich hervor, mir ist übel. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich muss weg von ihm. »Ich kann nicht …«
Sofort tritt Besorgnis an die Stelle des Verlangens in Saints Augen.
»Tessa?« Er setzt sich auf, streckt die Hand nach mir aus. Ich zucke zurück.
»Ich glaube, ich bin noch zu aufgewühlt. Wegen eben«, stammele ich und versuche, seinem Blick auszuweichen. »Ich dachte, ich wollte das hier, aber …«
»Schhh, alles gut«, sagt Saint, während er sich schnell wieder anzieht. Er lächelt mich an, es soll wohl beruhigend wirken. »Wir können einfach hier sitzen und noch ein bisschen reden, oder was immer du willst.«
Was ich will, ist, die letzten fünf Minuten zu löschen, sodass ich seine Tätowierung nie gesehen habe.
Oder noch weiter in der Zeit zurückzugehen, bevor ich ihn kennengelernt habe. Damit ich mich nicht ausgerechnet in den Mann verknalle, der das Leben meiner Schwester zerstört hat. Ich habe mit ihm gelacht, mich ihm anvertraut …
Ihn gevögelt.
O Gott.
Mit wackeligen Beinen stehe ich auf. Gerade eben habe ich das abgelegene Wäldchen am See noch als romantisch empfunden, jetzt kommt es mir gefährlich still vor. Wir sind ganz alleine hier, es ist niemand in Rufweite. Ich habe mich bei Saint so sicher gefühlt, und jetzt …
Jetzt kann ich nichts und niemandem mehr vertrauen.
»Lass uns zurück zur Party gehen«, sage ich schnell. Er soll nicht merken, dass ich Bescheid weiß. Jedenfalls nicht, bis ich weiß, wie ich hier wegkomme.
»Bist du sicher?«, fragt Saint skeptisch, und ich kann mir nur mit großer Mühe ein Lächeln abringen.
»Ja, das wird mir guttun, ein bisschen Ablenkung. Spaß. Ich will nicht mehr heulend herumsitzen.«
Nicht mit dem Mann, der vermutlich für jede einzelne dieser Tränen verantwortlich ist.
»Na gut.« Saint lächelt mich wieder voller Zuneigung an. »Dein Wunsch ist mir Befehl.«
Er streicht seine Kleidung glatt und nimmt meine Hand. Es widert mich an, am liebsten würde ich sie wegziehen, aber ich zwinge mich, mich normal zu verhalten. Und irgendwie gelingt es mir, ruhig neben ihm durch das Wäldchen zurück zu Musik und Licht und Leuten zu gehen, als wäre alles in bester Ordnung. Doch mit jedem Schritt wird der Wirbel in meinem Kopf heftiger.
Wie kann es Saint sein?
Ich habe ihm meine Geheimnisse offenbart, habe alles mit ihm geteilt. Habe ihm erzählt, wie sehr Wren unter diesem Vorfall in Oxford gelitten hat und wie die Trauer um meine Schwester mir das Herz zerrissen hat. Er hat gesagt, der Mann, der ihr das angetan hat, sei ein Monster. Böse.
Hat er sich die ganze Zeit einen Spaß mit mir gemacht?
War das alles irgendein krankes Spiel, um mich in Sicherheit zu wiegen?
Das ergibt keinen Sinn.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt endlich das Herrenhaus in Sicht. Die Party ist jetzt in vollem Gange, die Musik dröhnt, und die Blackthorn-Leute tanzen und trinken, jeder Anschein von guten Manieren ist ausgelassener Feierlaune gewichen. Wie konnte ich glauben, hier irgendeine finstere Verschwörung aufzudecken? Es ist nur ein Haufen privilegierter Aristokraten, die sich ein bisschen amüsieren.
Doch die wahre Gefahr war viel näher.
Saint führt mich an der Hand zur Terrasse, und ich schiele aus dem Augenwinkel zu ihm hoch. Er sieht so aus wie immer: einfach umwerfend, mit seinem dunklen Wuschelhaar, den sturmblauen Augen und diesem Lächeln, das mich alle Hemmungen vergessen lassen könnte.
Ich habe ihn einmal einen gefallenen Engel genannt. Aber jetzt soll er gar der Teufel sein?
»Ich brauche einen Drink!«, verkünde ich laut und lasse Saints Hand los. »Bist du so nett und besorgst mir was Spritziges? Und was zu essen. Ich mache mich kurz frisch und bin gleich zurück.«
Mein plötzlicher Stimmungswechsel scheint ihn zu beunruhigen, doch er nickt lächelnd.
»Süß oder herzhaft?«
»Ich lass mich überraschen!«
Saint geht zur Bar, und ich schlängele mich durch die Menge ins Haus. Am Ende des Ganges ist ein Bad, aber ich halte direkt auf den Vordereingang zu. Mein Herz hämmert, als würde ich einen Gefängnisausbruch planen. Ich rechne jeden Moment damit, dass Saints Stimme erklingt oder dass er mir den Weg versperrt. Ich halte den Kopf gesenkt, ignoriere die Partygäste um mich herum, und dann bin ich endlich draußen.
Auf dem Vorplatz herrscht reges Treiben, Wagen kommen und spucken Menschen aus. Na klar, die After-Party. Saint hat ja gesagt, dass sich nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung andere Leute unter die Mitglieder der Geheimgesellschaft mischen. Auf diese Weise ist meine Schwester wohl auf einer dieser Partys gelandet. Und da wurde sie dann entführt, in einer Zelle gefangen gehalten, und dann hat ein unbekannter Mann ihr Dinge angetan, an die sie sich – zum Glück – nicht erinnern konnte.
Es kann nicht Saint gewesen sein.
Ich schlucke den bitteren Geschmack schnell herunter und eile auf ein Taxi zu, aus dem gerade eine Gruppe aufgetakelter Frauen gestiegen ist.
»Können Sie mich nach Oxford bringen?«, frage ich verzweifelt.
Der Fahrer zieht die Brauen hoch, berechnet vermutlich die horrenden Fahrtkosten.
»Sicher, Miss. Steigen Sie ein.«
Ich werfe mich geradezu auf die Rückbank, halte den Atem an und ducke mich, während ich nach Saint Ausschau halte. Aber er verfolgt mich nicht. Der Fahrer zieht an der Reihe glänzender Luxusschlitten vorbei und biegt in die lange Einfahrt ein. Lichter und Musik der Party bleiben hinter uns zurück.
Ich entspanne mich nicht eine Sekunde lang, erst als wir viele Meilen entfernt sind. Wir rasen durch die dunkle Nacht, und ich kann meinen fassungslosen Tränen endlich freien Lauf lassen.
»Alles in Ordnung?«
Der Fahrer sieht in den Rückspiegel.
»Mh-hm«, mache ich und versuche mein Schluchzen zu unterdrücken. »Sorry, ich … Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht.«
»Das tut mir leid. Kopf hoch, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
Dennoch wirbeln die Fragen in meinem Kopf, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann wieder klarsehen kann. Ich lasse den heutigen Abend Revue passieren, versuche, zu verstehen, aber es passt einfach nicht zusammen.
Ich dachte, ich kenne Saint. Ich dachte, er mag mich.
War das alles gelogen?
Wer bist du, Saint?
***
In Oxford dirigiere ich den Taxifahrer zu meiner WG. Ich bin eigentlich vor ein paar Tagen ausgezogen …
Nein, Saint hat mich dazu gezwungen, mache ich mir klar, als ich die Treppe hochgehe. Er hat meine Sachen gepackt und in sein Haus gebracht. Er hat gesagt, ich sei hier nicht sicher, und er wolle mich beschützen.
War er dabei eigentlich derjenige, vor dem ich hätte beschützt werden müssen?
Zum Glück sind meine Mitbewohner, Jia und Kris, nicht zu Hause, die Wohnung ist ruhig und still. Ich gehe direkt in mein Zimmer und werfe mich aufs Bett. Davon abgesehen ist der Raum leer.
Was mache ich denn jetzt?
Mein Handy brummt, ich ziehe es aus meiner Handtasche. Saint hat, während ich im Auto saß, ein dutzend Mal getextet und angerufen.
Wo bist du?
Bist du noch auf der Party?
Geht es dir gut? Wir finden dich nicht.
Tessa, ich mache mir Sorgen.
Bitte sag mir, was los ist.
Die Nachrichten klingen immer besorgter, und ich empfinde leise Schuldgefühle. Mein plötzliches Verschwinden muss ihn extrem verwirrt haben.
Aber, nein, er hat mein schlechtes Gewissen nicht verdient. Ich schalte das Handy aus. Er verdient gar nichts, außer meiner Wut, meinem Ekel und meinem Hass für das, was er getan hat.
Nur … fühle ich all das nicht.
Ich fühle gar nichts außer Schock und Fassungslosigkeit.
Ich liege benommen auf dem Bett und starre an die Decke. Wie können der Mann, den ich glaubte zu kennen, und das Monster, das ich jage, ein und dieselbe Person sein? Es kann einfach nicht sein, dass er mich wieder und wieder so belogen haben soll. Dass er sich auf so schreckliche Weise an meiner Schwester vergangen hat und mich gleichzeitig glauben ließ, ihm würde etwas an mir liegen. Er war so zärtlich, hat mich unterstützt, war so leidenschaftlich, und wir hatten solchen Spaß.
Die Erinnerungen stürzen auf mich ein, und ich breche wieder in heiße Tränen aus, schluchze meinen Kummer heraus. Er hat mich verraten. Und jetzt liege ich hier, völlig gebrochen.
Wie konnte ich mich so sehr in ihm täuschen?
KAPITEL 2 Tessa
Ich bleibe das ganze Wochenende in meinem Zimmer, ignoriere Saints Nachrichten und versuche, das alles irgendwie zu verstehen. Es sind nicht nur Schock und Schrecken darüber, dass Saint vielleicht Wrens Peiniger war. Ich bin auch von Liebeskummer überwältigt. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie sehr ich in Saint verliebt war, bis sich herausgestellt hat, dass es alles nur eine Lüge ist.
Jetzt schwanke ich zwischen Hass und Sehnsucht. Ich verfluche ihn und wünsche mir gleichzeitig verzweifelt, dass es eine andere Erklärung gibt. Vielleicht hat noch jemand anderes dieses Tattoo … Vielleicht hat er gar nicht gelogen …
Am Montagmorgen bin ich völlig erschöpft von diesem Kampf, der in mir tobt. Ich stolpere aus meinem Zimmer, durch den Flur. Ich höre gedämpft, wie meine Mitbewohner in der Küche über mich lästern.
»Weißt du, was passiert ist? Sie heult sich seit Tagen die Augen aus dem Kopf.«
»Sie will nichts sagen. Nur dass sie sich getrennt haben.«
»Du meinst, er hat sie abgeschossen, wie wir es die ganze Zeit vorausgesagt haben.«
»Sie ist völlig fertig. Anscheinend hat sie nicht damit gerechnet.«
»Was? Dachte sie, sie verliebt sich Hals über Kopf und lebt glücklich bis an ihr Lebensende mit dem Duke?« Sie prusten vor Lachen. »Wir haben sie ja gewarnt. Diese reichen Arschlöcher sind immer oberflächlich.«
»Psst, ich glaube, sie kommt. Wir müssen es ihr ja nicht unter die Nase reiben.«
Ich schlucke, wappne mich innerlich und öffne absichtlich laut die Tür.
»Morgen.«
»Guten Morgen!« Plötzlich sind Kris und Jia die Aufmerksamkeit in Person und schauen mich mit großen Augen mitfühlend an.
»Wie geht es dir?«, gurrt Jia. »Möchtest du Kaffee? Konntest du schlafen?«
»Ein bisschen. Und Kaffee wäre super, danke.«
Ich ringe mir ein Lächeln ab, fülle Müsli in eine Schale und setze mich an den Tisch. Ich weiß, dass sie das Mitleid nur heucheln, wo sie gerade noch über meinen Kummer gelacht haben, aber ich nehme es hin. Sollen sie mich doch für ein kleines Naivchen halten, das gerade verlassen wurde, Hauptsache, ich muss ihnen nicht die Wahrheit erklären.
»Was hast du heute so vor?«, fragt Kris heiter.
»Lernen, fürchte ich«, sage ich niedergeschlagen. »Meine Studienbetreuerin hat mir letzte Woche die Hölle heiß gemacht. Ich muss mich anstrengen, wenn ich mein Stipendium nicht verlieren will.«
Wobei, will ich eigentlich noch in Oxford bleiben?
»Na ja, immerhin hast du jetzt Zeit«, sagt Jia süffisant. »Keine Ablenkung mehr.«
Sprich, kein Saint.
Ich nicke, wie betäubt.
»Geh du doch als Erstes mal schön lange duschen«, schlägt Kris mit bedeutungsschwerem Blick vor. »Es sollte noch ganz viel warmes Wasser geben. Du kannst mein Shampoo benutzen.«
»Danke«, sage ich, obwohl das offensichtlich weniger ein freundliches Angebot als ein Hinweis darauf war, wie scheiße ich wohl aussehe, nach zwei Tagen Dauerschluchzen ohne einen einzigen Blick in den Spiegel.
Ich weiß nicht, ob ich weine, weil Saint mich verraten hat, oder weil ich einfach nicht glauben kann, dass ich mich in einen Mann verliebt habe, der zu solch schrecklichen Verbrechen fähig ist.
»Wir gehen später in die College-Bar«, sagt Jia noch. »Es ist Karaoke-Abend. Komm doch auch!«
»Ich weiß nicht …«
»Es wird dir guttun, wenn du etwas rauskommst. Du solltest keine Zeit damit verschwenden, diesem Arsch hinterherzuflennen.«
»Wichser«, stimmt Kris zu. »Gut, dass du ihn los bist.«
»Vergiss ihn einfach. Er hat sich eh schon dem nächsten Leckerbissen auf der Speisekarte zugewendet.«
Kris sieht Jia vorwurfsvoll an.
»Was denn? Sorry«, sagt sie wenig aufrichtig zu mir. »Aber wir haben dich ja gewarnt. Diese reichen Arschlöcher sind alle gleich. Wenigstens weißt du jetzt, woran du bist. Hak es einfach als Erfahrung ab, und gut ist.«
Wenn es bloß so einfach wäre.
»Danke.« Ich schenke den beiden ein kurzes, falsches Lächeln. »Ihr habt recht.«
»Scheiße, wir müssen los«, sagt Kris und schnappt sich seine Tasche.
Jia grinst mich noch mal süffisant an. »Pass auf dich auf. Und vergiss das Duschen nicht!«
Die Tür fällt hinter ihnen ins Schloss, und ich bleibe zurück.
Allein.
Ich atme tief durch. Ich will nichts lieber, als mich wieder im Bett zu verkriechen, aber es stimmt, was ich gesagt habe: Ich stehe auf wackeligen Füßen, was meine nicht gerade brillanten akademischen Leistungen betrifft. Ich habe keine Ahnung, wie meine Zukunft hier in Oxford aussieht, oder ob ich überhaupt noch bleiben will, nach allem, was ich erfahren habe. Doch ich kann nicht noch länger allein bleiben, mit meinen Gedanken, die sich um Saints Verrat drehen. Also gehe ich duschen, was mir ja wärmstens empfohlen wurde, und lasse das Wasser über meinen Körper rinnen, bis ich mich wieder halbwegs wie ein Mensch fühle. Zum Glück hatte ich noch eine Ladung Wäsche in der Maschine, als Saint all meine Sachen geholt hat. Es ist ein grauer, bedeckter Tag, deshalb ziehe ich meine flauschigste Jogginghose und einen College-Pullover an, mummele mich warm ein und gehe in die Bibliothek vom Ashford College.
»Hallo, Tessa«, begrüßt mich meine Lieblingsbibliothekarin Maeve, als ich durch die großen hölzernen Türen trete. Die Bibliothek ist eine ehemalige Kirche, mit hohen Decken, Holzbalken und Buntglasfenstern.
»Ich habe die Bücher hier, die Sie bestellt haben«, fährt Maeve fort. »Die Warteliste dafür ist eine Meile lang, also sagen Sie mir bitte Bescheid, sobald Sie fertig sind.«
»Danke«, sage ich und nehme den Bücherstapel entgegen.
»Geht es Ihnen gut?«, fragt sie mit gerunzelter Stirn. Ich hätte vielleicht etwas mehr Zeit darauf verwenden sollen, meine verheulten Augen zu überschminken.
»Ja, alles super!«, behaupte ich. »Ich habe nur Heuschnupfen. Ich bringe Ihnen die Bücher so schnell wie möglich zurück.«
Ich gehe nach oben zu meinem üblichen Arbeitsplatz in der hintersten Ecke und richte mich dort für den Tag ein. Als ich beschloss, nach Oxford zu gehen, um herauszufinden, was mit Wren passiert ist, war mir klar, dass ich als einfache Touristin wohl kaum an die entsprechenden Antworten kommen würde. Ich musste ans Ashford College, wo Wren dank ihres Forschungsstipendiums war, und als Studentin ermitteln, um möglichst jeden ihrer Schritte nachverfolgen zu können.
Ich war akademisch nie sehr begabt. Ich habe mit Ach und Krach meinen Bachelor geschafft und danach bei gemeinnützigen Kunstorganisationen gearbeitet. Ich hatte schon seit Jahren kein Buch mehr aufgeschlagen, konnte aber ein Stipendium für Menschen mit »unüblichem« Bildungshintergrund für ein einjähriges Studium am Ashford College ergattern. Das hieß so viel wie: Menschen, die nicht von Geburt an glatte Einserkandidaten gewesen sind. Ich konnte mich durch das Aufnahmeverfahren mogeln und genug lobende Empfehlungsschreiben zusammenkratzen und bekam so den Platz. Jetzt bin ich tatsächlich hier und habe Mühe, bei den Vorlesungen und Seminaren mitzukommen.
Selbst in guten Zeiten ist es quasi ein Vollzeitjob, wenn ich mich halbwegs über Wasser halten will.
Und jetzt gerade ist definitiv keine gute Zeit.
Ich sehe mir mein Wochenprogramm an: Es wartet ein Haufen Vorlesungen auf mich, und ich muss zwei Essays einreichen. Einer ist für Saints Seminar über libertine Literatur. Ich muss schlucken. Da gehe ich auf keinen Fall hin – allein der Gedanke, mit ihm im selben Raum zu sein, weckt helle Panik in mir. Aber wenn ich keinen Essay abgebe, bekomme ich Ärger mit meiner Betreuerin. »Die Libertinen und die Kirche« lautet das Thema der Woche, also hole ich seufzend die Lektüreliste hervor und öffne dann das erste der verstaubten Bücher.
***
Zum Glück sind die Texte so kompliziert, dass sie meine volle Konzentration erfordern. Ich quäle mich durch die Lektüre, kritzele einen halbherzigen Essay zum Thema zusammen und wende mich dann der nächsten Aufgabe zu. Und der übernächsten. Ehe ich mich’s versehe, ist der Tag schon um. Ich habe nur eine kurze Pause gemacht, um mir ein Sandwich aus der Cafeteria zu holen.
Irgendwann habe ich solche Kopfschmerzen, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Draußen ist es dunkel, und die Bibliothek ist fast leer. Ich recke mich gähnend und packe meine Tasche. Maeves Schicht ist lange vorbei, deshalb lege ich die Bücher in den Rückgabekasten und trete in die kühle Abendluft auf den Innenhof.
»Da bist du ja.«
Das ist Saints Stimme. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Er kommt eilig von einem anderen Gebäude herüber und sieht ziemlich besorgt aus.
»Tessa, Gott sei Dank. Ich habe dich überall gesucht.«
Ich erstarre. Fuck.
»Saint …«, sage ich mit zittriger Stimme. Er sieht zerzaust und ungepflegt aus, mit stoppeligem Dreitagebart und zerknittertem Hemd unter seiner Cabanjacke.
Es zerreißt mir das Herz, ihn so zu sehen.
»Was ist passiert?«, fragt er, als er bei mir ankommt. »Tessa, du bist einfach von der Party verschwunden. Ich habe überall nach dir gesucht, bis irgendwer meinte, du seist weggefahren. Warum hast du mir nichts gesagt?«
Er rauft sich die Haare.
»Tut mir leid. Ich brauchte einfach etwas Abstand«, sage ich vorsichtig und sehe mich um. Aber es ist spät, der Hof ist menschenleer und dunkel, nur die alten Laternen spenden dämmriges Licht. Ich schaudere.
»Abstand?«, wiederholt Saint wütend. »Tessa, hast du eine Ahnung, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Du redest nicht mit mir. Du gehst nicht ans Telefon. Was ist los, verdammt noch mal?«
Ich schlucke den Kloß in meinem Hals herunter und versuche, trotz der widerstreitenden Gefühle in meiner Brust, klar zu denken.
»Ich habe nachgedacht. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir die Sache zwischen uns beenden.«
Das habe ich auch meinen Mitbewohnern gesagt. Vielleicht ist das der einfachste Ausweg aus der Situation, wenigstens, bis ich weiß, wie zur Hölle ich weiter vorgehen soll.
Saint starrt mich an, wie vom Donner gerührt.
»Du willst es beenden? Tessa, was erzählst du da? Was ist passiert?«
Ich weiche seinem Blick aus.
»Das mit uns funktioniert einfach nicht«, sage ich fest. »Wir sind zu verschieden. Du kommst aus einer völlig anderen Welt. Es sollte nur ein nettes Abenteuer sein, aber dann ist es aus dem Ruder gelaufen, und es ging alles viel zu schnell. Bei der Blackthorn-Party ist mir das klar geworden. Es ist besser, wir beenden es jetzt, bevor jemand verletzt wird.«
Ich ziehe meinen Rucksack zurecht und gehe los, doch Saint verstellt mir den Weg.
»Tessa, rede mit mir«, sagt er mit Schmerz in der Stimme. »Du musst mir nichts vormachen. Du kannst mir die Wahrheit sagen. Warum sagst du das alles?«
»So empfinde ich es eben«, behaupte ich und versuche, an ihm vorbeizukommen. »Wir wollen unterschiedliche Dinge. Du bist doch der sexy Professor. Du wirst schon eine andere finden, die dir das Bett wärmt.«
»So denkst du von mir?«, fragt Saint gekränkt. »Nach allem, was wir zusammen erlebt haben?«
Und wieder melden sich meine verräterischen Schuldgefühle. Meine Worte verletzen ihn, er versucht, das alles irgendwie zu verstehen, und meine Entschlossenheit schmilzt dahin.
Ich muss von ihm weg, bevor mein Schutzwall komplett einstürzt.
»Ich möchte nicht darüber reden«, erkläre ich deutlich. »Bitte ruf mich nicht mehr an. Lass mich einfach in Ruhe.«
Ich gehe.
»Tessa!«, ruft Saint mir hinterher. »Tessa, warte!«
Er schließt zu mir auf, hält mich am Arm fest. Instinktiv zucke ich zurück, will mich losreißen, Adrenalin rast durch meine Adern.
»Fass mich nicht an!«
Saint lässt meinen Arm sofort los und starrt mich ungläubig an. »Du hast Angst vor mir?«, fragt er, und diese Erkenntnis schleicht sich in seinen Blick.
Erkenntnis und Kränkung.
»Ich weiß nicht, was passiert ist, bitte, Tessa, rede mit mir«, drängt er. »Lass mich dir helfen. Was es auch ist, wir finden gemeinsam eine Lösung.«
Ich schüttele den Kopf, bin noch verwirrter als zuvor. Seine unschuldige Fassade bröckelt nicht eine Sekunde. Entweder ist er ein verdammt guter Schauspieler – oder er hat nicht die geringste Ahnung, was los ist. Aber das kann ja nicht sein.
Oder?
Schreckliche Wut flammt in mir auf. Ich hasse diese Ungewissheit. Ich kann diese Scharade keinen Moment länger ertragen.
»Hör auf zu lügen!«, brülle ich, meine Stimme hallt laut über den dunklen Hof. »Ich weiß alles, Saint. Ich habe dein Tattoo gesehen!«
»Wovon redest du?«
Er sieht mich immer noch offenbar verwirrt an.
»Das Tattoo! Auf deinem Oberschenkel«, sage ich bitter. »Sie hat es auch gesehen.«
»Wer?«
»Wren!«, bricht es aus mir heraus. »An dem Abend, als sie entführt worden ist. Das ist das einzige Detail von ihrem Peiniger, an das sie sich erinnern konnte. Sie hat es mir genau beschrieben. Du kannst mich nicht mehr täuschen. Ich weiß, dass du es warst.«
KAPITEL 3 Saint
Sie denkt, dass ich es war.
Ich starre Tessa fassungslos an. Das muss ein kranker Scherz sein. Sie kann doch nicht ernsthaft glauben …
Glaubt sie aber. Ihre Blicke sind abweisend, voller Argwohn und Misstrauen. Sie weicht vor mir zurück und läuft hastig durch das Collegegelände aufs Pförtnerhaus zu.
Sie denkt, ich wäre das Monster, das ihre Schwester misshandelt hat.
O mein Gott.
»Tessa!« Ich löse mich aus meiner Erstarrung und eile ihr hinterher. »Tessa, warte!«
Sie läuft weiter, ich hole sie ein, widerstehe aber dem Drang, sie wieder in die Arme zu schließen.
»Das, was mit deiner Schwester passiert ist … Du denkst nicht ernsthaft, dass ich so was tun könnte?«, frage ich stattdessen, zutiefst erschüttert von ihren Anschuldigungen.
»Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll!«, schluchzt Tessa, und in der Dunkelheit sehe ich Tränen auf ihren Wangen glitzern. »Ich habe geglaubt, dich zu kennen, Saint. Ich habe geglaubt, ich könnte mich fallenlassen – aber dann habe ich das Tattoo gesehen.«
Das verdammte Tattoo. Ich hätte sofort merken müssen, dass etwas nicht in Ordnung war, als sie die Party so plötzlich verlassen hat. »Ich bin nicht der einzige Mensch mit dieser Tätowierung«, erkläre ich ihr, bevor sie erneut wegrennen kann.
Tessa bleibt stehen. Sie dreht sich zu mir um. »W-was?«
In ihren Augen blitzt Erleichterung auf, und das gibt mir neue Hoffnung.
Sie wollte nicht glauben, dass ich es war.
»Ich habe dieses Tattoo schon seit meiner Zeit als Student hier«, erkläre ich schnell. »Meine Freunde und ich haben uns das als Mutprobe stechen lassen, an einem Abend kurz vor den Abschlussprüfungen. Wir haben das Motiv selbst entworfen. Es war nur eine Schnapsidee …«
Ich halte inne, da mir erst jetzt bewusst wird, was das bedeutet. Wenn der Mann, der Wren misshandelt hat, diese Tätowierung trägt …
Dann muss einer meiner Freunde aus jener Nacht das Monster sein, das Tessas Schwester verletzt hat. Das ihr Leben zerstört und sie in den Tod getrieben hat.
Ich seufze tief. »O Gott, Tessa, es tut mir so leid.«
Sie wiegt den Kopf, wie um die Informationen zu verarbeiten. Ihr dunkles Haar fällt ihr über die Augen. »Du warst es nicht?«, fragt sie, und ihre Stimme klingt hoffnungsvoll.
»Nein, Liebling. Ich schwöre«, sage ich in aller Aufrichtigkeit. »Die Party der Blackthorn Society letztes Jahr? Da war ich in unserem Haus in Südfrankreich und habe an meinem Buch gearbeitet. Ich kann dir Belege zeigen«, füge ich hinzu, »Flugtickets, Kreditkartenabrechnungen. Was immer du brauchst, um mir zu glauben. Du kennst mich«, beharre ich, »du musst doch wissen, dass ich niemandem so etwas antun könnte.«
Tessa schluckt und wirkt in ihrem übergroßen Mantel ganz verloren. Ich versuche, mir vorzustellen, wie verwirrt und verraten sie sich fühlen muss, aber ich weiß, dass ich das nicht annähernd nachempfinden kann. Zu denken, dass ich sie getäuscht habe, dass ich der Schuldige sein könnte …
Womöglich werde ich sie verlieren.
Plötzlich packt mich heftige, schneidende Angst. Diese Frau hat mich vom ersten Moment an in ihren Bann gezogen, und mit jeder Nacht, die wir zusammen verbracht haben, ist mein Verlangen nach ihr nur noch weiter gewachsen. Ich brauche sie.
»Es tut mir so leid, Tessa«, sage ich noch einmal und zwinge mich, mit ruhiger Stimme zu sprechen, trotz des gewaltigen emotionalen Sturms, der in mir tobt. Mein Instinkt schreit danach, sie zu umarmen, sie zu trösten. Ihr zu helfen, den Schock und die Zweifel zu bewältigen, die ihr ins Gesicht geschrieben stehen. Doch ich zwinge mich, auf Abstand zu bleiben und ihr den Freiraum zu lassen, um den sie mich gebeten hat. »Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in dir vorgegangen ist, als du das Tattoo gesehen hast und dachtest, ich …«
Mein Handy klingelt lautstark in meiner Jackentasche. Ich hatte den Ton angelassen, um einen etwaigen Rückruf von Tessa nicht zu verpassen. Jetzt stelle ich es schnell auf lautlos und schaue sie unverwandt an.
»Lass uns irgendwo hingehen und über das alles reden«, flehe ich sie an. »Aber wenn du heute Nacht nach wie vor allein sein willst, dann verstehe ich das auch. Schick mich bitte nur nicht für immer weg. Ich garantiere dir, nichts hat sich geändert«, schwöre ich, erschüttert von dem Gedanken, sie zu verlieren. »Ich bin noch derselbe Mann, der, den du kennst. Wie gesagt, ich habe meine Seele vor dir entblößt. Ich werde immer vollkommen ehrlich zu dir sein.«
Tessa wirkt etwas unschlüssig, aber jetzt vibriert mein Handy und hindert sie daran, zu antworten.
Ich unterdrücke einen Fluch und nehme das verdammte Ding heraus, um es ganz auszuschalten.
»Wer ist es?«, fragt Tessa.
»Meine Mutter.« Stirnrunzelnd halte ich inne. Warum in aller Welt ruft sie mich um diese Uhrzeit an? »Egal. Jetzt zählst nur du.«
Sobald ich den Anruf meiner Mutter abgewiesen habe, kommt ein anderer. Diesmal ist es mein Bruder Robert.
Tessa bemerkt mein Zögern und sagt: »Geh ran!«
»Nein …« Ich will diese Chance, zu ihr durchzudringen, auf keinen Fall versäumen, doch Tessa schüttelt den Kopf und weicht nervös zurück.
»Ich kann jetzt nicht über all das reden«, sagt sie. »Du hast recht. Ich brauche etwas Abstand, um alles zu verarbeiten.«
»Aber du glaubst mir doch, oder?« Meine Brust scheint vor Angst zu zerspringen. Verdammt, sie muss mir einfach glauben.
Tessa sieht mir in die Augen und seufzt. Dann nickt sie zögernd.
Es ist nur eine winzige Bewegung, ein kurzes Zucken mit dem Kinn, aber es lässt mich erleichtert aufatmen.
Gott sei Dank.
»Ich rufe dich an, wenn ich bereit bin zu reden«, sagt sie. »Bitte melde dich bis dahin nicht bei mir.«
Ehe ich noch irgendetwas erwidern kann, dreht sie sich um und verschwindet in Richtung des beleuchteten Pförtnerhauses.
Fuck, es kostet mich eine Menge Selbstkontrolle, sie einfach so gehen zu lassen.
Robert ruft noch mal an. Ich antworte mit einem verärgerten Grummeln. »Was ist denn, verdammt noch mal? Was zum Teufel ist so wichtig?«
Einen Moment herrscht Stille. Dann die Stimme meines Bruders, extrem angespannt: »Du musst nach London kommen. Es ist ein Notfall.«
Ich starre immer noch Tessa hinterher, und es dauert einen Moment, bis ich begreife, was er sagt. »Ein Notfall?«, wiederhole ich.
»Dad ist im Krankenhaus. Er hatte wohl einen schweren Herzinfarkt. Du musst sofort herkommen.«
***
Ich renne nach Hause, springe ins Auto und fahre sofort los. Es ist schon nach Mitternacht, als ich am Krankenhaus in London ankomme und Roberts Wegbeschreibung zum VIP-Bereich der nagelneuen kardiologischen Station folge. Die Gänge sind fast menschenleer, doch gerade kommt eine Krankenschwester aus dem Zimmer meines Vaters. Ich bleibe in der Tür stehen.
Umgeben vom leisen Surren der Maschinen, döst mein Vater auf dem Klinikbett, meine Mutter nestelt an den Kissen herum, während Robert im Flur telefoniert. In Vaters Nasenloch steckt ein Schlauch, und mehrere Kabel verschwinden im Nacken seines schlabberigen grünen Krankenhaushemdes. Er sieht blass und schwach aus. Nur ein Schatten des kernigen, entschlossenen Mannes, als den ich ihn, seit ich denken kann, immer wahrgenommen habe.
Ich bleibe kurz stehen, fassungslos darüber, wie fahl sein eigentlich nur grau meliertes Haar nun erscheint. Unter den Augen hat er tiefe, dunkle Ringe. Dieser Mann hat auf mich immer wie eine unaufhaltsame Kraft gewirkt, ein ständiger Stachel in meinem Fleisch: voller Erwartungen an mich, doch stets enttäuscht. Aber es erschüttert mich zutiefst, ihn jetzt so zerbrechlich zu sehen.
»Saint.« Meine Mutter bemerkt meine Anwesenheit und steht auf. »Gott sei Dank, dass du da bist.«
Sie kommt zu mir und umarmt mich zaghaft. Ein solcher Ausdruck körperlicher Zuwendung ist völlig untypisch für die große Lillian St. Clair und nur ein weiteres Zeichen dafür, dass die Sache wirklich ernst ist.
Ich lasse sie los und trete in den Raum. »Was ist passiert?«, frage ich und steuere auf das Bett zu. Mein Vater, Alexander, ist bei Bewusstsein und schenkt mir ein mattes Lächeln.
»Kein Grund zur Sorge«, sagt er. »Viel Lärm um nichts.«
»Es war ein schwerer Herzinfarkt«, korrigiert Robert. Er läuft hin und her und strahlt dabei eine besorgte Energie aus. Unser Jüngster arbeitet im Familienunternehmen eng mit Dad zusammen und ist normalerweise ein ausgeglichener Optimist. Doch an diesem Abend sieht er fast so ausgezehrt aus wie unser Vater.
»Wann?«, frage ich.
»Vor ein paar Stunden. Er hat lange gearbeitet. Mal wieder. Die Ärzte sagen, er hätte sterben können, wenn seine Sekretärin ihn nicht gefunden hätte.«
»Hätte, hätte, hätte.« Mein Vater wischt die Sorgen beiseite. »So schnell haut mich nichts um. Und erinnert mich daran, Tricia eine Gehaltserhöhung zu gewähren«, fügt er scherzhaft hinzu. »Als ich das Gesicht der armen Frau sah, dachte ich schon, sie bräuchte selbst einen Defibrillator.«
»Darling, du musst das ernst nehmen«, sagt meine Mutter tadelnd.
»Das tue ich«, antwortet er, und unsere Blicke treffen sich. »Lillian, schau doch mal bitte, ob du etwas zu essen für mich findest«, sagt er plötzlich. »Und Robert, du könntest mal einen Arzt auftreiben, der deinem Bruder alles erklären kann.«
Robert schaut zwischen uns hin und her und nickt dann. »Komm, Mutter«, sagt er und drängt sie zur Tür. »Lass uns mal schauen, ob sie dir einen Tee zur Beruhigung machen können.«
»Dafür braucht es etwas mehr als einen Tee«, sagt sie schmallippig, aber sie folgt ihm nach draußen, und so bleiben mein Vater und ich allein zurück.
Ich gehe näher zum Bett. »Wie geht es dir wirklich?«, frage ich ruhig und bemerke das leichte Zittern seiner Hand, als er versucht, nach dem Plastikbecher mit eisgekühltem Wasser auf dem Tisch neben sich zu greifen. Ich helfe ihm, langsam trinkt er einen Schluck.
»Es ging schon mal besser«, antwortet er und lehnt sich mit einem Seufzen zurück in die Kissen. »Aber es hat auch sein Gutes. Ich habe überlegt, mich ein bisschen aus dem Büro zurückzuziehen. Eine vorübergehende Freistellung, wie man so sagt.«
»Das kann man auch einfacher haben«, greife ich seinen Tonfall auf, obwohl er mich nervt. Mein Vater ist kein Mann, der Witze macht, schon gar nicht mit mir. Dass er es jetzt doch tut, zeigt mir, dass die Lage ernster ist, als er es sich anmerken lässt.
»Vielleicht fange ich an, Bridge zu spielen. Deine Mutter sagt immer, ich soll mir ein Hobby zulegen«, fährt mein Vater fort. »Oder vielleicht Rasenbowling. Es ist ein Jammer, dass ihr Jungs mir noch keine Enkelkinder geschenkt habt. Die würden mich auf Trab halten.«
»Was ist aus deinen ganzen Ermahnungen geworden, dass wir bloß gut aufpassen sollen?«, frage ich vorsichtig. »Du sagst doch immer, die Welt sei voller geldgieriger Flittchen, die nur darauf warten, sich in das Geblüt der St. Clairs einzuzecken.«
Das leise Lachen meines Vaters wird von einem Hustenanfall verschluckt. Er trinkt noch einen Schluck Wasser und legt sich wieder hin. »Die Zeiten ändern sich, mein Sohn«, sagt er mit etwas wackeliger Stimme. »Und Momente wie diese, nun ja, sie bringen einen dazu, über die Zukunft nachzudenken. Darüber, was von uns bleibt, wenn wir aus der Welt gehen.«
»Du gehst nirgendwohin«, entgegne ich sofort, noch verstörter als vorher. »Du bist gerade einmal fünfundsechzig. Genug Zeit, noch einen Haufen Kinder zu bekommen, wenn du willst.«
»Ich weiß nicht, was deine Mutter dazu sagen würde«, sagt mein Vater mit mattem Lächeln.
»Dann tausch sie halt gegen ein jüngeres Modell aus. Das machen deine Freunde doch auch alle so«, scherze ich – bevor ich mich an die heimliche Unterhaltung erinnere, die ich bei der Party von Lancaster Media vor ein paar Wochen mitbekommen habe. Ich war zufällig auf einen hitzigen, intim wirkenden Austausch zwischen meinem Vater und einer jüngeren Französin gestoßen. Ich konnte nicht genau hören, worüber sie gestritten haben, aber man musste kein Genie sein, um zu kapieren, was Sache war.
Ich räuspere mich und wechsele schnell das Thema. Die Affären meines Vaters gehen mich nichts an. »Was sagen die Ärzte, wie lange du hierbleiben sollst?«
»Noch ein paar Tage, zur Beobachtung. Mein Blutdruck ist immer noch zu hoch, und sie sagen, ich muss ein paar Sachen ändern, um einen weiteren Infarkt zu vermeiden.«
»Was denn?«, frage ich.
»Du weißt schon, Ernährung, gesunde Lebensweise, den Alltagsstress senken.« Mein Vater verdreht die Augen. »Tricia soll mir ab und zu einen Salat machen, dann wird schon alles gut.«
Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich will ihn nicht unter Druck setzen. Er gähnt, und ich stehe auf. »Es ist spät. Du solltest dich ausruhen«, sage ich, noch immer erschüttert von seinem untypischen Verhalten. »Ich spreche mal mit den Ärzten.«
Bereits etwas schläfrig nickt er. »Danke, dass du gekommen bist, mein Sohn.«
»Selbstverständlich«, murmele ich. »Schlaf gut.«
Verunsichert verlasse ich das Zimmer. Mein Vater und ich haben vielleicht nicht die beste Beziehung zueinander. Seit dem Tod meines älteren Bruders Edward vor zehn Jahren ist unser Verhältnis sogar sehr angespannt. Plötzlich lag die Zukunft der Familie auf meinen rebellischen Schultern – und meine Eltern haben nie einen Hehl daraus gemacht, wie enttäuschend das für sie ist. Ich habe eine gewisse Distanz gewahrt und ihre Belehrungen darüber ignoriert, dass ich sesshaft werden und meinen rechtmäßigen Platz als Sohn und Ashford-Erbe einnehmen soll – mit allem, was dazugehört, jahrhundertealtes Vermächtnis, Adelstitel und Pharmaunternehmen.
Ich wollte damit nichts zu tun haben und war entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen und nach Vergnügen statt nach Verantwortung zu streben. Doch wenn ich meinen Vater so sehe und mich mit seiner Sterblichkeit auseinandersetzen muss …
Plötzlich fühlt sich das Vermächtnis konkreter an als je zuvor, wie eine furchtbare Last, die mich erdrückt.
Es erinnert mich daran, dass ich Edwards strahlendem Beispiel niemals gerecht werden kann.
Dass ich immer nur die zweite Wahl sein werde.
Ich bin schon fast bei den Fahrstühlen, als meine Mutter auftaucht. »Anthony, warte«, sagt sie. »Gehst du schon?«
»Nur kurz, ich brauche ein paar Stunden Schlaf«, sage ich, ausgelaugt von den Ereignissen des heutigen Tages. Seit Tessa von der Party verschwunden ist, bin ich völlig fertig, und ich merke, dass ich kurz vor einem Zusammenbruch stehe. »Du solltest auch versuchen, dich ein bisschen auszuruhen«, füge ich hinzu, als ich ihren angespannten Gesichtsausdruck und die Schatten unter ihren Augen sehe. »Wir können morgen früh wieder hier sein, noch bevor er aufwacht.«
»Nur, wenn du auch wirklich wiederkommst«, sagt Lillian streng. »Wir müssen mit seinen Ärzten sprechen und einen Plan machen. Das alles wäre doch nie passiert, wenn er nicht so gestresst von der Arbeit wäre. Die klinischen Studien, die Markteinführung des neuen Produkts – das kann man nicht alleine stemmen, und Gott weiß, dein Bruder tut, was er kann, aber er ist noch zu jung, um die Zügel zu übernehmen.«
Anspannung macht sich in mir breit. »Willst du damit etwa sagen, das hier sei meine Schuld?«
»Ich will sagen, dass du jetzt langsam genug Zeit mit deinem akademischen Unfug vertan hast.« Meine Mutter schaut mich entschlossen an, ihr Blick ist vernichtend. »Du hattest deinen Spaß, aber jetzt ist es an der Zeit, dass du dich deiner Verantwortung dieser Familie gegenüber stellst – ehe sich dein Vater vor lauter Arbeit vorzeitig ins Grab bringt.«
Bevor ich antworten kann, geht sie davon, aber ihre Worte hallen in mir nach und treffen mich mitten in mein schuldbewusstes Herz.
Ich kämpfe schon ewig gegen diesen Teil meines Lebens an. Ich widerstehe all ihren Erwartungen und ihrem Druck und tue, was ich kann, um das Schicksal zu ignorieren, das mir bereits bei der Geburt in die Wiege gelegt wurde – und das seit dem Tag, an dem Edward starb und mich als Haupterben hinterließ, ganz besonders auf mir lastet.
Doch wenn ich meinen Vater hier so im Krankenhaus liegen sehe, weiß ich tief in mir, dass ich nicht länger vor meinem Schicksal davonlaufen kann.
Es muss sich etwas ändern.
KAPITEL 4 Tessa
Frühmorgens sind Oxfords Straßen immer wunderbar leer. Ich laufe meine übliche Runde durch die Altstadt, vorbei an historischen Colleges und alter Architektur. Meine Glieder brennen, doch ich lasse nicht nach, ziehe meine Schleife zurück nach Ashford, jogge durch den Hof und hinunter zum Fluss.