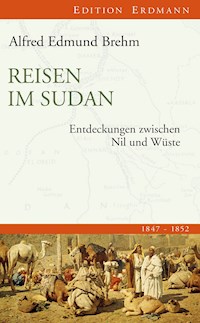3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Alfred Brehm war nicht nur ein abenteuerlustiger Tierforscher, der die Welt von Lappland bis Abessinien, von Sibirien bis in die USA bereiste, er war zugleich ein begnadeter Schriftsteller, der es verstand, farbenfroh und anschaulich, lebendig und plastisch für ein großes Publikum zu schreiben. Brehm begegnet den Tieren wie seinen Mitmenschen – er verleiht ihnen Charakter, er schildert sie mit Sympathie oder Abneigung, keinesfalls jedoch gleichgültig. Diese Auswahl zeigt ›Brehms Tierleben‹ als quicklebendigen Klassiker zum Erst- und Immer-wieder-Lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Alfred Edmund Brehm
Brehms Tierleben
Die schönsten Geschichten
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger, Stuttgart
Abbildung: »Black Monkey«©Brigeman Art Library, Berlin
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Unsere Adressen im Internet:
www.fischerverlage.de
www.fischer-klassik.de
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-10-401910-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Säugethiere
Die Affen
Die Flughunde
Der Löwe
Hunde
Die Wanderratte
Das Stinkthier
Unser Igel
Das Alpenmurmelthier
Unser Meerschweinchen
Das Faulthier
Das Zuckereichhorn
Das Känguru
Die Girafe
Die Elefanten
Der Delfin
Vögel
Der Wellensittich
Der Kukuk
Unser Wanderfalk
Der Steinadler
Die Nachtigallen
Die Pinguine
Fische
Der Menschenhai
Unser Goldfisch
Der Zitteraal
Insekten
Der Mistkäfer
Die Ameisen
Die Schmetterlinge
Die Heuschrecken
Unsere Stubenfliege
Niedere Thiere
Der Regenwurm
Die Kopffüßer
Die Auster
Anhang
Editorische Notiz
Daten zu Leben und Werk
Säugethiere
Die Affen
Die erste Ordnung der Primaten lehrt uns Menschen unseren nächsten Verwandten kennen: die Affen. Wagler nennt die Affen »umgewandelte Menschen« und wiederholt damit die uralte und doch immer neue Ansicht aller Völker, welche mit diesen fratzenhaften Wesen verkehrt haben und verkehren; das Gegentheil seines Ausspruches würde heutzutage gültigen Anschauungen entsprochen haben. Nicht die Affen sind umgewandelte Menschen, sondern diese vollkommener entwickelte Affen oder, falls ein solcher Ausdruck anstoßen sollte, höher stehende Handthiere.
Von den alten Völkern scheinen nur die Egypter und Inder eine gewisse Zuneigung für die Affen gezeigt zu haben. Die alten Egypter, auf deren Affenwürdigung ich zurückkommen werde, gruben ihre Bildnisse in den unvergänglichen Porphyr ein und schufen nach ihnen die Abbilder ihrer Götter; die alten Inder erbauten ihnen, wie ihre Nachkommen es heute noch thun, Häuser und Tempel. Salomo ließ sich zwar ebenfalls Affen aus Ophir kommen, und die Römer hielten solche zu ihrem Vergnügen, studirten, ihren Leib zergliedernd, an ihnen den inneren Bau des Menschen, freuten sich der drolligen Nachahmungssucht der Thiere, ließen sie wohl auch mit Raubthieren kämpfen, befreundeten sich aber nie recht mit ihnen und verkannten, ebensowenig wie Salomo, das »Thier« in ihnen. Die Araber gehen noch weiter; denn sie sehen in ihnen Söhne, Enkel, Urenkel und Nachkommen des Ungerechten, denen nichts heilig, nichts achtbar, nichts zu gut und nichts zu schlecht ist, welche keine Freundschaft halten mit anderen Geschöpfen des Herrn und verflucht sind seit dem Tage, an welchem sie durch das Strafgericht des Gerechten aus Menschen zu Affen verwandelt wurden, von Allah Verdammte, welche jetzt das Bild des Teufels und des Adamssohnes in wunderlicher Vereinigung zur Schau tragen.
Wir denken nicht viel anders als die Araber. Anstatt unserer nächsten Verwandten und vielleicht Vorgänger wollen auch wir kaum mehr in ihnen erkennen als Zerrbilder unserer selbst und schleudern das Urtheil der Verdammnis auf sie. Daraus erklärt sich mindestens theilweise der mit gelindem Entsetzen gemischte Abscheu aller nicht naturwissenschaftlich Gebildeten oder Verbildeten vor den Folgerungen, zu denen Darwins Lehre Veranlassung gegeben hat. Der Mensch, leiblich ein veredelter Affe, geistig ein Halbgott, will nur das letztere sein und versucht mit kindischer Ängstlichkeit seine nächsten Verwandten von sich abzustoßen, als könne er durch sie irgendwie beeinträchtigt werden.
Unser Widerwille gegen die Affen begründet sich ebensowohl auf deren leibliche wie geistige Begabungen. Sie ähneln dem Menschen zu viel und zu wenig. In der Gestalt des Menschen zeigt sich das vollendete Ebenmaß, in der Affengestalt gibt sich oft widerliche Fratzenhaftigkeit kund. Es ist unrichtig, die Affen als mißgebildete Geschöpfe zu bezeichnen, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt und auch von mir selbst geschehen ist. Es gibt bildschöne, und es gibt sehr häßliche Affen; mit dem Menschen aber ist dies nicht im geringsten anders. An und für sich sind die Affen sehr wohl ausgestattete Thiere; mit dem höchststehenden Menschen verglichen, erscheinen sie als Zerrbilder des vollendeteren Wesens. Doch hüte man sich vor aller Überschwenglichkeit; denn der Affenmensch spiegelt sich selbst in den Augen des salbadernden Menschenverherrlichers als Bruder des Menschenaffen.
Die Leibesgröße der Affen spielt in weiten Grenzen: der Gorilla kommt einem starken Manne, das Seidenäffchen einem Eichhorne gleich. Auch der Bau des Leibes ist sehr verschieden, wie die im allgemeinen richtigen Bezeichnungen »Menschen-, Hund- und Eichhornaffe« besser als lange Beschreibungen darthun. Einige sind massig, andere schlank, diese plump, jene zierlich gebaut; die einen haben stämmige, die anderen schmächtige Gliedmaßen, die meisten lange, einige kurze, einzelne gar keine Schwänze. Ebenso verhält es sich mit der Behaarung: bei diesen deckt ein spärliches Haarkleid, bei jenen ein ziemlich dichter Pelz den Leib. Die Farben des Felles, im ganzen düster, können doch zuweilen lebhaft und ansprechend sein, während die der nackten Theile oft geradezu grell, für unser Auge abstoßend erscheinen.
Die Übereinstimmung des inneren Leibesbaues der Affen ist größer als man, von ihrer äußeren Erscheinung folgernd, vermuthen möchte. Das Geripp enthält 12 bis 16 Brustwirbel, 4 bis 9 Lendenwirbel, 2 bis 5 Kreuzbein- und 3 bis 33 Schwanzwirbel; die Unterarmknochen sind getrennt und sehr beweglich, die Handwurzelknochen gestreckt. Der Schädel ist sehr verschieden gestaltet, je nachdem der Schnauzentheil vor-oder zurücktritt und der Hirnkasten sich erweitert. Das Gebiß enthält alle Zahnarten in ununterbrochenen Reihen, d.h. ohne Lücken zwischen den verschiedenen Zähnen: vier Schneidezähne, zwei oft außerordentlich und wie bei Raubthieren entwickelte Eckzähne, zwei oder drei Lück- und drei Mahlzähne in jedem Kiefer pflegen es zu bilden. Unter den Muskeln verdienen die der Hände unsere Beachtung, weil sie im Vergleiche zu denen der Menschenhand außerordentlich vereinfacht erscheinen. Der Kehlkopf befähigt nicht zu einer Sprache im menschlichen Sinne; die sackartigen Erweiterungen der Luftröhre dagegen begünstigen gellende, heulende Laute. Besonderer Erwähnung werth sind die Backentaschen, welche einige Affensippen besitzen: Ausbuchtungen der Mundhöhlenwände, welche durch eine hinter dem Mundwinkel gelegene Öffnung mit der Mundhöhle in Verbindung stehen und zur zeitweiligen Aufspeicherung der Nahrung dienen.
Man nennt die Affen oft auch Vierhänder und stellt ihnen die Zweihänder oder Menschen wegen des abweichenden Hand- und Fußbaues als grundverschiedene Thiere gegenüber. Beides ist falsch: die Affen sind keine Vierhänder, und die Zweihänder unterscheiden sich durch ihren Hand- und Fußbau wohl merklich, aber nicht grundsätzlich.
Oken beschreibt die Affen im Vergleiche zu dem Menschen mit folgenden Worten: »Die Affen sind dem Menschen ähnlich in allen Unsitten und Unarten. Sie sind boshaft, falsch, tückisch, diebisch und unanständig, sie lernen eine Menge Possen, sind aber ungehorsam und verderben oft den Spaß mitten im Spiele, indem sie dazwischen einen Streich machen wie ein tölpelhafter Hanswurst. Es gibt keine einzige Tugend, welche man einem Affen zuschreiben könnte, und noch viel weniger irgend einen Nutzen, den sie für den Menschen hätten. Wachestehen, Aufwarten, verschiedene Dinge holen, thun sie bloß so lange, bis sie die Narrheit anwandelt. Sie sind nur die schlechte Seite des Menschen, sowohl in leiblicher wie in sittlicher Hinsicht.«
Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Schilderung im wesentlichen nicht unrichtig ist. Wir wollen jedoch auch gegen die Affen gerecht sein und dürfen deshalb wirklich gute Seiten derselben nicht vergessen. Über ihre geistigen Eigenschaften in Einem abzuurtheilen, ist nicht gerade leicht, weil die ganze Sippschaft zu viele sich widersprechende Eigenthümlichkeiten zeigt. Man muß freilich anerkennen, daß die Affen boshaft, listig, tückisch, zornig oder wüthend, rachsüchtig, sinnlich in jeder Hinsicht, zänkisch, herrsch- und raufsüchtig, reizbar und grämlich, kurz leidenschaftlich sind, darf aber auch die Klugheit und Munterkeit, die Sanftheit und Milde, die Freundlichkeit und Zutraulichkeit gegen den Menschen, ihre Unterhaltungsgaben, ihre erheiternde Ernsthaftigkeit, ihre Geselligkeit, ihren Muth und ihr Einstehen für das Wohl der Gesammtheit, ihr kräftiges Vertheidigen der Gesellschaft, welcher sie angehören, selbst gegen ihnen überlegene Feinde, und ihre oft sehr unschuldige Lust an Spielereien und Neckereien nicht vergessen. Und in einem Punkte sind sie alle groß: in ihrer Liebe gegen ihre Kinder, in dem Mitleiden gegen Schwache und Unmündige nicht allein ihrer Art und Familie, sondern selbst anderer Ordnungen, ja sogar anderer Klassen des Thierreichs. Der Affe in seiner sinnlichen Liebe ist ein Scheusal; er kann aber in seiner sittlichen Liebe manchem Menschen ein Vorbild sein!
Die geistige Ausbildung, welche die Affen erreichen können, erhebt sie zwar nicht so hoch über die übrigen Säugethiere, mit Ausschluß des Menschen, stellt sie aber auch nicht so tief unter den Menschen, als von der einen Seite angenommen, von der anderen behauptet worden ist. Die Hand, welche der Affe besitzt, gewährt ihm vor anderen Thieren so große Vorzüge, daß seine Leistungen theilweise größer erscheinen, als sie sind. Er ist gelehrig, und der Nachahmungstrieb, welchen viele seines Geschlechtes besitzen, erleichtert es ihm, irgend eine Kunst oder Fertigkeit zu erlernen. Deshalb eignet er sich nach kurzer Übung die verschiedenartigsten Kunststücke an, welche einem Hunde
z.B. nur mit großer Mühe gelingen. Allein man darf nie verkennen, daß er das ihm Gelehrte immer nur mit einem gewissen Widerstreben, niemals aber mit Freude und Bewußtsein ausführt. Es hält nicht schwer, einen Affen daran zu gewöhnen, mit Messer und Gabel zu essen, aus Gläsern zu trinken, Kleider anzuziehen, ihn zum Drehen des Bratspießes oder zum Wasserholen usw. abzurichten; allein er wird solches nie mit derselben Sorgfalt, ich möchte sagen Gewissenhaftigkeit, thun wie ein wohlerzogener Hund. Dafür haben wir den Hund aber auch Jahrtausende hindurch gepflegt, gelehrt, unterrichtet und ein ganz anderes Geschöpf aus ihm gebildet als er war, während der Affe keine Gelegenheit hatte, mit dem Menschen in nähere Verbindung zu kommen. Was Affen leisten können, wird aus dem nachfolgenden hervorgehen und damit der Beweis geliefert werden, daß man Recht hat, sie zu den klügsten aller Thiere zu zählen. Ein hoher Grad von Überlegung ist ihnen nicht abzusprechen. Sie besitzen ein vortreffliches Gedächtnis und wissen ihre Erfahrungen verständig zu benutzen, mit wirklicher Schlauheit und List ihre Vortheile immer wahrzunehmen, bekunden überraschendes Geschick in der Verstellung und lassen es sich oft nicht merken, welche heillose Absicht sie in ihrem Gehirne ausbrüten, wissen sich Gefahren gewandt zu entziehen und finden trefflich die Mittel auf, gegen sie sich zu wahren. Auch Gemüth muß ihnen zuerkannt werden. Sie sind der Liebe und Zuneigung fähig, besitzen Dankbarkeit und äußern ihr Wohlwollen gegen diejenigen, welche ihnen Gutes thaten. Ein Pavian, welchen ich besaß, bewahrte mir unter allen Umständen seine unverbrüchliche Zuneigung, obgleich er leicht mit jedermann Freundschaft schloß. Sein Herz schien jedoch bloß für die Liebe zu mir Raum zu haben; denn er biß seinen eben gewonnenen Freund, sobald ich mich ihm und diesem nahte. Eine ähnliche Engherzigkeit habe ich bei allen Arten der Ordnung, welche ich beobachten konnte, wahrgenommen. Die Liebe, welche alle Affen gegen ihresgleichen bethätigen, spricht ebenfalls für ein tiefes Gemüth. Sehr viele Thiere verlassen die Kranken ihres Verbandes, einige tödten, andere fressen sie sogar: die Affen versuchen selbst ihre Todten wegzuschleppen. Doch ist ihre Zuneigung oder Liebe im allgemeinen ebenso wetterwendisch, wie sie selbst es sind. Man braucht bloß das Affengesicht zu studiren, um sich hierüber klar zu werden. Seine Beweglichkeit ist unglaublich groß. In ebenso rascher wie unregelmäßiger Folge durchlaufen es alle nur denkbaren Ausdrücke: Freundlichkeit und Wuth, Ehrlichkeit und Tücke, Lüsternheit, Genußsucht und andere Eigenschaften und Leidenschaften mehr. Und noch will es scheinen, als könne das Gesicht den Kreuz- und Quersprüngen des Affengeistes kaum folgen.
Hervorgehoben zu werden verdient, daß alle Affen, trotz ihres Verstandes, auf die albernste Weise überlistet und getäuscht werden. Ihre Leidenschaften tragen häufig einen vollständigen Sieg über ihre Klugheit davon. Sind jene rege geworden, so achten sie auch die plumpeste Falle nicht mehr und vergessen ihre Sicherheit gänzlich über der Absicht, ihrer Gier zu fröhnen. Die Malaien höhlen harte Kürbisse durch eine kleine Öffnung aus und füllen sie mit Stücken von Nahrung, namentlich mit Zucker oder mit Früchten, welche die Affen gern fressen. Diese zwängen, um zu ihrer Lieblingsspeise zu gelangen, ihre Hände durch die enge Öffnung und erfassen eins der Stücke mit solcher Gier, daß sie sich lieber fangen als das einmal Erfaßte wieder loslassen. In solcher Weise beherrschen die Leidenschaften auch die klügsten Affen – just wie so manche Menschen. Ob man deshalb berechtigt ist, ihren Verstand zu unterschätzen, möchte zu bezweifeln sein.
Die Affen waren in früheren Schöpfungsabschnitten über einen größeren Theil der Erde verbreitet als gegenwärtig; denn sie hausten im südlichen Europa, in Frankreich und England. Gegenwärtig beschränkt sich ihr Vaterland auf die warmen Theile der Erde. Gleichmäßige Wärme scheint Lebensbedingung für sie zu sein. Einige Paviane steigen zwar ziemlich hoch im Gebirge empor und ertragen geringere Wärmegrade, als man vermuthen möchte; fast alle übrigen Affen aber sind gegen Kälte höchst empfindlich. Jeder Erdtheil besitzt seine eigenen Arten, Asien mit Afrika wenigstens eine gemeinschaftlich. In Europa kommt nur eine Art vor, und zwar in einem einzigen Trupp, welcher an den Felsenwänden Gibraltars unter dem Schutze der Besatzung dieser Festung lebt.
Die Mehrzahl der Affen gehört dem Walde an; nur ein kleiner Theil lebt auf felsigen Gebirgen. Ihre Ausrüstung weist sie auf das Klettern hin: Bäume bilden daher ihren Lieblingsaufenthalt. Alle Felsenaffen bewegen sich auf diesen ungeschickt, besteigen sie auch bloß im Nothfalle.
Die Affen gehören unstreitig zu den lebendigsten und beweglichsten Säugethieren. So lange sie auf Nahrungserwerb ausgehen, sind sie nicht einen Augenblick lang ruhig. Schon die Mannigfaltigkeit ihrer Nahrung bedingt dies. Ihnen ist alles Genießbare recht. Früchte, Zwiebeln, Knollen, Wurzeln, Sämereien, Nüsse, Knospen, Blätter und saftige Pflanzenstengel bilden den Haupttheil ihrer Mahlzeiten; ein Kerbthier aber wird auch nicht verschmäht, und Eier, junge Vögelchen usw. sind Leckerbissen. Da gibt es nun immer etwas zu begucken, zu erhaschen oder abzupflücken, zu beriechen und zu kosten, um es entweder zu genießen oder auch wegzuwerfen. Solche Untersuchungen erfordern viel Bewegung; deshalb ist die ganze Bande niemals ruhig. Die Sorge um das liebe Futter scheint groß zu sein: sogar der gewaltige Elefant soll seine Prügel bekommen, wenn er so dreist ist, an der Affentafel – und das ist der ganze, große Wald – schmausen zu wollen. Von Eigenthum haben die Schelme äußerst mangelhafte Begriffe: »Wir säen, aber die Affen ernten«, sagen die Araber Ost-Sudâns. Felder und Gärten werden von allen Affen als höchst erquickliche Orte angesehen und nach Möglichkeit gebrandschatzt. Jeder einzelne Affe verwüstet, wenn er dies thun kann, zehnmal mehr, als er frißt. Gegen solche Spitzbuben hilft weder Schloß noch Riegel, weder Hag noch Mauer; sie öffnen Schlösser und steigen über Mauern hinweg, und was nicht gefressen werden kann, wird wenigstens mitgenommen, Gold und Edelsteine auch. Man muß eine Affenherde selbst gesehen haben, wenn sie auf Raub auszieht, um begreifen zu können, daß ein Landwirt sich halb todt über sie ärgern kann. Für den Unbetheiligten ist die Beobachtung der sich während des Raubzuges in ihrer ganzen Regsamkeit zeigenden Geschöpfe freilich ein höchst unterhaltendes Schauspiel. Alle Künste gelten. Es wird gelaufen, gesprungen, geklettert, gegaukelt, im Nothfalle auch geschwommen. Die Künsteleien auf dem Gezweige übersteigen allen Glauben. Nur die Menschenaffen und Paviane sind schwerfällig, die übrigen vollendete Gaukler: sie scheinen fliegen zu können. Sätze von sechs bis acht Meter Sprungweite sind ihnen Spaß; von dem Wipfel eines Baumes springen sie zehn Meter tief hernieder auf das Ende eines Astes, beugen denselben durch den Stoß tief herab und geben sich, während der Ast zurückschnellt, noch einen mächtigen Schwung, strecken Schwanz oder Hinterbeine als Steuer lang aus, und durchfliegen wie ein Pfeil die Luft. Sofort nach glücklicher Ankunft geht es weiter, auch durch die fürchterlichsten Dornen, als wandele man auf getäfeltem Fußboden. Eine Schlingpflanze ist eine höchst bequeme Treppe für die Affen, ein Baumstamm ein gebahnter Weg. Sie klettern vor- und rückwärts, oben auf einem Aste hin oder unten an ihm weg; wenn man sie in einen Baumwipfel wirft, erfassen sie mit einer Hand ein Zweiglein und hängen an ihm geduldig, bis der Ast zur Ruhe kommt, steigen dann an ihm empor und so unbefangen weiter, als hätten sie sich stets auf ebenem Boden befunden. Bricht der Zweig, so fassen sie im Fallen einen zweiten, hält dieser auch nicht, so thut es doch ein dritter, und im Nothfalle bringt sie ein Sturz auch nicht außer Fassung. Was sie mit der Vorderhand nicht ergreifen können, fassen sie mit der Hinterhand oder die neuweltlichen Arten mit dem Schwanze. Dieser wird von allen als Steuer angewandt, wenn weite Sprünge ausgeführt werden sollen, dient auch sonst noch zu den verschiedensten Zwecken, sei es selbst als eine Leiter für den nächsten. An ihm hängt sich der ganze Affe auf und wiegt und schaukelt sich nach Belieben; mit ihm holt er sich Nahrung aus Spalten und Ritzen; ihn benutzt er als Treppe für sich selbst; er dient anstatt der Hängematte, wenn sein Eigner Mittagsruhe halten will.
Die Leichtigkeit und Zierlichkeit ihrer Bewegungen zeigt sich übrigens nur beim Klettern. In dieser Beziehung leisten selbst die Menschenaffen erkleckliches, obgleich sie, wenigstens die höher begabten, mehr nach Art eines Menschen als nach Art anderer Ordnungsverwandten klettern. Der Gang der Affen ist immer mehr oder weniger plump und schwerfällig. Meerkatzen, Makaken, Roll- und Krallenaffen gehen noch am besten, schon die Paviane aber humpeln in spaßhafter Weise dahin und bewegen ihren dicken Hintern dabei so ausdrucksvoll, daß es aussieht, als wollten sie einen deutschen Bauerntanz aufführen. Der Gang der Menschenaffen ist kaum noch Gang zu nennen. Während jene mit der ganzen Sohle auftreten, stützen diese sich auf die eingeschlagenen Knöchel der Finger ihrer Hände und werfen den Leib schwerfällig vorwärts, so daß die Füße zwischen die Hände zu stehen kommen. Einige Sippen der Ordnung schwimmen vortrefflich, andere gehen im Wasser unter wie Blei. Zu ersteren gehören die Meerkatzen, von denen ich einige mit der größten Schnelligkeit und Sicherheit über den Blauen Nil schwimmen sah, zu den letzteren die Paviane und vielleicht auch die Brüllaffen; von jenen ertrank uns einer, als wir ihn baden wollten. Die Schwimmunkundigen scheuen das Wasser in hohem Grade: man hat eine fast verhungerte Familie von Brüllaffen auf einem Baume gefunden, dessen Fuß durch Überschwemmung unter Wasser gesetzt worden war, ohne daß die Affen es gewagt hätten, nach anderen, kaum sechzig Schritte entfernten Bäumen sich zu retten. Ulloa, welcher über brasilianische Thiere schrieb, hat daher für die armen, schwimmunkundigen Thiere eine hübsche Brücke erfunden, welche gewiß sehr gute Dienste leisten würde – wenn die Affen sie benutzen wollten. Er erzählt, daß je ein Brüllaffe mit seinen Händen den Schwanz eines anderen packe, und daß in dieser Weise die ganze Gesellschaft eine lange Kette aus lauter Affengliedern bilde, welche vermittels des Schwanzes des Endgliedaffen am Wipfel eines Unterbaumes befestigt und hierauf durch vereinigte Kraft aller Glieder in Schwingungen gesetzt werde, bis das Vorderglied den Zweig eines Baumes des jenseitigen Ufers erfassen und sich dort festhalten könne. Auf der solchergestalt hergerichteten Brücke sollen nun zuerst die Jungen und Schwächeren auf das andere Ufer übersetzen, dann aber der Vorderaffe die ganze Kette, deren Endglied seine Klammer löst, zu sich hinüberziehen. Prinz von Wied, ein sehr gewissenhafter Beobachter, nennt diese Erzählung bei ihrem rechten Namen: »eine spaßhafte Fabel«.
Alle Affen sind außerordentlich starkgliedrig und heben Lasten, welche verhältnismäßig für unsere schwachen Arme zu schwer sein würden: ein Pavian, den ich besaß, hing sich viele Minuten lang an einem Arme auf und hob seinen dicken Leib daran in die Höhe, so hoch es der Arm zuließ.
Das gesellige Leben der Affen ist ein für den Beobachter sehr anziehendes. Wenige Arten leben einsiedlerisch, die meisten schlagen sich in Banden zusammen. Von diesen erwählt sich jede einzelne ihren festen Wohnsitz, welcher größeren oder geringeren Umfang haben kann. Die Wahl fällt regelmäßig auf Gegenden, welche in jeder Hinsicht günstig scheinen. Etwas zu knacken und zu beißen muß es geben, sonst wandert die Bande aus. Waldungen in der Nähe menschlicher Ansiedelungen sind Paradiese: der verbotene Baum in ihnen kümmert die Affen nicht, wenn nur die Äpfel auf ihm gut sind. Mais- und Zuckerrohrfelder, Obst-, Melonen-, Bananen- und Pisanganpflanzungen gehen über alles andere; Dorfschaften, in denen jeder, welcher die unverschämten Spitzbuben züchtigt, den Aberglauben der Bewohner zu fürchten hat, sind auch nicht übel. Wenn sich die Bande erst über den Wohnort geeinigt hat, beginnt das wahre Affenleben mit all seiner Lust und Freude, seinem Kampf und Streit, seiner Noth und Sorge. Das stärkste oder älteste, also befähigtste männliche Mitglied einer Herde schwingt sich zum Zugführer oder Leitaffen auf. Diese Würde wird ihm nicht durch das allgemeine Stimmrecht übertragen, sondern erst nach sehr hartnäckigem Kampfe und Streite mit anderen Bewerbern, d.h. mit sämmtlichen übrigen alten Männchen, zuertheilt. Die längsten Zähne und die stärksten Arme entscheiden. Wer sich nicht gutwillig unterordnen will, wird durch Bisse und Püffe gemaßregelt, bis er Vernunft annimmt. Dem Starken gebührt die Krone: in seinen Zähnen liegt seine Weisheit. Der Leitaffe verlangt und genießt unbedingten Gehorsam und zwar in jeder Hinsicht. Ritterliche Artigkeit gegen das schwächere Geschlecht übt er nicht: im Sturme erringt er der Minne Sold. Das jus primae noctis gilt ihm heute noch. Er wird Stammvater eines Volkes, und sein Geschlecht mehrt sich, gleich dem Abrahams, Isaaks und Jakobs, »wie der Sand am Meere«. Kein weibliches Glied der Bande darf sich einer albernen Liebschaft mit irgend welchem Grünschnabel hingeben. Seine Augen sind scharf, und seine Zucht ist streng; er versteht in Liebessachen keinen Spaß. Auch die Äffinnen, welche sich oder besser ihn vergessen sollten, werden gemaulschellt und zerzaust, daß ihnen der Umgang mit anderen Helden der Bande gewiß verleidet wird; der betreffende Affenjüngling, welcher die Harêmsgesetze des auf sein Recht stolzen Sultâns verletzt, kommt noch schlimmer weg. Die Eifersucht macht diesen furchtbar. Es ist auch thöricht von einer Äffin, solche Eifersucht heraufzubeschwören; denn der Leitaffe ist Manns genug für sämmtliche Äffinnen seiner Herde. Wird diese zu groß, dann sondert sich unter der Führung eines inzwischen stark genug gewordenen Mitbruders ein Theil vom Haupttrupp ab und beginnt nun für sich den Kampf und den Streit um die Oberherrschaft in der Leitung der Herde und in der Liebe. Kampf findet immer statt, wo mehrere nach gleichem Ziele streben; bei den Affen vergeht aber sicher kein Tag ohne Streit und Zank. Man braucht eine Herde nur kurze Zeit zu beobachten und wird gewiß bald den Streit in ihrer Mitte und seine wahre Ursache kennen lernen.
Im übrigen übt der Leitaffe sein Amt mit Würde aus. Schon die Achtung, welche er genießt, verleiht ihm Sicherheit und Selbständigkeit, welche seinen Untergebenen fehlt; auch wird ihm von diesen in jeder Weise geschmeichelt. So sieht man, daß selbst die Äffinnen sich bemühen, ihm die höchste Gunst, welche ein Affe gewähren oder nehmen kann, zu theil werden zu lassen. Sie beeifern sich, sein Haarkleid stets von den lästigen Schmarotzern möglichst rein zu halten, und er läßt sich diese Huldigung mit dem Anstande eines Pascha’s gefallen, welchem eine Lieblingssklavin die Füße kraut. Dafür sorgt auch er treulich für die Sicherheit seiner Bande und ist deshalb in beständiger Unruhe. Nach allen Seiten hin sendet er seine Blicke, keinem Wesen traut er, und so entdeckt er auch fast immer rechtzeitig eine etwaige Gefahr.
Die Affensprache darf ziemlich reichhaltig genannt werden; wenigstens verfügt jeder Affe über sehr wechselnde Laute für verschiedenartige Erregungen. Auch der Mensch erkennt bald die Bedeutung dieser Laute. Der Ausruf des Entsetzens, welcher stets die Mahnung zur Flucht in sich schließt, ist besonders bezeichnend. Sobald dieser Warnungston laut wird, nimmt die Herde eiligst die Flucht. Die Mütter rufen ihre Kinder zusammen; diese hängen im Nu an ihr fest, und mit der süßen Bürde beladen, eilen sie so schnell als möglich nach dem nächsten Baume oder Felsen. Der alte Affe zieht voran und bezeichnet den Weg, welcher stets in der kühnsten Weise ausgeführt wird. Erst wenn er sich ruhig zeigt, sammelt sich die Herde und beginnt dann nach kurzer Zeit den Rückweg, um die unterbrochene Plünderung wieder aufzunehmen.
Jedoch nicht alle Affen flüchten vor Feinden; die stärkeren stellen sich vielmehr selbst furchtbaren Raubthieren und dem noch gefährlicheren Menschen kühn zur Wehre und lassen sich auf Kämpfe ein, deren Ausgang für den Angreifer mindestens zweifelhaft ist. Alle größeren Affen, namentlich Menschenaffen und Paviane, besitzen in ihren Zähnen so furchtbare Waffen, daß sie es mit einem Feinde wohl aufnehmen können, zumal sie im Kampfe außerordentlich treu und fest zusammenhalten. Weibliche Affen lassen sich nur, wenn sie sich ihrer Haut wehren oder ihr Junges vertheidigen müssen, in Streit ein, bethätigen dann aber ebenso große Tapferkeit wie die Männchen. Die meisten Arten kämpfen mit Händen und Zähnen: sie kratzen und beißen; allein es wird von vielen Seiten einstimmig versichert, daß sie auch mit abgebrochenen Baumästen sich vertheidigen, und es ist gewiß, daß sie Steine, Früchte, Holzstücke und dergleichen von oben herab auf ihre Gegner schleudern. Schon mit dem Pavian beginnt ohne Feuergewehr kein Eingeborener Kampf und Streit; dem Gorilla gegenüber wird er nicht einmal durch das Feuergewehr in allen Fällen zum überlegenen Gegner. Jedenfalls ist die beispielslose Wuth der Affen, welche deren Stärke noch bedeutend steigert, sehr zu fürchten, und die Gewandtheit, welche sie alle besitzen, nimmt ihrem Feinde nur zu häufig die Gelegenheit, ihnen einen entscheidenden Schlag beizubringen.
In der Gefangenschaft halten fast alle Affenarten gute Freundschaft; doch bildet sich bald ein ähnliches Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis wie unter einer freilebenden Bande. Der Stärkste erringt auch hier die Oberherrschaft und knechtet und peinigt den Schwächeren so lange, bis dieser sich fügt. Zarte Rücksicht zu nehmen, ist nicht der Affen Art; Übermuth macht sich jederzeit geltend, selbst inniggeliebten Pfleglingen gegenüber. Größere Arten, und zwar die Männchen ebensowohl wie die Weibchen, nehmen sich der kleineren, hülfloseren regelmäßig an; starke Äffinnen zeigen selbst Gelüste nach kleinen Menschenkindern oder allerlei jungen Thieren, welche sich tragen lassen. So abscheulich der Affe sonst gegen Thiere ist, so liebenswürdig beträgt er sich gegen Thierjunge oder Kinder, am liebenswürdigsten natürlich gegen die eigenen, und daher ist die Affenliebe sprichwörtlich geworden.
Die Affen gebären ein Junges, wenige Arten zwei. Dies ist regelmäßig ein kleines, häßliches Geschöpf, ausgestattet mit doppelt so lang erscheinenden Gliedmaßen, wie seine Eltern sie besitzen, und einem Gesichte, welches, seiner Falten und Runzeln halber, dem eines Greises ähnlicher sieht als dem eines Kindes. Dieser Wechselbalg ist aber der Liebling der Mutter, und sie hätschelt und pflegt ihn in rührender oder – lächerlicher Weise; denn die Liebe streift, mindestens in unseren Augen, an das lächerliche. Das Kind hängt sich bald nach seiner Geburt mit beiden Vorderhänden an dem Halse, mit beiden Hinterhänden aber an den Weichen der Mutter fest, in der geeignetsten Lage, die laufende Mutter nicht zu behelligen und ungestört zu saugen. Ältere Affenkinder springen bei Gefahr auch wohl auf Schulter und Rücken ihrer Eltern.
Anfangs ist der Affensäugling gefühl- und theilnahmslos, um so zärtlicher aber die Mutter. Sie hat ohne Unterlaß mit ihm zu thun; bald leckt sie ihn, bald laust sie ihn wieder, bald drückt sie ihn an sich, bald nimmt sie ihn in beide Hände, als wolle sie sich an seinem Anblicke weiden, bald legt sie ihn an die Brust, bald schaukelt sie ihn hin und her, als wolle sie ihn einwiegen. Plinius versichert ernsthaft, daß Äffinnen ihre Jungen aus Liebe zu Tode drücken; in der Neuzeit ist dies niemals beobachtet worden. Nach einiger Zeit beginnt der junge Affe mehr oder weniger selbständig zu werden, verlangt namentlich ab und zu ein wenig Freiheit. Diese wird ihm gewährt. Die Alte läßt ihn aus ihren Armen, und er darf mit anderen Affenkindern scherzen und spielen; sie aber verwendet keinen Blick von ihm und hält ihn in beständiger Aufsicht, geht ihm übrigens willig auf allen Schritten nach und erlaubt ihm, was sie gewähren kann. Bei der geringsten Gefahr stürzt sie auf ihn zu, läßt einen eigenthümlichen Ton hören und ladet ihn durch denselben ein, sich an ihre Brust zu flüchten. Etwaigen Ungehorsam bestraft sie mit Kniffen und Püffen, oft mit förmlichen Ohrfeigen. Doch kommt es selten dazu; denn das Affenkind ist so gehorsam, daß es manchem Menschenkinde zum Vorbilde dienen könnte, und gewöhnlich genügt ihm der erste Befehl seiner Mutter. In der Gefangenschaft theilt sie, wie ich mehrfach beobachtet habe, jeden Bissen treulich mit ihrem Sprößlinge und zeigt an seinem Geschicke einen solchen Antheil, daß man sich oft der Rührung nicht erwehren kann. Der Tod eines Kindes hat in vielen Fällen das Hinscheiden der gefangenen Mutter zur Folge. Stirbt eine Äffin, so nimmt das erste beste Mitglied der Bande die Waise an Kindesstatt an, und die Zärtlichkeit gegen ein Pflegekind der eigenen Art ist kaum geringer als die, welche dem eigenen Kinde zu theil wird. Bei anderartigen Pfleglingen ist dies anders: hier zeigt sich der Affe oft als unerklärliches Räthsel. Er pflegt seinen angenommenen Liebling nach Möglichkeit, drückt ihn an sich, reinigt ihn, behält ihn unter steter Aufsicht usw., gibt ihm aber gewöhnlich nichts zu fressen, sondern nimmt das für das Pflegekind bestimmte Futter ohne Gewissensbisse zu sich, hält jenes auch, während er frißt, sorgsam vom Napfe weg. So habe ich es an Pavianen beobachtet, wenn sie junge Hunde oder Katzen zu Pfleglingen erkoren hatten.
Ich weiß nicht, ob ich irgend einen Affen als Hausgenossen anrathen darf. Die munteren Gesellen bereiten viel Vergnügen, verursachen aber noch weit mehr Ärger. Auf lose Streiche aller Art darf man gefaßt sein, und wenn man eben nicht die Geisteskräfte des Affen studiren will, bekommt man jene doch bald gründlich satt. Die größeren Arten werden auch mitunter gefährlich; denn sie beißen und kratzen fürchterlich. Als frei herumgehendes Hausthier ist der Affe nicht zu dulden, weil sein ewig regsamer Geist beständig Beschäftigung verlangt. Wenn sein Herr solche ihm nicht gewährt, schafft er sie sich selbst und dann regelmäßig nicht eben zum Vortheile des Menschen. Einige Arten sind schon wegen ihrer Unanständigkeit nicht zu ertragen; sie beleidigen jedes sittliche Gefühl fortwährend in der abscheulichsten Weise. In Anbetracht der Untugenden, welche der Affe zeigt, der Tollheiten, welche er verübt, verschwindet der geringe Nutzen, welchen er gewährt.
Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, welche die Erforschung der Affen und ihrer Beziehungen zum Menschen neuerdings gewonnen hat, darf ein nochmaliger Rückblick auf ein vergangenes Volk und seine Anschauungen über unsere nächsten Verwandten als der beste Schluß des vorstehenden erachtet werden. Ich verdanke das folgende meinem verehrten Freunde Dümichen, einem der kenntnisreichsten unserer Alterthumsforscher, welcher die Güte gehabt hat, mir in kurzer Zusammenfassung mitzutheilen, was die Denkmäler der Pharaonenzeit in Bezug auf die den alten Egyptern bekannt gewesenen und von ihnen zur Darstellung gebrachten Thiere uns berichten.
»Unter den lebensvollen Bildern, welche, überall an den Wänden egyptischer Grabkapellen uns entgegentretend, von einer in nebelhafter Ferne hinter uns liegenden Vergangenheit uns erzählen, nehmen fast immer einen hervorragenden Platz die in mannigfachster Abwechselung dargestellten Scenen aus dem Thierleben ein. In den Wandgemälden der Grabkapellen, welche dem Todtenacker des alten Memphis angehören, in den Felsengräbern von Beni-Hassan, in der thebanischen Nekropolis und anderen Grabdenkmälern begegnen uns Darstellungen des Mantelpavian, ebenso auf Tempelwänden. Doch sehen wir hier fast immer nur das Männchen, dessen Bedeutung hier stets eine mythologische ist und zwar meistens in Beziehung zum Monde steht, natürlich abgesehen davon, wo das Bild desselben in den Inschriften der Tempel als einfaches Schriftzeichen von mancherlei Bedeutung erscheint. Ganz allerliebst, mitunter geradezu meisterhaft ausgeführt sind die kleinen aus verschiedenen Steinen geschnittenen Figuren, einen sitzenden Hamadryas darstellend, von denen man in allen ägyptischen Museen Europas mehrfache Stücke findet. Da weder der Hamadryas noch der Babuin in Egypten heimisch sind, und ebensowenig die beiden Meerkatzen der Thierwelt des unteren Nillandes angehören, sind wir durch das Vorkommen derselben schon auf solchen Denkmälern zu dem Schlusse berechtigt, daß bereits in jenen Urzeiten der Geschichte, ein Verkehr zwischen Egypten und dem Heimatslande unserer vier Affenarten bestanden haben muß.
Das Vorkommen unseres Affen auf den ältesten egyptischen Denkmälern liefert also den Beweis von einer uralten Verbindung Egyptens mit dem fernen Süden und Südosten und von einer vielleicht schon im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung stattgehabten Schiffahrt auf dem Rothen Meere. Bemerkenswerth ist, daß in der späteren Zeit unter der Ptolemäerherrschaft, wo man sich mit den Bilderschriftzeichen allerlei Schreibspielereien erlaubte, in den Inschriften zuweilen geradezu das Bild eines sitzenden Mantelpavians, welcher den Griffel oder die Rohrfeder in der rechten Hand hält, für das Wort Schreiben, Schreiber, Schrift, eintritt. Die alten Egypter versäumten es selten, ihre Wandgemälde durch hieroglyphische Beischriften noch besonders zu erläutern; so finden wir denn auch eben zur Seite der Schiffe eine Erklärung, in welcher uns unter anderem ein sorgfältiges Verzeichnis der Schiffsladungen gegeben wird. Diese Inschrift lautet in wörtlicher Übersetzung: Das Belasten der Schiffe mit einer großen Menge von Kostbarkeiten des Landes Arabien, allerlei wohlriechenden Hölzern, Haufen von Weihrauchharz, mit grünenden Weihrauchbäumen (man sieht, wie dieselben, in Holzkübel gepflanzt, von je sechs Männern auf die Schiffe getragen werden), mit Ebenholz, mit reinem Elfenbein, mit Gold und Silber aus dem Lande der Hirten, mit dem kostbaren Taschepholze und Kassiarinde, mit Ahemweihrauch und Mestemschminke, mit Ananaffen (Hamadryas), Kafuaffen (Babuin) und Tasemthieren (Wüstenluchsen), mit Fellen von Panthern des Südens, mit Weibern und ihren Kindern. Niemals ist eine Zufuhr gemacht worden gleich dieser von irgend einem Könige seit Erschaffung der Welt.
Die meisterhafte Vollendung in der Ausführung dieser Wandskulpturen und die überraschende treue Nachbildung der beiden Affen, welche den Worten ›Anan‹ und ›Kafu‹ hier nachgesetzt sind, stellen es außer Zweifel, daß wir in dem Anan den Hamadryas und in dem Kafu den Babuin vor uns haben.
In den astronomischen Darstellungen, welche zumeist an den Decken der Tempel angebracht sind, wird der Mantelpavian in deutlichste Beziehung zum Monde gesetzt. Bald tritt er zur Bezeichnung des Mondes selbst ein, bald erscheint er in aufrechter Stellung mit erhobenen Händen, in freudiger Erregung den aufgehenden Mond begrüßend, und ebenso wird das Bild eines sitzenden Hamadryas zur Bezeichnung der Tag- und Nachtgleichen gebraucht. Wie weit nun diesen Auffassungen eine richtige Naturbeobachtung von Seiten der alten Egypter zu Grunde liegt, was es mit dem Einflusse des Mondes auf den Hamadryas, mit der Freude über dessen Wiedererscheinung, mit der Trauer des Männchens und seinem Verstecken, wenn er des Mondlichtes beraubt ist, mit dem Blutflusse des Weibchens zu eben jener Zeit, mit dem häufigen und regelmäßigen Wasserabschlagen dieser Affenarten, was es mit alledem für eine Bewandnis habe: darauf zu antworten, kommt nicht der Alterthums-, sondern der Naturkunde zu.
Während der Mantelpavian, wie wir sahen, vorzugsweise in mythologischer Auffassung auf egyptischen Denkmälern uns entgegentritt, treffen wir die anderen drei Arten seiner Ordnung, den Babuin und beide Meerkatzen, im altegyptischen Hause an. Musik und Tanz, Zwerge, Hunde und Affen bildeten die ergötzliche Unterhaltung in dem Hause des vornehmen Egypters; und so finden wir denn in Darstellungen, welche uns derartige Scenen vorführen, ziemlich häufig eins von letzteren lustigen Äffchen abgebildet, wie es, an dem Lehnstuhle seines Herrn angebunden, diesen durch seine komischen Sprünge und Grimassen erheitert.
›Der Affe gar possirlich ist,
Zumal, wenn er vom Apfel frißt.‹
Auch dieser gewiß wahre Ausspruch ist bereits auf den altegyptischen Denkmälern wiederholt bildlich dargestellt, nur mit dem Unterschiede, daß es dort nicht Äpfel, sondern Feigen sind, deren Vertilgung der bald auf, bald unter dem Baume sitzende Affe sich angelegen sein läßt.«
Die Flughunde
Noch ehe bei uns an schönen Sommertagen die Sonne zur Rüste gegangen ist, beginnt eine der merkwürdigsten Ordnungen unserer Klasse ihr eigenthümliches Leben. Aus allen Ritzen, Höhlen und Löchern hervor kriecht eine düstere, nächtige Schar, welche sich bei Tage scheu zurückgezogen hatte, als dürfte sie sich im Lichte der Sonne nicht zeigen, und rüstet sich zu ihrem nächtlichen Werke. Je mehr die Dämmerung hereinbricht, um so größer wird die Anzahl dieser dunklen Gesellen, bis mit eintretender Nacht alle munter geworden sind und nun ihr Wesen treiben. Halb Säugethier, halb Vogel, stellen sie ein Bindeglied zwischen einer Klasse zur anderen dar, und dieser Halbheit entspricht auch ihr Leibesbau und ihre Lebensweise. Sie sind eben weder das eine noch das andere ganz: sie, die Fledermäuse, sind gleichsam ein Zerrbild der vollendeten Fluggestalt des Vogels, aber auch ein Zerrbild des Säugethiers. Unser Vaterland liegt an der Grenze ihres Verbreitungskreises und beherbergt bloß noch kleine, zarte, schwächliche Arten. Im Süden ist es anders.
Unter allen Merkmalen die ein Flatterthier besitzt, ist die Entwickelung der Haut das merkwürdigste, weil sie nicht nur die ganze Körpergestaltung, sondern namentlich auch den Gesichtsausdruck bedingt und somit die Ursache wird, daß viele Fledermaus- also auch Flughundgesichter ein geradezu ungeheuerliches Aussehen haben. Die breit geöffnete Schnauze trägt allerdings auch mit bei, daß der Gesichtsausdruck ein ganz eigenthümlicher wird: die Hautwucherung an den Ohren und der Nase aber ist es, welche dem Gesichte sein absonderliches Gepräge und – nach der Ansicht der Meisten wenigstens – seine Häßlichkeit gibt. Die Flughaut verdient eine eingehendere Betrachtung. Sie ist die Fortsetzung der Oberhaut, der Pigmentschichten und der Lederhaut beider Leibesseiten. Außer diesen beiden Platten enthält die Flatterhaut noch eine neue, elastische Haut und zwei Muskelfaserschichten, welche zwischen den äußeren Theilen liegen. Die erst vor kurzem aufgefundene, in hohem Grade dehnbare oder besser zusammenziehbare elastische Haut zeigt bei etwa dreihundertmaliger Vergrößerung ein filzartiges Gewebe und ist für die ganze Flughaut von größter Wichtigkeit, weil durch sie die Ernährung derselben geschieht. Außerdem aber reibt das Flatterthier die äußere Flughaut auch noch mit einer schmierigen, öligen, starkriechenden Flüssigkeit besonders ein. Diese Schmiere wird von gelben, plattgedrückten Drüsen abgesondert. Jedesmal nach dem Erwachen und unmittelbar vor dem Flattern erhält sie es so geschmeidig und fettig.
Wahrscheinlich steht der Geschmackssinn auf der tiefsten Stufe; doch ist auch er keineswegs stumpf zu nennen. Man hat Versuche gemacht, welche die Schärfe des Sinnes beweisen. Wenn man nämlich schlafenden, selbst halb erstarrten Fledermäusen einen Tropfen Wasser in die geöffnete Schnauze flößt, nehmen sie denselben ohne weiteres an und schlucken ihn hinter. Gibt man ihnen dagegen Branntwein oder sonst eine übelschmeckende Flüssigkeit, so wird alles regelmäßig zurückgewiesen. Nicht minder ausgebildet ist das Auge. Im Verhältnis zur Größe des Körpers muß man es klein nennen; doch ist der Stern einer bedeutenden Erweiterung fähig. Einige Sippen haben besonders kleine Augen und diese stehen, wie Koch hervorhebt, mitunter so in den dichten Gesichtshaaren versteckt, daß sie unmöglich dem Zwecke des Sehens entsprechen können. Allein das Auge kann gänzlich außer Thätigkeit gesetzt werden, ohne daß sie eine bemerkliche Beeinträchtigung dadurch erleiden. Der Gesichtssinn wird überhaupt durch Geruch, Gehör und Gefühl wesentlich unterstützt. Man hat mehrfach den Versuch gemacht, Fledermäuse zu blenden, indem man ihnen einfach ein Stückchen englisches Pflaster über die Augen klebte: sie flogen hierauf trotz ihrer Blindheit noch genau ebenso geschickt im Zimmer umher als sehend, und verstanden es meisterhaft, allen möglichen Hindernissen, z.B. vielen, in verschiedenen Richtungen durch das Zimmer gezogenen Fäden, auszuweichen. Der Sinn des Gefühls mag wohl größtentheils in der Flatterhaut liegen; wenigstens scheint dies aus allen Beobachtungen hervorzugehen.
Die geistigen Fähigkeiten der Flatterthiere sind keineswegs so gering, als man gern annehmen möchte, und strafen den auf ziemliche Geistesarmut hindeutenden Gesichtsausdruck Lügen. Ihr Gehirn ist groß und besitzt Windungen. Hierdurch ist schon angedeutet, daß ihr Verstand kein geringer sein kann. Alle Flatterthiere zeichnen sich durch einen ziemlich hohen Grad von Gedächtnis und einige sogar durch verständige Überlegung aus. Daß sie nach dem Flattern stets dieselben Orte wieder aufsuchen und für den Winterschlaf sich immer äußerst zweckmäßige Orte wählen: dies allein schon beweist, daß sie nicht so dumm sind, als sie aussehen. Mit der bequemen Ausflucht gläubiger und denkfauler Naturerklärer, daß der sogenannte Instinkt die maßgebende geistige Kraft der Fledermäuse sei, kommt man bei genauerer Beobachtung der Thiere nicht aus. Auch ihre Feinde kennen sie sehr gut und verstehen, ihnen schlau zu begegnen, wie sie ihrerseits wieder die kleineren Thiere, denen sie nachstellen, zu überlisten wissen. So erzählt Kolenati, daß eine Fledermaus, welche in einer Lindenallee jagte, das Weibchen eines Schmetterlings verschonte, weil sie bemerkt hatte, daß dieses viele Männchen heranlockte, welche sie nun nach und nach wegschnappen konnte. Wenn man Schmetterlinge an Angeln hängt, um Fledermäuse damit zu fangen, wird man sich stets vergeblich bemühen. Sie kommen heran, untersuchen das schwebende Kerbthier, bemerken aber auch sehr bald das feine Roßhaar, an welches die Angel befestigt ist, und lassen alles vorsichtig unberührt, selbst wenn sie wenig Futter haben sollten.
Mit Eintritt der Kälte fallen alle Fledermäuse, welche in höheren Breiten leben, in einen mehr oder weniger tiefen Winterschlaf von längerer oder kürzerer Dauer, entsprechend dem strengeren oder milderen Klima ihrer Heimat. Mit Beginn der rauhen Jahreszeit suchen sie Kellergewölbe, warme Dächer, Dachsparren und dergleichen auf. Diejenigen Arten, welche noch am wenigsten empfindlich gegen Kälte sind, unterbrechen den Winterschlaf bisweilen, erwachen und fliegen in ihren geschützten Schlupfwinkeln hin und her, anscheinend weniger um Beute als um sich Bewegung zu machen. Einzelne kommen wohl auch ins Freie und flattern eine Zeitlang über der schneebedeckten Erde umher; die Mehrzahl aber schläft ununterbrochen. Schon wenige Wochen nach dem Ausfliegen macht die Liebe sich geltend. Nachdem die Fledermäuse ihren Winteraufenthalt verlassen haben, locken die verschiedenen Geschlechter, laut Koch, sich durch einen eigenthümlichen Ruf, welcher von dem ärgerlichen Bellen, Angriffen gegenüber, wesentlich verschieden ist. In warmen Ländern sollen die großen Arten so laut werden, daß sie lästig fallen können. Bei der Liebeswerbung jagen und necken die Männchen die Weibchen, stürzen sich mit ihnen aus der Luft herab und treiben allerlei Kurzweil; doch geht dieses Schwärmen und Paaren nicht bei allen Arten der Fledermäuse der Begattung voraus – letztere erfolgt vielmehr bei einzelnen auffallend frühzeitig im Jahre. Wenige Wochen nach der Begattung (man nimmt an, nach fünf bis sechs) werden die Jungen geboren. Das kreisende Weibchen hängt sich, laut Blasius und Kolenati, gegen seine Gewohnheit mit der scharfen Kralle beider Daumen der Hände auf, krümmt den Schwanz mit seiner Flatterhaut gegen den Bauch und bildet somit einen Sack oder ein Becken, in welches das zu Tage kommende Junge fällt. Sogleich nach der Geburt beißt die Alte den Nabelstrang durch, und das Junge häkelt sich, nachdem es von der Mutter abgeleckt worden ist, an der Brust fest und saugt. Die blattnasigen Fledermausweibchen haben in der Nähe der Schamtheile zwei kurze, zitzenartige Anhängsel von drüsiger Beschaffenheit, an welche sich die Jungen während der Geburt sofort ansaugen, um nicht auf die Erde zu fallen, weil diese Fledermäuse während des Gebärens ihren Schwanz zwischen den beiden eng an einander gehaltenen Beinen zurück auf den Rücken schlagen und keine Tasche für das an das Licht tretende Junge bilden. Später kriechen auch diese Jungen zu den Brustzitzen hinauf und saugen sich dort fest.
Eine noch ungeborene Fledermaus hat ein sehr merkwürdiges Ansehen. Wenn sie so weit ausgebildet ist, daß man ihre Glieder erkennen, die Flughaut aber noch nicht wahrnehmen kann, hat sie mit einem ungeborenen Menschenkinde eine gewisse Ähnlichkeit. Die Hinterfüße sind noch viel kleiner als die vorderen, und die vortretende Schnauze zeigt das Thierische; aber der Bau des Leibes, der kurze, auf dem Brustkorbe sitzende Hals, die breite Brust, die ganze Gestalt der Schulterblätter und besonders die Beschaffenheit der Vorderfüße, welche mit ihren noch kurzen Fingern halbe Hände bilden, erinnert lebhaft an den menschlichen Keimling im ersten Zustande seiner Entwickelung.
Betrachten wir endlich die Flughunde oder fruchtfressenden Fledermäuse (Pteropina). Alle zu dieser Gruppe gehörigen Flatterthiere bewohnen ausschließlich die wärmeren Gegenden der alten Welt, namentlich Südasien und seine Inseln, Mittel- und Südafrika, Australien und Oceanien. Ihrer Größe wegen sind sie seit den ältesten Zeiten als wahre Ungeheuer verschrien worden. Sie, die harmlosen und gemüthlichen Thiere, hat man als scheußliche Harpyien und furchtbare Vampire angesehen; unter ihnen suchte man die greulichen Wesen der Einbildung, welche sich auf schlafende Menschen setzen und ihnen das Herzblut aussaugen sollten; in ihnen sah man die zur ewigen Verdammnis verurtheilten Geister Verworfener, welche durch ihren Biß unschuldige Lebende ebenfalls wieder zu Verworfenen verwandeln könnten. Kurz, der blühendste Aberglaube beschäftigte sich mit wahrem Behagen mit diesen Säugethieren, welche weiter nichts verschuldet haben, als etwas eigenthümlich gebildet zu sein, und in ihrer Ordnung einige kleine und eben wegen ihrer geringen Größe ziemlich unschädliche Mitglieder zu besitzen, welche sich des Frevels der Blutaussaugung allerdings schuldig machen.
Die Naturwissenschaft kann die abergläubischen Leute – denn heute noch gibt es gerade genug der Natur vollkommen entfremdete Unwissende, welche in unseren Thieren scheußliche Vampire zu sehen glauben – besser über die fruchtfressenden Fledermäuse oder Flughunde belehren. Sie haben so ziemlich die Fledermausgestalt, aber eine viel bedeutendere Größe und einen gemüthlichen Hunde- oder Fuchskopf, welcher ihnen den Namen Flughunde oder fliegende Füchse verschafft hat. Die Flatterhaut, und deshalb auch die Gliederung der Arme und Beine ist der anderer Fledermäuse ähnlich; der Nase fehlt der Hautansatz, und die Ohren sind niemals mit einer Klappe versehen. Hierdurch kennzeichnen sie sich also leicht von den übrigen Fledermäusen. Sie bewohnen am liebsten dunkle Waldungen und bedecken bei Tage oft in unzählbarer Menge die Bäume, an deren Ästen sie, Kopf und Leib mit den Flügeln umhüllt, reihenweise sich anhängen. In hohlen Bäumen findet man sie wohl auch, und zwar zuweilen in einer Anzahl von mehreren hundert Stücken. In düsteren Urwäldern fliegen sie manchmal auch bei Tage umher; ihr eigentliches Leben beginnt aber, wie das aller Flatterthiere, erst mit der Dämmerung. Ihr scharfes Gesicht und ihre vortreffliche Spürnase lassen sie die Bäume ausfindig machen, welche gerade saftige und reife Früchte besitzen; zu diesem kommen sie einzeln, sammeln sich bald in große Scharen und sind im Stande, einen solchen Baum vollkommen kahl zu fressen. In Weinbergen erscheinen sie ebenfalls nicht selten in bedeutender Anzahl und richten dann großen Schaden an; denn sie nehmen bloß die reifen und süßen Früchte: die anderen überlassen sie den übrigen Fruchtfressern. Die Früchte saugen sie mehr aus, als sie dieselben fressen; den Faserstoff speien sie aus. Süße und duftige Früchte werden anderen entschieden vorgezogen, und deshalb bilden Bananen, Feigen und dergleichen, ebenso auch wohlschmeckende Beeren, zumal Trauben, ihre Lieblingsnahrung. Wenn sie einmal in einem Fruchtgarten eingefallen sind, fressen sie die ganze Nacht hindurch und verursachen dabei ein Geräusch, daß man sie schon aus weiter Entfernung vernehmen kann. Durch Schüsse und dergleichen lassen sie sich nicht vertreiben; denn so geschreckt fliegen sie höchstens von einem Baume auf den anderen und setzen dort ihre Mahlzeit fort.
Bei Tage sind sie sehr furchtsam und ergreifen die Flucht, sobald sie etwas Verdächtiges bemerken. Ein Raubvogel bringt sie in Aufregung, ein heftiger Donnerschlag geradezu in Verzweiflung. Sie stürzen ohne weiteres von oben zur Erde herab, rennen hier im tollsten Eifer aus einander, klettern an allen erhabenen Gegenständen, selbst an Pferden und Menschen, gewandt in die Höhe, ohne sich beirren zu lassen, hängen sich fest, breiten die Flügel, thun einige Schläge und fliegen dahin, um sich ein anderweitiges Versteck zu suchen. Ihr Flug ist rasch und lebhaft, aber nicht eben hoch; doch treibt sie ihre Furchtsamkeit bei Tage ausnahmsweise in eine Höhe von über hundert Meter empor. Sie können nur von erhabenen Gegenständen, nicht aber von der Erde abfliegen, sind jedoch ganz geschickt auf dieser und laufen wie die Ratten umher. Sie schreien viel, auch wenn sie ruhig an Bäumen hängen, und zwar eigenthümlich knarrend und kreischend, lassen zuweilen auch ein Zischen vernehmen wie Gänse.
Das Weibchen bringt einmal im Jahre ein oder zwei Junge zur Welt, welche sich an der Brust festhalten und von der Mutter längere Zeit umhergetragen, sehr geliebt und sorgfältig rein gehalten werden.
In der Gefangenschaft werden sie nach geraumer Zeit zahm, gewöhnen sich auch einigermaßen an die Personen, welche sie pflegen, zeigen sogar eine gewisse Anhänglichkeit an solche. Sie nehmen ihnen bald das Futter aus der Hand und versuchen weder zu beißen noch zu kratzen. Anders ist es, wenn man sie flügellahm geschossen hat oder sie plötzlich fängt: dann wehren sie sich heftig und beißen ziemlich derb. Man nährt sie in der Gefangenschaft mit gekochtem Reis, allerlei frischen oder getrockneten Früchten, dem Marke des Zuckerrohrs und dergleichen.
Es ist anziehend und unterhaltend, die Ansichten verschiedener Völker über diese Thiere kennen zu lernen. Schon Herodot spricht von großen Fledermäusen in Arabien, welche auf der in Sümpfen wachsenden Pflanze Casia sich aufhalten, sehr stark sind und fürchterlich schwirren. Die Leute, welche die Casia sammeln, bedecken ihren ganzen Leib und das Gesicht bis auf die Augen mit Leder, um sie hierdurch von ihren Gesichtern abzuhalten, und können dann erst Ernte halten. Strabo erzählt, daß es in Mesopotamien, in der Nähe des Euphrat, eine ungeheuere Menge Fledermäuse gäbe, welche viel größer wären als an anderen Orten, gefangen und gegessen würden. Der Schwede Köping erwähnt zuerst, daß die Flatterhunde des Nachts in ganzen Herden hervorkämen, sehr viel Palmensaft tränken, davon berauscht würden und dann wie todt auf den Boden fielen. Er selbst habe einen solchen gefangen und an die Wand genagelt; das Thier aber habe die Nägel benagt und sie so rund gemacht, als wenn man sie befeilt hätte. Jeder unkundige Europäer, namentlich die weibliche Hälfte der Menschheit, erblickt in den Flederhunden entsetzliche Vampire und fürchtet sich fast vor den Ungeheuern. Die Hindus dagegen sehen in ihnen heilige Wesen. Als sich Hügel bei Nurpur befand und abends durch die Straßen ging, sah er über sich ein Thier fliegen, schoß mit seiner Doppelflinte nach ihm und erlegte eine Fledermaus von der Größe eines Marders. Augenblicklich rotteten sich die Leute zusammen, erhoben furchtbares Geschrei und wüthendes Geheul und hielten ihm das gellende, kreischende Thier vor. Er sicherte sich dadurch, daß er sich mit dem Rücken an die Wand lehnte und die Flinte vorstreckte, konnte aber den Aufruhr nur durch eine Unwahrheit beschwichtigen, indem er sagte, er habe das Thier für eine Eule gehalten. Man glaubt vielfach, daß die Flughunde Begleiter und Träger der bösen Geister seien. Ein junger, gebildeter Spanier behauptete mit aller Zuversicht, gehört zu haben, daß sie fluchen, wenn sie mit einem brennenden Span gereizt werden. Dergleichen Wunderlichkeiten kann man mehr hören, wenn man sich mit dem weniger gebildeten Volke über die allerdings eigenthümlich gestalteten Hautflügler unterhält. Wo Fledermäuse gereizt wurden, haben wir auch schon gehört, daß geflucht wurde, nicht aber von der Fledermaus, sondern von dem, welcher seinen Muthwillen an derselben auslassen wollte; denn namentlich die großen Arten verstehen keinen Spaß: wenn sie gefangen werden, beißen sie kräftig zu, und ihr Gebiß wie ihre Krallen sind scharf, und einige von ihnen können tiefe Wunden beibringen. Wenn sie nicht mehr im Stande sind, ihren Nachstellern zu entgehen, werden sie zornig und mitunter muthig und wissen ihre natürlichen Waffen sehr gewandt zu gebrauchen; aus freien Stücken greifen sie aber niemals an und zeigen sich in ihrem ganzen Wesen als äußerst harmlose Geschöpfe.
Der Löwe
Ein einziger Blick auf den Leib des Löwen, auf den Ausdruck seines Gesichtes genügt, um der uralten Auffassung aller Völker, welche das königliche Thier kennen lernten, vom Grunde des Herzens beizustimmen. Der Löwe ist der König der vierfüßigen Räuber, der Herrscher im Reiche der Säugethiere. Und wenn auch der ordnende Thierkundige diese königliche Würde eben nicht achten will und in dem Löwen nur eine Katze von besonders kräftigem Baue erkennen muß: der Gesammteindruck, welchen das herrliche Thier macht, wird auch den Forscher zwingen, ihm unter allen seinen Verwandten die höchste Stelle einzuräumen.
Die Löwen (Leo) sind leicht von sämmtlichen übrigen Katzen zu unterscheiden. Ihre Hauptkennzeichen liegen in dem stark gebauten, kräftigen Leibe mit der kurzen, glatt anliegenden, einfarbigen Behaarung, in dem breiten, kleinäugigen Gesichte, in dem Herrschermantel, welcher sich um ihre Schultern schlägt, und in der Quaste, welche ihre Schwanzspitze ziert. Beim Vergleiche mit anderen Katzen erscheint der Rumpf der Löwen kurz, der Bauch eingezogen, und der ganze Körper deshalb sehr kräftig, nicht aber plump. An der Spitze des Schwanzes, in der Quaste verborgen, steckt ein horniger Nagel, den schon Aristoteles beachtete, aber viele der neueren Naturforscher leugneten. Die Augen sind klein und haben einen runden Stern, die Schnurren ordnen sich in sechs bis acht Reihen. Vor allem ist es die Mähne, welche die männlichen Löwen auszeichnet und ihnen das stolze, königliche Ansehen verleiht.
»Ein Königsmantel, dicht und schön,
Umwallt des Löwen Brust und Mähn’,
Eine Königskrone wunderbar,
Sträubt sich der Stirne straffes Haar.«
Diese Mähne bekleidet in vollster Ausbildung den Hals und die Vorderbrust, ändert aber so verschieden ab, daß man aus ihr allein die Heimat des Löwen erkennen kann, und daß man nach ihr, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, mehrere Arten des Thieres unterschieden hat. Für unseren Zweck darf die vielfach beregte Frage als ziemlich bedeutungslos erscheinen, da im wesentlichen alle Löwen in ihrer Lebensweise sich gleichen.
Die Zeiten, in denen man sechshundert Löwen zum Kampfe in der Arena zusammenbringen konnte, liegen um Jahrtausende hinter uns. Seitdem hat sich der König der Thiere vor dem Herrn der Erde stetig mehr und mehr zurückgezogen. Aristoteles gibt die Flüsse Ressus und Acheolus als die Grenze des Löwengebietes in Europa an und sagt ausdrücklich, daß es in Europa nirgends weiter als hier Löwen gäbe. Wann diese in unserem Erdtheile ausgerottet wurden, läßt sich nicht feststellen; sicherlich aber ist mehr als ein Jahrtausend seitdem vergangen. Daß der Löwe, und zwar unzweifelhaft die persische Spielart, vormals in Syrien und Palästina lebte, wissen wir durch die Bibel; über die Zeit der Ausrottung in dem heiligen Lande aber haben wir keine Kunde. Wie hier oder dort ergeht es dem gefährlichen Feinde der Herden allerorten: der Mensch tritt überall nach besten Kräften gegen ihn in die Schranken und wird ihn ebenso stetig wie bisher zurückdrängen und endlich vernichten. Auch der dunkelfarbige Mensch drängt den Löwen mehr und mehr zurück. Demungeachtet beherbergen die weiten Steppenländer Innerafrika’s noch Löwen in ungezählter Menge und werden sie behalten, so lange neben den zahmen noch die wilden Herden, neben Hunderttausenden von Rindern noch Millionen von Antilopen jene weiten Gebiete durchstreifen.
Der Löwe lebt einzeln, und nur während der Brunstzeit hält er sich zu seinem Weibchen. Außer der Paarzeit bewohnt jeder Löwe sein eigenes Gebiet, ohne jedoch der Nahrung wegen mit anderen seiner Art in Streit zu gerathen. Vielmehr kommt es häufig vor, daß sich zu größeren Jagdzügen mehrere Löwen vereinigen. Nach Livingstone, dessen Berichte durchaus den Stempel der Wahrheit tragen, schweifen Trupps von sechs bis acht Stücken, wahrscheinlich zwei Löwinnen mit ihren Jungen, gemeinschaftlich jagend umher; Heuglins Leute sahen eines Morgens ihrer sechs oder sieben bei einander. Unter außergewöhnlichen Umständen gesellen sich, zumal im Süden Afrika’s, noch zahlreichere Trupps. »Wenn die trockene Jahreszeit vorschreitet«, schreibt mir Eduard Mohr, »also in den Monaten Mai bis September, verlassen zahllose Antilopen- und Quaggaherden die trockenen Einöden der Kalaharisteppe oder die einsamen Hochebenen des Transvaal und suchen jene weiten Grasebenen auf, welche um Lucia-Bai sich ausbreiten, unterwegs oder hier zu unschätzbaren Scharen anwachsend. Solchen Wildherden folgt der Löwe mitunter in förmlichen Rudeln. Der mir innig befreundete Jäger John Dunn traf, wie er mir berichtete, mit seinem Gefährten Oswell im Jahre 1861 in der Anatonga-Einöde eine wandernde Blaugnuherde, vermischt mit Quaggas und Impallah-Antilopen, welche nach seiner Schätzung in einer Breite von dreiviertel Meilen (englisch) dahinzog und fünfunddreißig Minuten zum Vorübertraben gebrauchte. Dieser Herde folgten einige zwanzig große und kleine, zu einem Rudel vereinigte Löwen.« Da auch Anderson von Löwenherden spricht, müssen wir zunächst wohl an die Wahrheit dieser Angaben glauben.
Während der Paarzeit bejagen Löwe und Löwin, nach der Brunstzeit gewöhnlich ihrer zwei oder drei, gemeinschaftlich ein je nach dem Wildstande mehr oder weniger ausgedehntes Gebiet, welches sie verlassen, wenn sie ihre Beute zu sehr gelichtet oder vertrieben haben. Jeder Löwe bedarf so viele Nahrung, daß eine größere Anzahl Seinesgleichen in einer Gegend nicht lange sich ernähren können würde. Breite waldige Thäler an Flüssen sind Lieblingsorte des Löwen; im Gebirge scheint es ihm weniger zu behagen; doch steigt er nach eigenen Erfahrungen immerhin bis zu 1500 Meter an den Bergen empor.
An irgend einem geschützten Orte, im Sudân gerne in den Gebüschen, im Süden Afrika’s mit Vorliebe in den breiten Gürteln hochstengeliger Schilfgräser, welche die Betten der zeitweilig fließenden Ströme begrenzen, wählt sich der Löwe eine flache Vertiefung zu seinem Lager und ruht hier einen oder mehrere Tage lang, je nachdem die Gegend arm oder reich, unruhig oder ruhig ist. In den größeren Waldungen bewohnt er oft lange ein und denselben Platz und verläßt ihn erst dann, wenn er hier seinen Wildstand gar zu sehr gemindert hat. Auf der Wanderung bleibt er liegen, wo ihn bei seinen Streifzügen der Morgen überrascht, immer aber in den verborgensten Theilen des Dickichts.
Im ganzen ähneln seine Gewohnheiten denen anderer Katzen; doch weicht er in vielen Stücken nicht unwesentlich von denselben ab. Er ist träger als alle übrigen Mitglieder seiner Familie und liebt größere Streifzüge durchaus nicht, sondern sucht es sich so bequem zu machen, als irgend möglich. Deshalb folgt er z.B. im Ostsudân regelmäßig den Nomaden, sie mögen sich wenden, wohin sie wollen. Er zieht mit ihnen in die Steppe hinaus und kehrt mit ihnen nach dem Walde zurück; er betrachtet sie als seine steuerpflichtigen Unterthanen und erhebt von ihnen in der That die drückendsten aller Abgaben.
Seine Lebensweise ist eine rein nächtliche; denn nur gezwungen verläßt er am Tage sein Lager. Bei Tage begegnet man ihm äußerst selten, im Walde kaum zufällig, sondern erst dann, wenn man ihn ordnungsmäßig aufsucht und durch Hunde von seinem Lager auftreiben läßt. Die Araber behaupten, daß er um die Mittagszeit entsetzlich vom kalten Fieber gepeinigt werde und deshalb so faul sei. Wolle man ihn jagen, so müsse man ihn vorher durch Steinwürfe auftreiben; er selbst rühre sich nicht. So arg ist es freilich nicht, eine große Trägheit aber kann ihm nicht abgesprochen werden, wenigstens so lange, als die Sonne am Himmel steht. Wie mich meine letzte Reise nach Habesch belehrte, kommt es doch vor, daß man ihn auch bei Tage im Dickicht umherschleichen oder ruhig und still auf einem erhabenen Punkte sitzen sieht, von wo aus er das Treiben der Thiere seines Jagdgebietes beobachten will. So brachte mir einer unserer Leute die Nachricht, daß er in der Mittagsstunde einen Löwen in dem von Mensah nach dem Ain-Saba abfallenden Thale habe sitzen sehen.
Der Löwe betrachtete ihn und sein Kamel mit großer Theilnahme, ließ aber beide ungefährdet ihres Weges ziehen. Man hat dieses Umschauhalten, welches schon von Levaillant beobachtet und von späteren Reisenden wiederholt berichtet wurde, für unwahr gehalten; allein auch wir haben uns davon überzeugt. Denn ein anderer Löwe, welchen wir in der Samchara auf der Spitze eines nackten, kiesbedeckten Hügels liegen sahen, konnte offenbar nur die eine Absicht haben, sein Jagdgebiet zu überschauen, um den Ort zu ermitteln, welcher ihm bei dem abendlichen Ausgange am ehesten Beute liefern könne.
In die Nähe der Dörfer kommt er nicht vor der dritten Nachtstunde. »Drei Mal«, so sagen die Araber, »zeigt er durch Brüllen seinen Aufbruch an und warnt hierdurch alle Thiere, ihm aus dem Wege zu gehen.« Diese gute Meinung ruht leider auf schwachen Füßen; denn ebenso oft, als ich das Brüllen des Löwen vernahm, habe ich in Erfahrung gebracht, daß er lautlos zum Dorfe herangeschlichen war und irgend ein Stück Vieh weggenommen hatte. Ein Löwe, welcher kurz vor unserer ersten Ankunft in Mensah vier Nächte hinter einander das Dorf betreten hatte, war einzig und allein daran erkannt worden, daß er beim versuchten Durchbruch einer Umzäunung einige seiner Mähnenhaare verloren hatte. Es wurde als sehr wahrscheinlich angenommen, daß er auch in den ersten Nächten unseres Aufenthaltes das Dorf umschlich; dennoch vernahmen wir sein Gebrüll nur zweimal und zwar in weiter Ferne, während ich dasselbe früher in Kordofân nicht allein vor dem Dorfe, sondern mitten in demselben ertönen gehört hatte. Auch andere Beobachter erzählen, daß der Löwe sehr oft lautlos herbeigeschlichen kommt, »wie ein Dieb in der Nacht«.
Und doch sagen die Araber nicht die Unwahrheit; sie deuten das Thatsächliche nur falsch. Fritsch hörte drei Löwen in nächster Nähe seines Wagens, an welchem die Zugochsen angebunden waren, bald brüllen, bald grunzen; ich selbst vernahm in Kordofân und in den Urwaldungen am Blauen Flusse den Donner aus des Löwen Brust bald nach Einbruch der Nacht mehr als hundert Male, habe in diesem Gebrülle aber nicht eine Warnung an die Beutethiere erkennen gelernt, bin vielmehr zu der Meinung geführt worden, daß es bezwecken soll, das Jagdgebiet aufzuregen, die Thiere zur Flucht zu veranlassen und dadurch einem oder dem anderen Löwen, wenn nicht dem brüllenden, so vielleicht dem gemeinschaftlich mit ihm jagenden, irgendwo auf der Lauer liegenden Gefährten ein Wild zuzuführen. Daß der Löwe angesichts eines Viehgeheges, heiße dasselbe nun Krâl oder Serîba, in der Absicht brüllt, das eingepferchte Vieh womöglich zum furchtblinden Ausbrechen zu verleiten, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen. Ich will versuchen, den Überfall eines solchen Geheges durch den Löwen aus eigener Erfahrung zu schildern.