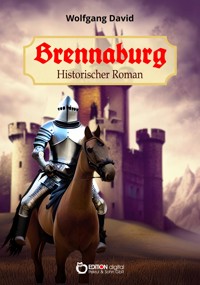
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herbst 928. Die Panzerreiter König Heinrichs I. überqueren die Elbe. Binnen weniger Monate besiegen sie die slawischen Heveller und deren Nachbarn. Als sie vier Jahre später sogar ein ungarisches Heer in die Flucht schlagen, scheint es, dass niemand ihnen widerstehen kann. Doch schon bald nach Heinrichs Tod gerät Otto, sein Sohn und Nachfolger, in größte Bedrängnis. Dieser fundierte historische Roman lässt die Regierungszeit Heinrichs I. und Ottos des Großen lebendig werden. Er schildert auch ein politisches Massaker, das zu den folgenschwersten des europäischen Mittelalters zählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Wolfgang David
Brennaburg
Historischer Roman
ISBN 978-3-96521-950-2 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1991 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Überall bedrückt der Starke den Schwachen, und die Menschen gleichen den Fischen des Meeres, die sich kreuz und quer gegenseitig verschlingen.
Synode von Trosly (909)
ERSTER TEIL: DER KÖNIG
ERSTES KAPITEL
1
EINE WOCHE NACH dem Allerheiligenfest des Jahres neunhundertachtundzwanzig verließ König Heinrich die Pfalz Quedlinburg. In seiner Begleitung befanden sich sein Sohn Otto, Graf Siegfried, der Schwager, sowie der Halberstädter Bischof Bernhard, außer ihnen ein knappes Hundert Dienstleute und Knechte. Da die Wagen schon Tage vorher aufgebrochen waren, führte man nur Packpferde mit.
Ursprünglich hatten sie in Biere übernachten wollen, um tags darauf nach Magdeburg weiterzureisen, das als Sammelort für die Aufgebote bestimmt worden war. Doch dann gab es eine Verzögerung. In einem Wald nahe der Bode stießen sie auf eine Schar Bauern, die sich offenkundig anschickte, unter einer riesigen Eiche irgendein heidnisches Spektakel zu vollziehen. Heinrich machte Bernhard ein Zeichen, die Leute nicht zu beachten, aber diese hatten sie bereits entdeckt, stürmten schreiend heran und umringten sie. Eine Frau reckte ihnen ein Bündel entgegen. Als sie es aufschlug, prallte der sechzehnjährige Otto, der gerade abgesessen war, zurück. In dem Tuch lag ein Säugling, dem ein Ohr, mehrere Finger sowie am linken Fuß alle Zehen fehlten.
Der Bischof war ebenfalls vom Pferd gestiegen. Steifbeinig trat er näher, warf einen Blick auf die Missgeburt und betupfte sich die Lippen; dann kniete er nieder und begann zu beten: „Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum …“
Als er das Vaterunser beendet hatte, stand er schroff auf, fragte die Menschen, was die mit dem Kind im Wald wollten. Abermals Geschrei. Ein Mann drängte nach vorn, verschaffte sich Ruhe und erklärte: Da der Säugling sicherlich bald sterben werde, habe man ihn unverzüglich taufen lassen wollen und sich dazu auf den Weg in die nächste Kirche begeben. Unter der Eiche hätten sie lediglich gerastet, Zauberei natürlich nicht im Sinn gehabt. Die Leute nickten eifrig.
Gelangweilt schaute Bernhard über ihre Köpfe hinweg. Sehr wahrscheinlich, dass sie wirklich einen Geistlichen gesucht hatten, dann aber, als sie an dem Baum vorbeigekommen waren, diese Absicht aufgegeben hatten. Das konnte man vielleicht herauskriegen, doch nachdem der Bischof das Kind gesehen hatte, verspürte der dazu keinerlei Neigung mehr. In Anbetracht der Umstände mochte es genügen, dass das Vorhaben verhindert und ihnen Angst eingejagt worden war.
„Also schön, guter Freund“, ließ sich Heinrich von seinem Pferd herunter vernehmen, „für heute glauben wir euch. Aber lasst euch nicht ein zweites Mal erwischen. Die Eichen hat Gott geschaffen, damit eure Schweine dick und rund werden, zu nichts anderem. Merkt euch das.“
Der junge Otto wurde von einem Lachen geschüttelt, worauf Graf Siegfried eine grimmige Miene aufsetzte, wohl, damit die Bauern nicht auf den Gedanken kamen, in das Lachen einzustimmen. Diese nickten jedoch bloß wieder. Nur ihr Sprecher, der anscheinend sofort begriffen hatte, dass der König der Sache ein Ende machen wollte, rief: „Aber Herr Bischof! Kommst du nicht mit uns? Das arme Wurm kann doch jeden Augenblick sein Leben aushauchen.“
Bernhard schien es, dass der Mann ihn verhöhne, dennoch musste er natürlich mit. Am Nachmittag erreichten sie das Dorf – vierzehn Gehöfte, die einer fränkischen Abtei zinspflichtig waren. Er vollzog die Taufe, benedizierte die Wöchnerin und das Haus, in dem das Kind geboren worden war, und riss kurzerhand einigen Bauern verdächtige Amulette ab, die sie ihn unbefangen sehen ließen. Dann brach es über ihn herein. Nicht nur für sich erbaten die Leute seinen Segen, sondern auch für ihre Brunnen, Gärten, Speicher, Geräte und Hunde. Einer schleppte sogar einen Tonkrug an, den er auf seinem Acker gefunden hatte und nicht zu benutzen wagte, bevor ihn ein Segenswort gereinigt hatte.
Geduldig kam der Bischof ihren Wünschen nach. Als er sich wieder auf den Heimweg machte, fing es an zu dämmern. Bereits von weitem hörte er Axthiebe, nahm den Geruch von Rauch wahr. Man würde also im Wald übernachten. Auf einem Kahlschlag neben der Eiche qualmten mehrere Feuer, in Form eines Hufeisens geordnet, dessen Öffnung zur Windrichtung zeigte. Zwischen ihnen das Gerippe einer Hütte, das Knechte gerade mit Zweigen abdeckten. Otto stocherte in einem der Feuer herum; sowie er den Bischof sah, ging er ihm entgegen und sagte: „Schön, dass du so spät kommst. Ich wollte im Freien schlafen, aber er erlaubt es nicht. Hast du sie beglückt?“
Er sprach hastig und monoton, schaute an dem anderen vorbei. Es war klar, dass er unter seinem Stimmwechsel litt und sich widerlich war, wenn er redete.
Bernhard baute sich trotzdem vor ihm auf und sagte nach einer Pause, die spröde Stimme seines Gegenübers nachahmend: „Junger Mann, du musst lernen, dich zu beherrschen. Du sprichst wie ein Wahnsinniger. Es hört sich an, als ob einer auf einem Reisighaufen herumspringt.“
Otto hielt ihm lachend die Faust unter die Nase. „Schade, dass man mit dir nicht kämpfen kann. Aber sieh dich vor. Sobald ich König bin, lasse ich dich entmannen. Falls du da überhaupt noch lebst.“
Bernhard wollte ihn abermals zurechtweisen, doch in diesem Moment ertönte hinter ihnen Lärm. Er blickte sich um. Vom Waldrand löste sich die mächtige Gestalt Heinrichs, neben ihm die ebenso große, aber schlankere des Grafen. Ihre Knechte trugen einen Ur, dem ein Teil des Schädels herunterhing. Otto ließ einen Jubelschrei vernehmen, dann stürmte er an seinem Vater vorbei auf die Beute los.
Dieser, über und über mit Blut und Gehirn bespritzt, kam geradewegs auf Bernhard zu. „Ich habe ihn mit dem Beil erledigt“, stieß er noch im Gehen hervor. „Hast du es krachen gehört? Ich glaube, ich bin davon taub geworden. Fast tut es mir leid um ihn, er ist bestimmt genauso alt wie ich.“ Er riss sich am Bart, eine Gebärde, die verriet, dass er vor Begeisterung außer sich war. „Na, was sagst du, Bischof?“, fuhr er aufgeräumt fort. „Ist das etwa kein Vorzeichen?“
Bernhard heftete seine Augen auf die im Zwielicht schimmernden Zähne des Königs und antwortete: „Das ist gut möglich. Es gibt aber auch andere. Darüber möchte ich mit dir reden.“
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, denn bis eben hatte er keineswegs „darüber“ reden wollen. Viel zu unsicher, wie die Begegnung mit dem missgestalteten Kind zu bewerten sei, lag ihm wenig daran, seinen Zweifel einem Mann zu offenbaren, für den er in einer Frage wie dieser eine Autorität sein und bleiben musste. Natürlich wusste Bernhard, dass es Vorzeichen gab, und der Gedanke, dass das Zusammentreffen mit dem Krüppel kein Zufall gewesen sein könnte, bedrückte ihn sehr. Andererseits liefen solche Auslegungen immer auf ein gewisses Verfügen über Gott hinaus, nur grobe Seelen übersahen das. Wo war die Grenze zu heidnischer Wahrsagerei? Gewöhnlich hütete sich der Bischof, ihr zu nahe zu kommen, doch die leichtfertige Art, in welcher der König seinen Jagderfolg gedeutet hatte, weckte in ihm den Wunsch, den anderen etwas herabzustimmen. Das bewog ihn jetzt, seine übliche Vorsicht aufzugeben.
„Also rede“, sagte Heinrich seufzend und blickte zerstreut um sich.
„Du hast das Kind gesehen?“, erkundigte sich Bernhard und drehte den Kopf so, dass sein Gesicht nicht mehr vom Feuer beschienen wurde.
„Ja.“ Heinrich hob das Beil und schlug es spielerisch in einen Baumstumpf. „Warum fragst du?“
„Ich mache mir Sorgen, Herr König. Du nicht auch?“
„Sorgen?“, wiederholte Heinrich, in einem Ton, als höre er das Wort zum ersten Mal. Seine Miene verfinsterte sich. „Was willst du eigentlich von mir?“, fauchte er plötzlich. „Sag endlich, worum es sich handelt, oder lass mich in Frieden.“
Bernhard spürte, dass er falsch angefangen hatte. Er war noch jung, Mitte dreißig erst, und vor bereits fünf Jahren zum Bischof geweiht worden. Von Natur aus eher kleinmütig, hatte dieser rasche Aufstieg seinen Ehrgeiz entfacht, in einem Maße, das ihm zuweilen unheimlich war. Mal zieh er sich verwerflichen Stolz, dann wieder verdächtigte er sich, dass er sich unterschätzte; denn wenn man ihm trotz seiner Jugend dieses Amt übertragen hatte, musste er offenbar Fähigkeiten besitzen, die ihm bislang verborgen geblieben waren. Obwohl er wusste, dass er die Erhöhung nicht so sehr seiner Gelehrsamkeit, als vielmehr seiner Herkunft verdankte, war der Verdacht inzwischen zur Gewissheit geworden. Dies rief in ihm das Verlangen hervor, sein Wirkungsfeld zu vergrößern.
Ein Ereignis, das über zwanzig Jahre zurücklag, wies seinem Tatendrang die Richtung. Heinrich hatte sich damals mit einer Witwe namens Hatheburg vermählt, einer Frau, die vor seiner Werbung jedoch schon den Schleier genommen hatte. Von Siegmund, der seinerzeit dem Halberstädter Sprengel vorgestanden hatte, war ihm daraufhin die eheliche Gemeinschaft mit ihr untersagt worden. Zwar hatten die beiden nach dem bischöflichen Einspruch noch einige Jahre zusammengelebt, sogar ein Sohn, Thankmar, war aus ihrer Verbindung hervorgegangen – schließlich hatte Heinrich aber das Sündhafte dieser Ehe erkannt, bereut und sich von Hatheburg getrennt. Seitdem Bernhard davon erfahren hatte, brannte er darauf, mindestens ebensoviel Einfluss zu erringen wie sein Vorgänger. Sein Traum war es, als Vertrauter des Königs zu gelten, den dieser immer dann zu Rate zog, wenn er sein Seelenheil gefährdet wähnte. Und dabei musste es ja nicht bleiben; zahlreiche Beispiele zeigten, wie weit es ein kluger Mann bei einem mächtigen Herrscher bringen konnte. Freilich gab es genügend Anzeichen, dass Heinrich nach einem geistlichen Vormund nicht unbedingt gierte. Auch damals hatte er (noch nicht einmal Herzog!) Siegmund keineswegs aufs Wort gehorcht, sondern sich erst von Hatheburg gelöst, als ihm die jüngere und vor allem reichere Mathilde versprochen worden war. Ein schwieriger, eigensinniger Mensch, den zu lenken bestimmt größte Geschicklichkeit erforderte. Doch gerade das reizte Bernhard, sich an dieser Aufgabe zu versuchen.
Wenn er seinem Ziel noch keinen Schritt nähergekommen war, so lag das, meinte er, daran, dass es ihm bisher an Gelegenheiten gemangelt hatte, den König von seinen Vorzügen zu überzeugen. Das tägliche Zusammensein während des bevorstehenden Feldzuges würde es ihm nun ermöglichen, dies nachzuholen. Hauptsächlich deshalb, aber auch, um seinen Eifer in Reichsbelangen zu beweisen, hatte er sich mit einem kleinen Aufgebot daran beteiligt.
„Wir Sterblichen sollten nicht über unser Maß hinaus klug sein wollen“, sprach er jetzt, ohne jedoch diesen Satz auf sich zu beziehen. „Und wie du, Herr König, weißt, liegt es in niemandes Macht, Gottes unerforschliche Absichten zu enträtseln. Wahrhaftig“, er bekreuzigte sich, „das sei mir fern.“ Er unterstrich diese wirkungsvolle Einleitung durch eine Pause, fuhr dann fort: „Manchmal scheint es allerdings, als sprächen die Dinge eigentümlich deutlich zu uns. In Frohse wurde neunhundertvierundzwanzig ein Kind geboren, das safrangelbe Zähne hatte und am Hinterkopf befiedert war. Es starb nach vier Tagen, im Sommer darauf aber raffte eine schwere Seuche die meisten Bewohner des Dorfes hinweg. Die Überlebenden meinten, dass ein Zusammenhang zwischen der Geburt des Ungeheuers und ihren Missetaten bestanden habe, und berichteten von häufigen Verstößen gegen das Fastengebot.“ Er zögerte und fügte hinzu: „Verzeih, aber ich hielt es für meine Pflicht, dir diese Begebenheit nicht zu verschweigen.“
Er fühlte, wie sich unter seinen Achselhöhlen Schweißtropfen bildeten und die Hüften herabrannen. Vor sechs Jahren hatte der König in der Nacht zum Gründonnerstag betrunken seiner Gemahlin beigewohnt; nahm man es genau, musste sogar von einer Vergewaltigung gesprochen werden, denn die fromme Frau hatte sich nach Auskunft des Gesindes heftig gewehrt. Der Vorfall war gebüßt worden, und indem er, Bernhard, jetzt darauf anspielte, ließ er erkennen, dass er eine Wiederholung nicht für ausgeschlossen hielt.
Eine solche Unterstellung war gewagt, doch Heinrich schien ihm seine Kühnheit nicht zu verargen. „Ein Säugling mit Federn und Zähnen?“, staunte er. „Was es nicht alles gibt. Welche Farbe hatten übrigens die Federn? Und wie lang waren sie?“
„Das ist mir nicht bekannt.“
„Dann hast du ihn gar nicht selbst gesehen?“
„Nein. Es ist mir erzählt worden“, antwortete Bernhard, von der absonderlichen Neugier des Königs ein wenig befremdet.
„Schade, ich hätte gern noch mehr davon gehört“, sagte dieser bedauernd, schmunzelte leicht, wurde jedoch sogleich wieder ernst und richtete seine kleinen, etwas hervorstehenden Augen fest auf den Bischof. Bernhard befiel Unruhe.
„Wir wollten uns über Vorzeichen unterhalten, nicht?“, sagte Heinrich und kratzte sich dabei am Kinn. „Weißt du, mein Freund, mit ihnen ist das so eine Sache. Ich bin ja ein bisschen älter als du und habe die Erfahrung gemacht, dass es am vernünftigsten ist, sie gar nicht zu beachten. Nicht lange, nachdem mir damals diese Geschichte mit der Königin passiert war“, er lächelte verstohlen, „besuchten uns doch wieder einmal die Ungarn, und ich dachte schon: Jetzt hast du’s! Dann gelang es uns, ihren Häuptling zu fangen und den Waffenstillstand auszuhandeln, und obwohl sie uns jedes Jahr ganz schön schröpfen, bin ich der Meinung, dass wir alles in allem keinen schlechten Tausch abgeschlossen haben. Du nicht?“
„Gewiss, Herr König“, bestätigte Bernhard gepresst.
„Siehst du. Ich kann dir Dutzende Fälle nennen, wo die Dinge, wie du dich ausgedrückt hast, eigentümlich deutlich zu mir gesprochen haben, und nachher kam es trotzdem anders. Manchmal besser, manchmal schlimmer, manchmal, das gebe ich zu, passte es auch zusammen. Eine Regel vermag ich aber nicht zu entdecken. Es stimmt schon: Gottes Ratschluss ist unerforschlich, und wer das nicht wahrhaben will und wie ein Heide hinter jedem Vogelschwarm eine Bedeutung wittert, darf sich nicht wundern, wenn er seinen Schöpfer damit verärgert.“
Bernhard stockte der Atem. Es war unglaublich. Dieser Mann, der von seinem schweren Fehltritt eben noch als von einer „Geschichte“ gesprochen hatte, erlaubte es sich ihn zu belehren, ja, er drehte den Spieß einfach um und bezichtigte ihn, den Bischof, heidnischer Neigungen. Wenn dies nun vor Zeugen geschehen wäre? Verzweifelt überlegte er, wie er sich, ohne unehrerbietig zu werden, verteidigen sollte, wurde aber von Heinrichs Bass an diesem Vorhaben gehindert.
„Da wir gerade dabei sind, möchte ich dir noch etwas sagen. Es wird dir vermutlich nicht gefallen, doch das ist mir gleichgültig. Ich bin zwar nicht so gebildet wie du, mache mir aber auch meine Gedanken und habe nie einsehen können, warum Gott in seiner Himmelsburg zwischen Knechten und Edlen nicht unterscheiden sollte. Nein, unterbrich mich nicht! Was hat ihm denn solch ein armes Bäuerlein zu bieten? Es zahlt pünktlich seinen Zehnt, hält sich an die Vorschriften, und damit ist es bereits aus. Dass er diesen Leuten nichts durchgehen lässt, ist nur zu begreiflich. Nun nimm jemanden wie mich! Wie stand es denn um das Kirchengut, bevor ich gewählt wurde? Was die Ungarn nicht fortschleppten, raubten die Herzöge, Grafen … Ja, du hast recht, ich übertreibe. Aber sehr weit von der Wahrheit entfernt ist das nicht. Mit Schenkungen und Privilegien war es auch nicht gerade üppig bestellt, was?“
„Niemand bestrei –“
„Denkt meinethalben von mir, was ihr wollt, aber dass es vor meiner Zeit der Kirche besser ging, kann wohl keiner behaupten. Wenn es jedoch so ist, glaubst du dann wirklich, dass es mir unser Schöpfer verübelt, falls ich an gewissen Tagen einmal danebengreife und statt eines Fisches eine Hühnerkeule erwische? Du verstehst: Ich lege es natürlich nicht darauf an. Aber nehmen wir an, es passiert, und nehmen wir auch noch an, ich vergesse es danach: hältst du es dann tatsächlich für wahrscheinlich, dass er mir deswegen einen Feldzug gegen die Heiden verdirbt? Denn das willst du mir doch weismachen.“
„Aber Herr König“, flüsterte Bernhard, „was redest du da? Das ist entsetzlich. Wüsste ich nicht –“
„Sei still, Bischof, sei bloß still!“ Heinrich bückte sich blitzschnell, riss einen glimmenden Ast aus dem Feuer und schleuderte ihn an Bernhard vorbei in den Wald, wo er funkensprühend an einem Stamm zerbarst. Keuchend schaute der König ihm hinterher, dann zum Bischof, der das Gesicht mit den Händen bedeckt hatte.
„Wage es nie wieder, mir zu drohen, oder du wirst es bereuen“, sagte er nach einer Pause dumpf. „Was bildest du verdammter Narr dir eigentlich ein? Dass ich ein altes Weib bin, das man mit irgendwelchen Gerüchten erschrecken kann? Schlag dir solche Flausen aus dem Kopf, sonst …“ Er zeigte auf den Strauch, in den der zerschmetterte Ast gefallen war, und setzte bereits ruhiger hinzu: „Ich diene Gott auf meine Weise, ob es die richtige ist, werde ich am Tage des Jüngsten Gerichts erfahren. Freilich, ich bin ein schwacher Mensch und gehe zuweilen in die Irre. Sag es mir getrost, wenn du meinst, dass meine Seele in Gefahr ist, doch sage es gerade heraus und nicht, indem du versuchst, mir Angst einzujagen. Das kann ich auf den Tod nicht leiden. In den nächsten Wochen allerdings verschone mich mit jeglichen Vorwürfen, denn während eines Krieges ist es auch dem Frommsten unmöglich, dauernd an seine Seligkeit zu denken. Und – kein Wort mehr von dem Balg, schon gar nicht zu den Leuten. Hast du mich verstanden?“
Bernhard nickte stumm.
„Das freut mich“, sagte Heinrich spöttisch. Er lachte kurz und berührte dabei den Bischof am Arm. „Nimm es mir nicht krumm, dass ich dich so angefahren habe, nein? Du bist selbst schuld daran. Mich an meine früheren Sünden zu erinnern, das hättest du nicht tun dürfen.“
Er blickte zur Seite.
„Wie es scheint, sind sie gerade im Begriff, meinen Ur zu rösten. Setze dich zu uns, wenn es soweit ist, ich lade dich ein. Wir wollen doch mal sehen, wie solch ein Vorzeichen schmeckt.“ Er lachte erneut, drehte sich um und ging.
Inzwischen war es völlig dunkel geworden. Bernhard fühlte die feuchte Kühle, bis über die Knie war er wie abgestorben. Trotzdem rührte er sich nicht von der Stelle. Die Kirche bindet und löst, sprach es in ihm, jede Sünde kann sie nachlassen – nur eine nicht, denn die wird weder in dieser noch in der künftigen Welt vergeben: die wider den heiligen Geist. Wer die Kirche nicht hört, sei wie ein Heide und Zöllner. Deutliche Sätze, genauso deutlich, wie jene grässlichen Lästerungen, die er gerade vernommen hatte … Die Namen von Märtyrern fielen ihm ein, Mauritius, Sebastian, Quirinus, der fünfzehnjährige Agapitus. Man hatte sie mit Pfeilen gespickt und kochendem Wasser übergossen, ihnen Hände und Füße abgeschlagen, die Zähne ausgebrochen. Er, Bernhard, aber hatte sich schon einer Drohung gebeugt.
Er gab sich einen Ruck und ging zu den anderen. Sehnsüchtig forschte er in ihren Mienen nach Anzeichen von Schadenfreude oder Verachtung, etwas, das ihn vielleicht veranlassen würde, noch einmal aufzubegehren. Er fand jedoch nichts. Siegfried reichte ihm gähnend ein Stück Fleisch, der König stierte ins Feuer, Otto schabte verkohlte Fetzen von seinem Braten. Bernhard setzte sich, und nach einem Gebet begann er zu essen.
In den Lichtkreis der Flammen drangen die Geräusche des Abends, seltsam klar, doch keineswegs störend. Ein Kauz rief sein melodisches „Kijuwitt“, ein zweiter antwortete ihm. Stöhnend rieb sich ein Ast im Rhythmus des Windes am Stamm des Nachbarbaumes. Dann und wann schrien die Wachen, um ihre Angst zu vertreiben, Schimpfworte in den Wald und warfen ihnen brennende Wachsfackeln hinterher.
Nach einer Weile bemerkte der Bischof erstaunt, dass sich seine Niedergeschlagenheit verflüchtigt hatte. Fast war ihm behaglich zumute. Hatte er nicht eben noch gemeint, sein Versagen niemals verwinden zu können? Jetzt, da er den zufriedenen Ausdruck in Heinrichs Gesicht sah, den Widerschein jener wohligen Trägheit, die auch ihn erfüllte, war ihm der Kummer, den er vorhin empfunden hatte, plötzlich nicht mehr recht verständlich; sogar seine früheren Anschauungen über diesen Mann kamen ihm auf einmal wunderlich vor. Wichtig dünkte ihn im Augenblick lediglich eines: die Beine so zu drehen, dass sie das Feuer von allen Seiten erwärmte.
Sobald man in Magdeburg eintreffen würde, sollten sämtliche Vorräte an Wein Graf Siegfried unterstellt und nur noch dann angetastet werden, wenn der König das erlaubte. Um sich über diese traurige Aussicht hinwegzutrösten, war ein Teil der Leute bis zum Morgengrauen wach geblieben und inzwischen mehr oder minder betrunken.
Einer von ihnen, Herpo, war Zinsbauer eines Klosters, das zur Halberstadter Diözese gehörte. Mit seinen siebenunddreißig Jahren befand er sich in einem Alter, das einen des Kriegshandwerks unkundigen Mann eigentlich vom Dienst jenseits der Grenze befreite. Dennoch hatte ihn der Vogt dem Aufgebot zugeteilt, angeblich deshalb, weil er außergewöhnlich geschickt beim Beschlagen von Pferden und Instandsetzen von Geräten mancherlei Art sei. Das stimmte zwar, wäre jedoch ebenfalls ein Grund gewesen, ihn zu schonen. Und tatsächlich lag die wahre Ursache für diese Entscheidung woanders. Als Nachkomme rodungsfreier Bauern besaß er sein Land zu verhältnismäßig günstigen Bedingungen. Seine Schweinezucht hatte in der Gegend einen gewissen Ruf. Es war daher begreiflich, dass dieser Besitz, inmitten von weitaus höher belasteten Höfen gelegen, die Gier der Klosterleute erregte. An Herpos Rechten ließ sich indes nicht rütteln.
Unglücklicherweise hatte jedoch sein ältester Sohn vor zwei Jahren bei einem Streit einen Mann erschlagen. Notwehr oder nicht – der Getötete zählte zum Gefolge des Grafen und war darum durch ein sehr hohes Wergeld geschützt. Das musste die Familie nun aufbringen. Und wie das so ist, gesellten sich zu diesem Missgeschick noch weitere: Herpo verletzte sich beim Bäumefällen am rechten Arm und konnte längere Zeit nur mit halber Kraft arbeiten; durch Blitzschlag brannte ihm ein Speicher ab – fast ein Drittel der Ernte kostete ihn das; schließlich wurde ein anderer Sohn von Bienen angefallen und so zugerichtet, dass er starb. Seither war Herpo mit den Abgaben immer mehr in Rückstand geraten, was dem Vogt zum Vorwand gedient hatte, ihn unter die fünf Männer einzureihen, die der Fronhof stellen musste. Dass jener dabei die Hoffnung hegte, die Frau allein würde die Wirtschaft nicht bewältigen, lag für Herpo auf der Hand. Ging diese Rechnung auf, würde er nach seiner Rückkehr gezwungen sein, sich dem Kloster zu ergeben. Falls er die Heimat überhaupt noch einmal wiedersah …
Anfangs war er entschlossen gewesen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Er hatte Vorsorge getroffen: Verwandte würden hin und wieder helfen. Doch sowie er von zu Hause fort war, brachen die ohnehin schwachen Dämme seiner Zuversicht auseinander, und ihm wurde klar, dass ihn auch das nicht retten würde.
Maß auf Maß schüttete Herpo in sich hinein, die Flammen der Verzweiflung zu löschen, gelang ihm indes nicht. Ihm gegenüber saß ein junger Bursche, beinahe noch ein Knabe, der unaufhörlich redete, lachte, sich bewegte. Zunächst hatte ihn Herpo nicht wahrgenommen, so, wie er den ganzen Tag über kaum etwas wahrgenommen hatte. Doch als die meisten schon schweigsam wurden und sich zurücklegten, blieb der Junge weiterhin aufrecht sitzen und plauderte unentwegt mit seinem Nachbarn. Wenn Herpo aufschaute, sah er das lebhafte Mienenspiel des anderen, ein Anblick, der ihn immer stärker peinigte. Bald schien es ihm, als bestünde ein Zusammenhang zwischen seinem Unglück und dem zügellosen Frohsinn des Burschen. Das war natürlich Unsinn, doch verschaffte ihm diese Vorstellung eine merkwürdige Erleichterung.
„Halt doch endlich deine Schnauze“, sagte er probeweise. Er wollte keinen Streit anfangen, sondern lediglich dahinterkommen, ob ihm nicht wohler wurde, wenn der Junge für einen Moment Ruhe gab. Dieser unterbrach sich kurz, so, als lausche er einem Geräusch hinterher, ohne indes sicher zu sein, es auch wirklich gehört zu haben. Danach erzählte er weiter – von der Jagd auf den Ur, an der er teilgenommen hatte.
Herpo ließ ihn reden. Er wartete, bis er meinte, dass der andere den Zwischenfall vergessen habe. „Du sollst deine Schnauze halten“, sagte er erneut und fühlte sofort, wie gut ihm das tat. Bei Gott, da hatte er offenbar das Richtige getroffen. Es war wundervoll, sich erst zurückzuhalten und dann unverhofft zuzuschnappen.
„Meinst du mich?“
„Wen denn sonst, du Hammel.“
„Du hast mir gar nichts zu sagen.“
Das sollte gewiss forsch klingen, hörte sich aber unsicher an. Und tatsächlich verstummte der Junge hierauf.
Herpo lauerte, doch es kam nichts mehr. Was nun? Ihn befiel Angst. In der Stille schmolz seine Hochstimmung dahin, gleich würde er wieder seiner Verzweiflung ausgeliefert sein. Er fischte einen glühenden Zapfen aus dem Feuer, warf ihn in die Richtung des Jungen, traf jedoch den Hals eines Mannes, der bereits schlief.
Brüllend sprang dieser hoch. Jemand wies auf Herpo. Der Mann hüpfte über einige Leiber hinweg und rannte um das Feuer herum auf ihn zu.
Herpo, schlagartig nüchtern, rührte sich nicht vom Fleck. Wieder einmal war etwas schiefgegangen, so, wie in letzter Zeit beinahe alles schiefgegangen war. Er hatte keine Prügelei gewollt, auch mit diesem Burschen nicht. Er hatte lediglich jenes Gefühl der Erleichterung ein bisschen verlängern wollen, das so unvermutet über ihn gekommen war. Stattdessen hatte er alles nur noch schlimmer gemacht. Er empfing zwei Fußtritte, die ihm die Luft nahmen. Von oben hagelte es Fausthiebe. Er wich ihnen kaum aus, sagte bloß matt: „Das reicht. Hör jetzt auf.“
Aus dem Empfinden heraus, dass sie in der Tat quitt waren, hatte der Mann innegehalten. Die scheinbar gleichgültige Art des anderen entfachte jedoch seinen Zorn erneut. Er stieß einen Fluch aus, riss Herpos Kopf an den Haaren nach vorn, rammte ihm das Knie unters Kinn und spukte ihm mehrmals ins Gesicht.
Herpo schloss die Augen. Über seine Wangen liefen Tränen. Es reicht, klang es in ihm, es reicht. Und ohne jedes Wutgefühl, elend wie zuvor, zog er sein Messer und trieb es dem anderen in den Bauch.
Einige Stunden später wurde Herpo dem Grafen Siegfried vorgeführt. Flüchtig besah dieser das zerschlagene Gesicht, allerdings nur, um festzustellen, ob der Mann zu ihm gehörte. Von den aufgeplatzten Brauen bis zu den Spitzen der Barthaare zogen sich zwei Bahnen getrockneten Blutes hin. Dazwischen ein heller Streifen – der Nasenrücken. Der Mund stand offen, wohl, damit sich die zerfetzten Lippen nicht berührten.
„Was ist mit dem anderen?“, fragte Siegfried. „Lebt er noch?“
„Schwer zu sagen“, antwortete einer von Herpos Bewachern. „Manchmal zuckt er – so!“ Er machte eine Bewegung und lachte anschließend über seinen Versuch, den Todeskampf nachzuahmen. „Lange dauert es jedenfalls nicht mehr.“
„Da hörst du es.“ Der Graf nickte Herpo vorwurfsvoll zu. „Das wird dich teuer zu stehen kommen.“
Er ging ein paar Schritte zurück, hin zu Bernhard, der das Beladen seiner Packpferde beobachtete und zuweilen mit bedrückter Miene auf den Misshandelten geschaut hatte.
„Es ist einer von deinen Leuten. Ich werde ihm dreißig verabreichen lassen. Was meinst du?“
Der Bischof hob die Hände. „Das geht mich nichts an“, sagte er hastig und drehte sich weg.
„Nun ja“, Siegfried lächelte schwach, „zwanzig sind auch genug. Er kommt sonst nicht mehr hoch.“
„Was ist genug?“, fragte es plötzlich neben ihm, er wandte sich um und erblickte den König sowie dessen Sohn, die in diesem Moment hinter ihrer Hütte hervortraten.
„Es geht um den Mann, der –“
„Ja, ich weiß. Und was hast du mit ihm vor?“
Siegfried zögerte. „Ich dachte an vierzig mit dem Stock“, sagte er dann in demselben Tonfall, in dem er zu Bernhard von zwanzig Schlägen gesprochen hatte. „Das scheint mir ausreichend, denn wie du siehst, haben ihn die Wachen bereits verdroschen.“
Heinrich runzelte die Stirn. „Zwanzig, dreißig, vierzig – was soll das?“, sagte er gedämpft. „Noch sind wir nicht auf der anderen Seite, noch haben die Strapazen nicht angefangen, aber diese Strolche gehen sich schon an die Kehle. Für den einen, den du jetzt schonst, werden vielleicht bald Dutzende mit ihrem Leben bezahlen müssen. Hast du das bedacht?“
In Siegfrieds ehrerbietigem Gesicht rührte sich nichts. Obwohl er verstanden hatte, was der König von ihm verlangte, verstand er doch nicht, warum. Dass sich eine Tat wie diese während des Feldzuges nicht wiederholte, dafür sorgte erfahrungsgemäß die Angst vor dem Feind. Der Mann hatte gefehlt, ein Mörder aber war er nicht. Weshalb sollte er trotzdem sterben? Im Frieden begnügte sich das Recht bei einem Totschlag unter Freien mit dem Vergleich; im Krieg, der diese Form der Sühne zwangsläufig aufschob, war eine zusätzliche Strafe in das Ermessen des Heerführers gestellt. Schlimmstenfalls pflegte man den Betreffenden zu prügeln, häufig wurde er auch nur zum Wachestehen außerhalb der Reihe oder zu anderen unbeliebten Tätigkeiten verurteilt; das Wergeld mussten er oder seine Angehörigen später natürlich auch noch zahlen. Der Gedanke, diesen Bauern hinzurichten, war dem Grafen daher so ungewohnt, dass er sich nicht sofort zu einer zustimmenden Entgegnung entschließen konnte. „Du hältst es also für erforderlich, ihn …“ Er stockte und blickte dabei zum Bischof, um zu kontrollieren, ob dieser wahrnahm, dass er sich bis zuletzt bemühte, Schaden von ihm abzuwenden.
„Ja“, sagte Heinrich knapp.
Siegfried nickte, erst langsam, dann rascher, und fragte: „Soll ich es hier tun? Oder in Magdeburg, wenn alle beisammen sind? Doch wozu warten“, antwortete er sich selber, „das spricht sich dann schon herum.“
„Richtig, Schwager“, pflichtete ihm der König bei. „Erledige es, bevor wir aufbrechen. Und noch etwas: Mache kein Geheimnis daraus, aber auch keine Vorstellung. Wer will, darf zugucken, wer nicht will, lässt es bleiben. Das Kriegsrecht braucht keine Zuschauer, doch es versteckt sich auch nicht. Es kümmert sich nur um sich. Das ist sehr wichtig, verstehst du?“
Er wandte sich zum Gehen, drehte sich aber noch einmal um, als er bemerkte, dass ihm sein Sohn nicht folgte. Dieser hatte sich hingehockt und stocherte, selbstvergessen wie ein Kind, mit einem Stöckchen in der Erde herum. Nachdenklich sah Heinrich auf ihn herab. Plötzlich presste er die Lippen zusammen, machte kehrt und ging.
Der Graf schaute ihm hinterher. „Dieser Mann ist verteufelt schlau“, sagte er versonnen. „Nichts überlässt er dem Zufall.“
„Gewiss“, entgegnete Bernhard steif. Mit einem Blick auf den jungen Otto setzte er hinzu: „Erkläre mir indes trotzdem, inwieweit es von Schläue zeugt, jemanden zum Krüppel zu schlagen, der uns noch gute Dienste leisten könnte. Sogar ich weiß, dass ein Mensch schwerlich mehr als fünfzig Hiebe übersteht.“
Siegfried wiegte den Kopf. „Nicht unbedingt. Letztlich entscheidet darüber das Geschick desjenigen, der schlägt. Doch was hat das mit unserem Fall zu tun? Dieser Bauer wird ja nun gehenkt.“
„Gehenkt?“, wiederholte Bernhard ungläubig.
„Natürlich, mein Freund.“
„Was redest du da? Du musst dich irren.“
Siegfried betrachtete den Bischof zweifelnd. „Nein, du bist es, der sich irrt. Gesagt hat er es zwar nicht, wohl aber gemeint. Dass du das nicht begriffen hast …“ Er brach in Lachen aus. „Nun sei nicht gekränkt. Ich gebe zu, auch ich habe nicht sofort erkannt, worauf der König hinauswollte.“
Fassungslos starrte ihn Bernhard an. In der Klosterschule war er stets einer der Besten gewesen, nicht nur in Fächern, die für einen künftigen Kleriker von erstrangiger Bedeutung waren, sondern auch in solchen, die einfach Gewandtheit des Denkens verlangten. Ein Rätsel wie dieses: Der Sohn eines Mannes heiratet eine Witwe, sein Vater ihre Tochter – wie sind die Kinder aus beiden Ehen miteinander verwandt? hatte ihn bereits als Elfjährigen nicht in Verlegenheit bringen können. In einem Alter, in dem der Graf vermutlich noch nicht einmal ein beschriebenes Pergament gesehen hatte, war er, Bernhard, anlässlich einer Visitation durch den Erzbischof dafür belobigt worden, dass er blitzschnell Definitionen herzusagen vermochte. (Was ist die Zunge? – Eine Geißel der Luft.) Seitdem hatte er seine Kenntnisse unaufhörlich vervollkommnet. Er war imstande zu begründen, weshalb das höllische Feuer zwar brannte, aber nicht leuchtete, wusste einigermaßen über die Rangordnungen am himmlischen Hof Bescheid, konnte über die Arten und die Dauer der im Jüngsten Gericht verhängten Strafen dozieren sowie zwingend darlegen, in welcher Gestalt die Toten einst auferstehen werden. Er beherrschte Latein und die Zeichensprache mittels der Finger, hatte jedoch von jener Unterhaltung offenkundig weniger verstanden als dieser ungebildete Kriegsmann. Das erschütterte ihn.
„Schau nicht so betrübt drein“, sagte Siegfried, der die Bestürzung des Bischofs auf seine Weise auslegte. „Gott weiß, dass ich dir gern den Gefallen getan und deinen Mann geschont hätte. Aber der König hat es anders beschlossen. Und obwohl ich mit dir fühle, kann ich doch nicht umhin, zuzugeben, dass er richtig entschieden hat. Denn durch seinen Tod nützt uns dieser Bauer gegenwärtig mehr als durch alle Heldentaten, die er später vielleicht begangen hätte.“
„Aber warum bloß?“, ließ sich in diesem Moment der junge Otto vernehmen. „Wenn der Mann nach Hause kommt, wird er Wergeld zahlen und Buße tun. Prügel kriegt er außerdem. Genügt das nicht? Mir scheint, dass es genügt. Auf mich hört der Vater nicht, aber auf dich, Siegfried, hält er große Stücke. Deshalb solltest du versuchen, ihn umzustimmen. Denn ist sein Zorn erst verraucht, bereut er gewiss diesen grausamen Befehl.“
Lächelnd sah der Graf auf ihn herab. „Dein Wunsch ehrt dich“, sagte er, „spricht doch aus ihm der künftige König, dem es widerstrebt, leichtfertig Blut zu vergießen. Hier allerdings handelt es sich um ein notwendiges Opfer. Wie du weißt, besteht unser Heer nicht nur aus Männern, die den Kampf lieben. Zudem werden durch die Widrigkeiten des Krieges Züchtigungen und selbst der Tod ihren Schrecken für sie verlieren. Es ist darum von Vorteil, ihnen beizeiten die Zähne zu zeigen und, falls möglich, auch kräftig zuzubeißen. Um sie einzuschüchtern, bedarf es freilich eines Anlasses, der sich am Beginn eines Feldzuges leider selten findet. Die Tat dieses Bauern kommt uns daher wie gerufen, was dein Vater im Unterschied zu mir sofort erkannt hat. Aus allen diesen Gründen“, schloss er mit einem kleinen Lachen, „werde ich mich hüten, ihm von deiner Bitte auch nur zu erzählen. Hast du nun verstanden?“
Otto nickte stumm. Plötzlich erhob er sich und schleuderte das Stöckchen fort, worauf sich Bischof Bernhard, den diese Gebärde an den gestrigen Abend erinnerte, unwillkürlich duckte.
Währenddessen stand Herpo noch immer zwischen seinen beiden Bewachern, und obwohl ihm der ganze Körper schmerzte, fühlte er sich nicht schlecht. Denn die Würfel waren gefallen. Das Wergeld für den Getöteten konnte er niemals aufbringen, sich aber verknechten zu lassen, zog er gar nicht erst in Betracht. Nicht nach dieser Nacht, in der er von vier betrunkenen Dienstmännern des Grafen wie ein Unfreier misshandelt worden war. Sie hatten ihn in den Wald geschleppt, hier seine Fesseln gelöst und sich dann an ihm ausgetobt. Vielleicht beließ man es bei dieser Strafe, andernfalls würde er wegen einiger Hiebe mehr auch nicht zerbrechen. Er würde hinnehmen, was man über ihn verhängte, und danach dorthin gehen, wo ihn nie wieder jemand drangsalieren konnte. Banden gab es überall. Die Familie war ohnehin nicht zu retten, die Söhne, sofern sie schlau waren, würden es genauso machen.
„Endlich“, sagte es neben ihm. Siegfried kam auf sie zu. Herpo straffte sich, und sofort hingen die beiden Wachen an seinen Armen. Er sah dem Grafen entgegen. Gerade Haltung, rascher Gang und dieser Ausdruck furchtloser Entschlossenheit, den schon ihre Kinder zur Schau trugen. Auch in Lumpen gekleidet, hätte er den Edeling nicht verleugnen können. In seiner herausfordernden Art zu laufen lag der ganze Stolz eines Menschen, der allein den Kampf anbetete und jeden verachtete, der mit dem Leben auf andere Weise verbunden war. Sein Anblick erfüllte Herpo mit solchem Hass, dass er den Kopf senkte, um sich nicht zu verraten.
Siegfried machte zwei Schritte vor ihm halt. „Du musst sterben, Mann“, sagte er mit klarer Stimme. „Das Kriegsrecht verlangt es. Bereite dich vor, der Bischof wird dir beistehen.“
Herpo hörte die Worte, verstand sie jedoch nicht. Nach einer Weile riss er die Augen auf und presste den Mund zusammen, worauf ihm ein Stöhnen entfuhr: Einige Wunden in dem zerschundenen Gesicht waren abermals aufgeplatzt, und es quollen Blutstropfen hervor. Als er sich wieder in der Gewalt hatte, suchte er den Blick des Grafen, doch dieser war längst gegangen.
Das Weitere geschah so, wie es König Heinrich gewünscht hatte. Während die Leute die Feuerstellen mit Erde bedeckten oder bereits die Pferde bestiegen, wurde Herpo unter die große Eiche geführt und mit Haselnusszweigen gebunden. Nachdem sein Kopf in der Schlinge steckte, näherte sich ihm von hinten ein riesiger Knecht, umklammerte seine Oberschenkel und hob ihn empor. Gleichzeitig zogen mehrere Männer am anderen Ende des Strickes.
Alle, die an dieser Prozedur nicht beteiligt waren, hatten ihre jeweilige Beschäftigung unterbrochen; sogar der Büttel, der inzwischen zurückgetreten war, schaute andächtig zu. Es war so ruhig, dass man das zarte Geläut der Goldhähnchen in den Wipfeln der Fichten vernehmen konnte. Plötzlich gab es ein knackendes Geräusch, Zweige fielen herab – der Sterbende hatte seine Fesseln gesprengt. Auf ein Zeichen des Grafen hängte sich der Knecht an die heftig ausschlagenden Beine, sprang aber sogleich wieder weg und wischte sich das Gesicht ab. Ein Fußtritt trieb ihn erneut an.
Dies alles hatte beiläufig aussehen sollen, das Grausige der unerwarteten Hinrichtung machte jedoch die beabsichtigte Wirkung zunichte. Als nach der Durchquerung der Bode die Leute gezählt wurden, stellte sich heraus, dass Herpos Henker, der während des Marsches das abgeknotete Seil offen am Sattel getragen hatte, spurlos verschwunden war. Drei Männer vom Tross fehlten ebenfalls. Nachdem sich Graf Siegfried mit dem König beraten hatte, verkündete er, dass sie sicherlich ertrunken seien, worauf ihm höhnisches Gelächter antwortete. Dennoch ließ man die Sache auf sich beruhen.
Weniger erfreulich auch das, was sie in Magdeburg vorfanden. Nur ein kleiner Teil der Aufgebote war bereits eingetroffen. Im Festungsgelände stank es nach Mist, bei jedem zweiten Schritt trat man auf Tierkot oder Knochen. Die Besatzung hatte nicht einmal Wachen aufgestellt. Als Siegfried erfuhr, dass sich die Männer statt der vorgeschriebenen Kriegsübungen meist der Jagd gewidmet hatten, löste er den Kommandanten ab und ließ ihn auspeitschen. Um die Stimmung unter den anderen zu heben, erwog er, noch am selben Abend Wein zu verteilen, stieß aber mit diesem Vorschlag beim König auf Widerspruch. „Wenn sie saufen wollen, müssen sie sich bei den Slawen bedienen; vorher gibt es keinen Tropfen“, sagte Heinrich und maß seinen Schwager mit einem verächtlichen Blick.
2
ALS KÖNIG HEINRICH daran ging, das Slawenland östlich der Elbe mit Krieg zu überziehen, war er jenseits der Fünfzig. Zwar war der Plan zu diesem Vorhaben nicht neu, seine Ausführung aber hatte er noch bis vor einem Jahr für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Falls er vorher starb, würde diese Aufgabe eben seinem Sohn und Nachfolger zufallen. Ihm, Heinrich, oblag es zunächst und vor allem, den Ungarn eine Lektion zu erteilen, sie womöglich so zu schlagen, dass sie sich im Reich nicht mehr blicken ließen; Ruhm genug für einen Mann, der vor noch nicht einmal zehn Jahren als erster seines Geschlechtes die Königswürde erlangt hatte. Denn keiner seiner Vorgänger war dieser Teufel bislang Herr geworden.
Niemand wusste genau, woher sie kamen. Nicht lange, nachdem sie vor einem halben Menschenalter Pannonien erobert und sich dort festgesetzt hatten, waren sie zum ersten Mal in ostfränkisches Gebiet eingefallen, und seither suchten sie es fast jährlich, alles verwüstend, heim. In ungeordneten Haufen drangen sie vor, brannten Dörfer und Klöster nieder, raubten, vernichteten, töteten. An Gefangenen lag ihnen wenig. Da sie wegen ihrer unsteten Lebensweise für Sklaven kaum Verwendung hatten und zudem, wie man hörte, glaubten, dass jeder, der durch ihr Schwert starb, ihnen im Jenseits dienen müsse, wurden mitunter selbst Frauen und Kinder von ihnen abgeschlachtet.
Kam es zum Gefecht, bildeten sie zwei Abteilungen, die abwechselnd gegen das feindliche Zentrum anstürmten und es mit einem Hagel von Pfeilen überschütteten. Sowie sie merkten, dass die Reihen des Gegners ins Wanken gerieten, setzten sie, schrille Schreie ausstoßend, auf ihren kleinen, jedoch schnellen Pferden hinterher und machten alles nieder. Lange Belagerungen vermieden sie, hatten die im schlechtbefestigten Sachsen allerdings auch kaum nötig.
Die schwerfällige Landwehr, aber auch die berittenen Vasallenheere standen ihrer Taktik zumeist machtlos gegenüber. Nicht oder nur notdürftig gepanzert und an den Kampf Mann gegen Mann gewöhnt, hatten sie den Pfeilschwärmen nichts entgegenzusetzen, und selbst da, wo sie ihnen widerstanden, gelang es nicht, den flinken Feind zu stellen.
Was zu tun war, lag auf der Hand: Einmal benötigte man Burgen, welche die in der Herstellung von Belagerungsgerät unerfahrenen Reiterscharen nicht einnehmen und in denen die eigenen Bauern samt ihrem Vieh und sonstiger Habe Zuflucht finden konnten. Zum anderen musste eine Streitmacht her, die der Kampfesweise dieser Nomaden gewachsen war. Beides erforderte jedoch Zeit, viel mehr Zeit, als zwischen den Sommerfeldzügen der Ungarn blieb.
Da kam die göttliche Fügung zu Hilfe und ließ einen ihrer Anführer in sächsische Gefangenschaft geraten. Es musste einer von Rang gewesen sein, denn für seine Freilassung sowie die regelmäßige Entrichtung eines Tributes verpflichteten sich seine Leute zu einem neunjährigen Waffenstillstand, den sie bislang auch eingehalten hatten. Und Heinrich nutzte die Frist, ließ Burgen bauen und verfallene oder zerstörte Befestigungen erneuern; selbst Klöster mussten sich mit einer Mauer umgeben. Den Burgen wurde Land zugeteilt, das die Besatzungen zu bestellen hatten, so dass sie sich selbst verpflegen und vor allem Vorräte anhäufen konnten. Im Ernstfall würden sie nicht nur die Bauern der umliegenden Ortschaften aufnehmen und schützen können, sondern auch eine Bedrohung im Rücken der Eindringlinge darstellen.
Festungen, die im Inneren des gefährdeten Raumes lagen und von denen man daher erwarten durfte, dass sie nicht sogleich überrannt werden würden, war eine etwas andere Aufgabe zugedacht. Ihre Besatzungen wurden mit den kostspieligen, aber pfeilsicheren Kettenpanzern ausgerüstet und mehrmals im Jahr zu Kriegsspielen zusammengerufen, bei denen der Reiterkampf in geschlossener Formation geübt werden musste. Diese Männer sollten den Kern des Verteidigungsheeres bilden und gemeinsam mit der Landwehr den Gegenschlag führen.
Da alle unter den Ungarn zu leiden hatten, überraschte es nicht, dass die Vorbereitungen zu ihrer Abwehr auf keinerlei Widerstand trafen. Dennoch beeindruckte es Heinrich, mit welchem Eifer seine Anordnungen befolgt wurden. Ohne zu murren, kamen die sonst so widerspenstigen sächsischen Bauern mit ihren Gespannen zum Burgenbau, und der Adel machte kaum Ausflüchte, wenn es darum ging, Dienstleute für die Grenzfestungen und die Panzerreiterei abzustellen. Während einer Rundreise durch Nordthüringen kam dem König ein Gedanke, der an sich in der Luft lag, ihn, da er nur selten Muße zum Grübeln hatte, jedoch erst jetzt erreichte: dass nämlich die Ungarn nicht nur eine Bedrohung waren – halfen sie ihm doch, Ziele zu erreichen, deren direkte Verwirklichung sehr viel mehr Kraft und Kampf gekostet hätte. Es war schon merkwürdig: Die da so emsig gruben, Steine heranfuhren und zimmerten, arbeiteten nicht bloß an der Niederlage des äußeren Feindes, sondern auch an ihrer künftigen eigenen, schienen davon aber nichts zu ahnen. Die Herzöge wiederum mochten tun und lassen, was sie wollten, jeder Sieg über den Gegner würde den König stärken und ihre Macht schmälern.
Daher beschloss er, alles zu unterlassen, was nicht dazu diente, den Sieg über die Ungarn sicherzustellen, sich von der Woge dieses Himmelsgeschenkes solange tragen zu lassen, bis sie verebbte.
Bald stellte sich indes heraus, dass es offenbar unmöglich war, mehrere Jahre einen Krieg vorzubereiten, ohne die Männer, die ihn führen sollten, zwischendurch einen wirklichen Kampf erleben zu lassen. Ständig und ohne Not lediglich zu üben, was sie, wie sie meinten, sowieso konnten – sich zu schlagen –, das war zu ungewohnt für sie … Lächerlich, auf die Dauer aber einfach lästig war es, zertrümmerte Mühlsteine von einer Burg zielsicher herunterzuwerfen – dabei laufend die Position zu wechseln, um den Gegner über die Stärke der Besatzung zu täuschen – und sie anschließend wieder hinaufzutragen und zu stapeln; während plötzlicher Ausfälle Brücken zu bauen, die nachher wieder abgerissen werden mussten, weil sie im Ernstfall nicht den Ungarn zugute kommen sollten; sich beim Trab auf ein Kommando hin blitzschnell mit den Schilden zu decken, um einen Pfeilhagel (den Knechte mit Zapfen nachahmten) abzufangen, danach gegen ein Feld von Strohpuppen anzureiten und auf sie einzudreschen, dass die Halme flogen … Anfangs bogen sich die Leute noch vor Lachen, taten aber mit, doch es kam der Zeitpunkt, an dem auch die Gutwilligsten die Lust verloren. Ein Heer, das, gut ausgebildet und diszipliniert, auf Abruf bereitstand, stampfte man, das zeigte sich nun, nicht so leicht aus dem Boden.
In den Festungen wurden die Kriegsübungen vernachlässigt, wer vorher Bauer gewesen war, sank, ohne den Stachel wirklicher Gefahr, rasch wieder in seine alte Lebensweise zurück. Die ehemaligen Gefolgsleute jedoch, diese geborenen Raufbolde, wurden zu einer wahren Landplage. Als sie noch bei ihren früheren Herren herumgelungert hatten, wussten sie wenigstens, wozu sie lebten: Heute musste ein geflüchteter Knecht eingefangen werden, morgen galt es, einen störrischen Liten an seine Verpflichtungen zu erinnern und nach einem nächtlichen Gelage mit dem Nachbarn eine alte Rechnung zu begleichen: seine Heuschober und Bienenstöcke anzuzünden oder seinen Dienstleuten aufzulauern, sie auszupeitschen und mit geschorenen Köpfen nach Hause zu schicken. Für all das erhielt man nicht nur Essen und Kleidung, sondern dann und wann auch noch ein Geschenk.
Nun gab es keine Geschenke mehr, statt Beutemachen hieß es arbeiten, und wie zum Hohn sollte man sich den Rest der Zeit mit kindischen Spielen vertreiben. Das konnte nicht gutgehen – und es ging auch nicht gut.
Während der König noch mit der Erkenntnis rang, dass es sich als ein verhängnisvoller Fehler erweisen könnte, die kostbare Streitmacht weiterhin gleichsam aufsparen zu wollen, mehrten sich Meldungen über geplünderte Gehöfte, gestohlenes Vieh, vergewaltigte Frauen. Die Bauern setzten sich zur Wehr, und bald gab es auf beiden Seiten die ersten Toten.
Anfang des Jahres neunhundertachtundzwanzig stand für Heinrich fest, dass etwas geschehen musste. Doch die Ungarn schon jetzt herauszufordern, indem man ihnen im Herbst den fälligen Tribut verweigerte, das mochte er nicht riskieren. Noch fehlte es an Fluchtburgen, die Verluste an Menschen, Tieren und Vorräten würden daher hoch sein. Der Sieg aber musste eindeutig ausfallen, sonst waren womöglich alle Anstrengungen vergebens. Und so drängten ihn die Umstände allmählich dahin, einen Feldzug gegen jenes Gebiet zu erwägen, das, wie er wusste, die Gedanken seiner beutegierigen Krieger schon längst beschäftigte – das Slawenland im Osten.
Die Nachrichten von dort flossen etwas spärlicher, seitdem die Großen des ostfränkischen Reiches – vollauf davon in Anspruch genommen, ihre eigenen Angelegenheiten zu ordnen – die Überfälle auf ihre Nachbarn eingestellt hatten. Heinrich selbst hatte vor mehr als zwanzig Jahren, noch im Auftrag seines Vaters, die Daleminzer bekriegt und ihnen viel Schaden zugefügt – was diese übrigens veranlasste, die Ungarn zu Hilfe zu holen. Diese Hilfe war so nachhaltig gewesen, dass – da an ähnliche Unternehmungen vorerst nicht mehr gedacht werden konnte – das Interesse der Sachsen an den Verhältnissen in dieser Gegend für lange Zeit erlosch.
Natürlich trieb man, wie eh und je, wenn nicht gerade Krieg war, Handel miteinander. Und natürlich wusste man, dass rechts der Elbe sesshafte Menschen lebten, die den Boden bebauten und Vieh züchteten: Im Norden die Obodriten und Wilzen, im Süden die Lusizer, Milzener, Daleminzer und die vielen sorbischen Stämme; zwischen ihnen die Heveller, deren Fürst über die meisten Stämme von der mittleren Elbe bis zur Oder herrschte. Von Alters her war das Land mit Burgen gespickt, großen und kleinen, denn nach ihrer Einwanderung hatten diese Völker lange miteinander gekämpft, ehe dann jedes seinen Platz fand. Kaiser Karl und auch noch seine Nachfolger hatten ihre Streitigkeiten geschickt ausgenützt und waren Bündnisse mal mit diesen, mal mit jenen eingegangen, ja, sie hatten es sogar verstanden, sich als Richter über ihre inneren Angelegenheiten aufzuspielen.
Doch das war lange her, und für Heinrich ergab sich daher die Frage, wie es heute um die Abwehrkraft der Slawen bestellt war. Um sie zutreffend beurteilen zu können, genügten die Auskünfte kleiner Händler und Bauern selbstverständlich nicht. Hierzu bedurfte es Menschen, die sich nicht nur für Preise interessierten, sondern für alles, was mit ihnen, wenn auch nur mittelbar, zusammenhing, Menschen, die ihm beispielsweise folgendes beantworten konnten: Warum hörte man in letzter Zeit so wenig von den Wilzen? Was war aus ihrer alten Feindschaft zu den Obodriten geworden? Wie eng waren die Verbindungen zwischen den Hevellern und den Böhmen? – Doch an solchen Leuten fehlte es eben.
Trotzdem war er zuversichtlich. Denn so dürftig und widerspruchsvoll die Meldungen waren, in einem Punkt ähnelten sie sich, und der ließ hoffen, dass diese Völker kaum wesentlich stärker geworden sein konnten.
Noch immer durfte man wohl davon ausgehen, dass die Großen selbst eines Stammes untereinander uneins waren, die Bauern wiederum eine geringe Bereitschaft zeigten, sich unterzuordnen. Grob gesprochen neigten diese dazu, ihren Adel eher zu benutzen, als ihm zu dienen; schon früher hörte man ja von abgesetzten, sogar ermordeten Fürsten. Lange Kriege schienen ihnen auch nicht zu liegen. Neben kleinen Gefolgschaften zu Pferd hatte man es stets mit unberittenen Bauernaufgeboten zu tun gehabt, die tapfer ihre Heimat verteidigten, doch in ihrem Eifer nachließen, sowie sie sich von ihr entfernten. Bei den Daleminzern hatte es Heinrich mehr als einmal erlebt, dass die Bauern vor Beginn der Schlacht ihre Anführer zwangen, vom Pferd zu steigen, damit diese im Falle einer Niederlage nicht fliehen konnten. Das waren Sitten, die man hierzulande glücklicherweise längst überwunden hatte.
Freilich gab es Unterschiede, und über die war leider viel zu wenig bekannt. Während die Wilzen und Sorben nun schon seit längerem ohne einen König lebten, duldeten Obodriten und Heveller immerhin jeweils einen Herrscher über sich. Was man von arabischen Sklavenhändlern, die sich, aus Spanien kommend, weit in den Osten vorwagten, in Erfahrung gebracht hatte, besagte dennoch, dass auch diese Stämme kaum imstande waren, eine bedeutende Zahl ausgebildeter Krieger auf die Beine zu stellen. Und eben darin bestand, falls das zutraf, ihre entscheidende Schwäche. Solange der Adel um die Vorherrschaft stritt und die Bauern sich nicht ins Joch fügten, konnten größere Gefolgschaften nicht entstehen. Daher dominierte bei ihnen der unberittene Bauernkrieger, der, wie aufopferungsvoll er sich auch schlug, für schnelle taktische Manöver doch ungeeignet und gepanzerten Reitern – jedenfalls im offenen Feld – allemal unterlegen war.
Nachdem Heinrich die Stärke des künftigen Gegners taxiert hatte, musste er entscheiden, wen er zuerst angreifen wollte. Am Anfang dieses Krieges – dessen weiteren Verlauf schon jetzt festzulegen, hütete er sich – sollte unbedingt ein gleichermaßen eindrucksvoller wie mit geringen Verlusten erzielter Sieg stehen. Deshalb musste es vermieden werden, das Heer in einer Vielzahl von Einzelgefechten zu verschleißen: statt eines langen Feldzuges mit ständigen Geplänkeln möglichst eine einzige große Schlacht, in der die Schlagkraft der Panzerreiterei voll zur Wirkung käme. Es empfahl sich dafür aber nur ein Gegner, bei dem einigermaßen geordnete Machtverhältnisse herrschten und der daher imstande war, den Hauptteil seiner Streitkräfte vergleichsweise rasch zu sammeln. Außerdem – zwar waren seine Leute auf Beute aus, und die sollten sie auch bekommen; zuviel davon, das war eine alte Erfahrung, würde jedoch nicht nur die Beweglichkeit des Heeres herabsetzen, sondern auch seine Kampfeslust dämpfen. Tributzahlungen, über die er zunächst allein verfügte und für deren Eintreibung und regelmäßige Entrichtung ein Herrscher verantwortlich gemacht werden konnte, waren da wesentlich vorteilhafter.
Aus beiden Gründen aber schieden Wilzen und Sorben erst einmal aus, denn hier würde man die Teilstämme nacheinander in die Knie zwingen und mit ihren Oberen jeweils einzeln verhandeln müssen. Die Lusizer und Milzener wiederum waren zu bedeutungslos, als dass er mit ihnen beginnen mochte.
Blieben Obodriten und Heveller. Die Obodriten kannte man besser, denn kein großer Strom trennte sie von den Sachsen. Trotzdem entschied sich Heinrich für die merkwürdig stillen Heveller, und das nicht nur, weil ihn ihre Friedfertigkeit neugierig machte. Zum einen lockte ihn die berühmte Brandenburg, Sitz des Fürsten und ein Ort, von dem auf dem Wasserweg noch andere Gebiete des Slawenlandes erreichbar waren, etwas, das bei späteren Unternehmungen einmal bedeutungsvoll werden konnte. Eine Eroberung dieser als schwer einnehmbar geltenden Festung würde auch auf die Nachbarstämme ihren Eindruck gewiss nicht verfehlen. Zum anderen würde sich der hevellische Herrscher – weil hinter Seen, Flüssen und Sümpfen verschanzt – bestimmt sicher fühlen und auf eine lange Belagerung vielleicht gar nicht vorbereitet sein.
Schließlich musste man auch einen Fehlschlag in Erwägung ziehen; dann würden die Heveller, falls sie überhaupt zu einem Gegenangriff fähig waren, nicht nur auf den mittlerweile schon recht beachtlichen Gürtel sächsischer Burgen links der Elbe stoßen, sondern zuvor auch noch den Fluss zu überqueren haben.
Von der Brandenburg war bekannt, dass sie auf einer Insel lag. Um sie mit einem lückenlosen Belagerungsring umgeben zu können, musste das sie schützende Gewässer so vereist sein, dass es das Heer auch trug. Nur – wann würde das sein?
Die Schwierigkeit, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, hatte dem König nicht geringe Sorgen bereitet. Zog er zu früh los, würde es unmöglich sein, die Festung abzuriegeln, und der Feldzug würde sich in die Länge ziehen, mit allen Unwägbarkeiten, die sich hieraus ergaben. Brach man erst auf, wenn Schnee und Frost herrschten, würden die Leute unnütz zu leiden haben. In Magdeburg wochenlang auf günstiges Wetter zu warten, kam ohnehin nicht in Betracht, weil dies die Vorräte aufbrauchen würde. Es blieb daher nichts übrig, als denen zu vertrauen, die einen zeitigen und strengen Winter vorausgesagt hatten.
Gegenwärtig sah es allerdings nicht danach aus. Nachdem es zwei Tage geregnet hatte, schien eine gelbe Herbstsonne, die den Boden so erwärmte, dass es wie im März nach Erde roch. Es war windstill, und an manchen Sträuchern konnte man sogar winzige Knospen sehen. Statt in großen Schwärmen die Nähe von Siedlungen zu suchen, liefen die Krähen eifrig pickend auf den Wiesen umher. Dicke Fliegen hockten auf Holzstößen und Abfallhaufen, und durch den Burghof spazierte wie zum Hohn ein Star, der es offenbar nicht für nötig gehalten hatte, fortzuziehen.
„Der schwarze Bursche ist mir ein richtiger Greuel“, sagte Graf Siegfried und warf einen Stein nach ihm. „Beim nächsten Mal erwische ich ihn bestimmt.“
„Mir wäre es lieber, der Frost würde ihn vorher erledigen“, antwortete Heinrich.
Wie an jedem Vormittag ritten beide vom Kastell hinunter ins Lager. Zwar hätte man die kurze Strecke auch zu Fuß gehen können. Doch das Volksrecht gestand einem Mann nur so lange zu, im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein, wie er noch – bewaffnet, mit einem Schild und ohne Hilfe (lediglich Pferd und Steigbügel durften ihm gehalten werden) – von einer höchstens daumenlangen Erhöhung auf sein Ross kam. Freilich hatte es über den König keine Macht, trotzdem nahm er gern jede Gelegenheit wahr, es in der Öffentlichkeit durch Gesten zu ehren, die ihn nichts kosteten.
„Dort sind sie“, sagte Siegfried, als sie den äußeren Graben passierten. Er wies auf die Westseite des Lagers. Am Vorabend waren die letzten Vasallen mit ihren Dienstleuten eingetroffen, alle aus dem Ostfalengau. Ziemlich spät, doch wie die Dinge nun lagen, noch immer zeitig genug. Die Anführer hatten sich mit diesem und jenem entschuldigt, wie allerdings zu hören war, sollten zwei Männer verletzt sein. Das ließ ahnen, weshalb sie erst jetzt kamen. Die Aufgebote waren angewiesen worden, „mit gutem Frieden“ zu ziehen und innerhalb des Reiches nur Wasser und Holz in Anspruch zu nehmen; von vorher genau bezeichneten Gütern durften sie auch Futter verlangen. Da ein großes Heer – selbst wenn sich der König in seiner Mitte befand – kaum zu kontrollieren war und zu Übermut neigte, hatte Heinrich den Sammelort bis an die Grenze verlegt. Er wollte keinesfalls von den eigenen Bauern mit Übergriffen in Verbindung gebracht werden und hatte überdies gehofft, dass kleine Trupps die Risiken von Plünderungen scheuen würden, zumal dann, wenn ihnen ja ein Beutezug bevorstand. Nun hatte es, wie man wohl befürchten musste, doch Zwischenfälle gegeben.
Die Neuankömmlinge hatten im Freien geschlafen, jetzt errichteten sie Zelte, zogen Gräben, entluden die Wagen. Zwischen ihnen liefen Ferkel herum, Schafe, Ziegen, Enten.
„So eine Unverschämtheit“, sagte Siegfried, „sie schleppen das Viehzeug auch noch lebend mit … Heimo! Gibst du uns die Ehre?“
Ein untersetzter Rotbart, der mit dem Stiel seiner Axt gerade einem Knecht in den Rücken gestoßen hatte, drehte sich um und kam gemächlich auf sie zu.
„Sei Gott willkommen und mir, Herr König“, sagte er selbstbewusst, in der Art eines Hausherrn, die er vermutlich auch im Wald nicht ablegte. „Und du natürlich auch, Graf Siegfried“, fügte er nachlässig hinzu.
Siegfried blinzelte. „Wo habt ihr die Tiere her?“
Heimo schien den Grafen nicht zu beachten. Er heftete seine wässrigblauen Augen auf den König und wartete so lange, bis der eine Kopfbewegung machte, die bedeutete, dass diese Frage seine Zustimmung fand. Sogleich gab Heimo Auskunft: „Geborgt.“
„Was heißt geborgt?“
Wieder würdigte ihn der Mann keines Blickes, er sah nur den König an, antwortete diesmal aber schneller: „Wir haben uns gesagt: Was man hat, das hat man. Wer weiß, was die Slawen für Leute sind. Es ist bald Winter, und sie werden bestimmt nicht wild darauf sein, mit uns zu teilen. Da haben wir uns eben unterwegs vorsichtshalber von Bauern diese Tiere geborgt. Wenn wir mit Beute heimkehren, kriegen sie alles zurück.“
„Wenn du glaubtest, dass drüben nichts zu holen ist, wie konntest du da den Besitzern versprechen, dass sie ihr Eigentum zurückerhalten?“, erkundigte sich der König.
Gut gegeben, dachte Siegfried, doch Heimo verlor nicht die Fassung: Falls man, was Gott verhüte, mit leeren Händen wiederkäme, würde er selbstverständlich in die eigene Tasche greifen. „Du warst leider noch nie mein Gast, Herr König, deshalb kannst du es nicht wissen: Was hier so herumspringt, wird bei mir in einer Woche von Raubzeug weggeschleppt, ohne dass ich es auch nur merke.“
„Das freut mich für dich“, sagte Heinrich trocken. „Und warum hast du dann nicht mehr von zu Hause mitgenommen? Da du doch so große Angst hast zu verhungern …“
Heimo nickte ein paarmal ernst. „Du hast recht, das war ein Fehler. Doch bedenke den weiten Weg. Außerdem hatten wir es ja eilig. Je mehr man mitnimmt, desto schwieriger wird es, vorauszusehen, wann man ankommt. Trotzdem, es war ein Fehler.“
Das war eine hübsche Frechheit. Ohne es direkt zu sagen, schob er einen Teil der Verantwortung denen zu, die ihn zur Eile genötigt hatten. Der Graf wollte hier einhaken, aber der König sprach weiter: „Waren die Bauern einverstanden?“
„Erst nicht, dann ja.“
„Wie habt ihr sie denn überzeugt?“
Der Mann überlegte kurz. „Genauso, wie jetzt euch. Nur dass es bei ihnen natürlich ein bisschen länger gedauert hat.“
Siegfried blickte zum König, entdeckte aber zu seiner Überraschung in dessen Gesicht keinerlei Anzeichen von Zorn, allenfalls den Ausdruck einer gewissen Spannung, die er aber nicht deuten konnte. Er deutete sie schließlich auf seine Weise und fragte scharf: „Es heißt, ihr hättet zwei Verletzte. Entspricht dies der Wahrheit?“
„Nicht ganz. Es ist nur noch einer. Der andere starb in der Nacht.“
„Und durch wen kamen sie zu Schaden?“
„Durch Räuber natürlich.“
Heimo hob die Schultern, doch nur leicht, so, als habe er Mühe, seine Verwunderung zu bezähmen. Er sah vom König zum Grafen und wieder zum König: Wollt ihr noch mehr wissen? Ich antworte selbstverständlich, aber ein bisschen seltsam sind sie schon, eure Fragen.
Man müsste ihm drohen, seine Leute einzeln zu vernehmen, dachte Siegfried; er legte sich die Worte zurecht, da hörte er den König sagen: „Nun gut. Auch wenn es sich so verhält, wie du behauptest, so hast du doch gegen meine Anordnung verstoßen. Bist du dir dessen bewusst?“
„Ich bin es, Herr König. Und es betrübt mich mehr, als ich es auszudrücken vermag.“
„Spare dir deine Beteuerungen! Du wirst deinen Gläubigern alles zurückerstatten. Gnade dir Gott, wenn mir Klagen über dich zu Ohren kommen. Und jetzt entferne dich.“
Heimo verbeugte sich schweigend und ging – ebenso langsam, wie er gekommen war.
Graf Siegfried schaute ihm hinterher. Dann senkte er die Augen.
„Weshalb lassen wir uns das gefallen?“, murmelte er erbittert. „Ich hätte ihm den Schädel spalten sollen.“
Heinrich lächelte ihm beschwichtigend zu. „So nimm dich doch zusammen, man beobachtet uns! Weshalb erregst du dich eigentlich? Weil er geraubt hat? Das wäre töricht. In den nächsten Wochen sind wir ebenfalls Räuber, und zwar hoffentlich nicht weniger erfolgreiche als dieser Heimo und seine Leute. Er ist mutig, kaltblütig, geschickt; auf wen sollte ich mich stützen, wenn nicht auf Männer wie ihn? Die Starken sind nun einmal zumeist eigennützig und schwer zu lenken, den Selbstlosen hingegen gebricht es zumeist an Stärke. Wir aber brauchen jetzt die Starken.“
„Ich danke dir für die Belehrung“, sagte Siegfried trocken. Er war vom Pferd gestiegen und hielt das des Königs am Zügel. „Und wozu zählst du mich?“, fügte er hinzu.
„Dich? Lass mich nachdenken … Nun, du bist zweifellos eine Ausnahme. Leider kriegt man mit Ausnahmen kein Heer zusammen.“
„Dann soll dieser dreiste Schuft also ungeschoren davonkommen?“
Siegfried spie auf die Erde.
„Dass es dich nicht eines Tages gereut! Bestrafe ihn doch, wenn wir zurück sind.“
„Das werde ich nicht“, sagte Heinrich beim Absitzen. „Vielleicht fällt er, dann mag der Teufel über ihn richten. Fällt er nicht, werde ich ihn beschenken, sofern er sich gut schlägt. Und verlass dich drauf, er wird sich gut schlagen.“
Sie machten sich daran, die Ausrüstung der Ostfalen zu überprüfen. Bei Heimos Leuten gab es nichts zu bemängeln; lediglich das Flechtwerk einiger Schilde war zerfetzt, was indes nicht überraschte. Anders sah es bei dem zweiten Aufgebot aus. Schon am ersten Wagen fehlte die Lederbespannung, in der des folgenden klafften Risse. Siegfried winkte den Anführer heran. „Bist du blind? Bringe das sofort in Ordnung!“
„Wir haben keine Häute mit.“
„So zieh dir deine eigene ab … Halt, ich bin noch lange nicht fertig! In jedem Wagen sollten Beile, Hobel, Bohrer, Spaten und Schaufeln mitgeführt werden. Bei euch sieht man nichts davon. Kannst du mir erklären, warum?“
„Also ist es wahr? Und ich meinte schon, der Bote hätte sich geirrt“, sagte der Mann, einfältig lächelnd. „Schließlich war die Rede von einem Krieg. Und wenn es da ans Bohren geht, verlasse ich mich doch lieber auf mein Schwert als auf irgendwelches Werkzeug.“ Er blickte Beifall heischend zum König, und als der nicht reagierte, fügte er hinzu: „Dass wir die Slawen mit Hobeln besiegen können, wollte mir gleich gar nicht in den Kopf.“
„Lass die Albernheiten. Ich will dir sagen, weshalb ihr diese Dinge nicht mitgenommen habt: Weil ihr den Hals nicht voll genug bekommen könnt und jedes Fleckchen mit Beute vollstopfen wollt. Übrigens – als euch der Bote sagte, dass zur Ausrüstung auch Pfeil und Bogen gehörte, glaubtest du da ebenfalls, er habe sich geirrt?“
„Das sind doch Waffen für Kinder“, maulte der andere. „Von uns will niemand damit kämpfen.“
„Das hast du verdammter Hund nicht zu entscheiden“, schrie Siegfried.
Der Mann erbleichte und trat einen Schritt zurück. „Ein Hund, Graf Siegfried, bin ich nicht. Und wenn du mich noch ein einziges –“
„Nimm sofort die Hand vom Messer, oder ich haue dich zusammen“, rief Heinrich schneidend. „Nein, ein Hund bist du nicht. Du bist ein Mann, der seine Pflichten vernachlässigt hat, und das ist viel schlimmer. Außerdem ein Dummkopf, der törichte Späße mit Witz verwechselt. Drückt dich dein Lehen? Dann sag es, dir kann geholfen werden.“
Der Auftritt schien sich herumgesprochen zu haben. Als sie bei dem dritten Aufgebot eintrafen, waren die Leute ausschließlich damit beschäftigt, schadhaftes Gerät instand zu setzen. Auf Steinen wurden verbogene Speerspitzen geradegehämmert, an einem Schleifstein schartige Klingen und Schneiden geschärft. Knechte zogen neue Sehnen in die Bogen, trieben Keile in die Äxte; neben einem Zelt saß ein Junge, der einen Haufen Kittel und Wämser vor sich liegen hatte, auf die er Lederstreifen oder Metallstücken nähte. Kaum waren der König und der Graf herangeritten, lief ihnen schon ein Mann entgegen, nahm seinen Strohhut ab und verbeugte sich.
„Der Anblick so vieler fleißiger Leute ist dem Auge natürlich ein Labsal, lieber Wolfram“, sagte Heinrich nach der Begrüßung. „Dennoch verrate mir, warum ihr das nicht schon zu Hause erledigt habt.“
Wolfram leckte sich die Lippen, verbeugte sich abermals und erklärte dann, dass es kurz vor ihrem Aufbruch einen Brand gegeben hätte, der auch die Waffenkammer nicht verschont habe. Weil er nicht in Verzug geraten wollte, habe er sich entschieden, auf die Ausrüstung seiner Liten zurückzugreifen, die sich jedoch leider in einem jammervollen Zustand befunden hätte. Die Mängel würden selbstverständlich beseitigt; wie zu sehen sei, führe man alles dazu Erforderliche mit.
„Wer von deinen Leuten ist denn so stark, dass er damit umgehen kann?“, fragte Heinrich unvermittelt und wies auf einen riesigen Zweihänder, der an einem Wagen lehnte. Er schillerte bunt im Sonnenlicht, hatte also auch im Feuer gelegen.
„Niemand, um die Wahrheit zu sagen“, erwiderte Wolfram. „Dein Vater, der selige Herzog Otto, schenkte ihn vor vielen Jahren meinem Vater für treue Dienste. Leider bin ich nicht so kräftig, dass ich ihn bedienen könnte. Doch ich hoffe, dass er mir Glück bringt. Es ist ja das erste Mal, dass ich mit dir in den Krieg ziehe … Erlaube mir nun, dass ich meine Männer antreten lasse, damit du dich davon überzeugen kannst, dass unsere Ausrüstung deinen Anweisungen entspricht, auch wenn sie, du kennst ja nun den Grund, nicht durchweg aus den besten Stücken besteht.“
„Lass gut sein, mein Freund“, sagte Heinrich. „Ich weiß, dass du ein ehrlicher Mann bist. Außerdem haben der Graf und ich heut noch viel zu tun. Lebe wohl.“
„Was haben wir denn noch zu tun?“, erkundigte sich Siegfried, als sie außer Hörweite waren.
„Wir besuchen die Panzerreiter.“
„Schon wieder? Aber wir waren doch erst gestern bei ihnen. Und da hattest du nichts zu beanstanden.“
„Gerade deshalb“, entgegnete der König. „Mich verlangt es jetzt nach Leuten, bei denen ich sicher sein darf, dass es an ihnen nichts zu beanstanden gibt.“
Eine Woche später geschah es, dass Graf Siegfried mitten in der Nacht erwachte. Er hatte am Vorabend getrunken, weswegen es eine Weile dauerte, bis ihm bewusst wurde, dass er bereits geraume Zeit mit offenen Augen lag und entsetzlich fror. Als er feststellte, dass sein Bart und der obere Rand der Decke mit Reif überzogen waren, sprang er auf und eilte in die Kammer des Königs.
Dieser stand mit seinem Sohn am geöffneten Fenster. In Wolfspelze gehüllt, schauten beide auf die im Mondlicht schimmernde Landschaft.
„Das ist schön, dass du kommst“, sagte der junge Otto in seiner herzlichen Art. „Ich wollte dich soeben holen. Ich wachte zähneklappernd auf, und da wusste ich gleich, was passiert ist.“
Siegfried lachte. „Ich wusste es erst, als ich mir ans Kinn fasste und einen Eiszapfen spürte. Dann aber hätte ich am liebsten sofort Alarm geblasen.“
„Freut euch nicht zu früh“, knurrte Heinrich. „So ein Herbstfrost muss noch nichts zu bedeuten haben.“
„Heißt das, du willst noch warten?“
Der König schmunzelte. „Das heißt es keineswegs. Aber ich kann doch meinem Vasallen nicht so ohne weiteres beipflichten. Was immer du sagst, von mir bekommst du erst einmal das Gegenteil zu hören. So bleibst du auch künftig ein bescheidener Mann.“
Die drei lachten.
„Deinen Star, Siegfried, hat übrigens ein Sperber gefressen“, sagte Otto. „Im Hof liegen die Federn.“ Bedauernd fügte er hinzu: „Ich hatte dem armen Burschen so gewünscht, dass er den Winter übersteht.“
„Armer Bursche, ach was!“, bemerkte sein Vater. „Er hat seinen Irrtum nicht mehr erlebt. Ein beneidenswerter Tod.“





























